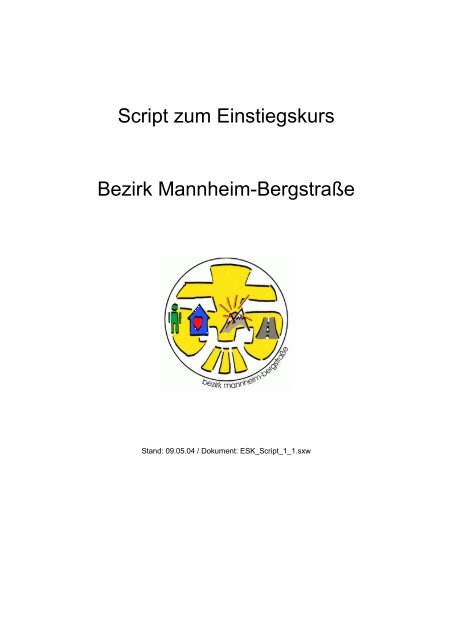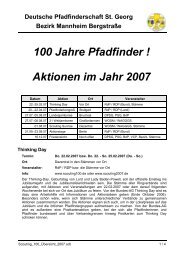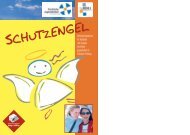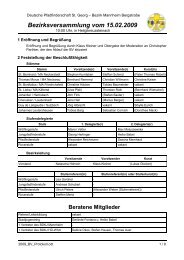ESK Script
ESK Script
ESK Script
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Script</strong> zum Einstiegskurs<br />
Bezirk Mannheim-Bergstraße<br />
Stand: 09.05.04 / Dokument: <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw
Inhalt<br />
1 Einleitung............................................................................................................................................. 4<br />
2 Grundsätzliches....................................................................................................................................4<br />
2.1 Stellenbeschreibung für einen Gruppenleiter............................................................................4<br />
2.2 Pfadfinder als Erziehungsverband............................................................................................. 5<br />
3 Streife....................................................................................................................................................6<br />
3.1 Die Streife selbst........................................................................................................................... 6<br />
3.2 Animation und Ideenfindung ..................................................................................................... 8<br />
3.3 Entscheidung.................................................................................................................................9<br />
3.4 Mitbestimmung...........................................................................................................................11<br />
3.5 Vorbereitung der eigentlichen Streife...................................................................................... 12<br />
3.6 Durchführung ............................................................................................................................ 12<br />
3.7 Auswertung und Dokumentation..............................................................................................13<br />
3.8 Reflexion...................................................................................................................................... 13<br />
3.9 Fest............................................................................................................................................... 15<br />
4 Pfadfinderische Stilelemente und Prinzipien..................................................................................15<br />
4.1 Stufenwechsel .............................................................................................................................15<br />
4.2 Groß-Kleingruppe...................................................................................................................... 17<br />
4.3 Fachleuteprinzip......................................................................................................................... 18<br />
4.4 Trupprat...................................................................................................................................... 18<br />
4.5 Look at the boy/girl.................................................................................................................... 19<br />
4.6 Versprechen................................................................................................................................ 19<br />
5 Religiöse Themen...............................................................................................................................20<br />
5.1 Religiöse Elemente......................................................................................................................20<br />
5.2 Kinder- und jugendgerechte Gestaltung der religiösen Elemente........................................ 21<br />
5.3 Leben aus dem Glauben begründen......................................................................................... 21<br />
6 Strukturen der DPSG........................................................................................................................21<br />
6.1 Die (Alters-) Stufen.....................................................................................................................22<br />
6.2 Die Ebenen...................................................................................................................................22<br />
6.3 Der Stamm...................................................................................................................................22<br />
6.4 Der Bezirk, der Diözesanverband und der Bundesverband...................................................23<br />
7 Geld und Zuschüsse...........................................................................................................................26<br />
8 Pfadfindergeschichte......................................................................................................................... 26<br />
8.1 Übersicht......................................................................................................................................26<br />
8.2 Das Leben Baden-Powells .........................................................................................................28<br />
8.3 Geschichte der Pfadfinderbewegung........................................................................................29<br />
8.3.1 Die Pfadfinderbewegung in Deutschland..............................................................................31<br />
9 Öffentlichkeitsarbeit......................................................................................................................... 33<br />
10 Elternarbeit...................................................................................................................................... 33<br />
11 Anhang..............................................................................................................................................35<br />
11.1 Animationsmethoden............................................................................................................... 35<br />
11.1.1 Bücherausstellung................................................................................................................35<br />
11.2 Reflexionsmethoden................................................................................................................. 35<br />
11.2.1 Wettervorhersage.................................................................................................................35<br />
11.2.2 Thermometer....................................................................................................................... 35<br />
11.2.3 Blitzlicht.............................................................................................................................. 35<br />
11.2.4 Plakate auslegen.................................................................................................................. 35<br />
11.2.5 Ampelreflexion....................................................................................................................36<br />
11.2.6 Highlights und Stolpersteine............................................................................................... 36<br />
11.2.7 Satz vervollständigen...........................................................................................................36<br />
11.2.8 Nah oder Fern...................................................................................................................... 36<br />
11.2.9 Gefühlsdiagramm................................................................................................................ 37<br />
11.2.10 Kerzenreflexion................................................................................................................. 37<br />
11.2.11 Schatzkiste und Mülleimer................................................................................................ 37
11.3 Entscheidungsmethoden.......................................................................................................... 38<br />
11.3.1 Wasserbecher.......................................................................................................................38<br />
11.3.2 Murmeln verteilen............................................................................................................... 38<br />
11.4 St. Georg.................................................................................................................................... 38<br />
11.5 Gottesdienstablauf....................................................................................................................39<br />
11.6 Übersicht der Weltjamborees..................................................................................................39<br />
11.7 Abschiedsbrief von Baden-Powell...........................................................................................40
Einleitung <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
1 Einleitung<br />
Dieses <strong>Script</strong> ist als Begleitmaterial für den Einstiegskurs des Bezirks Mannheim Bergstraße entstanden.<br />
Der Kurs orientiert sich an dem Handlungsstrang der Streife und so ist auch das <strong>Script</strong> an der<br />
Streife orientiert. Die Projektmethode wird bewusst nicht behandelt, da sie dem Woodbadgekurs Teil<br />
1 vorbehalten ist, viele ihrer Schritte kommen jedoch auch bei der Streife vor.<br />
Auf dem Einstiegskurs führen die Teilnehmer selbst eine Streife durch – ähnlich wie das die Mitglieder<br />
ihrer Gruppe machen würden. Das ermöglicht „Learning by doing“ im Gegensatz zu einem Kurs,<br />
der eher dem Frontalunterricht in der Schule gleicht. Wenn immer es geht, werden die theoretischen<br />
Hintergründe einzelner Schritte, wie z.B. Animation, Entscheidung oder Reflexion, begleitend zu der<br />
praktischen Durchführung – dem Erleben - behandelt. So können die persönlichen Erfahrungen als<br />
Grundlage für die weiterführenden, vertiefenden Informationen dienen.<br />
Themen die nicht am Handlungsstrang der Streife Orientiert sind, werden im Rahmen von Abendveranstaltungen,<br />
die über das Jahr verstreut sind, behandelt, um den Zeitrahmen des Kurses nicht zu<br />
sprengen.<br />
Dieses <strong>Script</strong> dient als Begleitmaterial auf dem Kurs, zum Nachlesen einzelner Themen und als Ideensammlung<br />
mit konkreten Methoden zum Nachschlagen bei der Vorbereitung entsprechender Gruppenstunden.<br />
Viele der im Folgenden beschriebenen Methoden können auch unabhängig von einer Streife<br />
eingesetzt werden (z.B.: Entscheidung).<br />
2 Grundsätzliches<br />
2.1 Stellenbeschreibung für einen Gruppenleiter<br />
Ein Gruppenleiter ist vor allem in der Gruppe aktiv die er leitet – das ist offensichtlich. Aber darüber<br />
hinaus gehören noch weitere Aufgabenfelder dazu, die letztlich seiner Tätigkeit in der Gruppe dienen.<br />
Neben der Durchführung der Gruppenstunden ist die Vorbereitung der Gruppenstunden sehr wichtig,<br />
denn nur durch eine gründliche Vorbereitung verbunden mit einer Planung die über die nächsten paar<br />
Gruppenstunden hinaus reicht ist es Möglich das Programm auf die Bedürfnisse der Gruppe und entsprechend<br />
den Erziehungszielen der DPSG auszurichten.<br />
Im Stamm nimmt ein Gruppenleiter an der Leiterrunde teil, in der die Aktionen und aktuellen Themen<br />
des Stamms besprochen werden<br />
Auf Bezirksebene finden regelmäßig, meist etwa alle 2 Monate, Treffen aller Leiter einer Altersstufe<br />
statt, auf denen gemeinsame Aktionen geplant werden (z.B. Stufentage, gemeinsame Zeltlager oder<br />
Religiöse Wochenenden). Darüber hinaus gibt es auch Aktionen die vom Bezirk stufenübergreifend<br />
angeboten werden und sich teilweise nur an Leiter (z.B.: Bezirkswochenende CU) oder auch an die<br />
Kinder und Jugendlichen wenden (z.B.: Fun Tag, Friedenslicht, Weltkindertag oder Bezirkslager).<br />
Auch auf Diözesanveranstaltungen sind Gruppenleiter gern gesehen. Es finden Wochenenden und<br />
Konferenzen für die Leiter einer Altersstufe und übergreifende Veranstaltungen (z.B.: Event oder Diözesanlager)<br />
statt.<br />
Die Ausbildung eines Gruppenleiters endet eigentlich nie. Sie beginnt bei uns in der Diözese Freiburg<br />
mit dem Einstiegskurs auf Bezirksebene, daran schlisst sich der Woodbadgekurs Teil 1 auf Diözesanebene<br />
an und nach dem Woodbadgekurs Teil 2 auf Bundesebene kann das Woodbadge als äußeres<br />
Zeichen der Ausbildung zum Gruppenleiter verliehen werden. Da ein Pfadfinder jedoch nie auslernt<br />
schliessen sich daran diverse Kurse je nach Angebot und Interesse des Leiters an.<br />
Hier eine Übersicht mit dem Versuch den zeitlichen Aufwand abzuschätzen<br />
Termine im Stamm<br />
4 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Grundsätzliches<br />
Gruppenstunde: wöchentlich 1,5 - 2 Stunden<br />
Trupprat: bei Bedarf ca. 1 Stunde<br />
Vor- und Nachbereitung der Gruppenstunden,<br />
alleine und im Team:<br />
wöchentlich bis zu 2 Stunden<br />
Leiterrunden:<br />
unregelmäßige Veranstaltungen<br />
meist monatlich ein Abend<br />
Elternabende ca. zweimal im Jahr ca. 2-3 Stunden<br />
Sommerunternehmen: einmal im Jahr 1-3 Wochen + Vorbereitungszeit<br />
Pfingst- und / oder Herbstlager: je ein evtl. verlängertes Wochenende + Vorbereitungszeit<br />
Wochenendunternehmungen mit der Gruppe: bis zu ca. 2-3 mal im Jahr<br />
Elternabend/Lagerabend des Stammes: einmal im Jahr einen Abend + Vorbereitungszeit<br />
Aktionen des Stammes (Kerwe, Schaulager, ...) je nach Aktion<br />
Leiterwochenenden im Stamm: meist ein Wochenende im Jahr<br />
Stammesversammlung: ein Abend im Jahr<br />
Bezirkstermine<br />
Stufenstammtische: 5-6 mal im Jahr<br />
Bezirksunternehmen: 2-3 mal im Jahr<br />
Diözesantermine<br />
Diözesanveranstaltungen: 1-2 mal im Jahr (teilweise stufenspeziefisch)<br />
Ausbildung und Kurse<br />
Einstiegskurs einmalig 5 Tage<br />
Leiterstammtische ca 4 Abende im Jahr<br />
Woodbadgekurs I einmalig 1 Woche + ein Nachbereitungs WE<br />
Woodbadgekurs II einmalig 1 Woche + ein Nachbereitungs WE<br />
2.2 Pfadfinder als Erziehungsverband<br />
Im Gegensatz zu manch anderer Jugendbewegung will die Pfadfinderbewegung Kinder und Jugendliche<br />
erziehen um sie auf ihr späteres Leben vorzubereiten. Wo z.B. die Wandervögel auf das Prinzip<br />
„Jugend führt Jugend“ setzen und Gruppenführer nur wenig älter als die Gruppenmitglieder sein<br />
sollen, setzt die Pfadfinderbewegung schon immer auf erwachsene Gruppenleiter, die deutlich älter<br />
sind als die Gruppenmitglieder und sich ihrer Erziehungsaufgabe bewusst sind.<br />
Pfadfinderleiter haben eine Vision und setzen Ziele<br />
Pfadfinderleiter haben eine Vision – ein Idealbild der Gruppe, wie sie sich das Zusammenleben und<br />
den Umgang miteinander in der Pfadfindergruppe, sowie das Verhalten und den Wissensstand des<br />
Einzelnen vorstellen. Gleichzeitig haben sie einen besonderen Blick für ihre Gruppe und erkennen die<br />
Stärken und Schwächen der Einzelnen und der Gruppe als Ganzes. Aus dem Vergleich des Idealbildes<br />
mit dem tatsächlichen Zustand der Gruppe entwickeln sie Ziele (und Zwischenziele), die im Gegensatz<br />
zu dem wahrscheinlich utopischen Idealbild auch realistisch erreicht werden können.<br />
Um den Zielen näher zu kommen nutzen sie vielfältige Methoden, von Spielen über Handlungsstränge<br />
(Streife, Projektmethode, ...) und besonderen Formen der Fahren (Hike, Trupplager, internationales<br />
Lager, ...) bis zur pfadfindertypischen Methode der „Waldläuferei“.<br />
Herausfordern und fördern statt Einschränken<br />
Pfadfinderleiter achten auf den persönlichen Entwicklungsstand des Einzelnen und der Gruppe und<br />
fordern und fördern die Mitglieder. Pfadfinder wachsen an ihren Herausforderungen, während die<br />
Leiter ihnen stets mit Rat und Tat zu Seite stehen.<br />
Ein Teilnehmer des ersten Pfadfinderlagers auf Brownsea Island berichtet, dass Baden-Powell stets<br />
„hinter den Jungs“ stand um sie zu ermutigen und ihnen Tipps zu geben.<br />
Das Schlagwort dazu ist „Look at the boy“.<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 5
Grundsätzliches <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
Die Kinder, und Jugendlichen an der Lösungen von Problemen beteiligen.<br />
Wenn die Gruppenstunden im Chaos versinken und keiner mehr zu Wort kommt, wird ein Pfadfinderleiter<br />
nicht jede Gruppenstunde damit verbringen „Ruhe!“ zu schreien, sondern sich mit den<br />
Gruppenmitgliedern zusammen setzen und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Auch<br />
Kinder verstehen, dass eine Lösung gefunden werden muss, und wenn sie an der Lösung beteiligt<br />
werden fällt es ihnen viel leichter sich an die resultierenden Regeln zu halten.<br />
In letzter Zeit ist dieses Prinzip unter dem Titel „Kindermitbestimmung“ in Form des Stimmrechts<br />
von Wölflingen, Jufis, Pfadis und Rovern auf der Stammesversammlung sogar in der Satzung der<br />
DPSG verankert worden. Im Alltag der Gruppe ist es aber genauso wichtig.<br />
Klare Regeln<br />
Kinder und Jugendliche brauchen die Sicherheit die ihnen klare Regeln geben. Das ist besonders für<br />
Jungen sehr wichtig, da eine produktive Arbeit mit ihnen erst beginnt, wenn die Grundlegenden<br />
Fragen: „Wer ist hier der Boss?“, „Was für Regeln gelten hier?“ und „Werden die Regeln gerecht<br />
durchgesetzt?“ geklärt sind. Sind die Regeln unklar oder werden sie nur sehr inkonsequent Durchgesetzt,<br />
fühlen sich die Kinder verunsichert und ungerecht behandelt, die Reaktion ist oft<br />
Wichtig ist jedoch, dass die Regeln für die Menschen da sind, und nicht umgekehrt. Macht eine Regel<br />
keinen Sinn (mehr) sollte sie den Gegebenheiten angepasst werden.<br />
3 Streife<br />
3.1 Die Streife selbst<br />
Streife ist „Vor Ort gehen und selber ansehen und ausfragen“<br />
Die Streife ist eine Methode um strukturiert auf die Fragen der Kinder und Jugendlichen eingehen zu<br />
können. Wichtig ist, das „Vor Ort Gehen“. Wie schon Baden Powell sagte: „Pfadfinderei ist keine<br />
Wissenschaft“, Fragen der Gruppe werden nicht theoretisch mit Tafel und Fachbuch im Gruppenraum<br />
gelöst sondern durch hingehen, ansehen und ausfragen.<br />
Dabei ist es nicht nötig die Fragen als Gruppenleiter selbst beantworten zu können, es schadet nicht,<br />
mit der Gruppe zusammen Neues zu entdecken.<br />
Eine Streife kann mehr oder weniger weit vorgegeben, vorstrukturiert sein.<br />
Im Idealfall taucht plötzlich eine Frage in der Gruppe auf, die alle interessiert und der Leiter zieht gekonnt<br />
die Methode „Streife“ aus der Tasche um das Ganze zu strukturieren. Manchmal wird das<br />
Leitungsteam aber auch beschließen, dass eine Streife durchgeführt werden soll und die Gruppe frei<br />
über die Fragestellung entscheiden lassen oder einige Fragestellungen vorgeben. Das ist dann eher<br />
eine „Künstlich herbeigeführte Streife“ und es werden zusätzliche Schritte wie Animation, Ideenfindung<br />
und Entscheidung benötigt. Die Idealsituation ist sicher, dass in der Gruppe spontan eine<br />
Frage auftaucht und das Leitungsteam mit der Methode der Streife auf die Anregung eingeht.<br />
6 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Streife<br />
„Konstruierte“ Streife initiert durch eine Idee des<br />
Leitungsteams oder eine Vorgabe von ausserhalb<br />
der Gruppe<br />
Streife als Reaktion<br />
auf eine spontane<br />
Frage<br />
Spontane<br />
Ausgangsfrage<br />
Differenzierung der<br />
Fragestellung<br />
Suche nach Fragepersonen<br />
und -orten<br />
Vorbereitung<br />
der Streife<br />
Durchführung<br />
der Streife<br />
Auswertung und<br />
Dokumentation<br />
Reflexion der<br />
Streife<br />
Fest<br />
Idee des<br />
Leitungsteams<br />
Animation und<br />
Ideenfindung<br />
Entscheidung<br />
Streife ist nicht Projektmethode<br />
Im Gegensatz zur Projektmethode, steht bei der Streife nicht das Erledigen einer Aufgabe im Mittelpunkt.<br />
Hier wird nicht in erster Linie gebaut, erschaffen oder erledigt sondern es werden Informationen<br />
und Eindrücke gesammelt. Aus den gewonnenen Eindrücken kann natürlich eine Betroffenheit<br />
oder Begeisterung und der Wusch nach einer Aktion entstehen, das kann durchaus sinnvoll sein, auch<br />
wenn es nicht Bestandteil der Streife selbst ist.<br />
Drei typische Ausprägungen<br />
Es gibt drei typische Ausprägungen, die sich aus drei typische Fragenbereichen ergeben:<br />
Die Naturstreife (Wie sieht der Anfang eines Bachs aus ?)<br />
Die Technikstreife (Wie sieht es in der Feuerwache aus ?)<br />
Die Sozialstreife (Wie lebt es sich in einem Asylbewerberheim ?)<br />
Das ist aber kein festes Raster und soll die Fragestellungen nicht einschränken.<br />
Eine Streife besteht aus aufeinander folgenden Schritten<br />
Ausgangsfrage<br />
Differenzierung der Fragestellung und ggf. Bildung von Kleingruppen<br />
Suche nach Fragepersonen und –orten<br />
Vorbereitung der Streife<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 7
Streife <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
Durchführung und Dokumentation der Streife<br />
Auswertung der Dokumentation<br />
Reflexion<br />
Fest<br />
3.2 Animation und Ideenfindung<br />
Ideen gibt es eigentlich viele, ...<br />
„Ideen gibt es eigentlich viele. Vermutlich gibt es so viele Ideen, dass ich gar keine Idee davon habe,<br />
wie viele Ideen es gibt. Ideen fallen mir einfach so ein, beim Lesen oder Fernsehen, beim Gespräch<br />
mit Freunden oder wenn ich abends im Bett liege – aber sie fallen mir auch oft wieder aus. Wenn<br />
dann im Trupp gefragt wird, was wir in der nächsten Zeit oder auf der nächsten Fahrt tun sollen sind<br />
sie wieder weg.“<br />
Kinder und Jugendliche haben viele Ideen, aber wenn man sie einfach nur fragt was sie interessiert<br />
oder was sie unternehmen wollen, fällt es ihnen schwer auf tolle Ideen zu kommen. Ideen kommen wo<br />
und wann die Gelegenheit günstig ist – nicht wenn der Mangel an Ideen es notwendig macht. Ideen<br />
sammeln ist ein spielerischer, kreativer Vorgang – keine Sitzung oder Konferenz. Unter Animation<br />
versteht man das Schaffen einer günstigen Gelegenheit, einer kreativen Stimmung in der sich Ideen<br />
entwickeln können. Bei der Ideenfindung wird versucht viele Ideen zu sammeln und immer wieder<br />
neu zu kombinieren um auf ganz neue und interessante Ideen zu kommen.<br />
Wer fragt schon Kinder und Jugendliche was sie wollen ?<br />
Kinder und Jugendliche sind es nicht gewohnt, dass sie gefragt werden was sie wollen. Auf der einen<br />
Seite wird ihnen von der Schule, der Ausbildungsstätte und teilweise auch von der Familie vorgeschrieben<br />
was sie zu tun haben. Es gibt Anweisungen, die ausgeführt werden sollen, ihre Meinung ist<br />
nicht gefragt. Auf der anderen Seite werden sie von sie heute mit allen Mitteln gelockt ihre Freiheit zu<br />
nutzen und ihre Möglichkeiten wahrzunehmen, damit sie die richtige Jeans kaufen, mit dem richtigen<br />
Handy telefonieren und die richtige Musik hören – die dem richtigen Anbieter das meiste Geld in die<br />
Kasse spült. Diese vermeintlichen Angebote gehen nicht auf ihre Interessen und Erwartungen ein,<br />
sondern suggerieren Bedürfnisse die sie vielleicht gar nicht haben. Die Kinder und Jugendlichen in<br />
unseren Gruppen sind oft überfordert, wenn sie dann plötzlich wirklich gefragt werden was sie eigentlich<br />
wollen und tun sich schwer etwas anderes als die übergestülpten Wünsche zu nennen. Das<br />
Leitungsteam schafft einen Rahmen in dem es möglich wird Ideen zu entwickeln – es animiert die<br />
Kinder und Jugendlichen da zu kreativ drauflos zu spinnen. Sowohl die Animation als auch die Ideenfindung<br />
werden meist in Kleingruppen durchgeführt, da sich der einzelne im kleinen Rahmen eher<br />
traut seine eigenen Wünsche und Ideen zu äußern.<br />
Aufgaben des Leitungsteams bei der Animation<br />
ein Klima zu schaffen, das das Ausspinnen von Ideen zulässt<br />
Formen anzubieten, die es ermöglichen, ohne Worte Ideen und Wünsche zu äußern<br />
jeden anzuregen mitzuspinnen<br />
zu verstärken und zu hinterfragen, um Probleme die angesprochen werden zu verdeutlichen<br />
selbst mitzuspinnen, um den Jugendlichen Sicherheit zu geben und sie zu begeistern<br />
weitergehende Möglichkeiten von genannten Ideen aufzuzeigen<br />
Materialien als Hilfe anzubieten<br />
zu beobachten, Ideen und Wünsche aufzuschreiben und die Gruppe anzuregen, ihre Spinnereien<br />
festzuhalten<br />
Von der Idee zum konkreten Vorschlag<br />
Eine heikle Phase ist die Entwicklung konkreter Vorschläge aus den verrückten Ideen. Hierbei gilt es<br />
aus den wilden Ideen konkrete und durchführbare Vorschläge zu entwickeln, ohne sich dabei zu sehr<br />
einzuschränken aus den mühsam gesammelten tollen Ideen wieder langweilige Vorschläge zu machen.<br />
Natürlich sollen die Vorschläge realistisch und durchführbar sein, aber wer es damit übertreibt<br />
wirft leicht die besten Ideen über Bord und verzichtet auf die grössten Abenteuer.<br />
8 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Streife<br />
Fragen denen sich ein konkreter Vorschlag stellen muss:<br />
Was wollen wir tun?<br />
Was wollen wir erreichen?<br />
Welche Möglichkeiten bietet der Vorschlag und was können wir dabei erleben?<br />
In welchem Umfang kann jeder dabei mitmachen?<br />
Welchen Aufwand verlangt die Durchführung?<br />
Aufgaben des Leitungsteams bei der Ideenfindung<br />
Darauf achten, dass jeder seine Meinung sagen kann.<br />
Darauf achten, dass die Sippen gemeinsam Vorschläge erarbeiten.<br />
Hilfestellung bei der Darstellung der Vorschläge geben.<br />
Durch gezieltes Nachfragen weitere Möglichkeiten erschließen oder auf Unklarheiten oder Problemfelder<br />
hinweisen.<br />
[in Anlehnung an „Crash“ Team Reihe 4]<br />
3.3 Entscheidung<br />
Entscheidungen sind Wendepunkte<br />
Entscheidungen sind Wendepunkte, an denen man sich entscheidet das eine zu tun und das andere zu<br />
lassen – es ist wichtig sich dessen bewusst zu sein und eine Entscheidung nicht nebenbei zu fällen.<br />
Um sich richtig entscheiden zu können bedarf es gewisser Voraussetzungen wie z.B. den nötigen Informationen.<br />
Die Art der Durchführung einer Entscheidung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und<br />
auch wenn die Entscheidung getroffen wurde sind einige Dinge zu beachten.<br />
Entscheidungen bewusst machen und bewusst treffen<br />
Grundsätzlich ist es wichtig sich klar zu machen, dass eine Entscheidung ansteht, egal ob die Entscheidung<br />
nur einen selbst oder die Gruppe betrifft. Viele Entscheidungen werden völlig formlos im<br />
Gespräch in einer Kleingruppe getroffen – manchmal ist anschließend nicht mehr nachzuvollziehen,<br />
wie es zu der Entscheidung gekommen ist. Für ‚einfache Entscheidungen‘ ist das sicher in Ordnung<br />
(„Wo gehen wir nach der Leiterrunde noch was trinken ?“), je wichtiger die Entscheidung und ihre<br />
Folgen für die Beteiligten aber sind, um so formaler wird die Vorgehensweise sein („Wen wählen wir<br />
für die nächsten drei Jahre als Stammesvorstand ?“).<br />
Entscheidungen nicht ignorieren<br />
Ein weiterer Knackpunkt ist das mehr oder weniger bewusste ignorieren von notwendigen Entscheidungen<br />
um „sich nicht entscheiden zu müssen“ bzw. vermeintlich beide Alternativen gleichzeitig zu<br />
realisieren. Man „kann sich nicht entscheiden“ und versucht beide Alternativen gleichzeitig zu<br />
realisieren, das ist jedoch oft nicht wirklich möglich. (Z.B. für einen Leiter, der auch noch Rover ist<br />
und nicht nur auf dem Stammeslager ständig zwischen den Stühlen sitzt. Einerseits möchte er als Rover<br />
an den Aktivitäten seiner Roverrunde teilnehmen, auf der anderen Seite will er als Leiter für die<br />
Kinder seiner Gruppe da sein).<br />
Vorbereitung der Entscheidung<br />
Um eine Entscheidung fällen zu können ist es wichtig die nötigen Informationen zu haben, in einer<br />
Gruppe ist besonders wichtig, dass alle über die notwendigen Informationen verfügen und niemand<br />
benachteiligt ist. Je jünger die Teilnehmer sind, um so wichtiger ist es die Alternativen und Konsequenzen<br />
gut Aufbereitet darzustellen. Kinder denken oft nicht über die Folgen ihrer Entscheidungen<br />
nach – aber das können sie bei uns lernen.<br />
Zu einer fairen Entscheidung gehört, dass alle die selben Chancen haben, dazu gehören die selben Informationen,<br />
aber auch die Chance an der Entscheidung teilzunehmen. Deshalb ist es wichtig dass<br />
allen klar ist wann genau die Entscheidung gefällt wird. „Alte Hasen“ machen nicht selten damit „Politik“<br />
dass sie Entscheidung zu bestimmten Zeitpunkten herbeiführen, die ihre Chancen verbessern –<br />
das ist zwar raffiniert, aber nicht unbedingt fair. Deshalb ist für Versammlungen auf denen wichtige<br />
Entscheidungen getroffen werden (z.B.: Stammesversammlung) auch festgelegt wie viele Wochen<br />
vorher die Einladungen verschickt werden müssen.<br />
Es muss klar sein, wer genau die Entscheidung fällt, also z.B. alle Gruppenmitglieder, nur die Sippensprecher<br />
oder gar nur die Leiter? Bei offiziellen Entscheidungen, die in der Satzung der DPSG<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 9
Streife <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
erwähnt werden, ist z.B. immer auch festgelegt wer genau stimmberechtigt ist. Wenn das nicht festgelegt<br />
ist, muss die Gruppe das selbst festlegen.<br />
Oft gibt es Grenzen, die der Entscheidung gesetzt sind. Ein Jufitrupp darf z.B. recht frei entscheiden<br />
wie die Jufiaktion auf dem Gemeindefest aussehen soll – dabei sind aber sicher diverse Grenzen zu<br />
beachten: Finanzen, Technische Möglichkeiten, pädagogische und rechtliche Überlegungen. Es ist<br />
wichtig die Grenzen vor der Entscheidung deutlich zu machen, sonst entsteht schnell der Eindruck,<br />
dass die Leiter die Entscheidung der Kinder doch nicht akzeptieren wollen. In der Praxis ist das aber<br />
manchmal schwierig wenn es Grenzen gibt die für die Leiter selbstverständlich sind, aber nicht für<br />
alle Mitglieder der Gruppe.<br />
Der Ablauf der Entscheidung und die nötige qualifizierte Mehrheit müssen auch vor der Entscheidung<br />
ganz klar sein. Wenn diese Punkte nicht klar waren, oder sogar während der Entscheidung noch<br />
verändert werden (z.B. plötzlich ist doch eine 2/3 Mehrheit erforderlich) entsteht schnell der Eindruck<br />
von Willkür.<br />
Die Durchführung der Entscheidung<br />
Auch während der Entscheidung muss darauf geachtet werden, dass alle die gleichen Chancen haben<br />
und dass die Methode zu der Gruppe passt. Je jünger die Teilnehmer sind um so spielerischer sollte<br />
die Methode gestaltet sein (z.B. Wasser auf die „Alternativeneimer“ aufteilen) ohne jedoch einen<br />
korrekten Ablauf zu gefährden (Alle bekommen die selbe Menge Wasser und niemand schöpft<br />
Wasser aus den Eimern zurück). Je selbstständiger die Teilnehmer sind, um so weniger muss darauf<br />
geachtet werden, dass nicht ein paar Wortführer die „Schwächeren“ beeinflussen. Die Methode darf<br />
Spass machen, sollte aber nicht unnötig kompliziert oder albern werden. Bei Erwachsenen wird eine<br />
einfache Abstimmung per Handzeichen in der Regel den Zweck erfüllen. Ein Ausnahme bilden dabei<br />
aber z.B. alle Wahlen zu Ämtern in der DPSG für die nach der Satzung immer eine geheime Abstimmung<br />
vorgeschrieben ist. Hier wird der Einzelne geschützt, seine Stimme frei und geheim abgeben zu<br />
können.<br />
Wenn mehr als zwei Alternativen zur Auswahl stehen ist es oft psychologisch sinnvoll eine mehrstufige<br />
Abstimmung zu nutzen, also immer mehr Alternativen auszuschließen um schließlich zwischen<br />
zwei Alternativen zu entscheiden. Dann hat immer eine Mehrheit für die Entscheidung gestimmt und<br />
damit steht hoffentlich auch diejenigen dahinter die bei der ersten Abstimmung für keine der zwei<br />
letzten Alternativen gestimmt hatten.<br />
Nach der Entscheidung sind noch zwei Fragen zu klären<br />
Ist das nun wirklich der Wille der Gruppe, oder hat die Hälfte nicht verstanden was hier gerade entschieden<br />
wurde. Manchmal stellt man sich selbst ein Bein, z.B. durch ein ungeschicktes Entscheidungsverfahren.<br />
Wenn sich zeigt dass die getroffene Entscheidung nicht der Gruppenmeinung entspricht<br />
muss man überlegen was schief gelaufen ist. Natürlich kann man nicht solange abstimmen<br />
lassen bis das Ergebnis passt.<br />
Was ist mit denen, die für etwas anderes gestimmt haben? Können sie sich damit abfinden und sich<br />
trotzdem beteiligen? Oder fühlt sich jemand von der Entscheidung persönlich eingeschränkt – sind<br />
vielleicht im Eifer des Gefechts die berechtigten Interessen einer Minderheit nicht beachtet worden?<br />
Checkliste – Entscheidung<br />
Vorbereitung<br />
Worüber wird entschieden? Welche Alternativen gibt es? Welche Folgen und Konsequenzen<br />
ergeben sich daraus? Liegen die Informationen vor und sind sie der Gruppe entsprechend gut<br />
dargestellt worden ?<br />
Wann wird entschieden und haben alle verstanden dass jetzt eine Entscheidung ansteht? (Schlechtes<br />
Beispiel: Entscheidungen auf informellen Treffen: „Ach übrigens, wir haben uns da neulich mal<br />
getroffen und entschieden, dass ...)<br />
Es muss klar sein wer die Entscheidung fällt (Leiter, Gruppenmitglieder, Kleingruppensprecher,<br />
...).<br />
10 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Streife<br />
Wenn es Grenzen für die Entscheidung gibt sollten die vorher klar gemacht werden und nicht<br />
nachher die Entscheidung gekippt werden weil sie den, nun plötzlich auftauchenden, Rahmenbedingungen<br />
nicht entspricht.<br />
Der Ablauf - der Entscheidungsmodus - muss vorher festgelegt werden. Wird abgestimmt und wird<br />
eine besondere Mehrheit benötigt? Nichts ist schlimmer als solange abzustimmen bis das Ergebnis<br />
passt.<br />
Durchführung<br />
Darauf achten, dass alle zu Wort kommen und nicht die üblichen Wortführer den Rest überrumpeln<br />
Ggf. eine spielerische, aber dennoch korrekte bzw. geheime Form (z.B. Wasser in Becher, Kugeln<br />
in Gläser, ...)<br />
Bei Abstimmungen ein mehrstufiges Verfahren anwenden - am Ende zwischen 2 Vorschlägen entscheiden,<br />
damit eine Mehrheit dafür gestimmt hat.<br />
Nach der Entscheidung<br />
Steht die Mehrheit hinter der Entscheidung? Am Ende noch einmal überprüfen ob das jetzt wirklich<br />
der Wille der Gruppe war, oder ob da bei der Entscheidung etwas schief gelaufen ist.<br />
Können alle damit leben? Natürlich kann sich die Gruppe nicht immer nach einer unzufriedenen<br />
Minderheit richten, aber wenn jemand überhaupt nicht mit dem Ergebnis leben kann muss eine<br />
praktikable Lösung gefunden werden.<br />
3.4 Mitbestimmung<br />
Unter Mitbestimmung verstehen wird die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an Entscheidungen<br />
innerhalb unseres Verbandes. Das beginnt bei den Gruppenstunden und findet auf Stammesversammlungen<br />
einen besonderen Ausdruck<br />
Die Chance Kinder und Jugendliche an Entscheidungen zu beteiligen wird im ‚Alltag der Gruppenstunden‘<br />
leicht übersehen. Oft stehen eine Vielzahl von möglichen Aktionen an die mehr oder<br />
weniger von „Außerhalb der Gruppe“ vorbestimmt sind, wie z.B.: Teilnahme an Bezirks- und Diözesanaktionen,<br />
Mitgestaltung von Festen der Gemeinde oder Pfarrgemeinde, Traditionelle Aktionen des<br />
Stammen, ... so dass übers Jahr gesehen nicht mehr allzu viel Programm der Gruppe übrigbleibt dass<br />
von ihr wirklich selbst entscheiden werden kann. Pfadfinderleiter unterstützen Kinder und Jugendliche<br />
dabei ihr Ideen und Wünsche umzusetzen – sie sollen sie nicht fertig vorsetzen.<br />
Die Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen endet jedoch da, wo die Verantwortung der Leiter<br />
für die Erziehung beginnt. Diese Verantwortung hat jeder Leiter und man kann ihr nicht entkommen,<br />
indem man sich hinter einer Entscheidung der Mitglieder versteckt. Dies ist in der Praxis ein kniffliger<br />
Punkt. Viele Grenzen sind in den pädagogischen und rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben<br />
und nicht immer kann man vor der Entscheidung klar machen, was alles nicht möglich ist.<br />
Entscheidungen und Mitbestimmungsmöglichkeiten sind wichtig weil:<br />
Wir Kinder und Jugendliche mit ihren Wünschen und Ideen ernst nehmen.<br />
Wer selbst entscheiden darf lernt Verantwortung für die Folgen ihrer Entscheidung zu übernehmen<br />
Die Gruppe an einem, eventuell nicht ganz einfachen, Entscheidungsprozeß wachsen kann.<br />
Kinder und Jugendliche lernen ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und selbst über ihre Unternehmungen<br />
zu entscheiden<br />
Sich damit die demokratische Struktur unseres Verbandes bis in die Gruppen vor Ort niederschlägt.<br />
Worüber wird entschieden:<br />
Programm der Gruppen. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Pfadfinderarbeit.<br />
Von kleinen (Was wollen wir spielen?) bis zu großen (Wohin fahren wir ins Sommerlager?)<br />
Fragen.<br />
Zusammensetzung der Gruppen/Sippen.<br />
Besetzung von Ämtern (vom Sippenkoch bis zum Stammesvorstand)<br />
Mitbestimmung erfordert Mut<br />
Wer Mitbestimmung zulässt kann nicht autoritär Entscheidungen vorwegnehmen (als Leiter, Stammesvorstand,<br />
...) und muss darauf vertrauen dass die Mehrheit ‚richtig‘ entscheiden wird.<br />
Wer anderer Meinung ist muss den Mut haben diese zu äußern. Nachher zu motzen hilft keinem.<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 11
Streife <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
Wem Informationen fehlen der muss nachfragen.<br />
Mitbestimmung kann man durch geeignete Strukturen fördern<br />
Wenn klar ist wer eine Entscheidung fällt (Trupprat, Bezirksversammlung, Vorstand, ...)<br />
Wenn es typische Orte und Zeiten gibt (Leiterrunde) statt informeller Treffen (Wir haben uns da<br />
neulich getroffen und schon mal besprochen, dass ...)<br />
Wenn Informations- und Einladungsfristen eingehalten werden.<br />
Wenn es eine gemeinsame Grundlage gibt (Ordnung und Satzung der DPSG, Evangelium, BGB)<br />
3.5 Vorbereitung der eigentlichen Streife<br />
„Endlich steht die Wölflingsmeute in der Feuerwache und alle staunen über die großen roten Autos.<br />
Alle dürfen mal auf die Leiter klettern und viele zu schnell geht die Zeit vorbei und die Wölflinge<br />
sitzen wieder im Gruppenraum. Leider fallen ihnen erste jetzt die Fragen ein, die sie wirklich interessiert<br />
hätten.“<br />
Die Vorbereitung der Streife ist ein wesentlicher Punkt wo Gruppenleiter Hilfestellung geben müssen.<br />
Sie stellen der Gruppe Fragen um zu klären, was genau ist von Interesse, welches ist genau das<br />
richtige Ziel, was erhoffen sich die Teilnehmer von der Streife?<br />
Darüber hinaus unterstützen Leiter natürlich bei der konkreten Planung, z.B.: Durch Gespräche mit<br />
den Verantwortlichen bei möglichen Streifenzielen und die Organisation Zeiten und Orten. Hierbei<br />
sollten die Teilnehmer soweit wie möglich eingebunden werden und Leiter nur die Aufgaben übernehmen,<br />
die die Teilnehmer nicht alleine durchführen können. Es ist vielleicht keine gut Idee einen<br />
Wölfling alleine in die Feuerwache zu schicken um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, aber<br />
warum sollte nicht ein Leiter mit den Rudelsprechern dort auftauchen.<br />
Je jünger die Teilnehmer sind, um so eher würden sie wahrscheinlich losrennen ohne sich vorzubereiten.<br />
Hier gilt es als Leiter einen Mittelweg zwischen ausreichender Vorbereitung und verpuffter Begeisterung<br />
der Teilnehmer zu finden.<br />
Checkliste: Vorbereitung der Streife<br />
Welches ist das richtige Ziel für die Streife?<br />
Steht der Zeitplan? Sind Absprachen mit den Verantwortlichen getroffen?<br />
Haben sich die Teilnehmer überlegt was sie interessiert, was sie wissen wollen? Fragenkatalog?<br />
Ist mit dem Gesprächspartner geklärt worum es geht ? Hat er verstanden was wir von ihm<br />
erwarten ?<br />
Sind Hintergrundinformationen nötig?<br />
Organisation vom Transport der Gruppe zum Steifenziel?<br />
Beachtung von Sicherheitsaspekten: 1.Hilfe, Straßenverkehr, besondere Gefahren (z.B.: Baustelle),<br />
Versicherung?<br />
3.6 Durchführung<br />
Ziel der Streife ist es Informationen und Eindrücke zu gewinnen. Würde es nur um die Informationen<br />
gehen, könnte man auch im Lehrbuch nachschlagen, aber dann würde ein wichtiger Aspekt fehlen.<br />
Wer sich selber an den Ort des Geschehens begibt und mit die Menschen trifft und mit ihnen spricht<br />
nimmt mehr mit als nur Informationen. Er lernt Menschen kennen, erlebt die Situation, wird beeindruckt<br />
oder fühlt sich betroffen. Pfadfinder lernen nicht aus Lehrbüchern – sie stürzen sich ins Geschehen.<br />
Der Gruppenleiter übernimmt dabei eine Vermittlerrolle. Er achtet darauf, dass die Interessen der<br />
Gruppe berücksichtigt werden und die Fragen geklärt werden. Er denkt an Fragen der Sicherheit, der<br />
Art der Vermittlung der Informationen (nicht jeder Gesprächspartner hat Erfahrungen mit Kindern)<br />
und den Schutz der Kinder (nicht jeder Ort und jedes Thema ist für Kinder geeignet. Ebenso ist der<br />
Gruppenleiter der Ansprechpartner für den externen Gesprächspartner und achte auf dessen Interessen<br />
(Kinder und Jugendliche könne manchmal sehr direkt sein).<br />
12 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Streife<br />
Checkliste: Durchführung der Streife<br />
Organisation: Sind die Zeit, der Ort, die Anfahrt und Ähnliches geklärt ?<br />
Absprachen mit dem Gesprächspartner: Ist beiden Seiten klar, was sie voneinander erwarten ?<br />
Welche Fragen wollte die Gruppe geklärt haben ?<br />
Die Dokumentation nicht vergessen (Fotos, Audio- oder Videoaufnahmen, Mitschreiben, Dinge<br />
mitnehmen, ...)?<br />
Sicherheit und Zumutbarkeit für die Gruppe ?<br />
Interessen des Gesprächspartners ?<br />
3.7 Auswertung und Dokumentation<br />
Nach der eigentlichen Streife, wenn alle wieder zurück sind, ist es wichtig die Ergebnisse zusammenzutragen.<br />
Nicht alle haben jede Einzelheit vor Ort mitbekommen oder verstanden. Manches<br />
muss vielleicht noch mal erklärt oder besprochen werden. Vielleicht wird klar, dass einige Fragen<br />
doch noch nicht geklärt wurden oder es treten neue Fragestellungen auf ? Bei Bedarf kann man ja<br />
noch mal nachfragen oder es entsteht die Idee für eine weitere Streife oder ein Projekt.<br />
Durch die Erstellung einer Dokumentation, werden die Ergebnisse und Erlebnisse nochmal deutlich<br />
gemacht und verarbeitet. Das kann vom einfachen Betrachten von den Fotos bis hin zu einer Präsentation<br />
reichen, die dann evtl. auch anderen (Eltern, Rest vom Stamm, Internet, ...) vorgeführt wird.<br />
Nicht vergessen sollte man auch den Dank an die Gesprächspartner.<br />
Der Unterschied zwischen Dokumentation und Reflexion bei der Streife besteht darin, dass die Dokumentation<br />
sich mit dem Thema der Streife auseinandersetzt (Was haben wir erfahren ?) während sich<br />
die Reflexion mit dem Ablauf der ganzen Streife (Wie ist es denn gelaufen ?) beschäftigt.<br />
3.8 Reflexion<br />
Reflexion ist die Kunst der kritischen Wertung. Sie macht Verhaltensweisen einzelner, aber auch<br />
ganzer Gruppen sichtbar und verständlich. Damit werden Vorschriften von Autoritäten zunehmend<br />
durch eigene Einsicht ersetzt. Das bedeutet den Abbau von Fremderziehung und Fremdverantwortung<br />
zu Gunsten von Selbsterziehung und Selbstverantwortung.<br />
Reflexion kann in 4 Schritten beschrieben werden.<br />
Beschreibung bzw. in Erinnerung rufen der Situation oder des Ereignisses. (Was ist passiert?)<br />
Suche nach den Ursachen (Warum ist es dazu gekommen?)<br />
Bewertung (Wie werte ich das, fand ich es gut oder schlecht?)<br />
Verhaltensänderung (Nächstes mal machen wir es etwas besser!)<br />
Beschreibung der Situation<br />
Um die Situation beschreiben zu könne ist es wichtig dass jeder seine Sicht der Ereignisse darstellen<br />
kann, ohne bewertet oder beschuldigt zu werden. Nur so kann der Einzelne erfahren, wie der Andere<br />
die Situation erfahren hat. Dabei ist es natürlich, dass verschiedene Menschen die selbe Situation<br />
anders erleben. Jeder sollte die Chance haben sich zu äußern, aber es sollte auch niemand zu einer<br />
Stellungnahme gezwungen werden, der das nicht möchte.<br />
Vor allem, wenn die Ereignisse eine Weile zurück liegen (Sommerlagerreflexion nach den großen Ferien)<br />
oder nicht alle auf einmal besprochen werden sollen (Reflexion eines Wochenendes am Sonntag<br />
Nachmittag) ist es sinnvoll das Geschehene in einem zeitlichen Ablauf darzustellen und jeweils nach<br />
der Beschreibung eines Abschnitts diesen zu reflektieren. Diese Aufgabe übernimmt der Reflexionsleiter,<br />
der bemüht ist die Beschreibung sachlich zu halten und nicht selbst zu bewerten.<br />
Beispiel: Zwei Zeltgruppen waren in eine wilde Rauferei verwickelt und beschuldigen sich gegenseitig<br />
angefangen zu haben. Der Reflexionsleiter kommt auf den Anfang des Streits zurück und lässt die<br />
Einzelnen schildern, wie sie das erlebt haben.<br />
Suche nach den Ursachen<br />
Die Suche nach den Ursachen hilft das Verhalten des Anderen oder die Entwicklung in der Gruppe zu<br />
verstehen. Wer das Verhalten des Gegenübers versteht und in der Zukunft evtl. voraussehen kann,<br />
kann auch die Ursache vermeiden.<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 13
Streife <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
Beispiel: Die Rauferei begann offenbar, weil sich die eine Gruppe über das schiefe Zelt der anderen<br />
lustig gemacht hatte. Ein ‚harmloser Witz‘ traf auf eine Gruppe, die das Zelt wegen vertauschten Gestänges<br />
schon drei mal aufgebaut hatte und in diesem Punkt nun überhaupt keinen Spass mehr<br />
verstand.<br />
Bewertung<br />
Um das Geschehene zu Bewerten ist ein Bewertungsmaßstab erforderlich. Das können gemeinsame<br />
Werte oder vereinbarte Regeln sein. Je nach Gruppe können solche Werte und Regeln unterschiedlich<br />
sein. Der übliche Umgangston ist z.B. mal eher rau mal besonders vorsichtig. In unseren Pfadfindergruppen<br />
haben wir ein Wertesystem, das sich unter anderem auf die Ideen von Baden Powell,<br />
das Pfadfindergesetz, die Menschenrechte, Recht und Gesetz, pädagogische Überlegungen und nicht<br />
zuletzt auf das Evangelium Jesu Christi stützt.<br />
In unserem Beispiel kann man sicher diskutieren, ob es in Ordnung ist sich über die Gruppe mit dem<br />
schiefen Zelt lustig zu machen, auf solch eine Provokation aber mit Gewalt zu reagieren liegt sicher<br />
nicht im Rahmen unserer Werte.<br />
Verhaltensänderung<br />
Wenn das Geschehen geklärt und bewertet wurde kann daraus eine Verhaltensänderung resultieren. Je<br />
nachdem wie die Bewertung ausgefallen ist. Natürlich sind nicht nur Probleme, Streit und andere Katastrophen<br />
Thema von Reflexionen, auch wenn Etwas gut gelaufen ist, macht es Sinn das zu besprechen.<br />
Wenn jedoch die Bewertung des Geschehens eher negativ ausfällt sollte daraus eine Verhaltensänderung<br />
für die Zukunft erfolgen. Nur so macht Reflexion wirklich Sinn und kann langfristig zu<br />
einer Verbesserung beitragen. Eine Reflexion die nach der Beschreibung abgebrochen wird ohne sich<br />
Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, hat ihr Ziel nicht erreicht.<br />
In unserem Beispiel gibt es da einige Möglichkeiten. Die Einen könnten helfen statt dumme Witze zu<br />
machen und die Anderen ihre Aggression unter Kontrolle halten.<br />
Reflexionsregeln und Rollen<br />
Entscheidend für den Verlauf einer Reflexion ist die wertfreie Darstellung der Ereignisse und Eindrücke<br />
durch die Teilnehmer. Je unerfahrener die Teilnehmer (mit Reflexionen) sind und je mehr sie<br />
persönlich betroffen sind, um so größer ist die Gefahr schon am Anfang in fruchtlosen Streitgesprächen<br />
zu enden. Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, dass jeder seine Meinung darstellen kann<br />
ohne gleich von der Gruppe oder Einzelnen bewertet und angegriffen zu werden.<br />
„Reflexion ist keine Diskussion !“ – Das ist ein stak vereinfachte Darstellung von Reflexion die daraus<br />
resultiert, dass die ersten Schritte einer Reflexion leicht in ein Streitgespräch abgleiten und hat damit,<br />
vor allem für jüngere und unerfahrene Teilnehmer, ihre Berechtigung. Spätestens bei der Suche<br />
nach Verhaltensänderungen und Verbesserungen darf über eine sinnvolle Lösung diskutiert werden.<br />
Es bietet sich an einen Reflexionsleiter zu bestimmen, der auf den Verlauf der Reflexion und die<br />
Einhaltung der Regeln achtet. Er selbst wird sich nicht an der Reflexion beteiligen und seine Erlebnisse<br />
schildern oder Bewertungen abgeben, damit er nicht in Gefahr gerät seine Autorität (Überwachen<br />
von Regeln) zu seinen Gunsten (verstärken der eigenen Meinung) zu missbrauchen. Sollte er bei<br />
einem Thema selbst betroffen sein kann ein anderer die Aufgabe übernehmen.<br />
Hier die wichtigsten Reflexionsregeln:<br />
Formuliere „Ich-Sätze“ denn die Anderen sprechen für sich selbst.. Also „Ich habe mich daran gestört,<br />
dass ...“ und nicht „Es war ja wohl völlig bescheuert, dass ...“.<br />
Sprich für dich selbst und erwarte nicht, dass andere für dich sprechen.<br />
Höre dem Anderen zu und gestehe ihm seine eigene Sicht der Dinge zu. (Reflexion ist (zunächst)<br />
keine Diskussion.<br />
Bewerte die Beiträge anderer nicht.<br />
Beschreibe den anderen, wie du ihr Verhalten empfunden hast.<br />
Benenne konkrete Situationen.<br />
14 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Streife<br />
Nicht vergessen: Auch positive Sachen sollen bei einer Reflexion zur Sprache kommen.<br />
Dimensionen der Reflexion<br />
Reflexionen können sehr unterschiedlich ausfallen:<br />
Ad hoc, aus der Situation heraus. Geplant und vorbereitet.<br />
Personenbezogen Sachbezogen<br />
Einzelreflexion (Wie ist es mir gegangen?) Gruppenreflexion (Wie ist es in unserer Gruppe<br />
gelaufen?)<br />
Reflexion als Regelkreis<br />
Reflexion kann man als Regelkreis auffassen. Das Geschehene wird mit den Ansprüchen, Zielen und<br />
Werten verglichen. Aus den beobachteten Abweichungen resultieren Handlungsänderungen, damit es<br />
das nächste mal besser läuft. So kann die regelmäßige Reflexion das Verhalten des Einzelnen und der<br />
Gruppe Stück für Stück im Sinne einer Selbsterziehung verändern.<br />
Streifenreflexion<br />
Den Ablauf von Beginn an noch mal durchgehen.<br />
Wie ist die Ideenfindung – Entscheidung gelaufen<br />
Wie ist die Streife (Vorbereitung – Durchführung – Doku) gelaufen?<br />
Wie hat sich die Gruppe verhalten<br />
Wie ging es den Einzelnen in der Gruppe<br />
Und ganz wichtig: Was können wir aus den Erfahrungen für die Zukunft lernen<br />
3.9 Fest<br />
Wer zusammen etwas besonderes erlebt hat, soll auch zusammen feiern. Das Fest bildet den Abschluss<br />
der Streife. Die Gruppe hat einen Weg hinter sich: Unter Umständen eine Suche nach einer<br />
Idee, eine vielleicht schwierige Entscheidungsfindung und Vorbereitung, eine abenteuerliche Durchführung,<br />
eine Aufbereitung der Ergebnisse und eine Präsentation und vielleicht eine Reflexion in der<br />
auch unangenehme Themen zur Sprache kamen. Jetzt ist der Zeitpunkt um gemeinsam ein Fest zu feiern<br />
und ein positives Gruppenerlebnis ans Ende zu stellen.<br />
Nach Möglichkeit können auch die Gesprächspartner vom Streifenziel eingeladen werden.<br />
4 Pfadfinderische Stilelemente und Prinzipien<br />
4.1 Stufenwechsel<br />
Kinder- und Jugendgruppen bei den Pfadfindern werden nach dem Alter der Mitglieder in<br />
Wölflinge (8 – 11 Jahre)<br />
Jungpfadfinder (12 – 14 Jahre)<br />
Pfadfinder (15 – 17 Jahre)<br />
Rover (18 – 20 Jahre)<br />
die sogenannten „Stufen“ oder „Altersstufen“ eingeteilt.<br />
Die Mitglieder sind auf dem Weg durch die Stufen<br />
Im Gegensatz zu den meisten anderen Jugendverbänden, bleibt die Zusammensetzung einer Gruppe<br />
der DPSG nicht über Jahre bestehen. Vielmehr bleiben die Gruppen in den Altersstufen bestehen und<br />
die Mitglieder wechseln die Gruppe, wenn sie in eine andere Altersstufe kommen. Jedes Jahr<br />
verlassen die ältesten Mitglieder, im Idealfall ein Drittel, die Gruppe und werden Teil der nächst älteren<br />
Gruppe, während aus der jüngeren Gruppe deren ältesten Mitglieder in neu die Gruppe kommen<br />
und nun die Jüngsten sind. Welche und wie viele Mitglieder die Gruppe wechseln wird von den Leitern,<br />
ggf. in Absprache mit den Leitern der anderen betroffenen Gruppe, entschieden. Dabei ist nicht<br />
nur das Alter sondern vor allem der Entwicklungsstand des Einzelnen ausschlaggebend.<br />
Der Stufenwechsels bricht Rollenstrukturen auf<br />
Der Sinn des Stufenwechsels besteht darin, dass die Rollenstruktur in den Gruppen immer wieder aufgebrochen<br />
wird. Wer nach drei Jahren zu den Ältesten zählt und den Ton in der Gruppe angibt, findet<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 15
Pfadfinderische Stilelemente und Prinzipien <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
sich plötzlich in der Rolle eines der Jüngsten Gruppenmitglieder wieder. Die neue Gruppe wird von<br />
anderen Leitern geleitet, es gibt andere Traditionen und gelten vielleicht auch andere Regeln. Das ist<br />
sicher nicht einfach, kann aber auch eine große Chance sein für jede, deren Rolle eher in Richtung<br />
„Gruppenkasper“ oder „Ewiger Verlierer“ ausgeprägt waren. Sie haben nun die Möglichkeit neu zu<br />
beginnen.<br />
Auch in der alten Gruppe werden die Rollen neu gemischt, die „Alte Riege“ ist gegangen und andere<br />
Mitglieder können deren Platz, z.B. als Kleingruppensprecher, einnehmen. Hier gilt es neu Verantwortung<br />
zu übernehmen und an den Aufgaben zu wachsen. Jene Mitglieder, die erst ein Jahr in der<br />
Gruppe sind, werden nun im Gegensatz zu den ganz Neuen zu „Alten Hasen“ denen sie die<br />
Traditionen und Gepflogenheiten der neuen Gruppe näher bringen.<br />
Vom Stufenwechsel profitieren<br />
auch Quereinsteiger, die keine<br />
Pfadfinderkarriere hinter sich<br />
haben sondern ganz neu zu den<br />
Pfadfindern kommen. Es ist viel<br />
schwerer neu in eine Gruppe zu<br />
kommen, die schon seit Jahren in<br />
der gleichen Besetzung existiert als<br />
in eine Gruppe, die immer in Bewegung<br />
bleibt und gewohnt ist<br />
dass immer wieder neue Mitglieder<br />
integriert werden.<br />
Stufenwechsel als Vorbereitung<br />
auf das Leben<br />
Wölflinge Jungpfadfinder<br />
Pfadfinder<br />
Die 'Jüngsten' werden die 'Mittleren'<br />
Die 'Ältesten' werden die 'Jüngsten'<br />
Die 'Mittleren' werden die 'Ältesten'<br />
Die 'Jüngsten' werden die 'Mittleren'<br />
Die 'Ältesten' werden die 'Jüngsten'<br />
Die 'Mittleren' werden die 'Ältesten'<br />
So wird durch den Stufenwechsel vermieden, dass sich über Jahre Rollen einschleifen, die den Mitgliedern<br />
keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr bieten. Durch die immer wieder neuen Situationen<br />
und Gruppen müssen sich die Mitglieder immer wieder neu in die Gemeinschaft integrieren bzw.<br />
andere in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Der Wechsel zwischen der Rolle der Jüngsten und der Ältesten<br />
fordert die Kinder und Jugendlichen immer wieder neu Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen<br />
und daran zu wachsen.<br />
Wir Pfadfinder sehen darin eine Vorbereitung auf das Leben, denn auch dort ist es immer wieder erforderlich<br />
Menschen kennen zu lernen, sich auf sie einzustellen und seinen Platz in der jeweiligen<br />
„Gruppe“ (Familie, Kollegenkreis, Verein, Pfarrgemeinde, ...) zu finden.<br />
Wer wechselt die Stufe ?<br />
Die Entscheidung welche Mitglieder in die nächst ältere Gruppe wechseln ist für das Leitungsteam<br />
nicht einfach. Einen Anhaltspunkt bietet das Alter der Mitglieder, aber entscheidender ist der<br />
Entwicklungsstand des Einzelnen. Im Idealfall haben die ältesten Mitglieder in der Gruppe in den<br />
vergangen drei Jahren immer mehr Verantwortung übernommen, viel gelernt und an die Jüngeren<br />
weitergegeben. Manchmal beginnen die Älteren auch sich zu langweilen, das „Stufentypische Programm“,<br />
kann sie nicht mehr begeistern und sie suchen neue Herausforderungen, die mit den Jüngeren<br />
in der Gruppe zusammen nicht möglich sind. In der Praxis sieht das manchmal anders aus und<br />
nicht selten verhält sich einer der Älteren ganz anders, als die Leiter es von ihm erwarten würden.<br />
Hier gilt es abzuwägen, ob es Sinn macht ihn erst im nächsten Jahr aufsteigen zu lassen, damit er noch<br />
ein Jahr Zeit hat sein Verhalten zu ändern und z.B. mehr Verantwortung in der Gruppe zu übernehmen,<br />
oder ob er gerade jetzt aufsteigen sollte, damit er als einer der Jüngeren in der nächsten<br />
Gruppe gezwungen ist sich in die Gruppe einzufügen. Die Entscheidung ist nicht einfach, und leider<br />
werden oft vor allem die organisatorischen Fragen wie z.B. Größe der Gruppen vor und nach dem<br />
Stufenwechsel betrachtet wobei in den Hintergrund rückt dass der Stufenwechsel ein zentrales pädagogisches<br />
Instrument ist, mit dem wir Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg fördern wollen.<br />
16 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Pfadfinderische Stilelemente und Prinzipien<br />
Anhaltspunkte<br />
Für die Entscheidung, wie viele und welche Mitglieder die Gruppe wechseln sollten sind folgende<br />
Fragen Anhaltspunkte:<br />
Welche Entwicklung hat der Einzelne in der Gruppe erfahren und welche Chancen hätte er in<br />
Wie alte ist der Einzelne und wie ist die Altersstruktur der Gruppe ?<br />
Sollten einige „Freunde“ zusammen aufsteigen oder gerade nicht, weil dann der Einzelne eine<br />
Chance hat aus der alten Rolle auszubrechen ?<br />
Gibt es überhaupt eine Gruppe, in die die Mitglieder aufsteigen können ? Manchmal gibt es nicht in<br />
allen Stufen Gruppen ?<br />
Wie ist die Altersstruktur in der älteren Gruppe ?<br />
Wie groß sind die beteiligten Gruppen nach dem Stufenwechsel ? Ist eine sinnvolle Arbeit noch<br />
möglich ?<br />
Durchführung des Stufenwechsels<br />
Nachdem geklärt ist welche Mitglieder die Gruppe/Stufe wechseln und eine möglichst einvernehmliche<br />
Lösung mit allen Beteiligten gefunden ist, wird der Stufenwechsel vorbereitet. Da er in der Regel<br />
alle Stufen betrifft, wird er meistens als Stammesaktion durchgeführt, es kann aber auch eine Aktion<br />
von nur zwei beteiligten Gruppen sein.<br />
Ein besonderer Rahmen bietet sich an, z.B. in Verbindung mit einer gemeinsamen Wanderung, einem<br />
Lager, einem Ausflug es kann aber auch ein Fest oder ein besonderer Gottesdienst sein. Wichtig ist,<br />
dass die beteiligten Gruppen und die Verabschiedung der Mitglieder aus der alten und die Aufnahme<br />
in die neue Gruppe im Mittelpunkt steht. Diese Aufnahme ist nicht zu verwechseln mit dem Versprechen,<br />
dass die aufgestiegenen Mitglieder in der neuen Gruppe frühestens in einigen Monaten ablegen<br />
werden.<br />
Der Stufenwechsel ist vor allem für Leiter eine Herausforderung, denn die Mitglieder, die man jetzt<br />
seit Jahren kennt und die in der Regel die Gruppe tragen verlassen sie nun, dafür kommen neue,<br />
jüngere die noch viel lernen müssen.<br />
4.2 Groß-Kleingruppe<br />
Ein typisches Kennzeichen pfadfinderischer Erziehung ist die Unterteilung der Gruppen in Kleingruppen.<br />
Das kann eine vorübergehende Einteilung zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe (z.B.<br />
im Rahmen eines Projektes oder einer Streife) sein oder eine dauerhafte Einteilung.<br />
Die Kleingruppe bietet den Mitgliedern einige Vorteile:<br />
Der Einzelne kann sich mit seinen Fähigkeiten besser einbringen. Da die Gruppe klein ist, kommt<br />
es auf jeden an, jeder wird gebraucht.<br />
Es ist leichter die eigenen Interessen zu vertreten. Man steht nicht gleich der großen Gruppe gegenüber.<br />
Die kleine Gruppe bietet die Möglichkeit sich besser kennen zu lernen und damit auch einen stärkeren<br />
Rückhalt.<br />
Die Kleingruppen, die nicht nur vorübergehend eingeteilt werden, bestehen üblicherweise über lange<br />
Zeit und die Mitglieder, die neu in eine Gruppe eintreten werden einer Kleingruppe zugeordnet. So<br />
bestehen die Kleingruppen oft über Jahre, auch wenn die ursprünglichen Mitglieder die Gruppe schon<br />
lange verlassen haben und neue Mitglieder aus der nächst jüngeren Stufe oder als Neu- und Quereinsteiger<br />
dazu gekommen sind.<br />
Für die Einteilung der Kleingruppen gibt es keine Patentrezepte. Wenn in einer Gruppe neue Kleingruppen<br />
eingeteilt werden müssen sich die Leiter evtl. auch mit den Kindern gut überlegen nach welchen<br />
Kriterien sie die Gruppen einteilen wollen. Mögliche Kriterien sind:<br />
Sollen die etwas Älteren und die etwas Jüngeren in verschiedene Gruppen, damit die Jüngeren<br />
mehr Chancen haben ihren eigenen Weg zu entdecken, oder gerade nicht, damit in beiden Gruppen<br />
die Jüngern von den Älteren lernen können ?<br />
Sollen die „Wilden“ von den „Braven“ getrennt sein, damit die „Braven“ nicht immer von den<br />
„Wilden“ dominiert werden, oder gerade nicht, damit diese Strukturen durchbrochen werden ?<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 17
Pfadfinderische Stilelemente und Prinzipien <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
Sollen die Gruppen nach Geschlechtern getrennt sein, damit sowohl die Mädchen als auch die<br />
Jungen einen gewissen Freiraum für ihre Interessen bekommen, oder sollen sie gerade gemischt<br />
sein, damit sie den Umgang miteinander im überschaubaren Feld der Kleingruppe leichter lernen<br />
können ?<br />
Sollen die „Besten Freunde“ zusammen in eine Kleingruppe, oder gerade nicht, damit sie auch mal<br />
Andere besser kennen lernen ?<br />
In jedem Fall ist es notwendig sich als Leitungsteam, die Gruppe sehr genau anzusehen und zu überlegen<br />
wo Defizite oder Probleme bestehen und in welche Richtung man gerne Chancen bieten und<br />
Veränderungen bewirken möchte. Deshalb kann es keine Regeln geben die immer auf alle Gruppen<br />
zutreffen, da jede Gruppe anders ist.<br />
Die Bezeichnungen für die Groß- und Kleingruppe sowie die Sprecher der Kleingruppensprecher ist<br />
bei jeder Stufe anders.<br />
Großgruppe Kleingruppe Kleingruppensprecher<br />
Wölflinge Meute Rudel Leitwolf<br />
Jungpfadfinder Trupp Sippe Kornett<br />
Pfadfinder Trupp Runde Rundensprecher<br />
Rover Runde Rundensprecher<br />
4.3 Fachleuteprinzip<br />
Das Fachleuteprinzip ist eng mit der Idee der Kleingruppen verknüpft. Die Idee ist für jedes Mitglied<br />
der Kleingruppe eine Aufgabe zu definieren und ihm die Verantwortung dafür zu übertragen. Das ist<br />
eine der wichtigsten Ideen von Baden Powell gewesen. Er hat, völlig im Gegensatz zu der zu seiner<br />
Zeit vorherrschenden Meinung, Jugendlichen Aufgaben und die Verantwortung für ihre Durchführung<br />
übertragen. Das dieses Prinzip mit Erwachsenen funktioniert, hatte er in seiner Militärzeit entdeckt.<br />
Seit seiner Zeit hat sich daran nicht allzu viel geändert. auch heute wird Kindern und Jugendlichen oft<br />
im Detail vorgeschrieben was sie zu tun oder zu lassen haben (z.B.: in der Schule) oder sie sollen<br />
zwar Verantwortung übernehmen, bekommen aber keinen Handlungsspielraum zugebilligt und vor<br />
allem keine Hilfestellung (ist nicht gleich Kontrolle!).<br />
Am Beispiel eines Jungpfadfindertrupps dessen Leben sich stark um Lager und Fahrt dreht können in<br />
einer Kleingruppe z.B.: Aufgaben sie die des Kornett (=Kleingruppensprecher), Materialwart,<br />
Kassenführer, Koch, 1.-Hilfe-Spezialist, Chronist (führt das Sippentagebuch) und viele mehr besetzt<br />
werden. Entscheidend ist, dass wirklich jeder eine Aufgabe hat, die ihn herausfordert, aber nicht überfordert<br />
und das Gefühl gibt dass es auf seine Mitarbeit ankommt. Durch die Zuteilung von solchen<br />
Aufgabenbereichen, vor allem im Rahmen von Lagern und Fahrten, entwickeln die Kinder und<br />
Jugendlichen ihre Fähigkeiten weiter und lernen Verantwortung für sich und die Kleingruppe zu übernehmen.<br />
4.4 Trupprat<br />
Der Trupprat (bzw. der Meuten- oder Roverrat) besteht aus den Sprechern der Kleingruppen und<br />
einem Vertreter des Leitungsteams. Im Trupprat ist das Nervenzentrum des Trupps. Hier werden Aktionen<br />
geplant und koordiniert sowie Entscheidungen der Gruppe vorbereitet. Arbeiten die Kleingruppen<br />
einer Gruppe gemeinsam an einem Projekt und haben sich die Aufgaben aufgeteilt so muss<br />
das koordiniert werden. Steht eine wichtige Entscheidung an, können im Trupprat mögliche Alternativen<br />
ausgelotet werden, bevor sie der ganzen Gruppe zur Entscheidung vorgelegt werden. Der<br />
Trupprat ist ein Instrument um die Mitglieder der Gruppe noch stärker in Entscheidungen einzubeziehen<br />
– nicht umsonst haben die Mitglieder gegenüber dem einen Leiter die Mehrheit.<br />
18 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Pfadfinderische Stilelemente und Prinzipien<br />
Wenn ein Leitungsteam eine bestimmte Idee in den Trupp einbringen möchte ist der Umweg über den<br />
Trupprat interessant. Was dort beschlossen wurde wird in der nächsten Gruppenstunde von den Kleingruppensprechern<br />
vertreten – das ist ein großer Unterschied zu der Situation in dem der Leiter der<br />
Gruppe eine Idee präsentiert.<br />
In einem guten Trupprat könne auch Probleme aus der Gruppe besprochen werden. In dem kleinen<br />
und vertrauten Rahmen ist es eher möglich offen und fair miteinander zu sprechen als in der ganzen<br />
Gruppe.<br />
Wenn jedoch der Eindruck entsteht, dass der Trupprat ein elitärer Kreis ist, der die Entscheidungen<br />
der Gruppe vorweg nimmt wird das Gegenteil erreicht. Hier gilt es den richtigen Mittelweg zwischen<br />
Motivation und Informationsvorsprung des Trupprates und Bevormundung der Großgruppe zu finden.<br />
Chancen und Risiken des Trupprates<br />
Nervenzentrum der Gruppe, Vorentscheidungen können leichter gefällt werden.<br />
Motivation der Kleingruppensprecher die sich auf die Kleingruppen übertragen kann.<br />
Möglichkeit für das Leitungsteam das Ohr näher an der Gruppe zu haben.<br />
Gefahr die Großgruppe zu bevormunden.<br />
4.5 Look at the boy/girl<br />
Pfadfinderische Erziehung setzt bei den Erwartungen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen<br />
an. Das Programm kommt aus der Gruppe selbst. Das ist einer der entscheidenden Punkte bei<br />
den Pfadfindern. Im Gegensatz zum Sportverein, dem Jugendrotkreuz oder der Jugendfeuerwehr, ist<br />
bei den Pfadfindern nicht auf den ersten Blick klar „Was man da so macht“. Die Leiter wissen zu unterscheiden<br />
zwischen den Erziehungszielen und dem Programm der Gruppe und den Methoden mit<br />
denen die Ziele Erreicht werden. Da das Programm aus der Gruppe kommt kann es sehr unterschiedlich<br />
aussehen und ist so vielfältig wie unsere Gruppen eben sind.<br />
Jede Gruppe ist anders und jedes Mitglied ist anders. Deshalb ist es eine besondere Aufgabe der<br />
Gruppenleiter sich immer wieder Zeit zu nehmen um sich „the boy“ und „the girl“ aber auch die<br />
Gruppe an sich anzusehen und sich darauf einzustellen. Baden-Powell hat das so beschreiben, dass<br />
Leiter „Boymen“ sein müssen, die einen Blick für die Interessen und Bedürfnisse der Kinder haben.<br />
Sie müssen ihre Methoden und Zwischenziele auf dem Weg der Erziehung zu selbstbewussten und<br />
verantwortungsvollen Menschen immer wieder an den aktuellen Stand des Einzelnen und der Gruppe<br />
anpassen. Auch dafür steht „Look at the boy/girl“.<br />
4.6 Versprechen<br />
Das Versprechen ist ein besonderes Element der pfadfinderischen Tradition. Es hat nichts mit einem<br />
Gelöbnis oder Eid zu tun sondern ist ein wichtiges Element um Kinder und Jugendliche in unseren<br />
Gruppen ernst zu nehmen.<br />
Das Versprechen beinhaltet 3 Punkte bzw. wendet sich in 3 Richtungen:<br />
Die Beziehung zu Gott<br />
Die Beziehung zu den Mitmenschen<br />
Die Beziehung zu mir selbst<br />
Baden Powell fordert, dass jeder Pfadfinder sich um die Beziehung zu Gott entsprechend seiner Religion<br />
kümmert, er lässt bewusst offen welche Religion das ist.<br />
Die Beziehung zu den Mitmenschen ist vor allem auf die Pfadfindergruppe bezogen in der der Einzelne<br />
steht. Deshalb wird das Versprechen auch nach jedem Stufenwechsel gegenüber der (neuen)<br />
Gruppe abgelegt. Natürlich sind aber Pfadfinder nicht nur ihrer eigenen Gruppe gegenüber freundlich<br />
gesonnen sondern sehen sich als Brüder und Schwestern aller Pfadfinder –weltweit und als Freunde<br />
aller Menschen.<br />
Die Beziehung gegenüber mir selbst bezieht sich auf die Ziele die ich mir gesteckt habe. Hier kommt<br />
das Pfadfindergesetz bzw. die Leitlinien ins Spiel. Wer sein Versprechen ablegt hat sich vorgenommen<br />
sich an dieser Richtschnur zu orientieren und ist vor allem sich selbst dafür verantwortlich.<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 19
Pfadfinderische Stilelemente und Prinzipien <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
Wer durch den Stufenwechsel oder ganz neu in eine Gruppe kommt legt das Versprechen nicht sofort<br />
ab. Üblich ist ein Zeitraum von ½ bis 1 Jahr, in dem der Neue die Chance hat sich in die Gruppe<br />
einzufinden und zu entscheiden ob er wirklich dazugehören möchte. Pfadfinder wollen Kinder und<br />
Jugendliche nicht für ihre Gruppen überreden sondern ihnen nach einer gewissen Zeit die ehrliche<br />
Frage stellen ob sie mitmachen wollen. Hierbei kann es vorkommen, dass jemand merkt, dass das<br />
nicht das Richtige für ihn ist oder das Leitungsteam entscheidet, dass er noch etwas warten sollte. In<br />
jedem Fall wollen wir dem Einzelnen die Möglichkeit einer bewussten Entscheidung bieten.<br />
Der alte von Baden-Powell überlieferten Text oder andere abgedruckte Texte sind dabei eine Hilfe,<br />
müssen aber nicht so übernommen werden. Entscheidend ist nicht der Wortlaut.<br />
Um den persönlichen Charakter des Versprechend zu unterstreichen suchen sich viele noch einen<br />
Punkt heraus, der ihnen besonders wichtig ist oder von dem sie wissen dass sie hier an sich arbeiten<br />
wollen (z.B.: „Keinen Streit anfangen“, „Hilfsbereit sein“, ...).<br />
Auch wenn große Massenversprechen beeindruckend sind, treffen sie nicht den Kern des Pfadfinderversprechens.<br />
Im Idealfall legt der „Neue“ das Versprechen gegenüber seiner Gruppe ab.<br />
5 Religiöse Themen<br />
„Es gibt keine religiöse Seite der Bewegung. Das Ganze basiert auf Religion, das heißt, auf der Erkenntnis<br />
Gottes und des Dienstes an ihm“ (Baden Powell)<br />
Die Pfadfinderbewegung ist zwar nicht an eine bestimmte Religion oder Konfession gebunden, Baden<br />
Powell sieht die Beziehung des Einzelnen zu Gott jedoch als so wichtig an, dass sie einer drei Punkte<br />
des Pfadfinderversprechens ist.<br />
Im Leben der Gruppen ergeben sich vor allem die folgenden drei Ansatzpunkte um religiöse Werte<br />
und Inhalte zu vermitteln.<br />
Religiöse Elemente im Alltag der Gruppe etablieren (z.B. Morgenrunden)<br />
Kind- bzw. jugendgerechte Gestaltung von Religiösen Elementen (z.B. Gottesdienste)<br />
Leben aus dem Glauben begründen (z.B. Aktionen gegen Fremdenfeindlichkeit)<br />
5.1 Religiöse Elemente<br />
Vor allem auf Fahrten und während Lagern viele Möglichkeiten religiöse Elemente einzubauen.<br />
Dabei geht es nicht darum besonders viele oder besonders „heilige“ Aktionen durchzuführen, sondern<br />
die Beziehung zu Gott in den Alltag miteinzubeziehen.<br />
Morgenrunden bieten die Möglichkeit, den Tag gemeinsam als Gruppe und mit Gott zu beginnen.<br />
Meist wird ein bestimmter Gedanke, passend zum Programm des Tages oder zur Situation der Gruppe<br />
in den Mittelpunkt gestellt. Das kann z.B.: der Lagerauf- oder –abbau oder der Hike sein, aber auch<br />
eine schwierige Situation in der Gruppe kann das Thema sein. Je nach Teilnehmerkreis kann die<br />
Morgenrunde aus Texten, Liedern, Aktionen oder Spielen bestehen die den Gedanken verdeutlichen.<br />
Abendrunden bieten die Möglichkeit den Tag bzw. das „offizielle Programm“ gemeinsam zu beenden.<br />
Dabei kann ein Gedanke zur Nach und/oder ein kurzer Rückblick auf den Tag im Mittelpunkt<br />
stehen.<br />
Tischgebete markieren den gemeinsamen Beginn des Essens und erinnern daran, dass es nicht selbstverständlich<br />
ist, dass wir etwas zu Essen auf dem Tisch haben – auch wenn wir das im Alltag leicht<br />
vergessen.<br />
Gebete sind nicht zwangsläufig Texte die man aus Büchern vorliest. Die besten Gebete entstehen<br />
spontan aus der Situation heraus. Das kann die Freude über einen schönen Tag, die Sorge um eine<br />
vermisste Gruppe auf dem Hike oder sonst ein Anliegen der Gruppe sein.<br />
Gottesdienste können nur als Wortgottesdienste oder mit Eucharistiefeier gestaltet werden – welche<br />
Form geeigneter ist hängt von der Situation und vor allem von der Gruppe ab. Wichtig ist, dass die<br />
Teilnehmer keine Zuschauer bleiben, an denen das Geschehen vorbei geht. Je nach Alter können die<br />
20 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Religiöse Themen<br />
Teilnehmern miteinbezogen werden. Das reicht z.B. von der Vorstellung von Ergebnissen bei einem<br />
religiösen Wochenende bis zum Ersatz der Predigt durch ein Gespräch bei kleinen Gruppen.<br />
Lagerkreuz – Wo Pfadfinder ihr Lager aufschlagen, dort werden meist auch Lagerbauten errichtet,<br />
dazu gehört auch ein Lagerkreuz an dem das DPSG-Banner und das Weltbundbanner im Wind<br />
flattern. Es ist für uns selbst und für andere ein Zeichen, dass wir auf dem Lager als Pfadfinder Geist<br />
von Jesus Christus zusammenleben wollen.<br />
Lageraltar – Manchmal wir auch ein Altar für den Gottesdienst errichtet. Ein Lageraltar ist ein<br />
besonders schönes Symbol dafür, dass wir Pfadfinder Gott mit uns wissen, egal wo wir gerade unterwegs<br />
sind und eben nicht nur in der Kirche beim üblichen Sonntagsgottesdienst.<br />
5.2 Kinder- und jugendgerechte Gestaltung der religiösen Elemente<br />
Egal ob Morgenrunde, Abendrunde oder Gottesdienst – wichtig ist es sich zu überlegen, was die<br />
zentrale Aussage sein soll – was die Teilnehmer mitnehmen sollen. Wenn das Thema nichts mit der<br />
Gruppe, der Aktion oder der Situation zu tun hat, geht der Anstoß leicht an den Teilnehmern vorbei.<br />
Das ist dann der Effekt des „typischen langweiligen Gottesdienstes“ wie ihn viele Kinder und Jugendliche<br />
erleben und nicht besonders schätzen. Deshalb sollte man die folgenden Schritte beachten:<br />
Suche nach dem zentralen Thema/Anstoß/Gedanken, den man den Teilnehmern mitgeben möchte.<br />
Dieser Gedanke sollte etwas mit der Gruppe zu tun haben und sich auf das Programm des Tages, die<br />
Situation der Gruppe oder das Thema der Aktion beziehen.<br />
Blick auf die Gruppe und Suche nach Methoden und Formen die zur Gruppe und zum Thema passen.<br />
Miteinbeziehen der Teilnehmer, damit sie nicht nur Zuschauer, sondern Beteiligte werden.<br />
5.3 Leben aus dem Glauben begründen<br />
Viele Aktionen, die wir als Pfadfinder durchführen, lassen sich aus unserem christlichen Welt- und<br />
Menschenbild begründen. Wenn wir diese Beziehung deutlich machen wird der Begriff „Leben aus<br />
dem Glauben“ nachvollziehbar. Eine Kinderrallye gegen Rechtsradikalismus oder eine Aktion wie<br />
„72 Stunden“ haben sehr viel mit dem „Leben aus dem Glauben“ zu tun.<br />
Auch viele typisch Pfadfinderischen Elemente lassen sich aus dem Menschenbild das uns Jesus Christus<br />
vorgelebt hat erklären. Das Pfadfinderversprechen z.B.: zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass<br />
wir Kinder- und Jugendliche ernst nehmen und ihre Entscheidung respektieren.<br />
6 Strukturen der DPSG<br />
Die Ordnung der DPSG stellt eine inhaltliche Grundlage unserer Arbeit dar, die Satzung regelt die<br />
Strukturen. Die Beschreibung der Strukturen in der Satzung ist wichtig, damit klar ist wie die DPSG<br />
organisiert ist und wer wofür verantwortlich ist. Kurz: Die Satzung beschreibt die Strukturen, die notwendig<br />
sind um die Werte und Inhalte der Ordnung zu garantieren – ohne unseren in der Satzung beschriebenen<br />
demokratischen Aufbau wäre die Mitbestimmung nicht sichergestellt.<br />
Regional ist die DPSG in die sogenannten Ebenen gegliedert. Die Stämme bilden Bezirke, die bilden<br />
Diözesanverbände und diese wiederum den Bundesverband. Da unsere Gruppen nach Altersstufen<br />
(Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover) unterschieden werden findet sich diese Einteilung<br />
ebenfalls auf allen Ebenen wieder.<br />
Die nachfolgende Darstellung ist leicht vereinfacht um den Überblick zu wahren. Details sind der jeweils<br />
gültigen Satzung der DPSG zu entnehmen.<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 21
Strukturen der DPSG <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
6.1 Die (Alters-) Stufen<br />
Im Stamm werden die Gruppen nach dem Alter der Mitglieder in die 4 Stufen<br />
Wölflinge (8-10),<br />
Jungpfadfinder (11-13),<br />
Rover<br />
Pfadfinder (14-16) und<br />
Pfadfinder<br />
Rover (17-20))<br />
unterschieden. Auch auf den anderen drei Ebenen finden Jungpfadfinder sich<br />
die Stufen in den Strukturen wieder. Hauptanliegen der<br />
ist es das Programm, die Pädagogik und die Ausbildung der<br />
Wölflinge<br />
Stufen<br />
Leiter an<br />
die entsprechende Altersstufe anzupassen. Deshalb wandern die Mitglieder im Lauf der Zeit durch die<br />
Stufen, während die Leiter und Referenten, in ihrer Stufe verbleiben.<br />
In der DPSG können Anliegen oft über die „Ebenenschine“ oder die „Stufenschine“ eingebracht<br />
werden. Z.B. kann ein Jufileiter, der etwas im Bezirk bewegen will, das über seinen Stammesvorsitzenden<br />
in die Bezirksversammlung einbringen oder über die Stufenkonferenz der Jufistufe, die<br />
wiederum 2 Vertreter in die Bezirksversammlung schickt.<br />
6.2 Die Ebenen<br />
Die DPSG auf vier Ebenen organisiert. Die Gruppen an einem Ort<br />
bilden zusammen einen Stamm. Die Stämme eines bestimmten Ge-<br />
Bundesebene<br />
bietes bilden zusammen einen Bezirk. Die Bezirke die in einer Diözese<br />
(= Organisationseinheit der katholischen Kirche) liegen bilden zusammen<br />
einen Diözesanverband. Diese bilden wiederum zusammen<br />
Diözesanebene<br />
Bezirksebene<br />
den Bundesverband.<br />
Da nur auf der Stammesebene Gruppen mit Kindern und Jugendlichen<br />
Stammesebene<br />
existieren unterscheidet sich die Stammesebene im Aufbau ein wenig von der Bezirks-, Diözesan- und<br />
Bundesebene.<br />
6.3 Der Stamm<br />
Der Stamm ist die unterste Ebene, was aber nicht bedeutet dass er die unwichtigste Ebene wäre. Die<br />
entscheidende Arbeit der DPSG – die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in den Gruppen –<br />
findet im Stamm statt – geleistet von den Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern vor Ort. Der Stamm<br />
fasst alle Gruppen an einem Ort, meist einer Pfarrgemeinde, manchmal auch einer Schule, zusammen.<br />
Ein Stamm hat mindestens zwei Gruppen (in unterschiedlichen Altersstufen), üblicherweise eine<br />
Gruppe pro Altersstufe und manchmal auch mehrere Gruppen pro Altersstufe.<br />
Alle Gruppenleiter eines Stammes bilden zusammen die Stammesleiterrunde. Dort werden vor allem<br />
pädagogische und inhaltliche Fragen die die Gruppen betreffen besprochen, sie ist Ort für die Ausund<br />
Weiterbildung der Leiter und den Austausch untereinander.<br />
Geleitet wird ein Stamm durch den Stammesvorstand (Stammesvorsitzende(r), Stammesvorsitzende<br />
(r), Stammeskurat). Der Stammesvorstand bildet zusammen mit je einem Sprecher eines jeden<br />
Leitungsteams und dem Vorsitzenden des Elternbeirates die Stammesleitung, die vor allem Aktionen<br />
des Stammes organisiert. Kurz gefasst ist die Stammesleiterrunde für inhaltliche und die Stammesleitung<br />
für organisatorische Arbeit zuständig.<br />
Die Stammesleitung, erweitert durch je zwei Sprecher der Stufen (Mitglieder, nicht Leiter) und den<br />
Stellvertreter des Elternbeirates bildet die Stammesversammlung. Die Stammesversammlung ist das<br />
mächtigste Gremium im Stamm, entscheidet über die Vorhaben und Aktionen des Stammes, nimmt<br />
den Bericht der Stammesleitung entgegen und wählt den Stammesvorstand.<br />
22 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Strukturen der DPSG<br />
Zusammenspiel der Organe des Stammes<br />
Wer hat die Mach im Stamm? Das ist einfach: Die Stammesversammlung. Sie stellt das Gremium dar<br />
in dem alle Teile des Stammes (Vorstand, Leitungsteams, Eltern und Mitglieder) vertreten sind. Für<br />
die praktische Arbeit unter dem Jahr ist der Stammesvorstand verantwortlich, der von der Versammlung<br />
gewählt wird und ihr gegenüber jedes Jahr Rechenschaft ablegen muss. Die Leiter werden vom<br />
Vorstand berufen und haben sozusagen Ministerstatus. Dass der Vorstand, und nicht etwa die Leiterrunde,<br />
darüber entscheidet wer Leiter ist und wer nicht, ist damit nur logisch, denn der Vorstand hat<br />
trägt gegenüber der Versammlung die Verantwortung für die Arbeit in den Gruppen und delegiert sie<br />
an Menschen die er für geeignet hält, eben die Leiter. Läuft etwas nicht so, wie er es für richtig hält<br />
muss er handeln.<br />
Organe des Stammes im Überblick<br />
Organ Mitglieder Aufgaben<br />
Stammesvorstand 2 Vorsitzende (je m/w)<br />
+ Kurat<br />
Stammesleitung Stammesvorstand<br />
+ je ein Leiter pro Leitungsteam<br />
+ Elternbeiratsvorsitzender<br />
Stammesversammlung Stammesleitung<br />
+ je 2 Delegierte der Stufen (= keine<br />
Leiter)<br />
+ Stellvertreter des Elternbeiratsvorsitzenden<br />
Stammesleiterrunde Stammesvorstand<br />
+ alle Leitungsteams<br />
+ ggf. Fachreferenten<br />
Ausführlich steht das in der Satzung des Verbandes.<br />
Leitung und Vertretung des Stammes<br />
Berufung der Leiter und Fachrefe-<br />
renten<br />
Organisation und Durchführung<br />
der Aktionen des Stammes<br />
Koordination der Stufen<br />
Wahl des Vorstandes und<br />
Rechtsträgers<br />
Entgegennahme der Berichte und<br />
Entlastung<br />
Beschlussfassung über Aktionen<br />
des Stammes<br />
Erfahrungsaustausch<br />
Auseinandersetzung mit den<br />
Zielen des Verbandes<br />
Aus- und Weiterbildung<br />
6.4 Der Bezirk, der Diözesanverband und der Bundesverband<br />
Ein Bezirk besteht aus mehreren Stämmen. Es können nur wenige (z.B.: vier) sein, aber auch deutlich<br />
mehr. Die Grenzen der Bezirke werden so festgelegt, dass eine möglichst sinnvolle Menge von Stämmen<br />
zusammenkommt. So wurden vor einigen Jahren z.B. die Bezirke Mannheim (4 Stämme) und<br />
Bergstraße (5 Stämme) zum Bezirk Mannheim-Bergstraße zusammengelegt.<br />
Der Diözesanverband besteht aus mehreren Bezirken, wobei es auch die Ausnahme von Diözesanverbänden<br />
ohne Bezirksstruktur (z.B.: Berlin) gibt, wenn die Anzahl der Stämme zu klein ist um Bezirke<br />
zu bilden. Die Grenzen des Diözesanverbandes sind identisch mit den Grenzen der katholischen<br />
Diözesen in Deutschland.<br />
Im Bundesverband sind alle Diözesanverbände von Deutschland zusammengefasst.<br />
Der Vorstand<br />
Auf allen Ebenen der DPSG gibt es einen Vorstand, der aus 3 gewählten Mitgliedern besteht. Es gibt<br />
(im Gegensatz zur Stammesebene) jeweils einen Vorsitzenden (m), eine Vorsitzende (w) und einen<br />
Kuraten. Der Vorstand wird von der entsprechenden Versammlung der Ebene gewählt, ist ihr gegenüber<br />
für die entsprechende Ebene verantwortlich und muss einmal im Jahr an die Versammlung berichten.<br />
Der Vorstand beruft die Stufen- und Fachreferenten.<br />
Die Leitung<br />
Die Bezirksleitung, Diözesanleitung oder Bundesleitung besteht aus dem Vorstand sowie den Stufen<br />
und Fachreferenten. Der Vorstand beruft Stufenreferenten die in seinem Auftrag die Arbeit der jeweiligen<br />
Stufe koordinieren und Fachreferenten (z.B.: „Aus- und Weiterbildung“ oder „Vertretung im<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 23
Strukturen der DPSG <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
BDKJ“) die für ein entsprechendes Fachgebiet zuständig sind. Genau wie die Leiter im Stamm sind<br />
die Referenten an den Vorstand gebunden und werden nicht gewählt, da sie im direkten Auftrag des<br />
Vorstandes aktiv werden und einen Teil der Aufgaben, für die der Vorstand verantwortlich ist übernehmen.<br />
In den Stufen können noch Stufenkuraten berufen werden, die ebenfalls Mitglieder der Leitung sind.<br />
Oft haben Referenten noch einen Kreis von Mitarbeitern, mit denen sie die Aufgaben zusammen erledigen,<br />
das ist dann der entsprechende Arbeitskreis.<br />
Die Versammlung<br />
Die Bezirks-, Diözesan- und Bundesversammlung ist das mächtigste Gremium auf der jeweiligen<br />
Ebene. In der Bezirksversammlung sitzen die Vorstände der Stämme und die Delegierten der Stufen<br />
sowie die Bezirksleitung. Diözesan- und Bundesversammlung sind entsprechend organisiert. Entscheidend<br />
ist, dass die Versammlung den Vorstand der jeweiligen Ebene wählt, den Bericht entgegen<br />
nimmt und ggf. entlastet. Außerdem ist die Versammlung für weitreichende Entscheidungen auf der<br />
jeweiligen Ebene zuständig.<br />
Die Stufenkonferenzen<br />
Die Stufenkonferenzen haben keine direkte Entsprechung auf der Stammesebene, sie könnten am ehesten<br />
mit den Gruppen verglichen werden. Auf der Konferenz treffen sich die Leiter / Referenten einer<br />
bestimmten Altersstufe mit dem entsprechenden Referenten der übergeordneten Ebene. In den Stufenkonferenzen<br />
treffen sich<br />
auf Bezirksebene die Leiter einer Stufe aus dem Bezirk mit dem Bezirksreferenten,<br />
auf Diözesanebene die Bezirksreferenten einer Stufe aus der Diözese mit dem Diözesanreferenten<br />
und<br />
auf Bundesebene die Diözesanreferenten einer Stufe mit dem Bundesreferenten.<br />
Die Stufenkonferenzen im Bezirk müssen mindestens 2 mal im Jahr stattfinden, meist treffen sich die<br />
Leiter aber öfter um gemeinsame Aktionen oder Veranstaltungen vorzubereiten.<br />
Die Bezirksstufenkonferenzen können 2 Delegierte in die Bezirksversammlung schicken und werden<br />
vom Bezirksreferenten in der Diözesanstufenkonferenz vertreten.<br />
Organ Mitglieder Aufgaben<br />
Vorstand Vorsitzende (w)<br />
+ Vorsitzender (m)<br />
+ Kurat<br />
Leitung Vorstand<br />
+ je ein Referent pro Stufe<br />
+ je ein Kurat pro Stufe<br />
+ Fachreferenten (Behindertenarbeit,<br />
Entwicklungsfragen und interkulturelles<br />
Lernen)<br />
Versammlung Vorstand<br />
+ je ein Referent pro Stufe<br />
+ je ein Kurat pro Stufe<br />
+ je 2 Delegierte der Stufenkonferenzen<br />
+ die Vorstände der untergeordneten<br />
Ebene<br />
Leitung und Vertretung der Ebene,<br />
Berufung der Stufen- und Fach-<br />
referenten<br />
Organisation und Durchführung<br />
der Aktionen der Ebene<br />
Koordination der Stufen<br />
Wahl des Vorstandes und<br />
Rechtsträgers<br />
Entgegennahme der Berichte und<br />
Entlastung<br />
Beschlussfassung über Aktionen<br />
des Stammes<br />
24 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Strukturen der DPSG<br />
Organ Mitglieder Aufgaben<br />
Stufenkonferenz 1 Mitglied des Vorstandes<br />
+ Stufenreferent u. Stufenkurat<br />
+ 2 Mitglieder des Arbeitskreises<br />
+ je ein Mitglied der Leitungsteams bzw.,<br />
die Referenten der untergeordneten<br />
Ebenen.<br />
+ (bei Bez. Roverkonf.) je ein Rover pro<br />
Roverrunde<br />
Bezirksversammlung<br />
Bezirksleitung<br />
Bezirksvorstand<br />
Bezirksvorsitzende<br />
Bezirksvorsitzender<br />
Bezirkskurat<br />
Bezirksreferent Wölflingsstufe<br />
Bezirkskurat Wölflingsstufe<br />
Bezirksreferent Jungpfadfinderstufe<br />
Bezirkskurat Jungpfadfinderstufe<br />
Erfahrungsaustausch<br />
Koordinierung der Arbeit in der<br />
Stufe<br />
Organisation gemeinsamer Aktionen<br />
Aus- und Weiterbildung<br />
Bezirksreferent Pfadfinderstufe<br />
Bezirkskurat Pfadfinderstufe<br />
Bezirksreferent Roverstufe<br />
Bezirkskurat Roverstufe<br />
Stammesvorstand A Stammesvorstand B Stammesvorstand C<br />
2 Delegierte der Wölflingsstuko 2 Delegierte der Roverstuko<br />
2 Delegierte der Jufistuko 2 Delegierte der Pfadfistuko<br />
Bezirkskonferenz Wölflingsstufe<br />
1 Vertreter des Bezirksvorstands<br />
Bezirksreferent Wölflingsstufe<br />
Bezirkskurat Wölflingsstufe<br />
2 Mitglieder des Bezirks Wö-AK<br />
Je 1 Vertreter der Wölflingsleitungsteams<br />
aus den Stämmen<br />
Bezirkskonferenz Jufistufe<br />
1 Vertreter des Bezirksvorstands<br />
Bezirksreferent Jufistufe<br />
Bezirkskurat Wölflingsstufe<br />
2 Mitglieder des Bezirks Jufi-AK<br />
Je 1 Vertreter der Jungpfadfinderleitungsteams<br />
aus den Stämmen<br />
Bezirkskonferenz Pfadfinderstufe<br />
1 Vertreter des Bezirksvorstands<br />
Bezirksreferent Pfadfinderstufe<br />
Bezirkskurat Pfadfinderstufe<br />
2 Mitglieder des Bezirks Pfadi-AK<br />
Je 1 Vertreter der Pfadfinderleitungsteams<br />
aus den Stämmen<br />
Bezirkskonferenz Roverstufe<br />
1 Vertreter des Bezirksvorstands<br />
Bezirksreferent Roverstufe<br />
Bezirkskurat Roverstufe<br />
2 Mitglieder des Bezirks Ro-AK<br />
Je 1 Vertreter der Roverleitungsteams<br />
aus den Stämmen<br />
Je 1 Rover aus jeder Roverrunde<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 25
Geld und Zuschüsse <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
7 Geld und Zuschüsse<br />
Über Geld und Zuschüsse werden eigene Arbeitshilfen angeboten. Wichtig ist jedoch für jeden<br />
Gruppenleiter einen Überblick zu haben von welchen Stellen Zuschüsse zu bekommen sind und was<br />
Bezuschusst wird.<br />
Grundsätzlich gibt vor allem 3 Quellen für Zuschüsse:<br />
Die katholische Kirche<br />
Die Stadt Mannheim bzw. den Kreis Weinheim<br />
Das Land Baden-Württemberg<br />
Darüber hinaus gibt es noch weitere Quellen wie z.B. den Bund.<br />
Da sich die Richtlinien zu den Zuschüssen häufig ändern ist es ratsam sich jeweils aktuell zu informieren.<br />
In den meisten Stämmen hat sich jemand auf dieses Thema spezialisiert und hilft den Leitern<br />
mit Detailinformationen weiter. Anfragen können auch an das Diözesanbüro gerichtet werden.<br />
Manche Zuschüsse können nach einer Veranstaltung beantragt werden, dafür ist in der Regel eine<br />
Teilnehmerliste die von allen Teilnehmern unterschrieben wurde nötig und manche Zuschüsse müssen<br />
bereits lange vorher beantragt werden – deshalb ist es wichtig sich rechtzeitig über Zuschussmöglichkeiten<br />
zu informieren.<br />
Katholische Kirche<br />
Zuschüsse der Kirche werden im „Kirchlichen Jugendplan“ geregelt. Vergeben werden die Zuschüsse<br />
vom Erzbischöflichen Jugendamt in Freiburg dort bekommt man auch nähere Informationen zu den<br />
Zuschüssen.<br />
Stadt Mannheim und Kreis Weinheim<br />
Die Zuschüsse der Stadt Mannheim und des Kreis Weinheim werden über den Stadtjugendring Mannheim<br />
und den Kreisjugendring Weinheim vergeben. Die Jugendringe sind Zusammenschlüsse der<br />
Jugendverbände in einer Stadt oder einem Kreis über die politischen und konfessionellen Grenzen<br />
hinweg. Die Mitglieder reichen von der Sportjugend bis zur Gewerkschaftsjugend und von der DPSG<br />
bis zur Jüdischen Gemeindejugend.<br />
Das Land Baden-Württemberg<br />
Das Land fördert die Jugendarbeit über den „Landesjugendplan“. Er regelt was bezuschusst wird.<br />
8 Pfadfindergeschichte<br />
8.1 Übersicht<br />
Die Geschichte der Pfadfinderbewegung ist natürlich eng mit dem Leben unseres Gründers Baden Powell<br />
verknüpft und genauso ist die Geschichte der DPSG mit der der Pfadfinderbewegung als ganzes<br />
verknüpft. Dennoch lassen sich die meisten Ereignisse Baden-Powell, der Weltpfadfinderbewegung<br />
oder der DPSG zuordnen um einen Überblick zu bekommen.<br />
Datum Bezug Ereignis<br />
22.2.1857 BP BP wird in London geboren<br />
1859 BP BPs Vater stirbt<br />
1870 BP Eintritt in die Charterhouse Schule, BP entdeckt den "Zauber der<br />
Waldläuferkunst"<br />
1876 BP Eintritt in die militärische Laufbahn und Übersiedlung nach Indien<br />
1884 - 1885 BP BP reist mit seinem Regiment über Südafrika zurück nach England<br />
1895 BP Teilnahme am Ashantifeldzug und Gefangennahme des Königs<br />
Pempreh<br />
1899 - 1900 BP 7 Monate Verteidigung des belagerten Mafeking in Südafrika. BP<br />
wird zum General ernannt.<br />
1900 BP BP Veröffentlicht "Aids to Scouting" ein Handbuch für Soldaten<br />
26 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Pfadfindergeschichte<br />
Datum Bezug Ereignis<br />
1902 - 1903 BP Organisation der Südafrikanischen Polizei.<br />
1907 Weltbund Erstes Pfadfinderlager auf Brownsea Island<br />
1908 Weltbund BP schreibt „Scouting for Boys“<br />
1909 Deutschland Erste Pfadfindergruppen auf deutschem Boden<br />
1909 Weltbund 1. Jamboree mit 11.000 Teilnehmern im Crystal-Palace<br />
in London. Unter ihnen die ersten Pfadfinderinnen.<br />
1910 BP Austritt aus dem Militärischen Dienst<br />
1912 BP BP heiratet Olave St. Claire Soames<br />
1914 Deutschland In Deutschland gibt es 110.000 Pfadfinder in zahlreichen<br />
Splittergruppen<br />
1914 - 1918 1. Weltkrieg<br />
1916 Weltbund Eröffnung der Wolfs- und Pfadfinderbewegung<br />
1919 Weltbund Eröffnung der Roverbewegung<br />
1920 Weltbund Erstes World Jamboree, BP wird zum ersten und einzigen „Chief<br />
Scout of the world“ ausgerufen.<br />
1924 Weltbund 2. Jamboree in Kopenhagen mit 50.000 Teilnehmer aus 34 Nationen.<br />
07.10.1929 DPSG Gründung der DPSG mit 800 Mitgliedern in Altenberg<br />
1929 BP Jamboree bei Birkenhead, BP wird zu Lord of Gillwell geadelt. Begin<br />
der Woodbadge-Ausbildung.<br />
1933 Weltbund 4. Jamboree in Ungarn unter Beteiligiung deutsche Pfadfinder.<br />
1937 Weltbund 5. Jamboree in Vogelzang in den Niederlanden. BP verabschiedet<br />
sich von den Pfadfindern.<br />
1938 BP BP wandert nach Kenia aus.<br />
1938 DPSG Verbot der DPSG „Zum Schutz von Volk und Staat“<br />
08.01.1941 BP BP stirbt im Alter von 83 Jahren in Nyeri nahe Nairobi in Kenia<br />
1939- 1945 2. Weltkrieg<br />
1947 DPSG Nach dem Krieg bereits wieder 282 Stämme und 10000 Mitglieder<br />
1949 Deutschland Gründung des „Ring deutscher Pfadfinderverbände“ aus DPSG,<br />
dem evangelischen CPD und dem überkonfessionellen BDP<br />
1950 Deutschland Aufnahme des „Ring deutscher Pfadfinderverbände“ in den Weltbund<br />
der Pfadfinder<br />
1954 DPSG DPSG ist Mitgründer der Internationalen Konferenz des kath. Pfadfindertums<br />
1958 Weltbund Erstes Jamboree on the air (Jamboree per Amateurfunk)<br />
1961 DPSG Zum Flinke Hände, flinke Füße<br />
1971 DPSG DPSG nimmt auch Mädchen und Frauen auf und beschreibt sich als<br />
koedukativer Verband. DPSG beschließt die Leitlinien<br />
1977 BP Olave, Lady Baden Powell stirbt in Surrey (England)<br />
1979 DPSG 50 Jahre DPSG<br />
1984 Weltbund Die Weltorganisation erhält den Friedenspreis der UNESCO<br />
1990 DPSG Für Bezirks-, Diözesan- und Bundesvorstände wird die<br />
weiblich/männliche Besetzung vorgeschrieben<br />
1994 DPSG Solidaritätsaktion mit Rwanda und Aufnahme von 20 bedrohten<br />
Pfadfindern in Deutschland<br />
1996 DPSG Das Stimmrecht der Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover<br />
auf der Stammesversammlung wird eingeführt<br />
1996 Weltbund Erstes Jamboree in the Internet<br />
1997 DPSG Power im Park - Großveranstaltung im Eisenhüttenwerk in Duisburg<br />
zum politischen Handeln<br />
2001-2003 DPSG Update Perspektiventwicklungsprozess und Up2Date Kongress<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 27
Pfadfindergeschichte <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
8.2 Das Leben Baden-Powells<br />
Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (BP) wurde am 22. Februar 1857 als fünftes von sieben<br />
Geschwistern geboren. Er kam aus gutem Hause. Sein Vater war Theologieprofessor. Zu seinen<br />
Vorfahren gehörte unter anderen auch Georg Stephenson, der Erfinder der Dampfmaschine. BPs<br />
Vater starb, als er 4 Jahre alt war. Trotz des frühen Todes seines Vaters war genügend Geld vorhanden.<br />
Baden-Powell machte als Kind viele Exkursionen mit seinen größeren Brüdern, z.B. Fischen,<br />
zelten, Kanu fahren... .<br />
Die Privatschule, die er in London besuchte, wurde von BPs Großvater bezahlt. BP war kein guter<br />
Schüler. Er hielt sich lieber in der Natur auf, versteckte sich vor den Lehrern in den Wäldern rund um<br />
die Schule, fing Kaninchen und briet sie. Bei den Schlägereien zwischen den Internatsschülern und<br />
den Metzgergesellen bewies er zum ersten Mal taktisches Geschick, als er den Schülern durch einen<br />
Lehrer eine Tür öffnen ließ, um die Metzgergesellen von der Seite aus anzugreifen und zu schlagen.<br />
1876 Nach der Schule bewarb er sich um einen Studienplatz in Oxford, bestand aber die Aufnahmeprüfung<br />
nicht.<br />
Ein Verwandter besorgte ihm die Möglichkeit beim Militär unterzukommen. Dort bestand er die Aufnahmeprüfung<br />
als Zweitbester von 700 Teilnehmern. Daraufhin bekam er sofort ein Offizierspatent in<br />
einem berühmten Regiment und wurde nach Bombay in Indien versetzt. In dieser Ecke der Welt (Afghanistan,<br />
Indien, Russland, Nepal) war es auch schon zu BPs Zeiten politisch brisant. Nach Feierabend<br />
und in der Freizeit gab es nicht viel Abwechslung und Zerstreuung für Soldaten und Offiziere.<br />
Die Offiziere gingen auf die Wildschweinjagd. (Darüber schrieb BP auch ein Buch).<br />
BP führte Theateraufführungen ein, bei denen er selbst mitspielte. Dies tat er, um die Moral der<br />
Truppe zu heben und ein Alternativprogramm zum Rumhängen und Saufen zu schaffen. BP hat im<br />
Militärischen Bereich einiges gelernt und er hat das damalige militärische System umgebaut. Er formte<br />
aus großen unbeweglichen Regimentern kleine Einheiten. Diese Einheiten sollten eigenverantwortlich<br />
entscheiden und handeln.<br />
Nach seinem Aufenthalt in Indien war BP in mehreren Afrikanischen Ländern eingesetzt, die zu seiner<br />
Zeit britische Kolonien waren.<br />
1884 war er Leiter einer Geographischen Expedition im Zululand. Anschließend wurde er als Nachrichtenoffizier<br />
für die Mittelmeerländer eingesetzt.<br />
1889 war BP in Ghana eingesetzt zum Brückenbau. Hier beobachtet er bei fähigen Eingeborenen, dass<br />
sie ein Erkennungszeichen untereinander hatten. Sie gaben sich die linke Hand, ganz so wie es heute<br />
noch die Pfadfinder tun.<br />
1895 wird BP nach Westafrika versetzt, um an einem Straffeldzug gegen die Ashanti teilzunehmen.<br />
Hier entsteht das aus der Praxis gewonnene Hilfsbuch für Kundschafter. "Aids to<br />
Scouting".<br />
1899 nimmt BP als Oberst am Burenkrieg teil. Bei diesem Krieg ging es unter anderem auch um die<br />
Gold und Diamantenvorkommen im südlichen Afrika. England und die Buren (Nachfahren niederländischer<br />
Einwanderer) führten einen Krieg, bei dem die Buren zunächst Erfolge feierten. Dabei haben<br />
sie auch den Ort Mafeking eingeschlossen, der mitten in Südafrika lag. In Mafeking lebten damals<br />
2000 Einwohner. Weiße und Schwarze. Gegen einen überlegenen Gegner verteidigt BP dank persönlicher<br />
Tapferkeit, Einfallsreichtum und geschickter Führung monatelang das belagerte Mafeking. Dadurch<br />
hat er größere burische Verbände gebunden, die nicht an anderen Kriegsschauplätzen eingreifen<br />
konnten.<br />
Die Belagerung Mafekings dauerte vom 11. Oktober 1899 bis zum 16. Mai 1900. Es war Krieg und<br />
im eingeschlossenen Mafeking musste Essen rationiert, das Trinkwasser auf Genießbarkeit überprüft<br />
werden. Es wurde eine eigene Währung, der Mafeking-Dollar eingeführt. Die Weißen und Schwarzen<br />
in Mafeking wurden gleich behandelt. Das geht aus einem Tagebuch eines schwarzen Bürgers aus<br />
Mafeking hervor. Das Tagebuch heißt "Tagebuch eines schwarzen Mannes über den Krieg des weißen<br />
Mannes". Aus diesem Tagebuch geht auch hervor, aß BP kein Rassist war. BP ging oft nachts selbst<br />
28 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Pfadfindergeschichte<br />
auf Kundschaft. Sonntags wurde nicht gekämpft (Eine Abmachung zwischen Belagerern und Belagerten).<br />
BP sorgte dafür, dass am Sonntag Gottesdienste stattfanden und zur Zerstreuung der Einwohner gab<br />
es auch Kricketspiele. (Zerstreuung für die ihm anvertrauten, so wie BP es schon in Indien eingeführt<br />
hatte). Es waren wenige Soldaten in der Stadt. Daher mussten die Soldaten von so vielen Diensten wie<br />
möglich befreit werden. BP setzt zum ersten Mal junge Leute (die Mafeking-Kadetten) zum Späher-,<br />
Verbindungsdienst und als Postbooten ein.<br />
Diese Mafeking-Kadetten waren die Vorbilder für die Pfadfinder. Die Befreiung von Mafeking fand<br />
in Großbritannien einen großen Widerhall und BP wurde zum Helden. Nach Beendigung des<br />
Burenkrieges erhält BP den Auftrag die Südafrikanische berittene Polizeitruppe zu errichten und<br />
einzurichten. Dabei führte er auch Fahrräder ein, um die Truppe mobiler zu machen.<br />
Die Uniform dieser Polizeitruppe diente als Vorbild zur Pfadfinderkluft. Von einem afrikanischen<br />
Krieger erhielt BP eine Kette mit vielen Klötzchen. Dies waren die ersten Woodbadgeklötzchen. Den<br />
Ehrennamen "Impesa" (=Der Wolf der nie schläft) erhielt er ebenfalls von den Ureinwohnern, bei<br />
denen er anerkannt war.<br />
1900 wird BP aufgrund seiner Verdienste um Mafeking zum General ernannt. BP hatte alles erreicht,<br />
was man auf militärischem Gebiet erreichen kann. BP hatte alle Kommandos, die ihm übertragen<br />
wurden gut gemeistert. BP wurde der jüngste<br />
General der britischen Armee.<br />
[Übernommen aus dem QWEST Kursordner]<br />
8.3 Geschichte der Pfadfinderbewegung<br />
Nun begann BP´s zweites Leben. Er überlegte sich, ob das was er in Mafeking mit Erfolg ausprobierte,<br />
nicht auch in Friedenszeiten möglich ist. Der Hintergedanke war zunächst natürlich, die jungen<br />
Leute fürs Vaterland und die Krone zu ertüchtigen.<br />
Wie sah die Situation zu Beginn des 20. Jh. für Kinder aus? Die Industrielle Revolution brachte<br />
Kinderarbeit mit sich. Kinder mussten 12-16 Stunden am Tag in Bergwerken schuften. Arbeitsrechte<br />
gab es noch kaum welche. Ausbildung war nur für die Kinder zu haben, deren Eltern die Ausbildung<br />
finanzieren konnten.<br />
Die zivilisierten Länder der Erde (in Europa, in Nordamerika, Japan...) wollten den "Wilden" die Zivilisation<br />
bringen und beuteten diese doch nur aus. Krieg galt noch als Fortführung der Politik mit<br />
anderen Mitteln. In dieser Welt lebte BP. Auf der anderen Seite entstanden die Pfadfinder. Deren<br />
Gründer ein berühmter General war, ein Idol seiner Zeit. Und wie es so mit Idolen war und ist. Die<br />
Anhänger von ihnen saugen alles gierig auf was sie von ihnen erhaschen können. BP kannte oder ahnte<br />
dieses Phänomen. Er bekam mit, dass alles was er sagte in der Presse aufgeschrieben und von den<br />
Kindern aufgenommen wurde. Seine Bücher, die bereits auf dem Markt waren (wie "Aids to Scouting"),<br />
wurden von den Kindern gelesen. Aber BP fand, dass es nicht gut war, wenn Kinder Bücher<br />
für Soldaten lesen. Daher schrieb er in der Zeitung Artikel, die unter dem Namen "Scouting for Boys"<br />
erschienen und später als Buch aufgelegt wurden.<br />
1907 findet das erste Pfadfinderlager auf Brownsea Island statt. BP findet, was im Krieg möglich ist<br />
muss auch im Frieden möglich sein. Um den Nachweis zu führen startet er dieses Lager. Bei dem alle<br />
Gesellschaftsschichten vertreten waren. Es war kein Elitelager. Brownsea Island liegt ca. zwei<br />
Stunden von London entfernt. Bei diesem Lager waren 20 Jungs dabei. Es wurden Spiele gemacht, z.<br />
B. Walfangen, Trampolin springen... .Zu den Meetings, die morgens, mittags und abends stattfanden,<br />
wurden die Pfadfinder mit dem Kuduhorn zusammengerufen.<br />
Die Kinder waren in Patrouillen zu 4-5 Jungen zusammengestellt. Sie waren für ihr Zelt selbstverantwortlich,<br />
auch mussten/durften sie selbst kochen. Den Kindern wurde Verantwortung übertragen. Das<br />
pädagogische Prinzip von Groß- und Kleingruppe wurde auch hier eingeführt. Das Lager war rundherum<br />
ein Erfolg.<br />
BP brachte seine Gedanken zu Papier. Die Zeitungen veröffentlichten diese Ideen der pfadfinderischen<br />
Pädagogik in 6 Folgen.:<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 29
Pfadfindergeschichte <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
1. Look at the boy. -> Welche Welten haben Kinder? Das Programm der Gruppenstunde soll danach<br />
ausgerichtet werden und nicht danach, was der Leiter will.<br />
2. Learning by doing. -> Lernen durch Handeln und nicht durch Bücher lesen, Video sehen...<br />
3. Impossible -> Unmöglich gibt es nicht für einen Pfadfinder.<br />
4. Scouting is no militarism. Pfadfinderei und Militär unterscheiden sich. Der Pfadfinder soll nicht<br />
blind gehorchen. Beim Militär durfte der Einzelne nicht denken.<br />
5. Once a scout always a scout-> einmal Pfadfinder immer Pfadfinder.<br />
6. Every day a good deet. -> Jeden Tag eine gute Tat<br />
BP verließ das Militär und widmete sein Leben ganz der Pfadfinderei. Der Zuspruch in Großbritannien<br />
war riesig. Es gab Rallyes mit tausenden von Pfadfindern (z.B. waren bei der Pfadfinderralley im<br />
Windsorpark im Jahr 1915 15.000 Pfadfinder anwesend).<br />
BP war auch im Königshause akzeptiert. 1909 entstanden die ersten Pfadfinderinnen (Girlscouts) aus<br />
Eigeninitiative. Den Vorstand übernahm zunächst eine Schwester von BP. Später übernahm seine<br />
Frau den Vorsitz. Es entstand das "First script how can girls help to built up the Empire".<br />
Die Welle der Pfadfinderbewegung verlässt England und schwappt über auf den Rest der Welt. Zunächst<br />
entstehen Pfadfindergruppen in USA und Kanada. Dann auch in ganz Europa. Auch im zaristischen<br />
Russland gab es Pfadfinder. 1909 entstanden auch die ersten Pfadfindergruppen in Deutschland.<br />
1912 lernt BP Olivia kennen.<br />
1914 brach der 1. Weltkrieg aus und BP schrieb Bücher mit dem Titel "Quick training for war" und<br />
"My adventures as a spy". Im letzten Buch beschreibt er, dass er den deutschen Ordnungshütern,<br />
denen er beim Erkunden eines neuen Gewehres aufgefallen war, dadurch entkam, dass er sich eine<br />
Flasche Schnaps übergoss und einen auf betrunkenen Penner machte.<br />
Die türkischen Festungen am Bosporus spähte er auch aus und zeichnete sie in sein Skizzenbuch. Er<br />
hatte sich als Schmetterlingssammler verkleidet und zeichnete die Festungen als Muster der Flügel.<br />
So schöpften die türkischen Behörden keinen Verdacht, und ließen ihn wieder laufen.<br />
Dann suchte er ein Haus, in dem er mit seiner Frau lebte.<br />
1920 fand in London das erste World Jamboree statt. Bei dieser Gelegenheit wurde er zum "Weltpfadfinderführer"<br />
ausgerufen. Bei BP saß der Schock des 1. Weltkrieges tief. Er sagte, dass man für<br />
das Geld, das ein Panzer kostet, die Freundschaft der ganzen Völkern untereinander vertiefen könnte.<br />
BP versuchte mit allen Mitteln einen weiteren Krieg zu verhindern.<br />
Es entstanden die Wölflinge. Zu ihrer Orientierung diente Roan Kipplings Roman das Dschungelbuch.<br />
(Das auch in Indien handelt, wo BP seine militärische Laufbahn begann).<br />
Die Pfadfinder zogen BP um die Welt. Und BP ließ sich ziehen. Meist regnete es, wenn er ein Lager<br />
oder ein Jamboree besuchte. In den USA wurde er auf vielfältigste Weise geehrt. Z.B. wurde er zum<br />
Häuptling ernannt.<br />
1924 findet das Jamboree in Dänemark statt.<br />
1929 wird BP geadelt. Er wird Lord und erhält den Gilwell-Park, in dem er die Woodbadgeausbildung<br />
startet. Auch heute finden noch Woodbadgeausbildungen im Gilwell-Park statt. Der Pfeil wurde ein<br />
Symbol der Pfadfinderei.<br />
1933 findet in Ungarn/Budapest das Jamboree statt. Bei diesem Jamboree waren die deutschen Pfadfinder<br />
nicht mehr offiziell dabei. Aber es waren trotzdem deutsche Pfadfinder anwesend.<br />
1937 fand in den Niederlanden das Jamboree statt. Die Zeit war auch für das internationale Pfadfindertum<br />
schwierig. Die politische Großwetterlage warf ihre dunklen Schatten voraus und BP war zu<br />
diesem Zeitpunkt schon ein sehr alter Mann, der auch körperlich nicht mehr so konnte, wie er gern gewollt<br />
hätte. Nachdem er einsehen musste, dass seine Idee von Friedenspfadfindern gescheitert war<br />
resignierte er.<br />
30 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Pfadfindergeschichte<br />
BP wollte nicht in Großbritannien bleiben. 1938/39 wanderte er nach Kenia aus. Dort ließ er sich am<br />
Fuße des Mount Kenia nieder. Hier malte er wieder, ging fischen und schrieb Bücher über "Wild<br />
beests in africa". BP lebte in einer Hütte. 1941 traf sich BPs Familie nochmals in Kenia, ehe er am<br />
8.1. 1941 verstarb.<br />
BP hat ein Vermächtnis hinterlassen. „Versucht die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als Ihr sie<br />
vorgefunden habt.“<br />
[Übernommen aus dem QWEST Kursordner]<br />
8.3.1 Die Pfadfinderbewegung in Deutschland<br />
In Deutschland war natürlich alles etwas schwieriger als woanders. So war die Pfadfinderbewegung in<br />
Deutschland ein Teil der damaligen Jugendbewegung. Die Wandervögel z.B. gab es nur in Deutschland.<br />
Die Wandervögel waren eine Bewegung von Schülern und Studenten, die sich um Berlin herum<br />
bildete. Im Laufe der Zeit gab es viele Auf- und Absplitterungen.<br />
1909 wurden die ersten Pfadfindergruppen auf deutschem Boden gegründet. Die Initiatoren waren<br />
Maximilian Bayer und Alexander Lyon. Beide waren Offiziere. Lyon war in Deutsch Südwestafrika<br />
(heute Namibia) als Stabsarzt stationiert. Bayer hatte sich beim Freiheitskampf des finnischen Volkes<br />
einen Namen gemacht. Lyon hat ein Pfadfinderbuch herausgebracht, dass in Anlehnung an BPs scouting<br />
for boys geschrieben war, allerdings arbeitete er die Besonderheiten mit ein, unter denen das<br />
Deutsche Pfadfindertum seiner Meinung nach stehen sollte. Darin gibt es z.B. die 10<br />
Gebote des Pfadfinders.<br />
Alexander Lyon traf BP im August 1909 in London. Er hatte ein Gespräch mit ihm. Lyon umschrieb<br />
die Atmosphäre so: "Es war ein Gespräch von Mensch zu Mensch, von Pfadfinder zu Pfadfinder, von<br />
Afrikaner zu Afrikaner und von Soldat zu Soldat". Wobei er auf die Parallelen in beiden Lebensläufen<br />
anspielte.<br />
Aber das Pfadfindertum in Deutschland sah etwas anders aus, als BP es in England eingeführt hatte.<br />
Die Führungsriege bildeten nämlich Militärs und Schulmeister. Pfadfinder wurde als vormilitärische<br />
Ausbildung der deutschen Jugend betrachtet. Zucht, Ordnung, Disziplin und Gehorsam galten und<br />
gelten noch immer als deutsche Tugenden. Daher war die Kaiserfamilie den Ideen auch gewogen. Sie<br />
zeigte immer Präsenz, wenn es offizielle Anlässe der Pfadfinder gab.<br />
In Friedenszeiten kann man erste Hilfe machen, aber es wurde immer darauf geachtet, dass die Ertüchtigung<br />
der Jugend nicht zu kurz kam. Im 1. Weltkrieg waren viele Pfadfinder Freiwillige. Von ihnen<br />
fielen viele. Aber nicht nur die Pfadfinderbewegung, die gesamte deutsche Jugend war nach 1918<br />
"kopflos". Nach dem 1. Weltkrieg gestaltete sich die gesamte Jugendbewegung in Deutschland um.<br />
1920 kam es zum Prünner Gelöbnis. Benannt nach dem Schloss Prünn im Altmühltal, auf dem sich<br />
das Treffen abspielte. Die Zeit zwischen 1920 und 1933 war gekennzeichnet durch große Zersplitterungen<br />
der Jugendbewegung in Deutschland. 1933 mit der Machtergreifung der Nazis begann die<br />
Gleichschaltung der Jugend. Es gab nur noch in den Kirchen Jugendgruppen, die nicht der Partei unterstellt<br />
waren. In diesem Jahr fand noch ein Großlager in Münster in der Lüneburger Heide statt, bei<br />
dem sich alle Verbände trafen, die nicht in den NS-Jugendverbänden aufgegangen waren. Feldmarschall<br />
von Trothar wurde zum Großdeutschen Jugendfeldmeister ausgerufen. (Sein Gegenspieler war<br />
der NS Reichsjugendführer Balduar von Schierach).<br />
Die Nazis lösten das Lager auf und beschlagnahmten Banner, Kluften und Symbole der Jugendverbände.<br />
Viele Jugendverbände versuchten in der HJ eine Nische zu finden, um weiter ihre eigene Arbeit<br />
organisieren zu können und von der Obrigkeit nicht gegängelt zu werden. Dies erwies sich im<br />
Nachhinein als Trugschluß. (Wie so vieles in der Zeit). Aber die Pfadfinder sahen diese Möglichkeit<br />
für sich nicht, denn alles was sie machten<br />
(Wanderungen, Lager, Lieder singen...) wurde auch in der HJ gemacht, also wo<br />
sollte man da eine Nische finden?<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 31
Pfadfindergeschichte <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
1936 (nach dem Tod des Reichspräsidenten von Hindenburg) wurden auch die konfessionellen<br />
Jugendverbände verboten. Erst nach dem Krieg ging es dann 1945 weiter mit der deutschen Jugendbewegung.<br />
1938 schließlich wurde die DPSG „zum Schutz von Volk und Staat“ (!) zwangsweise aufgelöst und<br />
verboten. Das zeigt: der Geist und die Ordnung unseres Verbandes widersprachen dem Geist und der<br />
Ordnung des nationalsozialistischen Staates. Die Hitler-Jugend wollte allein Freizeitangebote an<br />
jungen Menschen machen. Georgs-Pfadfinder wirkten jedoch in aller Stille, im Untergrund weiter.<br />
Der Verband wurde umbenannt in „Gemeinschaft Sankt Georg“.<br />
Draußen, weitab der großen Straßen, blühten Fahrt und Lager der Sippe und der Stämme, fand auch<br />
einmal ein größeres Treffen statt, für eine Nacht, für einen kurzen Tag, und es wurden Kurse gehalten.<br />
Manche wagten sogar, weiterhin Kontakte zu ausländischen Pfadfindern und konnten auf diese<br />
Weise Grundsteine legen für spätere Verständigung.<br />
Das Leben des Verbandes konnte trotz Verbot, trotz harter Belastungen und trotz der Toten im Krieg<br />
und in Konzentrationslagern nicht unterbrochen werden.<br />
Ein hoffnungsvoller Neubeginn<br />
Das nationalsozialistische Regime war besiegt. Doch die Sieger ließen kaum Freiheit erfahren; sie regierten<br />
mit Anordnungen und Befehlen. Aber das Leben war nicht zu verordnen; es blühte von selbst<br />
auf! so auch das Leben des Verbandes. Überall entstehen wieder Pfadfindergruppen, noch ehe 1946<br />
unter erschwerten Umständen ein Bundesthing stattfinden konnte und noch ehe in den Besatzungszonen<br />
die Lizenzen für die Pfadfinderverbände verteilt wurden.<br />
Dieser Neubeginn war aber nicht nur das Werk „der Alten“, die vor Verbot und Krieg in der DPSG<br />
wirkten. Die DPSG sprach auch viele „Neue“an: 1947 bereits zählte sie in 282 Stämmen 10 000 Mitgliedern.<br />
1947/48 werden erste internationale Kontakte zum Weltbüro geknüpft und es finden Gespräche über<br />
den Aufbau und die Gestaltung der Pfadfinderarbeit statt.<br />
1949 wird der Ring der Pfadfinderverbände gegründet. Die DPSG wird als Mitglied des Ringes der<br />
Pfadfinderbünde 1950 in die Weltpfadfinderbewegung aufgenommen.<br />
1954 ist die DPSG Mitbegründer der Internationalen Konferenz des kath. Pfadfindertums und veranstaltet<br />
deren erste Konferenz in Altenberg. Die Freizeitstätte für Behinderte in Westernohe wird 1956<br />
durch die Jahresaktion „Flinke Hände, Flinke Füße“ unterstützt. Seit dieser ersten Aktion wird jedes<br />
Jahr für soziale Projekte Geld gesammelt.<br />
Verbandliche Weiterentwicklung<br />
1971 wird die neue Ordnung des Verbandes beschlossen. Wegweisend sind die Grundlinien unserer<br />
Lebensauffassung und die Schwerpunkte in den Aufgaben und Tätigkeitsbereichen ( Leben in der Kirche,<br />
soziales Engagements, politische Mitverantwortung, Einsatz für den Frieden).<br />
Ursprünglich war die DPSG als reiner Jungenverband gegründet worden. Frauen wurden erst nach<br />
1949 als Leiterin der Wölflingsstufe anerkannt. Aufgrund des gesellschaftlichen Umbruchs und der<br />
Entwicklungen in der verbandlichen Praxis gegen der Ende der 60er Jahre kamen immer mehr Mädchen<br />
in die DPSG. Die 31. Bundesversammlung 1971 trug dieser Entwicklung Rechnung und beschrieb<br />
die DPSG als koedukativen Verband für Mädchen und Jungen, für Frauen und Männer.<br />
1979 feiert die DPSG ihren 50jährigen Weg mit 100 000 jungen Menschen. Ein weiterer Meilenstein<br />
der Geschichte der DPSG war die Annahme eines Antrags zur Verbesserung und Intensivierung der<br />
Öffentlichkeitsarbeit auf der 54. Bundesversammlung. Es wurde eine dreijährige Kampagne gestartet<br />
mit dem Namen „LuSi“, der für „LeiterInnen- und Selbstdarstellungsinitiative“ steht.<br />
Im Jahr 2001 wurde der Up-Date „Perspektiventwicklungsprozess“ gestartet, um über die inhaltlichen<br />
Grundlagen unserer Arbeit in der DPSG und über die thematischen Schwerpunkte zu beraten, der mit<br />
dem Up2Data Kongress im Jahr 2003 seinen Höhepunkt gefunden hat. 3000 Leiterinnen und Leiter<br />
haben über die Zukunft der DPSG diskutiert und abgestimmt.<br />
32 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Pfadfindergeschichte<br />
Heute ist die DPSG mit über 100000 Mitgliedern der größte katholische Jugendverband in der<br />
Bundesrepublik Deutschland und wird sich, wie die Geschichte zeigt, stetig weiterentwickeln.<br />
[Übernommen aus dem QWEST Kursordner]<br />
9 Öffentlichkeitsarbeit<br />
Warum Öffentlichkeitsarbeit ?<br />
Jedes Jahr werden unzählige Aktionen von Mitgliedern der DPSG durchgeführt, von denen sowohl innerhalb<br />
als auch außerhalb unseres Verbandes kaum etwas bekannt wird. Eigentlich schade, denn Berichte<br />
in den unterschiedlichsten Medien könnten folgende Wirkungen haben:<br />
Wenn die Teilnehmer und Veranstalter erfahren, dass über ihre Aktion berichtet wird, fühlen sie<br />
sich ernst genommen. Darüber hinaus schaffte es Anerkennung und Motivation für weitere Aktionen.<br />
Andere Mitglieder des Verbandes können Ideen übernehmen und weiterentwickeln. Berichterstattung<br />
dient auch der Kommunikation innerhalb unseres Verbandes. Daraus können neue Aktionsideen<br />
entstehen.<br />
Potentielle neue Mitglieder (Kinder, Jugendliche und deren Eltern) werden auf die DPSG Aufmerksam.<br />
Ein Bericht über eine tolle Aktion sagt oft mehr als eine lange Abhandlung über die pädagogischen<br />
Hintergründe.<br />
Unser Bild in der Öffentlichkeit kann aktiv beeinflusst werden. Anhand von Aktionen wird immer<br />
auch der Verband und die Pfadfinderbewegung präsentiert.<br />
Besonders in Bezug auf Entscheidungsträger und Geldgeber ist es wichtig unsere Arbeit nach<br />
außen zu präsentieren. Auch in der Jugendarbeit werden Marketing und Öffentlichkeitsarbeit<br />
immer wichtiger. Nicht selten werden Projekte unterstützt weil sie gut präsentiert werden.<br />
Öffentlichkeitsarbeit – aber wie ?<br />
Hierüber gibt es jede Menge Bücher und Seminare. Deshalb hier nur zwei besonders wichtige Tipps:<br />
Manche Medien (z.B. Tageszeitungen) berichten sehr aktuell. Hier sollte schon bei der Planung<br />
einer Aktion an die Öffentlichkeitsarbeit gedacht werden. Meist ist es durchaus möglich den<br />
Artikel schon vor der Aktion zu schreiben und nachher nur noch Korrekturen vorzunehmen.<br />
Journalisten haben 1. keine Zeit, haben 2. meist keinen tiefen Einblick in die Jugendarbeit und in<br />
die Pfadfinderei schon gar nicht und 3. zum Rückfragen keine Lust. Deshalb lieber so formulieren<br />
dass auch Nichtpfadfinder verstehen was gemeint ist, wenn z.B. „Wölflinge anlässlich des Stufenwechsels<br />
das Versprechens abgelegt haben“.<br />
Öffentlichkeitsarbeit – wo denn ?<br />
Für die Präsentation bietet sich eine Fülle von Möglichkeiten an:<br />
Verbands-interne oder -übergreifende Zeitschriften (Entwürfe, Stufenzeitschriften, Echt, Kratzbürste,<br />
BDKJ-Journal)<br />
Tages- und Lokalzeitungen sowie kleine Anzeigenblätter.<br />
Pfarrblätter und die entsprechenden Druckschriften auf Dekanats- (Kirche Aktiv) und Diözesanebene<br />
(Konradsblatt).<br />
Radio und Fernsehen z.B. das Jugendradio „Das Ding“ des SWR.<br />
und natürlich das Internet<br />
10 Elternarbeit<br />
In unserer Arbeit mit den Kindern kommen wir in allen Altersstufen immer wieder mit den Eltern in<br />
Kontakt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, weil sie uns für die Zeit der Gruppenstunden<br />
und der Lager die Verantwortung für ihre Kinder übergeben. Deshalb muss es unsere Aufgabe<br />
sein eine große Vertrauensbasis zu den Eltern aufzubauen.<br />
Gründe für die Elternarbeit:<br />
Eltern bekommen genügend Informationen<br />
Gruppenleiter bekommen eine Rückmeldung, wie die Arbeit bei den Kindern/Eltern ankommt.<br />
Eltern bekommen Vertrauen in die Leiter und deren Arbeit<br />
Eltern fühlen ihre Kinder bei den Pfadfindern gut aufgehoben<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 33
Elternarbeit <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
Eltern können bei ihren Kindern auf Dinge achten, wenn sie informiert sind, wie z.B. beim Packen<br />
für das Sommerlager, ...<br />
Eltern können praktische Hilfe leisten z.B. bei Fahren, oder Aktionen im Stamm. Viele Eltern machen<br />
das sogar gerne, wenn man sie freundlich fragt.<br />
Die Arbeit wird für Eltern transparent und die Eltern können auftretende Probleme<br />
besser verstehen<br />
Eltern lernen sich auch untereinander besser kennen<br />
Eltern werden Lobby in Pfarr- und politischer Gemeinde<br />
Die Hilfe kommt wieder, wird beständig<br />
Der Anteil an geleisteter Elternarbeit verkleinert den Gesamtaufwand bei der Planung und Durchführung<br />
von Gruppenstunden, Lagern und anderen Aktionen!<br />
Punkte, die bei der Elternarbeit beachtet werden sollten:<br />
Informationen wie Elternbriefe und Ankündigungen rechtzeitig herausgeben. Viele Eltern (ver)<br />
planen Urlaubs und Ferienzeiten frühzeitig.<br />
Sich Zeit für die Eltern nehmen<br />
Zuverlässig bei Terminen und Vereinbarungen sein<br />
Bei Gesprächen mit Eltern: zuhören können und auch wenn Angriffe kommen versuchen<br />
höflich zu bleiben<br />
Auf einen regelmäßigen Kontakt zu den Eltern achten.<br />
Checkliste Elternabend<br />
1. Vorbereitung:<br />
Was wollen wir den Eltern sagen? Was ist das Thema ?<br />
Rechtzeitige Terminplanung und Bekanntgabe des Themas<br />
Einladung entwerfen und rechtzeitig versenden<br />
Abklären der organisatorischen Fakten wie z.B.: Raum / Verpflegung / Medien für die Veranstaltung<br />
Absprache wer kümmert sich um was?<br />
Vorträge mit Medien transparent machen (z.B. Diavortrag)<br />
Richten des Raumes und testen der Hilfsmittel wie z.B.: Diaprojektor, Overheadprojektor, ...<br />
2. Durchführung:<br />
Den Eltern auch Gelegenheit geben mit euch zu reden ( nicht zu viel Programm )<br />
Die Leiter sollten sich nicht in einer Gruppe zusammensitzen<br />
Dafür sorgen, dass alle mithelfen aufzuräumen<br />
3. Nachbereitung:<br />
Reflexion abhalten unter den Gesichtspunkten: Was kam gut an; welche Rückmeldungen haben ihr<br />
von den Eltern bekommen ?<br />
Wo könnten Verbesserungen / Veränderungen getätigt werden?<br />
Waren die Aufgaben gut verteilt?<br />
Wichtig ist in jedem Fall, dass die Elternabende, Stammestage und andere Veranstaltungen, die<br />
sich an Eltern richten interessant und ansprechend gestaltet werden. Damit bekommen die Eltern<br />
auch Interesse das nächste mal wiederzukommen.<br />
[In Anlehnung an den QWEST Kursordner]<br />
34 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Anhang<br />
11 Anhang<br />
11.1 Animationsmethoden<br />
11.1.1 Bücherausstellung<br />
Die Gruppenmitglieder werden zu einer Bücherausstellung eingeladen. Die Gruppenleiter haben den<br />
Raum dekoriert und für eine ruhige, einladende Atmosphäre gesorgt. Jeder kann umhergehen, die Bücher<br />
ansehen und durchblättern. Wenn die Animation zielgerichtet (auf ein bestimmtes Thema hin)<br />
sein soll, werden die Bücher entsprechend ausgewählt.<br />
Ziel ist es, dass die Teilnehmer über die Beschäftigung mit den Büchern auf Ideen kommen und neue<br />
Gedanken entwickeln, aus denen sich ein Ziel für eine Streife oder ein Thema für ein Projekt entwickeln<br />
kann.<br />
11.2 Reflexionsmethoden<br />
11.2.1 Wettervorhersage<br />
Die Teilnehmer bereiten in kleinen Gruppen eine Wettervorhersage vor, mit der sie das Geschehene<br />
beschreiben („Nach anfänglichen Sonnenschein, zogen plötzlich Gewitterwolken auf ...“). Durch die<br />
Umschreibung mit Begriffen aus der Wettervorhersage fällt es leichter die Probleme zur Sprache zu<br />
bringen. Unterstützt werden kann die Methode, wenn der Reflexionsleiter kleine Symbole mitbringt,<br />
z.B.: Sonnen, Regenwolken, Blitze, ...<br />
11.2.2 Thermometer<br />
Auf dem Boden wird eine Linie markiert, deren Enden für „sehr gut“ und „sehr schlecht“ stehen. Nun<br />
werden der Gruppe Fragen gestellt, wie z.B. „Wie hat Dir der Hike gefallen“ und jeder stellt sich an<br />
die Stelle auf der Skala, die seiner Meinung entspricht.<br />
Vorteil: Die Gruppe kommt in Bewegung.<br />
Nachteil: Wenn alle in Richtung „schlecht“ rennen traut sich kaum jemand sich zu „gut“ zu stellen.<br />
Material: Evtl. ein Seil um die Skale zu markieren.<br />
11.2.3 Blitzlicht<br />
Das Blitzlicht ist eine Methode um schnell den Überblick über die Stimmungslage zu einer oder<br />
wenigen kurze Fragen in der Gruppe zu bekommen. Jeder in der Gruppe äußert kurz seine Meinung<br />
zu der Frage bzw. den Fragen.<br />
Vorteil: Es ist eine einfache und „schnelle“ Methode.<br />
Nachteil: Je nach Erfahrung der Teilnehmer eher für einfache Fragen geeignet, da sich jeder frei vor<br />
der Gruppe äußern muss. Es besteht die Gefahr, dass sich viele nur ihrem Vorredner anschließen um<br />
keine eigene Meinung äußern zu müssen.<br />
Variation: Die Teilnehmer sagen nichts sondern machen nur ein Handzeichen (z.B. Daumen „hoch“<br />
oder „runter“)<br />
11.2.4 Plakate auslegen<br />
Auf Tischen werden Plakate ausgelegt, auf denen mit Stichpunkten die einzelnen Fragestellungen notiert<br />
sind (z.B.: „Hike“, „Lageraufbau“, ...). Die Teilnehmer gehen im Raum zwischen den Plakaten<br />
umher und schreiben ihre Kommentare dazu. Hierbei ist evtl. auch möglich vorgefundene Kommentare<br />
zu kommentieren, da sich daraus kaum eine hitzige Diskussion entwickeln wird.<br />
Vorteil: Jeder kann sich in Ruhe äußern.<br />
Nachteil: Je jünger die Kinder um so schwierige fällt es ihnen sich schriftlich zu äußern.<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 35
Anhang <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
11.2.5 Ampelreflexion<br />
Jeder Teilnehmer erhält drei Karteikarten und zwar jeweils eine rote, eine grüne und eine gelbe. Zusätzlich<br />
überlegt sich jeder eine zum Thema passende Behauptung, zu der er gerne die Meinung der<br />
anderen hören möchte. Legt die Reflexionsleitung die Fragestellung fest, ist diese Methode auch für<br />
jüngere Kinder sehr gut geeignet. Alle setzen sich in einen Stuhlkreis zusammen und der erste (bzw.<br />
Leitung) stellt seine Behauptung auf. Jeder überlegt, wie er dazu steht und welche Karte er gleich<br />
zeigt: Grün = Zustimmung, Rot = Ablehnung, Gelb = Unentschlossenheit. Nach kurzer Bedenkzeit<br />
klärt die Leitung ab, ob sich jeder für eine Karte entschieden hat und nach dem Kommando "Rot,<br />
Gelb oder Grün" heben alle gleichzeitig ihre Karten.<br />
Alter: ab 12 Jahre<br />
Material: Karteikarten (rot, gelb und grün)<br />
11.2.6 Highlights und Stolpersteine<br />
In der Mitte steht eine brennende Kerze und liegt ein Stein. Jeder schreibt je auf eine Karteikarte positive<br />
bzw. negative Bewertungen. Die Karten legt er dann entweder zur Kerze (Highlights) oder zum<br />
Stein (Stolperstein).<br />
Alter: ab 10 Jahre<br />
Material: eine brennende Kerze, ein Stein, Karteikarten und Stifte<br />
11.2.7 Satz vervollständigen<br />
Alle sitzen im Kreis. Der Leiter gibt einen Satzanfang vor (siehe unten). Dieser Satzanfang macht<br />
jetzt die Runde und jeder hängt einen für sich passenden Schluss daran. Es ist selbstverständlich<br />
erlaubt zu passen. Die Statements bleiben unkommentiert. In der nächsten Runde wird ein neuer Satzanfang<br />
auf die Reise geschickt.<br />
Mögliche Satzanfänge sind:<br />
Ich war ganz aufgeregt, als...<br />
Ich war neugierig, als...<br />
Ich hätte mir gewünscht, dass...<br />
Ich freue mich, dass...<br />
Ich war gelangweilt, als...<br />
Ich war frustriert, dass...<br />
Alter: ab 10 Jahre<br />
Material: keines<br />
Variante: Sonnenreflexion. Dabei wird auf ein Plakat eine Sonne gemalt, deren Strahlen von oben<br />
genannten Satzanfängen gebildet werden. Nun ist jeder aufgefordert, die Sätze für sich sinnvoll zu<br />
ergänzen und dies auch den anderen mitzuteilen. (Ist für kleinere Kinder bildhafter.)<br />
11.2.8 Nah oder Fern<br />
Die Teilnehmer bilden einen Kreis. Einer nach dem anderen tritt in die Kreismitte und äußert seine<br />
Einschätzung zum letzten Programmteil. Die anderen drücken ihre Meinung zu dieser Aussage aus,<br />
indem sie ihre Position zu ihm verändern. Wer zustimmt, der tritt näher in die Mitte (je näher desto<br />
größer die Zustimmung), wer sich davon distanziert, tritt weiter nach außen. Um den Einstieg zu<br />
erleichtern können anfangs von der Leitung Meinungen vertreten werden.<br />
Alter: ab 10 Jahre<br />
Material: keines<br />
Variante: Zwei Ecken des Raumes werden jeweils als "Volle Zustimmung" und "Volle Ablehnung"<br />
bezeichnet. Der Leiter gibt nun Aussagen vor und die Teilnehmer stellen sich in die entsprechende<br />
Ecke, bzw. irgendwo dazwischen auf.<br />
36 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Anhang<br />
Gesichter malen<br />
Jeder malt ein Gesicht, das seiner Stimmung entspricht auf Papier oder mit Schminkfarben in sein<br />
Gesicht.<br />
Alter: ab 14 Jahre<br />
Material: Papier, Stifte oder Schminkfarben.<br />
11.2.9 Gefühlsdiagramm<br />
Auf ein großes Plakat wird ein Koordinatensystem gezeichnet. Die y-Achse wird von -10 bis +10 beschriftet<br />
und ist die Zufriedenheitsachse. Die x-Achse ist die Tätigkeitsachse und mit jeweils etwas<br />
Abstand werden die verschiedenen Programm- oder Höhepunkte in chronologischer Reihenfolge aufgeschrieben.<br />
Ideal ist, wenn jeder Teilnehmer einen Stift in eigener Farbe hat. Andernfalls sollte sich<br />
jeder ein Symbol aussuchen, das er möglichst unaufwendig malen kann. Am Anfang der Veranstaltung<br />
erklärt der Leiter den Sinn dieses Gefühlsdiagramms. Nach jedem Programmpunkt markieren<br />
alle den aktuellen Gefühlszustand (+10 = voll zufrieden bis -10 = voll unzufrieden) auf dem Diagramm.<br />
So entsteht im Laufe der Zeit ein Diagramm der Stimmungen und jeder kann ablesen, wer gerade<br />
gut oder auch schlecht drauf ist. Der Leiter sollte anfangs nach jedem Programmteil daran erinnern,<br />
seinen aktuellen Zustand zu markieren. Nach einer Weile erfolgt das dann schon automatisch.<br />
Je nachdem wie alt und reflexionserfahren die Teilnehmer sind, sollte auch die Möglichkeit gegeben<br />
sein, einen Zwischenstand einzufordern.<br />
Alter: ab 14 Jahre<br />
Material: keines<br />
Varianten:<br />
Das Gefühlsdiagramm wird erst am Ende rückblickend gestaltet. (bietet sich bei kurzen Veranstaltungen<br />
an)<br />
Das fertige Koordinatensystem wird als Kopie ausgeteilt und jeder trägt bei sich nur seine Stimmung<br />
ein.<br />
Stimmungsbarometer: das ganze lässt sich kindgerechter gestalten, in dem man die y-Achse<br />
durch verschiedene Wettersymbole von Sonne bis Gewitter ersetzt.<br />
Fieberthermometer: Jeder bekommt eine Wäscheklammer mit seinem Namen. Auf einem Papierstreifen<br />
befindet sich eine Temperaturskala von -50 bis +50 °C. Zu jeder Fragestellung heftet man<br />
nun seine Wäscheklammer an die entsprechende Stelle an der Temperaturskala. Auch hier sind<br />
wieder Kommentare erwünscht.<br />
11.2.10 Kerzenreflexion<br />
Neben einer großen Kerze brennen bereits einige Teelichter. Bei einer guten Bewertung wird eine<br />
weitere Kerze (an der großen Kerze) angezündet. Bei einer schlechten Bewertung wird eine Kerze<br />
ausgeblasen. Wichtig ist, dass keine bereits erloschene Kerze neu angezündet wird. Wenn anfangs<br />
nicht zu viele Teelichter brannten, so lässt sich am Schluss ziemlich gut ablesen, ob die positiven oder<br />
die negativen Erfahrungen überwiegen.<br />
Alter: ab 10 Jahre<br />
Material: Teelichter, eine brennende Kerze<br />
11.2.11 Schatzkiste und Mülleimer<br />
Alle sitzen im Kreis zusammen und der Reflexionsleiter zieht einen Mülleimer oder Papierkorb hervor<br />
und erklärt: "In diesen Mülleimer könnt ihr alles Negative reinwerfen. Alles was euch sauer aufgestossen<br />
ist, was echt scheiße war oder völlig danebengegangen ist! Ich gebe den Eimer jetzt im<br />
Kreis rum und jeder kann etwas reintun oder auch nicht. Er kann erklären, warum er es tut oder uns<br />
eine Erklärung schuldig bleiben."<br />
Nun wandert der Mülleimer herum und jeder kann etwas Negatives loswerden. Ist die Runde beendet,<br />
so verschwindet der Eimer und eine Schatzkiste wird hervorgeholt. Bevor auch die Kiste herumgereicht<br />
wird, erfolgt folgende Erklärung: " Auch diese Schatztruhe wandert im Kreis herum und ihr<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 37
Anhang <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
könnt sie mit euren Schätzen füllen. Legt hinein, was euch wichtig und wertvoll geworden ist. Legt<br />
hinein, was euch besonders gefallen hat oder in Erinnerung bleiben wird. Ihr dürft gerne erklären,<br />
warum ihr gerade dieses hineinlegt oder lasst es unkommentiert."<br />
Der Mülleimer und die Schatztruhe sind sehr klare und starke Bilder für Negatives bzw. Positives. Da<br />
benötigt man keine langen Erklärungen und man kann richtig etwas "loswerden" oder wie einen<br />
Schatz vorsichtig hineinlegen. Außerdem machen die Gegenstände (Eimer und Kiste) deutlich wer gerade<br />
das Wort hat.<br />
Alter: ab 10 Jahre<br />
Material: Schatzkiste und Mülleimer<br />
11.3 Entscheidungsmethoden<br />
Eine Entscheidung kann durch Abstimmung getroffen werden. Das macht aber nicht wirklich Spass.<br />
Wenn das Ganze eher spielerisch ablaufen soll oder z.B.: darauf geachtet werden soll, dass die Entscheidung<br />
geheim ist, also keiner in seiner Entscheidung beeinflusst wird bieten sich viele Methoden<br />
an.<br />
11.3.1 Wasserbecher<br />
Jeder bekommt die gleiche Menge Wasser in einem Becher und darf sie auf die Gefässe, die für die<br />
verschiedenen Alternativen stehen aufteilen. Ggf. werden die Alternativen-Gefässe so gewählt, dass<br />
man nicht sieht, wie viel Wasser bereits enthalten ist.<br />
Tipp: Das Wasser mit Lebensmittelfarben färben und mit einem spannenden Namen versehen.<br />
11.3.2 Murmeln verteilen<br />
Jeder darf die gleiche Menge Murmeln auf die Alternativen verteilen.<br />
11.4 St. Georg<br />
Der heilige Georg ist der Schutzpatron aller Pfadfinder. Baden-Powell hat ihn ausgewählt, weil der<br />
unter den Heiligen der einzige Ritter war, und BP großen Wert auf ritterliches Verhalten gelegt hat.<br />
Manche Pfadfinderorganisationen tragen den heiligen Georg sogar im Namen, wie eben die „Deutsche<br />
Pfadfinderschaft St. Georg“.<br />
Die Legende vom Heiligen Georg<br />
Georg, so erzählt die Legende, war ein Ritter aus einem Cappadocischen Geschlecht. Er durchstreifte<br />
das Land und kam so auch in das Land Lybia in die Gegend der Stadt Silena. Nahe bei der Stadt lag<br />
ein großer See. In diesem See hauste ein giftiger Drache, der das Volk bedrohte. Der Drache hatte das<br />
ganze Volk aus der Gegend des Sees vertrieben. Ja, er kam sogar bis vor die Mauern der Stadt und<br />
verpestete mit seinem Gifthauch die ganze Gegend, so dass viele daran starben.<br />
Um ihn zu besänftigen, übergaben ihm die Bürger der Stadt täglich zwei Schafe als Opfer. Als aber<br />
die Schafe zur Neige gingen, kamen die Bürger der Stadt überein, ihm täglich einen Menschen zu<br />
opfern. So loste man aus, wer denn das nächste Opfer sein sollte. Als nun schon alle Söhne und Töchter<br />
der Stadt geopfert waren, fiel das Los auf die einzige Tochter des Königs. Der König aber wollte<br />
sie nicht dem Drachen vorwerfen lassen und flehte das Volk an, sie sollten seine Tochter verschonen<br />
und statt dessen sein ganzes Geld nehmen. Das Volk aber wurde zornig und forderte die Herausgabe<br />
der Königstochter. Schließlich sei er es gewesen, der das Gebot erlassen habe, dem Drachen täglich<br />
einen Menschen zu opfern und nun sei es eben an ihm, dieses Gebot zu erfüllen. Schweren Herzens<br />
gab der König nach, ließ seiner Tochter königliche Kleider anlegen, verabschiedete sich unter Tränen<br />
von ihr und ließ sie an das Ufer des Sees bringen. Dort wurde sie an eine Baum gefesselt.<br />
Als sie da so gefesselt stand und wartete, kam zufällig Georg dahergeritten und sah sie. Er ritt zu ihr<br />
hin und fragte sie, was sie da tue. Die Jungfrau erzählte ihm die ganze Geschichte und warnte ihn, er<br />
38 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Anhang<br />
solle so schnell wie möglich das Weite suchen. Georg aber beruhigte sie und versprach, ihr zu helfen<br />
im Namen Christi. Als sie sich noch unterhielten, tauchte plötzlich der Drache aus den Fluten des<br />
Sees auf und kam auf die beiden zu. Die Jungfrau zitterte vor Angst und bat Georg noch einmal<br />
eindringlich, er solle fliehen. Georg aber hatte keine Angst. Er sprach ein kurzes Gebet und schwang<br />
sich auf den Rücken seines Pferdes. Fest hielt er seine Lanze fest in der rechten Hand und schützte<br />
sich mit dem Schild und Rüstung. So ritt er in vollem Galopp gegen den Drachen . Schon beim ersten<br />
Ansturm traf er den Drachen so schwer, dass dieser zu Boden stürzte. Schnell ritt er zurück zur<br />
Königstochter, befreite sie von ihren Fesseln und bat sie, sie solle dem verwundeten Drachen ihren<br />
Gürtel um den Hals binden. Als sie das getan hatte, wurde der Drachen zahm wie Schosshündchen<br />
und lies sich am Gürtel der Jungfrau willenlos bis vor die Mauern der Stadt führen.<br />
Als die Leute sie so kommen sahen, erschraken sie sehr und versteckte sich aus Angst vor dem Drachen.<br />
Georg aber rief sie zusammen und beruhigte sie. Der König selbst flehte Georg an, er solle den<br />
Drachen doch töten. Georg aber verlangte, dass sich erst alle taufen lassen sollten. So lies sich der<br />
König samt seinen Untertanen taufen. Dann zog Georg sein Schwert und erschlug den Drachen. Als<br />
Dank bot der König Georg unermessliche Schätze an, doch dieser lehnte dankend ab und ließ das<br />
Geld unter den Armen verteilen. Der König lies ein Kirche zu Ehren Marias bauen , in der eine<br />
wundertätige Quelle entsprang. Georg selbst verabschiedete sich und machte sich wieder auf den<br />
Weg.<br />
11.5 Gottesdienstablauf<br />
Wortgottesdienst Eucharistiefeier<br />
Eröffnung: Danksagung:<br />
Einzugslied Einsammeln der<br />
Begrüßung Opfergaben<br />
Einführung Gabenlied<br />
Schuldbekenntnis Einladung zum<br />
Kyrie (Herr erbarme dich) Dankgebet<br />
Gloria Gabengebet/Dankgebet<br />
Tagesgebet Hochgebet/Wandlung<br />
Wortfeier: Sanctus<br />
1. Lesung Kommunionfeier:<br />
Antwortgesang Einladung zur<br />
2. Lesung Kommunion<br />
Antwortgesang Vater unser<br />
(Halleluja-Ruf) Friedensgruss<br />
Evangelium Friedenslied<br />
Predigt Agnus die<br />
Glaubensbekenntnis Kommunion<br />
Fürbitten Kommunionlied<br />
Entlassung:<br />
Schlussgebet<br />
Ankündigungen<br />
Segen<br />
Schlusslied<br />
11.6 Übersicht der Weltjamborees<br />
Nr. Jahr Gastgeberland Teilnehmer Teilnehmerländer<br />
1 1920 England 8,000 34<br />
2 1924 Denmark 4,500 22<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 39
Anhang <strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong><br />
3 1929 England 50,000 69<br />
4 1933 Hungary 26,000 46<br />
5 1937 Holland 29,000 54<br />
6 1947 France 24,000 38<br />
7 1951 Austria 13,000 41<br />
8 1955 Canada 11,000 71<br />
9 1957 England 32,000 82<br />
10 1959 Philippines 12,000 44<br />
11 1963 Greece 14,000 88<br />
12 1967 United States 12,000 105<br />
13 1971 Japan 24,000 87<br />
14 1975 Norway 17,000 91<br />
15 1979 Iran (Cancelled) ---- ----<br />
15 1983 Canada 15,600 102<br />
16 1987-88 Australia 14,634 98<br />
17 1991 Korea 19,083 135<br />
18 1995 Netherlands 23,960 119<br />
19 1998-99 Chile 31,000 157<br />
20 2002-03 Thailand 30,000 157<br />
21 2007 United Kingdom ? ?<br />
Auf dem 9. Jamboree wurde der 100. Geburtstag von Baden-Powell und der 50. Geburtstag der Pfadfinderbewegung<br />
gefeiert.<br />
Das 15 Jamboree war für den Sommer 1979 im Iran vorgesehen, musste aber wegen der unsicheren<br />
politischen Lage abgesagt werden.<br />
40 <strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04
<strong>ESK</strong>-<strong>Script</strong> Anhang<br />
11.7 Abschiedsbrief von Baden-Powell<br />
Liebe Pfadfinder !<br />
In dem Theaterstück " Peter Pan ", das Ihr vielleicht kennt, ist der Piratenhäuptling stets dabei, seine<br />
Totenrede abzufassen aus Furcht, er könne, wenn seine Todesstunde käme, dazu keine Zeit mehr<br />
finden. Mir geht es ganz ähnlich. Ich liege zwar noch nicht im Sterben, aber der Tag ist nicht mehr<br />
fern. Darum möchte ich noch ein Abschiedswort an Euch richten. Denkt daran, dass es meine letze<br />
Botschaft an Euch ist, und beherzigt sie wohl.<br />
Mein Leben war glücklich, und ich möchte nur wünschen, dass jeder von Euch ebenso glücklich lebt.<br />
Ich glaube, Gott hat uns in diese Welt gestellt, um darauf glücklich zu sein und uns des Lebens zu<br />
freuen. Das Glück ist nicht die Folge von Reichtum oder Erfolg im Beruf und noch weniger von<br />
Nachsicht gegen sich selbst. Ein wichtiger Schritt zum Glück besteht darin, dass Ihr Euch nützlich<br />
erweist und des Lebens froh werdet, wenn Ihr einmal Männer sein werdet.<br />
Das Studium der Natur wird Euch all die Schönheiten und Wunder zeigen, mit denen Gott die Welt<br />
ausgestattet hat, Euch zur Freude. Seid zufrieden mit dem, was Euch gegeben ist, und macht davon<br />
den bestmöglichen Gebrauch. Trachtet danach, jeder Sache eine gute Seite abzugewinnen.<br />
Das eigentliche Glück aber findet Ihr darin, dass Ihr andere glücklich macht. Versucht, die Welt ein<br />
bisschen besser zurückzulassen als Ihr sie vorgefunden habt. Wenn dann Euer Leben zu Ende geht,<br />
mögt Ihr ruhig sterben im Bewusstsein, Eure Zeit nicht vergeudet , sondern immer Euer Bestes getan<br />
zu haben. Seid in diesem Sinn " allzeit bereit ", um glücklich zu leben und glücklich zu sterben. -<br />
Haltet Euch immer an das Pfadfinder-versprechen, auch dann, wenn Ihr keine Knaben mehr seid.<br />
Euer Freund<br />
Baden-Powell of Gilwell<br />
<strong>ESK</strong>_<strong>Script</strong>_1_1.sxw, Stand 09.05.04 41