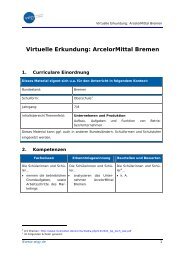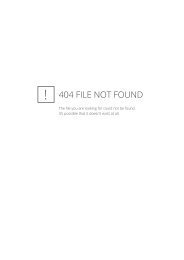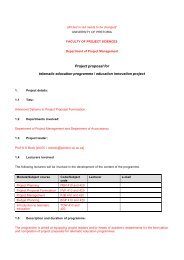Koch, Michael Praxiskontakte Wirtschaft
Koch, Michael Praxiskontakte Wirtschaft
Koch, Michael Praxiskontakte Wirtschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Koch</strong>, <strong>Michael</strong><br />
<strong>Praxiskontakte</strong> <strong>Wirtschaft</strong><br />
Fachbeitrag<br />
Im Rahmen des im Sommer 2000 gestarteten Projekts „<strong>Praxiskontakte</strong> <strong>Wirtschaft</strong> – Wirt-<br />
schaft in die Schule“, kurz Prawis 1 , wird erstmals der Versuch der systematischen Ein-<br />
bettung von Praxisbegegnungen in ein Curriculum „Ökonomie“ im Bereich der Sekundar-<br />
stufe II unternommen. Oberstes Ziel ist dabei die Ausbildung einer den Anforderungen<br />
der modernen Gesellschaft angemessenen Handlungs- und Entscheidungskompetenz der<br />
Schülerinnen und Schüler. Durch eine konsequente Verknüpfung von Theorie und Praxis<br />
im Rahmen eines handlungsorientierten Lernkonzepts soll insbesondere die Ausbildung<br />
der Fach-, Methoden-, Sozial- und Medienkompetenz stärker gefördert werden.<br />
Das Projekt Prawis<br />
Initiert wurde das Projekt von der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (bis<br />
zum 28.02.2002 IHK zu Münster), wobei die Finanzierung von rund 30 Unternehmen der<br />
Münsteraner Region übernommen wurde. Die wissenschaftliche Durchführung liegt bei<br />
den Instituten für Ökonomische Bildung der Universitäten Münster und Oldenburg. Insge-<br />
samt sechs Gymnasien aus Dülmen, Rheine, Recklinghausen, Ostbevern, Münster-Hiltrup<br />
und Steinfurt-Borghorst sind an der dreijährigen Erprobungsphase - unterstützt durch<br />
das Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
- beteiligt, in der mehr als 200 Schülerinnen und Schüler im Bereich der Sekundarstufe II<br />
in Grund- und Leistungskursen das Fach Sozialwissenschaften mit einem ökonomischen<br />
Schwerpunkt belegen.<br />
Die unterrichtliche Grundlage bilden dabei die im Projekt „<strong>Wirtschaft</strong> in die Schule!“ 2 er-<br />
arbeiteten Unterrichtseinheiten zu den Inhaltsbereichen „Private Haushalte im Wirt-<br />
schaftsgeschehen“, „Unternehmen als ökonomische und soziale Aktionszentren“, „Wirt-<br />
schaftsordnung/Die Funktionen des Staates in einer marktwirtschaftlichen Ordnung“ so-<br />
wie „Internationale <strong>Wirtschaft</strong>sbeziehungen“.<br />
Ergänzt werden diese durch Handreichungen zu ausgewählten <strong>Praxiskontakte</strong>n, die die<br />
wissenschaftliche Leitung sukzessive entwickelt und die den Lehrkräften Hilfen zur Vorbe-<br />
1 für weitere Information siehe: www.prawis.de<br />
2 siehe Lexis, U./Wiesner, C.: <strong>Wirtschaft</strong> in die Schule!, in: Unterricht/<strong>Wirtschaft</strong>, Heft<br />
2/2000, 54 ff.<br />
© www.wigy.de 1
Fachbeitrag<br />
reitung, Durchführung und unterrichtlichen Einbindung dieser Praxisbegegnungen liefern.<br />
(siehe die Abschnitte 3.-5.)<br />
Flankierend hilft die IHK Nord Westfalen den Lehrkräften auf Wunsch bei der Anbahnung<br />
von Kontakten zu Unternehmen und Institutionen. Im Rahmen regelmäßig stattfindender<br />
Projektseminare erhalten die beteiligten Lehrkräfte darüber hinaus fachwissenschaftliche<br />
und fachdidaktische Schulungen sowie die Möglichkeit des regelmäßigen Erfahrungsaus-<br />
tauschs. Eine mittlerweile eingerichtete Internetpräsenz (www.prawis.de) schafft weitere<br />
Möglichkeiten der Kommunikation auch außerhalb der Seminarzeiten.<br />
Im August 2001 begann nach einem Jahr der Vorbereitung die Phase der unterrichtlichen<br />
Erprobung in insgesamt elf Oberstufenkursen in den beteiligten Gymnasien mit der Bear-<br />
beitung des Inhaltsbereichs „Private Haushalte“, welche bis zu den Osterferien 2002 ab-<br />
geschlossen wurde. Im Anschluss folgte die Behandlung des Inhaltsbereichs „Unterneh-<br />
men“ in den Jahrgängen 11/2 und 12/1, welcher die unterrichtliche Auseinandersetzung<br />
mit den Bereichen „<strong>Wirtschaft</strong>sordnung/Staat“ (Jahrgang 12/2, ab Februar 2003) sowie<br />
„Internationale <strong>Wirtschaft</strong>sbeziehungen“ (Jahrgang 13/1, ab August 2003) folgen wird.<br />
Einbindung der <strong>Praxiskontakte</strong> in das Curriculum „Ökonomie“<br />
Die <strong>Praxiskontakte</strong> können je nach Art der Einbindung sowohl beim Einstieg in einen<br />
thematischen Komplex helfen, der Erarbeitung von Unterrichtsinhalten dienen wie auch<br />
am Ende einer Unterrichtssequenz im Rahmen der Auswertung und Ergebnissicherung<br />
zum Einsatz kommen.<br />
Verschiedene Formen von <strong>Praxiskontakte</strong>n sind dabei denkbar, z. B.<br />
Lernortwechsel als Erfahrung realer ökonomischer Strukturen und Prozesse,<br />
Expertenbefragung in der Schule,<br />
Recherche und Kommunikation mit Hilfe neuer Informations- und Kommunikationstech-<br />
nologien,<br />
Simulation ökonomischer Realität in Plan- und Rollenspiel unter Einbindung von Exper-<br />
ten.<br />
Für jeden Inhaltsbereich werden bis zu zehn mögliche <strong>Praxiskontakte</strong> ausgewählt, die<br />
besonders geeignet erscheinen, die Vermittlung spezifischer Sachverhalte zu fördern. Die<br />
im Rahmen des Projekts erstellten Handreichungen zu diesen <strong>Praxiskontakte</strong>n bieten den<br />
Lehrkräften<br />
die Einordnung des jeweiligen Praxiskontakts in das Gesamtcurriculum einschließlich<br />
der Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Inhaltsbereichen und <strong>Praxiskontakte</strong>n,<br />
die Formulierung wesentlicher Lernziele,<br />
© www.wigy.de 2
Fachbeitrag<br />
die notwendigen fachlichen Hinweise und die Herausarbeitung der wesentlichen für<br />
den Unterricht relevanten Problemstellungen,<br />
Vorschläge für die methodische Vorgehensweise,<br />
im Unterricht einzusetzende Materialien zur Vor- und Nachbereitung der Praxisbegeg-<br />
nung sowie<br />
Hinweise zu weiteren Informationsquellen wie Literaturtitel, Zeitschriften und Inter-<br />
netquellen.<br />
Durch die konsequente Verknüpfung von theoriegeleitetem Unterricht und regelmäßig<br />
durchgeführten Praxisbegegnungen soll vermieden werden, dass die <strong>Praxiskontakte</strong> – wie<br />
in der schulischen Realität noch zu oft – isolierte Ereignisse darstellen, deren Qualität oft<br />
von zufälligen Faktoren abhängen und deren Erkenntnisse für Schülerinnen und Schüler<br />
nur von kurzer Relevanz sind. Vielmehr geht es darum, sich die Vorteile derartiger Pra-<br />
xisbegegnungen im Rahmen der systematischen Erschließung ökonomischer Sachverhal-<br />
te zu Nutze zu machen. Nur die konsequente Einbindung in das Curriculum schafft für<br />
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die im Rahmen von <strong>Praxiskontakte</strong>n gemach-<br />
ten Erfahrungen und Erkenntnisgewinne in einen Gesamtzusammenhang verorten zu<br />
können. So entsteht ein unmittelbarer Bezug zwischen der Vermittlung von Theorie im<br />
Unterricht und dem Agieren in wirtschaftlicher Realität; beide bedingen und befragen sich<br />
gegenseitig. Theorie wird in der Praxis abgeglichen, während die Praxiserfahrung in einen<br />
allgemeinen und übergeordneten Rahmen einsortiert wird.<br />
Ein Praxiskontakt kann dabei selbstverständlich der Vermittlung unterschiedlichster in-<br />
haltlicher Aspekte, auch in verschiedenen Inhaltsbereiche, dienen. Relevant ist lediglich<br />
die eindeutige Verortung verbunden mit einer klaren Fokussierung auf die zu erarbeiten-<br />
den Inhalte, wie das folgende Beispiel verdeutlicht.<br />
Beispiel aus dem Inhaltsbereich „Private Haushalte“<br />
Für den Inhaltsbereich „Private Haushalte“ wurden zu den folgenden <strong>Praxiskontakte</strong>n<br />
Handreichungen erstellt:<br />
Verbraucherzentrale<br />
Einzelhandelsunternehmen<br />
Supermarkt<br />
Kreditinstitut<br />
Versicherung<br />
Werbeagentur<br />
Marktforschung<br />
© www.wigy.de 3
Fachbeitrag<br />
Im Folgenden soll an einem Beispiel die Struktur und curriculare Einordnung eines sol-<br />
chen Praxiskontakts in diesem Inhaltsbereich verdeutlicht werden.<br />
Praxiskontakt „Supermarkt“<br />
Fachliche Einordnung<br />
Zu Beginn der 60er Jahre verkörperte der Supermarkt wie kein anderer Ladentyp den<br />
Fortschritt im Lebensmitteleinzelhandel. Parallel zum Supermarkt entstanden des Weite-<br />
ren Discounter, die ebenfalls schnell zum festen Bestandteil des Lebensmittelbranche<br />
wurden. Vor allem die K. Albrecht KG - bekannt unter dem Namen ALDI - erlangte in die-<br />
sem Zusammenhang Berühmtheit. Bis heute hat zum einen eine rasante Discount-<br />
Entwicklung über Filialsysteme stattgefunden, zum anderen ist eine zunehmende Kon-<br />
zentrationswelle in der Branche zu verzeichnen, was eine enorme Wettbewerbsverschär-<br />
fung zur Folge hat. „Der Geschäftstyp [des Supermarktes] verkörpert mit seinen emotio-<br />
nalen Dimensionen ein menschliches Maß im Wettbewerb. Und Menschen, das heißt Kun-<br />
den, werden ja bekanntlich nicht nur von der Vernunft, sondern gleichermaßen stark von<br />
Gefühlen geprägt.“ 3 Diese Feststellung hat gewissermaßen Leitfunktion für die Auseinan-<br />
dersetzung mit den Verkaufsstrategien im Supermarkt. Die Erkenntnisse der Erforschung<br />
des Verbraucherverhaltens in Supermärkten, z. B. mit Hilfe von Kundenlaufstudien, hat<br />
u. a. ergeben, dass<br />
es einen eindeutigen und trivialen Zusammenhang zwischen der Einkaufsdauer und<br />
der Höhe des durchschnittlichen Einkaufsbetrages gibt. Je länger ein Käufer in einem<br />
Selbstbedienungsgeschäft bleibt, desto wahrscheinlicher wird ein Anstieg der Ein-<br />
kaufshöhe.<br />
Verbraucher überwiegend einem „Rechtsdrall“ unterliegen und daher bewusst nach<br />
rechts schauen und greifen. Dabei werden besonders solche Produktgruppen gekauft,<br />
die in Griff- und Sichthöhe platziert sind.<br />
die Waren im Supermarkt so zu platzieren sind, dass der Konsument regelmäßig be-<br />
nötigte Produkte (Fleischwaren, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Brot und Back-<br />
waren) verstreut im ganzen Supermarkt suchen muss. Auf diese Weise muss der ge-<br />
samte Markt durchlaufen werden, wodurch v. a. die Wahrscheinlichkeit von Impuls-<br />
käufen erhöht wird.<br />
sich gewinnträchtige Produkte überwiegend in Sicht- und Griffhöhe befinden, während<br />
„Muss-Artikel“ (z. B. Mehl, Zucker, Salz, usw.) auf unteren Regalböden präsentiert<br />
3 http://www.lz-net.de/specials/sortimente/sortimente_01_002.html, 20.12.00<br />
© www.wigy.de 4
Fachbeitrag<br />
werden. In der Kassenzone (sog. „Quengelzone“) werden Artikel präsentiert, die zu<br />
Impulskäufen führen sollen.<br />
die Steigerung der Kaufbereitschaft weiterhin durch Sonderangebote in verkaufs-<br />
schwachen Regalzonen, die Positionierung von Werbebotschaften, spezielle Verkaufs-<br />
förderungsaktionen, u. v. m. erreicht werden soll.<br />
Einordnung des <strong>Praxiskontakte</strong>s in das Curriculum<br />
Im Kontext der Auseinandersetzung mit den „Einflussfaktoren auf das Konsumentenver-<br />
halten“ erfahren Schülerinnen und Schülern durch die Erkundung eines Supermarktes,<br />
wie Erkenntnisse der Konsumentenforschung in gewinnbringende Verkaufsstrategien zur<br />
Beeinflussung der Kunden umgesetzt werden. Es erfolgt an dieser Stelle ein Perspekti-<br />
venwechsel, indem der Private Haushalt aus der Sicht eines Unternehmens betrachtet<br />
wird und zwar im Hinblick darauf, wie sich Produkte und Dienstleistungen so auf Märkten<br />
anbieten lassen, dass Konsumenten bereit sind, für diese zu bezahlen. In diesem Zu-<br />
sammenhang besteht ein enger Zusammenhang zum Praxiskontakt „Werbeagentur“, der<br />
ebenfalls die Möglichkeiten und Mittel der Einflussnahme auf Konsumentscheidungen der<br />
Verbraucher aus Unternehmenssicht erörtert.<br />
Im Zentrum stehen dabei die in der Praxis angewendeten Verkaufsstrategien in Super-<br />
märkten (Aufbau, Platzierungstechniken, Sonderangebote, Grifflücken, Stopper, Quen-<br />
gelzonen, Hintergrundmusik, Farbgestaltung, verkaufsfördernde Maßnahmen, z. B. Pro-<br />
bierstände, etc.). Die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz dieser Strategien bilden u.<br />
a. die Erkenntnisse der Marktforschung, deren Funktionen und Vorgehensweisen im<br />
gleichnamigen Praxiskontakt vorgestellt werden.<br />
Die Erarbeitung der Verkaufsstrategien in einem Supermarkt liefert den Lernenden zahl-<br />
reiche Erkenntnisse, in erster Linie zu den psychologischen Einflussfaktoren des Konsu-<br />
mentenverhaltens (aktivierende und kognitive Prozesse). Gleichzeitig können die diver-<br />
gierenden Interessen der Konsumenten und des Einzelhandels und daraus möglicherwei-<br />
se resultierende Konflikte ermittelt werden.<br />
Das den Verbrauchern weitgehend unbekannte absatzpolitische Instrumentarium soll<br />
durch den Praxiskontakt erfahrbar gemacht werden und helfen, ein kritischeres Konsu-<br />
mentenverhalten zu entwickeln und damit die Position des Verbrauchers zu stärken. Es<br />
muss jedoch auf jeden Fall erkannt werden, dass die absatzpolitischen Maßnahmen der<br />
Anbieter nur angemessen zu interpretieren sind vor dem Hintergrund des legitimen Un-<br />
ternehmensziels, Gewinne zu erzielen.<br />
Die Entwicklung von Gegenstrategien bzw. eines kritischen Bewusstseins lässt sich nicht<br />
allein auf einer kognitiven Ebene erzeugen, sondern wird durch die Möglichkeit eröffnet,<br />
© www.wigy.de 5
Fachbeitrag<br />
Verbraucherverhalten tatsächlich einzuüben. Die Erarbeitung von Erkundungsaufträgen<br />
für einen Supermarkt soll nicht zuletzt diesem Zweck dienen.<br />
Lernziele<br />
An dieser Stelle werden Lernziele formuliert, einerseits bezogen auf die übergeordneten<br />
Erkenntnisse, die Schülerinnen und Schüler generell hinsichtlich der „Einflussfaktoren des<br />
Konsumentenverhaltens“ mit Hilfe des <strong>Praxiskontakte</strong>s erwerben sollen (1., 2.), ander-<br />
seits bezogen auf den konkreten Kontakt (3. – 7.).<br />
Die Schülerinnen und Schüler sollen:<br />
1. wichtige Einflussfaktoren auf die Nachfrage der Privaten Haushalte nach Sachgütern<br />
und Dienstleistungen erkennen.<br />
2. erkennen, dass ökonomische Entscheidungsprobleme Privater Haushalte aus mehre-<br />
ren Elementen bestehen und dass die Interessen der Privaten Haushalte und Unter-<br />
nehmen konflikthaft aufeinander stoßen können.<br />
3. wissen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten bei der<br />
Konzeption von Supermärkten berücksichtigt werden.<br />
4. erkennen, dass Supermärkten ein großes absatzpolitisches Instrumentarium zur Ver-<br />
fügung steht, um Konsumentenverhalten zu beeinflussen.<br />
5. unterschiedliche Verkaufsstrategien kennen lernen (Verkaufsförderungsaktionen,<br />
Platzierungstechniken, Ladengestaltung, Umweltreize (Musik, Farben, Bilder, etc.),<br />
usw.).<br />
6. im Rahmen einer Erkundung Verkaufsstrategien in Supermärkten erkennen und ana-<br />
lysieren.<br />
7. die Erkenntnisse über Verkaufsstrategien im Supermarkt für die Entwicklung von Ge-<br />
genstrategien für ein zunehmend selbstbestimmtes Konsumentenverhalten nutzen<br />
(Verwendung eines Einkaufszettels; Kritik des Anbieterverhaltens, welches zu Lasten<br />
des Verbrauchers geht; wo möglich Kontrolle des eigenen Verbraucherverhaltens aus<br />
der Kenntnis bestimmter Verkaufsstrategien; Information über Verkaufsstrategien in<br />
der Bezugsgruppe).<br />
Unterrichtliche Realisierung<br />
Die Erkundung eines Supermarktes aus dem Einzugsbereich der Schule, z. B. mit Hilfe<br />
eines Grundrissplanes des betreffenden Supermarktes, stellt als methodische Variante<br />
der „Erkundung“ einen sog. Praxistest dar, d. h. die Schülerinnen und Schüler überprüfen<br />
am konkreten Fall die zuvor im Unterricht theoretisch erarbeiteten Kenntnisse. Die Er-<br />
© www.wigy.de 6
Fachbeitrag<br />
kundung erfolgt unter der Aufgabenstellung, folgende Verkaufsstrategien zu untersuchen<br />
bzw. zu identifizieren:<br />
1. Platzierung von Produktgruppen im Markt (durch Markierung der Standorte fast tägli-<br />
cher benötigter Produkte im Grundriss);<br />
2. Standorte von Sonderangeboten, Präsentation von Angeboten (Wühltische, Schütt-<br />
körbe, freistehender Warenstapel, usw.);<br />
3. Platzierung unterschiedlicher Marken innerhalb von Produktgruppen;<br />
4. verkaufsfördernde Maßnahmen (z. B. Gewinnspiele, Aktionsstände, Probierstände).<br />
Aber auch Sachverhalte zum Thema „Ladengestaltung“ können zu Erkundungsaspekten<br />
werden. So ist denkbar, dass Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen unterschiedliche<br />
Läden innerhalb einer Branche, z. B. Bekleidung, im Hinblick auf die Ladengestaltung<br />
erkunden.<br />
Die Durchführung einer Kundenbefragung durch Schülerinnen und Schüler stellt eine wei-<br />
tere Realisierungsmöglichkeit dar. Folgende Fragen könnten ggf. Gegenstand eines Schü-<br />
lerinterviews sein:<br />
(1) Haben Sie einen Einkaufszettel benutzt?<br />
(2) Wie reagieren Sie auf Sonderangebote?<br />
(3) Wie lange waren Sie im Laden?<br />
(4) Wie viel haben Sie insgesamt ausgegeben?<br />
(5) Was haben Sie eingekauft?<br />
(6) Wie viele Waren haben Sie spontan gekauft?<br />
(7) Welchen Weg haben Sie im Laden genommen?<br />
Informationsquellen<br />
Die Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken, insbesondere des<br />
Internets, kann im Rahmen der Vorbereitung einer Erkundung bzw. Expertenbefragung<br />
den Schülerinnen und Schüler eine große Hilfe sein. Bezogen auf den Praxiskontakt „Su-<br />
permarkt“ liefern die folgenden Internetpräsenzen zahlreiche Informationen:<br />
http://www.ehi.org/: EHI EuroHandelsinstitut<br />
http://www.einzelhandel.de/: Hauptverband des deutschen Einzelhandels<br />
http://www.lz-net.de/: Lebensmittelzeitung (zahlreiche Darstellungen zu den Berei-<br />
chen Ladengestaltung, Verkaufsaktionen, etc., in Form allgemeiner Vorstellungen o-<br />
der bezogen auf konkrete Aktionen der Lebensmittelwirtschaft)<br />
© www.wigy.de 7
Materialien<br />
Fachbeitrag<br />
Auch traditionelle Printmaterialien (Beiträge aus Monographien, Zeitungsartikel, Statisti-<br />
ken etc.) können den Lernprozess sowohl in der Vorbereitungs- wie auch in der Auswer-<br />
tungsphase unterstützen.<br />
Das Material M 1 liefert ein problemorientierten Einstieg in das Thema der Beeinflussung<br />
von Verbraucherverhalten. Die Auseinandersetzung zwischen Konsument und Warenan-<br />
bieter verdeutlicht die unterschiedlichen Interessen, welche konflikthaft aufeinander sto-<br />
ßen können. Der Versuch, das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher durch<br />
bestimmte Formen der Ladengestaltung und Warenplatzierung zu beeinflussen, stößt hier<br />
auf Widerstand.<br />
Die aufgezählten Verkaufsförderungsaktionen aus dem Jahr 2000 (M 2), zu finden auf<br />
den Internetseiten der Lebensmittelzeitung (s. o.), konkretisieren die Beeinflussung von<br />
Konsumenten im Einzelhandel am Beispiel ganz konkreter Marken und Produkte. Schüle-<br />
rinnen und Schüler könnten im Rahmen einer Erkundung beispielsweise auch aktuelle<br />
Beispiele sammeln und hinsichtlich der Kundenansprache bewerten.<br />
Ein Vergleich von Einsparmöglichkeiten bei Markentreue/Bezugsquellenflexibilität und<br />
Markenflexibilität/Bezugsquellenbindung (M 3) kann ebenfalls im Zentrum des methodi-<br />
schen Vorgehens stehen.<br />
Beispiel aus dem Inhaltsbereich „Unternehmen“<br />
Insgesamt neun <strong>Praxiskontakte</strong> wurden im Rahmen von Prawis für den Inhaltsbereich<br />
„Unternehmen“ konzeptioniert:<br />
Textilunternehmen<br />
Gewerkschaften/Arbeitgeber<br />
IHK/Arbeitsamt<br />
International operierendes Unternehmen<br />
Agrarunternehmen<br />
Rahmenbedingungen unternehmerischer Aktivitäten am Beispiel Gastgewerbe<br />
Energieunternehmen<br />
Zeitarbeit<br />
Existenzgründung<br />
Praxiskontakt „Energieunternehmen“<br />
Fachliche Einordnung<br />
Die Regulierung der deutschen Energiewirtschaft erfolgte im Wesentlichen durch das Ge-<br />
setz zur Förderung der Energiewirtschaft (EnWiG) vom 13. Dezember 1935, kurz Ener-<br />
© www.wigy.de 8
Fachbeitrag<br />
giewirtschaftsgesetz, und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Diese<br />
Rahmenbedingungen waren über 63 Jahre hinweg stabil. Das Energiewirtschaftsgesetz<br />
bestand damit länger als die Verfassung der Bundesrepublik. Seine Zielstellung war die<br />
sichere, flächendeckende und kostengünstige Versorgung mit Energie. Um dieses Ziel zu<br />
erreichen, wurden einige Regeln implementiert, die der Energiewirtschaft innerhalb unse-<br />
rer <strong>Wirtschaft</strong>sordnung eine Sonderrolle zukommen ließen und damit für ihre spezifische<br />
institutionelle Entwicklung verantwortlich waren.<br />
Die Kernpunkte des Regulierungsrahmens waren:<br />
a) Konzessionsverträge mit Ausschließlichkeitsklauseln<br />
Die EVU zahlten den Gemeinden Abgaben für die alleinige Nutzung der öffentlichen<br />
Wege.<br />
b) Demarkationsverträge<br />
In privatwirtschaftlichen Verträgen verpflichteten sich die Vertragspartner, nicht im Ver-<br />
sorgungsgebiet des jeweils anderen tätig zu werden (horizontale Demarkation) bzw.<br />
sich nicht auf der Wertschöpfungsstufe des anderen zu engagieren (vertikale Demar-<br />
kation).<br />
c) Preis- und Innovationsaufsicht<br />
Die <strong>Wirtschaft</strong>sminister der Länder nahmen Einfluss auf die elementaren betriebswirt-<br />
schaftlichen Innovationsentscheidungen (Neubau, Stilllegung etc.), während die Bun-<br />
destarifordnung die Preise für Tarifkunden festlegte und von staatlicher Seite Marktzu-<br />
gang und Geschäftsbedingungen beeinflusst wurden.<br />
Die EVU hatten dabei die Verpflichtung, alle natürlichen und juristischen Personen in ih-<br />
rem jeweiligen Gebiet gemäß der Tarifbedingungen zu versorgen und dabei seit 1990<br />
einen gewissen Anteil aus erneuerbaren Energien einzuspeisen.<br />
Mit der Verabschiedung der „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates<br />
betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt“ 1997 und dem<br />
daraus folgenden Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes in der Bundesrepu-<br />
blik Deutschland am 01.01.1999 setzte eine umfassende Deregulierung mit der fast voll-<br />
ständigen Aufhebung der Regulierungstatbestände in diesem Bereich ein. Die bisherigen<br />
Versorgungsgebiete für Gas und Strom wurden vollständig abgeschafft, eine staatliche<br />
Regulierung des Preises entfiel, eine Vorrangstellung von Strom aus Kraft-Wärme-<br />
Kopplung und erneuerbarer Energie fand Erwähnung und die EVU wurden zur getrennten<br />
Rechnungslegung ihrer verschiedenen Tätigkeitsbereiche verpflichtet. Parallel wurde das<br />
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung dergestalt modifiziert, dass eine Verweigerung<br />
© www.wigy.de 9
Fachbeitrag<br />
der Durchleitung des Stroms eines Anbieters durch die vorhandenen Netze eines anderen<br />
Anbieter verhindert wurde.<br />
Insbesondere für die ehemaligen Stadtwerke verursachten diese Entwicklungen einen<br />
Prozess der vollkommenen Neuorientierung. Waren sie vorher stark hierarchisch organi-<br />
siert, von „technischem“ Denken dominiert, bei Preisen und Verträgen stark gebunden<br />
und im Erscheinungsbild einer Behörde ähnelnd, die den Kunden als „Abnehmer“ defi-<br />
nierte, um den nicht geworben werden musste, so galt es nun, sich unter extremem<br />
Zeitdruck den Gegebenheiten eines offenen Marktes anzupassen. Sowohl die Beziehun-<br />
gen zur Außenwelt als auch die sachlichen und sozialen Binnenbeziehungen wurden<br />
grundsätzlich reorganisiert, wobei Rationalisierungsmaßnahmen eine wesentliche Rolle<br />
spielten. Unternehmensleitbilder wurden entwickelt, um eine vollkommen neue Unter-<br />
nehmenskultur entwickeln zu können, die nun die Wünsche der Kunden (!) und deren<br />
Befriedigung in das Zentrum des Denkens und Handelns jedes einzelnen Mitarbeiters<br />
stellte. Damit einhergehend kam es in vielen Fällen zu einer Erweiterung und Diversifika-<br />
tion der Angebotspalette, v. a. im Bereich der Telekommunikation.<br />
An vielen Orten stellte diese generelle Veränderung - gerade auch angesichts des äußerst<br />
knappen Zeitfensters - insbesondere viele der älteren Mitarbeiter vor große Probleme. Es<br />
waren nicht unerhebliche Widerstände zu überwinden, bevor die Binnenbeziehungen<br />
stärker durch Schnelligkeit, Flexibilität, neue Formen der Zusammenarbeit (v. a. Projekt-<br />
arbeit), Leistungsorientierung, Eigeninitiative und Lernbereitschaft geprägt wurden. Ge-<br />
rade auf die offiziellen Vertreter der Arbeitnehmer kam in diesem Zusammenhang die<br />
schwierige Aufgabe zu, die Entwicklung zu marktwirtschaftlichen Strukturen angesichts<br />
der Zukunftsperspektiven zu unterstützen und gleichzeitig die Belange der Mitarbeiter<br />
weiter zu vertreten.<br />
Einordnung des <strong>Praxiskontakte</strong>s<br />
Es wird deutlich, dass gerade die Untersuchung der Entwicklung der Energiebranche in<br />
den letzten Jahren den Schülerinnen und Schülern wesentliche Erkenntnisse im Hinblick<br />
auf die Auswirkungen von (massiven) Veränderungen der Rechtsordnung auf die Organi-<br />
sation von Unternehmen liefern kann. Im Zentrum des Praxiskontakts stehen dabei nicht<br />
die ordnungspolitischen Aufgaben der Regulierung bzw. Deregulierung auf Seiten des<br />
Staates, sondern vielmehr - entsprechend der Verortung im Inhaltsbereich „Unterneh-<br />
men“ - die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf die Organisation und das Handeln von<br />
Unternehmen betroffener <strong>Wirtschaft</strong>szweige. Und auch, wenn nur die wenigsten Schüle-<br />
rinnen und Schüler bereits über einen eigenen Hausstand verfügen und so als Abnehmer<br />
der Güter „Strom“ und „Gas“ einen direkten Bezug zu den EVU haben, werden sie heute<br />
© www.wigy.de 10
Fachbeitrag<br />
von deren erweiterter Angebotspalette - beispielsweise im Bereich der Telekommunikati-<br />
on - als Zielgruppe z. T. direkt angesprochen.<br />
Lernziele<br />
Auch hier kann, vergleichbar mit dem Beispiel aus dem Inhaltsbereich „Private Haushal-<br />
te“, unterschieden werden zwischen solchen Lernzielen, die generelle Erkenntnisgewinne<br />
formulieren (1. – 3.) und solchen, die sich spezifisch auf den vorliegenden Praxiskontakt<br />
konzentrieren (4. – 8.).<br />
Die Schülerinnen und Schüler sollen<br />
wesentliche Aufgaben, Formen und Veränderungen der Organisation von Unternehmen<br />
kennen lernen.<br />
erkennen, dass sich betriebliches Geschehen im Rahmen einer <strong>Wirtschaft</strong>s- und Rechts-<br />
ordnung vollzieht.<br />
erkennen, dass <strong>Wirtschaft</strong> und Gesellschaft einem permanenten Strukturwandel unterlie-<br />
gen, der sämtliche Unternehmensaktivitäten beeinflusst.<br />
am Beispiel der Energiewirtschaft erarbeiten, welche Auswirkungen Veränderungen der<br />
rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation eines Unter-<br />
nehmens haben.<br />
am Beispiel „Stadtwerk“ konkret den Ablauf und die Probleme der Neuordnung der inter-<br />
nen und externen Beziehungen kennen lernen.<br />
den Wandel von Arbeits- und Beschäftigungsformen im Bereich der Energieversorgung<br />
analysieren und im Hinblick auf die generelle Entwicklung im Arbeitsmarkt verorten.<br />
erkennen, welche Auswirkungen die Veränderungen der Verbraucherpräferenzen auf die<br />
Vorgehensweise der Unternehmen im Hinblick auf Organisation, Ansprache der Konsu-<br />
menten (früher „Abnehmer“, heute „Kunden“), Angebotspalette etc. haben.<br />
den Einfluss neuer Informations- und Kommunikationstechnologien hinsichtlich der Ent-<br />
wicklung von Unternehmensstrategien - beispielsweise hinsichtlich der Aktivitäten ehe-<br />
mals „reiner“ Stromanbieter im Telekommunikationsmarkt - untersuchen und die damit<br />
einhergehenden organisatorischen Auswirkungen erkennen.<br />
Unterrichtliche Realisierung<br />
Im Rahmen einer Erkundung oder Expertenbefragung können die Schülerinnen und<br />
Schüler die Veränderungen des Energiesektors und die Auswirkungen auf die Organisati-<br />
on der EVU – mithilfe des Arbeitsblattes (M 4) oder eigenständig – erarbeiten. Dabei, und<br />
dies soll noch einmal wiederholt werden, geht es weniger um die Erarbeitung gesetzlicher<br />
Details als vielmehr um die Organisation derart umfassender Veränderungen von Unter-<br />
© www.wigy.de 11
Fachbeitrag<br />
nehmensstrukturen. Dabei können die Aufgaben der Unternehmensführung, aber bei-<br />
spielsweise auch die Folgen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – entsprechend der un-<br />
terrichtlichen Zielsetzungen - betrachtet werden.<br />
Mit Hilfe des Arbeitsblatts M4 haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im<br />
Rahmen einer Erkundung bzw. Expertenbefragung die grundsätzliche Veränderung un-<br />
ternehmerischer Organisation in dieser Branche zu untersuchen. Mögliche Ergebnisse für<br />
die Ausprägung von (ehemaligen) Stadtwerken bzw. Unternehmen der Energiebranche<br />
vor und nach der Deregulierung finden sich in den folgenden Übersichten:<br />
Merkmal Ausprägung<br />
Organisationsstruktur stark hierarchisch<br />
feste Abteilungsstruktur<br />
Kunden (Anzahl, Zusammensetzung) große Zahl abhängiger Tarifkunden und<br />
wenige, ebenfalls abhängige Sonderver-<br />
tragskunden<br />
Kunde heißt Abnehmer<br />
Personal (Anzahl, Zusammensetzung) „technisches Denken“ dominiert<br />
Unternehmensführung:<br />
technischer und/oder kaufmännischer Ge-<br />
schäftsführer, evtl. Arbeitsdirektor<br />
Mitarbeiter:<br />
lange Betriebszugehörigkeit<br />
sicherheitsbewusster Typ (öffentlicher<br />
Dienst)<br />
Preise und Verträge genehmigte Tarife<br />
Erscheinungsbild Behörde<br />
Abb. 1: Stadtwerk vor der Deregulierung<br />
individuelle Vereinbarungen mit Großkunden<br />
lange Vertragslaufzeiten<br />
öffentlicher Auftrag prägt Selbstverständnis<br />
enge Verbindung zur Kommunalpolitik<br />
© www.wigy.de 12
Merkmal Ausprägung<br />
Organisationsstruktur dezentral<br />
Abb. 2: Stadtwerk nach der Deregulierung<br />
flache Hierarchien<br />
Teamorientierung<br />
Fachbeitrag<br />
Kunden (Anzahl, Zusammensetzung) große Zahl an Klein- und Mittelverbrauchern<br />
wenige Großkunden<br />
Gefahr der Abwanderung zur Konkurrenz<br />
Abnehmer heißt Kunde<br />
Personal (Anzahl, Zusammensetzung) „kaufmännisches Denken“ dominiert<br />
Unternehmensführung:<br />
versteht sich als Industriemanagement<br />
Mitarbeiter:<br />
Betriebszugehörigkeit verkürzt sich<br />
eigenverantwortlicher, anpassungsbereiter<br />
Typ ist gefragt<br />
neue Stellen im Marketing, Controlling und<br />
Handel<br />
Preise und Verträge marktorientierte Tarife<br />
vielfältige Vertragsformen<br />
kürzere Vertragslaufzeiten<br />
Erscheinungsbild Dienstleistungsunternehmen<br />
geringere Bindung an die Kommunalpolitik<br />
Quelle: Salge, K. (2000): Regulierung und Deregulierung (am Beispiel Energiemarkt),<br />
WIS! VE IV.2, M 14<br />
Informationsquellen<br />
http://www.vdew.de: Verband der Elektrizitätswirtschaft (umfangreiche Informationen zu<br />
den EVU der Bundesrepublik Deutschland, u. a. eine Auflistung aller Internetadressen der<br />
deutschen Unternehmen in dieser Branche).<br />
http://www.bmwi.de: Bundesministerium für <strong>Wirtschaft</strong> und Technologie (Gestaltung und<br />
Veränderung des Rechtsrahmens und der unternehmerischen Aktivitäten).<br />
© www.wigy.de 13
Materialien<br />
Fachbeitrag<br />
Die ausschlaggebenden Gesetzestexte lassen sich zur Vorbereitung des Praxiskontakts im<br />
Internet, beispielsweise mit Hilfe der im vorherigen Abschnitt angegebenen Adressen,<br />
leicht recherchieren und, vermutlich in Auszügen, zur Verfügung stellen.<br />
Bezogen auf die Veränderung der Organisation und im Zusammenhang mit dem bereits<br />
vorgestellten Arbeitsblatt M 4 kann die Vorstellung des aktuellen Unternehmensleitbilds<br />
eines EVU, hier in M 5 beispielhaft der Oldenburger EWE AG, Hinweise zu den momenta-<br />
nen Herausforderungen, denen sich ein solches Unternehmen heute gegenüber sieht,<br />
liefern.<br />
Der Zeitungsartikel (M 6), der einen aktuellen Überblick über die Umsetzung der gesetz-<br />
lichen Regelungen, die Entwicklung des deregulierten Marktes (auch die mittlerweile rele-<br />
vanten Strom-Börsen finden hier Erwähnung) sowie den Stand der organisatorischen<br />
Umstrukturierung der Unternehmen, könnte andererseits v. a. in der Reflexionsphase<br />
einer Erkundung bzw. Expertenbefragung kommen, insbesondere, da er die nächsten<br />
großen Herausforderungen für die EVU verbunden mit der bevorstehenden Deregulierung<br />
des Gasmarktes skizziert.<br />
© www.wigy.de 14