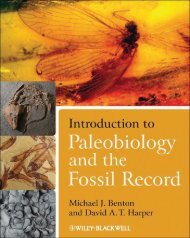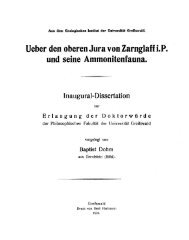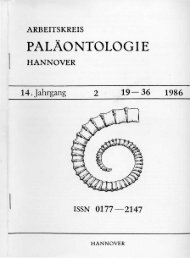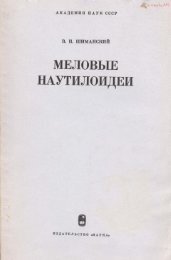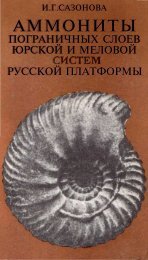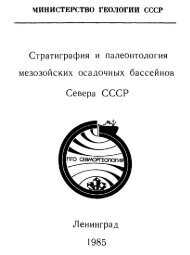Stratigraphische und faunistische Beziehungen im Weißen Jura ...
Stratigraphische und faunistische Beziehungen im Weißen Jura ...
Stratigraphische und faunistische Beziehungen im Weißen Jura ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Neues Jb.Geol. u. Paläont., Abh. 108 2 150-214 Stuttgart, Juli 1959<br />
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> (K<strong>im</strong>eridgien) zwischen<br />
Süddeutschland <strong>und</strong> Ardeche<br />
Von<br />
Helmut Holder, Tübingen <strong>und</strong> Bernhard Ziegler, Zürich<br />
Mit Tafel 17—22 sowie 8 Abbildungen <strong>im</strong> Text <strong>und</strong> auf 2 Beilagen
<strong>im</strong><br />
Hfl«« HöW«- and Bernhard Ziegler<br />
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> (K<strong>im</strong>eridgien) zwischen<br />
Süddeutschland <strong>und</strong> Ardeche<br />
Von<br />
Helmut Holder, Tübingen <strong>und</strong> Bernhard Ziegler, Zürich<br />
Mit Tafel 17—22 sowie 8 Abbildungen <strong>im</strong> Text <strong>und</strong> auf 2 Beilagen<br />
Abstractum: Genaue Profile in Verbindung mit Fossil-Listen ermöglichen<br />
einen stratigraphischen Vergleich <strong>im</strong> K<strong>im</strong>eridgien zwischen Ardeche<br />
<strong>und</strong> Süddeutschland. Äquivalente des süddeutschen „Suebiums" werden<br />
nachgewiesen. Einige Ammonitenformen werden besprochen.<br />
Einleitung<br />
Das K<strong>im</strong>eridgien am Berg Crussol . .<br />
Inhalt<br />
Die ältere Literatur<br />
Crussol-Profile<br />
Fossil-Listen der Crussol-Profile<br />
Das Profil Le Pouzin<br />
Das Profil<br />
Faunistischer Nachweis der Subeumela-Zone<br />
Vergleichende lithologische Bemerkungen . .<br />
Vergleich des Profiles Ardeche — Süddeutschland<br />
Das mittlere UnterMmeridgien<br />
Die „Glaukonitbank"<br />
„Suebium" (Oberes UnterMmeridgien)<br />
Äquivalent des <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> £ 1 (ülmensis- einschl. Lithographi-<br />
Seite<br />
151<br />
153<br />
153<br />
156<br />
164<br />
170<br />
170<br />
171<br />
172<br />
cum-Schichten) am Crussol 184<br />
Ammoniten-Beschreibungen<br />
Zusammenfassung . . . .<br />
Schriften-Verzeichnis . . .<br />
174<br />
174<br />
178<br />
179<br />
186<br />
207<br />
209
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 151<br />
Einleitung<br />
Die <strong>Jura</strong>schollen der Ardöche am Rande des Französischen<br />
Zentralplateaus, seit Mitte des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts einer der Brenn<br />
punkte französischer <strong>Jura</strong>-Stratigraphie (Lit. s. A. Riche &<br />
F. Roman, 1921, S. 9), haben seit A. Oppel (1863a) auch die Auf<br />
merksamkeit der süddeutschen Stratigraphen auf sich gezogen,<br />
zumal insbesondere die Montagne de Crussol starke lithologische<br />
<strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> Ähnlichkeiten mit den süddeutschen Verhält<br />
nissen erkennen ließ.<br />
Nachdem F. Fontannes (in E. Dumortier & F. Fontannes<br />
1876 <strong>und</strong> F. Fontannes 1879a) die Ammoniten aus dem <strong>Weißen</strong><br />
<strong>Jura</strong> des Berges Crussol am rechten Ufer der Rhone gegenüber<br />
Valence beschrieben hatte, spielten die dort aufgestellten Arten<br />
auch in der süddeutschen Malm-Literatur eine wichtige Rolle. Der<br />
Vergleich allein anhand der Figuren sowie die stratigraphische Ein<br />
stufung waren dabei freilich mit mancher Unsicherheit belastet.<br />
F. Roman hat daher wiederholt, zuletzt 1950, auf die notwen<br />
dige Revision der Ammoniten-Fauna vom Crussol hingewiesen, die<br />
auch <strong>im</strong> Interesse stratigraphischer Arbeiten <strong>im</strong> süddeutschen<br />
<strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> geboten erscheint <strong>und</strong> von gemeinsamen Bemühungen<br />
von französischer <strong>und</strong> deutscher Seite zu erhoffen ist.<br />
Der biostratigraphische Vergleich beider Gebiete verspricht<br />
auch eine verbesserte <strong>und</strong> verfeinerte Deutung der Profile <strong>und</strong> darin<br />
vorhandener oder vermeintlicher Lücken. Schon F. Blanchet<br />
(1923) konnte die chronologische Einstufung der von Th. Schneid<br />
(1915) studierten Neuburger Kalke <strong>und</strong> ihrer Ammoniten-Fauna<br />
anhand eines südostfranzösischen Profils korrigieren. Über die<br />
Äquivalente der Hangenden Bankkalke (f 3) des Schwäbischen <strong>Jura</strong><br />
<strong>und</strong> der entsprechenden Reisbergschichten (Th. Schneid 1914)<br />
des Fränkischen <strong>Jura</strong> wissen wir dagegen in Frankreich auch heute<br />
noch nicht Bescheid.<br />
Vor allem aber ist durch die Arbeiten Th. Schneid's (1914),<br />
F. Berckhemer's (1922,1926) <strong>und</strong> A. Roll's (1931,1933) zwischen<br />
der Pseudomutabilis- <strong>und</strong> der Lithographicum-Zone des süddeut<br />
schen Obermalms eine Ammoniten-Fauna bekannt geworden, die<br />
sich durch einen erheblichen Prozentsatz nur hier gef<strong>und</strong>ener<br />
Arten <strong>und</strong> Gattungen auszuzeichnen, ja als weitgehend endemisch<br />
zu erweisen schien.
152 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Eine Ablagerungslücke von entsprechender Zeitspanne in der<br />
Ardeche erschien dabei von Anfang an unwahrscheinlich, weil ins<br />
besondere Vertreter der Gattung Eybonoticeras („Waagenia"<br />
leckeri u. a.) in beiden Gebieten gleichartig <strong>und</strong> gleichzeitig auf<br />
treten. Aber wo blieben in der Ardeche die anderen Leitformen<br />
dieses Schichtenstoßes, den Th. Schneid als „Stufe der Waagenia<br />
leckeri" <strong>und</strong> E. Hennig (1943) in etwas anderer Abgrenzung als<br />
„Suebium" bezeichnete — warum blieben Sutneria subeumela<br />
Schneid, Oxyoppelia fischeri (Berckh.) <strong>und</strong> pseudopolitula<br />
(Berckh.), Perisphinctes (Virgataxioeeras) setatus Schneid, Peri<br />
sphinctes siliceus (Quenstedt) <strong>und</strong> andere in Süddeutschland<br />
charakteristische Arten sonst unbekannt ?<br />
Die offensichtlichen Unterschiede der <strong>faunistische</strong>n Kompo<br />
nenten <strong>im</strong> süddeutschen <strong>und</strong> <strong>im</strong> stärker mediterran beeinflußten<br />
südostfranzösischen Malm ließen es freilich begreiflich erscheinen,<br />
daß manche typisch süddeutschen Arten den Weg in die Tethys<br />
vielleicht ebensowenig zu finden vermochten, wie die in der<br />
Ardeche häufigen Phylloceraten <strong>und</strong> Lytoceraten in umgekehrter<br />
Richtung. Auch konnte man zur Erklärung endemischer Elemente<br />
vielleicht mit ökologischen Bedingungen besonderer Art <strong>im</strong> Zu<br />
sammenhang mit den ausgebreiteten Schwammbauten des süd<br />
deutschen Meeresraumes rechnen. Zunächst aber war zu prüfen,<br />
ob sich die große <strong>faunistische</strong> Lücke der südostfranzösischen Pro<br />
file nicht durch erneute Arbeit <strong>im</strong> Gelände schließen lasse.<br />
Wir haben der Lösung dieser Frage mehrere Sammelreisen ge<br />
widmet. 1939 konnte H. Holder dank eines Reisestipendiums der<br />
Württembergischen Naturaliensammlung (aus der Freiherr-von-<br />
Müller-Stiftung) einen Überblick über den <strong>Jura</strong> Südostfrankreichs<br />
gewinnen. 1956 <strong>und</strong> 1957 verbrachten die Verfasser zusammen mit<br />
Dr. W. Buck, Dr. H. Schumann <strong>und</strong> Dr. K. Vogel mehrere Wo<br />
chen am Berge Crussol <strong>und</strong> in seiner Umgebung. Bei systematischem<br />
Durchklopfen ausgedehnter Profile konnte ein Teilerfolg erzielt<br />
werden, über den hier berichtet sei.<br />
Für die beiden letztgenannten Reisen standen uns durch Prof. Dr.<br />
0. H. Schindewolf's fre<strong>und</strong>liche Vermittlung Reisebeihilfen der Deutschen<br />
Forschungsgemeinschaft zur Verfügung, die auch den für Fahrten bis nahe<br />
an die Aufschlüsse sowie für Werkzeug- <strong>und</strong> Materialbeförderung sehr<br />
geeigneten Combi-Wagen zur Verfügung stellte. Für die Reise 1957 gewährte<br />
außerdem die Französische Botschaft in Bonn entgegenkommenderweise<br />
eine finanzielle Unterstützung, die uns durch fre<strong>und</strong>liche Vermittlung von
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 153<br />
Herrn Direktor Lesage (Centre d'Etudes francaises in Tübingen) zuteil<br />
wurde. Eine Förderung unserer Unternehmung wurde uns auch durch<br />
Prof. Dr. E. Kuhn-Schnyder (Zürich), sowie — durch Übersendung von<br />
Vergleichsammoniten aus dem Fränkischen Obermalm — durch Prof.<br />
Franz Mayr (Eichstätt) in liebenswürdiger Weise zuteil. Spendern, Vermittlern<br />
<strong>und</strong> Förderern sei auch hiermit unser geziemender <strong>und</strong> herzlicher Dank<br />
ausgesprochen.<br />
In Dankbarkeit gedenken wir aber auch der französischen Kollegen, die<br />
uns in fre<strong>und</strong>licher Weise berieten <strong>und</strong> unterstützten. Die Herren Prof. Dr.<br />
Gautier <strong>und</strong> Prof. Dr. Viret (Lyon) haben unseren Absichten zunächst<br />
brieflich zugest<strong>im</strong>mt, obwohl wir damit in ihr engeres Arbeits- <strong>und</strong> Studiengelände<br />
übergriffen. Wir hoffen, unseren Dank für dieses Entgegenkommen<br />
durch einige Aufhellungen abstatten zu können, die sich aus der süddeutschen<br />
Sicht der Dinge ergeben haben. Wir freuen uns darüber, daß sich<br />
französische Kollegen <strong>im</strong> süddeutschen <strong>Jura</strong> mit der gleichen Zielsetzung<br />
umzusehen beginnen.<br />
Herr Professor Gautier hat uns die Sammlung der FoNTANNEs'schen<br />
Originale <strong>im</strong> Laboratoire geologique der Universität Lyon zugänglich<br />
gemacht, wobei wir die fre<strong>und</strong>liche Hilfe der Herren Dr. Busnardo <strong>und</strong><br />
R. Enay (der zu gleicher Zeit selbst <strong>im</strong> <strong>Jura</strong> der Ardeche arbeitete) erfahren<br />
durften. Die Herren Prof. Dr. Moset <strong>und</strong> Dr. Breistroffer haben die<br />
Besichtigung der Sammlungen <strong>im</strong> Laboratoire geologique in Grenoble in<br />
liebenswürdiger Weise ermöglicht. Herr Laurent (St. Peray am Crussol)<br />
hat uns die Schätze seiner Fossilsammlung gezeigt <strong>und</strong> zusammen mit den<br />
Herren A. Blanc (Valence), Prof. G. Clauzade (Apt) <strong>und</strong> Prof. Rosier<br />
(Valence) auf Exkursionen am Crussol geführt.<br />
Das K<strong>im</strong>eridgien am Berge Crussol 1<br />
Die ältere Literatur<br />
An der über die Rhone aufsteigenden Ostwand des Berges<br />
Crussol stehen über einem 70—80 m mächtigen Paket dünnbanM-<br />
ger Kalke <strong>und</strong> Mergel r<strong>und</strong> 100 m Felsenkalke (Calcaires du<br />
Chäteau Huguenin 1874 = Calcaires ruiniformes Toucas 1889)<br />
an. Die Schichten dieser <strong>Jura</strong>-Scholle, die am Kristallinrand des<br />
Zentralplateaus abgesunken <strong>und</strong> in sich gestört sind, steigen nach<br />
Süden an, so daß der Südrand des langgestreckten, hier fast 300 m<br />
über die Ebene aufragenden Höhenrückens keine Felsenkalke mehr<br />
trägt.<br />
A. Oppel (1863a) hat als erster erkannt, daß der <strong>Jura</strong> des<br />
Berges Crussol nicht nur bis ins Oxfordien reicht, sondern auch<br />
1<br />
Wir fassen das K<strong>im</strong>eridgien <strong>im</strong> Sinne von W. J. Arkell (1956).
154 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
fossilreiche Tenuilobaten-Schichten s. 1. <strong>und</strong> — von ihm noch nicht<br />
näher untersuchtes — K<strong>im</strong>eridgien umfaßt.<br />
Insbesondere F. Hugüenin, ein unermüdlich tätiger Sammler<br />
aus Valence, hat die vor allem in Mallet's Besitz befindlichen<br />
Steinbrüche auf Fossilien untersucht <strong>und</strong> 1874 das Ergebnis seiner<br />
vorbildlich horizontierten Ammoniten-Aufsammlungen (1400 bis<br />
1500 Stück) aus 11 Bänken bzw. Bankpaketen (I—XI) der Tenui-<br />
lobaten-Schichten veröffentlicht. F. Fontannes nahm die Be<br />
schreibung dieser Ammoniten vor (E. Dumortier & F. Fontannes<br />
1876).<br />
F. Hugüenin hat sich daraufhin auch dem Fossilgehalt der<br />
schwerer erschließbaren Felsenkalke in der Umgebung der Schloß<br />
ruine Crussol zugewandt, wozu Steinbrucharbeiten an der Felsen<br />
stirn südlich des Schlosses zur Materialgewinnung für Eisenbahn-<br />
<strong>und</strong> Uferbauten längs der Bhone günstige Gelegenheit boten. Eine<br />
unmittelbare Horizontierung der F<strong>und</strong>e war hierbei allerdings un<br />
möglich, da sie in losgesprengten, hangab gerollten Blöcken <strong>und</strong><br />
z. T. auch erst am Ort ihrer Verwendung gemacht wurden (F. Ro<br />
man 1950, S. 65).<br />
F. Hugüenin hat jedoch versucht, seine F<strong>und</strong>e wenigstens nach<br />
lithologischen Merkmalen drei Abteilungen der Felsenkalke zuzu<br />
ordnen, denen wir F. Fontannes' <strong>und</strong> unsere Gliederung zur Seite<br />
stellen:<br />
Hugüenin Fontannes<br />
30—40 m gelbe <strong>und</strong> Assises<br />
weiße Kalke; hellrote superieures<br />
<strong>und</strong> gelbe, von Spatadern<br />
durchsetzte Kalke<br />
30 m bläuliche <strong>und</strong> Assises<br />
gelbliche, splitternde moyennes<br />
Kalke, nach oben an<br />
Feinkörnigkeit zunehmend<br />
30 m heller gelber Kalk; Assises<br />
graublauer Kalk mit inferieures<br />
mattem Bruch, durch<br />
Mergel von den liegenden<br />
Tenmlobatenschichten<br />
getrennt<br />
Holder & Ziegler<br />
F<strong>und</strong>schicht 28—21<br />
(37 m)<br />
Hangendes von F<strong>und</strong>schicht<br />
20 bis F<strong>und</strong>schicht<br />
19 (10 m)<br />
Hangendes von F<strong>und</strong>schicht<br />
18 bis „Glaukonitbank"<br />
(19 m)<br />
Liegendes der „Glaukonitbank"<br />
bis ungefähr<br />
ins Hangende<br />
der F<strong>und</strong>schicht 2<br />
(Profil Guilherand)
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 155<br />
Die letzte Spalte erhebt nur Anspruch auf ungefähre Gleichsetzung. —<br />
Die von F. Hugüenin herangezogenen lithologischen Merkmale heben sich<br />
nur unscharf ab.<br />
F. Fontannes (1879a) hat auch die Ammoniten der Calcaires<br />
du Chäteau in seinem bekannten Werke sorgfältig beschrieben. Er<br />
war sich dabei der taxionomischen Problematik angesichts der bei<br />
vielen Ammoniten fließenden Formen bewußt. Nicht ohne Be<br />
denken entschied er sich bei nicht ganz sicherer Identifizierung mit<br />
schon bekannten Arten für die Neuaufstellung von Arten oder we<br />
nigstens von Varietäten, die er aber ebenfalls mit neuen, sonst in<br />
der Gattung nicht verwendeten Namen versah.<br />
Stratigraphisch wies er die Assises inferieures noch der Tenuilo-<br />
baten-Zone zu <strong>und</strong> betonte auch für die Assises moyennes die engen,<br />
dorthin weisenden <strong>faunistische</strong>n <strong>Beziehungen</strong>. In den Assises<br />
superieures sah er dagegen ein Äquivalent der Beckeri-Zone, für<br />
die er Waagenia leckeri, Oppelia steraspidoides, Haploceras sulelirnatum,<br />
Phylloceras mesophanes u. a. für charakteristisch hielt.<br />
Er bezeichnete die Beckeri-Zone auch als Steraspis-Zone in An<br />
lehnung an L. Würtenberger (1868), der Oppelia steraspis — ent<br />
sprechend der A. OpPELschen Zonenfolge (1858) — <strong>im</strong> Badischen<br />
<strong>Jura</strong> wohl irrtümlicherweise zusammen mit Ammonites pseudo-<br />
mutabilis, eudoxus <strong>und</strong> anderen Arten aus dem <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> 8 dicht<br />
über der Tenuilobaten-Zone erwähnt. Es ist uns wahrscheinlich,<br />
daß L. Würtenberger damals glatte S-Strebliten mit Ammonites<br />
steraspis verwechselt hat. Ein zu tiefer Ansatz der Steraspis-Zone<br />
findet sich aber auch noch später in der Literatur: E. Rod 1937,<br />
S. 32, W. J. Arkell 1957, S. L327 (wo Enosphinctes suleumelus<br />
aus der Steraspis-Zone genannt wird).<br />
F. Fontannes hat die Felsenkalke des Berges Crussol also den<br />
höchsten Tenuilobatus-Schichten s. 1. bis zur Beckeri-Zone des<br />
süddeutschen Profils gleichgesetzt. Dabei wurden damals in Süd<br />
deutschland die Beckeri-Schichten — entsprechend M. Neumayr—<br />
noch nicht von den liegenden Pseudomutabilis-Schichten unter<br />
schieden. F. Fontannes hielt es jedoch für möglich, daß der obere<br />
Teil der Crussol-Kalke auch noch den Lithographischen Platten-<br />
kalken von Solnhofen entsprechen könne, da sich der von dort<br />
bekannten Oppelia liihographica (Oppel) ähnliche Formen— die wir<br />
nicht von ihr abtrennen — auch am Crussol finden.
156 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
F. Fontannes rechnete mit einem sehr allmählichen Ausklingen<br />
alter <strong>und</strong> Einsetzen neuer Arten, das regional wohl auch zu ver<br />
schiedenen Zeiten stattfand. Anders als A. Oppel zögerte er,<br />
scharfe <strong>und</strong> weitreichende Grenzen zu ziehen. So sehr diese Vor<br />
stellung für eine Anzahl weißjurassischer Ammoniten-Arten auch<br />
zutreffen mag, darf doch nicht übersehen werden, daß sich die<br />
Grenzen für F. Fontannes infolge einer unsicheren Horizon-<br />
tierung <strong>und</strong> einiger Fehlbest<strong>im</strong>mungen (z. B. Streblites tenuilobatus<br />
noch in den Assises superieures) wohl stärker als in der Natur ver<br />
wischt haben.<br />
Bemerkenswert ist aber, daß er einen relativ erheblichen Fau<br />
nenschnitt mit Beginn der Assises superieures festgestellt hat, der<br />
ungefähr dem einschneidenden Wechsel an der süddeutschen dje-<br />
Grenze entsprechen dürfte.<br />
Crussol-Profile<br />
Die nachstehenden Profile wurden <strong>im</strong> Gebiet des Berges Crussol<br />
aufgenommen. Die fetten Ziffern verweisen dabei auf die entspre<br />
chenden F<strong>und</strong>schichten der Fossillisten (S. 164ff.). Die Lage der<br />
Profile ist auf Abb. 1 dargestellt.<br />
I. Carriere Mallet, kleiner Bruch.<br />
Hangendes nicht aufgeschlossen<br />
über 300 cm Kalk, dickbankig, rot gefleckt (3)<br />
280 cm Mergel, mit etwa sieben, bis 25 cm mächtigen Kalkbänken<br />
(2)<br />
220 cm Kalk, drei Bänke, davon die unterste durch grusigen Mergel<br />
abgetrennt (zusammen mit den tiefer folgenden Bänken:<br />
1)<br />
60 cm Kalk<br />
20 cm Kalk, mergelig<br />
40 cm Kalk<br />
28 cm Kalk<br />
30 cm Kalk<br />
50 cm Kalk, mergelig, obere 20 cm fester<br />
60 cm Kalk<br />
25 cm Mergel mit mergeligem Kalk<br />
55 cm Kalk<br />
30 cm Kalk, mergelig<br />
65 cm Kalk<br />
20 cm Mergel, grusig<br />
Liegendes nicht aufgeschlossen
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 157<br />
II. Carriere Mallet, großer Bruch.<br />
Hangendes nicht aufgeschlossen<br />
ca. 300 cm Kalk, dickbankig (14)<br />
20 cm Kalk, mürb, sandig-mergelig, gelbbraun („Glaukonitbank")<br />
60 cm Kalk (13)<br />
50 cm Kalk (12)<br />
90 cm Kalk<br />
50 cm Kalk<br />
55 cm Kalk<br />
110 cm Kalk, rot gefleckt (11)<br />
70 cm Kalk<br />
85 cm Kalk, obere 15 cm abgespalten<br />
100 cm Kalk, obere 20 cm<br />
durch Fuge abgespalten<br />
(10)<br />
10 cm Mergel, rötlich<br />
50 cm Kalk (9)<br />
10 cm Kalk, mergelig verwitternd<br />
100 cm Kalk<br />
50 cm Kalk, oben <strong>und</strong> unten<br />
mergelig verwitternd<br />
45 cm Kalk<br />
20 cm Mergel mit mergeligem<br />
Kalk (8)<br />
90 cm Kalk, drei Bänke mit<br />
Mergelfugen<br />
200 cm Kalk, gelblich mit rötlichen<br />
Flecken<br />
20 cm Kalk, mergelig, z. T.<br />
rot eingefärbt<br />
60 cm Kalk<br />
70 cm Kalk, drei Bänke mit<br />
Mergelfugen, unterste<br />
Bank z. T. mergelig<br />
45 cm Kalk<br />
I /C7etnerSf&n6n/c/>/4f0/tet<br />
IT Großerf/smfai/ahiHaffar<br />
MrJvff/ßur//>enmif<br />
Abb. 1. Kartenskizze des Berges<br />
Crussol 1 : 25 000 (nach RICHE &<br />
ROMAN 1921, vereinfacht). Schloß-<br />
10 cm Kalk, oben <strong>und</strong> unten ruine 351 m über N. N. Zu F<strong>und</strong>mit<br />
Mergelfuge punkt VI W Schloßruine vgl. S. 162.<br />
140 cm Kalk, kompakt<br />
80 cm Kalk, mit rötlichen Flecken<br />
25 cm Kalk, brecciös verwittert
158 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
40 cm Kalk, mit rötlichen Flecken<br />
Mergelfuge<br />
15 cm Kalk, z. T. mit rötlichen Flecken<br />
Mergelfuge<br />
175 cm Kalk, z. T. mit roten Flecken<br />
70 cm Kalk<br />
115 cm Kalk, grusig verwitternd, z. T. mit dicken Mergellagen mit<br />
Schwämmmen (6)<br />
160 cm Kalk, durch Fugen in etwa sechs Bänke aufgespalten<br />
Mergelfuge<br />
25 cm Kalk, mergelig (5)<br />
Mergelfuge<br />
40 cm Kalk<br />
15 cm Mergel<br />
25 cm Kalk<br />
50 cm Kalk, grusig, mit Mergel<br />
110 cm Kalk<br />
150 cm Kalk, gelblichgrau, durch Fugen in etwa fünf Bänke aufgespalten<br />
40 cm Kalk, gelblich, zweispaltig<br />
60 cm Kalk, rötlich gefleckt, zweispaltig, gegen unten grusig verwitternd<br />
70 cm Kalk, dreispaltig, rötlich gefleckt<br />
140 cm Kalk, z. T. mergelig verwitternd, mit Mergelfugen<br />
75 cm Kalk, zwei Bänke<br />
110 cm Kalk<br />
100 cm Kalk<br />
Das Liegende wurde nicht aufgenommen; es folgen zunächst einige Meter<br />
Mergel mit etwa sieben Kalkbänken, danach Wechsellagerung von Mergel<br />
mit dicken Kalkbänken (vgl. Profil I, Carriere Mallet, kleiner Bruch).<br />
III. Profil Guilherand, Steilwand der Montagne de Crussol ober<br />
halb des Dorfes Guilherand.<br />
Hangendes nicht zugänglich<br />
ca. 200 cm Kalk<br />
ca. 70 cm Kalk<br />
ca. 70 cm Kalk<br />
ca. 70 cm Kalk<br />
ca. 100 cm Kalk<br />
10 cm Kalkbank mit Mergel<br />
50 cm Kalk<br />
10 cm Kalkbank mit Mergel<br />
130 cm Kalk
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 159<br />
50 cm Kalk<br />
55 cm Kalk<br />
25 cm Kalk, mergelig (8)<br />
45 cm Kalk (8)<br />
10 cm Mergel mit grusigem Kalk (8)<br />
25 cm Kalk (8)<br />
10 cm Kalk<br />
35 cm Kalk<br />
35 cm Kalk<br />
30 cm Kalk<br />
45 cm Kalk<br />
50 cm Kalk<br />
90 cm Kalk<br />
40 cm Kalk, mergelig<br />
80 cm Kalk<br />
100 cm Kalk, grusig verwitternd, mit Mergel, vier Bänke<br />
60 cm Kalk<br />
20 cm Kalk, oben <strong>und</strong> unten Mergelfugen<br />
200 cm Kalk<br />
80 cm Kalk<br />
45 cm Kalk, etwas grusig verwitternd, durch Mergel in zwei Bänke<br />
gegliedert (7)<br />
60 cm Kalk<br />
25 cm Kalk, mergelig<br />
200 cm Kalk<br />
85 cm Kalk, untere 15 cm abgespalten, grusig verwitternd<br />
160 cm Mergel mit grusigem Kalk<br />
100 cm Kalk, zwei Bänke, obere etwas grusig verwitternd<br />
125 cm Kalk, mit Fugen<br />
Mergelfuge<br />
25 cm Kalk<br />
Mergelfuge<br />
70 cm Kalk<br />
140 cm Kalk, grusig verwitternd, mit viel Mergel (4)<br />
120 cm Kalk, mit Fugen<br />
40 cm Kalk, grusig verwitternd<br />
170 cm Kalk, vier Bänke, unterste durch eine kräftige Fuge abgetrennt<br />
50 cm Kalk, mit Fugen<br />
60 cm Kalk, desgl.<br />
25 cm Kalk, grusig verwitternd mit viel Mergel<br />
80 cm Kalk, mit Mergelfugen
160 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
160 cm Kalk, grusig verwitternd, mit zahlreichen Mergelfugen<br />
30 cm Kalk, grusig verwitternd<br />
50 cm Kalk, mit Fugen<br />
50 cm Kalk<br />
40 cm Kalk<br />
100 cm Kalk<br />
110 cm Kalk<br />
450 cm Mergel mit sieben Kalkbänken (2)<br />
230 cm Kalk, drei Bänke, unterste durch Mergelfuge abgetrennt<br />
20 cm Kalk, grusig verwitternd, mit Mergel<br />
75 cm Kalk<br />
15 cm Kalk, grusig, mit Mergel (1)<br />
50 cm Kalk<br />
25 cm Mergel<br />
55 cm Kalk, zwei Bänke<br />
15 cm Mergel<br />
70 cm Kalk<br />
25 cm Mergel mit grusig verwitterndem Kalk<br />
60 cm Kalk<br />
Die Fortsetzung des Profiles ins Liegende wurde nicht weiter vermessen.<br />
IV. Profil Crussol, Schlucht (Abb. 2).<br />
Das Hangende wurde <strong>im</strong> Profil V, Crussol Schloß, aufgenommen<br />
80 cm Kalk, Basis des Südwestturmes des Schlosses Crussol<br />
135 cm Kalk<br />
100 cm Kalk, gebankt<br />
120 cm Kalk, drei Bänke<br />
80 cm Kalk, das Niveau des Sattels südwestlich des Schlosses<br />
bildend (zusammen mit den tiefer folgenden 2—3 Bänken: 26)<br />
150 cm Kalk<br />
60 cm Kalk<br />
125 cm Kalk, in der Mitte mit Hornsteinen<br />
60 cm Kalk<br />
40 cm Kalk, zweispaltig<br />
40 cm Kalk<br />
100 cm Kalk<br />
100 cm Kalk<br />
70 cm Kalk<br />
30 cm Kalk<br />
70 cm Kalk<br />
95 cm Kalk<br />
130 cm Kalk<br />
40 cm Kalk<br />
200 cm Kalk, mit <strong>und</strong>eutlichen Fugen
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. Zu S. 160.<br />
Abb. 2. Le Chäteau de Crussol (351 m über N.N.) auf K<strong>im</strong>eridgien-Kalken. Blick von Süden über die schluchtartige<br />
Ausnischung des östlichen Berghangs, die in ihrem oberen Teil einen kleinen Felsrutsch beherbergt <strong>und</strong> am<br />
linken Bildrand durch alten Steinbruchbetrieb erweitert ist. F<strong>und</strong>schichten (umringte Zahlen) <strong>und</strong> Mächtigkeiten<br />
entsprechend den Profilen IV <strong>und</strong> V (S. 160). Im Hintergr<strong>und</strong> die Rhone-Ebene 120 m über N.N. Links über dem<br />
Felsrutsch Ausstieg in den Sattel zwischen Schloßruine <strong>und</strong> Bergrücken. Zeichnung (nach Photographie <strong>und</strong><br />
Geländeskizze) durch F. SPRINGER.
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 161<br />
30 cm Kalk, etwas knollig (25)<br />
100 cm Kalk, <strong>und</strong>eutlich in drei Bänke gegliedert (24)<br />
80 cm Kalk<br />
120 cm Kalk<br />
60 cm Kalk<br />
65 cm Kalk<br />
150 cm Kalk, mit Schichtfugen (23)<br />
40 cm Kalk, ruppig (22)<br />
40 cm Kalk, desgl. (22)<br />
30 cm Kalk, desgl. (22)<br />
110 cm Kalk (21)<br />
60 cm Kalk (21)<br />
170 cm Kalk<br />
170 cm Kalk (20) Schichtung <strong>und</strong>eutlich werdend<br />
190 cm Kalk<br />
190 cm Kalk (19a)<br />
40 cm Kalk<br />
180 cm Kalk (19)<br />
ca, 270 cm Kalk<br />
ca. 200 cm Kalk<br />
180 cm Kalk (18)<br />
70 cm Kalk, zweispaltig<br />
115 cm Kalk (17)<br />
100 cm Kalk (17)<br />
70 cm Kalk<br />
110 cm Kalk<br />
ca.110 cm Kalk<br />
90 cm Kalk, Schichtung wieder deutlich<br />
160 cm Kalk<br />
90 cm Kalk<br />
90 cm Kalk (16)<br />
ca. 100 cm verdeckt, wahrscheinlich Kalk<br />
65 cm Kalk (15)<br />
75 cm Kalk<br />
20 cm Kalkbänkchen, bräunlichgelb, z. T. ins Grünliche spielend,<br />
mergelig-sandig, mürb („Glaukonitbank")<br />
110 cm Kalk (13)<br />
160 cm Kalk<br />
120 cm Kalk<br />
110 cm Kalk (11)<br />
110 cm Kalk<br />
100 cm Kalk<br />
120 cm Kalk<br />
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abbandlungen. Bd. 108.<br />
11
162 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
610<br />
cm<br />
15 cm Kalkbänkchen mit Mergel<br />
55 cm Kalk<br />
15 cm Kalk mit Mergel<br />
Die Fortsetzung des Profiles ins Liegende wurde nicht weiter aufgenommen.<br />
V. Profil Crussol, Schloß (Abb. 2).<br />
Die höchsten, <strong>im</strong> Schloßhof aufgeschlossenen Partien sind ca. 100 cm<br />
gebankte Kalke, weiß mit roten Flecken, größtenteils grasbewachsen (28).<br />
25 cm Kalk (28)<br />
35 cm Kalk<br />
35 cm Kalk<br />
210 cm Kalk<br />
50 cm Kalk, zwei Bänke<br />
150 cm Kalk<br />
120 cm Kalk (27)<br />
50 cm Kalk<br />
70 cm Kalk<br />
60 cm Kalk<br />
70 cm Kalk<br />
60 cm Kalk<br />
30 cm Kalk<br />
40 cm Kalk<br />
50 cm Kalk<br />
80 cm Kalk<br />
100 cm Kalk, etwa vier Bänke<br />
Das Liegende wurde in Profil IV, Crussol Schlucht, aufgenommen.<br />
VI. Auf der Westseite des trockenen Taleinschnittes, der west<br />
lich an der Schloßruine Crussol vorbei gegen St. Peray hinabführt,<br />
sind ebenfalls fossilführende helle Kalke aufgeschlossen. Sie sind<br />
etwa der F<strong>und</strong>schicht 26 <strong>und</strong> ihrem Liegenden gleichzusetzen.<br />
Profile konnten wegen der Bedeckung durch Vegetation nicht auf<br />
genommen werden.<br />
Parallelisierung der Profile<br />
Die tiefsten Horizonte, die wir hier besprechen, stehen in den<br />
Profilen I (Carriere Mallet, kleiner Bruch), II (Carriere Mallet,<br />
großer Bruch, unterster Abschnitt, nicht aufgenommen) <strong>und</strong> III<br />
(Guilherand, unterster Teil) an. Die nächstjüngeren Schichten<br />
sind in den Profilen II <strong>und</strong> III aufgenommen worden. Obwohl bei
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. Zu S. 163.<br />
MAU£T GUILHERAND SCHWABEN<br />
Aomö/n/erf<br />
Abb. 3. Lithologische Vergleichsprofile <strong>im</strong> K<strong>im</strong>eridgien des Berges Crussol<br />
<strong>und</strong> des Schwäbischen <strong>Jura</strong>. Die arabischen Ziffern entsprechen den F<strong>und</strong>schichten<br />
der Profile S. 156 ff., die römischen Ziffern der Untergliederung des<br />
schwäbischen <strong>Weißen</strong> Juri ö (ZIEGLER 1955).
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 163<br />
der Aufnahme in der Regel Bankgruppen zusammengefaßt wurden,<br />
geht doch die weitgehende Übereinst<strong>im</strong>mung in der Ausbildung<br />
dieser altersgleichen Schichtenfolge aus Abb. 3 deutlich hervor.<br />
Allerdings läßt sich eine ziemlich erhebliche Abnahme der<br />
Mächtigkeiten in der Carriere Mallet gegenüber den Verhältnissen<br />
bei Guilherand feststellen. Bei einer Entfernung von nur 2—3 km<br />
schrumpft ein bei Guilherand 42,5 m mächtiger Schichtenstoß auf<br />
33 m in der Carriere Mallet zusammen. An der Mächtigkeitsreduk<br />
tion sind alle Schichtglieder etwa in gleichem Umfang beteiligt.<br />
In diesem Zusammenhang verdient eine Schichtungsunregel<br />
mäßigkeit <strong>im</strong> Südteil der Carriere Mallet Erwähnung, die sich<br />
möglicherweise als Strömungsrinne erklären läßt.<br />
Das Hangende der Profile II <strong>und</strong> III ist <strong>im</strong> Profil IV aufge<br />
schlossen (Crussol Schlucht), das durch eine Überschneidung von<br />
mehreren Metern den Anschluß eindeutig gewährleistet. Die Fort<br />
setzung des Profiles IV nach oben bildet das Profil V (Crussol<br />
Schloß), mit dem die Schichtenfolge am Berg Crussol abschließt.<br />
Wir haben versucht, das von F. HUGÜENIN (1874) gegebene<br />
Profil des Mallet'schen Steinbruches mit unseren eigenen Auf<br />
nahmen in Übereinst<strong>im</strong>mung zu bringen. Dies ist uns jedoch nicht<br />
eindeutig gelungen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Auf-<br />
schlußvcrhältnisse seit F. HUGÜENIN durch weiteren Abbau <strong>und</strong><br />
anderen Verwitterungszustand wohl wesentlich verändert worden<br />
sind.<br />
Nach F. HUGÜENIN (1874, S. 521) sind in der Carriere Mallet<br />
aufgeschlossen (von oben nach unten):<br />
11. 15 m Calcaire compacte gris bane XI<br />
10. 0 m 95 Marnes gris cendre et calcaire banc X<br />
9. 2 m Calcaire jaune clair banc IX<br />
8. 0m50 Marnes banc VIII<br />
7. 2 m Calcaire tres-jaune banc VII<br />
6. 0 m 75 Marnes banc VI<br />
5. 3 m Pierre blanche et gris-clair banc V<br />
4. 0 m 80 Calcaire marneux gris banc IV<br />
3. 2 m 75 Calcaire gris et bleu par places banc III<br />
2. 2 m 50 Marnes bleues banc II<br />
1. 3 m Calcaire gris, tachete par places banc I<br />
Es kann kaum ein Zweifel bestehen, daß die Bank II bei<br />
F. HUGÜENIN mit den 280 cm Mergeln (F<strong>und</strong>schicht 2) unseres<br />
11*
164<br />
Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Profiles I identisch ist. Seine Bank III entspricht dann den drei<br />
tiefsten Kalkbänken unseres Profiles II bzw. den höchsten Teilen<br />
des Profiles I (F<strong>und</strong>schicht 3). Die folgenden Bänke F.HUGUENIN'S<br />
lassen sich jedoch nicht ohne Willkür Schichten unserer Profile<br />
gleichsetzen.<br />
Relativ große Übereinst<strong>im</strong>mung zeigt dann erst wieder seine<br />
Bank VI mit unserer F<strong>und</strong>schicht 6. In beiden Fällen handelt es<br />
sich um mergelige Komplexe mit dem einzigen nachgewiesenen<br />
Vorkommen von Spongien. Allerdings beträgt der vertikale Ab<br />
stand der Bank VI von der Basis der Bank III nach F. HUGÜENIN<br />
ca. 650 cm, während unsere F<strong>und</strong>schicht 6 1170 cm über derselben<br />
Grenze zu liegen kommt. Eine Gleichsetzung der beiden Horizonte<br />
kommt daher nicht in Betracht, doch sind auch andere Versuche<br />
einer Parallelisierung mit allzu großer Unsicherheit belastet.<br />
Fossil-Listen der Crussol-Profile<br />
Aus den einzelnen auf ihre Fauna untersuchten Bänken stam<br />
men die nachstehend aufgeführten Arten. Die fetten Ziffern ent<br />
sprechen dabei denen der Profile.<br />
28: Phylloceras sp.<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER) 2<br />
Haploceras cf. subelirnatum FONTANNES<br />
Haploceras cf. carachteis (ZEUSCHNER)<br />
Perisphindes cf. siliceus (QUENSTEDT)<br />
Perisphinctes cf. capillaceus FONTANNES, juv., enger genabelt als nach<br />
FONTANNES, mit schwacher Externfurche<br />
Perisphindes sp.<br />
Aspidoceras cf. cyclotum (OPPEL)<br />
Lamellaptychus<br />
Nautilus sp.<br />
Belemnites sp.<br />
Astarie<br />
Anomia<br />
Muschel<br />
27: Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES), klein<br />
Lytoceras orsinii GEMMELLARO<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
2<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER 1846) <strong>und</strong> H. el<strong>im</strong>atum (OPPEL 1865)<br />
werden hier mit E. ROD (1937, S. 26) als Glieder eines Artkreises aufgefaßt<br />
<strong>und</strong> nicht getrennt.
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 165<br />
Glochiceras lilhographieum (OPPEL)<br />
Perisphindes ardesicus FONTANNES<br />
Perisphindes sp.<br />
Cidaris<br />
Ungefähr in diesem Niveau ferner:<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Streblites sp.<br />
26: Phylloceras sp.<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Lytoceras orsinii GEMMELLARO<br />
Taramelliceras prolithographicum (FONTANNES)<br />
Taramelliceras cf. prolithographicum (FONTANNES)<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras cf. subelirnatum FONTANNES<br />
Haploceras carachteis (ZEUSCHNER)<br />
Neochetoceras steraspis (OPPEL) (Taf. 22, Fig. 5)<br />
Glochiceras lilhographieum (OPPEL)<br />
Glochiceras lithographicum (OPPEL), Innenwindungen (Taf. 17, Fig. 4)<br />
Perisphindes siliceus (QUENSTEDT) (Taf. 17, Fig. 2)<br />
Perisphindes cf. ardesicus FONTANNES (ähnlich auch P. geron ZITT.)<br />
Perisphindes cf. unicomptus FONTANNES<br />
Apsidoceras cf. cyclotum (OPPEL)<br />
Hybonoliceras beckeri (NEUMAYR)<br />
Hybonoliceras beckeri subsp. cf. ornatum (SPÄTH)<br />
Hybonoliceras m<strong>und</strong>ulum (OPPEL) (Taf. 20, Fig. 1—5)<br />
Spondylopecten globosus (QUENSTEDT)<br />
Plicaiula<br />
Ungefähr aus diesem Niveau stammen vom F<strong>und</strong>punkt VI (vgl. Karte<br />
Abb. 1):<br />
Phylloceras medilerraneum NEUMAYR<br />
Phylloceras plychoicum (QUENSTEDT)<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Sowerbyceras sp.<br />
Lytoceras sp.<br />
Taramelliceras prolithographicum (FONTANNES), einschließlich diseeptandum<br />
(FONTANNES), sehr häufig<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras subelirnatum FONTANNES<br />
Streblites folgariacus (OPPEL in ZITTEL) (Taf. 22, Fig. 4)<br />
Streblites sp.<br />
Neochetoceras steraspis (OPPEL) (steraspidoides [FONTANNES]) (Abb. 8)<br />
Glochiceras lithographicum (OPPEL)<br />
Perisphindes ardesicus FONTANNES<br />
Aspidoceras sp.
166 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Hybonoliceras cf. hybonotum (OPPEL)<br />
Hybonoliceras beckeri (NEUMAYR)<br />
Hybonoliceras m<strong>und</strong>ulum (OPPEL) (Taf. 20, Fig. 1—5)<br />
Lamellaptychus<br />
Pygope janitor (PICTET) (NEUMAYR 1873, Taf. 43, Fig. 8 entsprechend;<br />
unsere Taf. 17, Fig. 5, 6)<br />
kleine Terebrateln<br />
Etwas tiefer:<br />
Taramelliceras subnudatum (FONTANNES)<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Etwas tiefer:<br />
Haploceras sp.<br />
Glochiceras lithographicum (OPPEL)<br />
Perisphindes cf. ardesicus FONTANNES<br />
Perisphindes sp.<br />
25: Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Taramelliceras rebouletianum (FONTANNES)<br />
Taramelliceras cf. franciscanum (FONTANNES)<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras subelirnatum FONTANNES<br />
Haploceras sp.<br />
Neochetoceras steraspis (OPPEL) (steraspidoides [FONTANNES])<br />
Glochiceras pseudocarachteis (FAVRE)<br />
Perisphindes sp.<br />
Aspidoceras longispinum longispinum (SOWERBY)<br />
Ungefähr aus diesem Niveau stammen ferner von der Nordseite des<br />
Berges Crussol unterhalb der Schloßruinen gegen St. Peray:<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Haploceras sp.<br />
Haploceras sp., auf Innenwindungen mit fein gekerbter Externfurche<br />
Glochiceras lens BERCKHEMER<br />
Hybonoliceras m<strong>und</strong>ulum (OPPEL)<br />
24: Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras subelirnatum FONTANNES<br />
Haploceras cf. carachteis (ZEUSCHNER)<br />
Glochiceras pseudocarachteis (FAVRE)<br />
Hybonoliceras beckeri ornatum (SPÄTH)<br />
Bhynchonella<br />
23: Ungefähr aus diesem Niveau stammen von der Nordseite des Berges<br />
Crussol unterhalb der Schloßruinen gegen St. Peray:<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Taramelliceras cf. compsum (OPPEL)
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 167<br />
6<br />
CO<br />
OD<br />
Taramelliceras sp.<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras carachteis (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras sp.<br />
Perisphindes sp.<br />
Aspidoceras longispinum longispinum (SOWERBY)<br />
Hybonoliceras ei. knopi (NEUMAYR), großes Bruchstück (Taf. 20, Fig. 9)<br />
Liostrea<br />
22: Haploceras cf. subelirnatum FONTANNES<br />
Perisphindes sp.<br />
Aspidoceras sp.<br />
Terebratula<br />
21: Phylloceras sp.<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Taramelliceras prolithographicum (FONTANNES)<br />
Taramelliceras sp. (cf. wepferi BERCKHEMER ?)<br />
Haploceras cf. staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras subelirnatum FONTANNES<br />
Glochiceras pseudocarachteis (FAVRE)<br />
Perisphindes cf. ardesicus FONTANNES<br />
Perisphindes cf. ulmensis (OPPEL)<br />
Perisphindes cf. siliceus (QUENSTEDT)<br />
Ungefähr aus diesem Niveau stammen ferner:<br />
Taramelliceras cf. Iclettgovianum bracheri BERCKHEMER & HOLDER<br />
(vgl. S. 182)<br />
Taramelliceras sp.<br />
Haploceras subelirnatum FONTANNES<br />
Glochiceras sp.<br />
Rhynchonella<br />
20: Haploceras subelirnatum FONTANNES<br />
Glochiceras lens BERCKHEMER<br />
19a: Virgataxioceras sp., Bruchstück<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
19: Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Haploceras sp. cf. staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras subelirnatum FONTANNES<br />
Ochetoceras cf. canaliferum (OPPEL)<br />
Glochiceras crenosum (QUENSTEDT)<br />
Perisphindes cf. siliceus (QUENSTEDT)<br />
Perisphindes sp.<br />
Terebratula<br />
Rhynchonella
168 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
18: Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) =<br />
Taramelliceras cf. pugile (NEUMAYR)<br />
Taramelliceras sp.<br />
Taramelliceras juv.<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Haploceras sp.<br />
Ochetoceras canaliferum (OPPEL)<br />
Glochiceras semicostatum BERCKHEMER . sp.<br />
n<br />
Glochiceras modesium ZIEGLER<br />
Perisphindes sp.<br />
Aspidoceras sp.<br />
Rhynchonella<br />
Astarte<br />
Monotide<br />
Cidaris<br />
Collyrites<br />
17: Taramelliceras pugile (NEUMAYR)<br />
16: Belemniles<br />
Rhynchonella<br />
15: Taramelliceras sp.<br />
Perisphindes sp.<br />
Aulacostephanus eudoxus (D'ORBIGNY)<br />
Velala velata (QUENSTEDT)<br />
Monotide<br />
14: Phylloceras praeposterium FONTANNES, Bruchstück<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Taramelliceras cf. compsum (OPPEL) (= trachynotum FONTANNES<br />
1879a, Taf. 5, Fig. 2)<br />
Taramelliceras klettgovianum (WÜRTENBERGER)<br />
Glochiceras crenosum (QUENSTEDT)<br />
Cidaris<br />
13: Taramelliceras compsum (OPPEL)<br />
Glochiceras crenosum (QUENSTEDT)<br />
Sutneria eumela (D'ORBIGNY)<br />
silenus (FONTANNES)<br />
12: Phylloceras sp.<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Lytoceras orsinii GEMMELLARO<br />
Taramelliceras compsum (OPPEL)<br />
Taramelliceras klettgovianum (WÜRTENBERGER)<br />
Glochiceras crenosum (QUENSTEDT)<br />
Glochiceras modesium ZIEGLER<br />
Perisphindes sp.<br />
Sutneria eumela (D'ORBIGNY)
StTatigraphische <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 169<br />
11: Phylloceras serum (OPPEL)<br />
Taramelliceras compsum (OPPEL)<br />
Taramelliceras compsum (OPPEL) (cf. hemipleurum FONTANNES, 1879 a,<br />
Taf. 6, Fig. 6)<br />
Taramelliceras cf. klettgovianum (WÜRTENBERGER)<br />
Glochiceras n<strong>im</strong>batum (OPPEL)<br />
Glochiceras cf. modesium ZIEGLER<br />
10: Perisphindes sp.<br />
9: Taramelliceras compsum (OPPEL)<br />
8: Phylloceras serum (OPPEL) (Horizont nicht ganz sicher)<br />
Taramelliceras compsum (OPPEL)<br />
Taramelliceras cf. pseudoflexuosum (FAVRE)<br />
Taramelliceras cf. pseudoflexuosum (FAVRE) <strong>und</strong> cf. compsum (OPPEL)<br />
Streblites levipidus (FONTANNES)<br />
Glochiceras n<strong>im</strong>batum (OPPEL)<br />
Glochiceras crenosum (QUENSTEDT)<br />
Glochiceras modesium ZIEGLER<br />
Glochiceras cf. nudatum (OPPEL)<br />
Creniceras dentatum (REINECKE)<br />
Perisphindes sp.<br />
Nebrodiles cf. hospes (NEUMAYR)<br />
Sutneria cyclodorsata (MOESCH) (Taf. 21, Fig. 4)<br />
Aspidoceras acanthicum acanthicum (OPPEL)<br />
Aspidoceras longispinum longispinum (SOWERBY)<br />
Aspidoceras haynaldi haynaldi HERBICH<br />
Aspidoceras haynaldi sesquinodosum FONTANNES<br />
Aspidoceras microplum (OPPEL)<br />
7: Ungefähr aus diesem Niveau stammt<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
6: Glochiceras crenosum (QUENSTEDT)<br />
Perisphindes sp.<br />
5: Glochiceras crenosum (QUENSTEDT)<br />
Nebrodiles sp.<br />
4: Phylloceras sp.<br />
Taramelliceras compsum (OPPEL)<br />
Creniceras dentatum (REINECKE)<br />
Nebrodiles hospes (NEUMAYR)<br />
Nebrodiles rhodanensis ZIEGLER n. sp. (Taf. 21, Fig. 2)<br />
Nebrodites sp.<br />
Sutneria cyclodorsata (MOESCH) (Horizont nicht ganz sicher)<br />
Aspidoceras acanthicum acanthicum (OPPEL)<br />
3: Phylloceras sp.<br />
Taramelliceras compsum (OPPEL)<br />
Taramelliceras cf. trachinotum (OPPEL)
170 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Glochiceras crenosum (QUENSTEDT)<br />
Idoceras halderum (OPPEL)<br />
Nebrodites hospes (NEUMAYR)<br />
Nebrodiles teres (NEUMAYR)<br />
Nebrodiles cf. he<strong>im</strong>i (FAVRE)<br />
Aspidoceras microplum (OPPEL)<br />
2: Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES)<br />
Taramelliceras Irachinolum (OPPEL)<br />
Streblites sp.<br />
Glochiceras fialar (OPPEL)<br />
Perisphindes cf. vandellii CHOFFAT<br />
Perisphindes sp.<br />
Divisosphindes cf. garnieri (FONTANNES)<br />
Nebrodiles rhodanensis ZIEGLER n. sp. (Taf. 21, Fig. 3)<br />
Aspidoceras microplum (OPPEL)<br />
Aspidoceras sp.<br />
1: Perisphindes sp.<br />
Alaxioceras sp.<br />
Das Profil Le Pouzin<br />
Das Profil<br />
Südwestlich des Ortes Le Pouzin an der Rhone, am südlichen<br />
Talhang des Flüßchens Ouveze (Carte de France 1:50 000, XXX 37)<br />
wurde <strong>im</strong> unteren K<strong>im</strong>eridgien folgendes Profil aufgenommen:<br />
Das Hangende wurde nicht vermessen<br />
ca. 1200 cm Kalk, massig wirkend, mit vereinzelten Fugen, <strong>im</strong> oberen Abschnitt<br />
zum Teil mit Fossilnestern (Fossilliste vgl.S.171—172)<br />
Basis des oberen Felsenkranzes<br />
ca. 150 cm Kalk, gebankt, großenteils verdeckt<br />
90 cm Kalk<br />
60 cm Kalk<br />
70 cm Kalk<br />
70 cm verdeckt<br />
20 cm Kalk<br />
40 cm Kalk, zwei Bänke<br />
40 cm Kalk<br />
5 cm Mergel<br />
20 cm Kalk<br />
10 cm Kalk, mergelig: Hohlkehle, Oberkante des unteren Felsenkranzes
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> "<strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 171<br />
Faunistischer Nachweis der Subeumela-Zone<br />
Ein verstürzter Block des oberen Felsenkranzes bei Le Pouzin,<br />
wahrscheinlich aus dessen oberem Teil stammend, lieferte folgende<br />
Fauna:<br />
80 cm Kalk<br />
150 cm Kalk<br />
70 cm Kalk<br />
50 cm Kalk, etwas knollig<br />
180 cm Kalk<br />
5 cm Mergelfuge<br />
60 cm Kalk<br />
10 cm Kalk<br />
40 cm Kalk, mergelig, knollig<br />
60 cm Kalk<br />
40 cm Kalk, mergelig, knollig<br />
40 cm Kalk<br />
150 cm Mergel mit Kalk, Hohlkehle am Fuß des unteren Felsenkranzes<br />
ca. 100 cm Kalk<br />
ca. 500 cm Kalk, mergelig<br />
ca. 100 cm Kalk<br />
ca. 500 cm Kalk, mergelig<br />
200 cm Kalkbänke<br />
100 cm verwachsen, wohl Kalk<br />
ca. 200 cm Kalkbänke<br />
100 cm verwachsen, wohl Mergel<br />
180 cm Kalk, fünf Bänke: Taramelliceras sp. (compswm-Gruppe)<br />
Perisphindes cf. vandellii CHOFFAT<br />
Perisphindes sp.<br />
ca. 250 cm Kalkbänke mit Mergel<br />
ca. 400 cm Kalkbänke<br />
ca. 450 cm Kalkbänke, großenteils verwachsen, anscheinend mit Mergelzwischenlagen<br />
350 cm Kalkbänke<br />
500 cm Kalkbänke mit Mergel: Divisosphindes lacertosus (FONTANNES)<br />
100 cm Kalk, grau, knollig: Ataxioceras sp.<br />
Das Liegende wurde nicht weiter aufgenommen.<br />
Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) = silenus (FONTANNES), sehr häufig.<br />
Es liegen Formen mit einem Enddurchmesser des Phragmokons um<br />
22 mm mit höchstens schwacher Lobendrängung <strong>und</strong> um 45—50 mm<br />
mit ausgeprägter Lobendrängung in großer Zahl vor.<br />
Lytoceras cf. sutile (OPPEL)
172 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Taramelliceras pugile (NEUMAYR), mit großen, compsum-ähnlichen Bruchstücken<br />
(Taf. 22, Fig. 1, 3)<br />
Taramelliceras acallopisium <strong>und</strong>ulatum BERCKHEMER & HOLDER (Taf. 22,<br />
Fig. 2)<br />
Taramelliceras sp., kleine, fast glatte Form<br />
Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
Ochetoceras zio (OPPEL)<br />
Glochiceras crenosum (QUENSTEDT), sehr häufig<br />
Glochiceras solenoides (QUENSTEDT)<br />
Glochiceras tuberculatum BERCKHEMER<br />
Perisphindes cf. cinibricus NEUMAYR <strong>und</strong> cf. isolatus SCHNEID<br />
Perisphindes ei. siliceus (QUENSTEDT)<br />
Perisphindes sp.<br />
Virgatosphinctes sp., Bruchstück mit virgatotomer Rippe<br />
Sutneria cf. eumela (D'ORBIGNY)<br />
Sutneria subeumela SCHNEID (Taf. 21, Fig. 6, 7)<br />
Aspidoceras hermanni BERCKHEMER (Taf. 19, Fig. 3, 4)<br />
Aspidoceras sp.<br />
Hybonoliceras cf. pressulum (NEUMAYR), stark korrodiert<br />
Hybonoticeras beckeri (NEUMAYR)<br />
Hybonoliceras beckeri (NEUMAYR), gegen H. harpephorum (NEUMAYR) tendierend<br />
(Taf. 20, Fig. 7)<br />
Hybonoticeras sp., enggeknotete Variante von H. beckeri (NEUMAYR) (Taf. 20,<br />
Fig. 8)<br />
Oberhalb des oberen Felsenkranzes von Le Pouzin, am flachen Hang<br />
gegen den höchsten Punkt des Berges, haben sich gef<strong>und</strong>en:<br />
Virgataxioceras cf. setatum (SCHNEID)<br />
Hybonoliceras beckeri (NEUMAYR) jur.<br />
Vergleichende lithologische Bemerkungen<br />
Bei ähnlicher Gesamtmächtigkeit ist die lithologische Aus<br />
bildung des unteren K<strong>im</strong>eridgien bei Le Pouzin von der am Berge<br />
Crussol deutlich verschieden. Es ist uns nicht gelungen, petro-<br />
graphisch gekennzeichnete, durchgehende Leithorizonte aufzu<br />
finden, obwohl die beiden Orte nur 22 km voneinander entfernt<br />
liegen. Selbst die „Glaukonitbank", die in Süddeutschland einen<br />
guten Leithorizont bildet <strong>und</strong> in anscheinend gleichem Niveau<br />
auch am Crussol ausgebildet ist (vgl. S. 178), fehlt bei Le Pouzin.<br />
Allerdings zeigt die Mergelführung hier wie am Crussol in großen<br />
Zügen ein ähnliches Verhalten. An beiden Orten n<strong>im</strong>mt die Ton<br />
zufuhr in den höheren Teilen des unteren K<strong>im</strong>eridgien merklich ab.<br />
Die Kalkbänke des Profiles Le Pouzin sind durch ihre graue<br />
Farbe gekennzeichnet, die sich gegen das hellere Gelbbraun der
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 173<br />
Kalke vom Crussol deutlich abhebt. Dies ist nicht auf eine unter<br />
schiedliche Verwitterung des FeS 2 zurückzuführen, sondern scheint<br />
auf höherem Tongehalt bei Le Pouzin zu beruhen. Bemerkenswert<br />
ist auch ihre vielfach vorhandene grobknollige Struktur, die be<br />
sonders bei der Verwitterung deutlich wird.<br />
Dieser Gesteinstypus ist <strong>im</strong> subalpinen Oberjura Südostfrank<br />
reichs weit verbreitet — gut aufgeschlossen sind die entsprechenden<br />
Horizonte z. B. südlich von Luc-en-Diois (Dept. Dröme) <strong>und</strong> bei<br />
La Faurie (Dept. Hautes-Alpes) — <strong>und</strong> weist <strong>im</strong> südhelvetischen<br />
Raum manche Parallelen auf. Das helvetisch-subalpine Becken<br />
stellte <strong>im</strong> Oberjura das am weitesten <strong>im</strong> Nordwesten gelegene Teil<br />
stück der Tethys dar. Wie Lithologie <strong>und</strong> Fauna von Le Pouzin<br />
ausweisen — vor allem die <strong>im</strong> höheren Teil des unteren K<strong>im</strong>eridgien<br />
auffallende Häufigkeit der Sowerbyceraten —, griff die Tethys hier<br />
noch auf die Westseite des Rhonetales hinüber.<br />
Dem Tethysbereich sind an seinem Nordsaume Crussol wie<br />
Schwaben <strong>und</strong> Franken als Randmeerbezirke mehr oder weniger<br />
vorgelagert. Gemeinsam werden sie <strong>im</strong> mittleren <strong>und</strong> oberen Teil<br />
des unteren K<strong>im</strong>eridgien durch hellere <strong>und</strong> glatter brechende Kalke<br />
gekennzeichnet, bei denen knollige Strukturen nicht bekannt sind.<br />
Das Gestein des Crussol unterscheidet sich jedoch von dem des<br />
Schwäbischen <strong>Jura</strong> auffallend durch das Fehlen von Schwamm-<br />
stotzen <strong>und</strong> damit eigentlicher Massenkalke. In den Mergelkalken<br />
des mittleren Malms sind zwar auch am Crussol gelegentlich<br />
Schwammrasen entwickelt; die Felsenkalke dagegen bestehen aus<br />
gebanktem glattem Gestein, das nur aus einiger Entfernung ein<br />
scheinbar ungeschichtet-massiges Aussehen zeigt.<br />
Sein Aufbau ist aber nicht homogen, sondern läßt <strong>im</strong> Anbruch<br />
oft eingestreute dunklere Partikel von unregelmäßig r<strong>und</strong>lichem<br />
Umriß erkennen. Dünnschliffe zeigen Schwammnadeln. Diese Ge<br />
bilde dürften (auch nach fre<strong>und</strong>licher Begutachtung durch Dr.<br />
K. SCHÄDEL, einem besonderen Kenner der schwäbischen Schwamm<br />
fazies) den Tuberoiden G. K. FKITZ 1958 (= Pseudooiden autorum)<br />
des schwäbischen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> ß <strong>und</strong> ö entsprechen. Da diese<br />
Textur <strong>im</strong> Schwäbischen <strong>und</strong> Fränkischen <strong>Jura</strong> mit Zeiten leb<br />
haften, aber laufendem Zerfall ausgesetzten Schwammwachstums<br />
in Beziehung gebracht wird (G. K. FRITZ 1958), ist mit ähnlichen<br />
Verhältnissen vielleicht auch für die Bildung der Felsenkalke am<br />
Crussol zu rechnen. Die Verwandtschaft mit der randtethydischen
174<br />
Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
süddeutschen Malmfazies erschiene hierdurch noch stärker als <strong>im</strong><br />
übrigen schon betont.<br />
Der Schwefelkies-Gehalt der Felsenkalke, der teils noch kristal<br />
lin, größtenteils aber in verwaschen blauen oder l<strong>im</strong>onitisch-roten<br />
Flecken auftritt, weist auch auf eine wesentliche Beteiligung orga<br />
nischer Zerfallsprodukte <strong>und</strong> findet in Süddeutschland ebenfalls<br />
seine Parallelen.<br />
Vergleich des Profiles Ardeche — Süddeutschland<br />
Das mittlere Unter k<strong>im</strong>eridgien 3<br />
Die tiefsten Teile des Unterk<strong>im</strong>eridgien in der Ardßche (Platy-<br />
nota-Zone <strong>und</strong> Ataxioceraten-Schichten) wurden von uns nicht<br />
untersucht. Nur aus den obersten Bänken der Ataxioceraten-<br />
Schichten (Tenuilobatus-Zone s. str.) stammt eine spärliche Fauna<br />
(F<strong>und</strong>schicht 1). Das süddeutsche Äquivalent dieses Horizontes ist<br />
der Malm yi (H. ALDINGER 1945). In der Ardeche wesentlich kalk<br />
reicher als in "Württemberg <strong>und</strong> dadurch geschlossener, überlagert<br />
er die Mergelfolgen des Malm yd, die in der Ardeche ebenfalls be<br />
deutend kalkiger entwickelt sind.<br />
Unmittelbar über den geschlossenen Kalken der F<strong>und</strong>schicht 1<br />
folgen in der Ardeche Mergel mit Kalkbänken, die eine typische<br />
Fauna mit Divisosphincten, Glochiceras fialar <strong>und</strong> — nach fre<strong>und</strong><br />
licher Mitteilung von Frl. cand. geol. G. CORVINUS, Tübingen —<br />
Aspidoceras uhlandi (OPPEL) enthalten (F<strong>und</strong>schicht 2). Diesem<br />
Abschnitt entsprechen in Südwestdeutschland die „Crusoliensis-<br />
Mergel" 4<br />
(Malm yb) mit nahezu übereinst<strong>im</strong>mender Fauna <strong>und</strong><br />
in ähnlicher Mächtigkeit. Sie unterscheiden sich hier fast nur durch<br />
größere Kalkarmut vom Crussol. Die relativ gering mächtigen<br />
„Crusoliensis-Mergel" können demnach als wichtiger Fixpunkt der<br />
Parallelisierung zwischen Süddeutschland <strong>und</strong> der Ardßche dienen.<br />
Eine weitere bedeutsame Stütze eines stratigraphischen Ver<br />
gleichs stellt der F<strong>und</strong> eines Idoceras balderum in der Carriere<br />
Mallet (kleiner Bruch) in F<strong>und</strong>schicht 3 dar. Die Balderum-<br />
3<br />
Vgl. die Gliederung S. 186.<br />
4<br />
Der Leitammonit der schwäbischen „Crusoliensis-Mergel" (E. VEIT<br />
1936) entspricht nicht so sehr Perisphindes crusoliensis FONTANNES als<br />
vielmehr Perisphindes garnieri FONTANNES (beide in E. DUMORTIER & F.<br />
FONTANNES 1876).
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> "<strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 175<br />
Schichten Südwestdeutschlands (Malm y6), in denen die Leit<br />
form besonders an der Basis verbreitet ist, finden damit auch in<br />
der Ardeche ihre Parallele. Mit ihnen schließt der untere Teil des<br />
Unterk<strong>im</strong>eridgien ab, der durch das Auftreten der Gattung Rasenia<br />
gekennzeichnet ist.<br />
Das mittlere Unterk<strong>im</strong>eridgien entspricht den Schichten mit<br />
Aulacostephanus <strong>im</strong> süddeutschen Raum (= Malm
176 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
der für Südwestdeutschland typische "Wechsel von Kalkbank-<br />
folgen <strong>und</strong> Mergelkomplexen (H. ALDINGER 1945) in der Ardeche<br />
nicht ausgeprägt, wenngleich das Vorherrschen der Kalke gegen<br />
über den mehr mergeligen Schichten der tieferen Horizonte auch<br />
hier unverkennbar ist. Da überdies die <strong>im</strong> Malm ö "Württembergs<br />
leitenden Ammoniten (vgl. B. ZIEGLER 1958 a) in der Ardeche z. T.<br />
von uns nicht gef<strong>und</strong>en wurden, z. T. auch sehr selten sind, kann<br />
eine Parallelisierung trotz der allgemeinen Ähnlichkeit der Faunen<br />
hier nur angenähert erfolgen.<br />
Leitformen der Mutabilis-Zone (B. ZIEGLER 1958a, S. 195 bis<br />
197) sind uns bei unseren Geländeuntersuchungen nicht bekannt<br />
geworden, doch ist es wahrscheinlich, daß die F<strong>und</strong>schichten<br />
4—7 in diesen Horizont zu stellen sind.<br />
Ein Äquivalent der unteren Pseudomutabilis-Zone Süd<br />
deutschlands bildet die F<strong>und</strong>schicht 8. Dies geht aus dem Auftreten<br />
von Aspidoceras longispinum, A. haynaldi, Sutneria cyclodorsata,<br />
Creniceras dentatum, Streblites levipictus <strong>und</strong> Taramelliceras<br />
cf. pseudoflexuosum hervor. Der F<strong>und</strong> von Aspidoceras acanthi<br />
cum deutet jedoch auf eine recht tiefe Lage der F<strong>und</strong>schicht in der<br />
Zone hin, der unterste Malm
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 177<br />
wir <strong>im</strong> obersten Malm dB die Äquivalente der F<strong>und</strong>schichten 12<br />
<strong>und</strong> 13. Die F<strong>und</strong>schichten 14 <strong>und</strong> 15 haben noch mehrere Formen<br />
geliefert, unter denen Aulacostephanus eudoxus besonders zu er<br />
wähnen ist, in ihrem Hangenden wird die Fauna jedoch sehr spär<br />
lich. Dies deckt sich sehr gut mit den ähnlichen Verhältnissen <strong>im</strong><br />
südwestdeutschen mittleren Malm
178 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Carriere Mallet zu suchen ist. Dies entspricht der Hauptverbrei<br />
tung dieser Formen in Südwestdeutschland <strong>im</strong> obersten Malm (53<br />
<strong>und</strong> <strong>im</strong> unteren (54. Allerdings reichen sie hier noch in etwas jün<br />
gere Horizonte hinauf.<br />
Andererseits sind Arten <strong>und</strong> Gattungen bekannt geworden, die<br />
in der Ardeche eine größere Häufigkeit zeigen als in Süddeutschland.<br />
Dies gilt insbesondere für Aspidoceras microplum <strong>und</strong> die Nebro-<br />
diten, doch ist auch Glochiceras crenosum vor allem in der Pseudo<br />
mutabilis-Zone auffallend verbreitet.<br />
Faunenelemente, die in Süddeutschland in entsprechenden<br />
Horizonten bisher überhaupt noch nicht nachgewiesen werden<br />
konnten, sind Lytoceras <strong>und</strong> Sowerbyceras. Phylloceras ist <strong>im</strong> un<br />
teren K<strong>im</strong>eridgien Süddeutschlands nur in einem einzigen Exem<br />
plar bekannt, in der Ardeche dagegen wesentlich häufiger. Dies deu<br />
tet bei aller sonstigen Ähnlichkeit der Fauna auf nähere Bezie<br />
hungen zur Tethys, als sie für Süddeutschland bestanden.<br />
Die stratigraphische Verbreitung st<strong>im</strong>mt bei den meisten For<br />
men in Süddeutschland <strong>und</strong> Ardeche überein. Gewisse Ausnahmen<br />
bilden die Aulacostephanen (s. o.) <strong>und</strong> die Aspidoceraten, beson<br />
ders Aspidoceras acanthicum (vgl. S. 175—176). Es handelt sich<br />
indessen um sehr geringfügige Differenzen, wie sie einmal aus der<br />
räumlichen Entfernung, zum andern aus der Lückenhaftigkeit<br />
unseres Materials leicht verständlich erscheinen. Ein Vorkommen<br />
des echten Streblites tenuilobatus noch <strong>im</strong> mittleren Unterk<strong>im</strong>erid<br />
gien (Aulacostephanus-Schichten, Malm 6), wie es in der Literatur<br />
<strong>im</strong>mer wieder angegeben wird, konnten wir nicht feststellen.<br />
Die „Glaukonitbank"<br />
Etwa drei Meter unter der Hangendgrenze des Profils II (Car<br />
riere Mallet, großer Bruch) ist eine etwa 20 cm mächtige Bank<br />
besonders bemerkenswert. Sie tritt auch <strong>im</strong> Profil IV (Crussol<br />
Schlucht) in gleicher Mächtigkeit <strong>und</strong> gleicher Lithologie auf. In<br />
beiden Fällen handelt es sich um einen mürben, körnigen, merge<br />
ligen Kalk, der durch relativ großen Eisengehalt in verwittertem<br />
Zustand gelblichbraun gefärbt ist. Chemische Analysen, die wir<br />
Dr. H. LANG verdanken, ergaben folgende Resultate:<br />
Mallet: CaC0 3:<br />
MgC0 3:<br />
Fe 20 3:<br />
77,80 %<br />
0,66 %<br />
0,50 %
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 179<br />
Crussol (Schlucht): CaC0 3: 74,80 %<br />
MgC0 3: 0,60 %<br />
Fe 80 3: 1,50 %<br />
Die Ammoniten-Faunen <strong>im</strong> Liegenden <strong>und</strong> Hangenden der<br />
Bank lassen in ihr ein südostfranzösisches Äquivalent der Grenze<br />
Malm (53/
180<br />
Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
HEMER'S Untersuchungen klassische Profil an der Steige E Graben<br />
stetten nach Schlattstall-Oberlenningen. Man pflegt hier die Subeumela-Zone<br />
mit einer Hybonoticeras pressulum (bzw. verestoieum)<br />
führenden Bank beginnen zu lassen, während sich das namengebende<br />
Zonen-Fossil erst höher konzentriert.<br />
Die Subeumela-Schichten sind innerhalb des <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong>s<br />
faunistisch besonders gut gekennzeichnet (Abb. 6). Von 23 wohl-<br />
abgrenzbaren Ammoniten-Arten treten 21 während oder kurz vor<br />
der Subeumela-Zeit neu in Erscheinung, <strong>und</strong> 15 dieser vorher unbe<br />
kannten Arten überdauern die Subeumela-Zeit nach unserer Kennt<br />
nis nicht oder nur wenig. Diese ungewöhnliche Selbständigkeit einer<br />
zeitlich eng begrenzten Ablagerungsfolge gilt so allerdings nur für<br />
den süddeutschen Raum. Sie gewinnt angesichts solcher Begren<br />
zung unter der Mitwirkung vermutlich endemischer Faktoren<br />
ebenso an Verständlichkeit, wie sie an weitreichender stratigra-<br />
phischer Bedeutung dadurch verliert. Bisher war selbst Sutneria<br />
subeumela ebenso wie Virgataxioceras setatum ausschließlich aus<br />
dem süddeutschen Ablagerungsbereich bekannt, so daß der Name<br />
„Suebium" sehr bezeichnend, <strong>im</strong> Profil außerhalb Süddeutschlands<br />
aber kaum anwendbar erscheinen mußte.<br />
Unsere Untersuchungen haben nun ergeben, daß typische Be<br />
standteile der süddeutschen Subeumela-Fauna auch in der Ardeche<br />
vertreten sind. Der S. 171 erwähnte ammonitenreiche Block lieferte<br />
neben drei Exemplaren von Sutneria subeumela das ebenfalls mit<br />
Ventralfurche versehene kleine Aspidoceras hermanni BERCK-<br />
HEMER als ständigen Begleiter des Zonenfossils auch <strong>im</strong> Schwä<br />
bischen <strong>Jura</strong>. Als charakteristisch hat sich auch Taramelliceras<br />
acallopistum (FONTANNES) in beiden Gebieten erwiesen.<br />
Von der Gattung Hybonoticeras erscheinen die Arten Jcnopi<br />
(NEUMAYR) <strong>und</strong> pressulum (NEUMAYR), von denen in der Ardeche<br />
bisher allerdings nur zwei nicht ganz eindeutig best<strong>im</strong>mbare Bruch<br />
stücke (S. 167,172) vorliegen, in Süddeutschland mit bzw. kurz vor<br />
der Subeumela-Fauna. Hybonoticeras beckeri (NEUMAYR) dagegen,<br />
an dem die Subeumela-Bank bei LePouzin reich ist, wird <strong>im</strong> Schwä<br />
bischen <strong>Jura</strong> erst in der hangenden Setatus-Zone (ob. Suebium)<br />
häufiger <strong>und</strong> reicht bis in die Ulmensis-Schichten. Doch kommt es<br />
mindestens vereinzelt auch hier schon in den Subeumela-Schichten<br />
vor, so daß sein Verhalten in der Ardeche <strong>und</strong> Süddeutschland
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 181<br />
lediglich Häufigkeitsunterschiede zeigt, die aus seiner mediterranen<br />
Herkunft begreiflich sind.<br />
Stärkere Unterschiede zeigen sich bei der Gattung Gloehiceras,<br />
die <strong>im</strong> Schwäbischen <strong>Jura</strong> über der d/e-Grenze mit ausschließlich<br />
neuen, zuvor nicht auftretenden Arten erscheint. Der Subeumela-<br />
fteudomi/t. -Zone o*4 St/öei/me/a - Zone £/\ Sefafisj-Zone £2<br />
14-18<br />
19<br />
20<br />
: SchMüfa<strong>Jura</strong><br />
i Cruj/o/<br />
H •• 6h/Jfo/<br />
ohne s/cfiereWarizanfierunff<br />
+ Lefbu7/n<br />
SCHWABEN<br />
ARDECHE<br />
Pnt/f/oce/m<br />
foHwtx/ee/vj<br />
Zoca/Zop/fAs/T?<br />
H.juöe//matum<br />
&.cnenofum<br />
ff<strong>im</strong>odestum<br />
Qt. tuöercu/afum<br />
Gf.preuäoco/vchffwä<br />
farmfrxjfus<br />
Jut.eu/ne/a<br />
Suf.jvbeumefa<br />
Sn.Jß ffONt J8F9, rnts)<br />
AspJong/s/mum<br />
Ajeigu/naafori/m<br />
A. nsrmonnt'<br />
Mi/ö.pfwsv/i/m<br />
Abb. 6.' Vergleich der Ammoniten-Fauna in Weißem <strong>Jura</strong>
182 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Block von Le Pouzin w<strong>im</strong>melt dagegen von Glochiceras crenosum<br />
(QUENSTEDT), einer <strong>im</strong> schwäbischen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> 6 häufigen,<br />
diese Stufe jedoch hier nicht überdauernden Art. Die einfachste<br />
Erklärung für diesen Bef<strong>und</strong> liegt in längerem Überleben in Gebie<br />
ten, die nicht den Sonderverhältnissen des süddeutschen Raumes<br />
zur Subeumela-Zeit unterworfen waren. Glochiceras solenoides<br />
(QUENSTEDT), das in Süddeutschland erst über der Subeumela-<br />
Zone gef<strong>und</strong>en ist, bleibt bei der Seltenheit seines Vorkommens<br />
für unsere Frage belanglos.<br />
Ohne Bedeutung ist auch der Nachweis von Sutneria cf. eumela<br />
(D'ORBIGNY) neben Sutneria subeumela. Es handelt sich um relativ<br />
großwüchsige Exemplare ohne Externfurche, wie sie auch in Süd<br />
deutschland zusammen mit Sutneria subeumela auftreten. Mög<br />
licherweise stellen sie nur eine extreme Variante dieser Art dar, die<br />
noch an die Stammform S. eumela erinnert, sich von dieser aber<br />
durch bedeutendere Größe unterscheidet.<br />
Auch kräftig <strong>und</strong> vorwiegend zweigabelig berippte Perisphinc-<br />
ten mit breiten, ger<strong>und</strong>eten Windungen (cf. c<strong>im</strong>bricus NEUMAYR<br />
oder isolatus SCHNEID, der cofoi&räiws-Gruppe nahestehend) er<br />
scheinen in Württemberg <strong>und</strong> der Ardeche für die Subeumela-<br />
Schichten bezeichnend, ohne den folgenden Zonen zu fehlen.<br />
Ochetoceras zio (OPPEL), aus den schwäbischen Subeumela-<br />
Schichten bisher noch nicht bekannt, sondern erst später auftre<br />
tend, ist doch angesichts sehr ähnlicher Vorläufer schon <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong><br />
<strong>Jura</strong> d auch <strong>im</strong> „Suebium" eigentlich zu erwarten. Sein Vorkom<br />
men in der Subeumela-Bank von Le Pouzin bedeutet daher keine<br />
Überraschung.<br />
Die Gattung Oxyoppelia erscheint dagegen nach wie vor auf<br />
Süddeutschland beschränkt. Sie hat sich vermutlich aus der<br />
Gruppe des Taramelliceras klettgovianum (WÜRTENBERGER) über<br />
dessen jüngere Unterart klettgovianum brachen BERCKHEMER<br />
& HOLDER unter Bildung der externen Schneide <strong>und</strong> Abschwä-<br />
chungderLobenzerschlitzungraschentwickelt<strong>und</strong> ist <strong>im</strong> „Suebium"<br />
Süddeutschlands mit den beiden Arten fischeri BERCKHEMER <strong>und</strong><br />
pseudopolitula BERCKHEMER häufig. Falls sich der Endemismus<br />
dieser Gattung auch weiterhin bestätigen sollte, wird man viel<br />
leicht an <strong>faunistische</strong> Sonderbedingungen <strong>im</strong> Zusammenhang mit<br />
der Überwucherung des Meeresbodens durch Schwammhügel zu
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 183<br />
denken haben, die den süddeutschen Raum, gegenüber der Tethys<br />
in begrenztem Maße abgeschirmt hat.<br />
Für die Deutung der Subeumela-Bank von Le Pouzin als Kon<br />
densationshorizont, wofür sich außer der Häufigkeit der Ammo<br />
niten — die allerdings nicht lagenhaft, sondern in Nestern ange<br />
reichert sind — das gemeinsame Auftreten von Sutneria cf. eumela,<br />
S. subeumela, Glochiceras crenosum, Hybonoticeras beckeri <strong>und</strong><br />
Ochetoceras zio vielleicht heranziehen ließe, liegt nach den voran<br />
gehenden Ausführungen bisher kein zwingender Gr<strong>und</strong> vor.<br />
Im Profil der Montagne de Crussol sind die Schichten um die<br />
F<strong>und</strong>horizonte 19 <strong>und</strong> 18 als Äquivalent der Subeumela-Schichten<br />
<strong>und</strong> ihres unmittelbaren Liegenden in Württemberg anzusehen.<br />
Doch kann hier aus unseren Crussol-Aufsammlungen bisher nur<br />
Glochiceras semicostatum BERCKHEMER (S. 168 <strong>und</strong> 205) als Cha<br />
rakterfossil der schwäbischen „Übergangssehichten
184<br />
Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Äquivalent des <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> £1<br />
(Uhnensis- einschließlich Lithographicum-Schichten) am Crussol<br />
Die F<strong>und</strong>schichten 21—25 führen Perisphinctiden aus der Ver<br />
wandtschaft von Perisphindes (Lithacoceras) ulmensis (OPPEL) <strong>und</strong><br />
P. siliceus (QUENSTEDT), Haploceras subelirnatum, Glochiceras<br />
pseudocarachteis (FAVRE), G. lens BERCKHEMER, Taramelliceras<br />
rebouletianum (FONTANNES) <strong>und</strong> Hybonoticeras beckeri (NEUMAYR).<br />
Damit dürften sie ungefähr den süddeutschen TJlmensis-Schichten<br />
(C1) entsprechen. Anders als in Süddeutschland finden sich außer<br />
dem Phylloceras sp., Sowerbyceras loryi (MUNIER-CHALMAS) =<br />
silenus (FONTANNES) (häufig), Haploceras staszycii (ZEUSCHNER)<br />
<strong>und</strong> H. carachteis (ZEUSCHNER) als typisch mediterrane Elemente.<br />
Auffallend ist, daß aus Horizont 21 auch schon ein Taramelliceras<br />
prolithographicum (FONTANNES) stammt.<br />
In den Horizonten um F<strong>und</strong>schicht 26 herrscht Taramelliceras<br />
prolithographicum neben Glochiceras lithographicum (OPPEL). Diese<br />
beiden Arten wurden, wenn wir von F. FONTANNES selbst absehen,<br />
in der seitherigen Literatur meistens fälschlicherweise vereinigt,<br />
kommen aber auch in den Plattenkalken des Fränkischen <strong>Jura</strong> <strong>und</strong><br />
insbesondere in dem dickbankigen „Oberen Wilden Fels" über den<br />
Plattenkalken nebeneinander vor. Aus Württemberg ist dagegen<br />
bisher nur Glochiceras lithographicum vereinzelt bekannt.<br />
Zu Glochiceras lithographicum <strong>und</strong> Taramelliceras prolithographicum<br />
paßt auch Neochetoceras steraspis (OPPEL), das ebenfalls<br />
in den fränkischen Plattenkalken auftritt. In einer mit besonders<br />
scharfen Marginalkanten erhaltenen Form liegt es allerdings auch<br />
noch aus den jüngeren Rennertshofer Schichten (obere Reisberg<br />
schichten) des Fränkischen <strong>Jura</strong> vor (A. ROLL, 1933, S. 556; F.<br />
BERCKHEMER & H. HOLDER, 1959, S. 100, Abb. 82—86).<br />
Hybonoticeras m<strong>und</strong>ulum (OPPEL) setzt <strong>im</strong> Schwäbischen <strong>Jura</strong><br />
bereits in den Subeumela-Schichten ein <strong>und</strong> reicht bis über die<br />
TJlmensis-Schichten (C1) in die Zementmergel (f 2). Auffallend ist<br />
dagegen, daß Hybonoticeras knopi am Crussol noch in der F<strong>und</strong><br />
schicht 23 vorkommt, während es <strong>im</strong> Schwäbischen <strong>Jura</strong> auf die<br />
Subeumela-Schichten beschränkt zu sein scheint. Nicht weniger<br />
bemerkenswert ist das gemeinsame Vorkommen von Hybonoticeras<br />
beckeri noch zusammen mit Glochiceras lithographicum. Da die<br />
beiden letztgenannten Arten <strong>im</strong> Fränkischen <strong>Jura</strong> (TH. SCHNEID
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 185<br />
1914) auf zwei sich folgende Zonen verteilt sind, warf W. J. ARKELL<br />
(1956, S. 72) die Frage auf, ob die Schichten unmittelbar unter den<br />
Ruinen des Schlosses Crussol noch der Beckeri- oder schon der<br />
Lithographicum-Zone zuzurechnen seien. Als Lösung ergibt sich,<br />
daß die beiden in Franken getrennten Arten in der Ardeche ge<br />
meinsames Lager haben.<br />
Damit erhebt sich auch hier die Frage, ob Kondensation vor<br />
hege. Bei der <strong>im</strong> Vergleich zu Süddeutschland relativ geringen<br />
Mächtigkeit der Schichten über Aulacostephanus eudoxus bis zu den<br />
Lithographicum-Schichten einschließlich (60 m gegenüber der un<br />
gefähr doppelten Mächtigkeit in der Schwäbisch-Fränkischen Alb)<br />
könnte das sogar naheliegend erscheinen. Die gemeinsame gleichmäßige<br />
Verteilung der Arten Glochiceras lithographicum, Taramelliceras<br />
prolithographicum <strong>und</strong> Hybonoticeras beckeri macht aber<br />
gemeinsames Vorkommen auch zu Lebzeiten wahrscheinlicher.<br />
Zur Ergänzung unserer eigenen Aufsammlungen sei noch ver<br />
merkt, daß F. ROMAN (1950) aus dem oberen Schichtenstoß des<br />
Schlosses Crussol neben Taramelliceras prolithographicum, Hybonoti<br />
ceras beckeri <strong>und</strong> anderen auch von uns gef<strong>und</strong>enen Arten noch<br />
Phylloceras semisulcatum (D'ORBIGNY), Ph.mesophanesFoNTANNES,<br />
Virgatosphinctes praetransitorius (FONTANNES), V. roubyanus<br />
(FONTANNES) als typische Glieder des Unteren Tithons erwähnt.<br />
Auch Ochetoceras palissyanum (FONTANNES) <strong>und</strong> Streblites weinlandi<br />
(OPPEL) werden angeführt, wobei die Eigenart dieser Formen<br />
am Crussol <strong>und</strong> ihre Beziehung zu süddeutschen Verwandten noch<br />
zu untersuchen ist. Ochetoceras palissyanum (E. DUMORTIER & F.<br />
FONTANNES, 1876) steht dem Ochetoceras irreguläre BERCKHEMER<br />
& HOLDER aus den süddeutschen Setatus- <strong>und</strong> unteren Ulmensis-<br />
Schichten mindestens sehr nahe; doch muß eine endgültige Be<br />
urteilung von Lager <strong>und</strong> möglicher Identität einer monographi<br />
schen Bearbeitung von Ochetoceras vorbehalten bleiben.<br />
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Assises<br />
superieures F. FONTANNES' (etwa unsere F<strong>und</strong>schichten 21—28)<br />
ungefähr dem unteren Teil des süddeutschen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> C(C1) ent<br />
sprechen dürften. Als beiden Gebieten gemeinsame Leitammoniten<br />
sind Perisphindes siliceus, Taramelliceras prolithographicum, Glochiceras<br />
lithographicum <strong>und</strong> Neochetoceras steraspis zu nennen. Die<br />
drei letztgenannten Arten werden wie in Süddeutschland erst in<br />
einem gewissen vertikalen Abstand über der „Suebium"-Fauna
186 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
HÄUFIG. ZUGLEICH TRITT AUCH DIE AUF DEN ALPIN-MEDITERRANEN BEREICH<br />
BESCHRÄNKTE Pygope janitor AUF. DA ABER WENIGSTENS Taramelliceras<br />
prolithographicum VEREINZELT SCHON TIEFER (FUNDSCHICHT 21) EINSETZT,<br />
OHNE DAß EIN NUR AUF DIESE TIEFEREN SCHICHTEN BESCHRÄNKTER AMMO-<br />
NIT BEKANNT WÄRE, ZIEHEN WIR AUCH DIESE SCHICHTEN UND DAMIT DIE<br />
GESAMTEN ASSISES SUPERIEURES AM CRUSSOL ZUR LITHOGRAPHICUM-ZONE.<br />
DIE STUFEN- BZW. ZONENFOLGE DES HÖHEREN MALMS DER ARDECHE<br />
IST DEMNACH:<br />
OBERTITHON (ARDESCIEN)<br />
UNTERTITHON (OBER- UND MITTELKIMERIDGIEN)<br />
ZONE DES Subplanites contiguus<br />
ZONE DES Gloehiceras lithographicum (JÜNGSTE SCHICH<br />
TEN DES CRUSSOL)<br />
UNTERMMERIDGIEN<br />
(ZONE DES Virgataxioceras setatum) (IN DER ARDECHE<br />
NOCH NICHT SICHER NACHGEWIESEN)<br />
ZONE DER Sutneria subeumela (LE POUZIN)<br />
ZONE DES Aulacostephanus pseudomutabilis<br />
ZONE DES Aulacostephanus mutabilis<br />
ZONE DES Idoceras balderum<br />
Da Hybonoticeras beckeri GLEICHZEITIG MIT Sutneria subeumela UND<br />
NOCH MIT DER HAUPTVERBREITUNG VON Gloehiceras lithographicum<br />
VORKOMMT, IST DIE FOLGENDE, VON TH. SCHNEID (1914, S. 115 FF.) VOR<br />
GENOMMENE TEILUNG IN<br />
STUFE DER Waagenia beckeri UND DER Oppelia lithographica<br />
UNTERSTUFE DER Oppelia lithographica<br />
UNTERSTUFE DER Waagenia beckeri<br />
SO IN DER ARDECHE NICHT DURCHZUFÜHREN.<br />
Ammoniten-Beschreibungen<br />
"WIR BESCHRÄNKEN BESCHREIBUNG UND TAXIONOMISCHE ERÖRTERUN<br />
GEN AUF DIE FÜR UNSERE STRATIGRAPHISCHE FRAGESTELLUNG WICHTIGSTEN<br />
ARTEN, SOWIE AUF EINIGE NEUE ODER IN SONSTIGER HINSICHT BESONDERE<br />
FORMEN AUS DEM MALM VON ARD&CHE UND SCHWABEN. Idoceras balderum,<br />
Sutneria cyclodorsata UND Sutneria eumela SIND OHNE BESCHREI<br />
BUNG ABGEBILDET.
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 187<br />
Perisphindes WAAGEN 1869<br />
(sensu lato)<br />
Perisphindes siliceus (QUENSTEDT)<br />
Taf. 17, Fig. 2<br />
v* 1858 Ammonites planulatus siliceus. — F. A. QUENSTEDT, <strong>Jura</strong>, S. 775,<br />
Taf. 95, Fig. 27.<br />
v 1959 Perisphindes siliceus (QUENSTEDT). •— F. BERCKHEMER & H. HOL<br />
DER, Amm. südd. Oberen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong>s, S. 41, Taf. 14, Fig. 70.<br />
Die <strong>im</strong> ganzen schwäbischen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> £ verbreitete Art<br />
zeichnet sich durch ziemüch dichtstehende, oft schwach s-förmig<br />
gekrümmte, regelmäßig zweigabelige Rippen aus, die von verein<br />
zelten einfachen Rippen unterbrochen werden. Charakteristisch<br />
ist auch, daß sich manchmal zwei Hauptrippen an der Windungs<br />
naht zu vereinigen pflegen.<br />
Die gleichen Merkmale besitzen Steinkerne aus den oberen<br />
Schichten am Crussol, die wir für artgleich mit siliceus halten.<br />
Entsprechende F<strong>und</strong>e am Crussol wurden bisher wohl zu P. ardesi<br />
cus FONTANNES gezogen.<br />
P. siliceus trägt — <strong>im</strong> Gegensatz zu dem größeren P. (Lithacoceras)<br />
ulmensis (OPPEL) — langgestreckte Mündungsohren, die an<br />
den F<strong>und</strong>en vom Crussol aus Erhaltungsgründen noch nicht nach<br />
gewiesen sind. Die letzten Rippen vor der Mündung können drei<br />
fache Gabelung zeigen.<br />
21, 28.<br />
Vorkommen: F<strong>und</strong>schicht 26; ähnliche (cf.)Formen aus 19,<br />
Perisphindes mit Schalenzerschneidung<br />
Taf. 19, Fig. 2<br />
Die aus dem schwäbischen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> beschriebenen auf<br />
fallenden Schnittränder an Ammoniten-Gehäusen (A. ROLL 1935,<br />
H. HÖLDEK 1955 a) finden sich auch am Crussol. Die Steinkerne<br />
enden dabei mit unnatürlich erscheinender, zackiger Grenzlinie,<br />
wie mit der Kinderschere in Papier, abgeschnitten.<br />
Es handelt sich hier vermutlich nicht um einfachen Schalen<br />
bruch nach dem Tode, sondern um gewaltsamen Schnitt, der<br />
— vielleicht durch Raubkrebse — dem noch lebenden Ammoni-<br />
tentier gegolten haben dürfte. Die aus Lias <strong>und</strong> Dogger nicht
188 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
bekannte Erscheinung ist daher wohl von ökologisch-fazieller<br />
Bedeutung <strong>und</strong> gehört in die Reihe der Ähnlichkeiten zwischen<br />
dem Malm von Süddeutschland <strong>und</strong> Crussol.<br />
Über einige anomale Perisphincten<br />
Perisphinctes spp. forma aegra „huguenini"<br />
(FONTANNES)<br />
Taf. 18, Fig. 1, 2, Abb. 7<br />
v*1876 Ammoniles Huguenini, FONTANNES. Perisphinctes? — E. DUMOR-<br />
TIER & F. FONTANNES, Amm. tenuilobatus, S. 73, Taf. 6, Fig. 3.<br />
1899 Perisphinctes Huguenini FONT. — J. VON SIEMIRADZKI, Monogr.<br />
Perisphinctes, S. 102.<br />
Die hier zu erörternde Ammoniten-Form bietet unter den<br />
Ammoniten-Figuren vom Crussol ein äußerst eigentümliches Bild.<br />
Schon E. DUMORTIER & F. FONTANNES jedoch haben bei dem da<br />
mals einzigen Exemplar, obwohl sie es als eigene Art beschrieben,<br />
an die Möglichkeit anomaler Skulptur gedacht. Diese Vermutung<br />
ließ sich nun anhand weiterer F<strong>und</strong>stücke bestätigen, <strong>und</strong> zwar<br />
unabhängig sowohl durch R. ENAY (in seiner Lyoner Diplomarbeit<br />
nach fre<strong>und</strong>licher mündlicher Mitteilung), als auch anhand unseres<br />
Tübinger Materials.<br />
Wir haben in „hugwnini" eine jener charakteristischen Ammo-<br />
niten-Anomalien vor uns, die nicht willkürliche Einzelfälle dar<br />
stellen, sondern wiederholt in übereinst<strong>im</strong>mender Weise <strong>und</strong> bei<br />
verschiedenen Arten auftreten, so daß sie wohl best<strong>im</strong>mten äußeren<br />
oder inneren Ursachen zuzuschreiben sind (vgl. H. HOLDER 1956).<br />
Das F.FONTANNES'sehe Original, das nur von der kranken<br />
Seite her sichtbar, auf der anderen dagegen fest mit dem Gestein<br />
verwachsen ist, trägt sehr dicht stehende, scharfe Rippen, die über<br />
der Nabelwand vorwärts, von Flankenmitte an aber in flachem<br />
Bogen rückwärts gegen die ger<strong>und</strong>ete Externseite schwingen.<br />
Knapp die Hälfte der Rippen ist einfach, die übrigen gabeln<br />
sich in zwei Äste, <strong>und</strong> zwar in einigen Fällen schon dicht über der<br />
Nabelwand, häufiger aber etwas unter oder in Flankenmitte.<br />
Manchmal ist ein Gabelast bei fehlender Verbindung mit der<br />
Gr<strong>und</strong>rippe als Schaltrippe ausgebildet, die dann dicht über Flan<br />
kenmitte beginnt. Dazu kommt an bisher einfachen oder schon tief<br />
gegabelten Rippen gelegentlich weitere Gabelung weit außen über
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 189<br />
der Umbiegung in die Externseite. Die beiden letzten Umgänge<br />
tragen schwache Einschnürungen in unregelmäßigem Abstand, die<br />
nächstinnere Windung zeigt stattdessen verdickte Wülste, die<br />
wahrscheinlich den rückwärts der Einschnürungen jeweils beson<br />
ders betonten Rippen entsprechen.<br />
Als F<strong>und</strong>lager geben E. DUMORTIER & F. FONTANNES (1876) die<br />
Tenuilobaten-Zone, „Bank X", an.<br />
Ein weiteres ähnliches Exemplar, das vermutlich einer<br />
anderen Perisphincten-Art angehört, fand Dr. E. DIETERICH wäh<br />
rend einer Tübinger Exkursion <strong>im</strong> Jahre 1931 in den Oxfordien-<br />
Kalkmergeln über dem Ravin d'Enfer am Südfuß des Crussol<br />
(Taf. 18, Fig. 2). An ihm erweist sich eindeutig die Verschiedenheit<br />
der beiden Flanken, wie sie bei krankhaften Skulpturen die Regel<br />
ist: Die eine Flanke zeigt den ÄMjMewwn-Charakter des „Holo-<br />
typus" mit geringen Abweichungen, die andere dagegen viel nor<br />
malere Perisphincten-Skulptur.<br />
Der äußere Umgang der normaleren Flanke trägt zahl<br />
reiche scharfe Rippen, die vom Oberrand des flachen Nabelabfalls<br />
gerade <strong>und</strong> dabei etwas nach vorn geneigt über die Flanke ziehen.<br />
R<strong>und</strong> die Hälfte davon bleibt auch hier einfach, die übrigen Rippen<br />
aber gabeln sich auf dem äußeren Flankendrittel oder — aus<br />
nahmsweise — auch schon über der Nabelwand.<br />
Die anomale Flanke des äußeren Umgangs besitzt wiederum<br />
den krankhaften Rippenschwung. Im übrigen zeigt sich auch hier<br />
ein der normaleren Flanke teilweise entsprechender Wechsel ein<br />
facher <strong>und</strong> auf Flankenmitte gegabelter Rippen (Abb. 7), der aber<br />
Abb. 7. Perisphindes sp.<br />
forma aegra „huguenini"<br />
(FONT.), Externberippung<br />
des in Fig. 2, Taf. 18, von<br />
beiden Flanken abgebildeten<br />
Steinkerns aus dem Oxfordien<br />
vom Crussol. Wulstrippen,<br />
unregelmäßige Virgatotomie<br />
<strong>und</strong> asymmetrische<br />
mediane Biegung als<br />
Zeichen starker Anomalie.<br />
Leg. Dr. E. DIETEKICH 1931.<br />
Ce 1145/12. Vergrößert <strong>und</strong><br />
in die Ebene projiziert.
190 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
durch noch stärker gebogene umbilikale Rippenwülste (hinter<br />
schwachen Einschnürungen) unterbrochen ist, von denen manche<br />
Anlaß zu deutlich virgatotomer Abspaltung der hier ansetzenden<br />
Marginalrippen geben.<br />
Die inneren Windungen sind auf der normaleren Flanke<br />
auffallend dicht, scharf <strong>und</strong> vorwiegend einfach, auf der anomalen<br />
noch dichter berippt <strong>und</strong> zeigen hier zugleich auch schon Rippen<br />
schwung, zahlreiche Umbilikalwülste <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Virgatotomie.<br />
Der ausgesprochen anomalen Skulptur der einen Flanke stehen<br />
also auch auf der normaleren anderen einige für Perisphincten auf<br />
fallende Erscheinungen gegenüber: Die ungewöhnlich dichte Innen-<br />
berippung <strong>und</strong> die verhältnismäßig große Zahl einfacher Rippen.<br />
Bei der skulpturellen Verschiedenheit der beiden Flanken besteht<br />
kein Zweifel, daß auch diese auffallenden Merkmale der insgesamt<br />
normaleren Hälfte Krankheitsfolgen sind.<br />
Das Fehlen der Virgatotomie am „Holotypus" zeugt von indi<br />
viduellem Variieren der <strong>im</strong> ganzen einheitlichen Krankheitsmerk<br />
male.<br />
Ein dritter Fall hegt uns in einem sicher wiederum anders<br />
artigen Perisphincten aus dem <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> ö von Neidlingen<br />
(Schwäbische Alb) vor (Taf. 18, Fig. 1). Hier ist die eine Flanke<br />
völlig normal perisphinctisch, mit hoch über Flankenmitte liegen<br />
der Rippengabelung ausgebildet, während die andere mit wulstig<br />
verdickten, tief gegabelten Umbilikalrippen Rasenia-ähnlich er<br />
scheint <strong>und</strong> sich durch den starken Rippenschwung als eine<br />
huguenini-'&hnliche Anomalie zu erkennen gibt. Die Jugendskulptur<br />
der kranken Flanke zeigt auch hier ungewöhnlich dichte <strong>und</strong> eben<br />
falls bereits von Wülsten unterbrochene Berippung.<br />
Das von J. VON SIEMIRADZKI (1899, S. 103) aus den Stramberger<br />
Schichten erwähnte Stück ist nach fre<strong>und</strong>licher Mitteilung von<br />
Professor Dr. R. DEHM in der Münchener Sammlung leider nicht<br />
mehr vorhanden.<br />
*<br />
Wir erwähnen <strong>und</strong> bilden (Taf. 19, Fig. 1) in diesem Zusammen<br />
hang endlich noch einen bisher einzigartigen Perisphincten-F<strong>und</strong><br />
aus dem mittleren Schwäbischen Malm (y 1) ab. Die Skulptur zeigt
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 191<br />
zwar keine umbilikale Bündelung, erinnert aber durch den s-<br />
förmigen Rippenschwung mit marginaler <strong>und</strong> externer Rück-<br />
biegung nicht unerheblich an die forma huguenini. Sie unterscheidet<br />
sich von huguenini jedoch gr<strong>und</strong>sätzlich durch völlig symmetrische<br />
Ausbildung auf beiden Flanken. Es ist deshalb nicht von der Hand<br />
zu weisen, daß eine bisher unbekannte <strong>und</strong> vor allem für den Schwä<br />
bischen <strong>Jura</strong> ungewöhnliche Perisphinctiden-Art vorliegt, zu der<br />
sich Verwandte mit ähnlich rückgebogenen Rippen vielleicht <strong>im</strong><br />
Krakauer Oxfordien finden ließen (G. BUKOWSKI 1887).<br />
Möglich ist aber, daß auch in dieser äußerlich regelmäßig ge<br />
bauten Form eine Anomalie vorliegt, bei der die nicht seltene<br />
krankhafte Rippen-Rückbiegung (forma verticata) mit ihrem<br />
Scheitel genau in die leicht zugefirstete Medianlinie fällt, so daß die<br />
sonst eintretende Asymmetrie ausgebheben ist.<br />
Nebrodites BURCKHARDT 1912<br />
Generotypus: S<strong>im</strong>oceras agrigentinum GEMMBLLARO 1872<br />
Nebrodiles rhodanensis ZIEGLER n. sp.<br />
Taf. 21, Fig. 1—3<br />
Holotypus: Original zu Taf. 21, Fig. 3, aufbewahrt <strong>im</strong> Institut <strong>und</strong> Museum<br />
für Geologie <strong>und</strong> Paläontologie der Universität Tübingen unter<br />
Nr. Ce 1145/1.<br />
Locus typicus: Carriere Mallet, Montagne de Crussol (Ardeche).<br />
Stratum typicum: Obere Tenuilobatus-Zone, „Crusoliensis-Mergel"<br />
(unteres K<strong>im</strong>eridgien).<br />
Derivatio nominis: Rhodanus = Rhone; rhodanensis: von dem bisher<br />
auf das Rhonegebiet beschränkten Vorkommen der Art.<br />
Diagnose: Art der Gattung Nebrodites BURCKHARDT mit un<br />
gefähr 7—10 cm Enddurchmesser, hochovalem Windungsquer<br />
schnitt <strong>und</strong> dicht stehenden, auf Flankenmitte meist biplikaten,<br />
auf der Wohnkammer in ihrem dorsolateralen Teil meist stark<br />
abgeschwächten Rippen.<br />
Beschreibung: Das Gehäuse erreicht einen Durchmesser von<br />
ungefähr 80 mm oder etwas darüber. Seine Endgröße ist nicht<br />
genau bekannt, doch dürfte sie diesen Wert kaum wesentlich über<br />
steigen. Der Nabel ist mäßig weit. Die Windungen sind deutlich<br />
höher als breit, ihre dickste Stelle liegt am Nabelabfall. Von dort<br />
aus neigen sich die etwas abgeflachten Flanken ein wenig gegen die
192<br />
Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Externseite zusammen. Die Externseite selbst ist breit ger<strong>und</strong>et.<br />
Der Nabelabfall ist steil, doch gut ger<strong>und</strong>et. Der Nabel ist ziemlich<br />
seicht.<br />
Maße der untersuchten Stücke:<br />
Durchmesser (mm)<br />
Windungshöhe<br />
Windungsdicke<br />
Nabelweite<br />
Ce 1145/1, Ce 1145/2, Ce 1145/3, A 2959,<br />
Tübingen Tübingen Tübingen Lyon<br />
68 80 61 76 41 55 65<br />
0,32 0,31 0,32 0,32 0,35 0,35 0,34<br />
0,27<br />
0,28<br />
0,44 0,45 0,49 0,47 0,43 0,42 0,43<br />
Die Lobenlinie war bei keinem der untersuchten Exemplare gut<br />
erkennbar. Die Wohnkammer n<strong>im</strong>mt ungefähr den letzten Um<br />
gang ein, ein M<strong>und</strong>rand war indessen nicht erhalten.<br />
Die Berippung der inneren Umgänge ist für einen Nebroditen<br />
typisch. Die Windungen tragen relativ dicht stehende, aber steife,<br />
teils zweispaltige, teils ungespaltene Rippen, zwischen die sich ver<br />
einzelt Einschnürungen einschieben können. Die Rippenspaltstelle<br />
liegt auf Flankenmitte, der Rippenverlauf ist radial. Auf der<br />
Externseite sind die Rippen unterbrochen.<br />
Bei einem Gehäusedurchmesser von ungefähr 25 mm beginnen<br />
sich die Rippen nach vorne zu biegen. Sie rücken dabei ein wenig<br />
dichter zusammen. Sie sind jetzt fast ausnahmslos biplikat, der<br />
Rippenspaltpunkt Hegt etwa auf Flankenmitte. Ihre Stärke bleibt<br />
vom Nabelabfall bis zur Endung neben der Externseite gleich. Die<br />
marginalen Rippenenden stehen sich in der Regel gegenüber.<br />
Bei einem Gehäusedurchmesser zwischen 30 <strong>und</strong> 40 mm be<br />
ginnen sich die Rippen in ihrem Dorsolateralteil oft abzuschwächen.<br />
Sie stehen jetzt ziemlich dicht <strong>und</strong> sind fast durchweg biplikat. Auf<br />
einen halben Umgang entfallen ungefähr 50 Marginalrippen. Auf<br />
der Wohnkammer schieben sich zwischen die biplikaten Rippen<br />
noch zusätzliche Rippen ein, die sich zum Teil recht tief an die<br />
Hauptrippe anlehnen. Es entsteht so vereinzelt der Eindruck eines<br />
doppelten Rippenspaltpunktes, wie er z. B. für die Ataxioceraten<br />
typisch ist <strong>und</strong> wie er auch bei Idoceras vorkommt. Die Rippen ver<br />
laufen auf der Wohnkammer recht steif, sind dabei aber vom<br />
Nabelabfall an leicht nach vorne geneigt. Der Dorsolateralabschnitt<br />
der Rippen ist in der Regel stark verwischt, schon bei leichter Kor<br />
josion des Steinkernes fast unkenntlich. Auf der Externseite lassen
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 193<br />
die Rippen ein breites glattes Band frei. Die marginalen Rippen<br />
enden stehen einander meist gegenüber.<br />
Vorkommen: „Crusoliensis-Mergel" (obere Tenuilobaten-<br />
Zone) bis unterste Mutabilis-Zone des südostfranzösischen Gebietes.<br />
Material: 6 Exemplare.<br />
Differentialdiagnose: Nebrodites rhodanensis gehört in die<br />
Gruppe des Nebrodites agrigentinus (GEMMELLARO) von mittel<br />
großem Gehäuse. Von dieser Art <strong>und</strong> von Nebrodites doublieri<br />
(D'ORBIGNY) unterscheidet sich Nebrodites rhodanensis durch den<br />
hochovalen Windungsquerschnitt <strong>und</strong> die vorgeneigten, anstatt<br />
auch auf der Wohnkammer radialen Rippen. Am nächsten steht<br />
Nebrodites he<strong>im</strong>i (FAVRE), doch ist diese Art etwas größerwüchsig,<br />
deutlich lockerer berippt <strong>und</strong> ohne Abschwächung der Rippen <strong>im</strong><br />
Dorsolateralbereieh. Die letzten beiden Merkmale unterscheiden<br />
auch gegenüber dem kleineren, schlankeren <strong>und</strong> laterale Ohrfort<br />
sätze tragenden Nebrodites hospes (NEUMAYR). Manche Ähnlich<br />
keiten bestehen auch zu den sicher eine spezifische Einheit bildenden<br />
„Arten" sautieri FONTANNES <strong>und</strong> malletianum FONTANNES (1876).<br />
Diese Formen unterscheiden sich jedoch von Nebrodites rhodanensis<br />
ebenfalls durch das Fehlen der Rippenabschwächung <strong>im</strong> Dorso<br />
lateralbereieh, ferner durch mehr perisphinetoidische Innenwin<br />
dungen, etwas schmälere R<strong>und</strong>ung der Externseite <strong>und</strong> gegen den<br />
Marginalbereich eher noch stärker vorgebogene Rippen, deren<br />
Enden vielfach alternieren. Hierdurch geben sie sich als Vertreter<br />
der Gattung Idoceras zu erkennen.<br />
Sutneria ZITTEL 1884<br />
Generotypus: Nautilus platynotus REINECKE 1818<br />
Wir unterlassen die Abtrennung von Enosphinctes SCHINDEWOLF (Generotypus:<br />
Sutneria subeumela SCHNEID) angesichts der sicher engen Verwandtschaft<br />
von 8. eumela (D'ORBIGNY) ohne <strong>und</strong> S. subeumela SCHNEID<br />
mit Ventralfurche.<br />
Sutneria subeumela SCHNEID<br />
Taf. 21, Fig. 6, 7<br />
v 1902 Ammonites n. sp. —• W. HAIZMANN, Weißer <strong>Jura</strong> y <strong>und</strong> ö, S. 538,<br />
Taf. 14, Fig. 5.<br />
v*1914 Sutneria subeumela mihi. — TH. SCHNEID, Geol. Fränkische Alb,<br />
S. 124, Taf. 6, Fig. 7.<br />
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. 13
194<br />
Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
1922 Sutneria subeumela SCHNEID. •— F. BERCKHEMEE, Neue Ammonitenformen,<br />
S. 74.<br />
1925 Enosphindes subeumelus (SCHNEID). — 0. H. SCHINDEWOLF, Entwurf<br />
Syst. Perisph., S. 324.<br />
1931 Sutneria subeumela SCHNEID. — A. ROLL, Stratigraphie ob. Malm,<br />
S. 20—22.<br />
1956 Enosphindes subeumelus (SCHNEID). — W. J. ARKELL, <strong>Jura</strong>ssic Geol.,<br />
S. 113.<br />
1957 Enosphindes subeumelus (SCHNEID). — W. J. ARKELL, Treatise,<br />
S. L 327, Abb. 419,8.<br />
Kleiner, in der Nabelweite variierender Ammonit mit r<strong>und</strong><br />
lichem "Windungsquerschnitt <strong>und</strong> rückknickenden Knierippen, die<br />
extern in der Regel von einer breiten Medianfurche unterbrochen<br />
sind. Nach "W. J. ARKELL (1957) ist diese Externfurche durch das<br />
Herausfallen des Sipho zu erklären, doch trifft diese Deutung mit<br />
Sicherheit nicht zu. Rippen <strong>und</strong> Furche hören schon vor der Mün<br />
dung auf, die an den Seiten mit Spießohren ausgestattet ist.<br />
Unsere F<strong>und</strong>e von Le Pouzin sind die ersten außerhalb Süd<br />
deutschlands. Die Medianfurche erscheint entsprechend vielen<br />
schwäbischen Exemplaren mit scharfen Rändern <strong>und</strong> ziemlich<br />
flachem Boden wie eingestanzt, ganz ähnlich, wie auch bei Aspido-<br />
ceras hermanni (S. 195). Die Mündungsohren sind an den drei uns<br />
vorliegenden Steinkernen, die trotz Beschädigung sicher best<strong>im</strong>m<br />
bar sind, nicht erhalten.<br />
Vorkommen: Sutneria subeumela ist aus Süddeutschland als<br />
Leitart der Subeumela-Zone (zwischen Pseudomutabilis- <strong>und</strong><br />
Setatus-Zone) bekannt. Bei Le Pouzin tritt sie wie in Süddeutschland<br />
zusammen mit Aspidoceras hermanni BERCKHEMER <strong>und</strong> Taramelliceras<br />
acallopistum <strong>und</strong>ulatum BERCKHEMER & HOLDER, <strong>im</strong><br />
Unterschied zu Süddeutschland jedoch auch noch in Begleitung<br />
von Gloehiceras crenosum (QUENSTEDT) <strong>und</strong> schon mit zahlreichen<br />
Hybonoticeras beckeri (NEUMAYR), dagegen ohne die Gattung<br />
Oxyoppelia auf.<br />
Aspidoceras ZITTEL 1868<br />
Generotypus: Ammonites rogoznicensis ZEUSCHNER 1846<br />
Aspidoceras hermanni BERCKHEMER<br />
Taf. 19, Fig. 3, 4<br />
v* 1922 Aspidoceras Hermanni n. sp. — F. BERCKHEMER, Neue Ammonitenformen,<br />
S. 76, Taf. 1, Fig. 12.<br />
1931 Physodoceras hermanni BERCKH. — A. ROLL, Stratigraphie ob.<br />
Malm, S. 21, 22.
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 195<br />
Kleine Form mit dicken, außen flach ger<strong>und</strong>eten Windungen.<br />
Die Externseite zeichnet sich vor allen anderen Aspidoceraten<br />
durch den Besitz einer deutlichen, breiten Externfurche aus. Dicht<br />
über der steilen Nabelwand sitzt eine umbilikale, kaum über Flanken<br />
mitte eine Reihe kräftiger äußerer Knoten, die durch schwache<br />
radiale Rippenwülste verb<strong>und</strong>en sind.<br />
Maße: 27 11 = 0,41 14= 0,52 9 = 0,33.<br />
Bei dem kleinen Exemplar Taf. 19, Fig. 4 ist die Medianfurche<br />
zwischen schwachen Randleisten besonders prägnant <strong>und</strong> breit ein<br />
gesenkt, genau wie oft auch bei der gleichzeitig auftretenden<br />
Sutneria subeumela.<br />
Vorkommen: Subeumela-Block bei Le Pouzin; sonst bisher<br />
nur aus den süddeutschen Subeumela-Schichten bekannt.<br />
Hybonoticeras BREISTROFFER 1947<br />
(nomen substitutum pro Waagenia NEUMAYR 1878)<br />
Generotypus: Ammonites hybonotus OPPEL 1863<br />
Hybonoticeras sp. äff. knopi (NEUMAYR)<br />
Taf. 20, Fig. 9<br />
cf. 1873 Aspidoceras Knopi NEUMAYR. — M. NEUMAYR, Asp. acanth.,<br />
S. 203, Taf. 43, Fig. 1, 2.<br />
Gekammertes Steinkern-Bruchstück einer weitgenabelten<br />
Scheibe mit kaum zunehmender Windungshöhe, auf dessen glatt<br />
ger<strong>und</strong>eter Externseite eine flache Medianrinne eingesenkt ist. Stark<br />
rückwärts strebende Umbilikalknoten sind in ihrer Mehrzahl über<br />
kaum wahrnehmbare Rippenwülste mit noch etwas zahlreicheren,<br />
vorgeneigten Marginalknoten gekoppelt.<br />
Rückneigung der Umbilikalknoten <strong>und</strong> Skulpturlosigkeit der<br />
die Medianrinne begleitenden, nicht kielartig hervortretenden<br />
Längswülste weisen das Stück der Gruppe des Hybonoticeras pressulum<br />
(NEUMAYR) ZU; pressulum selbst pflegt allerdings die Mar<br />
ginalknoten <strong>im</strong> Reifestadium zu verlieren, während sie bei knopi<br />
ausdauern, ohne ebenso zahlreich wie bei unserem Stück zu sein.<br />
(Die am jugendlichen H. knopi kräftige Berippung von Flanken<br />
<strong>und</strong> Externkielen verliert sich bei größeren Stücken.)<br />
Der Externlobus liegt an unserem Bruchstück wie in der Regel<br />
bei Hybonoticeras ein wenig seitlich der Medianlinie.<br />
13*
196 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Vorkommen: Am Crussol ungefähr in F<strong>und</strong>schicht 23 (S. 167).<br />
Im Süddeutschen <strong>Jura</strong> ist die Art etwas tiefer aus der Subeumela-<br />
Zone bekannt.<br />
Hybonoticeras beckeri (NEUMAYR)<br />
v Ng. * 1873 Aspidoceras Beckeri nov. sp. — M. NEUMAYR, Asp. acanth.,<br />
S. 202, Taf. 38, Fig. 3, 4.<br />
v 1879 Waagenia Beckeri, NEUMAYR. — F. FONTANNES, Amm. Crussol<br />
(1879a), S. 83, Taf. 12, Fig. 1.<br />
v 1959 Hybonoticeras beckeri (NEUMAYR). — F. BERCKHEMER & H.<br />
HOLDER, Amm. südd. Oberen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong>s, S. 26, Taf. 1,<br />
Fig. 2,3; Taf. 4, Fig. 13—15.<br />
F. FONTANNES hat die Art aus den oberen Kalken be<strong>im</strong> Schloß<br />
Crussol in einem Bruchstück abgebildet <strong>und</strong> beschrieben. Er er<br />
wähnte dabei außerdem mehrere schlecht erhaltene, an anderen<br />
Stellen der Ardeche gef<strong>und</strong>ene Exemplare der Art hybonotum<br />
(OPPEL).<br />
Wir fanden das typische Hybonoticeras beckeri mit streifiger,<br />
etwas unregelmäßiger Skulptur <strong>und</strong> Knotung in F<strong>und</strong>schicht 26<br />
(also zugleich mit dem Hauptvorkommen von Gloehiceras litho<br />
graphicum) am Crussol <strong>und</strong> zahlreich auch schon in dem Subeumela-<br />
Block bei Le Pouzin. An einem dem Holotypus-Nachguß genau<br />
entsprechenden Exemplar von Le Pouzin verliert der letzterhal<br />
tene Umgang wie dort beinahe die Berührung mit der vorangehen<br />
den Windung infolge äußerster Evolution. (Ce 1145/13.)<br />
Ein halber Steinkern, dessen Skulptur zu der nahe verwandten<br />
Art (oder Varietät) harpephorum (NEUMAYR) hin tendiert, ist auf<br />
Taf. 20, Fig. 7 abgebildet.<br />
Hybonoticeras beckeri subsp. indet.<br />
Taf. 20, Fig. 8<br />
Das kleine, ganz (?) gekammerte Exemplar mit schräger Nabel<br />
wand, sechseckigem Windungsquerschnitt mit ziemlich breiter<br />
Externseite sowie mit dichtgekerbten Kielen neben ausgeprägter<br />
Medianrinne dürfte ebenfalls zu beckeri gehören, trägt aber unge<br />
wöhnlich regelmäßige <strong>und</strong> zahlreiche Knoten. Die Maße entspre<br />
chen M. NEUMA YR'S Holotypus-Figur (ohne die letzte Umgangshälfte)<br />
gut.<br />
Vorkommen: Subeumela-Block von Le Pouzin.
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 197<br />
Hybonoticeras beckeri subsp. cf. ornatum (SPÄTH)<br />
1931 Waagenia ornata, sp. nov. •— L. F. SPÄTH, Revision Kachh, Pt. V,<br />
S. 649, Taf. 118, Fig. 5, Taf. 120, Fig. 1.<br />
Bruchstück mit auffallend breiter <strong>und</strong> flacher Externseite, die<br />
von den schwach gewellten Externkielen bis zu den horizontal ab<br />
stehenden Marginalstacheln kaum abfällt <strong>und</strong> erst hier ungefähr<br />
rechtwinklig in die (nicht erhaltenen) Flanken umbiegt.<br />
Die flache, breite Medianrinne ist von sanften Kielen begleitet,<br />
auf denen die schräg vorwärts gerichteten, schwachen Extern<br />
rippchen in schwachen, höckerartigen Erhebungen enden.<br />
Breite Externseite <strong>und</strong> starke Stacheln st<strong>im</strong>men mit Waagenia<br />
ornata L. F. SPÄTH (1931) überein, die beckeri als Unterart zuge<br />
ordnet werden kann.<br />
Ce 1145/35. F<strong>und</strong>schicht 26, Crussol.<br />
Microconchiate Hybonoticeraten<br />
(mit Mündungsohren)<br />
Hybonoticeras m<strong>und</strong>ulum m<strong>und</strong>ulum (OPPEL)<br />
Taf. 20, Fig. 1—6<br />
1865 Ammonites m<strong>und</strong>ulus OPP. — A. OPPEL, Tithonische Etage, S. 547.<br />
1870 Oppelia m<strong>und</strong>ula OPP. sp. — K. ZITTEL, Ältere Tithonbild., S. 63,<br />
Taf. 4, Fig. 12.<br />
Der Name m<strong>und</strong>ulus bedeutet zierlich, nett. —• Die Einreihung in<br />
Oppelia durch K. A. ZITTEL erklärt sich aus der Parallele zu der kleinen<br />
Oppelia fallauxi (OPPEL) (= Semiformiceras L. F. SPÄTH 1925), deren Steinkerne<br />
ebenfalls eine (allerdings auf andere Weise bedingte <strong>und</strong> weichere)<br />
Medianrinne tragen.<br />
Kleinwüchsiges, 2Jcm Durchmesser kaum überschreitendes<br />
Gehäuse mit weitem Nabel, nur schwach gewölbten Flanken <strong>und</strong><br />
schmaler Medianrinne, die schon bei wenigen mm Durchmesser<br />
ausgebildet <strong>und</strong> von zwei (fast) glatten Kielen begleitet ist. Skulptur<br />
bis auf den letzten Umgang aus dichtstehenden, kräftigen, mehr<br />
oder weniger scharfen, radial oder schwach rückwärts gerichteten<br />
Rippen, die sich marginal knotenartig verdicken, bzw. in Stacheln<br />
verlängern, um sich dann unter geringer Vorbiegung mit der Basis<br />
der Externkiele zu verbinden.<br />
Auf der letzten Umgangshälfte (Endwohnkammer) biegen die<br />
Rippen marginal stärker zurück, treten auseinander <strong>und</strong> werden<br />
gegen die Mündung <strong>im</strong>mer schwächer.
198 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Der Holotypus besteht nur aus einer solchen Endwohn<br />
kammer mit sich abschwächender Skulptur. Dabei dürfte K.<br />
ZITTEL'S Fig. 12 a die Rückbiegung der Rippen wohl richtiger als<br />
die vergrößerte Fig. 12 c zeigen.<br />
Nach Erfahrungen an schwäbischem Material besitzen solche<br />
kleinen Hybonoticeraten langgestreckte Mündungsohren (ähnlich<br />
wie Sutneria), die an dem von uns gesammelten Crussol-Material<br />
ebensowenig erhalten sind, wie die langen Stacheln der Endwohn<br />
kammer. Das <strong>im</strong> Anschluß als Unterart beschriebene Original zu<br />
Waagenia pressula (NEUMAYR) (F. FONTANNES, 1879 a, Taf. 12,<br />
Fig. 3) hat dagegen noch den Ansatz eines Mündungsohres.<br />
Vork ommen: F<strong>und</strong>schicht 25 (2 Exemplare), 26 (über ein<br />
Dutzend Exemplare), Crussol.<br />
Hybonoticeras munäulum attenuatum<br />
BERCKHEMER & HOLDER<br />
v 1879 Waagenia pressula, NEUMAYR. — F. FONTANNES, Amm. Crussol<br />
(1879a), S. 86, Taf. 12, Fig. 3.<br />
v 1959 Hybonoticeras munäulum attenuatum n. subsp. — F. BERCKHEMER<br />
& H. HOLDER, Amm. südd. Oberen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong>s, S. 35, Taf. 3,<br />
Fig. 10,11; Abb. 19.<br />
Die vom Crussol nur in dem genannten einzigen Exemplar<br />
F. FONTANNES' bekannte, <strong>im</strong> übrigen mehrfach in den Subeumela-<br />
Schichten des Schwäbischen <strong>Jura</strong> gef<strong>und</strong>ene Unterart unterscheidet<br />
sich von der Nominatunterart abgesehen von größerer Windungs<br />
dicke <strong>und</strong> etwas engerem Nabel dadurch, daß die Rippen schon vor<br />
oder zu Beginn des letzten Umgangs auseinanderzutreten beginnen<br />
<strong>und</strong> sich auf der Endwohnkammer viel stärker verwischen, so daß<br />
nur etwas unruhig verlaufende Falten übrig bleiben.<br />
Eindeutige Neuf<strong>und</strong>e zu dem von F. FONTANNES abgebildeten,<br />
mit Ohransatz versehenen Exemplar Hegen nicht vor. Morpho<br />
logisch könnten freiHch manche der übrigen m<strong>und</strong>ulum-hmen-<br />
windungen auch zu dieser Unterart gehören, deren stratigraphisches<br />
Vorkommen am Crussol noch zu klären ist.<br />
Die frühen Jugendwindungen von Hybonoticeras pressulum<br />
tragen bei gleichem Durchmesser wie attenuatum bereits UmbiHkal-<br />
knoten, die den Kleinformen stets lebenslang fehlen.
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 199<br />
Taramelliceras DEL CAMPANA 1904<br />
Generotypus: Ammonites trachinotus OPPEL 1863<br />
Taramelliceras pugile (NEUMAYR)<br />
Taf. 22, Fig. 1, 3<br />
1873 Oppelia pugilis NEUMAYR. — M. NEUMAYR, Asp. acanth., S. 167,<br />
Taf. 32, Fig. 1, 2.<br />
v 1879 Oppelia pugilis, NEUMAYR. — F. FONTANNES, Amm. Crussol (1879 a),<br />
S. 45, Taf. 7, Fig. 1, 2.<br />
v 1955 Taramelliceras (Taramelliceras) pugile (NEUMAYR). — H. HOLDER,<br />
Taramelliceras, S. 121, Abb. 122.<br />
F. FONTANNES hat die Art in einem M. NEUMAYR'S Fig. 2 ent<br />
sprechenden Exemplar vom Crussol gut abgebildet, auch wir haben<br />
sie dort mehrfach gef<strong>und</strong>en.<br />
Ebenso erhielten wir sie aus dem Subeumela-Block von Le<br />
Pouzin, aus dem uns ein stark angelöstes, aber mit den charakte<br />
ristischen dicken Marginal- <strong>und</strong> Externknoten erhaltenes großes<br />
Exemplar (Dm 12—13 cm) vorliegt, dessen Nabelweite wohl eben<br />
falls mehr M. NEUMAYR'S Fig. 2, als der weitergenabelten Fig. 1<br />
entspricht. (Ce 1145/38.)<br />
Von unseren kleineren Stücken zeigt Fig. 1 sehr schön die<br />
Jugcndskulptur, die an M. NEUMAYR'S <strong>und</strong> F. FONTANNES' Figuren<br />
erst in ihrem letzten Stadium zu sehen ist. Sie besteht über fast<br />
skulpturloser Dorsolateralfläche aus ziemlich dicht gekämmten,<br />
etwas zugefirsteten Marginalrippen, von denen nahezu die Hälfte<br />
am Ende knotig verdickt ist. Manche Rippen vereinigen sich paar<br />
weise in einem der marginalen Knoten. Externseite korrodiert.<br />
Maße: 60 31 = 0,52 17 = 0,28 11,5 = 0,19.<br />
F. FONTANNES' Taf. 7, Fig. 2 zeigt eine jugendliche Variante mit<br />
etwas kürzeren Marginalrippen <strong>und</strong> größerer skulpturloser Flanken<br />
fläche.<br />
Auch Oppelia hemipleura (F. FONTANNES, 1879a, Taf. 6, Fig. 2)<br />
mit ähnlicher, etwas gröberer <strong>und</strong> steiferer Skulptur als unsere Fig. 1<br />
gehört vielleicht ebenfalls einem jugendlichen Tar. pugile an, zumal<br />
die Nabelweite offensichtlich auch geringer als nach F. FONTANNES'<br />
Angaben sein kann.<br />
Taramelliceras acallopistum (FONTANNES)<br />
* 1879 Oppelia acallopista. — F. FONTANNES, Diagnoses Crussol, S. 11.<br />
v 1979 Oppelia acallopista, FONTANNES. — F. FONTANNES, Amm. Crussol<br />
(1879a), S. 44, Taf. 6, Fig. 5.
200<br />
Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Die aus den oberen Kalken des Crussol als Seltenheit beschrie<br />
bene kleinwüchsige Art (Holotypus mit Lobendrängung!) hat nach<br />
F. FONTANNES die Maße<br />
Dm 39 mm Wh 0,51 Wd0,33 Nw0,13<br />
<strong>und</strong> besitzt reliefschwache Sichelfalten, die auf dem etwas einge<br />
senkten Nabelfeld schwach beginnen, sich <strong>im</strong> Knie auf Flanken<br />
mitte ein wenig akzentuieren <strong>und</strong> dann wiederum abgeschwächt<br />
über Marginal- <strong>und</strong> Außenpartie weiterziehen. Die an sich schmale<br />
Ventralseite verdickt sich <strong>im</strong> Bereich der Wohnkammer rasch,<br />
wobei die Flanken ungefähr parallele Stellung einnehmen.<br />
Eigengesammeltes Material Hegt uns vom Crussol nicht vor.<br />
Taramelliceras acallopistum <strong>und</strong>ulatum<br />
BERCKHEMER & HOLDER<br />
Taf. 22, Fig. 2<br />
v * 1959 Taramelliceras acallopistum <strong>und</strong>ulatum BERCKHEMER & HOLDER<br />
n. subsp. — F. BERCKHEMER & H. HOLDER, Amm. südd. Oberen<br />
<strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong>s, S. 75, Taf. 19, Fig. 90, 94.<br />
Die zuerst in den Subeumela-Schichten des Schwäbischen <strong>Jura</strong><br />
gef<strong>und</strong>ene Form st<strong>im</strong>mt skulpturell weitgehend mit der Nominat-<br />
unterart überein, behält aber bis zur Mündung eine schmale, durch<br />
± konvergierende Flanken gekennzeichnete Gehäuseform. Win<br />
dungsdicke 0,22.<br />
Aus dem Subeumela-Block von Le Pouzin liegen uns zwei den<br />
schwäbischen gut entsprechende Exemplare vor.<br />
Maße: 40,5 21 = 0,52 10= 0,25 5= 0,12.<br />
Die umbüikalen Sichelfalten setzen über steiler Nabelwand fast<br />
ein wenig knotig ein, ziehen dann zunächst einfach, bald aber unter<br />
strähniger Aufgliederung vorgeneigt bis zum Rippenknie auf<br />
Flankenmitte, um auf dem Marginalfeld <strong>im</strong> Bereich spiraler Fieder<br />
streifung (wie sie bei skulpturschwachen TaramelHceraten häufig<br />
in Erscheinung tritt) fast zu erlöschen. Genau wie bei dem süd<br />
deutschen Holotypus der Subspecies ist das innere Flankendrittel<br />
als Nabelfeld ein wenig eingesenkt <strong>und</strong> durch einen kaum bemerk<br />
baren Wulst von dem größeren, externwärts abfallenden Flanken<br />
feld geschieden.
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 201<br />
' Taramelliceras prolithographicum (FONTANNES) <strong>und</strong><br />
Glochiceras lithographicum (OPPEL)<br />
Taramelliceras prolithographicum (F. FONTANNES 1879 a, Taf. 4,<br />
Fig. 1), zu dem auch Oppelia greenackeri (F. FONTANNES 1879 a,<br />
Taf. 5, Fig. 7; non greenackeri MOESCH) als etwas steifer berippte<br />
Jugendvariante gehört, unterscheidet sich von Glochiceras lithographicum<br />
(A. OPPEL, 1863, Taf. 68, Fig. 1—3) durch engeren<br />
Nabel, etwas höhere Windungen, Fehlen jeder Andeutung eines<br />
Flankenkanals, an dessen Stelle aber ein flacher Flankenwulst aus<br />
gebildet sein kann, <strong>und</strong> durch leicht geschwungenen M<strong>und</strong>saum<br />
ohne Mündungsohren.<br />
Glochiceras lithographicum — von B. ZIEGLER (1958, S. 149)<br />
zum Subgenerotypus von Paralingulaticeras best<strong>im</strong>mt — besitzt<br />
einen weiteren Nabel, geringere Windungshöhe, eine mehr oder<br />
weniger deutliche Flankenrinne <strong>und</strong> lang vorgestreckte Mündungs<br />
ohren. Es unterscheidet sich von Taramelliceras außerdem dadurch,<br />
daß die dorsolateralen Rippen am inneren Ende nabelwärts nicht<br />
vorwärts biegen, wie das bei Taramelliceras ein wenig der Fall zu<br />
sein pflegt, sondern rückwärts gerichtet bleiben.<br />
Trotz dieser klaren Unterschiede erweckt der skulpturelle Habi<br />
tus vor allem durch die marginale Knotung jeder Rippe bei beiden<br />
Formen einen so ähnlichen Eindruck, daß sie in der Literatur nach<br />
F. FONTANNES bis vor kurzem nicht getrennt wurden.<br />
Stratigraphisch war die irrtümliche Vereinigung allerdings ohne<br />
Belang, weil beide Formen sowohl am Crussol als auch <strong>im</strong> Fränki<br />
schen <strong>Jura</strong> gleichzeitig auftreten.<br />
Es handelt sich hier um einen der nicht seltenen Fälle frappie<br />
render Ähnlichkeit zweier Ammonitenformen ohne nähere Ver<br />
wandtschaft, wobei die skulpturelle Konvergenz in dem hier dar<br />
gelegten Fall durch das gleichzeitige Auftreten besonders merk<br />
würdig erscheint.<br />
Außer zahlreichen vollständigen Exemplaren von Glochiceras<br />
lithographicum liegen uns aus der F<strong>und</strong>schicht 26 mehrere Innen<br />
windungen vor (Taf. 17, Fig. 4), die durch ihre kräftige Skulptur<br />
<strong>und</strong> die geblähten Umgänge auffallen. Gehäuse aus dem Wilden<br />
Fels von Mörnshe<strong>im</strong> (Fränkische Alb) st<strong>im</strong>men damit gut überein.
202 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
F. FONTANNES selbst hat seine Arten Oppelia vertumnus <strong>und</strong><br />
culminis für sehr nahe verwandt mit lithographicum, vielleicht nur<br />
für Varietäten gehalten. B. ZIEGLER (1958, S. 152) hat sie ebenso<br />
wie haeberleini (OPPEL) mit lithographicum vereinigt.<br />
Streblites HYATT 1900<br />
Generotypus: Ammonites tenuüdbatus OPPEL 1862<br />
Vorbemerkung: Wir vermuten, daß sich F. FONTANNES'<br />
Angabe von Oppelia frotho (OPPEL) <strong>und</strong> vielleicht auch jene von<br />
Oppelia tenuilobata (OPPEL) aus den Assises superieures der Felsen<br />
kalke vom Crussol auf Streblites folgariacus (OPPEL) bezieht.<br />
Streblites folgariacus (OPPEL)<br />
Taf. 22, Fig. 4<br />
1863 Ammonites Folgariacus OPP. — A. OPPEL, Jur. Cephalopod., S. 199,<br />
Taf. 54, Fig. 6.<br />
1870 Oppelia Folgariaca OPP. sp. — K. ZITTEL, Ältere Tithonbild., S. 68,<br />
Taf. 4, Fig. 19, 20.<br />
1872—82 Oppelia Frotho OPP. sp. — G. GEMMELLARO, Faune giuresi, S. 39,<br />
Taf. 6, Fig. 6.<br />
Die vorliegende, K. ZITTEL'S Figuren gut entsprechende halbe<br />
Scheibe eines gekammerten Steinkerns von 5 cm erhaltenem<br />
Durchmesser trägt einen flachen Mittelwulst auf der leicht gewölb<br />
ten Flanke, die in schöner R<strong>und</strong>ung in die Externseite übergeht.<br />
Dieser sitzt ein spätig-conellöser Kielboden auf. Das nabelnahe<br />
Flankenfeld ist von schwachen, vorwärts geneigten Falten bedeckt,<br />
während sich ventrolateral (marginal) erst nahe der Umbiegung<br />
zur Externseite ungefähr radial gerichtete Rippchen mit zwischen<br />
geschalteten r<strong>und</strong>lichen Knoten zeigen.<br />
Die Sutur erscheint noch zarter gegliedert als bei Neochetoceras<br />
steraspis. Der Laterallobus hat einen sehr dünnen, ventralwärts<br />
gebogenen Stamm <strong>und</strong> greift mit seinen ventralen Zweigen bis auf<br />
die Wölbung der Externseite hinauf.<br />
Vorkommen: F<strong>und</strong>schicht 26, Crussol.<br />
Streblites sp.<br />
Einige schlecht erhaltene, bei 10 cm noch gekammerte Stein<br />
kerne entbehren der r<strong>und</strong>en Marginalknoten von Streblites folgariacus.<br />
Vorkommen: F<strong>und</strong>schicht 26, Crussol. (Ce 1145/36.)
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 203<br />
Neochetoceras SPÄTH 1925<br />
Generotypus: Ammonites steraspis OPPEL 1863<br />
Neochetoceras steraspis (OPPEL)<br />
Taf. 22, Fig. 5, Abb. 8<br />
1863 Ammonites steraspis OPP. — A. OPPEL, Jur. Cephalopod., S. 251,<br />
Taf. 69, Fig. 1—7.<br />
1879 Oppelia steraspidoides, FONTANNES. — F. FONTANNES, Amm. Crussol<br />
(1879a), S. 20, Taf. 3, Fig. 1.<br />
1925 Neochetoceras steraspis (OPPEL). — L. F. SPÄTH, Somaliland, S. 118.<br />
1959 Neochetoceras steraspis (OPPEL). — F. BERCKHEMER & H. HOLDER,<br />
Amm. südd. Oberen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong>s, S. 103, Abb. 82—86, Taf. 20, Taf. 27.<br />
Die sehr enggenabelte gekammerte Scheibe Fig. 5 zeigt bei<br />
schwacher Flankenwölbung insgesamt flachen, keilförmigen Win<br />
dungsquerschnitt mit abgeplatteter Externseite, die von den<br />
Flanken durch leicht abger<strong>und</strong>ete Marginalkanten geschieden<br />
ist. Bei günstiger Beleuchtung deutet sich schwache Sichelskulptur<br />
mit spärlichen, rückwärts geneigten, nach vorn offenen Marginal-<br />
bögen an.<br />
Maße: 42 25= 0,58 — 3 = 0,07.<br />
Der tiefzerschlitzte Laterallobus trägt wie bei Streblites weit<br />
ausladende Zweige, deren ventrale Spitzen den Marginalkanten<br />
nahekommen <strong>und</strong> die Zweige des viel kürzeren Externlobus „über<br />
schatten". Innerhalb des Laterallobus folgen auf der Flanke noch<br />
fünf Hilfsloben.<br />
Gehäuseform <strong>und</strong> Skulptur entsprechen Ammonites steraspis<br />
OPPEL, für den A. OPPEL die Maße<br />
85 50 = 0,58 — 9 = 0,11<br />
angibt. Von den Cotypen zeigt A. OPPEL'S Fig. 3 tr<strong>im</strong>arginiten-<br />
ähnlich abgeflachte Externseite mit Mediankiel, wie er auch an<br />
einigen Stücken vom Crussol angedeutet ist. Unter OPPEL'S Origi<br />
nalen (Sammlung München) ist ein solches Exemplar zwar nicht<br />
erhalten; in Stuttgart aber (Museum für Naturk<strong>und</strong>e, Nr. 19 538)<br />
liegt ein körperlich erhaltenes, typisches steraspis aus dem „Wilden<br />
Fels" von Solnhofen, das eine entsprechend abgeflachte <strong>und</strong> gekielte<br />
Außenseite besitzt. Seine anfangs spärlichen Marginalbögen werden<br />
später zahlreicher, doch scheinen Zahl <strong>und</strong> Betonung dieser Bögen<br />
variabel zu sein. Die Sutur ist auch hier <strong>und</strong> bei einem der OPPEL-
204 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
sehen Originale, das der Flankenansicht seiner Fig. 3 entspricht,<br />
fein <strong>und</strong> sehr tief zerschlitzt <strong>und</strong> zeigt einen Laterallobus mit weit<br />
ausgebreiteten Zweigen (während OPPEL'S Figur wohl zu Unrecht<br />
eine einfachere Suturzeichnung vortäuscht).<br />
Abb. 8, eine vermutlich jugend<br />
liche, zur Hälfte erhaltene Scheibe<br />
vom Crussol, zeigt weiteren Nabel,<br />
geringere Windungshöhe <strong>und</strong> auf der<br />
Wohnkammer-Partie schwach sträh<br />
nige Flankenberippung mit Rippen<br />
knie auf Flankenmitte. Ein etwas<br />
dickeres, größeres Stück (Ce 1145/37,<br />
F<strong>und</strong>schicht 25) mit den Maßen<br />
Abb. 8. Neochetoceras steraspis 61<br />
(OPPEL) var. steraspidoides<br />
34=0,56 15 = 0,25 6 = 0,10,<br />
(FONTANNES), Lithographicum- ebenfalls mit schwacher, gleichmäßi<br />
Zone, F<strong>und</strong>schicht 26, Crussol. ger Sichelskulptur (ohne die an<br />
X 1. Ce 1145/32.<br />
OPPEL'S Figuren betonten margina<br />
len Einzelbögen) dürfte dem erwähn<br />
ten juvenilen Exemplar trotz ziemlicher Abr<strong>und</strong>ung der Marginal-<br />
kanten entsprechen. Beide Stücke st<strong>im</strong>men nach Nabelweite, Skulp<br />
tur <strong>und</strong> Windungsdicke mit Oppelia steraspidoides FONTANNES<br />
überein. Da jedoch A. OPPEL für sein steraspis die gleiche Nabel<br />
weite nennt, erscheint angesichts der offenbar variablen Skulptur<br />
eine artliche, bzw. unterartliche Abtrennung nicht hinreichend<br />
begründet. Auch kommen in den Rennertshofer Schichten des<br />
Fränkischen <strong>Jura</strong> Vertreter der weitergenabelten, weniger hoch<br />
mündigen Form („Oppelien mit zwei scharfen Marginalkanten",<br />
A. ROLL 1933, S. 556) vor, die sich ebenfalls nicht gegen steraspis<br />
abgrenzen lassen.<br />
F. FONTANNES selbst hat steraspidoides nur aus Vorsicht aufge<br />
stellt, ohne eine mögliche Identität mit steraspis zu bestreiten. Ein<br />
endgültiges taxionomisches Urteil wollen aber auch wir nicht fällen.<br />
Material <strong>und</strong> Vorkommen: 11 Exemplare (bzw. Bruch<br />
stücke) aus den F<strong>und</strong>schichten 25 <strong>und</strong> 26 vom Crussol. Im Frän<br />
kischen <strong>Jura</strong> aus der Lithographicum-Zone (£1) <strong>und</strong> den Rennerts<br />
hofer Schichten (£3) bekannt.<br />
Unterscheidung: Die Maße der enggenabelten unserer<br />
steraspts-Steinkerne st<strong>im</strong>men mit Strellites zonarius (OPPEL) über-
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 205<br />
ein, der aber radial gerichtete gleichmäßige Marginalrippchen<br />
trägt, während steraspis marginale Bögen <strong>und</strong> — wenn überhaupt,<br />
dann — vorwärts geneigte Marginalrippchen besitzt. Auch fehlen<br />
bei steraspis Relikte des für Streblites bezeichnenden, spätig erhal<br />
tenen Kielbodens. Der Querschnitt von steraspis ist noch deutlicher<br />
keilförmig als bei zonarius <strong>und</strong> kommt damit dem von Oxylenticeras<br />
lepidum SPÄTH 1950 nahe, das aber (als Ausnahme unter den Neo-<br />
ammonoidea) einen geschlossenen Nabel besitzt.<br />
Glochiceras HYATT 1900<br />
Generotypus: Ammonites n<strong>im</strong>baius OPPEL 1863<br />
Glochiceras semicostatumBERCKHEMERn. sp. 6<br />
Taf. 17, Fig. 3<br />
1931 Hapl. semicostatum BERCKH. — A. ROLL, Stratigraphie ob.Malm, S.18.<br />
1933 Oppelia semicoslata BERCKH. — W. BUBECK, Stratigr. u. Tekt. Frielingen,<br />
S. 13.<br />
1945 Oppelia semicoslata BERCKH. — H. ALDINGER, Stratigraphie Weißer<br />
<strong>Jura</strong> ö, S. 128.<br />
1958 Glochiceras (Lingulaiiceras) cf. crenosum (Qu.). — B. ZIEGLER, Glochiceras,<br />
Taf. 13, Fig. 16.<br />
1958 Glochiceras (Lingulaiiceras) semicostatum BERCKHEMER. — B. ZIEGLER,<br />
Glochiceras, S. 159.<br />
Holotypus: Original zu Taf. 17, Fig. 3 (= B. ZIEGLER, 1958, Taf. 13, Fig.<br />
16), aufbewahrt <strong>im</strong> Staatlichen Museum für Naturk<strong>und</strong>e in Stuttgart<br />
unter Nr. 19387.<br />
Locus typicus: Griestal bei Immendingen, Schwäbische Alb.<br />
Stratum typicum: Obere Pseudomutabilis-Zone, Oberer Weißjura 8<br />
(unteres K<strong>im</strong>eridgien).<br />
Derivatio nominis: Die kräftige Berippung bedeckt nur die äußere<br />
Hälfte der Flanken.<br />
Bemerkungen zum Autor: F. BERCKHEMER hat in einem nachgelassenen<br />
Manuskript, das einer eingehenden Bearbeitung der Gattung Glochiceras<br />
zugr<strong>und</strong>e lag (B. ZIEGIER 1958) die Art mit den von Art. 21 <strong>und</strong> 25<br />
der Internationalen Nomenklaturregeln vorgeschriebenen Erfordernissen<br />
versehen. Trotz anfänglicher Zweifel (B. ZIEGLER, 1958, S. 139) hat es sich<br />
als gerechtfertigt erwiesen, sie als neue Art aufzustellen. Dies soll darum<br />
unter F. BERCKHEMER'S Autorschaft geschehen.<br />
* Die Artbeschreibung von Glochiceras semicostatum BERCKHEMER<br />
n. sp. verdanken wir Herrn Dr. rer. nat. DIETRICH SEEGER, der die artliche<br />
Selbständigkeit anhand eigengesammelten Materials gesichert hat.
206<br />
Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Diagnose: Art der Gattung Gloehiceras HYATT, Untergattung<br />
Lingulaticeras ZIEGLER, mit glatter Externseite <strong>und</strong> steilem Nabel-<br />
abfall. Rippen auf das Ventrolateralfeld beschränkt <strong>und</strong> gegen<br />
Flankenmitte stark vorgezogen. Ausgeprägter Lateralkanal fehlt.<br />
Ohrstiel schmal.<br />
Beschreibung: Das dünnscheibenförmige Gehäuse ist mittel<br />
groß <strong>und</strong> ziemlich weit genabelt. Die schwach gewölbten Flanken<br />
stehen nahezu parallel; gegen den seichten Nabel fallen sie über nur<br />
wenig abgestumpfte Kante in steiler, aber niedriger Nabelwand ab.<br />
Knapp dorsalwärts der Flankenmitte kann eine leichte, Spirale<br />
Einmuldung verlaufen, deren dorsale Begrenzung zuweilen etwas<br />
erhöht ist. Das Dorsolateralfeld ist oft etwas abgeschrägt. Die<br />
Externseite ist gut gewölbt, der Windungsquerschnitt rectangulat.<br />
Maße der untersuchten Stücke:<br />
Holotypus: Dm 29 Wh 11 = 0,39 — Nw 9,5 = 0,32<br />
Mittel aller vermessenen Exemplare am M<strong>und</strong>saum:<br />
31<br />
29—36<br />
Der M<strong>und</strong>saum läuft flach aus, höchstens kann er dorsalwärts<br />
des Ohrstiels schwach aufgebogen sein. Er setzt in rechtem Winkel<br />
auf der Naht auf <strong>und</strong> ist auf der Ventralseite leicht vorgebogen.<br />
Eine sehr seichte Rinne zieht am M<strong>und</strong>saum vom Ohrstiel nach der<br />
Externseite, ob sie diese überquert, ist unbekannt. Eine ventrale<br />
Kapuze fehlt. Etwa auf Flankenmitte ist der M<strong>und</strong>saum in einen<br />
schmalen (bei 2 Exemplaren 20—25% der Wh), etwas eingefurch<br />
ten Ohrstiel ausgezogen. Die Ohrplatte selbst ist nicht bekannt.<br />
Die Wohnkammer n<strong>im</strong>mt die Hälfte des letzten Umganges ein.<br />
Lobenlinie unbekannt.<br />
0,39<br />
0,36—0,42<br />
0,34<br />
0,32—0,39<br />
Die Flankenskulptur kommt vor allem auf dem Ventrolateral<br />
feld zur Geltung. Das Dorsolateralfeld trägt höchstens vereinzelte,<br />
weitstehende, zum Nabelabfall zurückgekämmte <strong>und</strong> schwache<br />
Rippchen. Knapp dorsalwärts der Flankenmitte verläuft bei eini<br />
gen Stücken eine seichte Einmuldung; ein ausgesprochener Lateral<br />
kanal fehlt indessen. Etwa auf Flankenmitte beginnen die Ripp<br />
chen herauszutreten. Sie sind zuerst tangential nach rückwärts<br />
geneigt, biegen jedoch bald in radiale Richtung um. Marginal enden<br />
sie in rechtem Winkel zur Externseite, können aber sogar etwas<br />
nach vorn gebogen sein <strong>und</strong> sind hier am stärksten. Die Ventro-
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 207<br />
lateralrippen sind vorwiegend einfach, vereinzelt spalten sie sich<br />
jedoch auf Flankenmitte, manchmal auch wenig ventralwärts da<br />
von, in zwei Teilrippchen auf. Die Rippchen setzen sich teilweise<br />
in feinen, nach vorne stark durchgebogenen Streifen auf der Ex<br />
ternseite fort. Wülste, Kerben oder Zähne sind auf der Externseite<br />
aber nicht vorhanden.<br />
Vorkommen: Mittlerer bis oberer Weißjura öi <strong>und</strong> unterstes e<br />
(vor dem Einsetzen von Sutneria subeumela). Schwäbischer <strong>Jura</strong>,<br />
Crussol.<br />
Material: 17 Exemplare.<br />
Differentialdiagnose: Glochiceras (Lingulaticeras) semi<br />
costatum hat seine ziemlich flachen Flanken, den steilen Nabel<br />
abfall <strong>und</strong> die glatte Externseite mit Gl. modestum <strong>und</strong> Gl. pro-<br />
curvum gemeinsam. Die übrigen Arten der Untergattung Lingulaticeras<br />
mit glatter Externseite (Gl. crassum, Gl. lingulatum, Gl.<br />
nudatum, Gl. solenoides <strong>und</strong> Gl. planulatum) unterscheiden sich<br />
entweder durch ger<strong>und</strong>eten Nabelabfall oder das Auftreten eines<br />
ausgeprägten Lateralkanales, der bei Gl. semicostatum fehlt. Gl.<br />
modestum ist etwas kleiner; wenn Vertreter dieser Art überhaupt<br />
berippt sind, bleiben die Rippen feiner, schwächer <strong>und</strong> auf Flanken<br />
mitte nur schwach vorgebogen. Bei Gl. procurvum sind die Rippen<br />
<strong>im</strong> Marginalbereich viel stärker vorgezogen <strong>und</strong> überdies dort aufge<br />
spalten. Gl. crenosum unterscheidet sich durch die Externkerben,<br />
den schwachen Rippenschwung <strong>und</strong> den breiten Ohrstiel. Die<br />
Flankenskulptur von Gl. fialar zeigt gewisse Ähnlichkeit, doch<br />
laufen dort die Ventrolateralrippen auf Flankenmitte zu einem<br />
Spiralen Wulst zusammen. Überdies trägt die Externseite Quer<br />
wülste, die median knötchenartig verstärkt sind.<br />
Zusammenfassung<br />
Der Oberjura des Crussol (Ardßche) bietet mit seinen litholo-<br />
gischen <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong>n Ähnlichkeiten zu Süddeutschland wich<br />
tige Vergleichsmöglichkeiten. Eingeschränkt gilt das auch für den<br />
22 km südlich des Crussol gelegenen Malm von Le Pouzin, der nach<br />
Fazies <strong>und</strong> Fauna jedoch schon zum helvetisch-subalpinen Becken<br />
der Tethys gehört.<br />
Im unteren K<strong>im</strong>eridgien (soweit dieses <strong>im</strong> vorliegenden Rah<br />
men untersucht wurde) st<strong>im</strong>mt die Faunen- <strong>und</strong> Zonenfolge des
208 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
Crussol mit Süddeutsehland sehr weitgehend überein. Auch ein<br />
zelne Gesteinskomplexe („Crusoliensis-Mergel", „Glaukonitbank")<br />
lassen sich parallelisieren. Das „Suebium" (das als mutmaßliches<br />
Äquivalent der oberen Pseudomutabilis-Zone Englands noch zum<br />
Unterk<strong>im</strong>eridgien gestellt wird) ist am Crussol ungefähr 12 m<br />
mächtig. Typische Leitarten stammen allerdings nur von Le Pouzin<br />
: Sutneria subeumela, Aspidoceras hermanni <strong>und</strong> Taramelliceras<br />
acallopistum <strong>und</strong>ulatum. Das gleichzeitige Vorkommen von Gloehiceras<br />
crenosum, Hybonoticeras beckeri <strong>und</strong> Ochetoceras zio ist durch<br />
unterschiedliche Lebensdauer <strong>und</strong> zeitlich gegenüber Süddeutsch<br />
land verschiedenes Auftreten zu erklären. Die Assises superieures<br />
F. FONTANNES' entsprechen dem Weißjura £1 Süddeutschlands.<br />
Im paläontologischen Teil werden einige in stratigraphischer<br />
Hinsicht wichtige Arten der Ardeche <strong>und</strong> Süddeutschlands be<br />
schrieben <strong>und</strong> abgebildet. Perisphinctes huguenini FONTANNES<br />
stellt eine Ammoniten-Anomalie dar. Sie tritt nicht als willkür<br />
licher Einzelfall, sondern wiederholt in übereinst<strong>im</strong>mender Weise<br />
auf. Als neue Arten werden Nebrodites rhodanensis ZIEGLER aus<br />
der oberen Tenuilobatus- bis untersten Mutabilis-Zone der Ardeche<br />
<strong>und</strong> Gloehiceras (Lingulaticeras) semicostatum BERCKHEMER aus den<br />
Schichten knapp unter dem Auftreten der Sutneria subeumela in<br />
Süddeutschland <strong>und</strong> am Crussol aufgestellt.<br />
Resume<br />
Le <strong>Jura</strong>ssique superieur de Crussol (Ardeche) offre par ses ana-<br />
logies lithologiques et faunistiques avec l'Allemagne du Sud la<br />
possibilite de rapprochements interessants. C'est aussi valable,<br />
avec des restrictions, pour le K<strong>im</strong>eridgien du Pouzin, ä 22 km au<br />
Sud de Crussol, qui appartient cependant par son facies et sa<br />
faune au bassin helvetique et subalpin de la Mer mesogeenne.<br />
Au K<strong>im</strong>eridgien inferieur (autant qu'il a ete examine ici) la<br />
succession des faunes et des zones de Crussol correspond tres bien<br />
ä l'Allemagne du Sud. Meme certains ensembles de roches („Cruso<br />
liensis-Mergel", „Glaukonitbank") peuvent etre parallelises. Le<br />
„Suebium" (que l'on place encore au K<strong>im</strong>eridgien inferieur, comme<br />
equivalent probable de la zone ä Aulacostephanus pseudomutabilis<br />
superieure en Angleterre) a une epaisseur d'environ 12 m ä Crussol.<br />
Ce n'est toutefois que du Pouzin que proviennent de typiques<br />
especes caracteristiques: Sutneria subeumela, Aspidoceras hermanni
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 209<br />
et Taramelliceras acallopistum <strong>und</strong>ulatum. La presence s<strong>im</strong>ultanee<br />
de Glochiceras crenosum, Hybonoticeras beckeri et Ochetoceras zio<br />
est ä expliquer par une duree de vie inegale et un moment d'appa-<br />
rition different par rapport ä l'Allemagne du Sud. Les Assises<br />
superieures de F. FONTANNES correspondent au „Weissjura<br />
Dans la partie paleontologique quelques especes de l'Ardeche<br />
et de rAllemagne du Sud, <strong>im</strong>portantes au point de vue stratigra-<br />
phique, sont decrites et figurees. Perisphindes huguenini FONT.<br />
represent une anomalie parmi les ammonites. Elle n'apparait pas<br />
comme un cas isole du au hasard, mais ä plusieurs reprises d'une<br />
facon correspondante. Nebrodites rhodanensis ZIEGLER de la zone<br />
ä Streblites tenuilobatus superieure ä la zone ä Aulacostephanus<br />
mutabilis de l'Ardeche, et Glochiceras (Lingulaiiceras) semicostatum<br />
BERCKHEMER des couches precedent juste l'apparition de Sutneria<br />
subeumela en Allemagne du Sud et ä Crussol sont etablies comme<br />
especes nouvelles.<br />
Schriften-Verzeichnis<br />
ALDINGER, H.: Zur Stratigraphie des <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> Delta in Württemberg.<br />
— Jber. u. Mitt. oberrh. geol. Ver., n. F. 31,111—152, Stuttgart 1945.<br />
ARKELL, W. J.: <strong>Jura</strong>ssic Geology of the World. — London <strong>und</strong> Edinburgh<br />
(Oliver & Boyd) 1956.<br />
— Mesozoic Ammonoidea. — In: Treatise on Invertebrate Paleontology,<br />
Part L, Mollusca 4, Cephalopoda Ammonoidea, Kansas 1957.<br />
BERCKHEMER, F.: Beschreibung wenig bekannter <strong>und</strong> neuer Ammonitenformen<br />
aus dem oberen <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> Württembergs. — Jh. Ver.<br />
vaterl. Naturkde. Württ., 78, 68—80, Stuttgart 1922.<br />
— Der obere Weiße <strong>Jura</strong> in Württemberg. — Z. dt. geol. Ges., 78, Mber.,<br />
S. 170, Berlin 1926.<br />
BERCKHEMER, F. & HOLDER, H.: Ammoniten aus dem Oberen <strong>Weißen</strong><br />
<strong>Jura</strong> in Süddeutschland. — Geol. Jb., Beih. 35, 135 S., 89 Abb.,<br />
27 Taf., Hannover 1959.<br />
BLANCHET, F.: La Faune du Tithonique inferieur des regions subalpines et<br />
ses rapports avec celle du <strong>Jura</strong> franconien. — Bull. Soc. geol. France,<br />
(4) 23, 70—80, Paris 1923.<br />
BUBECK, W.: Stratigraphie <strong>und</strong> Tektonik bei Frielingen <strong>und</strong> Mühlhe<strong>im</strong> <strong>im</strong><br />
Donautal. — Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., 89, 1—64, Stuttgart<br />
1933.<br />
BUKOWSKI, G.: Über die <strong>Jura</strong>bildungen von Czenstochau in Polen. — Beitr.<br />
Geol. Paläont. österr. -Ungarns u. Orients, 5, 75—171, Wien 1887.<br />
DUMORTIER, E. & FONTANNES, F.: Description des Ammonites de la zone<br />
ä Ammonites tenuilobatus de Crussol (Ardeche). — Mem. Acad. Lyon,<br />
21, Lyon <strong>und</strong> Paris 1876.<br />
N. Jahrbuch 1. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. 14
210 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
FONTANNES, F.: Sur les Ammonites de la zone ä Ammonites tenuilolalus de<br />
Crussol (Ardeche). — Bull. Soc. geol. France, (3) 5, 33—39, Paris<br />
1876.<br />
— Diagnoses de quelques especes nouvelles des calcaires du chäteau de<br />
Crussol (Ardeche). — Lyon 1879.<br />
•— Description des Ammonites des calcaires du chäteau de Crussol (Ardeche).<br />
— Lyon 1879 [1879a].<br />
— Resultats stratigraphiques de l'^tude des Ammonites des calcaires<br />
du chäteau de Crussol. — Bull. Soc. g
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 211<br />
ROLL, A.: Die Stratigraphie des oberen Malm <strong>im</strong> Lauchertgebiet (Schwäbische<br />
Alb) als Gr<strong>und</strong>lage für tektonische Untersuchungen. — Abh.<br />
preuß. geol. L. A., n. F. 135, Berlin 1931.<br />
— <strong>Stratigraphische</strong>r Vergleich zwischen nordwesteuropäischem <strong>und</strong><br />
süddeutschem oberem Malm. •— N. Jb. Miner., Beil.-Bd. 68, 179—<br />
189, Stuttgart 1932.<br />
— Über den Oberen Malm der südwestlichen Frankenalb. Vorläufige<br />
Mitteilung. — Cbl. Miner., 1933 B, 553—564, Stuttgart 1933.<br />
— Über Fraßspuren an Ammonitenschalen. — Cbl. Miner., 1935 B,<br />
120—124, Stuttgart 1935.<br />
ROMAN, F.: Le Bas-Vivarais. — Act. sei. industr., 1090, GAol.r6g.de la<br />
France, VI, Paris 1950.<br />
SALFELD, H.: Die Gliederung des oberen <strong>Jura</strong> in Nordwesteuropa von den<br />
Schichten mit Perisphinctes Martelli OPPEL an aufwärts auf Gr<strong>und</strong><br />
von Ammoniten. — N. Jb. Miner., Beil.-Bd. 37, 125—246, Stuttgart<br />
1913.<br />
SCHINDEWOLF, 0. H.: Entwurf einer Systematik der Perisphincten. —<br />
N. Jb. Miner., Beil.-Bd. 52 B, 309—343, Stuttgart 1925.<br />
SCHNEID, TH.: Die Geologie der Fränkischen Alb zwischen Eichstätt <strong>und</strong><br />
Neuburg a. D. — Geognost. Jh., 27—28, 59—170, München 1914.<br />
— Die Ammonitenfauna der obertithonischen Kalke von Neuburg<br />
a. D. — Geol. Paläont. Abh., n. F. 13, 305—414, Jena 1915.<br />
SIEMIRADZKI, J. VON: Monographische Beschreibung der Ammonitengattung<br />
Perisphinctes. — Palaeontographica, 45, 69—352, Stuttgart 1898—99.<br />
SPÄTH, L. F.: Ammonites and Aptychi. — Monogr. geol. Dep. Hunterian<br />
Museum Glasgow Univ., 1,111—164, Glasgow 1925.<br />
•— Revision of the jurassic Cephalopod Fauna of Kachh (Cutch). —<br />
Mem. geol. Surv. India, Pal. indica, n. S. 9 (1—6), Calcutta 1928—33.<br />
•— A new Tithonian ammonoid fauna from Kurdistan, northern Iraq. —<br />
Bull. Brit. Mus. (nat. Hist.), Geol., 1 (4), 96—137, London 1950.<br />
TOUCAS, A.: Etüde de la Faune des Couches tithoniques de 1'Ardeche. —<br />
Bull. Soc. geol. France, (3) 18, 560—630, Paris 1889.<br />
VEIT, E.: Geologische Untersuchungen <strong>im</strong> Gebiet des oberen Filstales. —<br />
Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., 92, 74—138, Stuttgart 1936.<br />
WÜRTENBERGER, L.: Einige Beobachtungen <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> des oberen<br />
Donauthales. — N. Jb. Miner., 1868, 540—547, Stuttgart 1868.<br />
ZEUSCHNER, L.: Nowe lub niedokladnie opisani gatunki. — 1846. (Die<br />
Arbeit konnte nicht eingesehen werden.)<br />
ZIEGLER, B.: Die Sed<strong>im</strong>entation <strong>im</strong> Malm Delta der Schwäbischen Alb. —<br />
Jber. u. Mitt. oberrh. geol. Ver., n. F. 37, 29—55, Stuttgart 1955.<br />
— Monographie der Ammonitengattung Gloehiceras <strong>im</strong> epikontinentalen<br />
Weißjura Mitteleuropas. — Palaeontographica, 110 A, 93—164,<br />
Stuttgart 1958.<br />
— Die Ammonitenfauna des tieferen Malm Delta in Württemberg. —•<br />
Jber. u. Mitt. oberrh. geol. Ver., n. F. 40, 171—201, Stuttgart 1958<br />
[1958a].<br />
14*
212 Helmut Holder <strong>und</strong> Bernhard Ziegler<br />
ZIEGLER, B.: Das nordwesteuropäische Äquivalent des „Suebiums" (Oberjura).<br />
— N. Jb. Geol. Paläont., Mh. 1958, 433—436, Stuttgart 1958<br />
[1958b].<br />
ZITTEL, K. A.: Die Fauna der älteren Cephalopoden führenden Tithonbildungen.<br />
— Palaeontographica, Suppl. II, 1, Kassel, 1870.<br />
Bei der Schriftleitung eingegangen am 14. November 1958.<br />
Tafelerklärungen<br />
Tafel 17<br />
Fig. 1. Idoceras balderum (OPPEL), Balderum-Zone, Crussol. Nachguß eines<br />
Exemplars aus dem Museum für Naturk<strong>und</strong>e Berlin. Nat. Gr. Dank<br />
fre<strong>und</strong>licher Vermittlung durch Prof. Dr. W. 0. DIETRICH aufbewahrt<br />
in Tübingen unter Ce 1145/4.<br />
Fig. 2. Perisphindes siliceus (QUENSTEDT), Lithographicum-Zone, F<strong>und</strong>schicht<br />
26, Crussol. Nat. Gr. Ce 1145/5. Vgl. S. 187.<br />
Fig. 3. Glochiceras (Lingulaticeras) semicostatum BERCKHEMER n. sp., Holotypus.<br />
Oberer Weißjura cS, Griestal bei Immendingen (Schwäbische<br />
Alb). X 3/2. Staatl. Museum f. Naturk<strong>und</strong>e Stuttgart, Nr. 19 387.<br />
Vgl. S. 205.<br />
Fig. 4. Glochiceras (Pardlingulaticeras) lithographicum (OPPEL), Innenwindung,<br />
Lithographicum-Zone, F<strong>und</strong>schicht 26, Sattel S Schloßruine<br />
Crussol. X 2. Ce 1145/30. Vgl. S. 201.<br />
Fig. 5. Pygope janitor (PICTET), Ventralseite mit unvollständigem Stirnrand,<br />
F<strong>und</strong>punkt VI (Kärtchen S.157) Crussol. Nat. Gr. Br 1145/33.<br />
Fig. 6. Pygope janitor (PICTET), Ventralseite, F<strong>und</strong>punkt VI, Crussol. Nat.<br />
Gr. Br 1145/34.<br />
Tafel 18<br />
Fig. 1. Perisphindes sp., forma aegra huguenini (FONT.), anomale Flanke<br />
mit rückgebogenen <strong>und</strong> über der Naht knotig gebündelten Rippen<br />
(Gegenflanke normal perisphinctisch). Weißjura 6, Burz (Bergschlipf-<br />
Scholle) bei Neidlingen (Schwäbische Alb). Nat. Gr. Ce 1145/11.<br />
Vgl. S. 190.<br />
Fig. 2. Perisphindes sp., forma aegra huguenini (FONT.), links anomale<br />
Flanke (vergrößert), rechts normale Gegenflanke desselben Steinkerns<br />
(nat. Gr.). Oxfordien-Kalk, Südfuß des Berges Crussol; leg. Dr.<br />
E. DIETERICH 1931. Ce 1145/12. Vgl. S. 189 <strong>und</strong> Abb. 7.
<strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> usw. 213<br />
Tafel 19<br />
Fig. 1. Perisphindes sp. mit s-förmiger, auf beiden Flanken ganz gleichmäßig<br />
ausgebildeter Rippenbiegung. Weißjura y 1, Weilerberg (Bergsturz)<br />
bei Wurmlingen (Tuttlingen). Nat. Gr. Ce 1145/8. Vgl. S. 190.<br />
Fig. 2. Perisphindes (cf. ardesicus FONT.) mit Schnittrand, der die<br />
Windung — <strong>im</strong> Bild unten — zackig begrenzt. Nat. Gr. Ce 1145/6.<br />
Vgl. S. 187.<br />
Fig. 3. Aspidoceras hermanni BERCKHEMER, Subeumela-Zone, aus dem<br />
Subeumela-Block von Le Pouzin. X 3/2. Ce 1145/20. Vgl. S. 194.<br />
Fig. 4. Aspidoceras hermanni BERCKHEMER, Externseite eines anderen<br />
Exemplars mit der scharf eingestanzten Medianrinne. Subeumela-<br />
Zone, aus dem Subeumela-Block von Le Pouzin. X 3/2. Ce 1145/21.<br />
Vgl. S. 195.<br />
Tafel 20<br />
Fig. 1—5. Hybonoticeras m<strong>und</strong>ulum (OPPEL), Innenwindungen mit steifen,<br />
marginal bedornten Rippen, die auf der letzten Umgangshälfte erwachsener<br />
Exemplare (Fig. 1,4,5) rückgebogen <strong>und</strong> marginal abgeschwächt<br />
sind; Mündungsohren nicht erhalten. Lithographicum-<br />
Zone, in oder in Nähe von F<strong>und</strong>schicht 26, Crussol. Alle Figuren<br />
ungefähr X 3/2. Ce 1145/14—18. Vgl. S. 197.<br />
Fig. 6. Hybonoticeras m<strong>und</strong>ulum striatulum BERCKHEMER & HOLDER, durch<br />
feine Marginalrippchen charakterisiert. Weißjura £ 1, Frankenhofen<br />
bei Ehingen. Nat. Gr. Ce 1145/19. Leg. Dr. H. PRINZ.<br />
Fig. 7. Hybonoticeras beckeri (NEUMAYR), gegen H. harpephorum (NEUMAYR)<br />
tendierend. Subeumela-Zone, aus dem Subeumela-Block von Le Pouzin.<br />
Nat. Gr. Ce 1145/7. Vgl. S. 196.<br />
Fig. 8. Hybonoticeras cf. beckeri (NEUMAYR), Varietät oder subsp. mit zahlreichen<br />
Stachelknoten. Subeumela-Zone, aus dem Subeumela-Block<br />
von Le Pouzin. Nat. Gr. Ce 1145/9. Vgl. S. 196.<br />
Fig. 9. Hybonoticeras sp. äff. knopi (NEUMAYR), (untere) Lithographicum-<br />
Zone, F<strong>und</strong>schicht 23, Crussol. Nat. Gr. Ce 1145/10. Vgl. S. 195.<br />
Tafel 21<br />
Fig. 1. Nebrodites rhodanensis ZIEGLER n. sp., Paratypoid, obere Tenuilobatus-Zone,<br />
Crussol. Nat. Gr. Ce 1145/3. Vgl. S. 191.<br />
Fig. 2. Nebrodites rhodanensis ZIEGLER n. sp., Paratypoid, unterste Mutabilis-Zone,<br />
F<strong>und</strong>schicht 4, Steinbruch Mallet, Crussol. Nat. Gr.<br />
Ce 1145/2. Vgl. S. 191.<br />
Fig. 3. Nebrodites rhodanensis ZIEGLER n. sp., Holotypus, obere Tenuilobatus-Zone,<br />
F<strong>und</strong>schicht 2, Steinbruch Mallet, Crussol. Nat. Gr.<br />
Ce 1145/1. Vgl. S. 191.<br />
Fig. 4. Sutneria cyclodorsata (MOESCH), unterste Pseudomutabilis-Zone,<br />
F<strong>und</strong>schicht 8, Crussol. x 2. Ce 1145/22. Vgl. S. 169.
214 Holder u. Ziegler, <strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong> usw.<br />
Noch Tafel 21<br />
Fig. 5. Sutneria eumela (D'OBBIGNY), Pseudomutabilis-Zone, F<strong>und</strong>schicht<br />
12, Steinbruch Mallet, Crussol. x 2. Ce 1145/31. Vgl. S. 168.<br />
Fig. 6. Sutneria subeumela SCHNEID, Flanken- <strong>und</strong> Externansicht, Subeumela-Zone,<br />
aus dem Subeumela-Block von Le Pouzin. X 3/2.<br />
Ce 1145/24. Vgl. S. 193—194.<br />
Fig. 7. Sutneria subeumela SCHNEID, Externansicht der Endwohnkammer<br />
mit der scharf eingestanzten, gegen die Mündung erlöschenden<br />
Medianrinne. Subeumela-Zone, aus dem Subeumela-Block von<br />
Le Pouzin. X 3/2. Ce 1145/23. Vgl. S. 193—194.<br />
Tafel 22<br />
Fig. 1. Taramelliceras pugile (NEUMAYR), nicht erwachsen, Subeumela-Zone,<br />
aus dem Subeumela-Block von Le Pouzin. Nat. Gr. Ce 1145/25.<br />
Vgl. S. 199.<br />
Fig. 2. Taramelliceras acallopistum (FONT.), subsp. <strong>und</strong>ulatum BERCKHEMER<br />
& HOLDER, Subeumela-Zone, aus dem Subeumela-Block von<br />
Le Pouzin. Nat. Gr. Ce 1145/26. Vgl. S. 200.<br />
Fig. 3. Taramelliceras pugile (NEUMAYR), nicht erwachsen, gröber skulpierte<br />
Varietät als Fig. 1. Subeumela-Zone, aus dem Subeumela-Block<br />
von Le Pouzin. Nat. Gr. Ce 1145/28. Vgl. S. 199.<br />
Fig. 4. Streblites folgariacus (OPPEL). Lithographicum-Zone, F<strong>und</strong>schicht 26,<br />
Crussol. Nat. Gr. Ce 1145/27. Vgl. S. 202.<br />
Fig. 5. Neochetoceras steraspis (OPPEL). Flanken- <strong>und</strong> Schrägansicht desselben<br />
Stückes mit deutlicher Marginalkante am Rand der fast<br />
flachen Externseite. Lithographicum-Zone, F<strong>und</strong>schicht 26, Sattel S<br />
Schloßruine Crussol. Nat. Gr. Ce 1145/29. Vgl. S. 203.<br />
Alle unter Ce (bzw. Br) 1145 angeführten Stücke liegen <strong>im</strong> Museum<br />
für Geologie <strong>und</strong> Paläontologie der Universität Tübingen.
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. Taf. 17.<br />
H. Holder u. B. Ziegler: Straligraphische <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> zwischen Süddeutschland <strong>und</strong> Ardeche.
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. Taf. 18.<br />
H. Holder u. B. Ziegler: <strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> zwischen Süddeutschland <strong>und</strong> Ardeche.
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. Taf. 19.<br />
H. Holder u. B. Ziegler: Straligraphische <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> zwischen Süddeutschland <strong>und</strong> Ardeche.
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. Taf. 20.<br />
H. Holder u. B. Ziegler: <strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> zwischen Süddeutschland <strong>und</strong> Ardeche.
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. Taf. 21.<br />
H. Holder u. B. Ziegler: <strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> zwischen Siiddeutschland <strong>und</strong> Ardeche.
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 108. Taf. 22.<br />
H. Holder u. B. Ziegler: <strong>Stratigraphische</strong> <strong>und</strong> <strong>faunistische</strong> <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Weißen</strong> <strong>Jura</strong> zwischen Süddeutschland <strong>und</strong> Ardeche.