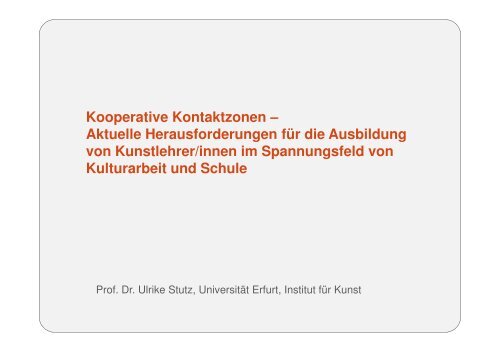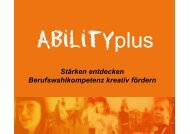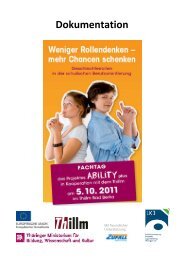Kooperative Kontaktzonen – Aktuelle Herausforderungen für die ...
Kooperative Kontaktzonen – Aktuelle Herausforderungen für die ...
Kooperative Kontaktzonen – Aktuelle Herausforderungen für die ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kooperative</strong> <strong>Kontaktzonen</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Herausforderungen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> Ausbildung<br />
von Kunstlehrer/innen im Spannungsfeld von<br />
Kulturarbeit und Schule<br />
Prof. Dr. Ulrike Stutz, Universität Erfurt, Institut <strong>für</strong> Kunst
Albrecht Dürer<br />
Der Schulmeister 1510
Lehrer mit Schulgehilfe , um 1500
Unterrichtsszene, 1734
Lithographie nach einem Gemälde von Johann Peter Hasenclever<br />
1846
Berthold Otto Schule, Berlin 1930<br />
Gesamtunterricht
Lehrer in Hessen, 1950er Jahre
Reformpädagogische Schule in Bremen, 1950er Jahre
Thema und Struktur des Vortrags<br />
Überlegungen <strong>für</strong> <strong>die</strong> universitäre Ausbildung von Kunstlehrer/innen hinsichtlich<br />
des Aspektes des kooperativen Lehrens<br />
Nach kurzer historischer Betrachtung<br />
• Formen und Verständnis von Kooperation<br />
• Stu<strong>die</strong>n zu kooperativen Partnerschaften mit und in Schule<br />
• Kulturelle und künstlerische Bildung und Schule<br />
• <strong>Kooperative</strong> Kunst als Bezugsfeld<br />
• Situation in den Lehramtsstu<strong>die</strong>ngängen Kunst<br />
• Beispielhafte Fortbildung zu kooperativen Arbeitsformen im<br />
Kunstunterricht der Schule<br />
• Überlegungen zu Konsequenzen <strong>die</strong> <strong>für</strong> Ausbildung von Kunstlehrer/innen
Kooperation von Schulen mit<br />
außerschulischen Partner/innen
Verschiedene Formen von Kooperation (nach Thimm 2008)<br />
Kooperationsverhältnisse<br />
• Formales Kooperationsverhältnis<br />
• nützlichkeitsorientiertes Kooperationsverhältnis<br />
• empathisches, einsichtsgestützes Kooperationsverhältnis<br />
Art und Weise der Kooperation<br />
• Einfache Koordination (additiv, parallel)<br />
• Komplexe Koordination (stellenweise Verknüpfung)<br />
• Kooperation (Empathie und Gemeinsamkeiten)<br />
• Strukturell-konzeptionelle Verbindung (Verähnlichung, Integration)
Verschiedene Formen von Kooperation (nach Thimm 2008)<br />
Kooperationsverhältnisse<br />
• Formales Kooperationsverhältnis<br />
• nützlichkeitsorientiertes Kooperationsverhältnis<br />
• empathisches, einsichtgestützes Kooperationsverhältnis<br />
Art und Weise der Kooperation<br />
• Einfache Koordination (additiv, parallel)<br />
• Komplexe Koordination (stellenweise Verknüpfung)<br />
• Kooperation (Empathie und Gemeinsamkeiten)<br />
• Strukturell-konzeptionelle Verbindung (Verähnlichung, Integration)
Verschiedene Formen von Kooperation (nach Thimm 2008)<br />
Kooperationsverhältnisse<br />
• Formales Kooperationsverhältnis<br />
• nützlichkeitsorientiertes Kooperationsverhältnis<br />
• empathisches, einsichtgestützes Kooperationsverhältnis<br />
Art und Weise der Kooperation<br />
• Einfache Koordination (additiv, parallel)<br />
• Komplexe Koordination (stellenweise Verknüpfung)<br />
• Kooperation (Empathie und Gemeinsamkeiten)<br />
• Strukturell-konzeptionelle Verbindung (Verähnlichung, Integration)
Verschiedene Formen von Kooperation (nach Thimm 2008)<br />
Kooperationsverhältnisse<br />
• Formales Kooperationsverhältnis<br />
• nützlichkeitsorientiertes Kooperationsverhältnis<br />
• empathisches, einsichtgestützes Kooperationsverhältnis<br />
Art und Weise der Kooperation<br />
• Einfache Koordination (additiv, parallel)<br />
• Komplexe Koordination (stellenweise Verknüpfung)<br />
• Kooperation (Empathie und Gemeinsamkeiten)<br />
• Strukturell-konzeptionelle Verbindung (Verähnlichung, Integration)<br />
Ebenen von Kooperation<br />
• Personale Ebene (Lehrer/innen-Lehrer/innen, Lehrer/innen-Künstler/innen, …)<br />
• Strukturelle Ebene (Raum, Zeit, Material, Ressourcen, …)<br />
• Institutionelle Ebene (Curricula, Gremien, …)
Verschiedene Formen von Kooperation (nach Thimm 2008)<br />
Kooperationsverhältnisse<br />
• Formales Kooperationsverhältnis<br />
• nützlichkeitsorientiertes Kooperationsverhältnis<br />
• empathisches, einsichtgestützes Kooperationsverhältnis<br />
Art und Weise der Kooperation<br />
• Einfache Koordination (additiv, parallel)<br />
• Komplexe Koordination (stellenweise Verknüpfung)<br />
• Kooperation (Empathie und Gemeinsamkeiten)<br />
• Strukturell-konzeptionelle Verbindung (Verähnlichung, Integration)<br />
Ebenen von Kooperation<br />
• Personale Ebene (Lehrer/innen-Lehrer/innen, Lehrer/innen-Künstler/innen, …)<br />
• Strukturelle Ebene (Raum, Zeit, Material, Ressourcen, …)<br />
• Institutionelle Ebene (Curricula, Gremien, …)
Systeme von Kooperation<br />
Mikrosystem: Lehrer/innen-Lehrer/innen, Schüler/innen-Schüler/innen,<br />
Schüler/innen-Lehrer/innen<br />
Mesosystem: Lehrpersonen mit Kollegium, mit Eltern, mit Schülerschaft<br />
und mit privatem Umfeld<br />
Exosystem: Räume, Materialien, Lehrpläne, schulisches Umfeld,<br />
Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
Makrosystem: gesellschaftliche Bedingungen, Normen, Werte, …
Kontext Ganztagsschule:<br />
Datenbasis StEG (Stu<strong>die</strong> zur Entwicklung von Ganztagsschulen,<br />
1. Erhebung 2005)<br />
Drei Orientierungen der Kooperationspartner von Schule:<br />
nutzerorientiert (freie Anbieter), kooperativ (Jugendhilfe, öffentliche<br />
Anbieter), anbieterorientiert (gewerbliche Anbieter)<br />
Verzahnung mit Unterricht:<br />
50% gar nicht, 18% mit Regelunterricht verknüpft (insbesondere Sport und<br />
Musik), 20% im Unterricht vor- und nachbereitet, 30% mit Unterricht<br />
abgestimmt (insbesondere Kultureinrichtungen wie Museum, Bibliothek,<br />
Kunstschule, …)<br />
Zusammenarbeit der Professionen:<br />
35% der Lehrkräfte teilweise oder sehr in Koop. mit weiterem päd. Personal<br />
84% der Externen im Austausch mit Schulleitung oder Lehrkräften, davon:<br />
35% wöchentliche Abstimmung mit Lehrkr., 25 % gemeinsame Projekte<br />
20% Absprachen über Hausaufgaben, 12 % keine Absprachen<br />
Jugendhilfe = stärkerer Austausch mit Lehrkräften und Schulleitungen.
Kontext Ganztagsschule:<br />
Datenbasis StEG (Stu<strong>die</strong> zur Entwicklung von Ganztagsschulen,<br />
1. Erhebung 2005)<br />
> Nebeneinander unterschiedlicher Kooperationsformen<br />
> Zur Intensivierung sind Institutionalisierte Kommunikationsabläufe notwendig<br />
(z.B. gemeinsame Gremienarbeit)<br />
(vgl. Arnoldt/Züchner 2008)
Gelingensbedingungen (Thimm: Stu<strong>die</strong> zu Kooperationen in schulischen<br />
Ganztagsvorhaben, 2006)<br />
Partner/innen müssen Grenzen der eigenen Fachkompetenz erkennen<br />
Interagieren als eigenständige Partner/innen<br />
Wissen voneinander ist wesentlich, Begegnungsmöglichkeiten sollten<br />
hergestellt werden<br />
Sowohl Unterschiede aber besonders auch <strong>die</strong> Gemeinsamkeiten beider<br />
Partner/innen sind wesentlich<br />
Gemeinsame Orte und Zeiten, Kommunikation<br />
sozial-emotionale Erfahrungen müssen gut sein, Wiederholungen angestrebt<br />
werden (Win-Win-Situation)
Hindernisse:<br />
• Einzelarbeiter-Rolle von Lehrer/innen,<br />
• Erwartungen von Lehrer/innen an schnelle Effekte,<br />
• Zeitstrukturen von Schule,<br />
• schlechter Informationsfluss<br />
• Konkurrenz<br />
• Motivationsmangel<br />
• unterschiedliche Erwartungen<br />
• vollendete Tatsachen<br />
• Ergebnisse nicht als Kooperationswirkung wahrgenommen<br />
• Geringe Beachtung der fachlichen Autonomie<br />
• Unverbindlichkeit<br />
• Unreflektierte Vorurteile<br />
(vgl. Szcyrba 2003 zitiert nach Thimm 2008)
Relevant:<br />
Persönliches Kennenlernen der Partner (personale Ebene)<br />
Einnahme eines Systemblicks (Erkennen von Handlungszwängen, …)<br />
(personale Ebene)<br />
Langfristige Perspektiven (strukturelle Ebene)<br />
Besonders günstig: Nicht nur Einzelpersonen kooperieren, sondern Koop.<br />
sind Bestandteile institutionellen Handelns (Institutionelle Ebene)<br />
>>Fortbildung als Qualifizierung. Diese sollte berufsbegleitend und<br />
projektgenerierend angelegt sein, Koppelung von Fortbildung und<br />
Projektberatung, Planungs- und Leitungsebene integrieren (Person, Struktur,<br />
Institution)<br />
(vgl. Thimm 2006)
Kooperation in Schulen -<br />
Teamteaching als Beziehungsdidaktik (K. Reich)
Stu<strong>die</strong>n zum Teamteaching in der Grundschule in Zürich (2001/02)<br />
und in der Volksschule Kärnten (Huber 2000)<br />
Fazit<br />
• Integrationsgedanke und Wunsch nach Qualitätssteigerung von Unterricht<br />
notwendig, um Potentiale von TT zu nutzen (nicht nur, aber auch Entlastung)<br />
• Gesprächskultur entwickeln<br />
• Reflexiver Umgang mit Fähigkeiten und Grenzen<br />
• positive Einstellung zu TT, Bereitschaft zur Kooperation<br />
• Verbindung von Vorbildfunktion und entsprechendem Unterrichtssetting sowie<br />
Reflexion wesentlich, um kooperatives Verhalten der Kinder ebenfalls anzuregen<br />
• häufigeres Durchführen ‚offener’ und ‚freier’ Unterrichtsphasen <strong>für</strong><br />
selbstständiges und selbsttätiges Lernen durch TT<br />
• Institutionelle und strukturelle Verankerung ist begünstigend<br />
(Einbeziehung von TT in Unterrichtsentwicklung)<br />
• Sowohl Autonomie als auch Rahmenbedingungen sind notwendig <strong>für</strong> TT u.a.<br />
auch Angebote der Weiterbildung und Supervision<br />
>> Effekte in Bezug auf Lehrer/innen- und Schüler/innenhandeln sowie<br />
<strong>für</strong> veränderte Strukturen von Unterricht<br />
>> Voraussetzung: Einstellung von Lehrer/innen, Offenheit<br />
>> Institutionelle und strukturelle Ebene wesentlich, ebenso Rahmenbedingungen
Beispiel Helene Lange Schule Wiesbaden,<br />
institutionelle und strukturelle Verankerung des Planens<br />
und Lehrens im Team<br />
Helene Lange Schule, Wiesbaden,<br />
Lehrerteam der Jahrgangsstufe 6 (4 Parallelklassen)
Kooperationen in der künstlerischen und<br />
kulturellen Bildung
Künstlerische und kulturelle Bildung<br />
Tradition in der Einbeziehung von außerschulischen Partner/innen durch<br />
Künstler/innen in der Schule<br />
Partnerschaften mit Kultureinrichtungen (Museum, Galerie, …)<br />
sozialraumorientierte Ansätze (u.a. pädagogische Aktion München)<br />
Erster Modellversuch<br />
„Künstler und Schüler“ März 1976 bis Dezember 1979 (BMBW)<br />
> bereits hier grundlegende Effekte <strong>für</strong><br />
- Schüler/innen (Emanzipation, Reflexion, Handlungswerweiterung),<br />
- Künstler/innen (Anerkennung, Erweiterung des Berufsfeldes) und<br />
- Lehrer/innen (Erweiterung, Rollenwechsel, Forschungsperspektive), aber<br />
auch Ängste von Lehrer/innen und Künstler/innen thematisiert<br />
(vgl. Mörsch 2005)
Modellprojekte, Konzepte und Arbeitsstellen aus der jüngeren Zeit:<br />
Freiligrathschule <strong>–</strong> Die Dritten <strong>–</strong> außerschulische Professionelle (Berlin)<br />
KLiP <strong>–</strong> Kunst und Lernen im Prozess (Berlin)<br />
Artus <strong>–</strong> Kunst unseren Schulen (Brandenburg)<br />
Kulturagenten (bundesweit)<br />
Künste und Schule (Kulturprojekte Berlin)<br />
Arbeitsstelle Kulturelle Bildung und Schule in NRW<br />
Programm Kultur und Schule, NRW<br />
Fachstelle Kultur macht Schule (bundesweit)<br />
Konzept „Kulturschule“ (BKJ)<br />
…
Kunst als Bezugsfeld <strong>–</strong><br />
<strong>Kooperative</strong> Praxisformen
Joseph Beuys „7000 Eichen“, 1982-87
Thomas Hirschhorn, Bataille Monument<br />
Documenta 2002, Imbiss von Anwohnern betrieben
Rirkit Tiravanija „The Zoo Society“, 1997 Münster
Reinigungsgesellschaft „Leitsystem zum Neuen“, Grambow 2009
Lehramts-Stu<strong>die</strong>ngänge Kunst<br />
Stu<strong>die</strong>ngänge an 54 Hochschulen gesichtet:<br />
• 8 Stu<strong>die</strong>ngänge integrieren Aspekte von kooperativer Praxis (u.a.<br />
Teamfähigkeit, Kooperation mit anderen Fachlehrer/innen, …)<br />
> davon 4 PHs<br />
• 5 mit Bezug zu außerschulischer Arbeit, u.a. Museum als Lernort<br />
• 5 Stu<strong>die</strong>ngänge, in denen Elternarbeit thematisiert wird
Beispielhafte Fortbildung „Kontextschule“<br />
Hintergrund: Offensive Kulturelle Bildung Berlin (seit 2006)<br />
Patenschaften Künste und Schulen (ab 2007)<br />
> langfristige Partnerschaften zwischen Schulen und Kultureinrichtungen<br />
Beobachtung und Analyse zum Projekt „Patenschaften“ (ifkik UDK Berlin)<br />
"Zoom Patenschaften" von 2007-20010 begleitet<br />
> Notwendigkeit zur stärkeren Förderung der Kooperation erkannt<br />
Fortbildung Kontextschule<br />
Abwechselnd an 17 Terminen „Experten treffen“ und „Projekte entwickeln“<br />
Sowie künstlerisch-edukative Warm-ups von Teilnehmer/innen aus ihrer<br />
beruflichen Praxis abgeleitet
Die Schule zum Kontext machen<br />
Distanzierter und reflexiver Blick auf Schule<br />
ortsspezifische Arbeitsweisen initiieren (Räume, spezifische Phänomene<br />
wie z.B. <strong>die</strong> Schulglocke, Mobiliar, soziale Konstellationen, … zum<br />
Gegenstand der Untersuchung machen)<br />
> Repräsentationsmechanismen erfahrbar machen und befragen<br />
Den Kontext zur Schule machen<br />
Gegenseitiges Kennenlernen der Akteure<br />
Sich gegenseitig besuchen „Praktikum im Alltag des Anderen“<br />
Wesentliche Aspekte <strong>für</strong> <strong>die</strong> Zukunft:<br />
> Fragen zu Bildungs- und Kunst- und Kulturbegriffen einbeziehen<br />
> Institutionell-strukturelle Verankerung im System Schule<br />
> Fragen zur Qualität künstlerisch-edukativer Projekte behandeln
Überlegungen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Fachdidaktik Kunst <strong>für</strong> Lehramt:<br />
Theorie:<br />
Fachliches Wissen über kooperatives Lehren:<br />
- Historische Aspekte<br />
- Stu<strong>die</strong>n<br />
- Praxisbeispiele (u.a. Kulturagenten, Kultur macht Schule, …)<br />
- Wissen über aktuelle, internationale Entwicklungen von Schule (u.a.<br />
Ganztagsbildung)<br />
Wissen über kooperative künstlerische Praxisformen<br />
Praxis:<br />
Erfahrungen mit kooperativem Lehren<br />
- in der eigenen Stu<strong>die</strong>ngruppe (Teamteaching als Normalfall)<br />
- Reflexion von Lehrer/innenrollen und Lehrer/innenbildern<br />
- Einbeziehen von Externen bereits im Studium (Praktikum)<br />
(z.B. Kooperation mit Museum, Galerie, Stadtteilprojekt, …)<br />
- Hospitation in kooperativen Angeboten<br />
- praktische Erfahrungen mit kooperativen künstlerischen Praxisformen
Verbindung von explizitem, theoriebezogenem und implizitem,<br />
handlungsbezogenen Wissen, um <strong>die</strong> Ausbildung eines künstlerischen<br />
und kooperativen Habitus zu ermöglichen und hiermit auch eine Grundlage<br />
da<strong>für</strong> zu schaffen, strukturelle und institutionelle Veränderungen mit zu<br />
initiieren und mittragen zu können
Literatur<br />
Arnoldt, Bettina/Züchner, Ivo (2008): Kooperationsbeziehungen an<br />
Ganztagsschulen, in: Thomas Coelen/Hans Uwe Otto (Hrsg.): Grundbegriffe<br />
Ganztagsbildung. Das Handbuch. VS-Verlag, Wiesbaden. 2008, S. 633-644.<br />
Frommherz, Brigitte/Halfhide, Therese (2003): Teamteaching an Unterstufen-<br />
Schulklassen der Stadt Zürich. Universität ZH/Pädagogisches Institut,<br />
Zürich.<br />
Huber, Birgit: Team Teaching. 2000, Peter Lang Frankfurt/Main<br />
Hummel, Claudia (Hrsg.) (2011): Kontext Schule. Institut <strong>für</strong> Kunst im Kontext,<br />
Universität der Künste Berlin.<br />
Mörsch, Carmen (2005): Eine kurze Geschichte von KünstlerInnen in Schulen,<br />
in: Nanna Lüth/Carmen Mörsch (Hrsg.): Kinder machen Kunst mit Me<strong>die</strong>n.<br />
Kopaed, München, (Text auf DVD).<br />
Thimm, Karlheinz (2006): Ganztagsschule gemeinsam gestalten. Deutsche<br />
Kinder- und Jugendstiftung, Berlin.<br />
Thimm, Karlheinz (2008): Personelle Kooperation und Fortbildung, in: Thomas<br />
Coelen/Hans Uwe Otto (Hrsg.): Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das<br />
Handbuch. VS-Verlag, Wiesbaden. 2008, S. 809-818.
Radisch, F. & Klieme, E. (Hrsg.) (2005). Ganztagsangebote in der Schule.<br />
Internationale Erfahrungen und empirische Forschungen. Bonn: BMBF.<br />
Holtappels, H.G., Klieme, E., Rauschenbach. T., Stecher, L. (Hrsg.) (2007):<br />
Ganztagsschule in Deutschland. Ergebnisse der Ausgangserhebung der<br />
"Stu<strong>die</strong> zur Entwicklung von Ganztagsschulen" (StEG). Stu<strong>die</strong>n zur<br />
ganztägigen Bildung, Band 1. Weinheim: Juventa.<br />
Weblinks<br />
Helene Lange Schule: http://helene-lange-schule.templ2.evision.net/<br />
Kersten Reich: Konstruktiver Methodenpool<br />
http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/frameset_uebersicht.htm