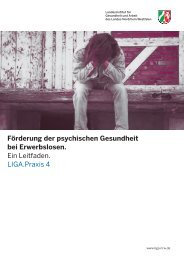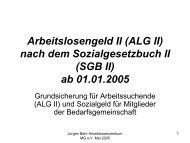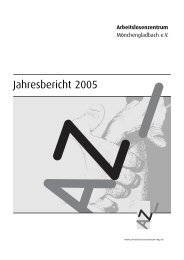Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach eV
Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach eV
Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Psychosoziale Betreuung<br />
Konzept<br />
<strong>Arbeitslosenzentrum</strong><br />
<strong>Mönchengladbach</strong> e.V.<br />
www.arbeitslosenzentrum-mg.de
Psychosoziale Betreuung für Arbeitslose<br />
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Sozialgesetzbuch II (SGB II )<br />
<strong>Arbeitslosenzentrum</strong><br />
<strong>Mönchengladbach</strong> e. V.<br />
Der Gesetzgeber hat die Kommunen als Träger der Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3<br />
Sozialgesetzbuch II (SGB II) bestimmt. Die Leistungserbringung erfolgt zum Teil durch die<br />
Kommunen selbst, zum Teil durch beauftragte Dritte. Durch eine bedarfsgerechte, passgenaue<br />
und zielorientierte Gewährung stellen die Kommunen ihre Leistungsfähigkeit, Vielfalt und<br />
Innovationskraft unter Beweis. Gleichzeitig leisten sie damit einen unverzichtbaren Beitrag zur<br />
Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende<br />
Die Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 – 4 SGB II – die Kinderbetreuung bzw. die Pflege<br />
von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung<br />
– sollen bei Bedarf den Prozess der Wiedereingliederung in Arbeit unterstützen und flankieren.<br />
Bereits vor der Einführung des SGB II wurden diese Leistungen nach Maßgabe des<br />
BSHG, des SGB III, der Arbeitslosenhilfe, des SGB I, SGB X und des SGB XII in <strong>Mönchengladbach</strong><br />
unter Beteiligung des <strong>Arbeitslosenzentrum</strong>s <strong>Mönchengladbach</strong> e.V. umgesetzt.<br />
Der Gesetzgeber definiert mit der Verabschiedung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) die<br />
sozialen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II als originär kommunale<br />
Leistungen und damit als ein wichtiges Handlungsfeld für die kommunale Aufgabenwahrnehmung<br />
nach dem SGB II. Hierzu zählt die psychosoziale Betreuung nach § 16 Abs. 2<br />
Satz 2 Nr. 3 SGB II.<br />
Die Angebote der psychosozialen Betreuung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB II sind unterschiedlich<br />
und sind nach Bedarf vor Ort zu entwickeln und festzulegen.<br />
Der Begriff der psychosozialen Betreuung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB II ist bisher in<br />
der Fachdiskussion nicht konkret gefasst. Generell dient die psychosoziale Betreuung dem<br />
Abbau von psychosozialen Problemlagen, der Reduzierung von psychosozialen Belastungen,<br />
die aus der Arbeitslosigkeit resultieren und der Bearbeitung von psycho-sozialen Problemlagen,<br />
die eine Vermittlung in Arbeit behindern und nicht auf einem diagnostizierten Krankheitsbild<br />
beruhen. Die Grenzen zum psychiatrischen und medizinischen Bereich auf der einen Seite<br />
und zur sozialpädagogischen und sozialen Seite auf der anderen Seite sind fließend. Gleiches<br />
gilt zu den übrigen sozialen Leistungen nach dem SGB I, SGB II, SGB III, SGB VI, SGB<br />
VIII, SGB IX, SGB X, SGB XI; SGB XII.<br />
Die Ergebnisse der modernen Arbeitslosenforschung bilden den Hintergrund, die den Gesetzgeber<br />
veranlasst haben, die psychosoziale Betreuung in § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB II als<br />
zu erbringende Leistung zu definieren.<br />
Psychosoziale Folgen der Arbeitslosigkeit<br />
Bereits die klassische Arbeitslosen-Studie von Marie Jahoda und Paul Lazarsfeld in den 30er<br />
Jahren des vergangenen Jahrhunderts zeigt auf, dass Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit<br />
• Zeitstruktur<br />
• Tägliche Erfahrung von Aufgaben und Kooperation
• Erweiterung des sozialen Gesichtskreises über die Familie hinaus<br />
• Status und Identität<br />
• Zwang zur Aktivität<br />
verlieren.<br />
Die Ergebnisse der moderne Arbeitslosenforschung zeigen klar, dass die psychosozialen Folgen<br />
von Arbeitslosigkeit weit tiefer gehen, als „nur“ in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu kommen<br />
und Hilfe bei der Arbeitssuche zu benötigen (vgl. Wacker, Kieselbach, Heinemeier u.a.).<br />
An Hand der drei bzw. fünf Phasen in der Bewältigung von Arbeitslosigkeit nach Heinemeier<br />
wird dies deutlich. Nach einer „Frühphase“, die durch allg. Verunsicherung, Entlastungs- und<br />
Lähmungsmomente, Kompensation durch andere Tätigkeiten geprägt ist, folgt die Phase des<br />
„Ernst-Werdens der Arbeitslosigkeit“. Diese kann wiederum in drei Unterphasen klassifiziert<br />
werden. Die erste Phase lässt sich als „Zermürben der biografischen Orientierungen“ beschreiben.<br />
Dies geschieht insbesondere durch die Erfahrung, im Kontrast zu gesellschaftlichen<br />
Normen leben zu müssen, durch Erfahrungen mit der Arbeitsverwaltung und durch<br />
scheiternde Bewerbungen. Dieser Phase folgt der „Zusammenbruch der biografischen Perspektive<br />
mit dem Eintritt der Krise“. Diese Phase wird ausgelöst und verstärkt durch negative<br />
Erlebnisse mit Behörden, dadurch, dass sich bisherige Bewältigungsstrategien als Sackgasse<br />
erweisen, durch die Zunahme an Konflikten und dem immer deutlicher werdenden Verlust von<br />
Routinen. Die dritte typisierbare Phase kann als „Umorientierung der Lebensplanung und<br />
Handlungen“ beschrieben werden. Diese nimmt sehr unterschiedliche Verläufe. Der Verlauf<br />
hängt stark von individuellen Handlungsspielräumen und Entscheidungen ab. Letztlich folgt<br />
die Phase der „Verfestigung in der Arbeitslosigkeit“, die nicht selten mit dem Verzicht auf eine<br />
weitere Erwerbsperspektive verbunden ist oder einen Entwurf eines berufsbiografischen Neubeginns<br />
mit neuer Perspektive umfassen kann.<br />
Die in der modernen Arbeitslosenforschung festgestellten Bewältigungsmuster wie 1. Hoffnungslosigkeit<br />
und Leere und 2. Arrangieren und Wege in Nischen suchen, treten insbesondere<br />
dann auf, wenn schnelle Abhilfe nicht in Sicht ist oder nicht im Sinne der Betroffenen gegeben<br />
wird. Menschen, die Einrichtungen der Arbeitslosenarbeit aufsuchen, haben häufig Arbeitslosigkeitsverläufe<br />
hinter sich, die mit vielen Versagenserlebnissen, nicht wirksamen Hilfen<br />
und Erfahrungen von Drucksituationen in der Arbeitsagentur oder bei der ARGE verbunden<br />
sind, aber zugleich keine eigenen wirksamen Handlungsoptionen eröffnet haben.<br />
Die Folgen sind entsprechend:<br />
• Existenzsicherungsprobleme mit Verlust bisher gewohnter wirtschaftlicher Standards<br />
zumeist nach einem Jahr,<br />
• Veränderung der Zeitstrukturen hinsichtlich Alltagszeit und Zeitverläufen im biografischen<br />
Prozess,<br />
• Verlust sozialer Bindungen in der Freizeit auch wegen eingeschränkter finanzieller<br />
Möglichkeiten und der Verlagerung auf familiäre Bindungen mit entsprechenden Belastungen<br />
sowie gesellschaftlichen Folgewirkung wie dem allmählichen Verlust der Fähigkeit,<br />
gesellschaftlich zu kommunizieren,<br />
• Stigmatisierung, z.B. durch die Anklage von Arbeitslosen als Faulenzer und die öffentliche,<br />
immer wieder aufkeimende Missbrauchsdebatte sowie der Diskussion um vermeintlich<br />
zu hohe Sozialleistungen,<br />
• Verpuffen von Interventionen, weil die Hilfen gerade zu Beginn, bei neu einsetzender<br />
Arbeitslosigkeit zu gering ausfallen, später aber, wenn das Aktivitätsniveau schon abgeflaut<br />
ist, die Forderung von hoher Eigenaktivität gestellt wird,<br />
• Enttäuschung und Resignation, weil Hilfen oft unangemessen, zu spät, nicht passend<br />
sind und Widersprüche zwischen institutionellen Anforderungen an arbeitslose Men-<br />
2
schen und die individuellen Erwartungen der Betroffenen bestehen. (Mehlich, 2005, S.<br />
117 ff.).<br />
Psychosoziale Probleme entstehen oft durch persönliche Lebenskrisen. Indikatoren für solche<br />
Problemlagen sind z. B. Probleme bei der Alltagsbewältigung, Verarmung, Erkrankung, Wohnungslosigkeit,<br />
Verschuldung, Sucht und soziale Isolation. Für den Erfolg der Wiedereingliederung<br />
von (Langzeit-)Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt sind die sozialen Leistungen von hoher<br />
Bedeutung. In vielen Fällen können berufliche Eingliederungsmaßnahmen und Vermittlungsbemühungen<br />
überhaupt erst durch die Bearbeitung von bestehenden persönlichen Problemlagen<br />
bzw. nach einer wirtschaftlichen Stabilisierung greifen und wirksam werden.<br />
Auf Grund der Zunahme der individuellen und der sozialen Hilfebedürftigkeit sollten Angebote<br />
der Psychosozialen Betreuung für Arbeitslose auf der Grundlage des § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3<br />
Sozialgesetzbuch II (SGB II ) sich zum einen auf den Einsatz von Angeboten, wie z.B.<br />
• Sozialberatung,<br />
• Krisenintervention/Vermeidung erneuter Krisen,<br />
• Clearingfunktion/vermittelnde Hilfs- und Beratungsleistungen,<br />
die methodisch der Einzelfallhilfe zugerechnet werden, bedienen. Zum anderen sollte die psychosozialen<br />
Betreuung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB II<br />
sich zur<br />
1. Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen/Motivationsarbeit<br />
2. Vermittlung lebenspraktischer Fähigkeiten,<br />
3. Stärkung sozialer Kompetenzen und Potentiale<br />
4. psychosozialen Betreuung, die der sozialen Isolation durch Integration entgegenwirkt,<br />
auf offene Begegnungsangebote, die zur sozialen Gruppenarbeit gehören, stützen.<br />
Aufgaben einer psychosozialen Beratung<br />
Beratung bietet sich vor allem dort an, wo eine reine Informationsvermittlung zu unverbindlich<br />
bleiben würde, andererseits ein therapeutisches Vorgehen nicht problemangemessen erscheint<br />
oder von der Zielgruppe nicht akzeptiert würde. Psychologische Beratung ist vor allem<br />
durch die Betonung eines präventiven Ansatzes gekennzeichnet. Von Ansätzen, die sich allein<br />
auf das Individuum beziehen, unterscheidet sie sich durch die Berücksichtigung von Umgebungsfaktoren<br />
bei der Problemanalyse und der Entwicklung von Bewältigungsstrategien. Als<br />
weitere Charakteristika sind zu nennen:<br />
• Freiwilligkeit der Inanspruchnahme, als Anlass des Kommens liegt ein konkret umrissenes<br />
Problem vor,<br />
• Beratung ist immer bereichsbezogen beispielsweise: Arbeitslosenberatung,<br />
Erziehungsberatung etc., d.h., das Hinterfragen von Persönlichkeitsstrukturen, wie es<br />
in der Psychotherapie angelegt ist, ist hier nur insofern angezeigt als diese das direkte<br />
Problemumfeld beeinflussen,<br />
• Beratung ist handlungsorientiert ausgerichtet<br />
• und findet in multiprofessionellen, d.h. interdisziplinär arbeitenden<br />
Teams statt<br />
Stabilisierung der persönlichen Situation<br />
Übergeordnetes Ziel ist die Wiedererlangung von Handlungsfähigkeit und die Reintegration<br />
der Ratsuchenden in soziale Bezüge. In der konkreten Beratungssituation geht es zunächst<br />
3
darum, einen Überblick über primäre Problemfelder zu gewinnen, die bei der Bewältigung von<br />
Arbeitslosigkeit zentral sind:<br />
• materielle Probleme: Finanzielle Schwierigkeiten, Verschuldung, Wohnungsprobleme;<br />
• arbeitsbezogene Probleme. Ärger mit Ämtern, fehlendes Zutrauen<br />
in die eigene Arbeits- und Leistungsfähigkeit;<br />
• gesundheitliche Probleme: gesundheitliche Einschränkungen, Rehabilitation;<br />
• psychische Probleme: Zeitverwendung, Selbstwertkrisen, Angst vor neuen Situationen;<br />
• soziale Probleme: Isolation, Erziehungsschwierigkeiten, Partnerprobleme.<br />
Der Überblick über die Problemfelder und das Erarbeiten einer Rangfolge sollte, je nach Problemlage,<br />
ein bis zwei Beratungskontakte in Anspruch nehmen. Diese Reihenfolge ergibt sich<br />
aus der Dringlichkeit der Bearbeitung bzw. der Lösbarkeit der Probleme. Beispiele für Strategien<br />
zur Lösung von Identitätsproblemen sind z.B.:<br />
• Die Erarbeitung eines angemessenen Stellenwertes von Arbeit, d.h. die Aufrechterhaltung<br />
einer Arbeitsmotivation, die sich auch auf andere Tätigkeitsfelder außerhalb von<br />
Erwerbsarbeit (ehrenamtliche Aktivitäten, Freiwilligenarbeit etc.) beziehen kann.<br />
• Die Auflockerung festgelegter familiäre Rollen, wie die des alleinigen "Familienernährers",<br />
die sich in der Arbeitslosigkeit als besonders belastend erweisen kann.<br />
• Darüber hinaus können Erziehungsfragen oder Veränderungen des Verhaltens der<br />
Kinder durch die Arbeitslosigkeit eines Elternteils behandelt oder allgemeine Probleme<br />
in der Arbeitslosigkeit herausgearbeitet werden, die sich nicht vorrangig auf individuelles<br />
Versagen zurückführen lassen.<br />
• bei Schwierigkeiten mit der Zeitverwendung (Langeweile): Erarbeiten von Möglichkeiten<br />
der Zeitgestaltung, Aktivierung von Hobbys etc.<br />
Der Aufbau sozialer und handlungsorientierter Kompetenzen, die eine Bewältigung der Arbeitslosigkeit<br />
ermöglichen, kann soweit nicht allein durch die Einzelberatung zu bewältigen,<br />
durch die Einbeziehung von Gruppenangeboten unterstützt werden. Bei solchen Angeboten<br />
kommt den anderen Teilnehmern dieser Gruppen eine wichtige Funktion der sozialen Unterstützung<br />
zu. Ziel ist hierbei der Aufbau von SelbsthilfepotentiaIen, die eine Fixierung der Arbeitslosen<br />
auf den professionellen Helfer verhindern.<br />
Akute Krisenintervention<br />
Bei akuten Krisen in denen Ratsuchende stehen wie z.B.<br />
• einer zugespitzten Familiensituation,<br />
• bei Alkoholmissbrauch,<br />
• oder bei Suizidgefahr<br />
sollte die psychosoziale Beratung so aufgebaut sein, dass sie in der Lage ist, eine akute Krisensituation<br />
zu entschärfen und die Betroffenen durch weitere Gespräche bzw. durch die Einbindung<br />
in die Gruppenarbeit zu stabilisieren. Je nach Lage kann allerdings auch die Intervention<br />
in einer Überweisung an den Sozialpsychiatrischen Dienst, eine Klinik oder Alkoholtherapieeinrichtung<br />
bestehen. Aufgrund einer solchen frühzeitigen Intervention kann verhindert<br />
werden, dass Arbeitslose in akuten Krisensituationen institutionellen Interventionen ausgesetzt<br />
werden (Gefahr der Psychiatrisierung). Wichtig in diesen Zusammenhängen ist hierbei, dass<br />
die Beratung auch für die Angehörigen der ratsuchenden Arbeitslosen erreichbar ist.<br />
Weitervermittlung und Kooperation<br />
Da die Beratungsstelle keine therapeutische, d.h. längerfristige und intensivere Arbeit z.B. bei<br />
Ehe- oder Erziehungsproblemen leisten kann, sind Ratsuchende mit solchen Problemen an<br />
4
die entsprechenden Beratungsstellen weiterzuverweisen, auch wenn deutlich wird, dass die<br />
Probleme erst durch Arbeitslosigkeit hervorgerufen, aktualisiert oder verstärkt worden sind.<br />
Die Aufgabe der Weitervermittlung bezieht sich auf alle Beratungsbereiche, für die es Stellen<br />
gibt, die kompetenter sind bzw. für die Bearbeitung bestimmter Probleme über mehr Zeit und<br />
Ressourcen verfügen. So ist klar, dass ein wegen seiner finanziellen Lage verzweifelter Ratsuchender<br />
an eine Schuldnerberatung verwiesen werden muss.<br />
Entscheidend für diesen Bereich ist das Vorhandensein langfristiger Kooperationsstrukturen,<br />
z.B. mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes sowie Einrichtungen der<br />
psychosozialen Versorgung und kirchlichen Stellen.<br />
Präventive Arbeit: Offene Angebote und Wochenseminare<br />
Die der Beratungsstelle angegliederten Angebote sollten thematisch folgende Inhalte umfassen:<br />
• Bewerbungstraining zur besseren Bewältigung und Kontrolle von Stresssituationen bezogen<br />
auf den Umgang mit potentiellen Arbeitgebern,<br />
• Gruppenangebote, die sich an einer spezifischen Problematik wie z.B. Spielsucht orientieren.<br />
Das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> bietet der Selbsthilfe dafür eine<br />
entsprechende Plattform.<br />
Daneben können Seminare mit Arbeitslosen-Familien, wie sie beispielsweise von der Katholischen<br />
Arbeitnehmerbildungsstätte in Herzogenrath und Ev. Landeskirche im Rheinland und<br />
Westfalen für Familien oder vom DGB für Einzelpersonen seit 1984 durchgeführt wurden, ein<br />
wichtiges Angebot psychosozialer Prävention sein. Die Seminare bieten Gesprächskreise für<br />
Arbeitslose und Partner mit dem Ziel der Entindividualisierung familiärer Konflikte und dem<br />
Herausarbeiten der Mechanismen, durch die Arbeitslosigkeit auf die Privatsphäre der Betroffenen<br />
einwirkt,<br />
Die Seminare haben gezeigt, dass auch eine Kombination von psychosozialer Arbeit, Rechtsberatung<br />
und dem Aufzeigen politischer Handlungsmöglichkeiten den Bedürfnissen Arbeitsloser<br />
entspricht.<br />
Unterstützung von Rechts- und Bildungsberatung<br />
Eine Unterstützung der Sozialberatung durch psychosoziale Anteile ist besonders da nötig, wo<br />
subjektive Gründe die Ratsuchenden an der Inanspruchnahme ihrer Rechte hindern. Hiermit<br />
ist besonders das Gefühl gemeint, durch die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen zum<br />
Almosenempfänger zu werden und die damit einhergehende Bedrohung des Selbstwertgefühls.<br />
Eine psychosoziale Intervention kann auch dazu beitragen, überzogene, unrealistische<br />
Erwartungen an Hilfe und Unterstützung zu hinterfragen und auf ein angemessenes Niveau zu<br />
reduzieren.<br />
Auch für den Weiterbildungsbereich gilt, dass sowohl übertrieben pessimistische Einschätzungen<br />
wie unrealistisch hohe Ansprüche an Bildungs- und Berufschancen schädlich für arbeitslose<br />
Ratsuchende sind. Wo die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Realität nicht<br />
auszuräumen ist, sollte ein psychosozialer Berater hinzugezogen werden<br />
Psychosoziale Betreuung in der Praxis des <strong>Arbeitslosenzentrum</strong>s <strong>Mönchengladbach</strong><br />
Seit ihren Anfängen in den 70er Jahren basieren die psychosozialen Angebote für (Langzeit-)<br />
Arbeitslose, die im Kontext der in den Arbeitslosenzentren geleisteten Arbeitslosenarbeit entwickelt<br />
wurden, auf den miteinander vernetzten Projektbereichen: Beratung, Begegnung und<br />
Betreuung.<br />
5
Unbeschadet der mit dem SGB II erfolgten neuen Ausrichtung dieser Leistungen auf die Eingliederung<br />
in das Erwerbsleben kann die Stadt <strong>Mönchengladbach</strong> auf jahrelang eingespielte,<br />
funktionierende Strukturen und Netzwerke mit den Leistungserbringern zurückgreifen. Zu diesen<br />
Leistungserbringern gehört seit Jahrzehnten das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong><br />
e.V. Daneben existieren für besondere Zielgruppen wie Strafentlassene, Migranten mit Integrationsproblemen,<br />
Frauen in Frauenhäusern, psychisch oder körperlich Kranke, schwer vermittelbare<br />
Jugendliche und junge Erwachsene, Suchtkranke, Personen mit besonderen sozialen<br />
Schwierigkeiten, spezielle Angebote und Einrichtungen der psychosozialen Betreuung.<br />
In Trägerschaft des <strong>Arbeitslosenzentrum</strong>s <strong>Mönchengladbach</strong> e.V. vereinigen sich die Projektbereiche<br />
<strong>Arbeitslosenzentrum</strong> (Begegnung) und Beratungsstelle für Arbeitslose (Beratung) zu<br />
einem niederschwelligen Angebot Psychosozialer Betreuung für Arbeitslose<br />
Die sozialen Angebote des <strong>Arbeitslosenzentrum</strong>s <strong>Mönchengladbach</strong> e.V. unter dem Dach des<br />
Hauses Lüpertzender Str. 69 basieren konzeptionell auf den drei Angeboten Beratung, Begegnung<br />
und psychosoziale Betreuung und bilden seit Jahren erfolgreich eine konzeptionelle<br />
Einheit. Ratsuchende finden im <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> e.V. in einem niederschwelligen,<br />
auf Freiwilligkeit und Vertraulichkeit basierenden Angebot bei allen materiellen<br />
und psychosozialen Problemen und Fragen rund um das Thema Arbeitslosigkeit kompetenten<br />
Rat. Daneben bietet die Einrichtung Unterstützung bei der beruflichen Orientierung, der Stellensuche<br />
und bei Bewerbungsbemühungen. Das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> trägt<br />
mit seinem breit gefächerten Leistungsangebot im Zusammenwirken mit der lokalen sozialen<br />
Infrastruktur <strong>Mönchengladbach</strong>s zur Minderung von Armutsrisiken, psychosozialen Belastungen<br />
zur Vermeidung sozialer Ausgrenzung und zum sozialen Frieden bei.<br />
Neben der Beratung bietet das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> (Langzeit-) Arbeitslosen<br />
zur psychosozialen Unterstützung ein Begegnungsangebot an, das dem Erhalt bzw. Wiederaufbau<br />
der Beschäftigungsfähigkeit und der Stärkung der Gesundheitskompetenz der Zielgruppe<br />
dient. Mittlerweile werden in diesem Projektbereich über 11.000 Besuchskontakte jährlich<br />
erfasst. Der Ansatz zielt unter dem Stichwort „Beschäftigungsfähigkeit“ neben der Prävention<br />
auf die Vermeidung und Reduzierung der vielfältigen psychosozialen Folgewirkungen von<br />
Arbeitslosigkeit.<br />
Entscheidend für den Erfolg der im <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> niedrigschwellig angelegten Angebote,<br />
die psychosoziale Betreuung, Begegnung und Beratung miteinander kombinieren, ist, dass<br />
sie sich an alle Personen wenden, die hinsichtlich materieller Notlagen, drohender oder bereits<br />
eingetretener Erwerbslosigkeit oder auch bei Unterstützungsbedarfen im sozialen Umfeld<br />
Hilfe benötigen.<br />
Das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> leistet damit nicht nur eine integrationsorientierte Arbeit in Bezug auf<br />
den Arbeitsmarkt, sondern auch und besonders in soziale Bezugssysteme abseits des Arbeitsmarktes,<br />
der einem großen Teil der (Langzeit-) Arbeitslosen in <strong>Mönchengladbach</strong> aus<br />
den verschiedensten Gründen aber auch aufgrund besonderer Lebenslagen langfristig nicht<br />
zugänglich ist. Damit betreut der Projektbereich <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> viele seiner Besucherinnen<br />
und Besucher psychosozial, in dem er wichtige Beiträge zur Inklusion dadurch leistet,<br />
dass sich unter seinem Dach Menschen treffen, die unterschiedliche Erfahrungen mit der Erwerbslosigkeit<br />
gemacht haben. Hierbei handelt es sich um Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz<br />
2 Nr. 3 Sozialgesetzbuch II (SGB II).<br />
Das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> ist stadtweit eine wichtige und zentrale Anlaufstelle<br />
für:<br />
• Langzeitarbeitslose Menschen<br />
• Menschen ohne Leistungen aus dem SGB III oder SGB II-Kreis, die aber dennoch in<br />
Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug stehen,<br />
• Menschen in Situationen der Unterbeschäftigung oder prekären Beschäftigung<br />
6
• Menschen, die zwar in Arbeit sind, jedoch aus anderen Gründen der Hilfe bedürfen<br />
(Unterbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit, Niedriglohnbeschäftigung<br />
u.v.m., die die Existenz nicht sichern).<br />
• Menschen, die mit den Unterstützungssystemen im SGB III und SGB II Schwierigkeiten<br />
haben, rechtlichen Rat benötigen und sich dort unter ungerechtfertigtem Druck fühlen.<br />
• Menschen mit psychosozialen Schwierigkeiten<br />
Neben Langzeitarbeitslosen sind folgende Zielgruppen im <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> anzutreffen:<br />
• Alleinstehende Erwerbslose beider Geschlechter<br />
• Ältere Erwerbslose über 45 Jahre beider Geschlechter<br />
• BerufsrückkehrerInnen<br />
• Jugendliche ohne und nach der Ausbildung ohne Arbeitsplatz<br />
• Menschen aus der Stillen Reserve Minijobber<br />
• MigrantInnen<br />
• Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen<br />
• von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen<br />
Im Sinne einer inklusionsorientierten Ausrichtung ist das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> damit z.T. aber<br />
auch Anlaufstelle für Beschäftigte und damit wichtiger Bestandteil für die Aufhebung der Trennung<br />
zwischen Arbeitenden und Arbeitslosen. Zum anderen steht die Einrichtung auch Menschen,<br />
die Leistungen z.B. nach dem Sozialgesetzbuch XII oder Renten erhalten, offen. Durch<br />
die Möglichkeit, Beratung, Begegnung und psychosoziale Betreuung gemeinsam nutzen zu<br />
können, ergibt sich für die genannten Zielgruppen die Möglichkeit, Ausgrenzung zu reduzieren.<br />
Das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> erfüllt als Einrichtung die wesentlichen Anforderungen<br />
an ein niedrigschwelliges, ganzheitliches Angebot:<br />
• es ist räumlich leicht erreichbar,<br />
• Ratsuchende unterliegen keinen langen Wartezeiten,<br />
• der Zugang beruht auf Freiwilligkeit und Vertraulichkeit,<br />
• es unterliegt nicht der Prüfung formaler Leistungsansprüche,<br />
• die Beratungstätigkeit steht nicht im Zusammenhang mit Sanktionsmöglichkeiten,<br />
• für die Beratung steht den Ratsuchenden ausreichend Zeit zur Verfügung,<br />
• Beratung, Begegnung und psychosoziale Betreuung sind konzeptionell integriert,<br />
• es ist offen für alle anstehenden Problemstellungen, offen für alle Ratsuchenden im<br />
Umfeld von Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung,<br />
• es baut Brücken zu anderen Beratungs- und Hilfsangeboten in der Umgebung,<br />
• es ist innerhalb der Stadt und Region bekannt und vernetzt,<br />
• Mitarbeitende werden kontinuierlich durch Fort- und Weiterbildung qualifiziert,<br />
• es bietet Ratsuchenden Hilfe zur Selbsthilfe.<br />
Das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> ist zu den folgenden Zeiten geöffnet:<br />
Montag und Dienstag: 10:00 – 17:00 Uhr<br />
Mittwoch und Freitag 10:00 – 14:00 Uhr<br />
Donnerstag 10:00 – 18:00 Uhr<br />
Die wöchentliche Gesamtöffnungszeit beträgt 30 Stunden.<br />
Das <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> gehört als niederschwelliges, eingeführtes und<br />
von den Zielgruppen akzeptiertes Angebot zu den wichtigen Anlaufstellen, um Bewältigungs-<br />
7
essourcen wieder zu aktivieren und den Menschen Rückenstärkung zu geben, um mit den<br />
Anforderungen der ARGE, der Arbeitsagentur und dem sozialen Umfeld (wieder) zurecht zukommen<br />
.<br />
Dabei kommt einer nicht zweckrationalen Beratung und Betreuung eine wichtige Funktion zu.<br />
Im Sinne des von Antonovsky formulierten Konzeptes der Salutogenese ist es notwendig für<br />
Menschen, Kontrollkompetenz in Bezug auf die Gestaltung ihrer Lebensumstände zu haben.<br />
Die Bewältigung von Krisensituationen funktioniert um so besser, je stärker der Mensch sein<br />
Leben selber kontrollieren kann, sich selber als wirksam dabei erfährt und in der biografischen<br />
Perspektive auch die Erfolge seines Handelns erkennen kann. Bei Menschen in Situationen<br />
von Armut und Langzeitarbeitslosigkeit ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung häufig stark<br />
beeinträchtigt, da sie sich immer wieder in Situationen wieder finden, in denen sie nicht selber<br />
gestaltend handeln können. Arbeitslosigkeit bringt hinsichtlich der Aspekte des Kohärenzsinnes<br />
(dazu gehören Verstehbarkeit des Lebens, Handhabbarkeit von Lebensanforderungen<br />
und Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit von Leben) unterschiedliche Beeinträchtigungen mit<br />
sich. Dazu gehören die Erfahrung der Inkonsistenz, der Unter- und Überforderung, der fehlenden<br />
Teilhabe an Entscheidungsprozessen, verbunden mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins.<br />
Schwere physische und psychische Gesundheitsstörungen sind die Folge.<br />
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse kann eine stärkende und somit auch integrierende/<br />
inkludierende Konzeption der psychosozialen Betreuung, die Beratung und Begegnung einschließt,<br />
Selbstwirksamkeitserfahrung erreichen und Beschäftigungsfähigkeit erhalten.<br />
Die Reduktion der Stressoren aus und in der Arbeitslosigkeit kann durch kognitive und emotionale<br />
Aspekte sozialer Unterstützung erreicht werden. Dazu sind Angebote der Information<br />
mit dem Ziel der Reduzierung von Mehrdeutigkeiten und Unklarheiten einerseits notwendig,<br />
andererseits aber auch Angebote der reflektierten Unterstützung bei Selbstbewertungsprozessen.<br />
Für diese Prozesse ist die Rückkopplung mit der Wahrnehmung anderer in vergleichbarer<br />
Situation als hilfreich anzusehen. Dies gilt insbesondere für solche (Langzeit-) arbeitslosen,<br />
die mit einem rein auf Beratung basierten Konzept der Ansprache nicht erreicht werden.<br />
Darüber hinaus entbehren Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit häufig Umgebungen, die Vertrautheit<br />
und Geborgenheit anbieten. Insofern wird dies in öffentlich zugänglichen Räumen<br />
benötigt.<br />
Kuhnert zeigt den Bedarf wie folgt auf:<br />
1. „Informative Beratung und Anleitung zum sozialen Umfeld, Problemen und Umgang<br />
mit diesem.<br />
2. Unterstützung und Rückmeldung zu den Bewältigungsversuchen, mit Hilfe derer Identität<br />
bewahrt bzw. wiederhergestellt wird und langfristig Kompetenzen verbessert werden.<br />
3. Bindung (attachment), die auf emotional befriedigender Kommunikation mit Personen<br />
beruht, zu denen eine Vertrauensbeziehung besteht.“ (Kuhnert, 1999, S. 71)<br />
Langzeitstudien zeigen, dass Negativsymptome (Krankheit, Ängstlichkeit, Depressivität) abnehmen,<br />
wenn soziale Unterstützung gegeben ist. Dies kann durch private Unterstützungsnetzwerke<br />
oder durch niedrigschwellige öffentliche Angebote erfolgen. Da die privaten Netze<br />
nach lang anhaltender Arbeitslosigkeit oft versagen, ist dies eine gesellschaftliche Aufgabe,<br />
die gelöst werden muss, wenn die gesellschaftlichen Langfristfolgen minimiert werden sollen.<br />
Die Arbeitslosenzentren setzen genau hier an und helfen, auch private Netze wieder zu stärken<br />
und zu aktivieren.<br />
Alle Ausführungen und Erkenntnisse sowohl der Arbeitslosenforschung als auch der psychologischen<br />
Gesundheitsforschung zusammengefasst zeigen die Notwendigkeit von Angeboten:<br />
8
• der Beratung (unabhängig von Sanktionsmechanismen),<br />
• der Sozialen Arbeit im breiten Sinne einer Stärkung der Selbstwirksamkeit der Betroffenen<br />
(Gesundheitsförderung, Linderung von Armutsfolgen, soziale Kontaktgestaltung,<br />
Bildung auf einfachem Niveau) durch Begegnung,<br />
• der Zeitstrukturierung,<br />
• der Stärkung von Selbsthilfepotentialen,<br />
• der sozialräumlichen Orientierung,<br />
• ohne Einschränkung durch sozialrechtliche Zugangsbarrieren,<br />
• mit ergebnisoffenen Prozessen,<br />
• in enger Vernetzung mit Fachberatungs- und Qualifizierungsangeboten sowie ARGE<br />
und der Agentur für Arbeit.<br />
Kurz- und zusammengefasst lassen sich diese Aufgaben und Inhalte als Konzeption einer<br />
psychosozialen Betreuung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB II, wie sie in Trägerschaft des<br />
<strong>Arbeitslosenzentrum</strong>s <strong>Mönchengladbach</strong> seit vielen Jahren erfolgreich realisiert wird, beschreiben.<br />
Literatur:<br />
Jahoda, Marie (1983): Wieviel Arbeit braucht der Mensch? Arbeit und Arbeitslosigkeit im 20.<br />
Jahrhundert. Weinheim, Basel<br />
Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul F.; Zeisel, Hans (2007): Die Arbeitslosen von Marienthal.<br />
Frankf./M.<br />
Heinemeier, Siegfried (1991): Zeitstrukturkrisen. Opladen<br />
Mehlich, Michael (2005): Langzeitarbeitslosigkeit. Individuelle Bewältigung im gesellschaftlichen<br />
Kontext. Baden-Baden.<br />
Antonovsky, Aaron (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Dt. erweiterte<br />
Herausgabe von A. Franke. Tübingen.<br />
Kuhnert, Peter (1999): Bewältigungskompetenzen und Beratung von Langzeitarbeitslosen.<br />
Diss. Dortmund<br />
Spindler, Helga (2007): Aufgaben und Inhalte sozialer Beratung in Zeiten nach Hartz. In:1982-<br />
2007. 25 Jahre <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> e.V. Kompetenz, Politik und ein gutes<br />
Herz. Festschrift zum Jubiläum, Juni 2007. <strong>Mönchengladbach</strong><br />
Vomberg, Prof. Dr. Edeltraud Stellungnahme zur Anhörung am 13.2.2008 im Ausschuss für<br />
Arbeit, Gesundheit und Soziales im Landtag Nordrhein-Westfalen zu „Finanzierung und Leistungsangebot<br />
der Arbeitslosenzentren und –beratungsstellen sichern“ Drucksache 14/4866<br />
Dieser Beitrag unterliegt dem Urheberrecht. Vervielfältigungen, Weitergabe oder Veröffentlichung<br />
des Textes in Teilen oder als Ganzes sind nur nach vorheriger Genehmigung und unter<br />
Angabe der Quelle erlaubt, soweit mit dem Verfasser nichts anderes vereinbart ist.<br />
<strong>Mönchengladbach</strong> Juli 2010<br />
© <strong>Arbeitslosenzentrum</strong> <strong>Mönchengladbach</strong> e.V.<br />
Lüpertzender Str. 69<br />
41061 <strong>Mönchengladbach</strong><br />
Tel : 02161 20195<br />
FAX : 02161 179981<br />
Email: info@arbeitslosenzentrum-mg.de<br />
Internet: http://www.arbeitslosenzentrum-mg.de<br />
9