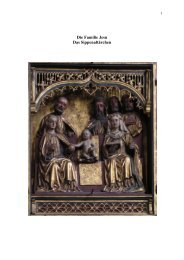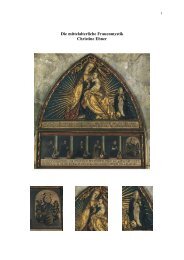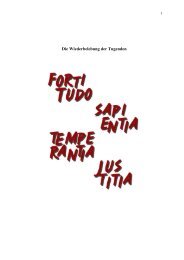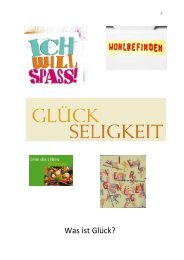Führung Melanchthon - Schmidt-bernd.eu
Führung Melanchthon - Schmidt-bernd.eu
Führung Melanchthon - Schmidt-bernd.eu
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Philipp <strong>Melanchthon</strong> in Nürnberg<br />
Es ist immer wieder interessant und aufschlussreich zu sehen, wie die allgemeine,<br />
geschichtliche Situation das individuelle Leben eines Einzelnen prägt und<br />
wie auch umgekehrt in einigen, wenigen Ausnahmefällen das Leben eines Einzelnen<br />
auf den geschichtlichen Ablauf einwirkt.<br />
Um einen Menschen recht zu verstehen, muss man ihn im Gesamtzusammenhang<br />
sehen. Ein Einzelner ist immer wie ein Schauspieler in einem Theaterstück.<br />
Zum Theaterstück gehören der Gehalt und der Inhalt, die anderen Schauspieler<br />
mit ihren Rollen, der Ort und die Zeit und dergleichen.<br />
Um z.B. Faust zu verstehen, muss man das ganze Stück verstehen. Man stelle<br />
sich vor, man hört auf der Bühne nur den Text von Faust selbst und sonst nichts.<br />
1 Das Umfeld<br />
H<strong>eu</strong>te wird es um <strong>Melanchthon</strong> gehen. Wir wollen seiner Persönlichkeit näher<br />
kommen und erfahren, wer er war. Um ihn richtig verstehen zu können, müssen<br />
wir das Umfeld sehen, in dem er gelebt und gewirkt hat. Das sind die politische<br />
Situation, die kirchliche und religiöse Situation, die gesellschaftliche und soziale<br />
Situation und zuletzt die geistig- kulturelle Situation.<br />
Wenn wir sozusagen die Bühne aufgebaut haben, können wir uns anschließend<br />
<strong>Melanchthon</strong> als einem einzelnen Mitspieler zuwenden.<br />
1.1 Die politische Situation<br />
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, von ungefähr 1500 bis 1550 sind es<br />
einige markante, herausragende Persönlichkeiten, die die politische Situation<br />
bestimmen.<br />
Da ist einmal in England Heinrich VIII. Er trennte sich<br />
von Rom und begründete eine eigene, die anglikanische<br />
Kirche. Er tat das, weil ihm der Papst die Scheidung<br />
von seiner Frau Katharina von Aragon verweigert hatte<br />
und er deswegen seine Geliebte Anne Boleyn nicht heiraten<br />
konnte.<br />
Ab 1538 ließ König Heinrich die englischen Klöster<br />
auflösen und konfiszierte deren Besitztümer. Weiterhin<br />
wurden die Transsubstantiationslehre, das Verbot der<br />
Priesterehe, die Gültigkeit des K<strong>eu</strong>schheitsgelübdes und<br />
die Ohrenbeichte unter Androhung schwerster Strafen<br />
aufgehoben. Katholiken, die an der römischen Kirche<br />
festhielten wurden verfolgt, inhaftiert und hingerichtet.<br />
1
Da ist der französische König Franz I, der sich in lang<br />
dauernden Kämpfen mit dem Kaiser Karl V aus der<br />
habsburgischen Umklammerung zu lösen versuchte. In<br />
diesen Auseinandersetzungen schloss auch der „allerchristlichste“<br />
König eine Allianz mit dem muslimischen<br />
Sultan Suleiman dem Prächtigen nicht aus.<br />
Diese Kriege banden die Kräfte Karls V. und führten dazu,<br />
dass er in der Anfangszeit der Reformation in den<br />
Jahren zwischen 1520 und 1530 nicht in D<strong>eu</strong>tschland<br />
war und die Reformation in dieser Zeit Gelegenheit hatte,<br />
sich ungehindert auszubreiten.<br />
Da ist der Kaiser Karl V, in dessen Reich die Sonne nicht<br />
unterging. Er war von der mittelalterlichen Idee beherrscht,<br />
das heilige, römische Reich d<strong>eu</strong>tscher Nation zu<br />
erhalten. Hierzu gehörte nach seiner Überz<strong>eu</strong>gung eine<br />
einheitliche Religion als Band, das alles zusammenhält<br />
und allem einen Sinn gibt. In diesem Zusammenhang hatte<br />
er einen Zweifrontenkrieg zu führen. Einmal gegen die<br />
Reformation und zum anderen gegen den Papst und die<br />
Kurie, die sich seinem Wunsch nach einem Konzil widersetzten,<br />
einem Konzil, das vielleicht die erforderlichen<br />
Reformen hätte durchsetzen können.<br />
Und dann ist da noch der muslimische Sultan Suleiman<br />
der Prächtige, der Europa zu erobern drohte und bereits<br />
zweimal bis nach Wien vorgedrungen war.<br />
Man kann sich schwer vorstellen, wie Europa und die<br />
Welt aussehen würden, wenn ihm das gelungen wäre.<br />
Das es nicht soweit kam, ist Karl V. zu verdanken. Er<br />
benötigte hierfür allerdings die Hilfe und Unterstützung<br />
der protestantischen Fürsten, denen er als Gegenleistung<br />
in Bezug auf die Religion weit reichende Zugeständnisse<br />
machen musste.<br />
1.2 Die kirchliche und religiöse Situation<br />
Die kirchliche Situation war desaströs. Die Päpste in Rom und die Bischöfe waren<br />
ausschließlich an Prachtentfaltung, an persönlicher, politischer Macht und<br />
an ausschweifendem Luxusleben interessiert. Wichtig war, der eigenen Familie,<br />
insbesondere den eigenen Kindern, auch den unehelichen, weltliche Machtpositionen<br />
zu sichern. Der Klerus war arm, ungebildet und demotiviert, die Klöster<br />
zum größte Teil verlottert und moralisch verkommen.<br />
2
Der prunksüchtige Papst Julius II wollte Rom städtebaulich<br />
umgestalten. Er begann mit dem Bau der<br />
Peterskirche, lies die Sixtinische Kapelle und die<br />
Stanzen ausmalen und gab für sich ein grandioses<br />
Grabmal in Auftrag. Er beauftragte hierzu Bramante,<br />
Michelangelo und Raffael, die bekanntesten und<br />
besten Künstler der Renaissance. Diese Unternehmungen<br />
kosteten Unsummen von Geld, die unter<br />
anderem auch durch Ablasshandel aufgebracht werden<br />
mussten.<br />
Sein unb<strong>eu</strong>gsamer Machtwille und sein grenzenloser<br />
Ehrgeiz trug ihm den Namen Il Terrible, der<br />
Schreckliche ein. Weil er keine Hemmungen hatte,<br />
seine Gegner gnadenlos umbringen zu lassen, nannte<br />
ihn Luther einen Blutsäufer.<br />
Nach Julius II wurde Leo X Papst. Nach seiner<br />
Wahl soll er gesagt haben: „Da Gott uns die Papstwürde<br />
verliehen hat, so lasst sie uns denn genießen.“<br />
Religiösen und theologischen Problemen stand er<br />
hilf- und interesselos gegenüber. Die geistigen Unruhen<br />
um Luther hat er mit der Bemerkung<br />
„Mönchsgezänk“ zur Seite geschoben. Im Jahre<br />
1521 exkommunizierte er Luther mit der Bulle Decet<br />
Romanum Pontificem.<br />
Aufgrund der hohen Schulden, die Leo X. hinterließ,<br />
konnten angeblich nicht einmal die Kerzen für seine<br />
Bestattung bezahlt werden.<br />
Ein typischer Vertreter der Kirche war der Hohenzoller<br />
Albrecht. Bereits mit 23 Jahren erhielt er den<br />
Kardinalshut. 1513 wurde er Bischof von Magdeburg<br />
und Administrator des Bistums Halberstadt,<br />
1515 sogar Erzbischof von Mainz. Abgesehen von<br />
der politischen Macht waren diese Stellen jeweils<br />
mit reichen Pfründen bedacht. Um sie zu erlangen,<br />
musste er 29.000 Gulden an die Kurie in Rom bezahlen.<br />
Um diesen Betrag aufwenden zu können,<br />
nahm er bei den Fuggern aus Augsburg einen Kredit<br />
von 72.000 Gulden auf.<br />
Da die Fugger darauf drängten, dass Albrecht seine<br />
Schulden zügig zurückzahlte, rief Albrecht in<br />
3
D<strong>eu</strong>tschland einen Ablasshandel ins Leben. Er beauftragte unter anderem den<br />
geschäftstüchtigen und marktschreierischen Tetzel mit dieser Aufgabe, der daraus<br />
ein blühendes Geschäft machte. Damit kam der Stein der Reformation ins<br />
Rollen.<br />
Man kann es nur als perfide H<strong>eu</strong>chelei empfinden, wenn sich Albrecht in seiner<br />
prachtvoll roten Robe als demütig Glaubender vor dem gekr<strong>eu</strong>zigten Jesus abbilden<br />
lässt.<br />
1.3 Die gesellschaftliche und soziale Situation<br />
Auch in gesellschaftlicher und sozialer Beziehung war die erste Hälfte des 16.<br />
Jahrhunderts eine Krisen- und Übergangszeit. Die f<strong>eu</strong>dale Ordnung zerbröckelte<br />
langsam. An ihre Stelle trat das frühkapitalistische Wirtschaftssystem, das in den<br />
Handelshäusern der aufblühenden Städte zu Hause war. Die Fugger in Augsburg<br />
und die Tucher oder Imhoff in Nürnberg sind Beispiele.<br />
Eine Folge war der Abstieg und die Verarmung des Ritterstandes. Diese Entwicklung<br />
wurde noch verstärkt durch die n<strong>eu</strong>e Kriegsführung der mit F<strong>eu</strong>erwaffen<br />
versehenen Landsknechte, die die Ritter ohne Aufgabe ließ. Um ihren aufwändigen<br />
Lebensstil weiterhin aufrecht erhalten zu können, versuchten die Ritter<br />
aus den Bauern immer höhere Leistungen zu erpressen, indem sie ihnen zum<br />
Teil alte Rechte entzogen. Folge waren die schrecklichen Baueraufstände, die<br />
von den Fürsten mit Gewalt niedergeschlagen wurden, wobei in mehreren<br />
Kämpfen insgesamt über 70.000 Bauern niedergemetzelt wurden.<br />
1.4 Die geistig-kulturelle Situation<br />
Die Renaissance brachte im Vergleich zum Mittelalter eine ganz n<strong>eu</strong>e Weltsicht,<br />
in deren Rahmen auch die Stellung des Menschen in einem geänderten Licht<br />
erschien. Die Welt gewann einen eigenen Wert; sie war nicht nur Durchgangsstation<br />
auf dem Weg zu einem Jenseits. Man entdeckte und erforschte ihre<br />
Schönheit und ihre Bed<strong>eu</strong>tung.<br />
Auch der Mensch gewinnt an Eigenwert. Sobald es im gelingt, sich aus Irrtum<br />
und Aberglauben zu befreien, kann er sich zum wahren Ideal hinentwickeln.<br />
Sehr schön drückt das Pico della Mirandola (1463-1494) aus. Er lässt Gott zu<br />
Adam sagen:<br />
Ich schuf dich als ein Wesen, weder sterblich noch unsterblich,<br />
allein damit du dein eigener freier Bildner und Gestalter seiest.<br />
Du kannst zum Tier entarten und zum gottähnlichen Wesen dich wiedergebären.<br />
Du allein hast eine Entwicklung, ein Wachsen nach freiem Willen,<br />
du hast Keime eines allartigen Lebens in dir.<br />
Es sind die antiken Autoren, die für dieses Ziel Begleiter und Wegweiser sind.<br />
Die Vertreter der n<strong>eu</strong>en Geistesrichtung des Humanismus übersetzen und studieren<br />
sie eifrig. Zurück zu den Quellen, ad fontes, zurück zu den ursprünglichen<br />
4
Texten ist der Wahlspruch. Auf diese Weise hat jeder selbst Zugang zur unverstellten<br />
Wahrheit.<br />
2 Philipp <strong>Melanchthon</strong><br />
Der Lebenslauf<br />
In dem soeben beschriebenen Umfeld lebt und agiert Philipp <strong>Melanchthon</strong>. Er<br />
begegnet Kaiser Karl V und hat engen Kontakt zu den Reichsfürsten. Er ringt<br />
mit der Kurie und ihren Vertretern. Er nimmt zu den sozialen Umwälzungen,<br />
z.B. den Bauernkriegen Stellung, und er wirkt als Humanist mit am Traum einer<br />
Veredelung des Menschen durch Schulung und Bildung.<br />
Seine ganz besondere Bed<strong>eu</strong>tung liegt in seinem Einsatz für die Reformation als<br />
Weg- und Kampfgefährt Luthers.<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong> wurde am 16. Februar 1497 im kurpfälzischen Bretten<br />
(h<strong>eu</strong>te Baden Württemberg) geboren.<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong> durchläuft zunächst die übliche Ausbildung. Seine hervorragende<br />
Begabung fällt auf und verhilft ihm zu vielseitiger Förderung, insbesondere<br />
durch den Humanisten R<strong>eu</strong>chlin, einen entfernten Verwandten.<br />
1509 Studium in Heidelberg<br />
Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik)<br />
1511 Abschluss Baccalar<strong>eu</strong>s Artium (mit 14 Jahren)<br />
1512 Studium in Tübingen<br />
Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie)<br />
1514 Abschluss Magister Artium (mit 17 Jahren)<br />
Der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise hatte in Wittenberg eine Reformuniversität<br />
ins Leben gerufen, die einen ausgezeichneten Ruf genoss.<br />
1518 Professur für Gräzistik in Wittenberg auf Empfehlung von R<strong>eu</strong>chlin (mit<br />
21 Jahren)<br />
Bekanntschaft mit Luther<br />
Anhänger und Mitstreiter der Reformation<br />
Da wir uns für <strong>Melanchthon</strong> und seine Beziehung zu Nürnberg besonders interessieren,<br />
müssen an dieser Stelle drei Daten besonders hervorgehoben werden.<br />
Wir werden noch ausführlich darauf eingehen:<br />
1525 Aufenthalt in Nürnberg: Diskussion mit Caritas Pirckheimer<br />
1526 Aufenthalt in Nürnberg: Einweihung der Oberen Schule<br />
1555 Aufenthalt in Nürnberg zur Klärung theologischer Streitigkeiten mit Osiander,<br />
dem Prediger in St. Lorenz.<br />
1530 Augsburger Reichstag: Confessio Augustana<br />
Ein wichtiger Markstein in der Reformation insgesamt und im Leben von Philipp<br />
<strong>Melanchthon</strong> war der Augsburger Reichstag 1530. Nach 9jähriger Abwe-<br />
5
senheit kam Kaiser Karl V erstmals wieder nach D<strong>eu</strong>tschland. Er wollte mit Güte<br />
oder Gewalt die Protestanten zum alten Glauben zurückführen.<br />
Die katholische Seite war durch den Theologen Johannes Eck vertreten. Er hatte<br />
die sogenannten Irrlehren Luthers in 404 Sätzen zusammengestellt.<br />
Als Entgegnung hatte Philipp <strong>Melanchthon</strong> eine Bekenntnisschrift erstellt, die<br />
die evangelische Position beschreibt. Sie hat weltgeschichtliche Bed<strong>eu</strong>tung erlangt.<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong> hatte sich hierbei große Zurückhaltung auferlegt.<br />
Ihm lag sehr an einer versöhnlichen Ergebnis. Er war davon überz<strong>eu</strong>gt, nicht<br />
außerhalb der katholischen Kirche zu stehen. Ihm ging es um Reform der bestehenden<br />
Kirche und nicht um Kirchenspaltung und Reformation.<br />
An dieser Stelle wird ein herausragender Charakterzug von Philipp <strong>Melanchthon</strong><br />
d<strong>eu</strong>tlich. Mit außerordentlicher Kompromissbereitschaft war er immer bemüht,<br />
Konflikte zu vermeiden. Mit diese versöhnlichen Haltung stand er ganz im Gegensatz<br />
zu Luther, der sehr viel energischer und kämpferischer war und der das<br />
Vorgehen von Philipp <strong>Melanchthon</strong> in Augsburg als Leisetreterei bezeichnete.<br />
Es ist ein Unglück, dass der Reichstag in Augsburg erfolglos verlief. Die Bekenntnisschrift<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong>s wurde in D<strong>eu</strong>tsch verlesen. Da Karl V<br />
kein D<strong>eu</strong>tsch verstand, schlief er während der Verlesung an. Er hielt die Confessio<br />
für widerlegt und erwartete die Unterwerfung der Protestanten. Diese fühlten<br />
sich jedoch im Recht und gaben nicht nach. Damit war der Versuch, die Glaubensfrage<br />
mit Hilfe des kaiserlichen Schiedsspruchs zu lösen, gescheitert.<br />
Für Philipp <strong>Melanchthon</strong> war das der erste von vielen Misserfolgen, die noch<br />
folgen sollten.<br />
1555 Aufenthalt in Nürnberg zur Klärung theologischer Streitigkeiten mit Osiander,<br />
dem Prediger in St. Lorenz.<br />
1560 Tod in Wittenberg<br />
Nach kurzer, schwerer Krankheit stirbt Philipp <strong>Melanchthon</strong> mit 63 Jahren,<br />
müde, resigniert und den Tod herbeisehnend. Sterbend schrieb er auf einen Zettel:<br />
Du entkommst den Sünden, du wirst befreit von aller Mühsal und von der wütenden<br />
Streitlust der Theologen.<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong> liegt in der Schlosskirche in Wittenberg neben Luther begraben.<br />
3 Philipp <strong>Melanchthon</strong><br />
Der Humanist<br />
<strong>Melanchthon</strong> teilte mit anderen Humanisten die nachfolgenden Grundsätze:<br />
* Eine umfassende Bildung ist die Voraussetzung für ein erfülltes Leben<br />
6
* Das vorurteilsfreie Studium der Literatur ist die Bedingung für eigenständiges<br />
Denken<br />
* Glauben hat Wissen als Grundlage<br />
* Toleranz und undogmatische Gesprächbereitschaft anderen Meinungen gegenüber<br />
werden erstrebt<br />
Das Denkmal für Philipp <strong>Melanchthon</strong>, das Daniel Burgschmiet 1826 geschaffen<br />
hat, charakterisiert in eindrucksvoller Weise diese Denkweise. Anlass war<br />
der 300. Jahrestag de Gründung der Oberen Schule im Jahre 1526 durch Philipp<br />
<strong>Melanchthon</strong>.<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong> wird in der typischen Pose eines Gelehrten mit Barett und<br />
Gelehrtenmantel dargestellt.<br />
Mit seiner rechten Hand stützt er sich auf einen Bücherstapel, Schriften von A-<br />
ristoteles, Plato und Cicero. Darauf steht senkrecht die Lutherbibel mit dem Zi-<br />
tat aus 1. Korinther 13.<br />
Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte<br />
alle Erkenntnis und allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte<br />
der Liebe nicht, so wäre ich nichts.<br />
7
So aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist das größte unter<br />
ihnen.<br />
Sehr schön wird hier zum Ausdruck gebracht, dass sich in der Vorstellung von<br />
<strong>Melanchthon</strong> der religiöse Glaube auf die Erkenntnis der Philosophie stützen<br />
muss, jedoch darüber hinausragt und das Wesentliche darstellt.<br />
Die Tafel auf dem Sockel trägt die folgende Inschrift:<br />
Dem Philipp <strong>Melanchthon</strong> dem Einrichter der freien Künste zwischen den d<strong>eu</strong>tschen<br />
Dem weisesten, humanistischen, beredtesten,<br />
um die fromme Erinnerung zu pflegen<br />
an den Tag vor 300 Jahren<br />
als er das Gymnasium Egidien eingeweiht hat.<br />
Dieses Denkmal ist auf amtliche Anweisung errichtet.<br />
Dank der Nürnberger Bürgerschaft 1826<br />
4 Die Obere Schule in Nürnberg<br />
Als Humanist war Philipp <strong>Melanchthon</strong> der Überz<strong>eu</strong>gung, dass der Mensch die<br />
wahre Menschlichkeit durch Studium und Bildung erreichen könne.<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong> hat sich damit d<strong>eu</strong>tlich von Luther absetzt, für den wahre<br />
Menschlichkeit nur durch die Gnade Gottes erreichbar ist. Für Luther ist es vorrangige<br />
Aufgabe der Bildung und Ausbildung, den Menschen in den Stand zu<br />
setzen, selbständig die Bibel zu lesen.<br />
Die damals übliche Ausbildung war für die Vorstellungen von Philipp <strong>Melanchthon</strong><br />
nicht ausreichend. Sie umfasste im Wesentlichen die 7 Artes liberales, die<br />
sich in das Trivium und das Quadrivium gliedern. Sie wurden in der so genannten<br />
Artistenfakultät gelehrt.<br />
Zum Trivium gehörten:<br />
Grammatik: Lateinische Sprachlehre<br />
Rhetorik: Stillehre<br />
Dialektik bzw. Logik: Schlüsse und Beweise<br />
Zum Quadrivium gehörten:<br />
Arithmetik: Zahlentheorie (Zahlenbegriff, Zahlenarten, Zahlenverhältnisse) und<br />
z. T. auch praktisches Rechnen<br />
Geometrie: <strong>eu</strong>klidische Geometrie, Geografie, Agrimensur<br />
Musik: Musiktheorie und Tonarten u. a. als Grundlage der Kirchenmusik<br />
Astronomie: Lehre von den Sphären, den Himmelskörpern und ihren Bewegungen,<br />
unter Einschluss der Astrologie und der Auswirkungen auf die sublunare<br />
Sphäre und den Menschen<br />
8
Die Artistenfakultät war auf der mittelalterlichen Universität die Vorstufe zu den<br />
drei oberen Fakultäten Theologie, Medizin und Jura.<br />
Der Schöne Brunnen in Nürnberg zeigt sehr schön diese alten Vorstellungen. Er<br />
entstand in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts im Rahmen der N<strong>eu</strong>gestaltung des<br />
Marktes.<br />
Die bildnerische Gestaltung zeigt noch die ganz und gar den weltanschaulichen<br />
Überz<strong>eu</strong>gungen des Mittelalters verhaftete Einstellung, die noch weit von den<br />
Vorstellungen der Humanisten und <strong>Melanchthon</strong>s entfernt ist.<br />
Im unteren Kreis finden sich die 7 Artes liberales in einer Weise, wie sie zur üblichen<br />
Ausbildung der späten Mittelalters gehörten. Jeder Disziplin wurde als<br />
Symbol ihr markantester Vertreter zugeordnet. So kann man als Vertreter der<br />
Astronomie den griechischen Wissenschaftler Ptolemäus und als Vertreter der<br />
Geometrie Euklid sehen.<br />
Nun ist es interessant und aufschlussreich zu sehen, dass sich hinter jedem der<br />
heidnischen Vertreter der Artes liberales je einer der 4 Evangelisten oder je einer<br />
der 4 Kirchenväter befinden.<br />
Sie sind es, die sozusagen die heidnische Wissenschaft überwachen und weiterführen<br />
und das, was bei ihnen nur bruchstückhaft zu sehen ist, zur Vollendung<br />
führen. So sitzt z.B. hinter Pythagoras der Evangelist Matthäus.<br />
Es sind drei große Veränderung der Schule, die <strong>Melanchthon</strong> vorschweben. Er<br />
beschreibt sie in seiner Schrift ,,Einrichtung allgemein bildender Schulen mit<br />
christlicher Unterweisung"<br />
9
* Erweiterung des Curriculums<br />
* Schulordnung<br />
* Verbesserung der Didaktik und der Pädagogik<br />
In diesem Sinne war er während seines ganzen Lebens als Lehrer, als Lehrbuchschreiber<br />
und als Organisator des Schulwesens tätig. Diese Aktivitäten haben<br />
ihm den Ehrentitel Präceptor Germaniae, Schulmeister D<strong>eu</strong>tschlands eingetragen.<br />
Dieser eingeschränkte Fächerkanon wurde von Philipp <strong>Melanchthon</strong> um die Fächer<br />
Geschichte, Moralphilosophie, Poetik, Naturwissenschaft und Geografie<br />
erweitert. Dazu kam noch die griechische Sprache. Sein Ziel war eine Bürgerschule,<br />
die im Wesentlichen Allgemeinbildung vermitteln sollte. Allerdings<br />
wurde auch immer großer Wert auf das eigenständige Studium von Gottes Wort<br />
gelegt, ohne das wahre Bildung nicht möglich schien.<br />
Da durch die Reformation die kirchlich geleiteten Schulen wegfielen, entstand<br />
zunächst ein großes Defizit. Erasmus von Rotterdam fällt 1528 in einem Brief<br />
angesichts der betrüblichen Lage ein hartes Urteil:<br />
Wo der Lutheranismus herrscht, da ist der Untergang der Wissenschaften.<br />
Es musste also ein n<strong>eu</strong>es Schulsystem geschaffen werden, das an die Stelle der<br />
bisherigen Kloster- und Kirchenschulen trat. Es wurde von Philipp <strong>Melanchthon</strong><br />
beispielgebend in den Schulen in Eisenach und Nürnberg erprobt.<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong> schwebte ein dreigliedriges Schulsystem vor.<br />
* Grundschule: Lesen und Schreiben, Einführung in das Lateinische, Glaubensbekenntnis.<br />
* Weiterführende Schule: Als weitere Fächer Dialektik und Rhetorik.<br />
* Obere Schule: Umgangssprache Latein, Griechisch.<br />
In Bezug auf die Pädagogik verfolgte Philipp <strong>Melanchthon</strong> etwas, was man h<strong>eu</strong>te<br />
mit Reformpädagogik bezeichnen würde. An die Stelle des Drills und des<br />
Rohrstocks sollte die Fr<strong>eu</strong>de am Lernen und an der Schule treten. Eigenes Fragen<br />
und eigener Wissensdrang sollten vorrangig sein. Hierzu dienten Philipp<br />
<strong>Melanchthon</strong> Erzählungen aus dem Alltagsleben, Fabeln oder Geschichten aus<br />
der Weltgeschichte, die alle den Unterricht lebendig und abwechslungsreich gestalten<br />
sollten.<br />
Allerdings musste er feststellen, dass sich <strong>Melanchthon</strong>s idealistischen Vorstellungen<br />
in Bezug auf die Schule oft nicht mit der Realität deckten. So bemerkt er:<br />
10
Gibt es einen Esel, der je in der Mühle so viel Übles zu erdulden hätte, wie der<br />
Durchschnitt der Lehrer im Unterricht an Mühe und Beschwerden aushalten<br />
muss?<br />
Die Kinder, verdorben durch häusliche Schwäche, bringen statt Liebe zum Studium<br />
grimmigen Hass, Missachtung der Lehrer und die schlimmsten Gewohnheiten<br />
mit in die Schule. Und mit einem solchen Ungeh<strong>eu</strong>er soll sich der Lehrer<br />
herumplagen…<br />
Der Lehrer trägt etwas vor, da beschleicht den Weichling der Schlaf, während<br />
der Lehrer sich müde spricht. Fragst du daher am nächsten Tag nach dem, was<br />
durchgenommen wurde, so ist es zu einem Ohr rein- und zum anderen hinausgegangen.<br />
Die Arbeit beginnt von vorne… Nie nimmt der Knabe ein Buch zur<br />
Hand, es sei denn, dass der Lehrer ihn nötigt.<br />
Wir Lehrer sind von allen Sterblichen am übelsten dran, denn wir haben die<br />
härteste Arbeit, leben in kümmerlichen Verhältnissen und müssen uns noch mit<br />
Verachtung behandeln lassen, nicht nur von unseren Schülern sondern auch von<br />
ihren Eltern.<br />
Bereits im Jahre 1524 beschloss der Rat der Stadt Nürnberg die Gründung einer<br />
weiterführenden Schule. Sie sollte dem Typ der Oberen Schule, also dem dritten<br />
Abschnitt in <strong>Melanchthon</strong>s Schulordnung entsprechen. Auf diese Weise sollten<br />
die Söhne der Nürnberger Patrizier eine solide Grundausbildung erhalten, bevor<br />
sie auf die Universitäten in anderen Städten wechselten.<br />
<strong>Melanchthon</strong> wurde der gut dotierte Posten eines Schulleiters angeboten. Er<br />
lehnte ab. Allerdings empfahl er seinen Fr<strong>eu</strong>nd Camerarius als Schulleiter.<br />
Die Bezahlung der Lehrer war fürstlich. So erhielt z.B. Camerarius 150 Gulden<br />
im Jahr. Im Vergleich: Ganz ungefähr kann man davon ausgehen, dass der<br />
Kaufkraft entsprechend ein Gulden 7.500 Euro wert war. Das Jahresgehalt betrug<br />
demnach 112.500 Euro. Davon lässt sich wohl leben!<br />
Im Jahre 1526 konnte die Obere Schule unter Anwesenheit von Philipp <strong>Melanchthon</strong><br />
eröffnet werden. In seiner Festrede sagte er:<br />
Die Spartaner sagen, die Mauern einer Stadt müssen aus Eisen nicht aus Stein<br />
sein. Ich aber bin der Meinung, dass eine Stadt nicht so sehr durch Waffen als<br />
vielmehr durch Klugheit, Besonnenheit und Frömmigkeit verteidigt werden sollte.<br />
Leider war der Schule kein Erfolg beschieden. Die Schülerzahl blieb gering. Das<br />
lag wohl einmal an der Tatsache, dass die Schule keinen akademischen Grad<br />
und keinen akademischen Titel vergeben konnte. Zum anderen scheinen die<br />
pragmatisch gesinnten Nürnberger Kaufl<strong>eu</strong>te eine humanistische Bildung als<br />
nicht unbedingt erforderlich angesehen zu haben.<br />
11
So soll der Mathematiklehrer Schöner nur zwei Schüler gehabt haben. Erasmus<br />
von Rotterdam spottete, dass in der Oberen Schule in Nürnberg die Schüler kein<br />
Schulgeld zu bezahlen brauchten. Vielmehr müsse man sie bezahlen, damit sie<br />
kämen.<br />
Im Jahre 1575 wird die Obere Schule in Nürnberg geschlossen und aufs Land<br />
nach Altdorf verlegt.<br />
1633 wurde die Obere Schule wegen organisatorischer und pädagogischer Mängel<br />
wieder zurück nach Nürnberg geholt. 1669 bezog die Schule einen N<strong>eu</strong>bau<br />
auf dem Egidienplatz.<br />
Als die Reichsstadt Nürnberg im Jahre 1808 in das Königreich Bayern integriert<br />
wurde, wurde die Schule verstaatlicht und Georg Friedrich Hegel zum Direktor<br />
ernannt.<br />
1911 erhielt die Schule ein n<strong>eu</strong>es Gebäude in der Sulzbacher Straße.<br />
1925 besuchte das erste Mädchen die Schule.<br />
1933 wurde die Schule in <strong>Melanchthon</strong> Gymnasium umbenannt.<br />
5 Das Nürnberger Religionsgespräch<br />
Die freie Reichsstadt Nürnberg schließt sich relativ früh der Reformation an.<br />
Hierfür gibt es gewichtige Gründe.<br />
Der Nürnberger Rat war vorwiegend humanistisch gesinnt. Er stand damit den<br />
Anliegen der Reformation offen und unterstützend gegenüber. Dazu kam, dass<br />
viele Söhne von Patrizierfamilien in Wittenberg studiert hatten und dort mit dem<br />
Geist der Reformation vertraut worden waren. Nach ihrer Rückkehr nach Nürnberg<br />
wurden sie zu Befürwortern der Reformation.<br />
Die Humanisten trafen sich in einem Kreis von Gleichgesinnten, der so genannten<br />
Sodalitas Staupiziana.<br />
Johann von Staupitz war Generalvikar der d<strong>eu</strong>tschen Augustiner-Eremiten, zu<br />
denen auch Luther gehörte. Er war Professor in Wittenberg. Staupitz selbst war<br />
mehrere Male in Nürnberg, 1512, 1516 und 1517. Seine Predigen hatten ungeh<strong>eu</strong>ren<br />
Zulauf.<br />
Der Sodalitas Staupiziana gehörten z.B. Willibald Pirckheimer, aber auch Albrecht<br />
Dürer an. Man tagte regelmäßig im Augustinerkloster und diskutierte dort<br />
humanistische und theologische Themen, besonders die Barmherzigkeitslehre<br />
des Heiligen Augustin, die von Staupitz vertreten wurde. Auf diese Weise wurde<br />
bereits sehr früh humanistisches und reformatorisches Gedankengut in Nürnberg<br />
lebendig.<br />
Es gab im Nürnberger Rat Persönlichkeiten, die bewusst und intensiv die Reformation<br />
förderten. Hierzu gehörte z.B. der Vorderste Ratschreiber Lazarus<br />
Spengler, von dem bereits 1519 eine Schrift bekannt wurde, in der er die Lehre<br />
Luthers verteidigte.<br />
12
Außerdem war es den Nürnbergern schon lange vor der Reformation in schwierigen<br />
Auseinandersetzungen mit dem Bischof in Bamberg und der Kurie in Rom<br />
gelungen, das Recht zur Besetzung der Pfarrstellen zu erkämpfen. Das hatte zur<br />
Folge, dass nun die Hauptkirchen St. Sebald, St. Lorenz. St. Jakob und St. Egidien<br />
mit Predigern besetzt werden konnten, die alle reformatorisch gesinnt waren.<br />
Besonders aktiv war hier der Prediger in St. Lorenz, Andreas Osiander.<br />
Im Bereich der Klöster war der Prior des Augustinerklosters Wolfgang Volprecht<br />
führend. Bereits 1523 reichte er das Abendmahl in beiderlei Gestalt. 1524<br />
hielt er eine Messe in d<strong>eu</strong>tscher Sprache.<br />
Gleichzeitig gab es jedoch in einigen Kirchen und Klöstern, wie z.B. bei den<br />
Barfüßern, den Karmelitern, Dominikanern und den Klarissen noch Anhänger<br />
des alten römisch-katholischen Glaubens.<br />
Beide Seiten haben sich gegenseitig heftig beschimpft und verunglimpft.<br />
Um diese unglückliche Situation zu beenden und eine gleichartige Gottesdienstordnung<br />
in allen Nürnberger Kirchen sicherzustellen, wurden beide Parteien<br />
1525 zu einem Religionsgespräch eingeladen.<br />
Dieses Religionsgespräch fand im Nürnberger Rathaus statt. Geladen waren<br />
alle Mitglieder des Rates, Vertreter der altgläubigen und der reformatorisch gesinnten<br />
Kirchen und Klöster und zahlreiche angesehene Bürger, sodass etwa 500<br />
Personen anwesend waren. Vor dem Rathaus hatte sich eine große Menschenmenge<br />
versammelt, die durch die geöffneten Fenster zum Teil mithören konnte<br />
und mit Erregung den Ausgang der Verhandlungen erwartete.<br />
Die Atmosphäre war spannungsgeladen und explosiv.<br />
Beide Parteien sollten den Glauben betreffend auf 12 Grundfragen Antwort geben.<br />
Hierzu gehörten z.B. die Priesterehe, die Eucharistie und die Rechtfertigungslehre.<br />
Für die Protestanten sprach der Prediger von St. Lorenz Osiander,<br />
für die Altgläubigen der Franziskaner Michael Fries aus dem Barfüßerkloster.<br />
Der mehr oder weniger vorhersehbare Ausgang führte dazu, dass Nürnberg eine<br />
evangelische Stadt wurde. Es ergaben sich damit unter anderem die folgenden<br />
Konsequenzen:<br />
Klöster wurden geschlossen oder freiwillig an die Stadt übergeben.<br />
Prozessionen und Messen wurden abgeschafft.<br />
Die Anzahl der Feiertage wurde eingeschränkt.<br />
Der Übergang war nicht reibungslos und konfliktfrei.<br />
Altgläubige Prediger, wie z.B. Andreas Stoß, der Sohn des Bildhauers Veit Stoß,<br />
mussten die Stadt verlassen.<br />
Von besonderer Bed<strong>eu</strong>tung waren die Beschlüsse für das Klarissenkloster unter<br />
Leitung der Äbtissin Caritas Pirckheimer. So weigerten sich z.B. die Klarissen,<br />
ihr Kloster freiwillig zu verlassen. Es kam zu Tumulten.<br />
13
6 Philipp <strong>Melanchthon</strong> und Caritas Pirckheimer<br />
Caritas Pirckheimer hieß vor ihrem Eintritt in das Klarissenkloster Barbara.<br />
Sie wurde 1467 als Tochter von Johannes Pirckheimer und seiner Ehefrau Barbara,<br />
geb. Löffelholz geboren. Sie entstammt damit zwei der vornehmsten<br />
Nürnberger Patrizierfamilien. Zur Ausbildung kam sie in die Klosterschule der<br />
Klarissen. Dies war kein ungewöhnlicher Schritt, da die 4 Nürnberger Lateinschulen<br />
nur Jungen aufnahmen. Sehr früh schon zeigte sich ihre außerordentliche<br />
Begabung.<br />
Mit 16 Jahren wurde sie als Novizin in das Klarissenkloster<br />
aufgenommen. Sie erhielt den<br />
Namen Caritas. Im Kloster übernahm sie eine<br />
Reihe von Aufgaben. So unterrichtete sie z.B.<br />
die Klosterschülerinnen, war für die Bibliothek<br />
verantwortlich und war Novizenmeisterin. Im<br />
Jahre 1503 wurde sie zur Äbtissin gewählt.<br />
Die Aufgabe der Äbtissin umfasst einerseits die<br />
Sorge um das geistlichen Leben im Konvent<br />
und andererseits auch die um das leibliche<br />
Wohl der Mitschwestern. Zu Caritas' Zeiten<br />
waren es fünfzig bis sechzig Nonnen. Caritas<br />
legte großen Wert auf eine geistig-religiöse<br />
Ausbildung der Nonnen. Alle Schwestern erhielten<br />
Lateinunterricht. Sie sollten die Sprache,<br />
in der sie beteten, verstehen und darüber<br />
hinaus die Fähigkeit besitzen, Bibelstellen in<br />
Latein und D<strong>eu</strong>tsch zu studieren. Nach Meinung<br />
der Äbtissin kann nur mit Hilfe einer guten Bildung eine tiefgehende<br />
Frömmigkeit entstehen. Durch eine umfassende, humanistisch geprägte Bildung<br />
sollte den Schwestern eine Auseinandersetzung mit ihrem Glauben ermöglicht<br />
werden.<br />
Das Kloster geriet während der Reformation in eine schwere Krise. Nach den<br />
Nürnberger Religionsgesprächen wurde im März verfügt, dass den Franziskanern,<br />
die Beichtväter und Prediger für die Nonnen waren, verboten wurde, ihr<br />
Amt weiterhin auszuüben. Die Nonnen mussten außerdem auf die Messe, das<br />
Bußsakrament und das Sterbesakrament verzichten. Caritas Pirckheimer schreibt<br />
darüber:<br />
Es wäre uns lieber und nützlicher, Ihr schicket einen Henker in unser Kloster,<br />
der uns allen die Köpfe abschlüge, als dass Ihr uns einen vollen, trunkenen, unk<strong>eu</strong>schen<br />
Pfaffen zuschickt. Man nötigt keinen Dienstboten, noch einen Bettler,<br />
dass er beichten muss, wo seine Herrschaft will. Wir wären ärmer als arm, sollten<br />
wir denen beichten, die selber keinen Glauben an die Beichte haben, sollten<br />
wir das hochwürdige Sakrament von denen empfangen, die so absch<strong>eu</strong>lichen<br />
14
Missbrauch damit treiben, dass es eine Schande ist davon zu hören, sollten wir<br />
denen gehorsam sein, die weder dem Papst, dem Bischof, dem Kaiser, noch der<br />
ganzen heiligen, christlichen Kirche gehorsam sind. Sollten sie auch den schönen<br />
göttlichen Dienst abschaffen und nach ihren Köpfen ändern, so wollte ich<br />
lieber tot als lebendig sein.<br />
In der Pfingstwoche des Jahres 1525 erging ern<strong>eu</strong>t ein Beschluss des Rates an<br />
die Nürnberger Klöster, der folgende fünf Forderungen beinhaltete:<br />
* Alle Mitschwestern sollten durch die Äbtissin von ihren Ordensgelübden entbunden<br />
werden.<br />
* Keine Nonne sollte gegen ihren eigenen oder den Willen ihrer Eltern gezwungen<br />
werden, im Kloster zu bleiben. Das Kloster wurde darüber hinaus dazu<br />
verpflichtet, heiratswilligen Schwestern ihre Mitgift auszuzahlen.<br />
* Statt des Habits sollte bürgerliche Kleidung getragen werden.<br />
* Der Rat sollte eine Aufstellung über alle Einkünfte, Besitztümer und sonstiger<br />
Wertgegenstände des Konvents erhalten.<br />
* Schließlich sollten die bisherigen, mit schwarzem Stoff abgedeckten Redefenster<br />
am Klausurgitter entfernt werden, damit der Besucher sicher sein konnte,<br />
dass das Gespräch von keiner anderen Person belauscht würde.<br />
Die Situation eskalierte am Tag vor Fronleichnam 1525, als drei Nonnen gewaltsam<br />
von ihren Müttern aus dem Konvent verschleppt wurden, nachdem die<br />
Töchter in vorangegangenen Versuchen nicht zu einem freiwilligen Verlassen<br />
des Klaraklosters zu bewegen gewesen waren.<br />
Nur eine der Schwestern, Anna Schwarz, verließ den Konvent freiwillig. Sie<br />
sympathisierte mit den reformatorischen Gedanken. Es existiert eine Quittung,<br />
auf der sie am 10. März 1528 bescheinigte, dass sie ihre Mitgift zurückerhalten<br />
hatte. Bis zum Aussterben des Konvents blieb sie die einzige Nonne, die diesen<br />
Schritt tat.<br />
Auf den Straßen vor dem Kloster spielten sich tumultartige Szenen ab. Der aufgebrachte<br />
oder auf aufgehetzte Pöbel störte den Gottesdienst, verwüstete den<br />
Friedhof und warf mit Steinen Fensterscheiben ein.<br />
In dieser Situation wandte sich Caritas Pirckheimer an ihren Bruder Willibald<br />
Pirckheimer und dieser an <strong>Melanchthon</strong>. Als <strong>Melanchthon</strong> im November 1525<br />
in Nürnberg war, kam ein Gespräch zwischen <strong>Melanchthon</strong> und Caritas Pirckheimer<br />
zustande. Dieses Gespräch muss sehr erfolgreich verlaufen sein. Sowohl<br />
Caritas Pirckheimer wie auch <strong>Melanchthon</strong> äußerten sich sehr positiv. Caritas<br />
Pirckheimer schrieb über das Gespräch:<br />
Als er hörte, dass wir unsere Hoffnung auf die Gnade Gottes und nicht auf die<br />
eigenen Werke setzten, sagte er, wir könnten ebenso wohl im Kloster selig werden<br />
wie in der Welt, wenn wir nur nicht allein auf unsere Gelübde vertrauten. Er<br />
schied in guter Fr<strong>eu</strong>ndschaft von uns.<br />
15
<strong>Melanchthon</strong> seinerseits machte dem Rat der Stadt Nürnberg wegen seines rigorosen<br />
Vorgehens Vorhaltungen. Er wandte sich gegen die Amtsenthebung der<br />
Franziskaner und gegen die gewaltsame Entführung der Nonnen durch ihre Eltern.<br />
Auf Grund seiner d<strong>eu</strong>tlichen Worte änderte der Rat sein Verhalten. Der<br />
Fortbestand des Klosters wurde zugesichert. Einschränkende, insbesondere gewaltsame<br />
Maßnahmen unterblieben. Die Nonnen durften unbehelligt ihr bisheriges<br />
Leben fortsetzen. Allerdings durften keine Novizinnen mehr aufgenommen<br />
werden. Damit war das Kloster zum Aussterben verurteilt. 1591 erfolgte nach<br />
dem Tod der letzten Nonne die Auflösung.<br />
Das Verhalten von Caritas Pirckheimer und ihrer Nonnen zeigt, dass nicht in<br />
allen Klöstern in gleicher Weise unzumutbare Zustände herrschten. Allerdings<br />
stellte das Klarissenkloster in Nürnberg wohl eine Ausnahme dar. Verantwortlich<br />
hierfür war sicherlich die hochgebildete und gleichzeitig menschlich überz<strong>eu</strong>gende<br />
Äbtissin Caritas Pirckheimer. Einen Eindruck von der Art und Weise,<br />
wie Caritas Pirckheimer ihr Kloster leitete, mag man erhalten, wenn man sieht,<br />
wie Caritas Pirckheimer im Jahre 1529 den 50. Jahrestag ihres Klostereintritts<br />
feierte. Es muss sehr lebensfroh zugegangen sein. Caritas Pirckheimer schlug<br />
das Hackbrett und die Nonnen tanzten. Ihr Bruder Willibald Pirckheimer ließ zu<br />
diesem Anlass ein Fass Wein und Silbergeschirr ins Kloster bringen.<br />
7 Willibald Pirckheimer<br />
Die Familie Pirckheimer war eine in<br />
Nürnberg einflussreiche Patrizierfamilie<br />
mit eigenen Handelsniederlassungen in<br />
Venedig und Lübeck. Die bekanntesten<br />
Vertreter dieser Familie sind Willibald<br />
Pirckheimer und seine Schwester Caritas.<br />
Willibald Pirckheimer hatte in Pavia und<br />
Padua die Artes liberales und anschließend<br />
Jura studiert. Er war für die Stadt<br />
Nürnberg als juristischer Berater, Gesandter<br />
und Feldhauptmann tätig. Neben<br />
dieser Tätigkeit war er Prosaschriftsteller,<br />
sowie Übersetzer und Bearbeiter der<br />
Werke klassischer Autoren und der<br />
Schriften von Kirchenvätern. Er war<br />
entweder persönlich oder über Briefkontakte<br />
mit zahlreichen bed<strong>eu</strong>tenden Humanisten<br />
seiner Zeit verbunden, z.B. mit<br />
Erasmus von Rotterdam und Thomas<br />
Morus in England. Sein Interesse für<br />
16
Kunst führte zur Fr<strong>eu</strong>ndschaft mit Albrecht Dürer.<br />
Willibald Pirckheimer war auch mit <strong>Melanchthon</strong> bekannt. So schickte <strong>Melanchthon</strong><br />
ihm z.B. im Jahre 1517 einen Brief mit einem griechisches Gedicht.<br />
Es folgt ein langer Briefwechsel in lateinischer Sprache.<br />
Die Bekanntschaft mit <strong>Melanchthon</strong> führte dazu, dass sich Willibald Pirckheimer<br />
auf Bitten seiner Schwerster dafür einsetzte, dass <strong>Melanchthon</strong> nach Nürnberg<br />
kam und im Streit um die Auflösung des Klarissenklosters vermittelnd wirken<br />
konnte.<br />
Willibald Pirckheimer ist so ähnlich wie Erasmus von Rotterdam ein gutes Beispiel,<br />
das zeigt, dass sich viele Humanisten, die anfangs der Reformation wohlgesonnen<br />
gegenüberstanden, sich später von ihr abwandten, als d<strong>eu</strong>tlich wurde,<br />
welch verheerende Folgen die Auflösung der bestehenden Ordnung hatte.<br />
8 Das Religionsgespräch mit Osiander<br />
Der Sebalder Pfarrhof in Nürnberg ist ein Ort, der einen direkten Bezug zu <strong>Melanchthon</strong><br />
hat. Hier in diesem Hof fanden im Jahre 1555 drei Religionsgespräche<br />
mit dem Prediger von St. Lorenz Osiander statt. Anwesend waren drei Ratsmitglieder<br />
und alle Nürnberger Prediger und Pfarrer.<br />
Die katholische Kirche wirft Luther vor, von vornherein eine Kirchenspaltung<br />
angestrebt und damit eine schrittweise Reform unmöglich gemacht zu haben.<br />
Statt zu einer Reform hätte sein Verhalten zur Reformation und damit zu einer<br />
alles Bestehende umstürzenden Revolution geführt.<br />
Nun ist eine Reform allemal besser als eine Revolution. Eine Revolution bed<strong>eu</strong>tet<br />
immer Chaos, bevor sich eine n<strong>eu</strong>e Ordnung etablieren kann. Das war so<br />
nach der Revolution in Frankreich und Russland, und das war auch so nach der<br />
Reformation in D<strong>eu</strong>tschland. Es scheint nur so zu sein, dass es Situationen gibt,<br />
in denen eine Reform nicht mehr möglich ist und nur eine Revolution die Verhältnisse<br />
ändern kann. Das könnte auch bei der Reformation der Fall gewesen<br />
sein. Man kann sich schwerlich vorstellen, dass die römisch-katholische Kirche<br />
des 16. Jahrhunderts in der Lage gewesen wäre, von sich aus und ohne gewaltsamen<br />
Anstoß von außen die erforderlichen und dringend nötigen Reformen in<br />
Angriff zu nehmen.<br />
Die Reformation hat in der Tat eine Auflösung der bestehenden Ordnung bed<strong>eu</strong>tet<br />
und das sowohl auf weltlichem wie auch auf geistlichem Gebiet.<br />
Der römisch-katholischen Kirche ist es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder<br />
gelungen, abweichende Lehrmeinungen zu integrieren. Das geschah zum<br />
Teil durch geschickte und verständnisvolle Menschenführung, zum Teil mit<br />
Gewalt. Inquisition und Scheiterhaufen waren die ultima ratio. Diese einheitliche<br />
Lehrmeinung wurde durch die Reformation zerstört. An ihre Stelle trat eine<br />
Vielzahl gegensätzlicher und sich um Teil erbittert bekämpfender Religionsformen.<br />
Die wichtigsten waren die Lutheraner, die Anhänger Zwinglis und die<br />
17
Anhänger Calvins. Dazu kam eine ganze Reihe extremer, schwärmerischer<br />
Gruppen wie z.B. die Wiedertäufer oder die so genannten Böhmischen Brüder.<br />
Aber selbst innerhalb der Lutheraner gab es Streitigkeiten und Kontroversen. Sie<br />
wurden besonders d<strong>eu</strong>tlich nach dem Tod Luthers im Jahre 1546, als die Autorität<br />
und die Überz<strong>eu</strong>gungskraft Luthers wegfielen.<br />
Ein derartiger Streit war auch die Auseinandersetzung zwischen Osiander und<br />
<strong>Melanchthon</strong>, der im Jahre 1555 hier im Sebalder Pfarrhof stattfand. Es ging um<br />
die Rechtfertigungslehre.<br />
Für uns H<strong>eu</strong>tige sind diese theologischen Auseinandersetzungen kaum noch<br />
nachvollziehbar. Wir haben h<strong>eu</strong>tzutage ganz andere Probleme. Damals war die<br />
Rechtfertigung des Menschen vor Gott ein ganz zentrales Thema, das die Gemüter<br />
heftig bewegte. Ist der Mensch von Natur aus mit der Erbsünde behaftet und<br />
kann nur durch Gottes Gnade gerettet<br />
werden? Oder kann der Mensch durch eigenes<br />
Bemühen, z.B. durch gute Werke an<br />
seiner Erlösung mitwirken?<br />
Die Position <strong>Melanchthon</strong>s war klar: Als<br />
Anhänger Luthers vertrat er die Meinung,<br />
dass der Mensch nichts, aber auch gar<br />
nichts zu seiner Rettung beitragen kann.<br />
Er ist ausschließlich auf die Gnade Gottes<br />
9 <strong>Melanchthon</strong> und Luther<br />
angewiesen.<br />
18<br />
Osiander vertrat im Gegensatz dazu die<br />
Meinung, dass sich der Mensch im Glauben<br />
durch die Gnade Gottes verändert, ein<br />
anderer wird und dadurch zu guten Werken<br />
befähigt wird.<br />
<strong>Melanchthon</strong> konnte sich durchsetzen.<br />
Seine Meinung wurde innerhalb der lutherischen<br />
Kirche verbindlich.<br />
Die nachfolgende Darstellung von Lukas Cranach zeigt <strong>Melanchthon</strong> und Luther<br />
gemeinsam auf einem Bild.<br />
Die beiden Figuren lassen die langwährende und doch schwierige Fr<strong>eu</strong>ndschaft<br />
zwischen diesen beiden bed<strong>eu</strong>tenden Männern d<strong>eu</strong>tlich werden. Es ist verwunderlich,<br />
wenn nicht sogar unbegreiflich, wie zwei Männer, die doch so grundverschieden<br />
in ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter waren, so lange und so<br />
gut zusammenarbeiten konnten. Beide verdanken sich gegenseitig sehr viel.
Allein vom äußeren Erscheinungsbild hätten die beiden nicht verschiedener sein<br />
können. Luther war von eher kräftiger, fast massiger Gestalt. <strong>Melanchthon</strong> eher<br />
klein, zartgliedrig, zierlich und fast schmächtig. Er war nur anderthalb Meter<br />
groß! Außerdem hatte er einen kleinen Sprachfehler.<br />
Hier Luther, der Geniale, der Rabiate, Lebensfrohe, der manchmal zu Grobe und<br />
Polternde, der keinem theologischen Streit aus dem Weg geht; dort <strong>Melanchthon</strong>,<br />
der überaus Gebildete, der Abwägende, sehr Ernste, der, wenn es unter<br />
Wahrung der gemeinsamen theologischen Hauptsache irgend geht, einen Kompromiss<br />
sucht und den offenen Konflikt vermeiden möchte.<br />
Hier die bildreiche Sprache Luthers voller Kraft, dort die gemessene, exakte,<br />
wissenschaftliche Sprache <strong>Melanchthon</strong>s.<br />
Luther charakterisiert dieses Verhältnis mit eigenen Worten so:<br />
Ich muss die Klötze und Stämme ausrotten, Dornen und Hecken weghauen, die<br />
Pfützen ausfüllen, und bin der grobe Waldrechter, der die Bahn brechen und<br />
zurichten muss. Aber Magister Philipps fähret säuberlich und stille daher, bauet<br />
und pflanzet, säet und beg<strong>eu</strong>ßt mit Lust, nachdem Gott ihm hat gegeben seine<br />
Gaben reichlich.<br />
<strong>Melanchthon</strong> sieht sein Verhältnis zu Luther so:<br />
Ich ertrug auch vordem eine fast entehrende Knechtschaft, da Luther oft<br />
19
mehr seinem Temperament folgte, in welchem eine nicht geringe philoneikia lag,<br />
als auf sein Ansehen und auf das Gemeinwohl achtete.<br />
Immer wenn <strong>Melanchthon</strong> etwas Heikles, gar Verfängliches ausdrücken wollte,<br />
wechselte er ins Griechische. Philoneikia steht für Streitsucht.<br />
10 Was bleibt?<br />
Philipp <strong>Melanchthon</strong> ist 1560, also vor 450 Jahren gestorben. Was bed<strong>eu</strong>tet er<br />
für uns h<strong>eu</strong>te? Warum ist es sinnvoll, sich mit ihm zu beschäftigen? Was bleibt?<br />
<strong>Melanchthon</strong> lebte in einer unruhigen, konfliktreichen Zeit. Er zeichnete sich<br />
aus durch tolerantes und offenes Denken, das sich bemühte, auch den Standpunkt<br />
der Andersdenkenden zu verstehen und zu berücksichtigen. Man hat ihn<br />
einen Ireniker, einen Friedensstifter genannt. In unserer Zeit, die auf der einen<br />
Seite auf dem Weg zur Ökumene ist, auf der anderen Seite gegen Fundamentalismus<br />
und religiösen Terror zu kämpfen hat, kann er Vorbild sein.<br />
Er war als Humanist überz<strong>eu</strong>gt, dass Bildung die Voraussetzung für ein sinnvolles<br />
und erfülltes Leben ist. Das eigenständige Denken, das nicht vorgefertigten<br />
Meinungen nachläuft, war ihm wichtig. In unserer Zeit, die immer stärker Wert<br />
auf eine brauchbare Ausbildung legt und für Bildung immer weniger Verständnis<br />
aufbringt, kann er dazu beitragen, die Gewichte wieder zurechtzurücken.<br />
Vielleicht kann man sein Lebenswerk einem Satz von ihm zusammenfassen:<br />
Nati sumus ad mutuam sermonis communicationem<br />
( Wir sind zum Gespräch miteinander geboren)<br />
20