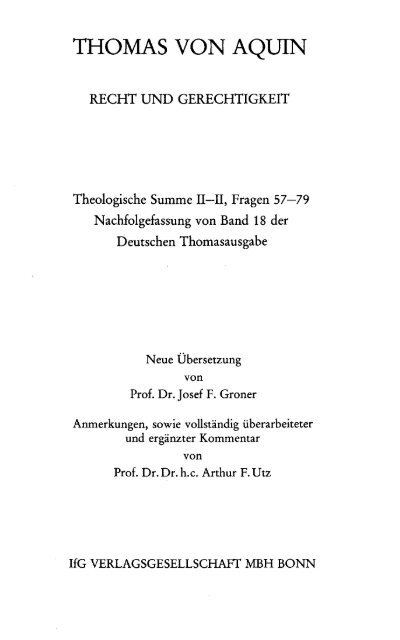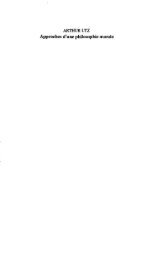Recht und Gerechtigkeit - stiftung-utz.de
Recht und Gerechtigkeit - stiftung-utz.de
Recht und Gerechtigkeit - stiftung-utz.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
THOMAS VON AQUIN<br />
RECHT UND GERECHTIGKEIT<br />
Theologische Summe II—II, Fragen 57—79<br />
Nachfolgefassung von Band 18 <strong>de</strong>r<br />
Deutschen Thomasausgabe<br />
Neue Übersetzung<br />
von<br />
Prof. Dr. Josef F. Groner<br />
Anmerkungen, sowie vollständig überarbeiteter<br />
<strong>und</strong> ergänzter Kommentar<br />
von<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Arthur F. Utz<br />
IfG VERLAGSGESELLSCHAFT MBH BONN
CIP-Kurztitelaufnahme <strong>de</strong>r Deutschen Bibliothek<br />
Thomas :<br />
<strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>: Theol. Summe II—II,<br />
Fragen 57—79/Thomas von Aquin. Anm., sowie vollst, überarb.<br />
u. erg. Kommentar von Arthur F. Utz. —<br />
Nachfolgefassung von Bd. 18 d. Deutschen Thomasausgabe/<br />
neue Ubers, von Josef F. Groner. — Bonn: IfG-Verlagsgesellschaft, 1987.<br />
Einheitssacht.: Summa theologica Teiiausg.<br />
ISBN 3-922183-15-8<br />
NE: Utz, Arthur [Hrsg.]
VORWORT<br />
Der 18. Band <strong>de</strong>r Deutschen Thomasausgabe war kurze Zeit<br />
nach seinem Erscheinen (1953) vergriffen. Die Anfragen, ob ich<br />
noch irgendwo ein Exemplar dieses Ban<strong>de</strong>s auftreiben könne,<br />
häuften sich. Einige Bibliotheken teilten mir sogar mit, <strong>de</strong>r Band<br />
sei abhan<strong>de</strong>n gekommen. Der Verlag Styria/Graz konnte sich<br />
für eine Neuauflage nicht entschließen. Dankenswerterweise<br />
hat es nun <strong>de</strong>r Verlag <strong>de</strong>s Instituts für Gesellschaftswissen<br />
schaften Walberberg in Bonn gewagt, diese Nachfolgefassung<br />
zu übernehmen.<br />
Die Nachfolgefassung unterschei<strong>de</strong>t sich bereits äußerlich<br />
von <strong>de</strong>r ersten Auflage innerhalb <strong>de</strong>r Deutschen Thomasaus<br />
gabe. Sie bringt nicht mehr <strong>de</strong>n lateinischen Text. Ein Großteil<br />
<strong>de</strong>r Leser <strong>de</strong>r Werke <strong>de</strong>s hl. Thomas von Aquin ist mit <strong>de</strong>m<br />
Lateinischen nicht mehr so vertraut, wie man es noch vor etwa<br />
fünfzig Jahren voraussetzen konnte. Die übrigen Leser können<br />
eine <strong>de</strong>r leicht zugänglichen lateinischen Summa-Ausgaben ein<br />
sehen. Wer die <strong>de</strong>utsche Übersetzung <strong>de</strong>r ersten Auflage von<br />
Bd. 18 <strong>de</strong>r Deutschen Thomasausgabe zur Hand nimmt, ist<br />
zum vollen Verständnis sehr oft auf das Mitlesen <strong>de</strong>r lateinischen<br />
Parallele angewiesen. Darum bestand die Absicht, eine <strong>de</strong>utsche<br />
Übersetzung anzufertigen, die ohne Rückgriff auf <strong>de</strong>n lateini<br />
schen Text voll <strong>und</strong> ganz verständlich sein sollte. Als neuen<br />
Übersetzer konnte ich meinen Mitbru<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong> Prof.<br />
Dr. Groner gewinnen. Mit sprachlichem Geschick <strong>und</strong> mit<br />
gründlicher Kenntnis <strong>de</strong>s Thomas-Lateins hat er nun einen<br />
<strong>de</strong>utschen Text erstellt, <strong>de</strong>r das Original adaequat auf <strong>de</strong>utsch<br />
wie<strong>de</strong>rgibt, weshalb man auf die lateinische Vorlage verzichten<br />
kann.<br />
Den Kommentar habe ich vollständig überarbeitet <strong>und</strong> zum<br />
Teil auch wesentlich ergänzt. Auch im Teil „Anmerkungen"<br />
wird <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r die erste Auflage besitzt, manche Än<strong>de</strong>run<br />
gen feststellen. Auf die allgemein in wissenschaftlichen Werken<br />
eingehaltene Gewohnheit, möglichst viel Literatur in Fußnoten<br />
V
anzuführen, habe ich verzichtet. Ein Kommentar zu Thomas<br />
von Aquin sollte nicht schon nach wenigen Jahren als veraltet<br />
beiseite gelegt wer<strong>de</strong>n, weil <strong>de</strong>r literarische Apparat <strong>de</strong>n wissen<br />
schaftlichen Prestigenormen nicht mehr zu entsprechen scheint.<br />
Ich habe lediglich <strong>de</strong>n einen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Titel, <strong>de</strong>r für <strong>de</strong>n Band<br />
von einiger Be<strong>de</strong>utung ist, im Literaturverzeichnis nachgetra<br />
gen. Wer mehr wünscht, kann meine „Bibliographie <strong>de</strong>r Sozial<br />
ethik" zu Rate ziehen. Die gr<strong>und</strong>sätzlichen Fragen über das<br />
Naturrecht bei Thomas von Aquin, die <strong>de</strong>m vorliegen<strong>de</strong>n Band<br />
thematisch vorausgehen (I—II 90—97), möchte ich auf gleiche<br />
Weise wie hier an absehbarer Zeit herausbringen, dies u. a. (vgl.<br />
Anm. 1 in <strong>de</strong>r Einleitung) <strong>de</strong>shalb, weil ich mich mit diesem<br />
Kommentar seit Jahrzehnten beschäftige.<br />
Übersetzer <strong>und</strong> Kommentator danken Dr. Brigitta Gräfin<br />
von Galen für die redaktionelle Überarbeitung <strong>de</strong>r Manu<br />
skripte, die Lesung <strong>de</strong>r Korrekturen <strong>und</strong> die Erstellung <strong>de</strong>r<br />
Verzeichnisse.<br />
Mit <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Neufassung hoffen Übersetzer <strong>und</strong><br />
Kommentator, <strong>de</strong>r Deutschen Thomasausgabe einen Dienst<br />
erwiesen zu haben.<br />
VI<br />
A.F.Utz OP
INHALTSVERZEICHNIS<br />
VORWORT V<br />
EINLEITUNG XIX<br />
DER AUFBAU DER ARTIKEL XXVI<br />
TEXT 1<br />
57. FRAGE: DAS RECHT 3<br />
1. Artikel: Ist das <strong>Recht</strong> das Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>? .... 3<br />
2. Artikel: Wird das <strong>Recht</strong> zutreffend in Naturrecht <strong>und</strong> posi<br />
tives <strong>Recht</strong> eingeteilt? 5<br />
3. Artikel: Ist das Völkerrecht das gleiche wie das Naturrecht ? 7<br />
4. Artikel: Müssen väterliches <strong>und</strong> herrschaftliches <strong>Recht</strong><br />
beson<strong>de</strong>rs unterschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n? 9<br />
58. FRAGE: DIE GERECHTIGKEIT 12<br />
1. Artikel: Ist die Definition <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>: Der unwan<br />
<strong>de</strong>lbare <strong>und</strong> feste Wille, je<strong>de</strong>m das Seine zu geben,<br />
richtig? 12<br />
2. Artikel: Ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> auf einen an<strong>de</strong>ren bezogen? 15<br />
3. Artikel: Ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> Tugend? 17<br />
4. Artikel: Hat die <strong>Gerechtigkeit</strong> ihren Sitz im Willen? .... 18<br />
5. Artikel: Ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> „allgemeine Tugend"? .... 20<br />
6. Artikel: Ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> als allgemeine Tugend wesent<br />
lich je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Tugend gleich? 21<br />
7. Artikel: Gibt es außer <strong>de</strong>r allgemeinen <strong>Gerechtigkeit</strong> noch<br />
eine beson<strong>de</strong>re <strong>Gerechtigkeit</strong>? 23<br />
8. Artikel: Hat die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit einen eigenen Wirk<br />
bereich? 25<br />
9. Artikel: Hat die Gesetzesgerechtigkeit etwas mit <strong>de</strong>n Lei<br />
<strong>de</strong>nschaften zu tun? 27<br />
10. Artikel: Ist die Tugendmitte gleich <strong>de</strong>r Sachmitte? 29<br />
VII
11. Artikel: Besteht <strong>de</strong>r Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> darin, je<strong>de</strong>m<br />
das Seine zu geben? 30<br />
12. Artikel: Steht die <strong>Gerechtigkeit</strong> an <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n? 32<br />
59. FRAGE: DIE UNGERECHTIGKEIT 34<br />
1. Artikel: Ist die Ungerechtigkeit ein beson<strong>de</strong>res Laster? . . 34<br />
2. Artikel: Heißt jemand ungerecht, weil <strong>de</strong>r Ungerechtes tut? 35<br />
3. Artikel: Kann jemand willentlich Unrecht lei<strong>de</strong>n? 37<br />
4. Artikel: Sündigt schwer, wer Unrecht tut? • 39<br />
60. FRAGE: DIE RECHTSPRECHUNG 41<br />
1. Artikel: Ist die <strong>Recht</strong>sprechung ein Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ? 41<br />
2. Artikel: Ist es erlaubt, <strong>Recht</strong> zu sprechen? 43<br />
3. Artikel: Ist ein Urteil auf bloßen Verdacht hin erlaubt? . . 45<br />
4. Artikel: Müssen Zweifel nach <strong>de</strong>r günstigeren Seite hin<br />
gelöst wer<strong>de</strong>n? 47<br />
5. Artikel: Muß man immer nach <strong>de</strong>m geschriebenen Gesetz<br />
<strong>Recht</strong> sprechen? 49<br />
6. Artikel: Wird die <strong>Recht</strong>sprechung durch Anmaßung beein<br />
trächtigt? 50<br />
61. FRAGE: DIE TEILE DER GERECHTIGKEIT 53<br />
1. Artikel: Gibt es zwei Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong>, die austei<br />
len<strong>de</strong> <strong>und</strong> die ausgleichen<strong>de</strong>? 53<br />
2. Artikel: Wird die „Mitte" bei <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
ausgleichen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> auf gleiche Weise<br />
bestimmt? 55<br />
3. Artikel: Haben die bei<strong>de</strong>n Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong> ver<br />
schie<strong>de</strong>ne Materien? 57<br />
4. Artikel: Ist <strong>Gerechtigkeit</strong> einfachhin das gleiche wie Ver<br />
geltung? 60<br />
62. FRAGE: DIE RÜCKERSTATTUNG 63<br />
1. Artikel: Ist die Rückerstattung ein Akt <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n<br />
VIII<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>? 63
2. Artikel: Ist die Rückgabe einer entwen<strong>de</strong>ten Sache zum<br />
ewigen Heil notwendig? 65<br />
3. Artikel: Genügt es, einfach das zurückzugeben, was zu<br />
Unrecht weggenommen wur<strong>de</strong>? 67<br />
4. Artikel: Muß jemand zurückgeben, was er nicht entwen<strong>de</strong>t<br />
hat? 68<br />
5. Artikel: Muß man immer <strong>de</strong>m zurückerstatten, von <strong>de</strong>m<br />
man etwas genommen hat? 70<br />
6. Artikel: Muß immer jener zurückerstatten, <strong>de</strong>r entwen<strong>de</strong>t<br />
hat? 72<br />
7. Artikel: Sind die, die nichts entwen<strong>de</strong>t haben, zur Wie<strong>de</strong>r<br />
erstattung verpflichtet? 74<br />
8. Artikel: Muß man sofort zurückgeben o<strong>de</strong>r darf man die<br />
Restitution hinauszögern? 77<br />
63. FRAGE: DAS „ANSEHEN DER PERSON" 79<br />
1. Artikel: Ist das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" eine Sün<strong>de</strong>? 79<br />
2. Artikel: Spielt bei <strong>de</strong>r Verleihung von geistlichen Gütern<br />
das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" eine Rolle? 81<br />
3. Artikel: Kommt es bei <strong>de</strong>r Erweisung von Ehre <strong>und</strong> Hoch<br />
achtung zum „Ansehen <strong>de</strong>r Person" ? 84<br />
4. Artikel: Gibt es bei Gerichtsentscheidungen die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
„Ansehens <strong>de</strong>r Person" ? 85<br />
64. FRAGE: DER MORD 87<br />
1. Artikel: Darf man irgendwelche Lebewesen töten? 87<br />
2. Artikel: Ist es erlaubt, Sün<strong>de</strong>r zu töten? 89<br />
3. Artikel: Darf eine Privatperson einen Sün<strong>de</strong>r töten? .... 91<br />
4. Artikel: Ist es Geistlichen erlaubt, Verbrecher zu töten? . . 92<br />
5. Artikel: Darf man sich selber töten? . 94<br />
6. Artikel: Darf man in bestimmten Fällen einen Unschuldi<br />
gen töten? 97<br />
7. Artikel: Darf man in Notwehr jeman<strong>de</strong>n töten? 99<br />
8. Artikel: Verstrickt sich, wer zufällig einen Menschen tötet,<br />
in Schuld? 101<br />
IX
65. FRAGE: ANDERE ARTEN VON UNRECHT GEGEN<br />
PERSONEN 103<br />
1. Artikel: Kann es gegebenenfalls erlaubt sein, jeman<strong>de</strong>n zu<br />
verstümmeln? 103<br />
2. Artikel: Dürfen Väter ihre Kin<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r die Herren ihre<br />
Dienerschlagen? 105<br />
3. Artikel: Ist es erlaubt, einen Menschen einzukerkern? . . . 107<br />
4. Artikel: Wird die Sün<strong>de</strong> schwerer, wenn durch die gegen<br />
bestimmte Personen begangenen Unrechtstaten<br />
an<strong>de</strong>re mitbetroffen wer<strong>de</strong>n? 108<br />
66. FRAGE: DIEBSTAHL UND RAUB 111<br />
1. Artikel: Kommt materieller Besitz <strong>de</strong>m Menschen von<br />
Natur aus zu ? 111<br />
2. Artikel: Ist Privateigentum erlaubt? 113<br />
3. Artikel: Besteht Diebstahl in <strong>de</strong>r geheimen Wegnahme<br />
einer frem<strong>de</strong>n Sache? 115<br />
4. Artikel: Sind Diebstahl <strong>und</strong> Raub spezifisch verschie<strong>de</strong>ne<br />
Sün<strong>de</strong>n? 116<br />
5. Artikel: Ist Diebstahl immer Sün<strong>de</strong>? 118<br />
6. Artikel: Ist Diebstahl schwere Sün<strong>de</strong>? 120<br />
7. Artikel: Darf man aus Not stehlen? 121<br />
8. Artikel: Kann Raub Sün<strong>de</strong> sein? 123<br />
9. Artikel: Ist Raub eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Diebstahl? . . . 125<br />
67. FRAGE: DIE MISSACHTUNG DER GERECHTIGKEIT<br />
X<br />
BEI DER AUSÜBUNG DES RICHTERAMTES 126<br />
1. Artikel: Kann <strong>de</strong>r Richter über jeman<strong>de</strong>n urteilen, für <strong>de</strong>n<br />
er nicht zuständig ist? 126<br />
2. Artikel: Ist es erlaubt, angesichts <strong>de</strong>r vorgebrachten Aus<br />
sagen ein Urteil gegen das eigene bessere Wissen<br />
Zufällen? 128<br />
3. Artikel: Kann <strong>de</strong>r Richter tätig wer<strong>de</strong>n, auch wenn kein<br />
Kläger vorhan<strong>de</strong>n ist? 130<br />
4. Artikel: Darf <strong>de</strong>r Richter die Strafe erlassen? 132
68. FRAGE: DIE UNGERECHTE ANKLAGE 134<br />
1. Artikel: Ist man verpflichtet, Anklage zu erheben? 134<br />
2. Artikel: Muß die Anklage schriftlich abgefaßt wer<strong>de</strong>n? . . . 136<br />
3. Artikel: Wird die Anklage ungerecht durch Verleumdung,<br />
Verheimlichung (praevaricatio) <strong>und</strong> Wi<strong>de</strong>rruf (ter-<br />
giversatio)? 137<br />
4. Artikel: Verfällt ein Ankläger, <strong>de</strong>r in seiner Beweisführung<br />
versagt, <strong>de</strong>r Strafe <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvergeltung? 139<br />
69. FRAGE: DIE SÜNDEN DES ANGEKLAGTEN GEGEN<br />
DIE GERECHTIGKEIT 142<br />
1. Artikel: Kann <strong>de</strong>r Angeklagte, ohne eine Todsün<strong>de</strong> zu be<br />
gehen, die Wahrheit leugnen, die seine Verurtei<br />
lung zur Folge hätte? 142<br />
2. Artikel: Darf sich <strong>de</strong>r Angeklagte mit unredlichen Mitteln<br />
verteidigen? 144<br />
3. Artikel: Darf <strong>de</strong>r Schuldige Berufung einlegen, um <strong>de</strong>r Ver<br />
urteilung zu entgehen? 146<br />
4. Artikel: Darf sich ein zum Tod Verurteilter verteidigen,<br />
wenn er kann? 148<br />
70. FRAGE: DIE VERSTÖSSE GEGEN DIE GERECHTIG<br />
KEIT DURCH DEN ZEUGEN 150<br />
1. Artikel: Ist man zur Zeugenaussage verpflichtet? 150<br />
2. Artikel-: Genügt die Aussage von zwei o<strong>de</strong>r drei Zeugen? 152<br />
3. Artikel: Kann die Aussage eines Zeugen, ohne daß bei ihm<br />
Schuld vorliegt, zurückgewiesen wer<strong>de</strong>n? 155<br />
4. Artikel: Ist falsche Zeugenaussage immer Todsün<strong>de</strong>? .... 157<br />
71. FRAGE: DIE UNGERECHTIGKEITEN, DIE VOR<br />
GERICHT DURCH DIE ANWÄLTE BEGAN<br />
GEN WERDEN 159<br />
1. Artikel: Ist <strong>de</strong>r Anwalt verpflichtet, als <strong>Recht</strong>sbeistand im<br />
Prozeß eines Armen mitzuwirken? 159<br />
2. Artikel: Ist es in Ordnung, daß bestimmte Personen recht<br />
mäßig vom Amt <strong>de</strong>s Anwalts ausgeschlossen wer<br />
<strong>de</strong>n? 161<br />
XI
3. Artikel: Sündigt <strong>de</strong>r Anwalt, <strong>de</strong>r eine ungerechte Sache<br />
vertritt? 163<br />
4. Artikel: Darf <strong>de</strong>r Anwalt für seinen <strong>Recht</strong>sbeistand Geld<br />
nehmen? 165<br />
72. FRAGE: DIE SCHMÄHUNG 167<br />
1. Artikel: Besteht die Schmähung in Worten? 167<br />
2. Artikel: Ist Schmähung o<strong>de</strong>r Beschimpfung Todsün<strong>de</strong>? . . 169<br />
3. Artikel: Muß man zugefügte Schmähung dul<strong>de</strong>n? 171<br />
4. Artikel: Entspringt die Schmähung <strong>de</strong>m Zorn? 173<br />
73. FRAGE: DIE EHRABSCHNEIDUNG 175<br />
1. Artikel: Besteht die Ehrabschneidung in <strong>de</strong>r Anschwärzung<br />
frem<strong>de</strong>n Leum<strong>und</strong>s durch heimliche Worte? .... 175<br />
2. Artikel: Ist Ehrabschneidung Todsün<strong>de</strong>? 177<br />
3. Artikel: Ist Ehrabschneidung die schwerste aller Sün<strong>de</strong>n<br />
gegen <strong>de</strong>n Nächsten, 179<br />
4. Artikel: Sündigt <strong>de</strong>r Zuhörer, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Ehrabschnei<strong>de</strong>r ge<br />
währen läßt, schwer? 182<br />
74. FRAGE: DIE OHRENBLÄSEREI 185<br />
1. Artikel: Unterschei<strong>de</strong>t sich die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ohrenbläserei<br />
von <strong>de</strong>r Ehrabschneidung? 185<br />
2. Artikel: Ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ehrabschneidung schwerer als<br />
die Ohrenbläserei? 186<br />
75. FRAGE: DIE VERSPOTTUNG 189<br />
1. Artikel: Ist die Verspottung eine beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong>? 189<br />
2. Artikel: Kann Verspottung Todsün<strong>de</strong> sein? 191<br />
76. FRAGE: DIE VERFLUCHUNG 193<br />
1. Artikel: Darf man jemand verfluchen? 193<br />
2. Artikel: Darf man etwas Vernunftloses verfluchen? 195<br />
3. Artikel: Ist Verfluchen Todsün<strong>de</strong>? 197<br />
4. Artikel: Ist Verfluchen eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Ehrab<br />
xn<br />
schneidung? 198
77. FRAGE: DER BETRUG BEI KAUF UND VERKAUF . . 200<br />
1. Artikel: Darf man etwas über seinen Wert verkaufen? . . . 200<br />
2. Artikel: Wird <strong>de</strong>r Verkauf ungerecht <strong>und</strong> unerlaubt wegen<br />
Fehlerhaftigkeit <strong>de</strong>r verkauften Sache? 203<br />
3. Artikel: Muß <strong>de</strong>r Verkäufer auf einen Warenfehler hin<br />
weisen? 206<br />
4. Artikel: Darf bei Han<strong>de</strong>lsgeschäften <strong>de</strong>r Verkaufspreis<br />
höher sein als <strong>de</strong>r Einkaufspreis? 208<br />
78. FRAGE: DIE SÜNDE DES ZINSNEHMENS 211<br />
1. Artikel: Ist es Sün<strong>de</strong>, Zins für geliehenes Geld anzuneh<br />
men? 211<br />
2. Artikel: Kann man für ein Darlehen irgen<strong>de</strong>ine an<strong>de</strong>re<br />
Gefälligkeit erbitten? 215<br />
3. Artikel: Muß man <strong>de</strong>n Gewinn aus Wucherzinsen zurück<br />
erstatten? 219<br />
4. Artikel: Ist es erlaubt, gegen Zins ein Darlehen aufzuneh<br />
men? 220<br />
79. FRAGE: DIE DER VERVOLLSTÄNDIGUNG DIENEN<br />
DEN TEILTUGENDEN DER GERECHTIG<br />
KEIT 223<br />
1. Artikel: Sind Das-Gute-tun <strong>und</strong> Das-Böse-mei<strong>de</strong>n Teile<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>? 223<br />
2. Artikel: Ist die Übertretung eine Sün<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rer Art? . . 225<br />
3. Artikel: Ist die Unterlassung eine Sün<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rer Art? . 227<br />
4. Artikel: Ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Unterlassung schwerer als die<br />
Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Übertretung? 229<br />
ANMERKUNGEN 233<br />
KOMMENTAR 263<br />
Zur Einführung 265<br />
ERSTER TEIL: DAS WESEN DER GERECHTIGKEIT<br />
(Fr. 57-60) 267<br />
XIII
Erstes Kapitel: Das <strong>Recht</strong> als Gegenstand <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> (Fr. 57) 267<br />
I. Der Begriff <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s (Art. 1) 267<br />
II. Naturrecht <strong>und</strong> positives <strong>Recht</strong> (Art. 2-4) 274<br />
1. Die Entstehung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Natur <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
positiven Satzung (Art. 2) 274<br />
2. Die Naturrechtslehre <strong>de</strong>s hl. Thomas <strong>und</strong> die <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>r<br />
nen <strong>Recht</strong>sphilosophie 277<br />
a) Die Normen <strong>de</strong>s Naturrechts 277<br />
b) Der rechtslogische Prozeß von <strong>de</strong>n Normen zum<br />
konkreten <strong>Recht</strong> 289<br />
3. Das „jus gentium" (Art. 3) 292<br />
4. Vaterrecht <strong>und</strong> Herrschaftsrecht (Art. 4) 298<br />
Zweites Kapitel: <strong>Gerechtigkeit</strong> als Tugend (Fr.58) 302<br />
1. Die allgemeine Begriffsbestimmung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>ren sittliche Bewandtnis (Art. 1-4) 302<br />
2. Die allgemeine <strong>Gerechtigkeit</strong>. Das Problem <strong>de</strong>r sozialen<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> (Art. 5 u. 6) 307<br />
3. Die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit (Art. 7-10) 312<br />
4. Das gerechte Tun (Art. 11) 313<br />
5. Die Werthöhe <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> (Art. 12) 314<br />
Drittes Kapitel: Die Ungerechtigkeit (Fr.59) 315<br />
Viertes Kapitel: Die <strong>Recht</strong>sprechung (Fr.60) 317<br />
ZWEITER TEIL: DIE TEILTUGENDEN DER GERECH<br />
TIGKEIT (Fr. 61-79) 322<br />
Erstes Kapitel: Die ausgleichen<strong>de</strong> <strong>und</strong> die austeilen<strong>de</strong> Ge<br />
rechtigkeit (Fr. 61 u. 62) 322<br />
Zweites Kapitel: Die Sün<strong>de</strong>n gegen die austeilen<strong>de</strong> Gerech<br />
tigkeit. Die falsche Rücksicht auf Personen<br />
(Fr. 63) 325<br />
Drittes Kapitel: Die Sün<strong>de</strong>n gegen die ausgleichen<strong>de</strong> Ge<br />
XIV<br />
rechtigkeit (Fr. 64-78) 327
I. Der Mord (Fr. 64) 328<br />
1. Die To<strong>de</strong>sstrafe (Art. 1-4) 328<br />
a) Schuld <strong>und</strong> Strafe 329<br />
b) Staatsgewalt <strong>und</strong> To<strong>de</strong>sstrafe 333<br />
2. Der Selbstmord (Art. 5) 338<br />
a) Der Selbstmord als Verbrechen gegen sich selbst . . . 340<br />
b) Der Selbstmord als Verbrechen gegen die Gesellschaft 341<br />
c) Der Selbstmord als Sün<strong>de</strong> gegen Gott 341<br />
3. Die Tötung unschuldigen Lebens (Art. 6) 342<br />
4. Die Tötung eines lebensgefährlichen Angreifers (Art. 7) 343<br />
II. Die an<strong>de</strong>rn Eingriffe in das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Person, wie Körper<br />
verletzung, Züchtigung, Freiheitsberaubung (Fr. 65) 346<br />
1. Die Körperverstümmelung (Art. 1) 346<br />
2. Die Prügelstrafe (Art. 2) 348<br />
3. Kerkerhaft <strong>und</strong> Gewahrsam (Art. 3) 349<br />
4. Das Unrecht in seiner Aus<strong>de</strong>hnung auf einen weiteren<br />
Personenkreis (Art. 4) 350<br />
III. Diebstahl <strong>und</strong> Raub (Fr. 66) 351<br />
A. Das Eigentumsrecht (Art. 1 u. 2) 351<br />
1. Der Streit um die Auslegung <strong>de</strong>r thomasischen Texte 351<br />
2. Das Eigentum als Naturrecht in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Schau<br />
weise 354<br />
3. Die Lehre vom Eigentum in <strong>de</strong>r christlichen Tradition . . 365<br />
4. Die Lehre über das Eigentum beim hl. Thomas 385<br />
a) Der Zweck <strong>de</strong>r Güterwelt. Ihre soziale Bestimmung 385<br />
b) Kommunismus o<strong>de</strong>r private Eigentumsordnung? . . . 389<br />
c) Das <strong>Recht</strong> auf Eigentum ein Naturrecht? 394<br />
d) Die Reichweite <strong>de</strong>s Privaten 397<br />
e) Der Eigentumsbegriff <strong>de</strong>s hl. Thomas <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>r Wirtschaft 398<br />
B. Die sittliche Bewertung <strong>de</strong>s Diebstahls <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Raubes<br />
(Art. 3-9) 401<br />
XV
IV. Die Ungerechtigkeiten im gerichtlichen Prozeß (Art. 67-71) 405<br />
1. Die Ungerechtigkeiten vonseiten <strong>de</strong>s Richters (Fr. 67) . . 405<br />
2. Die Ungerechtigkeiten vonseiten <strong>de</strong>s Klägers (Fr. 68) . . . 406<br />
3. Die Ungerechtigkeiten vonseiten <strong>de</strong>s Angeklagten (Fr. 69) 407<br />
4. Die Ungerechtigkeiten vonseiten <strong>de</strong>r Zeugen (Fr. 70) . . 408<br />
5. Die Ungerechtigkeiten vonseiten <strong>de</strong>s Anwalts (Fr. 71) . . 409<br />
V. Die außergerichtlichen, durch Worte verursachten Unge<br />
rechtigkeiten (Fr. 72-76) 411<br />
1. Die Schmähung (Fr. 72) 411<br />
2. Die Ehrabschneidung (Fr. 73) 412<br />
3. Die Ohrenbläserei (Fr. 74) 413<br />
4. Die Verspottung (Fr. 75) 413<br />
5. Die Verfluchung (Fr. 76) 414<br />
VI. Die Ungerechtigkeit in <strong>Recht</strong>sgeschäften (Fr. 77 u. 78) . . 414<br />
A. DerBetrug —die Sün<strong>de</strong> gegen <strong>de</strong>n gerechten Preis (Fr. 77) 416<br />
1. Der gerechte Preis 416<br />
2. Die Han<strong>de</strong>lsmoral 419<br />
B. Der Zins (Fr. 78) 424<br />
1. Die Beurteilung <strong>de</strong>r Rente (census) 426<br />
2. Der Darlehenszins 435<br />
Viertes Kapitel: Die Wesenselemente gerechten Han<strong>de</strong>lns<br />
(Fr. 79) 442<br />
Exkurs I: Die Anwendung <strong>de</strong>s Begriffs <strong>de</strong>r Ganzheit auf die<br />
Gesellschaftslehre 444<br />
Exkurs II: Der Wan<strong>de</strong>l im Begriff <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerech<br />
tigkeit. Soziale <strong>Gerechtigkeit</strong> — soziale Liebe .... 448<br />
Exkurs III: Der Gemeinwohlbegriff <strong>de</strong>s hl. Thomas <strong>und</strong> die<br />
XVI<br />
katholische Soziallehre 456<br />
1. Die Frage nach <strong>de</strong>r Systematik <strong>de</strong>r Sozialethik bei Tho<br />
mas von Aquin <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre . . . 456<br />
2. Der Konsens in <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong>thesen <strong>de</strong>r katholischen<br />
Soziallehre 457
3. Analyse <strong>de</strong>s Gemeinwohlbegriffs <strong>de</strong>r päpstlichen Ver<br />
lautbarungen 461<br />
Unterscheidung von Wert- <strong>und</strong> Handlungsordnung . . 461<br />
Das Gemeinwohl als ethischer Wert 462<br />
Das Gemeinwohl in <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Handlungs<br />
ordnung 469<br />
Das Gemeinwohl <strong>de</strong>r Kirche <strong>und</strong> das ihm entsprechen<strong>de</strong><br />
Subsidiaritätsprinzip 472<br />
Zusammenfassung 475<br />
4. Die philosophische <strong>und</strong> theologische Interpretation <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohlbegriffs <strong>de</strong>r kirchlichen Soziallehre 477<br />
Das Objekt <strong>de</strong>r Interpretation 477<br />
a) Das Gemeinwohl bei Thomas von Aquin 479<br />
Zusammenfassung 484<br />
b) Das Gemeinwohl im Solidarismus von G. G<strong>und</strong>lach . 486<br />
c) Das Gemeinwohl bei Johannes Messner 493<br />
5. Die Anwendung <strong>de</strong>s Gemeinwohlbegriffs <strong>de</strong>r katho<br />
lischen Soziallehre auf die Bestimmung <strong>de</strong>r Wohlfahrt. . 495<br />
Abkürzungen 499<br />
Literaturverzeichnis 503<br />
Alphabetisches Sachverzeichnis 523<br />
Namenverzeichnis 541<br />
XVII
EINLEITUNG<br />
Der vorliegen<strong>de</strong> Band überrascht wohl <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen Leser<br />
durch die Reichhaltigkeit an Themen, die unter <strong>de</strong>m Sammelbe<br />
griff „<strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>" zusammengefaßt wer<strong>de</strong>n.<br />
Thomas breitet hier eine <strong>Recht</strong>sphilosophie aus, die sich mit<br />
vielen Einzelheiten <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Zusammenseins<br />
befaßt <strong>und</strong> die darum schon rein äußerlich in die Richtung<br />
weist, nach welcher alle Einzeltraktate eingestellt sind: in die<br />
Richtung <strong>de</strong>s Naturrechts. Mit mo<strong>de</strong>rnen Begriffen ausge<br />
drückt: es han<strong>de</strong>lt sich hier um eine „<strong>Recht</strong>sphilosophie", eine<br />
„Gesellschafts- <strong>und</strong> Staatsphilosophie" <strong>und</strong> nicht zuletzt um<br />
eine „Wirtschaftsethik", wobei <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r Wirtschaftsethik<br />
nicht etwa nur ein allgemein sittlich-gutes Verhalten in wirt<br />
schaftlichen Fragen besagen, son<strong>de</strong>rn das <strong>Recht</strong>sverhältnis aus<br />
drücken will, das in <strong>de</strong>r Wirtschaftsgesellschaft geltend sein<br />
soll. Es gibt kaum ein Thema dieses Ban<strong>de</strong>s, das uns Mo<strong>de</strong>rne<br />
nicht zutiefst anspricht o<strong>de</strong>r wenigstens aufhorchen läßt <strong>und</strong> zu<br />
intensiverem Studium anregen wird. Neben <strong>de</strong>n gr<strong>und</strong>sätz<br />
lichen Erörterungen über die Wesenheit <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, seine Ent<br />
stehung, seine völkerumfassen<strong>de</strong> Spannweite, seine Beziehung<br />
zur Moral, vernehmen wir Wichtiges über die Gr<strong>und</strong>rechte <strong>de</strong>s<br />
Menschen, über das <strong>Recht</strong> auf Leben - in Verbindung damit<br />
über das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Staatsgewalt, die To<strong>de</strong>sstrafe zu verhängen -<br />
<strong>und</strong> über das <strong>Recht</strong> auf körperliche Unversehrtheit. Nicht<br />
zuletzt kommt auch das <strong>Recht</strong> auf Eigentum zur Sprache. Mit<br />
diesem letzten Fragenkomplex führt Thomas bereits ins Gebiet<br />
<strong>de</strong>r Wirtschaftsethik ein. Hier sind es dann vor allem die mit<br />
<strong>de</strong>m Kapital <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Kapitalrendite, <strong>de</strong>m arbeitslosen Einkom<br />
men, zusammenhängen<strong>de</strong>n Fragen, mit <strong>de</strong>nen sich Thomas<br />
beschäftigt. In Wahrheit also eine Summe <strong>de</strong>s Naturrechts als<br />
einer rechtlich friedlichen Regelung <strong>de</strong>r politischen, gesell<br />
schaftlichen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Ordnung.<br />
Um nicht über all diese brennen<strong>de</strong>n Gegenwartsfragen nur<br />
Allgemeines zu sagen, sei kurz auf die aktuelle Be<strong>de</strong>utung<br />
zweier gr<strong>und</strong>legen<strong>de</strong>n Erkenntnisse hingewiesen, die <strong>de</strong>m<br />
mo<strong>de</strong>rnen Leser <strong>de</strong>s vorliegen<strong>de</strong>n Ban<strong>de</strong>s als neu <strong>und</strong> unerwar<br />
tet auffallen dürften <strong>und</strong> müßten:<br />
XIX
1. die thomasische Begründung <strong>de</strong>s Naturrechts, die durch<br />
die traditionelle Kommentierung manche Verschiebung, wenn<br />
nicht gar Verzeichnung erfahren hat 1 ;<br />
2. die Rückorientierung <strong>de</strong>r Eigentumslehre <strong>und</strong> <strong>de</strong>r damit<br />
zusammenhängen<strong>de</strong>n Probleme auf die altchristliche Tradition,<br />
die in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen wirtschaftsethischen Diskussion allzu<br />
leicht übersehen wird.<br />
1. An Naturrechtslehrern hat es bis heute nicht gefehlt. Und<br />
auch an <strong>de</strong>r Berufung auf Thomas von Aquin mangelt es nicht.<br />
Ob man sich aber jeweils <strong>de</strong>r Tragweite einer solchen Berufung<br />
auf Thomas bewußt war? So hoch auch die Lehre <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas von <strong>de</strong>n ewigen Normen <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s <strong>und</strong> von <strong>de</strong>m<br />
damit gegebenen erkenntnistheoretischen Standpunkt eines<br />
gemäßigten Realismus anzuschlagen ist, so wäre <strong>de</strong>r mensch<br />
lichen Gesellschaft damit noch nicht viel gedient, da diese Lehre<br />
allein rechtsphilosophisch nur ein Bruchstück wäre, utopisch,<br />
unbrauchbar für die Wirklichkeit. Man re<strong>de</strong>t eigentlich noch gar<br />
nicht vom spezifisch thomasischen Naturrecht, solange man<br />
nur die ewig gelten<strong>de</strong>n Normen menschlichen Zusammenseins<br />
meint. Und <strong>de</strong>r Kampf mit <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong>spositivismus wird von<br />
seiten <strong>de</strong>r Scholastiker mit papiernen Waffen ausgefochten,<br />
solange sie einzig auf absolute Sittennormen für die Menschen<br />
pochen, aber nicht beweisen, daß diese Sittennormen zugleich<br />
auch <strong>Recht</strong>snormen im Sinne <strong>de</strong>r Organisation <strong>de</strong>s äußeren<br />
Lebens <strong>de</strong>r Menschen untereinan<strong>de</strong>r sind, <strong>und</strong> dazu <strong>Recht</strong>snor<br />
men, die nicht nur ewig gelten, son<strong>de</strong>rn vor allem hier <strong>und</strong> jetzt<br />
in dieser genau bestimmten Form.<br />
Die <strong>Recht</strong>spositivisten haben darum immer <strong>de</strong>n Finger auf<br />
<strong>de</strong>n w<strong>und</strong>en Punkt <strong>de</strong>r Naturrechtslehre vieler Scholastiker<br />
gelegt, in<strong>de</strong>m sie Antwort verlangten auf die Frage: Auf wel-<br />
1 Thomas setzt allerdings in diesem Traktat die allgemeine Lehre vom Naturrecht<br />
voraus, die er in I—II 94-97 dargestellt hat. Ich habe vor, diesen Traktat<br />
<strong>de</strong>r Summa in einem eigenen Band zu veröffentlichen, da gera<strong>de</strong> dieser Teil im<br />
Kommentar <strong>de</strong>s bereits erschienenen Ban<strong>de</strong>s 13 <strong>de</strong>r Deutschen Thomasausgabe<br />
spärlich behan<strong>de</strong>lt wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Auf die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Zinslehre <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsmoral <strong>de</strong>s hl. Thomas, die<br />
bei<strong>de</strong> in diesem Band zu Wort kommen, kann ich in dieser Einleitung nicht<br />
näher eingehen. Ich verweise auf <strong>de</strong>n Kommentar. Daß Thomas das Gewinnmotiv<br />
ablehnt, darf nicht überraschen. Wenn die Börsenspekulation (beson<strong>de</strong>rs<br />
auf <strong>de</strong>m Geldmarkt) keine sozialwirtschaftliche Funktion mehr ausübt,<br />
also einzig durch das individualistische Gewinnmotiv begrün<strong>de</strong>t ist, dann gilt<br />
das Verdikt, mit <strong>de</strong>m Thomas das Gewinnmotiv belegt, auch heute noch.<br />
XX
chem rechtslogischen Wege gelangt <strong>de</strong>r Mensch zu <strong>de</strong>m im kon<br />
kreten Leben gelten<strong>de</strong>n Naturrecht, nicht also nur zu irgend<br />
welchen Naturrechtsnormen, son<strong>de</strong>rn zu einem hier <strong>und</strong> jetzt<br />
gelten<strong>de</strong>n natürlichen <strong>Recht</strong>? Wo ist das Organ, welches rechts<br />
erzeugend die ewigen Normen in konkret gelten<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong><br />
umformt? Den <strong>Recht</strong>spositivisten von heute geht es eigentlich<br />
nicht um die Leugnung ewiger Gewissensnormen, die unser<br />
Gemeinschaftsleben regeln sollen. Die mo<strong>de</strong>rne Soziologie<br />
beweist zur Genüge, daß das <strong>Recht</strong>liche bei weitem nicht die<br />
einzige Kategorie ist, welche das gesellschaftliche Leben ordnet.<br />
Und alle Juristen sind sich darüber im klaren, daß isoliertes<br />
<strong>Recht</strong> die Gesellschaft nicht erhält, son<strong>de</strong>rn ertötet, gemäß <strong>de</strong>m<br />
angeblichen Ausspruch Ferdinands L: Fiat justitia, pereat<br />
m<strong>und</strong>us. Die absolute Notwendigkeit einer wenigstens einiger<br />
maßen standfesten Moral besagt aber noch nicht, daß die Moral<br />
schon eine <strong>Recht</strong>skategorie sei. Dem Mo<strong>de</strong>rnen will es nicht<br />
einleuchten, daß man hier das Gewissen in <strong>de</strong>n rechtslogischen<br />
Prozeß, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Normen zum gelten<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong> führt, ein<br />
schalten könne, zumal die Soziologie nachzuweisen glaubt, daß<br />
das Gewissen <strong>de</strong>r Menschen keine einheitliche Struktur besitze.<br />
W. Friedmann macht in seinem Buch „An introduction to world<br />
politics" (London 1951) die Feststellung, daß dasselbe Indivi<br />
duum im politischen Raum mit einem ganz an<strong>de</strong>ren Gewissen<br />
urteile, als es im persönlichen Leben zu tun gewohnt sei. Der<br />
duldsamste <strong>und</strong> nachsichtigste Privatmann kann als Politiker in<br />
<strong>de</strong>r Verteidigung seiner nationalen Interessen über Menschen<br />
leben, über ganze Nationen hinwegschreiten! Mit wieviel spöt<br />
tischer Verachtung spricht nicht oft <strong>de</strong>r Christ von <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rn<br />
Nation, während er sich sonst im persönlichen Leben um die<br />
christliche Nächstenliebe zu bemühen glaubt! Und was Fried<br />
mann vom Politiker auf internationaler Plattform sagt, das gilt<br />
entsprechend auch im nationalen Raum, hier allerdings oft in<br />
umgekehrtem Verhältnis: Das Gewissen <strong>de</strong>s einzelnen Men<br />
schen schreckt meistens noch vor öffentlichen sittlichen Ver<br />
brechen zurück, während es im geheimen Winkel <strong>de</strong>s privaten<br />
Lebens zu ähnlichen Untaten schon längst fähig <strong>und</strong> gewillt ist.<br />
Bei dieser Sachlage scheint es also unmöglich, das Gewissen<br />
als Richter über die rechtlich zu formulieren<strong>de</strong> Moral anzu<br />
rufen. Mit an<strong>de</strong>ren Worten: es fehlt an <strong>de</strong>r rechtserzeugen<strong>de</strong>n<br />
Kraft, welche die ewigen Normen menschlichen Han<strong>de</strong>lns <strong>und</strong><br />
menschlichen Zusammenseins in Form eines naturhaften Pro-<br />
XXI
zesses - <strong>de</strong>nn dies wäre für ein wirkliches Naturrecht unum<br />
gänglich - auf die jeweilige Gegenwart anwen<strong>de</strong>t. Solange es<br />
nicht möglich ist, diesen natürlichen Prozeß bis ins konkrete<br />
<strong>Recht</strong> hinein durchzuführen, verbleiben die Naturrechtsfor<strong>de</strong><br />
rungen am Himmel <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>en, die höchstens für eine <strong>Recht</strong>s<br />
politik, nicht aber für eine eigentliche <strong>Recht</strong>serzeugung in Frage<br />
kommen. In <strong>de</strong>r Ungewißheit, auf diese ernste Frage <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>spositivismus eine stichhaltige Antwort zu geben, haben<br />
sich eben die Scholastiker allzuoft mit <strong>de</strong>r unermüdlichen Wie<br />
<strong>de</strong>rholung <strong>de</strong>r ewigen Gültigkeit <strong>de</strong>s Naturrechts begnügt,<br />
ohne zu beweisen, daß dieses <strong>Recht</strong> gera<strong>de</strong> in diesem Augen<br />
blick <strong>und</strong> in dieser Situation nur in einmaliger Weise gelten<br />
kann.<br />
Hier ist eine ernste Besinnung auf die Naturrechtslehre <strong>de</strong>s<br />
hl. Thomas gefor<strong>de</strong>rt, wie er sie wirklich vorgetragen hat, <strong>und</strong><br />
nicht, wie sie als in seinem vermeintlichen „Geiste" von einigen<br />
Erklärern neueren <strong>und</strong> älteren Datums dargestellt wird. Diese<br />
genuin thomasische Naturrechtsauffassung ist sehr wohl<br />
imstan<strong>de</strong>, <strong>de</strong>n soziologischen Bef<strong>und</strong> einer Zeit mitaufzu<br />
nehmen in die konkrete Formulierung eines wirklichen Natur<br />
rechts, nicht bloß eines an <strong>de</strong>n ewigen natürlichen Sittennor<br />
men gemessenen positiven <strong>Recht</strong>s. Thomas vermag dies, weil<br />
er erstens das <strong>Recht</strong> - auch das Naturrecht - wirklich als einen<br />
konkreten Inhalt erkennt <strong>und</strong> weil es ihm zweitens gelungen<br />
ist, das Gewissen trotz aller menschlichen Deka<strong>de</strong>nz <strong>und</strong><br />
Gewissensmißbildung im rechtslogischen Prozeß <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>s<br />
erzeugung zu retten. Nach Thomas bedarf beispielsweise <strong>de</strong>r<br />
Katalog <strong>de</strong>r Menschenrechte <strong>de</strong>r UNO zur konkreten Gültig<br />
keit nicht unbedingt <strong>de</strong>r positiven Anerkennung durch die<br />
jeweiligen Verfassungen <strong>de</strong>r einzelnen Nationen (unter <strong>de</strong>r Vor<br />
aussetzung, daß diese Menschenrechte <strong>de</strong>m eigentlichen<br />
Naturrecht entsprechen wür<strong>de</strong>n). Damit ist dann zugleich die<br />
Frage eines Kriegsverbrecherprozesses gelöst, mit <strong>de</strong>r sich <strong>de</strong>r<br />
Thomaskommentar Victoria ausdrücklich auseinan<strong>de</strong>rsetzt 2 .<br />
Weitere Ausführungen über diese Probleme können wir uns mit<br />
<strong>de</strong>m Hinweis auf <strong>de</strong>n Kommentar zu Fr. 57 ersparen.<br />
2 Vgl. die ausgezeichnete Einleitung von PaulHadrossek zu: Francisco <strong>de</strong> Victoria,<br />
De Indis recenter inventis et <strong>de</strong> jure belli Hispanorum in Barbaras relectiones.<br />
Zur Deutung <strong>de</strong>r Völkerrechtslehre Victorias durch Paul Hadrossek<br />
vergleiche meine Besprechung in: Politeia 4 (1952) 226-228.<br />
XXII
2. In <strong>de</strong>r Eigentumsfrage sind wir heute durchweg <strong>de</strong>r<br />
selbstverständlich scheinen<strong>de</strong>n Anschauung, daß die Begrün<br />
dung <strong>de</strong>s Eigentumsrechts <strong>de</strong>s einzelnen Menschen in erster<br />
Linie auf <strong>de</strong>m individual-personalen Charakter <strong>de</strong>s Menschen<br />
beruhe, so daß man von einem unabän<strong>de</strong>rlichen „Naturrecht"<br />
<strong>de</strong>s Einzelmenschen auf „sein" Eigentum re<strong>de</strong>t. Wenngleich<br />
sich auch aus <strong>de</strong>r thomasischen Eigentumslehre diese Schluß-<br />
folgerung bei folgerichtigem Weiter<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r Naturrechtsauf<br />
fassung <strong>de</strong>s hl. Thomas ergibt, so hätte Thomas selbst diese<br />
Schlußfolgerung niemals von vornherein als philosophischen<br />
Gr<strong>und</strong>satz aufgestellt. Für ihn ergibt sich die Legitimierung <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s auf Privateigentum aus <strong>de</strong>m Gemeinwohl, ganz im Ein<br />
klang mit <strong>de</strong>r gesamten christlichen Tradition. Mit dieser An<br />
schauung ist er, <strong>de</strong>r „Aristoteliker", <strong>de</strong>r auch in diesem Punkte<br />
beinahe alle Einzelheiten seinem philosophischen Lehrmeister<br />
verdankt, eben doch nicht Aristoteliker, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r<br />
christlichen Uberlieferung gebil<strong>de</strong>te Theologe. Dies hervorzu<br />
heben dürfte beson<strong>de</strong>rs wichtig sein, weil man gemeiniglich die<br />
Abhängigkeit <strong>de</strong>s hl. Thomas von Aristoteles allzusehr über<br />
treibt. Der Geist <strong>und</strong> die Gr<strong>und</strong>auffassung <strong>de</strong>r thomasischen<br />
Eigentumslehre ist durchaus altchristlich, nicht aristotelisch.<br />
Ganz im Gegensatz hierzu haben die christlichen Liberalisten<br />
<strong>de</strong>n aristotelischen Gedanken von einem apriorischen „Natur<br />
recht" auf Privateigentum - nicht zwar als Gefolgsmänner <strong>de</strong>s<br />
Stagyriten, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Individualismus <strong>de</strong>s 19. Jahrh<strong>und</strong>erts -<br />
allzu leichtfertig <strong>und</strong> ohne Rückbesinnung auf <strong>de</strong>n eigentlich<br />
christlich-logischen Weg, <strong>de</strong>r in Wahrheit zu dieser Schlußfolge<br />
rung führen kann, das „Naturrecht" auf Privateigentum zur un<br />
umstößlichen Devise <strong>de</strong>r Wirtschaftsethik gemacht. Die Kor<br />
rektur wur<strong>de</strong> durch die päpstlichen Verlautbarungen vor<br />
genommen. Mit <strong>de</strong>r logischen Weichenstellung, die Thomas in<br />
diesem gesamten Fragenkomplex vorgenommen hat, stehen<br />
unsere wirtschaftsethischen Diskussionen über freie <strong>und</strong><br />
geb<strong>und</strong>ene Wirtschaft, über privatkapitalistische Wirtschafts<br />
weise in einem ganz neuen Zusammenhang. Im Hinblick auf<br />
die Be<strong>de</strong>utung einer solchen Wie<strong>de</strong>rent<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>s altchrist<br />
lichen Gedankengutes bei Thomas - gegenüber einem Großteil<br />
bisheriger Kommentare - wird man es <strong>de</strong>m Kommentator nicht<br />
verübeln, wenn er in <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>m Eigentumsrecht (Fr. 66<br />
Art. 1 u. 2) die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Texte <strong>de</strong>r Kirchenväter so aus<br />
führlich anführt. Die Texte sind vielleicht altbekannt, ihre Ver-<br />
XXIII
wertung bei <strong>de</strong>m „Aristoteliker" Thomas aber ist lei<strong>de</strong>r zu un<br />
bekannt.<br />
Der Leser einer Summa theologica wird natürlich mit <strong>Recht</strong><br />
nach <strong>de</strong>m theologischen Gehalt dieses Traktates über <strong>Recht</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> fragen. In <strong>de</strong>r Tat ist die innere Struktur<br />
dieses Traktates zunächst rein natürlich, da die natürliche Sach<br />
lage das <strong>Recht</strong> bestimmt. Die Ordnung in <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Gemeinschaft wird, wie auch die päpstlichen Verlautbarungen<br />
immer wie<strong>de</strong>r betonen, durch das <strong>Recht</strong> erstellt. Wenigstens<br />
schwebt <strong>de</strong>m vernünftig Ordnen<strong>de</strong>n zunächst ein gedankliches<br />
Mo<strong>de</strong>ll einer Ordnung gemäß <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> vor. Es ist<br />
gera<strong>de</strong> ein verdienstvolles Kennzeichen <strong>de</strong>r Denkweise <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas, die Ordnungen nicht zu verwischen. Nirgendwo fin<br />
<strong>de</strong>t sich bei ihm auch nur ein Anflug von einem utopischen<br />
Gedanken an eine I<strong>de</strong>algemeinschaft unter Menschen auf<br />
Er<strong>de</strong>n, die einzig durch <strong>de</strong>n spontanen Impuls <strong>de</strong>r Liebe ein<br />
gerichtet wer<strong>de</strong>n könnte. Da aber das <strong>Recht</strong> für eine Gesell<br />
schaft gilt, <strong>de</strong>ren Einheits- <strong>und</strong> Lebensprinzip die in Gott ver<br />
ankerte Ethik ist, darum eben öffnet sich für die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
die Sicht ins typisch Theologische. Zu wie<strong>de</strong>rholten Malen<br />
erklärt Thomas, daß mit <strong>de</strong>r Bedrohung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> die<br />
christliche Existenz überhaupt bedroht ist. Nichts an<strong>de</strong>res als<br />
die Liebe hält das menschliche Auge für das <strong>Recht</strong>e <strong>und</strong> Billige<br />
wach. Die göttliche Liebe ist es, die <strong>de</strong>m Menschen die Verant<br />
wortung gegenüber <strong>de</strong>r gerechten Ordnung einschärft.<br />
Pius XII. hat diesen christlichen Gehalt <strong>de</strong>r Lehre von <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> in seiner Osteransprache vom 9. April 1939 in die<br />
Worte gefaßt: „Freilich ist es das Anliegen <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>,<br />
die Normen jener Weltordnung, die erstes <strong>und</strong> hauptsächliches<br />
F<strong>und</strong>ament eines festgefügten Frie<strong>de</strong>ns ist, aufzustellen <strong>und</strong><br />
unversehrt zu bewahren. Doch kann diese allein die schwie<br />
rigen Hin<strong>de</strong>rnisse nicht überwin<strong>de</strong>n, die oft genug <strong>de</strong>r Verwirk<br />
lichung <strong>und</strong> Festigung <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns sich entgegenstellen.<br />
Wenn sich darum zur starr <strong>und</strong> scharf abgegrenzten Gerechtig<br />
keit nicht die Liebe zu brü<strong>de</strong>rlichem B<strong>und</strong>e gesellt, dann wird<br />
allzu leicht das geistige Auge vor Dunkelheit die <strong>Recht</strong>e <strong>de</strong>s<br />
an<strong>de</strong>rn nicht mehr sehen können, das Ohr wird taub gegenüber<br />
<strong>de</strong>r Stimme jener Billigkeit, die, wenn sie mit willigem <strong>und</strong> ver<br />
ständigem Bemühen untersucht wird, auch die verworrensten<br />
<strong>und</strong> schwierigsten Streitfälle in vernünftiger Ordnung lösen<br />
XXIV
<strong>und</strong> beschwichtigen kann." (Utz-Groner, Soziale Summe<br />
Pius XII., Nr. 3641).<br />
Der vorliegen<strong>de</strong> Band will keine Patentlösung für die darin<br />
behan<strong>de</strong>lten Fragen bieten. Dem Leser könnte kein größeres<br />
MißVerständnis <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sphilosophie <strong>de</strong>s hl. Thomas unter<br />
laufen. Wohl aber wird je<strong>de</strong>r eifrig Studieren<strong>de</strong> sich eine sichere<br />
geistige Haltung aneignen können, die ihn instandsetzt, im<br />
echten Geiste <strong>de</strong>s hl. Thomas <strong>de</strong>n Weg zu einer konkreten<br />
Lösung <strong>de</strong>r brennen<strong>de</strong>n Gegenwartsfragen unserer aufgewühl<br />
ten Gesellschaft zu fin<strong>de</strong>n.<br />
A. F. Utz<br />
XXV
DER AUFBAU DER ARTIKEL<br />
1. Die Titelfrage zum Artikel stammt nicht von Thomas<br />
selbst, son<strong>de</strong>rn ist <strong>de</strong>r Einleitung zum ersten Einwand ent<br />
nommen, mit <strong>de</strong>m je<strong>de</strong>r Artikel beginnt („Es scheint, daß<br />
nicht..." o<strong>de</strong>r „Es scheint, daß..."). In <strong>de</strong>r Ubersetzung ist<br />
diese Einleitung weggelassen, weil sie in <strong>de</strong>r Titelfrage zum<br />
Ausdruck kommt.<br />
2. Auf die Titelfrage folgen mehrere in <strong>de</strong>r Thomas-Literatur<br />
als „Einwän<strong>de</strong>" bezeichnete Argumente, welche die Unter<br />
suchung einleiten. In <strong>de</strong>r Übersetzung sind sie einfach mit<br />
Nummern versehen. Wenn auf solche Einwän<strong>de</strong> verwiesen<br />
wird, benützt die Übersetzung die Abkürzung E. (= Einwand).<br />
3. Im „Dagegen" (Sed contra) begrün<strong>de</strong>t Thomas die <strong>de</strong>n<br />
vorausgehen<strong>de</strong>n Einwän<strong>de</strong>n entgegengesetzte These mit einem<br />
o<strong>de</strong>r mehreren Autoritätsbeweisen, teilweise aus <strong>de</strong>r<br />
Hl. Schrift, teilweise aus Aristoteles <strong>und</strong> an<strong>de</strong>ren philosophi<br />
schen o<strong>de</strong>r theologischen Autoren.<br />
In <strong>de</strong>r „Antwort" (wörtlich: „Meines Erachtens ist zu<br />
sagen") entwickelt Thomas seine eigene Doktrin. Dieser Teil<br />
wird in <strong>de</strong>r Thomasliteratur als „corpus articuli" bezeichnet.<br />
4. Auf die „Antwort" folgen die Erwi<strong>de</strong>rungen auf die Ein<br />
wän<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>r Übersetzung wer<strong>de</strong>n sie durch „Zu 1", „Zu 2",<br />
„Zu 3" usw. eingeleitet, entsprechend <strong>de</strong>m Lateinischen „Ad<br />
primum", „Ad sec<strong>und</strong>um", „Ad tertium" usw.<br />
XXVI
TEXT
57 FRAGE<br />
DAS RECHT<br />
Nach <strong>de</strong>r Klugheit ist nun die <strong>Gerechtigkeit</strong> zu behan<strong>de</strong>ln.<br />
Dabei kommt ein Vierfaches unter Betracht: 1. die Gerechtig<br />
keit, 2. ihre Teile, 3. die entsprechen<strong>de</strong> Gabe <strong>de</strong>s Heiligen Gei<br />
stes, 4. die zur <strong>Gerechtigkeit</strong> gehören<strong>de</strong>n Gebote.<br />
Die <strong>Gerechtigkeit</strong> umfaßt vier Themen: 1. das <strong>Recht</strong>, 2. die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> als solche, 3. die Ungerechtigkeit, 4. das Urteil.<br />
Zum ersten Punkt stellen sich vier Fragen:<br />
1. Ist das <strong>Recht</strong> das Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
2. Wird das <strong>Recht</strong> zutreffend in Naturrecht <strong>und</strong> positives<br />
<strong>Recht</strong> eingeteilt?<br />
3. Sind Völkerrecht <strong>und</strong> Naturrecht dasselbe?<br />
4. Muß das <strong>Recht</strong> noch beson<strong>de</strong>rs in herrschaftliches <strong>und</strong><br />
väterliches <strong>Recht</strong> unterschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist das <strong>Recht</strong> das Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
1. Der <strong>Recht</strong>sgelehrte Celsus sagt: „Das <strong>Recht</strong> ist die Kunst<br />
<strong>de</strong>s Guten <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>en" (Dig.1,1; KR I,29a). Die Kunst ist<br />
aber nicht Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, son<strong>de</strong>rn meint an sich<br />
intellektuelles Können. Also ist das <strong>Recht</strong> nicht Objekt <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
2. Nach Isidors Etymologie (V, 3; ML 82,199) ist das Gesetz<br />
„eine Art <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s". Das Gesetz ist aber nicht das Objekt <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, son<strong>de</strong>rn mehr <strong>de</strong>r Klugheit. Daher führt Aristo<br />
teles (Eth.VI,8; 1141 b25) die Gesetzgebung auch als Teil <strong>de</strong>r<br />
Klugheit an. Also ist das <strong>Recht</strong> nicht Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
3. Vor allem ist es die <strong>Gerechtigkeit</strong>, die <strong>de</strong>n Menschen<br />
Gott unterwirft. Augustinus sagt nämlich im Buch De moribus<br />
ecclesiae (c. 15; ML 32,1322): „Die Liebe, die Gott allein dient,<br />
ist die <strong>Gerechtigkeit</strong>, <strong>und</strong> darum beherrscht sie vortrefflich auch<br />
alles, was <strong>de</strong>m Menschen unterworfen ist". Doch das <strong>Recht</strong><br />
gehört nicht zu <strong>de</strong>n göttlichen, son<strong>de</strong>rn nur zu <strong>de</strong>n mensch<br />
lichen Dingen, sagt doch Isidor (Etym.V, 2; ML 82,198): „Sitt<br />
lichkeit ist göttliches Gesetz, <strong>Recht</strong> aber ist menschliches<br />
Gesetz". Also ist das <strong>Recht</strong> nicht Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
3
DAGEGEN steht, daß Isidor ebendort (c.3; ML 82,199)<br />
schreibt: „Es heißt etwas ,<strong>Recht</strong>', weil es gerecht ist". Doch das<br />
Gerechte ist das Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Aristoteles sagt näm<br />
lich im V. Buch seiner Ethik (c. 1; 1129 a 7): „Alle wollen jenen<br />
Habitus ,<strong>Gerechtigkeit</strong>' nennen, durch <strong>de</strong>n sie gerechte Werke<br />
vollbringen". Also ist das <strong>Recht</strong> Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
ANTWORT. Im Unterschied zu an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n ist es<br />
eine beson<strong>de</strong>re Eigenart <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, <strong>de</strong>n sachbezogenen<br />
Umgang <strong>de</strong>s Menschen mit an<strong>de</strong>ren in eine Ordnung zu brin<br />
gen. Sie besagt nämlich, wie schon <strong>de</strong>r Name nahelegt, einen<br />
gewissen Ausgleich. In <strong>de</strong>r Umgangssprache heißt ja das, was<br />
ausgeglichen wird, „richtig"stellen. Ausgleich aber ist auf an<strong>de</strong><br />
res bezogen. Die übrigen Tugen<strong>de</strong>n hingegen vervollkommnen<br />
<strong>de</strong>n Menschen nur in Bezug auf ihn selbst. Was bei diesen<br />
Tugen<strong>de</strong>n das Richtige ist - worauf die Tugend als auf ihr<br />
wesenseigenes Objekt hinzielt -, versteht sich nur im Hinblick<br />
auf <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n. Das „Richtige" jedoch im Werk <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> ergibt sich - abgesehen von <strong>de</strong>r subjektiven Sicht<br />
auf <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n - durch die Beziehung zu etwas an<strong>de</strong>rem.<br />
Was nämlich in unserem Tun als gerecht bezeichnet wird,<br />
berührt in Form irgen<strong>de</strong>ines Ausgleichs einen an<strong>de</strong>ren, z.B. die<br />
Bezahlung <strong>de</strong>s geschul<strong>de</strong>ten Lohnes für eine Dienstleistung.<br />
So heißt nun also etwas „gerecht", das sich durch die <strong>Recht</strong><br />
heit <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, worin die gerechte Handlung besteht,<br />
auszeichnet. Auf welche Weise dies vom Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n zustan<strong>de</strong><br />
gebracht wird, bleibt dabei außer Betracht. Das <strong>Recht</strong>e bei <strong>de</strong>n<br />
an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n hingegen wird nicht unabhängig von <strong>de</strong>m<br />
bestimmt, was <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong> irgendwie tut. Deshalb wird <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> im Gegensatz zu <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n als<br />
eigentliches Objekt das zugewiesen, was wir das „<strong>Recht</strong>e"<br />
nennen. Und das ist das <strong>Recht</strong>. Somit wird klar, daß das <strong>Recht</strong><br />
Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ist.<br />
Zu 1. Es ist ganz geläufig, daß die Namen von <strong>de</strong>m, was sie<br />
ursprünglich bezeichneten, auf an<strong>de</strong>res übertragen wer<strong>de</strong>n. So<br />
wird das Wort „Medizin" zunächst zur Bezeichnung <strong>de</strong>s Heil<br />
mittels für <strong>de</strong>n Kranken, <strong>de</strong>r geheilt wer<strong>de</strong>n soll, gebraucht,<br />
dann jedoch wur<strong>de</strong> es auf die Kunst angewandt, durch die das<br />
geschieht. Ebenso wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Namen „<strong>Recht</strong>" zunächst die<br />
rechte Sache belegt, sodann übertrug man ihn auf die Kunst,<br />
mittels <strong>de</strong>rer das <strong>Recht</strong>e erkannt wird, außer<strong>de</strong>m zur Kenn<br />
zeichnung <strong>de</strong>s Ortes, wo <strong>Recht</strong> gesprochen wird, wie wenn<br />
4
man sagt, es müsse jemand vor „<strong>de</strong>m <strong>Recht</strong>" (d. h. vor Gericht) 57. 2<br />
erscheinen, <strong>und</strong> schließlich heißt auch das noch „<strong>Recht</strong>", was<br />
vom amtlichen <strong>Recht</strong>spfleger gesprochen wird, selbst wenn<br />
seine Entscheidung ungerecht ist.<br />
Zu 2. Wie das sichtbare Kunstwerk zuerst als künstlerische<br />
Leiti<strong>de</strong>e im Geist <strong>de</strong>s Künstlers vorhan<strong>de</strong>n ist, so ist auch vom<br />
Werk <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> das, was von <strong>de</strong>r Vernunft bestimmt<br />
wird, zuvor im Geist als eine I<strong>de</strong>e vorhan<strong>de</strong>n, gleichsam als<br />
Richtschnur <strong>de</strong>r Klugheit. Wenn dies dann schriftlich festgelegt<br />
wird, spricht man von „Gesetz". Nach Isidor (Etym.V, 3;<br />
ML 82,199) be<strong>de</strong>utet nämlich Gesetz soviel wie „geschriebene<br />
Ordnung". Somit ist, genau gesagt, „Gesetz" nicht das gleiche<br />
wie „<strong>Recht</strong>", son<strong>de</strong>rn die Ursache <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s [1].<br />
Zu 3. Weil <strong>Gerechtigkeit</strong> Ausgleich be<strong>de</strong>utet, wir aber Gott<br />
nichts Gleichwertiges anbieten können, vermögen wir ihm<br />
gegenüber auch nicht vollen <strong>Recht</strong>sausgleich zu schaffen. Des<br />
halb heißt das göttliche Gesetz im eigentlichen Sinn auch nicht<br />
einfach „<strong>Recht</strong>", son<strong>de</strong>rn eben „Göttliches <strong>Recht</strong>" („fas"), <strong>de</strong>nn<br />
Gott ist zufrie<strong>de</strong>n, wenn wir tun, was wir können. Dennoch<br />
strebt die <strong>Gerechtigkeit</strong> dahin, daß <strong>de</strong>r Mensch Gott soviel<br />
zurückerstattet, als er vermag, <strong>und</strong> dies geschieht dadurch, daß<br />
er sich ihm völlig unterwirft.<br />
2. ARTIKEL<br />
"Wird das <strong>Recht</strong> zutreffend in Naturrecht <strong>und</strong> positives<br />
<strong>Recht</strong> eingeteilt?<br />
1. Was naturhaft ist, ist unverän<strong>de</strong>rlich <strong>und</strong> bei allen gleich.<br />
So etwas fin<strong>de</strong>t man jedoch unter menschlichen Verhältnissen<br />
nicht, <strong>de</strong>nn alle menschlichen <strong>Recht</strong>sregeln versagen einmal da<br />
o<strong>de</strong>r dort <strong>und</strong> setzen sich nicht überall durch. Also gibt es kein<br />
Naturrecht.<br />
2. Was vom menschlichen Willen festgesetzt wird, heißt<br />
„positiv". Doch was vom Willen <strong>de</strong>s Menschen festgesetzt wird,<br />
ist <strong>de</strong>swegen nicht auch schon gerecht, sonst könnte <strong>de</strong>r Wille<br />
<strong>de</strong>s Menschen ja nie ungerecht sein. Da nun das Gerechte soviel<br />
ist wie <strong>Recht</strong>, gibt es also kein positives <strong>Recht</strong>.<br />
3. Göttliches <strong>Recht</strong> ist nicht gleich Naturrecht, da es über<br />
<strong>de</strong>r menschlichen Natur liegt. Es ist aber auch kein positives<br />
<strong>Recht</strong>, weil es sich nicht auf menschliche, son<strong>de</strong>rn auf göttliche<br />
5
57. 2 Autorität stützt. Also ist die Einteilung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s in natür<br />
liches <strong>und</strong> positives unangebracht.<br />
DAGEGEN steht das Aristoteleswort (Eth. V, 10; 1134bl8):<br />
„Für <strong>de</strong>n gerechten Staatsmann ist das eine (<strong>Recht</strong>) natürlich,<br />
das an<strong>de</strong>re gesetzlich", d. h. durch Gesetz festgelegt.<br />
ANTWORT. Wie oben (Art. 1) gesagt, ist das <strong>Recht</strong> o<strong>de</strong>r das<br />
<strong>Recht</strong>e eine angemessene Leistung zugunsten eines an<strong>de</strong>ren<br />
gemäß einem Modus <strong>de</strong>s Ausgleichs. Auf zweifache Weise nun<br />
kann einem Menschen etwas angemesen sein. Einmal aufgr<strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Sache, wie wenn z. B. jemand soviel gibt, um genau soviel<br />
zu erhalten. In diesem Fall spricht man von Naturrecht. - Auf<br />
an<strong>de</strong>re Weise ist etwas angemessen aufgr<strong>und</strong> einer Abmachung<br />
o<strong>de</strong>r allgemeinen Ubereinkunft, wie wenn sich jemand zufrie<br />
<strong>de</strong>n gibt bei so<strong>und</strong>soviel Gegenleistung. Auch dies kann auf<br />
doppelte Weise geschehen: einmal aufgr<strong>und</strong> einer privaten Ver<br />
einbarung, wie sie durch einen Vertrag zwischen privaten Per<br />
sonen abgeschlossen wird. Ein an<strong>de</strong>res Mal gemäß einer öffent<br />
lichen Ubereinkunft, z. B. wenn ein ganzes Volk zustimmt, daß<br />
etwas mit einem an<strong>de</strong>ren als verglichen o<strong>de</strong>r angemessen gelten<br />
soll, o<strong>de</strong>r wenn <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sherr, <strong>de</strong>m die Sorge für das Volk<br />
obliegt <strong>und</strong> <strong>de</strong>r es in seiner Person vertritt, dies anordnet. Dann<br />
ist von positivem <strong>Recht</strong> die Re<strong>de</strong>.<br />
Zu 1. Das Naturhafte, das einem Wesen mit unverän<strong>de</strong>r<br />
licher Natur eigen ist, muß sich immer <strong>und</strong> überall gleich<br />
bleiben. Die Natur <strong>de</strong>s Menschen aber ist verän<strong>de</strong>rlich. Darum<br />
kann das Natürliche <strong>de</strong>s Menschen bisweilen versagen. Z. B.<br />
entspricht es <strong>de</strong>m naturgemäßen Ausgleich, daß <strong>de</strong>m Hinter<br />
leger das Hinterlegte zurückgegeben wer<strong>de</strong>, <strong>und</strong> wenn die<br />
menschliche Natur stets „recht" wäre, müßte man sich immer<br />
daran halten. Weil jedoch <strong>de</strong>r menschliche Wille bisweilen ver<br />
<strong>de</strong>rbt ist, kommt es vor, daß man das Hinterlegte nicht zurück<br />
geben darf, damit ein Mensch mit verwerflicher Absicht nicht<br />
schlechten Gebrauch davon macht, wie z. B. wenn ein Geistes<br />
gestörter o<strong>de</strong>r ein Staatsfeind seine hinterlegten Waffen zurück<br />
for<strong>de</strong>rn wollte [2].<br />
Zu 2. Der Mensch mit seinem freien Willen kann aufgr<strong>und</strong><br />
allgemeiner Abmachung in Dingen, die keinen Wi<strong>de</strong>rspruch zur<br />
natürlichen <strong>Gerechtigkeit</strong> besagen, etwas als gerecht bestim<br />
men. Und hier nun fin<strong>de</strong>t das positive <strong>Recht</strong> sein Betätigungs<br />
feld. Daher sagt Aristoteles im V.Buch seiner Ethik (c. 10;<br />
1134 b 20): „Das gesetzlich Gerechte ist das, was gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
6
an<strong>de</strong>rs sein kann. Ist es aber einmal festgelegt, dann hat es einen 57 3<br />
Unterschied zur Folge". Steht jedoch etwas zum Naturrecht im<br />
Wi<strong>de</strong>rspruch, dann kann es durch menschlichen Willensent<br />
scheid nicht als gerecht erklärt wer<strong>de</strong>n, wie z. B. wenn fest<br />
gesetzt wür<strong>de</strong>, daß Diebstahl o<strong>de</strong>r Ehebruch erlaubt seien.<br />
Daher heißt es bei Isaias 10,1: „Weh <strong>de</strong>nen, die unheilvolle<br />
Gesetze erlassen!"<br />
Zu 3. Jenes <strong>Recht</strong> heißt „göttlich", das durch Gott k<strong>und</strong><br />
getan wird. Es bezieht sich teilweise auf das naturhaft Gerechte<br />
- seine <strong>Gerechtigkeit</strong> bleibt <strong>de</strong>m Menschen jedoch verborgen -,<br />
teilweise auf das, was durch göttliche Verfügung gerecht wird.<br />
Daher kann, wie das menschliche <strong>Recht</strong>, auch das göttliche<br />
nach diesen zwei Gesichtspunkten unterschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
Denn auch im göttlichen Gesetz gibt es manches, das geboten<br />
wird, weil es in sich gut, <strong>und</strong> manches, das verboten wird, weil<br />
es in sich schlecht ist, wie auch etwas, das nur gut ist, weil es<br />
geboten, <strong>und</strong> nur schlecht, weil es verboten wird [3].<br />
3. ARTIKEL<br />
Ist das Völkerrecht [4] das gleiche wie das Naturrecht?<br />
1. Die Menschen kommen nur in <strong>de</strong>m überein, was ihnen<br />
naturhaft innewohnt. Doch im Völkerrecht kommen alle<br />
Menschen überein, sagt doch <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sgelehrte (Dig. 1,1;<br />
KR 1,29 a): „Völkerrecht ist, was bei <strong>de</strong>n Völkern <strong>de</strong>r Menschen<br />
in Gebrauch steht". Also ist das Völkerrecht das gleiche wie das<br />
Naturrecht.<br />
2. Sklaverei ist unter <strong>de</strong>n Menschen etwas Naturgegebenes,<br />
sagt doch Aristoteles im I.Buch seiner Politik (c.4; 1254a 15):<br />
„Manche sind von Natur aus Sklaven". Nach Isidor (Etym.V, 6;<br />
ML 82,199) nun gehört die Sklaverei zum Völkerrecht. Also<br />
sind Völkerrecht <strong>und</strong> Naturrecht dasselbe.<br />
3. Das <strong>Recht</strong> wird, wie oben ausgeführt, in natürliches <strong>und</strong><br />
positives <strong>Recht</strong> eingeteilt. Doch das Völkerrecht ist kein posi<br />
tives, <strong>de</strong>nn niemals sind alle Völker übereingekommen, um auf<br />
gr<strong>und</strong> gemeinsamer Abmachung etwas festzulegen. Also ist das<br />
Völkerrecht Naturrecht.<br />
DAGEGEN steht IsidorsWort (Etym.V, 6; ML 82,199): „Das<br />
<strong>Recht</strong> ist entwe<strong>de</strong>r ein natürliches o<strong>de</strong>r ein bürgerliches o<strong>de</strong>r<br />
7
57 3 Völkerrecht" - Und so wird das Völkerrecht vom Naturrecht<br />
unterschie<strong>de</strong>n.<br />
ANTWORT. Das <strong>Recht</strong> o<strong>de</strong>r das naturhaft Gerechte ist<br />
jenes, das aufgr<strong>und</strong> seiner Natur einem an<strong>de</strong>ren angeglichen o<strong>de</strong>r<br />
angemessen ist (vgl.o. Art. 2). Dies kann auf zweifache Weise<br />
<strong>de</strong>r Fall sein. Einmal unter seinem absoluten Betracht so wie<br />
z.B. <strong>de</strong>m Männlichen eine naturhafte Hinordnung auf das Weib<br />
liche zum Zweck <strong>de</strong>r Zeugung eigen ist <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Mutter auf das<br />
Kind zum Zweck <strong>de</strong>s Nährens. Auf an<strong>de</strong>re Weise ist etwas <strong>de</strong>m<br />
an<strong>de</strong>ren angemessen nicht aufgr<strong>und</strong> absolut gültigen Verhält<br />
nisses, son<strong>de</strong>rn aufgr<strong>und</strong> von etwas, das sich aus diesem ergibt,<br />
z. B. die Eigenart <strong>de</strong>r Besitzaufteilung. Betrachtet man etwa<br />
diesen Acker absolut, dann spielt es keine Rolle, ob er diesem<br />
o<strong>de</strong>r jenem gehört. Faßt man ihn jedoch unter <strong>de</strong>m Gesichts<br />
punkt <strong>de</strong>r vorteilhaften Bearbeitung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r friedlichen Nut<br />
zung ins Auge, dann zeigt sich eine gewisse Angemessenheit<br />
dafür, daß er diesem <strong>und</strong> nicht jenem gehöre (Aristoteles<br />
Pol.II,5; 1262a21) [5].<br />
Etwas absolut erfassen ist nicht nur <strong>de</strong>m Menschen, son<strong>de</strong>rn<br />
auch an<strong>de</strong>ren Sinnenwesen eigen. Darum ist das <strong>Recht</strong>, das<br />
„natürliches" im ersten Sinne meint, uns <strong>und</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren<br />
Sinnenwesen gemeinsam. „Von einem so verstan<strong>de</strong>nen Natur<br />
recht weicht das Völkerrecht ab", wie <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sgelehrte<br />
(Dig. 1,1; KR 1,29 a) sagt, „weil jenes allen Sinnenwesen, dieses<br />
jedoch nur <strong>de</strong>n Menschen unter sich gemeinsam ist". Nur die<br />
Vernunft jedoch vermag etwas zu erfassen in seinem Verhältnis<br />
zu <strong>de</strong>m, was aus ihm folgt. Und <strong>de</strong>shalb ist das, was sie diktiert,<br />
für <strong>de</strong>n Menschen im Hinblick auf seine Vernunftnatur natür<br />
lich [6]. Der <strong>Recht</strong>sgelehrte Gaius sagt darum auch: „Was die<br />
natürliche Vernunft aller Menschen festlegt <strong>und</strong> was von allen<br />
Menschen beachtet wird, heißt Völkerrecht" (Dig. 1,1;<br />
KR 1,29 b).<br />
Zu 1. Die Antwort ergibt sich aus <strong>de</strong>m oben Gesagten.<br />
Zu 2. In sich betrachtet, besteht kein natürlicher Gr<strong>und</strong><br />
dafür, daß ein bestimmter Mensch eher Sklave sei als ein an<strong>de</strong><br />
rer, son<strong>de</strong>rn er ergibt sich nur aus einem gewissen Nützlich<br />
keitsstandpunkt, insofern es für <strong>de</strong>n einen vorteilhaft ist, von<br />
einem Klügeren gelenkt zu wer<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> für <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren, von<br />
jenem Hilfe zu erhalten (Aristoteles Pol. 1,6; 1255b 5). Darum<br />
ist die Sklaverei, die zum Völkerrecht gehört, natürlich nicht in<br />
seiner ersten, son<strong>de</strong>rn in seiner zweiten Be<strong>de</strong>utung.<br />
8
Zu 3. Weil die natürliche Vernunft möglichst übereinstim- 57. 4<br />
men<strong>de</strong>s als Völkerrecht erklärt, bedarf es keiner beson<strong>de</strong>ren<br />
Verfügung, son<strong>de</strong>rn die natürliche Vernunft selbst verfügt es,<br />
wie die oben angeführte Autorität bestätigt.<br />
4. ARTIKEL<br />
Müssen väterliches <strong>und</strong> herrschaftliches <strong>Recht</strong> beson<strong>de</strong>rs<br />
unterschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n?<br />
1. Zur <strong>Gerechtigkeit</strong> gehört es, „Je<strong>de</strong>m das Seine zu geben",<br />
wie Ambrosius in seiner Pflichtenlehre (1,24; ML 16,57)<br />
schreibt. Doch, wie gesagt, ist das <strong>Recht</strong> das Objekt <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit. Also gehört das <strong>Recht</strong> in gleicher Weise zu je<strong>de</strong>rmann,<br />
<strong>und</strong> so braucht man nicht im beson<strong>de</strong>ren zwischen väterlichem<br />
<strong>und</strong> herrschaftlichem <strong>Recht</strong> zu unterschei<strong>de</strong>n.<br />
2. Das <strong>Recht</strong> geht aus <strong>de</strong>m Gesetz hervor (Art. 1 Zu 2).<br />
Doch das Gesetz betrifft das Gemeinwohl <strong>de</strong>s Staates <strong>und</strong><br />
Reiches (1-1190,2), nicht aber das Privatwohl einer einzelnen<br />
Person o<strong>de</strong>r einer einzigen Familie. Deshalb darf es auch kein<br />
herrschaftliches o<strong>de</strong>r väterliches <strong>Recht</strong> o<strong>de</strong>r Gerechtes geben,<br />
da Herr <strong>und</strong> Vater zum selben Hauswesen gehören (Aristoteles<br />
Pol. 1,3; 1253 b 5).<br />
3. Es bestehen zahlreiche Gradunterschie<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n Men<br />
schen: die einen sind Soldaten, an<strong>de</strong>re Priester, wie<strong>de</strong>rum<br />
an<strong>de</strong>re Fürsten. Also muß auch für sie ein je verschie<strong>de</strong>nes<br />
<strong>Recht</strong> festgesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
DAGEGEN unterschei<strong>de</strong>t Aristoteles im V. Buch seiner Ethik<br />
(c. 10; 1134 b 8) vom bürgerlichen <strong>Recht</strong> ein herrschaftliches<br />
<strong>und</strong> ein väterliches <strong>und</strong> an<strong>de</strong>res <strong>de</strong>rgleichen.<br />
ANTWORT. Das <strong>Recht</strong> o<strong>de</strong>r das Gerechte wird in Beziehung<br />
auf etwas an<strong>de</strong>res ausgesagt. Dieses an<strong>de</strong>re kann nun zweifach<br />
sein. Einmal das schlechthin an<strong>de</strong>re <strong>und</strong> gänzlich unterschie<br />
<strong>de</strong>ne, wie es z. B. bei zwei Menschen <strong>de</strong>r Fall ist, von <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r<br />
eine <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren nicht untersteht, son<strong>de</strong>rn bei<strong>de</strong> einem ein<br />
zigen Lan<strong>de</strong>sfürsten untenan sind. Zwischen diesen besteht<br />
nach Aristoteles (Eth.V, 10; 1134 a26) das Verhältnis <strong>de</strong>s<br />
schlechthin Gerechten. - Sodann gibt es ein nicht schlechthin<br />
an<strong>de</strong>res, son<strong>de</strong>rn ein in seiner Existenz vom an<strong>de</strong>ren Abhän<br />
giges. Auf diese Weise ist unter <strong>de</strong>n Menschen <strong>de</strong>r Sohn „etwas<br />
vom Vater", gleichsam ein „Teil" von ihm, wie es bei Aristoteles<br />
9
57 4 (Eth.VIII, 14; 1161 b 18) heißt, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Sklave „etwas von<br />
seinem Herrn", weil er <strong>de</strong>ssen Werkzeug ist (Aristoteles Pol. 1,4;<br />
1253 b 32). Darum besteht zwischen <strong>de</strong>m Vater <strong>und</strong> seinem<br />
Sohn kein Verhältnis wie zu einem schlechthin an<strong>de</strong>ren <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>swegen auch keine <strong>Recht</strong>sbeziehung absoluter Art, son<strong>de</strong>rn<br />
nur ein relatives <strong>Recht</strong>, nämlich das väterliche. Aus <strong>de</strong>m glei<br />
chen Gr<strong>und</strong> ist dies auch nicht zwischen <strong>de</strong>m Herrn <strong>und</strong> seinem<br />
Sklaven <strong>de</strong>r Fall. Zwischen ihnen gilt das herrschaftliche <strong>Recht</strong>.<br />
Die Gattin hingegen unterschei<strong>de</strong>t sich von ihrem Mann<br />
mehr als <strong>de</strong>r Sohn vom Vater o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Sklave von seinem Herrn,<br />
obwohl sie „etwas von ihrem Mann" ist - <strong>de</strong>r Apostel betrachtet<br />
sie im Epheserbrief 5,28 wie zu <strong>de</strong>ssen eigenem Leib gehörig -,<br />
wird sie doch in das gemeinschaftliche Leben <strong>de</strong>r Ehe auf<br />
genommen. Daherbesteht nach Aristoteles (Eth.V, 10; 1134b 15)<br />
zwischen Mann <strong>und</strong> Frau ein strengeres <strong>Recht</strong>sverhältnis als<br />
wie zwischen Vater <strong>und</strong> Sohn o<strong>de</strong>r Herr <strong>und</strong> Sklave [7]. Weil<br />
jedoch Mann <strong>und</strong> Frau in <strong>de</strong>r häuslichen Gemeinschaft un<br />
mittelbar verb<strong>und</strong>en sind, gilt zwischen ihnen nicht absolut<br />
das bürgerliche, son<strong>de</strong>rn mehr das häusliche <strong>Recht</strong>.<br />
Zu 1. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> verlangt, je<strong>de</strong>m das Seine zu geben.<br />
Vorausgesetzt dabei wird allerdings <strong>de</strong>r Unterschied <strong>de</strong>s einen<br />
vom an<strong>de</strong>ren. Teilt sich nämlich jemand zu, was ihm selber<br />
gehört, dann kann von <strong>Recht</strong> keine Re<strong>de</strong> sein. Und weil das,<br />
was <strong>de</strong>r Sohn hat, <strong>de</strong>m Vater <strong>und</strong> was <strong>de</strong>r Sklave hat, seinem<br />
Herrn gehört, darum besteht auch keine strenge <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
zwischen Vater <strong>und</strong> Sohn o<strong>de</strong>r Herr <strong>und</strong> Sklave.<br />
Zu 2. Der Sohn ist als solcher <strong>de</strong>m Vater zugeordnet <strong>und</strong><br />
ebenso <strong>de</strong>r Sklave als solcher seinem Herrn. Wird je<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
bei<strong>de</strong>n jedoch als Mensch betrachtet, so ist er ein selbständiges,<br />
von an<strong>de</strong>ren unterschie<strong>de</strong>nes Wesen. Als Menschen steht ihnen<br />
daher irgendwie die strenge <strong>Gerechtigkeit</strong> zu. [8]. Daher gibt es<br />
auch bestimmte Gesetze zum Verhältnis Vater-Sohn <strong>und</strong> Herr-<br />
Sklave. Doch insofern einer „etwas vom an<strong>de</strong>ren" ist, versagt<br />
hier <strong>de</strong>r vollkommene Begriff von <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>.<br />
Zu 3. Alle an<strong>de</strong>ren Unterschie<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Personen, die im Staate<br />
leben, weisen auf eine unmittelbare Beziehung zur Staatsge<br />
meinschaft <strong>und</strong> ihrem Oberhaupt hin. Daher besteht zwischen<br />
ihnen ein <strong>Recht</strong>sverhältnis im strengen Sinn <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Dennoch gibt es <strong>Recht</strong>sunterschie<strong>de</strong> entsprechend <strong>de</strong>n ver<br />
schie<strong>de</strong>nen dienstlichen Stellungen. So spricht man von Militär-<br />
Justiz, Behör<strong>de</strong>nrecht o<strong>de</strong>r Klerikerrecht, nicht weil hier die<br />
10
strenge <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht in Frage käme wie beim väterlichen 57 4<br />
<strong>und</strong> herrschaftlichen <strong>Recht</strong>, son<strong>de</strong>rn weil <strong>de</strong>r jeweilige Per<br />
sonenstand entsprechend seiner beson<strong>de</strong>ren Aufgabe eine<br />
beson<strong>de</strong>re Berücksichtigung verlangt.<br />
11
58. FRAGE<br />
DIE GERECHTIGKEIT<br />
Hierauf ist von <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zu han<strong>de</strong>ln. Dabei stellen<br />
sich zwölf Fragen:<br />
1. Was ist die <strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
2. Ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> stets auf einen an<strong>de</strong>ren bezogen?<br />
3. Ist sie Tugend?<br />
4. Ist ihr Sitz im Willen?<br />
5. Ist sie „allgemeine Tugend"?<br />
6. Ist sie als „allgemeine Tugend" wesentlich je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
Tugend gleich?<br />
7. Gibt es eine Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit?<br />
8. Hat die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit eine eigene Materie?<br />
9. Richtet sie sich auf die Lei<strong>de</strong>nschaften o<strong>de</strong>r nur auf die<br />
Tätigkeiten?<br />
10. Ist die „Tugendmitte" gleich <strong>de</strong>r „Sachmitte"?<br />
11. Besteht <strong>de</strong>r Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> darin, je<strong>de</strong>m das Seine<br />
zu geben?<br />
12. Steht die <strong>Gerechtigkeit</strong> an <strong>de</strong>r Spitze aller sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist die Definition <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>: Der unwan<strong>de</strong>lbare<br />
<strong>und</strong> feste Wille, je<strong>de</strong>m das Seine zu geben, richtig?<br />
1. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist nach <strong>de</strong>m V.Buch <strong>de</strong>r Ethik <strong>de</strong>s<br />
Aristoteles (c. 1; 1129a7) „ein Habitus, <strong>de</strong>m das gerechte Tun<br />
<strong>de</strong>r Menschen entspringt <strong>und</strong> <strong>de</strong>r die Ursache dafür ist, daß<br />
sie es tun <strong>und</strong> wollen". Unter Wille versteht man jedoch Fähig<br />
keit o<strong>de</strong>r auch Akt. Also läßt sich <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht ein<br />
fach mit „Wille" gleichsetzen.<br />
2. Wille ist nicht gleich <strong>Recht</strong>heit <strong>de</strong>s Willens, sonst könnte<br />
es, wenn <strong>de</strong>r Wille soviel wie <strong>Recht</strong>heit wäre, keinen verkehrten<br />
Willen geben. Nach Anselms Buch Über die Wahrheit (c. 12;<br />
ML 148,480) aber ist „<strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>Recht</strong>heit". Also ist<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> nicht Wille.<br />
3. Gottes Wille allein ist unwan<strong>de</strong>lbar. Setzt man also<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> mit unwan<strong>de</strong>lbarem Willen gleich, dann gibt es<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> nur in Gott, <strong>und</strong> das ist falsch.<br />
12
4. Alles Unwan<strong>de</strong>lbare ist fest, weil es unabän<strong>de</strong>rlich ist. 58. 1<br />
Daher setzt man „unwan<strong>de</strong>lbar" <strong>und</strong> „fest" überflüssigerweise<br />
in die Definition <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ein.<br />
5. Je<strong>de</strong>m das Seine zu geben, ist Sache <strong>de</strong>s Fürsten. Wenn<br />
nun die <strong>Gerechtigkeit</strong> darin besteht, je<strong>de</strong>m das Seine zuzu<br />
teilen, folgt, daß nur <strong>de</strong>r Fürst gerecht sein kann, dies aber ist<br />
nicht zutreffend.<br />
6. Augustinus sagt im Buch De moribus ecclesiae (c. 15;<br />
ML 32,1322): „Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist Liebe, die nur Gott dient".<br />
Also gibt sie nicht je<strong>de</strong>m das Seine.<br />
ANTWORT. Die obige Definition stimmt, man muß sie nur<br />
recht verstehen. Da je<strong>de</strong> Tugend ein Habitus ist, Ausgang guten<br />
Tuns, muß man Tugend notwendigerweise mit <strong>de</strong>m Akt <strong>de</strong>fi<br />
nieren, <strong>de</strong>r sich auf ihr Betätigungsfeld (ihre „Materie") bezieht.<br />
Die <strong>Gerechtigkeit</strong> nun ist auf Dinge, die „<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren" an<br />
gehen, ausgerichtet, sie sind ihre Materie (s. u. Art. 2 u. 8).<br />
Wenn es darum heißt, die <strong>Gerechtigkeit</strong> „gebe je<strong>de</strong>m sein<br />
<strong>Recht</strong>", so wird dadurch ihre Hinordnung auf ihre Materie <strong>und</strong><br />
ihr Objekt zum Ausdruck gebracht. So sagt auch Isidor'm seiner<br />
Etymologie (X,l; ML82,320): „Gerecht ist, wer das <strong>Recht</strong><br />
wahrt". Damit aber ein Akt auf irgen<strong>de</strong>inem Betätigungsfeld<br />
Akt <strong>de</strong>r Tugend sei, muß er <strong>de</strong>m Willen entspringen, fest <strong>und</strong><br />
beharrlich sein. Aristoteles schreibt nämlich im II. Buch seiner<br />
Ethik (c.3; 1105a31), zum Tugendakt gehöre 1. „daß man<br />
weiß, was man tut", 2. „daß man überlegt <strong>und</strong> wegen eines<br />
ehrenhaften Zieles entschei<strong>de</strong>t", 3. daß man „ohne Wanken<br />
han<strong>de</strong>lt". Das erste ist im zweiten enthalten, <strong>de</strong>nn „was aus<br />
Unwissenheit getan wird, ist unwillentlich", wie es im III. Buch<br />
<strong>de</strong>r Ethik (c.2; 1129 b 35) heißt. Daher steht in <strong>de</strong>r Definition<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> an erster Stelle <strong>de</strong>r Wille, um darzutun, daß<br />
ihr Akt aus freiem Entscheid hervorgehen muß. Standhaftigkeit<br />
<strong>und</strong> Unwan<strong>de</strong>lbarkeit kommen hinzu, um die Festigkeit <strong>de</strong>s<br />
Han<strong>de</strong>lns zu kennzeichnen. Und somit ist die vorgelegte Defi<br />
nition eine vollständige Bestimmung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, nur daß<br />
anstelle von Habitus Akt eingesetzt wird, weil sie eben durch<br />
<strong>de</strong>n Akt ihr Gepräge erhält (spezifiziert wird), <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Habi<br />
tus wird durch <strong>de</strong>n Akt <strong>de</strong>finiert. Wer die Definition in voll<br />
kommene Form bringen wollte, könnte sagen: Die Gerechtig-<br />
. keit ist ein Habitus, kraft <strong>de</strong>ssen je<strong>de</strong>m das Seine mit festem<br />
<strong>und</strong> unwan<strong>de</strong>lbarem Willen zugeteilt wird. Diese Definition<br />
kommt <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aristoteles im V.Buch seiner Ethik (c.9;<br />
13
58. 1 1134a 1) ziemlich gleich, wo es heißt: „Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist ein<br />
Habitus, kraft <strong>de</strong>ssen jemand aus freier Entscheidung das<br />
Gerechte tut."<br />
Zu 1. Wille be<strong>de</strong>utet hier Akt, nicht Fähigkeit (Potenz). Die<br />
Autoren pflegen jedoch <strong>de</strong>n Habitus durch <strong>de</strong>n Akt zu <strong>de</strong>fi<br />
nieren. So schreibt z. B. Augustinus in seinem Johanneskom<br />
mentar (Tr. 40; ML 35,1690): Glaube heißt „annehmen, was du<br />
nicht siehst."<br />
Zu 2. Auch die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist nicht gleich <strong>Recht</strong>heit <strong>de</strong>s<br />
Willens, son<strong>de</strong>rn nur <strong>de</strong>ren Ursache, sie ist nämlich ein Habi<br />
tus, aus <strong>de</strong>m heraus jemand richtig han<strong>de</strong>lt <strong>und</strong> will.<br />
Zu 3. Der Wille kann auf zweifache Weise „unwan<strong>de</strong>lbar"<br />
genannt wer<strong>de</strong>n. Einmal im Hinblick auf <strong>de</strong>n Akt, <strong>de</strong>r unwan<br />
<strong>de</strong>lbar weiterdauert. So ist nur <strong>de</strong>r Wille Gottes unwan<strong>de</strong>lbar.<br />
Das an<strong>de</strong>re Mal im Hinblick auf das Objekt, insofern jemand<br />
unwan<strong>de</strong>lbar etwas tun will. Und dies gehört zum Wesen <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>. Um gerecht zu sein, genügt es nicht, wenn<br />
jemand nur für eine St<strong>und</strong>e in irgen<strong>de</strong>iner geschäftlichen Sache<br />
die <strong>Gerechtigkeit</strong> hochhalten will - kaum gibt es ja einen, <strong>de</strong>r<br />
stets <strong>und</strong> immer ungerecht han<strong>de</strong>ln möchte -, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r<br />
Mensch muß <strong>de</strong>n Willen haben, unwan<strong>de</strong>lbar <strong>und</strong> in allem die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> zu wahren.<br />
Zu 4. Unter „unwan<strong>de</strong>lbar" versteht man nicht unwan<strong>de</strong>l<br />
bare Dauer <strong>de</strong>s Willensaktes. Deshalb steht nicht überflüssig<br />
das Wörtchen „fest" dabei. Wie mit „unwan<strong>de</strong>lbarer Wille" aus<br />
gedrückt wird, daß jemand unwan<strong>de</strong>lbar die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
wahren möchte, so mit <strong>de</strong>m Wort „fest", daß er diesen Vorsatz<br />
mit Festigkeit durchhält.<br />
Zu 5. Der Richter „gibt je<strong>de</strong>m das Seine" als Befehlen<strong>de</strong>r<br />
<strong>und</strong> Leiten<strong>de</strong>r, weil <strong>de</strong>r Richter nach <strong>de</strong>m V. Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 7<br />
u. 9; 1132a21,1134al) „die leben<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Fürst <strong>und</strong> Wächter <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>" ist. Die Untergebenen<br />
hingegen geben je<strong>de</strong>m das Seine als Ausführen<strong>de</strong>.<br />
Zu 6. Wie in <strong>de</strong>r Liebe zu Gott die Liebe zum Nächsten ein<br />
geschlossen ist (vgl. o. Fr. 25, Art. 1), so gibt <strong>de</strong>r Mensch, <strong>de</strong>r<br />
Gott dient, auch je<strong>de</strong>m, was ihm gebührt.<br />
14
2. ARTIKEL 58. 2<br />
Ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> auf einen an<strong>de</strong>ren bezogen?<br />
1. Der Apostel schreibt im Römerbrief 3,22: „Die Gerech<br />
tigkeit Gottes aus <strong>de</strong>m Glauben an Jesus Christus." Doch <strong>de</strong>r<br />
Glaube versteht sich nicht durch die Beziehung eines Menschen<br />
zum an<strong>de</strong>ren. Also auch nicht die <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
2. Weil die <strong>Gerechtigkeit</strong> nach Augustinus (De mor. eccl.<br />
c. 15; ML 32,1322) alles in <strong>de</strong>n Dienst Gottes stellt, vermag sie<br />
auch das, was „<strong>de</strong>m Menschen unterworfen ist, gut zu beherr<br />
schen." Doch das sinnliche Begehren ist <strong>de</strong>m Menschen unter<br />
worfen gemäß Gn4,7, wo es heißt: „Ihre", nämlich <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>,<br />
„Begier soll unter dir sein", „<strong>und</strong> du sollst sie beherrschen."<br />
Also gehört es zur Aufgabe <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, das eigene<br />
Begehren zu beherrschen. Und darum bezieht sich die Gerech<br />
tigkeit auf einen selbst.<br />
3. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> Gottes dauert ewig. Doch gab es nie<br />
etwas, das zusammen mit Gott ebenso ewig gewesen wäre.<br />
Also gehört die Ausrichtung auf einen an<strong>de</strong>ren nicht zum<br />
Begriff <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
4. Wie die auf an<strong>de</strong>re ausgerichteten Tätigkeiten einer Norm<br />
zu unterwerfen sind, so auch die Handlungen, die einen selbst<br />
angehen. Doch durch die <strong>Gerechtigkeit</strong> wer<strong>de</strong>n Handlungen<br />
normiert gemäß Sprll,5: „Der Arglosen Weg lenkt die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>." Also richtet sich die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht nur auf<br />
das, was an<strong>de</strong>re, son<strong>de</strong>rn auch auf das, was einen selbst betrifft.<br />
DAGEGEN schreibt Cicero im I. Buch seiner Pflichtenlehre<br />
(c.7): „Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist jenes Ordnungsprinzip, das die<br />
menschliche Gesellschaft <strong>und</strong> das Gemeinschaftsleben zusam<br />
menhält." Dies jedoch besagt Bezug auf <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren. Also<br />
erstreckt sich die <strong>Gerechtigkeit</strong> nur auf die Beziehung zum<br />
an<strong>de</strong>ren.<br />
ANTWORT. Da <strong>Gerechtigkeit</strong> Ausgleich be<strong>de</strong>utet (vgl.<br />
Fr. 57, Art. 1), ergibt sich aus ihrem Wesen, daß sie auf einen<br />
an<strong>de</strong>ren ausgerichtet ist, nichts nämlich ist sich selbst gegen<br />
über ausgeglichen, son<strong>de</strong>rn nur gegenüber einem an<strong>de</strong>ren. Und<br />
weil die <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>de</strong>m menschlichen Tun Ausrichtung zu<br />
geben hat (vgl. 1-1160,2; 61,3), muß jene „An<strong>de</strong>rsheit", die sie<br />
verlangt, in zwei Handlungsmächtigen bestehen, die verschie<br />
<strong>de</strong>n voneinan<strong>de</strong>r sind. Die Tätigkeiten aber gehen von Personen<br />
15
58. 2 <strong>und</strong> vom Ganzen aus, nicht aber streng genommen von <strong>de</strong>n<br />
Teilen <strong>und</strong> Formen o<strong>de</strong>r Fähigkeiten (Potenzen). Man sagt ja<br />
eigentlich nicht: „Die Hand schlägt", son<strong>de</strong>rn: <strong>de</strong>r Mensch mit<br />
seiner Hand. Auch heißt es nicht eigentlich, „die Hitze macht<br />
warm", son<strong>de</strong>rn: das Feuer durch seine Hitze. Doch dies sind<br />
bildliche Ausdrucksweisen. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> im eigentlichen<br />
Sinn verlangt also die Verschie<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>r Subjekte, <strong>und</strong> darum<br />
kann es sie nur zwischen zwei Menschen geben. Wegen einer<br />
gewissen Ähnlichkeit jedoch läßt sich in einem <strong>und</strong> <strong>de</strong>mselben<br />
Menschen von verschie<strong>de</strong>nen Tätigkeitsprinzipien unterschied<br />
licher Herkunft re<strong>de</strong>n: Vernunft, überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s, begehren<strong>de</strong>s<br />
Vermögen. Im übertragenen Sinn kann man daher sagen, in<br />
einem <strong>und</strong> <strong>de</strong>mselben Menschen gebe es <strong>Gerechtigkeit</strong>, inso<br />
fern die Vernunft <strong>de</strong>m überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n <strong>und</strong> begehren<strong>de</strong>n Ver<br />
mögen befiehlt, <strong>und</strong> insofern diese <strong>de</strong>r Vernunft gehorchen,<br />
darüber hinaus ganz allgemein, insofern je<strong>de</strong>m Teil <strong>de</strong>s Men<br />
schen zugeteilt wird, was ihm gebührt. Daher bezeichnet<br />
Aristoteles solcherlei <strong>Gerechtigkeit</strong> als „metaphorisch" (Eth.V,<br />
15; 1138b5).<br />
Zu 1. Unsere durch <strong>de</strong>n Glauben bewirkte <strong>Gerechtigkeit</strong>,<br />
durch <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>r gerechtfertigt wird, besteht in <strong>de</strong>r rechten<br />
Ordnung <strong>de</strong>r Seelenteile, wie oben (1-11113,1) dargelegt<br />
wur<strong>de</strong>, wo von <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>fertigung <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs die Re<strong>de</strong> war.<br />
Dies gehört jedoch zur <strong>Gerechtigkeit</strong> im übertragenen Sinne,<br />
die man auch bei einem einsam <strong>und</strong> allein Leben<strong>de</strong>n fin<strong>de</strong>n<br />
kann.<br />
Daraus ergibt sich die Antwort auf <strong>de</strong>n 2. Einwand.<br />
Zu 3. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> Gottes ist von Ewigkeit entspre<br />
chend seinem ewigen Willen <strong>und</strong> Vorsatz, <strong>und</strong> darin besteht vor<br />
allem die <strong>Gerechtigkeit</strong>. Von <strong>de</strong>r Wirkung aus gesehen, ist sie<br />
freilich nicht von Ewigkeit, weil es nichts gibt, das wie Gott<br />
gleich ewig ist.<br />
Zu 4. Die Tätigkeiten <strong>de</strong>s Menschen, die auf ihn selbst aus<br />
gerichtet sind, stehen ausreichend unter einer Norm, wenn die<br />
Lei<strong>de</strong>nschaften durch an<strong>de</strong>re sittliche Tugen<strong>de</strong>n in Ordnung<br />
gebracht wor<strong>de</strong>n sind. Doch die auf an<strong>de</strong>re bezogenen Tätig<br />
keiten bedürfen einer beson<strong>de</strong>ren Regelung, <strong>und</strong> zwar nicht nur<br />
im Hinblick auf <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn auch im Hinblick auf<br />
<strong>de</strong>ssen Adressaten. Daher muß es diesbezüglich eine eigene<br />
Tugend geben, <strong>und</strong> dies ist die <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
16
3. ARTIKEL 58. 3<br />
/st die <strong>Gerechtigkeit</strong> Tugend?<br />
1. Bei Lk 17,10 heißt es: „Wenn ihr alles getan habt, was<br />
euch befohlen wur<strong>de</strong>, sollt ihr sagen: wir sind unnütze Knechte,<br />
wir haben nur unsere Schuldigkeit getan." Doch ein Werk <strong>de</strong>r<br />
Tugend zu verrichten, ist nicht unnütz, sagt doch Ambrosius im<br />
II. Buch seiner Pflichtenlehre (c. 6; ML 16,109): „Wir nennen<br />
nützlich nicht, was sich mit barer Münze ausdrücken läßt, son<br />
<strong>de</strong>rn die Erlangung <strong>de</strong>r Frömmigkeit." Was man machen muß,<br />
ist also kein Werk <strong>de</strong>r Tugend. Doch von dieser Art ist die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>. Also ist sie keine Tugend.<br />
2. Was aus Notwendigkeit geschieht, ist nicht verdienstlich.<br />
Doch je<strong>de</strong>m das Seine geben, worin die <strong>Gerechtigkeit</strong> besteht,<br />
ist notwendig. Also ist es nicht verdienstlich. Durch Tugendakte<br />
jedoch erwerben wir Verdienste. Also ist die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
keine Tugend.<br />
3. Bei <strong>de</strong>n sittlichen Tugen<strong>de</strong>n geht es um das Tun. Was aber<br />
äußerlich geschieht, ist nicht tun, son<strong>de</strong>rn „machen" (vgl.<br />
Aristoteles, Metaphysik IX, c. 8; 1050 a 30). Da nun die Gerech<br />
tigkeit darin besteht, äußerlich ein in sich gutes Werk zu<br />
„machen", kann sie keine sittliche Tugend sein.<br />
DAGEGEN erklärt Gregor im II. Buch seiner Moralia (2,49;<br />
ML 75,592): „Die ganze Struktur <strong>de</strong>s guten Werkes erhebt sich<br />
auf <strong>de</strong>n vier Tugen<strong>de</strong>n", nämlich <strong>de</strong>r Maßhaltung, <strong>de</strong>r Klugheit,<br />
<strong>de</strong>r Tapferkeit <strong>und</strong> <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
ANTWORT. Menschliche Tugend „macht das menschliche<br />
Tun <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Menschen selber gut" (Aristoteles, Eth. 11,6;<br />
1113 a26). Dies trifft auch für die <strong>Gerechtigkeit</strong> zu. Das<br />
menschliche Tun wird nämlich dadurch gut, daß es mit <strong>de</strong>r<br />
Maßstab setzen<strong>de</strong>n Vernunft, die ihm seine Ausrichtung gibt,<br />
übereinstimmt. Da nun die <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>de</strong>n menschlichen<br />
Tätigkeiten Richtung verleiht, ist klar, daß sie damit das Tun <strong>de</strong>s<br />
Menschen gut macht. So erklärt auch Cicero im I. Buch seiner<br />
Pflichtenlehre (c.7): „Die Menschen wer<strong>de</strong>n hauptsächlich<br />
wegen ihrer <strong>Gerechtigkeit</strong> gut genannt." Daher ist, wie er eben-<br />
dort bemerkt, „<strong>de</strong>r Glanz <strong>de</strong>r Tugend in ihr am größten."<br />
Zu 1. Wenn jemand tut, was er tun muß, bringt er <strong>de</strong>m, für<br />
<strong>de</strong>n er tut, was er tun muß, keinen Gewinn, son<strong>de</strong>rn schützt ihn<br />
lediglich vor Scha<strong>de</strong>n. Dennoch hat er selber insofern N<strong>utz</strong>en,<br />
17
58. 4 als er spontan <strong>und</strong> entschlossen tut, was er tun muß, <strong>und</strong> das<br />
heißt tugendhaft han<strong>de</strong>ln. Darum steht im Buch <strong>de</strong>r Weisheit<br />
8,7: die Weisheit Gottes „lehrt Mäßigkeit <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>,<br />
Klugheit <strong>und</strong> Starkmut, - nichts Nützlicheres gibt es im Leben<br />
<strong>de</strong>r Menschen", nämlich <strong>de</strong>r tugendhaften.<br />
Zu 2. Die Notwendigkeit ist eine zweifache. Einmal die <strong>de</strong>s<br />
Zwanges. Diese verschafft kein Verdienst, <strong>de</strong>nn sie hebt die<br />
Willenskraft auf. Die an<strong>de</strong>re Notwendigkeit grün<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>r Ver<br />
pflichtung durch ein Gebot o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Notwendigkeit, ein Ziel<br />
zu erlangen, z. B. wenn jemand das Ziel einer Tugend nur unter<br />
dieser o<strong>de</strong>r jener Bedingung erreichen kann. Diese Art von<br />
Zwang schließt die Möglichkeit <strong>de</strong>s Verdienstes nicht aus, weil<br />
hier das Notwendige freiwillig getan wird. Dennoch fehlt ihm<br />
<strong>de</strong>r Ruhm <strong>de</strong>r Ubergebühr entsprechend <strong>de</strong>m Pauluswon im<br />
1. Korintherbrief 9,16: „Wenn ich das Evangelium verkün<strong>de</strong>,<br />
kann ich mich <strong>de</strong>swegen nicht rühmen, <strong>de</strong>nn ein Zwang liegt<br />
auf mir."<br />
Zu 3. <strong>Gerechtigkeit</strong> besteht nicht darin, mit äußeren Dingen<br />
etwas zu „machen", - das ist Sache <strong>de</strong>r Kunst, son<strong>de</strong>rn hat<br />
etwas zu tun mit <strong>de</strong>r Art, wie die Dinge in Bezug auf einen<br />
an<strong>de</strong>ren zu gebrauchen sind.<br />
4. ARTIKEL<br />
Hat die <strong>Gerechtigkeit</strong> ihren Sitz im Willen?<br />
1. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> wird bisweilen auch Wahrheit genannt.<br />
Doch die Wahrheit ist nicht im Willen, son<strong>de</strong>rn im Verstand.<br />
Also hat die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht im Willen ihren Sitz.<br />
2. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> befaßt sich mit Dingen, die Bezug zu<br />
einem an<strong>de</strong>ren haben. Doch etwas auf einen an<strong>de</strong>ren hinordnen<br />
ist Sache <strong>de</strong>s Verstan<strong>de</strong>s. Also hat die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht im<br />
Willen, son<strong>de</strong>rn vielmehr im Verstand ihren Sitz.<br />
3. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist keine Verstan<strong>de</strong>stugend (kein Ver<br />
stan<strong>de</strong>shabitus), da sie nicht auf Erkenntnis ausgerichtet ist.<br />
Daher kann sie nur sittliche Tugend sein. Doch die sittliche<br />
Tugend wurzelt im „Vernünftigen durch Teilhabe", <strong>und</strong> dies ist<br />
das überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>und</strong> das begehren<strong>de</strong> Vermögen (vgl.<br />
Aristoteles, Eth. 1,13; 1102b30). Also hat die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
nicht im Willen, son<strong>de</strong>rn im überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n <strong>und</strong> im begeh<br />
ren<strong>de</strong>n Vermögen ihren Sitz.<br />
18
DAGEGEN steht Anselms Wort (De veritate c. 12; ML 158, 58. 4<br />
482): „Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist die um ihrer selbst willen bewahrte<br />
<strong>Recht</strong>heit <strong>de</strong>s Willens."<br />
ANTWORT. Jenes Vermögen ist Sitz (Subjekt) <strong>de</strong>r Tugend,<br />
<strong>de</strong>ssen Akt durch die Tugend seine <strong>Recht</strong>heit erhalten soll. Die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> aber hat nicht irgen<strong>de</strong>inen Erkenntnisakt zu<br />
lenken, heißen wir ja nicht gerecht, weil wir etwas richtig erken<br />
nen. Daher ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> auch nicht im Verstand o<strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>r Vernunft, d. h. im Erkenntnisvermögen, verwurzelt.<br />
Da wir jedoch „gerecht" heißen, weil wir etwas auf rechte<br />
Weise vollbringen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r unmittelbare Ausgangspunkt <strong>de</strong>s<br />
Han<strong>de</strong>lns in <strong>de</strong>r Strebekraft liegt, muß die <strong>Gerechtigkeit</strong> ihren<br />
Sitz notwendigerweise in irgen<strong>de</strong>iner Strebekraft haben. Es gibt<br />
nun ein doppeltes Strebe vermögen, nämlich <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Vernunft<br />
beheimatete Wille <strong>und</strong> das sinnliche Streben, das <strong>de</strong>r sinnlichen<br />
Wahrnehmung folgt <strong>und</strong> in das überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>und</strong> das begeh<br />
ren<strong>de</strong> Vermögen eingeteilt wird (vgl. 181,2). „Einem je<strong>de</strong>n das<br />
Seine geben" kann aber nicht aus <strong>de</strong>m sinnlichen Streben her<br />
geleitet wer<strong>de</strong>n, da die sinnliche Wahrnehmung nicht zur Erfas<br />
sung <strong>de</strong>s Verhältnisses <strong>de</strong>s einen zum an<strong>de</strong>ren ausreicht. Diese<br />
Aufgabe löst allein <strong>de</strong>r Verstand. Daher kann die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
ihren Sitz we<strong>de</strong>r im überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n noch im begehren<strong>de</strong>n Ver<br />
mögen haben, son<strong>de</strong>rn nur im Willen. Deshalb <strong>de</strong>finiert Aristo<br />
teles die <strong>Gerechtigkeit</strong> auch mit <strong>de</strong>m Akt <strong>de</strong>s Willens (vgl.<br />
o.Art. 1,1. Einw.) [9].<br />
Zu 1. Der Wille ist ein Vernunftstreben, <strong>und</strong> darum behält<br />
die <strong>Recht</strong>heit <strong>de</strong>r Vernunft - auch „Wahrheit" genannt -, wenn<br />
sie in <strong>de</strong>n Willen eindringt, wegen ihrer Nähe zur Vernunft <strong>de</strong>n<br />
Namen „Wahrheit". Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
bisweilen „Wahrheit" genannt.<br />
Zu 2. Der Wille stellt sich auf sein Objekt nach voraus<br />
gehen<strong>de</strong>r Vernunfterkenntnis ein. Weil nun <strong>de</strong>r Verstand die<br />
Hinordnung auf einen an<strong>de</strong>ren bewirkt, kann auch <strong>de</strong>r Wille<br />
etwas in Hinordnung auf einen an<strong>de</strong>ren wollen, <strong>und</strong> das ist<br />
Sache <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Zu 3. Das Vernünftige durch Teilhabe fin<strong>de</strong>t sich nicht nur<br />
im Uberwindungs- <strong>und</strong> Begehrungsvermögen, son<strong>de</strong>rn „über<br />
haupt allgemein im sinnenhaften Streben", wie es im I. Buch <strong>de</strong>r<br />
Ethik (c. 13; 1102b30) heißt, <strong>de</strong>nn jegliches Streben gehorcht<br />
<strong>de</strong>r Vernunft. Unter die Strebekräfte aber fällt auch <strong>de</strong>r Wille,<br />
<strong>und</strong> darum kann er Sitz einer moralischen Tugend sein.<br />
19
58. 5 5. ARTIKEL<br />
Ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> „allgemeine Tugend"? [10]<br />
1. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> steht in <strong>de</strong>r Einteilung <strong>de</strong>s Weisheits-<br />
buches 8,7 neben an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n: „Sie (die Weisheit) lehrt<br />
Maßhaltung <strong>und</strong> Klugheit, <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> Tapferkeit."<br />
Doch das Allgemeine kann man nicht mit an<strong>de</strong>ren teilen o<strong>de</strong>r<br />
mit <strong>de</strong>m unter <strong>de</strong>m Allgemeinen Stehen<strong>de</strong>n zusammenzählen.<br />
Also ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> keine allgemeine Tugend.<br />
2. Gleichwie die <strong>Gerechtigkeit</strong> unter die Kardinaltugen<strong>de</strong>n<br />
gerechnet wird, so auch Maßhaltung <strong>und</strong> Tapferkeit. Doch<br />
Maßhaltung o<strong>de</strong>r Tapferkeit gilt nicht als allgemeine Tugend.<br />
Also darf auch die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht irgendwie als allgemeine<br />
Tugend angesehen wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist immer auf einen an<strong>de</strong>ren ausge<br />
richtet (o. Art. 2). Doch die Sün<strong>de</strong>, die sich gegen <strong>de</strong>n Nächsten<br />
richtet, ist nicht „allgemeine" Sün<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn steht <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>,<br />
durch die sich <strong>de</strong>r Mensch gegen sich selbst verfehlt, gegenüber.<br />
Also ist auch die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht allgemeine Tugend.<br />
DAGEGEN schreibt Aristoteles im V. Buch seiner Ethik (c. 1;<br />
1130 a 8): „Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist eine allgemeine Tugend."<br />
ANTWORT. Wie gesagt (Art. 2), ordnet die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
<strong>de</strong>n Menschen in seinem Verhältnis zu einem an<strong>de</strong>ren. Dies nun<br />
kann auf zweifache Weise geschehen. Einmal in seinem Verhält<br />
nis zu einer Einzelperson, ein an<strong>de</strong>res Mal zu einem an<strong>de</strong>ren<br />
„im allgemeinen". Dies ist <strong>de</strong>r Fall bei <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r im Dienst einer<br />
Gemeinschaft steht <strong>und</strong> somit allen Menschen dieser Gemein<br />
schaft dienstbar ist. Unter dieser doppelten Sichtweise kann die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> zum Zuge kommen. Es ist aber klar, daß alle, die<br />
einer Gemeinschaft angehören, sich zu dieser wie Teile zum<br />
Ganzen verhalten. Der Teil aber als solcher ist etwas vom<br />
Ganzen. Daher läßt sich das Wohl <strong>de</strong>s Teiles auf das Wohl <strong>de</strong>s<br />
Ganzen hinordnen. Danach also verbin<strong>de</strong>t sich das Gut je<strong>de</strong>r<br />
Tugend, bringe sie einen Menschen in sich selbst in Ordnung<br />
o<strong>de</strong>r in Bezug auf an<strong>de</strong>re Einzelmenschen, mit <strong>de</strong>m Gemein<br />
wohl, <strong>de</strong>m die <strong>Gerechtigkeit</strong> verpflichtet ist. Und so können die<br />
Akte aller Tugen<strong>de</strong>n, insofern sie <strong>de</strong>n Menschen auf das<br />
Gemeinwohl ausrichten, zur <strong>Gerechtigkeit</strong> gehören. In diesem<br />
Sinn heißt die <strong>Gerechtigkeit</strong> „allgemeine Tugend". Und weil es<br />
Aufgabe <strong>de</strong>s Gesetzes ist, die Hinordnung auf das Gemeinwohl<br />
20
sicherzustellen (vgl. 1-1190,2), erhält die <strong>Gerechtigkeit</strong>, die, 58.6<br />
wie eben erklärt, „allgemein" ist, <strong>de</strong>n Namen „Gesetzesgerech<br />
tigkeit", <strong>de</strong>nn durch sie unterwirft sich <strong>de</strong>r Mensch <strong>de</strong>m Gesetz,<br />
das die Akte aller Tugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Gemeinwohl dienstbar macht.<br />
Zu 1. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> steht in <strong>de</strong>r Einteilung zusammen<br />
mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n nicht als allgemeine, son<strong>de</strong>rn als<br />
beson<strong>de</strong>re Tugend, wie unten dargelegt wer<strong>de</strong>n wird. (Art. 7).<br />
Zu 2. Maßhaltung <strong>und</strong> Tapferkeit haben ihren Sitz im sinn<br />
lichen Strebevermögen, d. h. im begehren<strong>de</strong>n <strong>und</strong> im überwin<br />
<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n. Diese Kräfte aber wen<strong>de</strong>n sich gewissen Einzelobjek<br />
ten zu, wie auch die sinnliche Erkenntnis nur Einzelnes erfaßt.<br />
Die <strong>Gerechtigkeit</strong> hingegen hat ihren Sitz im rationalen Strebe<br />
vermögen <strong>und</strong> ist <strong>de</strong>shalb imstan<strong>de</strong>, auf das vom Verstand<br />
erkannte Allgemeingut auszugehen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> kann<br />
die <strong>Gerechtigkeit</strong> auch eher eine allgemeine Tugend sein als<br />
Maßhaltung <strong>und</strong> Tapferkeit.<br />
Zu 3. Was einen selbst angeht, läßt sich auch auf an<strong>de</strong>re<br />
beziehen, vor allem, wenn es um das Gemeinwohl geht. Daher<br />
kann die Gesetzesgerechtigkeit, weil sie auf das Gemeinwohl<br />
ausrichtet, „allgemeine Tugend" genannt wer<strong>de</strong>n. Und aus <strong>de</strong>m<br />
gleichen Gr<strong>und</strong> läßt sich die Ungerechtigkeit als „allgemeine<br />
Sün<strong>de</strong>" bezeichnen. Daher heißt es 1 Jo. 3,4: Je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> ist<br />
Ungerechtigkeit."<br />
6. ARTIKEL<br />
Ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> als allgemeine Tugend wesentlich<br />
je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Tugend gleich?<br />
1. Aristoteles schreibt im V.Buch seiner Ethik (c.5; 1130<br />
al2), Tugend <strong>und</strong> Gesetzesgerechtigkeit „sind gleich je<strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>ren Tugend, ihr Begriff aber ist nicht dasselbe". Was jedoch<br />
nur begrifflich verschie<strong>de</strong>n ist, unterschei<strong>de</strong>t sich nicht im<br />
Wesen. Also ist <strong>Gerechtigkeit</strong> wesentlich gleich je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
Tugend.<br />
2. Eine Tugend, die nicht je<strong>de</strong>r Tugend wesentlich gleich<br />
kommt, ist Teil einer Tugend. Doch die genannte <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
ist nach <strong>de</strong>r obigen y4ratote7esstelle „nicht Teil <strong>de</strong>r Tugend,<br />
son<strong>de</strong>rn die ganze Tugend". Also unterschei<strong>de</strong>t sich die vor<br />
genannte <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht wesentlich von je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
Tugend.<br />
21
58. 6 3. Dadurch, daß eine Tugend ihren Akt auf ein höheres Ziel<br />
ausrichtet, wird sie in ihrem Wesen als Habitus nicht verän<strong>de</strong>rt.<br />
So bleibt sich <strong>de</strong>r Habitus <strong>de</strong>r Maßhaltung wesentlich gleich,<br />
auch wenn ihr Akt auf Gott hinweist. Die Gesetzesgerechtigkeit<br />
jedoch ordnet alle Tugendakte auf ein höheres Ziel hin, nämlich<br />
auf das gemeinsame Wohl aller, das über <strong>de</strong>m Wohl einer Ein<br />
zelperson liegt. Also ist die Gesetzesgerechtigkeit wesentlich<br />
gleich allen an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n.<br />
4. Je<strong>de</strong>r Teil ist auf das Ganze ausgerichtet, an<strong>de</strong>rnfalls ist es<br />
vergeblich <strong>und</strong> umsonst. Das Tugendhafte jedoch kann nicht so<br />
sein. Also kann es auch keinen Tugendakt geben, <strong>de</strong>r nicht zur<br />
allgemeinen <strong>Gerechtigkeit</strong> gehört, <strong>de</strong>ren Objekt das Gemein<br />
wohl ist. Und so erklärt sich, daß die allgemeine <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
wesentlich das gleiche ist wie je<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re Tugend.<br />
DAGEGEN behauptet Aristoteles im V.Buch seiner Ethik<br />
(c.3; 1129b33): „Viele können die Tugend in ihren eigenen<br />
Angelegenheiten ausüben, aber in <strong>de</strong>m, was an<strong>de</strong>re betrifft,<br />
können sie es nicht." Und im III. Buch <strong>de</strong>r Politik (c.4;<br />
1277a 22) schreibt er: „Die Tugend <strong>de</strong>s guten Mannes ist nicht<br />
einfach die Tugend <strong>de</strong>s guten Staatsbürgers." Denn die Tugend<br />
<strong>de</strong>s guten Bürgers ist die allgemeine <strong>Gerechtigkeit</strong>, die das<br />
Gemeinwohl ins Auge faßt. Also sind „allgemeine Gerechtig<br />
keit" <strong>und</strong> Tugend im allgemeinen nicht das gleiche, <strong>de</strong>nn man<br />
kann die eine ohne die an<strong>de</strong>re haben.<br />
ANTWORT. „Allgemein" versteht sich zweifach. Einmal als<br />
Aussage, wie: „Sinnenwesen" gilt allgemein für Mensch <strong>und</strong><br />
Pferd u. dgl. Hierbei muß das Allgemeine bei <strong>de</strong>nen, auf welche<br />
die Aussage zutrifft, wesentlich das gleiche sein, <strong>de</strong>nn das<br />
Genus fin<strong>de</strong>t sich wesentlich gleich in <strong>de</strong>r Spezies wie<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
bestimmt <strong>de</strong>ren Definition. - In an<strong>de</strong>rer Weise spricht man von<br />
„allgemein" <strong>de</strong>r Kraft nach. So ist die Universalursache „all<br />
gemein" bezüglich aller Wirkungen, wie die Sonne in Bezug auf<br />
alle Körper, die beleuchtet o<strong>de</strong>r durch ihre Kraft verän<strong>de</strong>rt<br />
wer<strong>de</strong>n. Das <strong>de</strong>rart „Allgemeine" braucht in seinem Wesen<br />
nicht mit <strong>de</strong>m übereinzustimmen, für das es „allgemein" ist,<br />
<strong>de</strong>nn Ursache <strong>und</strong> Wirkung sind nicht gleichen Wesens.<br />
Auf diese zweite Art nun wird die oben (Art. 5) besprochene<br />
Gesetzesgerechtigkeit „allgemeine Tugend" genannt, nämlich<br />
insofern sie die Akte aller an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n auf ihr Ziel aus<br />
richtet, was be<strong>de</strong>utet: unter ihrem Befehl alle an<strong>de</strong>ren Tugen<br />
<strong>de</strong>n in Bewegung bringen. Wie man die Caritas (übernatürliche<br />
22
Liebe zu Gott) „allgemeine Liebe" nennen kann, insofern sie 58. 7<br />
die Akte aller Tugen<strong>de</strong>n auf Gott als höchstes Gut ausrichtet, so<br />
auch die Gesetzesgerechtigkeit, insofern diese die Akte aller<br />
Tugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Gemeinwohl zuordnet. Wie nun die Caritas, die<br />
das göttliche Gut als ihr beson<strong>de</strong>res Objekt ins Auge faßt, ihrem<br />
Wesen nach eine eigene Tugend ist, so ist auch die Gesetzes<br />
gerechtigkeit ihrem Wesen nach eine eigene Tugend mit <strong>de</strong>m<br />
Gemeinwohl als ihrem beson<strong>de</strong>ren Objekt. Und so ist sie im<br />
Fürsten „haupt"-sächlich <strong>und</strong> gleichsam Richtung weisend, in<br />
<strong>de</strong>n Untergebenen aber in zweiter Linie <strong>und</strong> gleichsam aus<br />
führend.<br />
Je<strong>de</strong> Tugend kann jedoch „Gesetzesgerechtigkeit" genannt<br />
wer<strong>de</strong>n, insofern sie, als zwar wesensverschie<strong>de</strong>ne, doch wegen<br />
ihrer Bewegkraft als „allgemein" wirksame, auf das Gemein<br />
wohl hingeordnet ist. So gesehen kommt die Gesetzesgerech<br />
tigkeit mit je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Tugend überein, unterschei<strong>de</strong>t sich<br />
aber <strong>de</strong>m Begriff nach. In diesem Sinn spricht Aristoteles<br />
(Eth.V,3; 1130 a 12).<br />
Zu 1 <strong>und</strong> Zu 2: Die Antworten ergeben sich aus <strong>de</strong>r obigen<br />
Darlegung.<br />
Zu 3. Auch jener Einwand geht von <strong>de</strong>r in diesem Sinn<br />
gefaßten Gesetzesgerechtigkeit aus, wonach die von <strong>de</strong>r Geset<br />
zesgerechtigkeit gelenkte Tugend selbst wie<strong>de</strong>rum Gesetzes<br />
gerechtigkeit genannt wird.<br />
Zu 4. Je<strong>de</strong> Tugend richtet entsprechend ihrer Eigenart ihren<br />
Akt auf das ihr zugehörige Ziel. Daß sie aber einem weiteren<br />
Ziel zustrebt, sei es für immer, sei es bisweilen, liegt nicht in<br />
ihrer Wesensart. Es muß dazu eine an<strong>de</strong>re, höhere Tugend vor<br />
han<strong>de</strong>n sein, die sie auf jenes Ziel einstellt. Und so muß es eine<br />
höhere Tugend geben, die alle Tugen<strong>de</strong>n auf das Gemeinwohl<br />
ausrichtet, <strong>und</strong> dies ist die Gesetzesgerechtigkeit - eine wesent<br />
lich von je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren verschie<strong>de</strong>ne Tugend.<br />
7. ARTIKEL<br />
Gibt es außer <strong>de</strong>r allgemeinen <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
noch eine beson<strong>de</strong>re <strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
1. Im Reich <strong>de</strong>r Tugen<strong>de</strong>n gibt es nichts überflüssiges. Nun<br />
setzt die allgemeine <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>de</strong>n Menschen ausreichend<br />
23
58. 7 in <strong>de</strong>n Stand, um allem zu genügen, was <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren betrifft.<br />
Also ist eine beson<strong>de</strong>re <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht vonnöten.<br />
2. Eines <strong>und</strong> Vieles än<strong>de</strong>rn die Art einer Tugend nicht. Die<br />
Gesetzesgerechtigkeit aber ordnet <strong>de</strong>n Menschen auf <strong>de</strong>n an<strong>de</strong><br />
ren hin in all <strong>de</strong>m, was alle betrifft (vgl. o. Art. 5 u. 6). Also gibt<br />
es keine an<strong>de</strong>re Tugendart, die <strong>de</strong>n Menschen auf <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren<br />
in <strong>de</strong>m hinordnet, was nur eine einzelne Person angeht.<br />
3. Zwischen <strong>de</strong>r Einzelperson <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Menge <strong>de</strong>r Bürger<br />
gibt es ein Mittleres, nämlich die Familiengruppe. Wenn es nun<br />
außer <strong>de</strong>r allgemeinen <strong>Gerechtigkeit</strong> noch eine Son<strong>de</strong>rgerech<br />
tigkeit für die Beziehung zu einer einzelnen Person gibt, dann<br />
muß es auch eine <strong>Gerechtigkeit</strong> für die Hausgemeinschaft<br />
geben, die das Wohl einer Familie sichert. Doch davon re<strong>de</strong>t<br />
niemand. Also gibt es neben <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit auch<br />
keine Einzelgerechtigkeit.<br />
DAGEGEN steht das Chrysostomuswort zu Mt 5,6 („Selig,<br />
die hungern <strong>und</strong> dürsten nach <strong>Gerechtigkeit</strong>"): „Mit Gerechtig<br />
keit bezeichnet er (Christus) die allgemeine o<strong>de</strong>r die <strong>de</strong>m Geiz<br />
entgegengesetzte beson<strong>de</strong>re Tugend" (Horn. 15; MG57,227).<br />
ANTWORT. Wie (im vorigen Art.) gesagt, ist die Gesetzes<br />
gerechtigkeit nicht je<strong>de</strong>r Tugend wesentlich gleich, son<strong>de</strong>rn<br />
außer <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit, die <strong>de</strong>n Menschen unmittelbar<br />
auf das Gemeinwohl hinordnet, muß es noch an<strong>de</strong>re Tugen<strong>de</strong>n<br />
geben, die ihn unmittelbar zu Einzelgütern in Beziehung brin<br />
gen. Dies kann in bezug auf sich selbst o<strong>de</strong>r auf eine an<strong>de</strong>re<br />
Einzelperson zutreffen. Wie es nun neben <strong>de</strong>r Gesetzesgerech<br />
tigkeit Son<strong>de</strong>rtugen<strong>de</strong>n geben muß, die <strong>de</strong>n Menschen in sich in<br />
Ordnung halten, z. B. Maßhaltung <strong>und</strong> Tapferkeit, so auch<br />
neben <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit eine Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit, die<br />
<strong>de</strong>m Menschen in seinem Verkehr zu einer an<strong>de</strong>ren Einzelper<br />
son die rechte Weisung gibt.<br />
Zu 1. Die Gesetzesgerechtigkeit gibt <strong>de</strong>m Menschen in sei<br />
nen Beziehungen zu an<strong>de</strong>ren im Hinblick auf das Gemeinwohl<br />
unmittelbar zwar genügend rechte Orientierung, bezüglich <strong>de</strong>s<br />
Wohls einer einzelnen Person jedoch nur mittelbar [11]. Daher<br />
muß es eine Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit geben, die <strong>de</strong>n Menschen<br />
unmittelbar auf das Wohl einer an<strong>de</strong>ren Einzelperson hinorien<br />
tiert.<br />
Zu 2. Das Gemeinwohl <strong>de</strong>s Staates <strong>und</strong> das Einzelwohl<br />
einer Person unterschei<strong>de</strong>n sich nicht nur wie viel <strong>und</strong> wenig,<br />
son<strong>de</strong>rn wesenhaft („formal"). Etwas wesentlich an<strong>de</strong>res ist<br />
24
nämlich das Wohl <strong>de</strong>s Gemeinwesens <strong>und</strong> etwas an<strong>de</strong>res das 58. 8<br />
Wohl <strong>de</strong>r einzelnen. Sie sind so gr<strong>und</strong>verschie<strong>de</strong>n wie das<br />
Ganze <strong>und</strong> sein Teil. Daher sagt Aristoteles im I. Buch seiner<br />
Politik (c. 1; 1252 a 7): „Unrichtig drückt sich aus, wer sagt, <strong>de</strong>r<br />
Staat <strong>und</strong> die Hausgemeinschaft <strong>und</strong> an<strong>de</strong>res dgl. unterschie<strong>de</strong>n<br />
sich nur wie viel <strong>und</strong> wenig, <strong>und</strong> nicht ihrer Wesensart nach."<br />
Zu 3. Im Familienverband unterschei<strong>de</strong>t Aristoteles (vgl.<br />
Pol.1,3; 1253b6) drei Beziehungsverhältnisse, nämlich „<strong>de</strong>r<br />
Gattin zu ihrem Mann, <strong>de</strong>s Vaters zu seinem Sohn <strong>und</strong> <strong>de</strong>s<br />
Herrn zu seinem Sklaven", wobei die eine <strong>de</strong>r so verb<strong>und</strong>enen<br />
Personen jeweils „etwas von <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren" ist. Daher besteht<br />
bezüglich dieser Person nicht einfach das Verhältnis von<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> schlechthin, son<strong>de</strong>rn eine beson<strong>de</strong>re Gerechtig<br />
keit, nämlich die „häusliche" (vgl. Aristoteles Eth.V, 10;<br />
1134b8).<br />
8. ARTIKEL<br />
Hat die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit einen eigenen Wirkbereich?<br />
1. Zum Vers Gn2,14: „Der vierte Fluß ist <strong>de</strong>r Euphrat",<br />
bemerkt die Glosse (Augustinus, ML 34,204): „Euphrat heißt <strong>de</strong>r<br />
,Fruchtbare'. Und es wird nicht gesagt, wobin er fließt, <strong>de</strong>nn die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> erstreckt sich auf alle Teile <strong>de</strong>r Seele". Dies wäre<br />
aber nicht möglich, wenn sie einen beson<strong>de</strong>ren Wirkbereich<br />
hätte, je<strong>de</strong>m beson<strong>de</strong>ren Wirkbereich entspricht nämlich ein<br />
beson<strong>de</strong>res Wirkvermögen (Potenz). Also steht <strong>de</strong>r Son<strong>de</strong>r<br />
gerechtigkeit keine beson<strong>de</strong>re Materie zu.<br />
2. Augustinus schreibt in seinem Buch Drei<strong>und</strong>achtzig Fragen<br />
(Fr. 61; ML 40,51): „Mit vier Tugen<strong>de</strong>n in unserer Seele bestrei-<br />
ten wir hinie<strong>de</strong>n unser geistiges Leben, nämlich mit <strong>de</strong>r Klug<br />
heit, <strong>de</strong>r Maßhaltung, <strong>de</strong>m Starkmut <strong>und</strong> <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>".<br />
Und er fügt hinzu: die vierte ist die <strong>Gerechtigkeit</strong>, „die alle<br />
durchdringt". Also hat die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit - eine <strong>de</strong>r vier<br />
Kardinaltugen<strong>de</strong>n - keine beson<strong>de</strong>re Materie.<br />
3. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> gibt <strong>de</strong>m Menschen genügend Orien<br />
tierung in seinen Beziehungen zum an<strong>de</strong>ren. Doch alles im<br />
Leben hinie<strong>de</strong>n kann <strong>de</strong>n Menschen zu einem an<strong>de</strong>ren in Bezie<br />
hung bringen. Also hat die <strong>Gerechtigkeit</strong> nur einen allgemeinen<br />
<strong>und</strong> keinen beson<strong>de</strong>ren Wirkbereich.<br />
25
58. 8 DAGEGEN for<strong>de</strong>rt Aristoteles im V. Buch seiner Ethik (c. 5;<br />
1130 b 31) eine Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit für das beson<strong>de</strong>re Gebiet<br />
zwischenmenschlichen Verkehrs.<br />
ANTWORT. Alles, was sich durch die Vernunft regeln läßt,<br />
ist Materie <strong>de</strong>r sittlichen Tugend, die durch die „rechte Ver<br />
nunft" <strong>de</strong>finiert wird, wie aus <strong>de</strong>m II. Buch <strong>de</strong>r aristotelischen<br />
Ethik (c. 6; 1107al) hervorgeht. Durch die Vernunft können<br />
nun sowohl die inneren Lei<strong>de</strong>nschaften als auch die äußeren<br />
Handlungen <strong>und</strong> ebenso die äußeren Dinge, die die Menschen<br />
in Gebrauch haben, in Ordnung gebracht wer<strong>de</strong>n. Doch durch<br />
die äußeren Handlungen wie durch die äußeren Dinge, welche<br />
die Menschen miteinan<strong>de</strong>r in Kontakt bringen können, tritt ein<br />
Mensch mit einem an<strong>de</strong>ren in Verkehr; im Bereich <strong>de</strong>r inneren<br />
Lei<strong>de</strong>nschaften hingegen hat es je<strong>de</strong>r nur mit sich selbst zu tun.<br />
Da sich nun die <strong>Gerechtigkeit</strong> im Verhältnis zu einem an<strong>de</strong>ren<br />
abspielt, erstreckt sie sich nicht auf das ganze Wirkungsgebiet<br />
<strong>de</strong>r sittlichen Tugend, son<strong>de</strong>rn nur auf die äußeren Handlungen<br />
<strong>und</strong> Dinge unter <strong>de</strong>m beson<strong>de</strong>ren Blickwinkel, daß dadurch<br />
zwei Menschen einan<strong>de</strong>r zugeordnet wer<strong>de</strong>n.<br />
Zu 1. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> gehört zwar wesenhaft zu einem be<br />
stimmten Teil <strong>de</strong>r Seele, in <strong>de</strong>m sie ihren Sitz hat, nämlich zum<br />
Willen, dieser jedoch steuert durch seinen Befehl alle an<strong>de</strong>renTeile<br />
<strong>de</strong>r Seele. So erstreckt sich die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht unmittel<br />
bar, jedoch in einer Art von Ubergreifen auf alle Teile <strong>de</strong>r Seele.<br />
Zu 2. Wie oben (1-1161,3 u. 4) dargelegt, wer<strong>de</strong>n die Kardi<br />
naltugen<strong>de</strong>n zweifach verstan<strong>de</strong>n. Einmal als beson<strong>de</strong>re Tugen<br />
<strong>de</strong>n mit bestimmten Wirkungsfel<strong>de</strong>rn, sodann, insofern sie<br />
gewisse allgemeine Weisen <strong>de</strong>r Tugend bezeichnen. In diesem<br />
Sinne spricht dort Augustinus. Er schreibt nämlich, die Klugheit<br />
sei „Erkenntnis <strong>de</strong>ssen, was zu erstreben <strong>und</strong> zu fliehen ist", die<br />
Maßhaltung „Zügelung <strong>de</strong>r Begier<strong>de</strong> in <strong>de</strong>m, was für kurze Zeit<br />
Lust verschafft", die Tapferkeit „Seelenstärke in vorübergehen<br />
<strong>de</strong>n Beschwernissen", die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist die Tugend, „die alle<br />
durchtränkt, sie ist Liebe zu Gott <strong>und</strong> zum Nächsten" <strong>und</strong> die<br />
gemeinsame Wurzel <strong>de</strong>r gesamten Beziehungen zu an<strong>de</strong>ren.<br />
Zu 3. Die inneren Lei<strong>de</strong>nschaften - ein Teilbereich für sitt<br />
liche Betätigring - sind in sich nicht auf einen an<strong>de</strong>ren ausgerich<br />
tet - dies gehört spezifisch zur <strong>Gerechtigkeit</strong> -, doch ihre Wir<br />
kungen, d. h. das durch sie ausgelöste Verhalten kann sich auf<br />
an<strong>de</strong>re richten. Daraus folgt also nicht, daß die Materie <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> allgemein ist.<br />
26
9. ARTIKEL 58. 9<br />
Hat die Gesetzesgerechtigkeit<br />
etwas mit <strong>de</strong>n Lei<strong>de</strong>nschaften zu tun?<br />
1. Im II. Buch seiner Ethik (c.2; 1104b 8) schreibt Aristo<br />
teles: „Sittliche Tugend hat mit Lust <strong>und</strong> Trauer zu tun." Lust, d.<br />
h. Begier<strong>de</strong>, <strong>und</strong> Trauer aber sind Lei<strong>de</strong>nschaften, wie oben im<br />
Traktat über die Lei<strong>de</strong>nschaften dargelegt wur<strong>de</strong> (I—II 24,4). Da<br />
nun die <strong>Gerechtigkeit</strong> eine sittliche Tugend ist, bezieht sie sich<br />
auch auf die Lei<strong>de</strong>nschaften.<br />
2. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> schafft Ordnung in <strong>de</strong>n Beziehungen<br />
zu an<strong>de</strong>ren. Doch diese Ordnung läßt sich nicht schaffen,<br />
solange die Lei<strong>de</strong>nschaften nicht in Ordnung sind, <strong>de</strong>nn aus <strong>de</strong>r<br />
Unordnung <strong>de</strong>r Lei<strong>de</strong>nschaften folgt die Unordnung im<br />
erwähnten Bemühen. Die Begier<strong>de</strong> auf sexuellem Gebiet führt<br />
nämlich zum Ehebruch, <strong>und</strong> die übermäßige Liebe zum Geld<br />
verleitet zum Diebstahl. Also muß sich die <strong>Gerechtigkeit</strong> auch<br />
auf die Lei<strong>de</strong>nschaften erstrecken.<br />
3. Wie die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit, so bezieht sich auch die<br />
Gesetzesgerechtigkeit auf an<strong>de</strong>re. Doch die Gesetzesgerechtig<br />
keit hat es mit <strong>de</strong>n Lei<strong>de</strong>nschaften zu tun, sonst wäre sie nicht<br />
für alle Tugen<strong>de</strong>n zuständig, von <strong>de</strong>nen sich offensichtlich<br />
einige auf die Lei<strong>de</strong>nschaften beziehen. Also wirkt die Gerech<br />
tigkeit auch auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Lei<strong>de</strong>nschaften.<br />
DAGEGEN steht das Wort <strong>de</strong>s Aristoteles in seiner Ethik<br />
(V, 1; 1129a 3), wonach sie nur die Tätigkeiten berührt.<br />
ANTWORT. Die Lösung <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Frage ergibt sich<br />
aus zwei Tatsachen. 1. aus <strong>de</strong>m Träger (Sitz, Subjekt) <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, nämlich <strong>de</strong>m Willen, <strong>de</strong>ssen Bewegungen o<strong>de</strong>r<br />
Akte nichts von Lei<strong>de</strong>nschaften an sich haben (vgl. I—II 22,3), -<br />
nur die Regungen <strong>de</strong>s sinnlichen Strebevermögens heißen<br />
Lei<strong>de</strong>nschaften. Darum erstreckt sich die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht<br />
auf die Lei<strong>de</strong>nschaften, wie es bei <strong>de</strong>r Maßhaltung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Tapferkeit <strong>de</strong>r Fall ist, die <strong>de</strong>n Lei<strong>de</strong>nschaften <strong>de</strong>s überwin<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>s begehren<strong>de</strong>n Vermögens zugehören. - 2. aus <strong>de</strong>r<br />
Art <strong>de</strong>s Wirkungsbereichs (<strong>de</strong>r „Materie"). Die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
ist nämlich auf <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren ausgerichtet, die im Inneren<br />
wohnen<strong>de</strong>n Lei<strong>de</strong>nschaften verweisen uns aber nicht unmittel<br />
bar an einen an<strong>de</strong>ren. Daher hat die <strong>Gerechtigkeit</strong> nichts mit<br />
Lei<strong>de</strong>nschaften zu tun.<br />
27
58.9 Zu 1. Nicht je<strong>de</strong> sittliche Tugend wirkt im Bereich von Lust<br />
<strong>und</strong> Trauer. Denn die Tapferkeit hat es mit Furcht <strong>und</strong> Übermut<br />
zu tun. Dennoch ist je<strong>de</strong> sittliche Tugend auf Freu<strong>de</strong> <strong>und</strong> Trauer<br />
als Folgeerscheinungen hingeordnet, wie Aristoteles im<br />
VII. Buch seiner Ethik (c. 12; 1152b2) sagt: „Lust <strong>und</strong> Unlust<br />
stehen im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong> unseres Empfin<strong>de</strong>ns, wenn wir etwas<br />
mit schlecht o<strong>de</strong>r gut bezeichnen." Dies gilt auch für die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, <strong>de</strong>nn „es gibt keinen Gerechten, <strong>de</strong>r über sein<br />
gerechtes Tun nicht Freu<strong>de</strong> empfän<strong>de</strong>" (Eth. 1,9; 1099 a 18).<br />
Zu 2. Die äußeren Handlungen liegen sozusagen in <strong>de</strong>r<br />
Mitte zwischen <strong>de</strong>n äußeren Dingen, auf die sie sich beziehen,<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n inneren Lei<strong>de</strong>nschaften, <strong>de</strong>nen sie entspringen. Bis<br />
weilen kann nun auf <strong>de</strong>r einen Seite etwas fehlen, was auf <strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>ren nicht <strong>de</strong>r Fall ist, z. B. wenn jemand eine frem<strong>de</strong> Sache<br />
wegnimmt, ohne sie behalten zu wollen, son<strong>de</strong>rn nur, um zu<br />
scha<strong>de</strong>n, o<strong>de</strong>r, umgekehrt, wenn einer <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren Sachen be<br />
gehrt, ohne sie wegnehmen zu wollen. Die rechte Ordnung also<br />
in <strong>de</strong>n Handlungen, die äußerlich vollzogen wer<strong>de</strong>n, ist Auf<br />
gabe <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, doch was zur Ordnung <strong>de</strong>r Lei<strong>de</strong>n<br />
schaften gehört, untersteht an<strong>de</strong>ren sittlichen Tugen<strong>de</strong>n. Ihr<br />
Betätigungsfeld sind eben die Lei<strong>de</strong>nschaften. So verhin<strong>de</strong>rt die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> die Wegnahme frem<strong>de</strong>n Gutes, insofern sie <strong>de</strong>m<br />
zu wahren<strong>de</strong>n Ausgleich in <strong>de</strong>r Sachwelt wi<strong>de</strong>rspricht; die<br />
Freigebigkeit hingegen, insofern sie <strong>de</strong>r übermäßigen Begier<strong>de</strong><br />
nach Reichtum entspringt. Weil jedoch die äußeren Handlun<br />
gen ihr wesentliches Gepräge nicht von inneren Lei<strong>de</strong>nschaften,<br />
son<strong>de</strong>rn mehr von äußeren Dingen als von ihren Objekten<br />
erhalten, bil<strong>de</strong>n, an sich gesprochen, die äußeren Handlungen<br />
mehr <strong>de</strong>n Gegenstandsbereich <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> als <strong>de</strong>r an<strong>de</strong><br />
ren sittlichen Tugen<strong>de</strong>n.<br />
Zu 3. Das Gemeinwohl ist das Ziel <strong>de</strong>r einzelnen in <strong>de</strong>r<br />
Gemeinschaft leben<strong>de</strong>n Personen, so wie das Ganze das Ziel<br />
je<strong>de</strong>s seiner Teile ist. Das Wohl einer einzelnen Person bil<strong>de</strong>t<br />
jedoch nicht das Ziel einer an<strong>de</strong>ren. Daher läßt sich die <strong>de</strong>m<br />
Gemeinwohl zugeordnete Gesetzesgerechtigkeit eher auf die<br />
inneren Lei<strong>de</strong>nschaften, die <strong>de</strong>n Menschen irgendwie in sich<br />
selber zurechtrücken, aus<strong>de</strong>hnen, als die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit,<br />
die auf das Wohl einer an<strong>de</strong>ren Einzelperson bezogen ist.<br />
Dennoch erstreckt sich die Gesetzesgerechtigkeit hauptsächlich<br />
auf die Tätigkeiten <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n, insofern „das Gesetz<br />
vorschreibt, die Werke <strong>de</strong>s Mutigen zu verrichten, als auch die<br />
28
Werke <strong>de</strong>s Maßvollen <strong>und</strong> die <strong>de</strong>s Sanftmütigen", - so Aristo- 58.10<br />
teles in seiner Ethik (V,3; 1129b 19).<br />
10. ARTIKEL<br />
Ist die Tugendmitte gleich <strong>de</strong>r Sachmitte? [12]<br />
1. Der Wesensgehalt <strong>de</strong>r Gattung muß in allen ihren Arten<br />
wie<strong>de</strong>rkehren. Nun wird die sittliche Tugend <strong>de</strong>finiert als<br />
„Habitus <strong>de</strong>s Willens, <strong>de</strong>r die nach uns bemessene Mitte hält<br />
<strong>und</strong> durch die Vernunft bestimmt wird". Also gilt auch für die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> die durch die Vernunft <strong>und</strong> nicht die durch die<br />
Sache bestimmte „Mitte".<br />
2. Bei <strong>de</strong>m, was schlechthin gut ist, gibt es keinen Gr<strong>und</strong>, ein<br />
Zuviel <strong>und</strong> ein Zuwenig anzunehmen, <strong>und</strong> folglich auch kein<br />
Mittleres, wie Aristoteles über die Tugen<strong>de</strong>n im II. Buch <strong>de</strong>r<br />
Ethik (c. 6; 1107a22) sagt. Bei <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> geht es jedoch<br />
um „schlechthin Gutes", wie es im V. Buch <strong>de</strong>r Ethik heißt (c. 2;<br />
1129b 5). Also gibt es bei <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> keine Sachmitte.<br />
3. Bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n spricht man von Vernunft- <strong>und</strong><br />
nicht von sachentsprechend, weil die Entsprechung je nach<br />
Person verschie<strong>de</strong>n ist: was für <strong>de</strong>n einen viel ist, ist für <strong>de</strong>n<br />
an<strong>de</strong>ren wenig (Aristoteles, Eth.II,5; 1106 a 36). Doch dies läßt<br />
sich auch bei <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> beobachten: ungleich fällt die<br />
Strafe aus, wenn ein Fürst o<strong>de</strong>r wenn eine Privatperson geschla<br />
gen wird. Also gilt für die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht die Sach-, son<br />
<strong>de</strong>rn die Vernunftmitte.<br />
DAGEGEN steht, daß Aristoteles in seiner Ethik (V,7;<br />
1132a 1) die „Mitte" <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> nach <strong>de</strong>m arithme<br />
tischen Verhälnis angibt, womit er die sachbezogene „Mitte"<br />
meint.<br />
ANTWORT. Wie oben (Art. 2,4 u. Art. 8) dargelegt, bewe<br />
gen sich die an<strong>de</strong>ren sittlichen Tugen<strong>de</strong>n hauptsächlich auf <strong>de</strong>m<br />
Gebiet <strong>de</strong>r Lei<strong>de</strong>nschaften. Hier wird das rechte Verhalten nur<br />
nach <strong>de</strong>m Menschen, in <strong>de</strong>m sich die Lei<strong>de</strong>nschaften regen,<br />
bemessen, d. h. daß er in Zorn geraten <strong>und</strong> begehren darf je<br />
nach <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Umstän<strong>de</strong>n. Deshalb bestimmt sich die<br />
„Mitte" bei diesen Tugen<strong>de</strong>n nicht durch das Verhältnis <strong>de</strong>r<br />
einen Sache zur an<strong>de</strong>ren, son<strong>de</strong>rn allein durch das Verhältnis<br />
zur Person <strong>de</strong>s Tugendhaften. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird hier die<br />
„Mitte" allein von <strong>de</strong>r an uns gemessenen Vernunft festgelegt.<br />
29
58. Ii Die Materie <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> hingegen ist eine äußere Hand<br />
lung, sofern sie o<strong>de</strong>r eine in Gebrauch genommene Sache in<br />
einem bestimmten Verhältnis zu einer an<strong>de</strong>ren Person steht.<br />
Deshalb besteht die „Mitte" bei <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> in einem aus<br />
geglichenen Verhältnis einer äußeren Sache zu einer äußeren<br />
Person. Der „Ausgleich" aber liegt sachlich in <strong>de</strong>r „Mitte"<br />
zwischem <strong>de</strong>m Mehr <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Weniger, wie es bei Aristoteles im<br />
X. Buch seiner Metaphysik (c. 5; 1056 a 22) heißt. Also wird die<br />
„Mitte" bei <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> von <strong>de</strong>r Sache her bestimmt.<br />
Zu 1. Jene sachbestimmte Mitte ist zugleich auch vernunft<br />
bestimmte Mitte. Deshalb bleibt die <strong>Gerechtigkeit</strong> als sittliche<br />
Tugend unangetastet.<br />
Zu 2. Das schlechthin Gute ist ein zweifaches. Eimal jenes,<br />
das in je<strong>de</strong>r Hinsicht gut ist, - so sind die Tugen<strong>de</strong>n „gut". Und<br />
bei <strong>de</strong>m schlechthin Guten gibt es auch keine Mitte <strong>und</strong> keine<br />
Extreme. - Sodann heißt etwas schlechthin gut, weil es absolut,<br />
d. h. von seinem Wesen her gesehen, gut ist, wenngleich es<br />
durch Mißbrauch schlecht wer<strong>de</strong>n kann, wie dies beim Reich<br />
tum <strong>und</strong> bei <strong>de</strong>r Ehre <strong>de</strong>r Fall ist. Hier kann man von Zuviel,<br />
von Zuwenig <strong>und</strong> von Mitte in Bezug auf die Menschen re<strong>de</strong>n,<br />
die davon guten o<strong>de</strong>r schlechten Gebrauch machen können.<br />
Und in diesem Sinne befaßt sich die <strong>Gerechtigkeit</strong> mit <strong>de</strong>m<br />
schlechthin Guten.<br />
Zu 3. Ein an<strong>de</strong>res Gewicht hat zugefügtes Unrecht gegen<br />
einen Fürsten <strong>und</strong> ein an<strong>de</strong>res gegen eine Privatperson. Daher<br />
muß es durch Strafe bei<strong>de</strong> Male an<strong>de</strong>rs ausgeglichen wer<strong>de</strong>n.<br />
Dies gehört also zum Unterschied in <strong>de</strong>r Sache, nicht zum Un<br />
terschied in <strong>de</strong>r Vernunftgemäßheit.<br />
11. ARTIKEL<br />
Besteht <strong>de</strong>r Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> darin, je<strong>de</strong>m das<br />
Seine zu geben?<br />
1. Augustinus teilt in seinem Buch Uber die Dreifaltigkeit<br />
(14,9; ML42,1046) <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> die Aufgabe zu, „<strong>de</strong>nen,<br />
die im Elend sind, zu helfen". Doch wenn wir <strong>de</strong>n Elen<strong>de</strong>n hel<br />
fen, geben wir Ihnen nicht das Ihre, son<strong>de</strong>rn vielmehr das<br />
Unsrige. Also besteht <strong>de</strong>r Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht darin,<br />
je<strong>de</strong>m das Seine zu geben.<br />
30
2. Cicero schreibt im I. Buch seiner Pflichtenlehre (c. 7): „Die 58.11<br />
Wohltätigkeit, die man Güte o<strong>de</strong>r Freigebigkeit nennen darf",<br />
gehört zur <strong>Gerechtigkeit</strong>. Doch freigebig sein heißt, einem<br />
an<strong>de</strong>ren vom Eigenen, nicht vom Seinigen etwas geben. Also<br />
be<strong>de</strong>utet <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht, je<strong>de</strong>m das Seine geben.<br />
3. Zur <strong>Gerechtigkeit</strong> gehört nicht nur, die Dinge in angemes<br />
sener Weise zu verteilen, son<strong>de</strong>rn auch, ungerechte Handlun<br />
gen zu verhin<strong>de</strong>rn, z. B. Mord, Ehebruch u. dgl. Doch „Je<strong>de</strong>m<br />
das Seine geben" bezieht sich nur auf das Verteilen. Wenn also<br />
<strong>de</strong>r Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> nur darin bestehen soll, je<strong>de</strong>m das<br />
Seine zu geben, dann ist er damit nicht genügend gekenn<br />
zeichnet.<br />
DAGEGEN schreibt Ambrosius im I. Buch seiner Pflichten<br />
lehre (c.24; ML 16,57): „Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist jene Tugend, die<br />
je<strong>de</strong>m gibt, was sein ist, sich frem<strong>de</strong>s Gut nicht aneignet <strong>und</strong><br />
nicht auf <strong>de</strong>n eigenen Vorteil schaut, um so die allgemeine<br />
<strong>Recht</strong>sgleichheit zu schützen."<br />
ANTWORT. Wie gesagt (Art. 8,10), bil<strong>de</strong>t die äußere Hand<br />
lung, insofern sie o<strong>de</strong>r eine Sache, die wir gebrauchen, auf eine<br />
an<strong>de</strong>re Person, mit <strong>de</strong>r wir rechtlich verb<strong>und</strong>en sind, hinge<br />
ordnet ist, das Betätigungsfeld <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Was nun einer<br />
Person nach <strong>de</strong>m Verhältnis <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sgleichheit geschul<strong>de</strong>t<br />
wird, nennt man „das Seine". Daher besteht <strong>de</strong>r eigentliche Akt<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> in nichts an<strong>de</strong>rem, als je<strong>de</strong>m das Seine zu<br />
geben.<br />
Zu 1. Der <strong>Gerechtigkeit</strong> als Kardinaltugend sind gewisse<br />
nachgeordnete Tugen<strong>de</strong>n zugesellt, wie Barmherzigkeit, Frei<br />
gebigkeit u. dgl. (vgl. u. Fr. 80). Den Elen<strong>de</strong>n helfen, was zur<br />
Barmherzigkeit o<strong>de</strong>r zum Mitleid gehört, <strong>und</strong> reichlich Gutes<br />
tun, was zur Freigebigkeit gehört, wird daher <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
als Haupttugend zugerechnet.<br />
Daraus ergibt sich die Antwort Zu 2.<br />
Zu 3. Nach Aristoteles (Eth.V, 7; 1132 b 11) wird alles Zuviel<br />
in Sachen <strong>Gerechtigkeit</strong> als „Gewinn" im weiteren Sinn<br />
bezeichnet, wie, umgekehrt, alles „Zuwenig" als „Verlust". Dies<br />
erklärt sich dadurch, daß die <strong>Gerechtigkeit</strong> früher, <strong>und</strong> auch<br />
jetzt noch, als Tauschgeschäft in Kauf <strong>und</strong> Verkauf ausgeübt<br />
wur<strong>de</strong>, wobei diese Ausdrücke in ihrer eigentlichen Be<strong>de</strong>utung<br />
gebraucht wur<strong>de</strong>n. Von da wur<strong>de</strong>n sie auf alles übertragen, was<br />
mit <strong>Gerechtigkeit</strong> zu tun hat. Und <strong>de</strong>rselbe Gr<strong>und</strong> liegt vor bei<br />
<strong>de</strong>r Formel „Je<strong>de</strong>m das Seine geben".<br />
31
58. 12 12. ARTIKEL<br />
Steht die <strong>Gerechtigkeit</strong> an <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n?<br />
1. Aufgabe <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ist, je<strong>de</strong>m das Seine zu geben.<br />
Die Freigebigkeit jedoch teilt vom Eigenen aus, <strong>und</strong> das ist viel<br />
tugendhafter. Also steht die Freigebigkeit über <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit.<br />
2. Der Schmuck ist von höherem Wert als das Geschmückte.<br />
Doch „die Hochherzigkeit ist Schmuck <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong><br />
aller Tugen<strong>de</strong>n", wie Aristoteles im IV. Buch seiner Ethik (c. 7;<br />
1124 a 1) schreibt. Also ist die Hochherzigkeit <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
überlegen.<br />
3. „Das Schwierigere <strong>und</strong> das Gute" ist die Sache <strong>de</strong>r Tugend<br />
(Aristoteles, Eth.II,3; 1105a9). Doch die Tapferkeit steht viel<br />
Schwierigerem gegenüber, nämlich <strong>de</strong>n To<strong>de</strong>sgefahren (Aristoteles,<br />
Eth.III,9; 1115a24). Also übertrifft die Tapferkeit die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
DAGEGEN meint Cicero in seiner Pflichtenlehre (1,7):<br />
„Tugendglanz umgibt die <strong>Gerechtigkeit</strong>, ihretwegen heißen die<br />
Menschen gut."<br />
ANTWORT. Wenn wir von <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> sprechen, ist es<br />
klar, daß sie alle sittlichen Tugen<strong>de</strong>n überragt, <strong>und</strong> zwar <strong>de</strong>s<br />
halb, weil das Gemeinwohl über <strong>de</strong>m Einzelwohl einer Person<br />
steht. Dies meint Aristoteles, wenn er im V. Buch seiner Ethik<br />
(c. 1; 1094 b 7) schreibt: „Die herrlichste Tugend ist die Gerech<br />
tigkeit, <strong>und</strong> we<strong>de</strong>r Abend- noch Morgenstern sind so w<strong>und</strong>er<br />
bar wie sie."<br />
Doch auch die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit übertrifft die an<strong>de</strong>ren<br />
sittlichen Tugen<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> zwar aus zweifachem Gr<strong>und</strong>. 1. vom<br />
Subjekt aus gesehen: sie hat ihren Sitz im edleren Teil <strong>de</strong>r Seele,<br />
nämlich im geistigen Streben, im Willen, während die an<strong>de</strong>ren<br />
sittlichen Tugen<strong>de</strong>n im sinnlichen Strebevermögen verwurzelt<br />
sind, zu <strong>de</strong>m als Materie ebendieser Tugen<strong>de</strong>n die Lei<strong>de</strong>nschaf<br />
ten gehören. - 2. Vom Objekt her gesehen: Die an<strong>de</strong>ren Tugen<br />
<strong>de</strong>n erhalten ihr Ansehen allein von <strong>de</strong>m, was sie im Tugendhaf<br />
ten selbst an Gutem bewirken, die <strong>Gerechtigkeit</strong> hingegen<br />
dadurch, daß sich <strong>de</strong>r Tugendhafte einem an<strong>de</strong>ren gegenüber<br />
gut verhält, <strong>und</strong> so wird die <strong>Gerechtigkeit</strong> irgendwie ein Gut<br />
<strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren, wie es im V. Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 3; 1130a 3) heißt.<br />
32
Darum bemerkt Aristoteles im I.Buch seiner Rhetorik (c.9; 58. 12<br />
1366b 3) auch: „Die größten Tugen<strong>de</strong>n sind notwendig jene, die<br />
für an<strong>de</strong>re das Beste bewirken, <strong>de</strong>nn die Tugend ist eine wohl<br />
tätige Macht. Deshalb wer<strong>de</strong>n die Tapferen <strong>und</strong> die Gerechten<br />
am meisten geehrt, ist doch die Tapferkeit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren im<br />
Kriege von N<strong>utz</strong>en, die <strong>Gerechtigkeit</strong> aber im Krieg <strong>und</strong> im<br />
Frie<strong>de</strong>n."<br />
Zu 1. Auch wenn die Freigebigkeit vom Eigenen austeilt, so<br />
tut sie das doch im Hinblick auf das eigene sittliche Wohl. Die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> jedoch gibt <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren, was Sein ist, im Hin<br />
blick auf das Gemeinwohl. Außer<strong>de</strong>m wird die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
allen gegenüber gewahrt, die Freigebigkeit hingegen läßt sich<br />
nicht auf alle aus<strong>de</strong>hnen. Überdies grün<strong>de</strong>t die Freigebigkeit,<br />
die vom Ihrigen gibt, auf <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, die darauf achtet,<br />
daß je<strong>de</strong>r das Seine behält.<br />
Zu 2. Sofern die Hochherzigkeit zur <strong>Gerechtigkeit</strong> hinzu<br />
kommt, vermehrt sie <strong>de</strong>ren Wert. Ohne <strong>Gerechtigkeit</strong> jedoch<br />
besäße sie überhaupt nicht die Beschaffenheit einer Tugend.<br />
Zu 3. Die Tapferkeit hat es zwar mit <strong>de</strong>m Schwierigeren,<br />
jedoch nicht mit <strong>de</strong>m Besseren zu tun, da sie nur im Kriege<br />
nützlich ist. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist es im Krieg <strong>und</strong> im Frie<strong>de</strong>n,<br />
wie soeben betont wur<strong>de</strong>.<br />
33
59. FRAGE<br />
DIE UNGERECHTIGKEIT<br />
Hierauf ist die Ungerechtigkeit zu betrachten. Dabei erge<br />
ben sich vier Fragen:<br />
1. Ist die Ungerechtigkeit ein beson<strong>de</strong>res Laster?<br />
2. Ist das Unrechttun das Kennzeichen <strong>de</strong>s Ungerechten?<br />
3. Kann jemand mit seiner Zustimmung Unrecht erlei<strong>de</strong>n?<br />
4. Ist die Ungerechtigkeit Ihrer Art nach eine schwere<br />
Sün<strong>de</strong>?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist die Ungerechtigkeit ein beson<strong>de</strong>res Laster?<br />
1. In 1 Jo 3,4 heißt es: „Je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> ist Gesetzwidrigkeit".<br />
Doch Gesetzwidrigkeit scheint das gleiche wie Ungerechtigkeit<br />
zu sein, <strong>de</strong>nn <strong>Gerechtigkeit</strong> besteht in einem gewissen Aus<br />
gleich, <strong>und</strong> so scheint die Ungerechtigkeit dasselbe wie Unaus<br />
geglichenheit (inaequalitas) o<strong>de</strong>r Gesetzwidrigkeit (iniquitas)<br />
zu sein. Also ist Ungerechtigkeit keine beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong>.<br />
2. Eine beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong> steht nicht in Gegensatz zu allen<br />
Tugen<strong>de</strong>n. Doch Ungerechtigkeit wi<strong>de</strong>rspricht sämtlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n. So ist das Unrecht <strong>de</strong>s Ehebruchs gegen die Keusch<br />
heit, <strong>de</strong>s Mor<strong>de</strong>s gegen die Mil<strong>de</strong> usw. Also ist die Ungerechtig<br />
keit keine beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong>.<br />
3. Die Ungerechtigkeit steht in Gegensatz zur Gerechtig<br />
keit, die ihren Sitz im Willen hat. Doch „je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> ist im<br />
Willen", wie Augustinus sagt (De duabus animabus c. 10;<br />
ML42,103). Also ist Ungerechtigkeit keine beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN steht: die Ungerechtigkeit ist das Gegenteil von<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>. Doch die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist eine beson<strong>de</strong>re<br />
Tugend, also die Ungerechtigkeit auch ein beson<strong>de</strong>res Laster.<br />
ANTWORT. Die Ungerechtigkeit ist eine zweifache. Die eine<br />
ist gesetzeswidrig, weil sie <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit wi<strong>de</strong>r<br />
spricht, <strong>und</strong> sie ist ihrem Wesen nach ein beson<strong>de</strong>res Laster,<br />
weil sie ein beson<strong>de</strong>res Objekt hat, nämlich das Gemeinwohl,<br />
das sie verachtet. Von <strong>de</strong>r Absicht her gesehen, ist sie jedoch ein<br />
allgemeines Laster, <strong>de</strong>nn die Mißachtung <strong>de</strong>s Gemeinwohls<br />
kann <strong>de</strong>n Menschen zu allen Sün<strong>de</strong>n verleiten. Daher tragen<br />
34
alle Laster, insofern sie <strong>de</strong>m Gemeinwohl wi<strong>de</strong>rsprechen, <strong>de</strong>n 59. 2<br />
Charakter <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit, gleichsam als seien sie von <strong>de</strong>r<br />
Ungerechtigkeit abgeleitet (vgl. o. Fr. 58, Art. 6).<br />
Auf an<strong>de</strong>re Weise kann man von Ungerechtigkeit unter <strong>de</strong>m<br />
Gesichtspunkt einer gewissen Ungleichheit in <strong>de</strong>r Beziehung zu<br />
einem an<strong>de</strong>ren sprechen, wie wenn einer mehr Güter, z.B.<br />
Reichtum <strong>und</strong> Ehren, <strong>und</strong> weniger Übles, z.B. Arbeit <strong>und</strong><br />
Scha<strong>de</strong>n, haben möchte. Und so hat die Ungerechtigkeit eine<br />
beson<strong>de</strong>re Materie <strong>und</strong> ist ein beson<strong>de</strong>res, <strong>de</strong>r Son<strong>de</strong>rgerechtig<br />
keit entgegengesetztes Laster.<br />
Zu 1. Wie man von Gesetzesgerechtigkeit im Hinblick auf<br />
das Gemeingut spricht, so von göttlicher <strong>Gerechtigkeit</strong> im Hin<br />
blick auf das Gut, das Gott ist, <strong>de</strong>m je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> wi<strong>de</strong>rstreitet.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> heißt je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> Gesetzwidrigkeit.<br />
Zu 2. Auch die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit steht - indirekt - im<br />
Gegensatz zu allen Tugen<strong>de</strong>n, insofern auch die äußeren Akte<br />
sowohl zur <strong>Gerechtigkeit</strong> wie auch zu <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n gehören, wenngleich auf verschie<strong>de</strong>ne Weise (vgl. Fr.<br />
58, Art. 2 Zu 2).<br />
Zu 3. Der Wille - wie auch die Vernunft - erstreckt sich auf<br />
die gesamte Materie <strong>de</strong>s Sittlichen, d. h. auf die Lei<strong>de</strong>nschaften<br />
<strong>und</strong> auf die äußeren Handlungen, die sich auf an<strong>de</strong>re richten.<br />
Doch die <strong>Gerechtigkeit</strong> vervollkommnet <strong>de</strong>n Willen nur, soweit<br />
er sich auf Tätigkeiten, die auf an<strong>de</strong>re ausgerichtet sind,<br />
erstreckt. Und das gleiche gilt für die Ungerechtigkeit.<br />
2. ARTIKEL<br />
Heißt jemand ungerecht, weil er Ungerechtes tut?<br />
1. Der Habitus erhält seine spezifische Prägung durch sein<br />
Objekt (vgl. 1-1154,2). Nun ist das eigentliche Objekt <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> das Gerechte <strong>und</strong> das eigentliche Objekt <strong>de</strong>r<br />
Ungerechtigkeit das Ungerechte. Also muß einer, <strong>de</strong>r Gerechtes<br />
tut, „gerecht" genannt wer<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> „ungerecht", wer Ungerech<br />
tes tut.<br />
2. Nach Aristoteles (Eth.V, 13; 1137a 17) ist die Meinung<br />
jener falsch, die glauben, es liege in <strong>de</strong>r Macht <strong>de</strong>s Menschen, so<br />
einfachhin Ungerechtes zu tun <strong>und</strong> nicht weniger könne <strong>de</strong>r<br />
Gerechte ebenso Unrechtes tun wie <strong>de</strong>r Ungerechte. Dies wäre<br />
35
59. 2 nur <strong>de</strong>r Fall, wenn das Unrechttun eine Wesenseigenschaft <strong>de</strong>s<br />
Ungerechten wäre. Also ist jemand als Ungerechter einzustu<br />
fen, weil er Ungerechtes tut.<br />
3. Je<strong>de</strong> Tugend verhält sich zu ihrem eigentümlichen Akt<br />
immer gleich, <strong>und</strong> dasselbe gilt von <strong>de</strong>n entgegengesetzten<br />
Lastern. Wer nun die Maßhaltung überschreitet, heißt „un<br />
mäßig". Demnach heißt „ungerecht", wer Ungerechtes tut.<br />
DAGEGEN schreibt Aristoteles im V.Buch seiner Ethik<br />
(c. 10; 1134a 17): „Es tut einer etwas Ungerechtes <strong>und</strong> ist trotz<br />
<strong>de</strong>m nicht ungerecht".<br />
ANTWORT. Wie das Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> Ausgleich in<br />
äußeren Dingen besagt, so ist das Objekt <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit<br />
etwas Unausgeglichenes, insofern jeman<strong>de</strong>m mehr o<strong>de</strong>r auch<br />
weniger, als ihm zusteht, gegeben wird. Dieses Objekt ist auf<br />
<strong>de</strong>n Habitus <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit bezogen, <strong>und</strong> zwar durch<br />
<strong>de</strong>ssen eigentümlichen Akt, das Unrechttun. Es kann also auf<br />
zweifache Weise vorkommen, daß jemand Ungerechtes tut, <strong>und</strong><br />
doch nicht ungerecht ist. Einmal, weil es zwischen <strong>de</strong>r Tätigkeit<br />
<strong>und</strong> ihrem eigentümlichen Objekt keine Entsprechung gibt, -<br />
die Tätigkeit erhält ja Art <strong>und</strong> Namen vom Objekt, <strong>und</strong> zwar<br />
von ihrem An-sich-Objekt, nicht von <strong>de</strong>m, was nur „zufällig"<br />
einmal ihr Gegenstand sein kann. Bei <strong>de</strong>m, was Ziel (Objekt)<br />
einer Handlung ist, heißt „an sich", was sich mit absichtlichem<br />
Wollen verbin<strong>de</strong>t, „zufällig", was außerhalb <strong>de</strong>r Absicht liegt.<br />
Wer daher etwas Ungerechtes tut, ohne die Absicht, es zu tun,<br />
es z. B. aus Unwissenheit tut, ohne etwas Unrechtes zu ahnen,<br />
begeht nichts Unrechtes „an sich" <strong>und</strong> eigentlich („formell"),<br />
son<strong>de</strong>rn nur „zufällig" <strong>und</strong> beiläufig („per acci<strong>de</strong>ns"). - Auf<br />
an<strong>de</strong>re Weise kann es vorkommen (daß jemand Unrecht tut,<br />
ohne ungerecht zu sein) wegen fehlen<strong>de</strong>r Übereinstimmung <strong>de</strong>r<br />
Tätigkeit mit <strong>de</strong>m Habitus. Das Unrechttun kann nämlich bis<br />
weilen einer Lei<strong>de</strong>nschaft entspringen, z. B. <strong>de</strong>m Zorn o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Begehrlichkeit, bisweilen aber auch <strong>de</strong>r freien Wahl, wenn das<br />
Unrechttun in sich Wohlgefallen erregt. Dann geht es im eigent<br />
lichen Sinn vom Habitus aus, <strong>de</strong>nn j e<strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r einen Habitus hat,<br />
ist willkommen, was diesem Habitus entspricht. - Unrechttun<br />
mit Absicht <strong>und</strong> aus freier Wahl macht also das Eigentümliche<br />
<strong>de</strong>s Ungerechten aus, insofern „Ungerechter" heißt, wer <strong>de</strong>n<br />
Habitus <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit besitzt. Doch ohne Absicht o<strong>de</strong>r<br />
aus Lei<strong>de</strong>nschaft Unrechtes tun kann jemand ohne <strong>de</strong>n Habitus<br />
<strong>de</strong>r Ungerechtigkeit.<br />
36
Zu 1. Nur das im eigentlichen <strong>und</strong> formellen Sinn verstan- 59. 3<br />
<strong>de</strong>ne Objekt bestimmt die Art <strong>de</strong>s Habitus, nicht jedoch, wenn<br />
man es materiell <strong>und</strong> als etwas Zufälliges versteht.<br />
Zu 2. Es tut nicht leicht jemand absichtlich Unrecht aus rei<br />
nem Vergnügen, son<strong>de</strong>rn eber aus an<strong>de</strong>ren Grün<strong>de</strong>n. Dies ist,<br />
wie Aristoteles ebendort (Eth.V, 10 u. 14; 1134al7 bzw.<br />
1137a 22) betont, bezeichnend für <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r einen Habitus<br />
besitzt.<br />
Zu 3. Das Objekt <strong>de</strong>r Maßhaltung ist nicht wie bei <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> etwas äußerlich Festgelegtes, son<strong>de</strong>rn es ist das<br />
Maßvolle <strong>und</strong> ergibt sich allein aus seiner Bezogenheit zum<br />
Menschen. Das Beiläufige <strong>und</strong> Unbeabsichtigte kann daher<br />
we<strong>de</strong>r materiell noch formell „maßvoll" genannt wer<strong>de</strong>n, <strong>und</strong><br />
ebensowenig „unmäßig". Diesbezüglich besteht keine Ähnlich<br />
keit zwischen <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n. Bezüglich <strong>de</strong>s Verhältnisses <strong>de</strong>r Handlung zum<br />
Habitus jedoch gilt für sie wie bei allen das gleiche.<br />
3. ARTIKEL<br />
Kann jemand willentlich Unrecht erlei<strong>de</strong>n?<br />
1. Ungerecht ist soviel wie unausgeglichen (vgl. Art. 2).<br />
Doch wer sich selbst verletzt, bewirkt ebenso Unausgeglichen<br />
heit wie durch Verletzung eines an<strong>de</strong>ren. Es kann also jemand<br />
sich selbst genau so wie einem an<strong>de</strong>ren Unrecht zufügen. Doch<br />
wer Unrecht tut, tut es willentlich. Also kann jemand willentlich<br />
Unrecht erlei<strong>de</strong>n, vor allem durch sich selbst.<br />
2. Das bürgerliche Gesetz straft nur wegen begangenen<br />
Unrechts. Doch Selbstmör<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n [wur<strong>de</strong>n] nach <strong>de</strong>n<br />
Staatsgesetzen dadurch bestraft, daß ihnen früher die Ehre<br />
eines Begräbnisses verweigert wur<strong>de</strong>, wie Aristoteles berichtet<br />
(Eth.V, 15; 1138 al2). Also kann sich jemand selbst Unrecht<br />
antun <strong>und</strong> so willentlich Ungerechtigkeit erlei<strong>de</strong>n.<br />
3. Unrecht geschieht nur, wenn es jemand erlei<strong>de</strong>t. Nun<br />
kommt es vor, daß jemand einem an<strong>de</strong>ren mit <strong>de</strong>ssen Zustim<br />
mung Unrecht zufügt. Also kommt es vor, daß jemand willent<br />
lich Unrecht erlei<strong>de</strong>t.<br />
DAGEGEN steht, daß Unrechterlei<strong>de</strong>n das Gegenteil ist von<br />
Unrechttun. Doch Unrecht tut man nur mit Willen. Also erlei-<br />
37
59. 3 <strong>de</strong>t, umgekehrt, niemand Unrecht, es sei <strong>de</strong>nn, gegen seinen<br />
Willen.<br />
ANTWORT. Eine Handlung geht begriffsgemäß vom Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n<br />
aus, das Erlei<strong>de</strong>n hingegen wird seiner Natur nach von<br />
einem an<strong>de</strong>ren bewirkt. Daher kann ein <strong>und</strong> <strong>de</strong>rselbe nicht in<br />
gleicher Hinsicht Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Erlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r sein (vgl.<br />
Aristoteles, Physik III, 1 u. VIII, 5; 201 a 19 u. 256b20). Nun ist<br />
das eigentliche Tätigkeitsprinzip bei <strong>de</strong>n Menschen <strong>de</strong>r Wille,<br />
<strong>und</strong> daher tut <strong>de</strong>r Mensch eigentlich <strong>und</strong> an sich nur das, was er<br />
willentlich tut. Umgekehrt erlei<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Mensch im eigentlichen<br />
Sinn das, was er gegen seinen Willen erlei<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>nn insofern er<br />
will, liegt <strong>de</strong>r Ausgangspunkt in ihm selbst, <strong>und</strong> insofern ist er<br />
mehr Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>r als Erlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r.<br />
Man muß also sagen: an sich <strong>und</strong> im eigentlichen Sinn (formell)<br />
gesprochen, kann niemand Unrecht tun, es sei <strong>de</strong>nn, er<br />
will, <strong>und</strong> niemand es erlei<strong>de</strong>n, es sei <strong>de</strong>nn gegen seinen Willen.<br />
Beiläufig (per acci<strong>de</strong>ns) jedoch <strong>und</strong> gleichsam materiell gesprochen,<br />
kann jemand etwas an sich Ungerechtes entwe<strong>de</strong>r, ohne<br />
es zu wollen, tun (z. B. wenn er es ohne Absicht tut) o<strong>de</strong>r etwas<br />
willentlich erlei<strong>de</strong>n, z. B. wenn jemand einem an<strong>de</strong>ren freiwillig<br />
mehr gibt, als er muß.<br />
Zu 1. Wer freiwillig einem gibt, was er ihm nicht schul<strong>de</strong>t,<br />
begeht we<strong>de</strong>r ein Unrecht, noch schafft er damit eine Ungleichheit.<br />
Das Besitzrecht <strong>de</strong>s Menschen hängt nämlich von seinem<br />
Willen ab, <strong>und</strong> so ergibt sich kein MißVerhältnis, wenn er etwas<br />
freiwillig abgibt o<strong>de</strong>r sich nehmen läßt.<br />
Zu 2. „Einzelperson" kann doppelt verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
Einmal an sich, <strong>und</strong> wenn sich, so gesehen, jemand einen Scha<strong>de</strong>n<br />
zufügt, kann dies zwar <strong>de</strong>n Charakter einer Sün<strong>de</strong> annehmen,<br />
z. B. <strong>de</strong>r Unmäßigkeit o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Unklugheit, nicht jedoch<br />
<strong>de</strong>r Ungerechtigkeit, <strong>de</strong>nn wie die <strong>Gerechtigkeit</strong> sich stets auf<br />
einen an<strong>de</strong>ren bezieht, so auch die Ungerechtigkeit. - Sodann<br />
läßt sich <strong>de</strong>r Mensch als zum Staatswesen gehörig als <strong>de</strong>ssen Teil<br />
betrachten o<strong>de</strong>r als Gott zugehörig, nämlich als <strong>de</strong>ssen<br />
Geschöpf <strong>und</strong> Ebenbild. Wer sich nun selbst tötet, begeht ein<br />
Unrecht, zwar nicht sich selbst, jedoch <strong>de</strong>m Staat <strong>und</strong> Gott gegenüber.<br />
Darum wird er sowohl vom göttlichen wie vom<br />
menschlichen Gesetz bestraft, so wie <strong>de</strong>r Apostel vom Unzüchtigen<br />
sagt (1 Kor 3,17): „Wer <strong>de</strong>n Tempel Gottes verdirbt, <strong>de</strong>n<br />
wird Gott ver<strong>de</strong>rben".<br />
38
Zu 3. Das Erlei<strong>de</strong>n wird durch eine äußere Handlung 59.4<br />
bewirkt. Beim Tun <strong>und</strong> Erlei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Unrechts erscheint nun als<br />
materielles Element <strong>de</strong>r äußere Akt in sich betrachtet (vgl. o.<br />
Art. 2), das Formelle <strong>und</strong> Eigentliche jedoch ist im Willen <strong>de</strong>s<br />
Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Erlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n zu sehen (vgl. ebda.). Den<br />
noch ist zu sagen, daß Unrechttun <strong>de</strong>s einen <strong>und</strong> Unrecht<br />
erlei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren materiell gesehen immer zusammen sind.<br />
Re<strong>de</strong>n wir aber formell, so kann <strong>de</strong>r eine Unrecht tun, <strong>und</strong> zwar<br />
mit Absicht, <strong>und</strong> <strong>de</strong>nnoch erlei<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re kein Unrecht,<br />
weil er es willentlich hinnimmt. Umgekehrt kann einer Unrecht<br />
erlei<strong>de</strong>n, falls er das Unrecht gegen seinen Willen erlei<strong>de</strong>t, <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>nnoch tut <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re, weil er aus Unwissenheit han<strong>de</strong>lt, kein<br />
Unrecht im formellen (eigentlichen) Sinn, son<strong>de</strong>rn nur mate<br />
riell (äußerlich gesehen).<br />
4. ARTIKEL<br />
Sündigt schwer, wer Unrecht tut?<br />
1. Die läßliche Sün<strong>de</strong> steht im Gegensatz zur schweren.<br />
Doch bisweilen ist es nur läßliche Sün<strong>de</strong>, wenn jemand Unrecht<br />
tut. Aristoteles sagt nämlich im V.Buch seiner Ethik (c. 10;<br />
1136 a 6), wenn er von solchen spricht, die Unrecht tun: „Nach<br />
sicht verdienen fehlerhafte Handlungen, wenn sie nicht bloß in<br />
Unwissenheit, son<strong>de</strong>rn auch aus Unwissenheit geschehen".<br />
Also sündigt man nicht immer schwer, wenn man Unrecht tut.<br />
2. Wer in einer unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Sache Unrecht tut, weicht<br />
nur wenig von <strong>de</strong>r „Mitte" ab. Dies aber ist nach Aristoteles'<br />
Ethik (V, 9; 1109 b 18) erträglich <strong>und</strong> unter die kleinen Übel<br />
zu rechnen. Also sündigt nicht je<strong>de</strong>r schwer, <strong>de</strong>r Unrecht tut.<br />
3. Die Caritas (übernatürliche Gottesliebe) ist die „Mutter<br />
aller Tugen<strong>de</strong>n"; was zu ihr in Gegensatz steht, heißt Todsün<strong>de</strong>.<br />
Doch nicht alle Sün<strong>de</strong>n, die an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n wi<strong>de</strong>rsprechen,<br />
sind Todsün<strong>de</strong>n. Also ist Unrechttun auch nicht immer Tod<br />
sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN steht: was sich gegen Gottes Gebot richtet, ist<br />
Todsün<strong>de</strong>. Doch wer Unrecht tut, han<strong>de</strong>lt gegen ein Gesetz<br />
Gottes, gehe es um Diebstahl, um Ehebruch, um Mord o<strong>de</strong>r<br />
etwas an<strong>de</strong>res <strong>de</strong>rgleichen, wie weiter unten auseinan<strong>de</strong>rgelegt<br />
wird (Fr. 64ff.). Wer Unrecht tut, begeht also eine Todsün<strong>de</strong>.<br />
39
59. 4 ANTWORT. Wie oben (I-II72,5), als es um <strong>de</strong>n Unterschied<br />
<strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>n ging, gesagt wur<strong>de</strong>, ist Todsün<strong>de</strong>, was <strong>de</strong>r Caritas,<br />
die <strong>de</strong>r Seele das Leben verleiht, wi<strong>de</strong>rspricht. Je<strong>de</strong>r Scha<strong>de</strong>n<br />
aber, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Nächsten zugefügt wird, wi<strong>de</strong>rstreitet an sich <strong>de</strong>r<br />
Caritas, die dazu antreibt, <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren Gutes zu wollen. Da<br />
nun Unrecht immer in <strong>de</strong>r Schädigung <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren besteht, ist<br />
offensichtlich, daß Unrechttun seiner Art nach Todsün<strong>de</strong> ist.<br />
Zu 1. Jenes Aristoteleswort versteht sich vom Nichtwissen<br />
<strong>de</strong>s Tatbestan<strong>de</strong>s, das er selbst (Eth. 111,2; 1110b31) mit<br />
„Nichtwissen <strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>ren Umstän<strong>de</strong>" bezeichnet. Dieses<br />
verdient Nachsicht, nicht jedoch das Nichtwissen <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>s<br />
lage. Dieses entschuldigt nicht. Wer aber unwissentlich Unrecht<br />
tut, tut es nur beiläufig (per acci<strong>de</strong>ns; vgl. o. Art. 2).<br />
Zu 2. Wer in Kleinigkeiten Unrecht tut, erfüllt nicht <strong>de</strong>n<br />
Vollbegriff <strong>de</strong>s Unrechttuns, insofern man annehmen darf, sol<br />
ches sei nicht gänzlich gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>ssen, <strong>de</strong>r es erlei<strong>de</strong>t,<br />
z.B. wenn jemand einem einen Apfel o<strong>de</strong>r etwas <strong>de</strong>rgleichen<br />
wegnimmt, wodurch <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re wohl kaum Scha<strong>de</strong>n erlei<strong>de</strong>t<br />
o<strong>de</strong>r sich <strong>de</strong>swegen ungehalten zeigt.<br />
Zu 3. Die Sün<strong>de</strong>n gegen die an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n verursachen<br />
beim an<strong>de</strong>ren nicht immer Scha<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn tragen eine<br />
gewisse Unordnung in die menschlichen Lei<strong>de</strong>nschaften hinein.<br />
Die Gesichtspunkte sind also verschie<strong>de</strong>n.<br />
40
60. FRAGE<br />
DIE RECHTSPRECHUNG<br />
Hierauf ist die <strong>Recht</strong>sprechung zu betrachten. Dazu gibt es 6<br />
Fragen:<br />
1. Ist die <strong>Recht</strong>sprechung ein Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
2. Ist es erlaubt, <strong>Recht</strong> zu sprechen?<br />
3. Darf man auf Verdachtsgrün<strong>de</strong> hin <strong>Recht</strong> sprechen?<br />
4. Müssen Zweifel nach <strong>de</strong>r günstigeren Seite hin gelöst<br />
wer<strong>de</strong>n?<br />
5. Muß man immer nach <strong>de</strong>m geschriebenen Gesetz <strong>Recht</strong><br />
sprechen?<br />
6. Wird die <strong>Recht</strong>sprechnung durch Anmaßung beeinträch<br />
tigt?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist die <strong>Recht</strong>sprechung ein Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
1. Aristoteles schreibt im I. Buch seiner Ethik (c. 1; 1094 b 27):<br />
„Je<strong>de</strong>r beurteilt gut, was er kennt." Die <strong>Recht</strong>sprechung ist<br />
<strong>de</strong>mnach also Sache <strong>de</strong>r Erkenntniskraft. Die Erkenntniskraft<br />
wird jedoch durch die Klugheit vervollkommnet. Also gehört<br />
die <strong>Recht</strong>sprechung mehr zur Klugheit als zur <strong>Gerechtigkeit</strong>,<br />
die im Willen ihren Sitz hat (Fr. 58,4).<br />
2. Der Apostel schreibt im 1. Korintherbrief 2,15: „Der<br />
geisterfüllte Mensch urteilt über alles". Doch am meisten<br />
geisterfüllt wird <strong>de</strong>r Mensch durch die Tugend <strong>de</strong>r Caritas<br />
(übernatürliche Gottesliebe), die „ausgegossen ist in unsere<br />
Herzen durch <strong>de</strong>n Heiligen Geist, <strong>de</strong>r uns gegeben ist", wie es<br />
im Römerbrief 5,5 heißt. Also gehört die <strong>Recht</strong>sprechung eher<br />
zur Caritas als zur <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
3. Je<strong>de</strong> Tugend muß sich ein richtiges Urteil über ihre eigene<br />
Materie bil<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn nach <strong>de</strong>s Aristoteles Ethik (111,6;<br />
1113a 32) „urteilt <strong>de</strong>r Tugendhafte über alles <strong>und</strong> je<strong>de</strong>s richtig".<br />
Die <strong>Recht</strong>sprechung gehört also nicht in höherem Maß zur<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> als zu <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren sittlichen Tugen<strong>de</strong>n.<br />
4. Die <strong>Recht</strong>sprechung scheint einzig Sache <strong>de</strong>r Richter zu<br />
sein. Gerechtes Han<strong>de</strong>ln jedoch gibt es bei allen Gerechten. Da<br />
nun nicht nur die Richter allein gerecht sind, ist wohl auch die<br />
<strong>Recht</strong>sprechung kein <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> eigener Akt.<br />
41
60.1 DAGEGEN heißt es im Ps93,15: „... bis zur <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
das Gerichtswesen zurückkehrt."<br />
ANTWORT. „<strong>Recht</strong>sprechung" be<strong>de</strong>utet im eigentlichen<br />
Sinn <strong>de</strong>n Akt <strong>de</strong>s Richters, insofern er Richter ist. „Richter"<br />
(ju<strong>de</strong>x) aber heißt soviel wie „<strong>Recht</strong> sprechend" (jus dicens).<br />
Nun ist das <strong>Recht</strong> das Objekt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, wie oben<br />
(Fr. 57,1) dargelegt wur<strong>de</strong>. Und so besagt „<strong>Recht</strong>sprechung"<br />
nach ihrem unmittelbaren Wortsinn Bestimmung o<strong>de</strong>r Fest<br />
legung <strong>de</strong>s Gerechten o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. Die Fähigkeit aber, ge<br />
nau richtig sagen zu können, was tugendhaft ist, hängt ent<br />
schei<strong>de</strong>nd vom Habitus <strong>de</strong>r Tugend ab. So vermag z.B. <strong>de</strong>r<br />
Keusche genau anzugeben, was zur Keuschheit gehört. In glei<br />
cher Weise unterliegt die <strong>Recht</strong>sprechung, die in <strong>de</strong>r richtigen<br />
Bestimmung <strong>de</strong>ssen, was recht ist, besteht, <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>. Daher schreibt Aristoteles im V. Buch <strong>de</strong>r Ethik<br />
(c.7; 1132a 20): Die Menschen „nehmen ihre Zuflucht zum<br />
Richter wie zu einer Art von lebendiger <strong>Gerechtigkeit</strong>".<br />
Zu 1. Das Wort „<strong>Recht</strong>sprechung" wur<strong>de</strong> zunächst für die<br />
richtige Bestimmung <strong>de</strong>ssen gebraucht, was gerecht ist, sodann<br />
jedoch auf die richtige Bestimmung an<strong>de</strong>rer Dinge übertragen,<br />
sowohl im Bereich <strong>de</strong>s reinen Denkens als auch <strong>de</strong>s praktischen<br />
Tuns. Immer jedoch setzt eine sachgemäße <strong>Recht</strong>sprechung<br />
zwei Dinge voraus: einmal die Fähigkeit, ein Urteil zu bil<strong>de</strong>n,<br />
<strong>und</strong> so ist die <strong>Recht</strong>sprechung ein Akt <strong>de</strong>r Vernunft; etwas aus<br />
zusprechen o<strong>de</strong>r zu <strong>de</strong>finieren, ist nämlich Sache <strong>de</strong>r Vernunft.<br />
Das an<strong>de</strong>re Erfor<strong>de</strong>rnis besteht in <strong>de</strong>r persönlichen Eignung<br />
<strong>de</strong>s Richten<strong>de</strong>n zum richtigen Urteil. In Sachen <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
geht die <strong>Recht</strong>sprechung also aus <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
hervor, wie das, was zur Tapferkeit gehört, <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r<br />
Tapferkeit entspringt. Die <strong>Recht</strong>sprechung ist daher ein Akt <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, insofern diese zum richtigen Urteilen geneigt<br />
macht, ein Akt <strong>de</strong>r Klugheit jedoch, insofern sie das Urteil<br />
ausspricht. Daher heißt auch die „Synesis" (<strong>de</strong>r „hausbackene<br />
Verstand"), die zur Klugheit gehört, „treffen<strong>de</strong> Urteilskraft"<br />
(vgl. Fr. 51,3).<br />
Zu 2. Der geistliche Mensch [13] besitzt kraft <strong>de</strong>r Tugend<br />
Caritas die Geneigtheit, alles nach göttlichen Normen zu beur<br />
teilen. Im Blick auf sie spricht er, gelenkt durch die Gabe <strong>de</strong>r<br />
Weisheit, sein Urteil aus, so wie <strong>de</strong>r Gerechte, gelenkt durch die<br />
Tugend <strong>de</strong>r Klugheit, im Blick auf die Normen <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s sein<br />
Urteil ausspricht.<br />
42
Zu 3. Die übrigen Tugen<strong>de</strong>n schaffen Ordnung im Men- 60. 2<br />
sehen selbst, die <strong>Gerechtigkeit</strong> jedoch in seinen Beziehungen zu<br />
an<strong>de</strong>ren (vgl. Fr. 58,2). Nun ist <strong>de</strong>r Mensch Herr über das, was<br />
ihn selber, nicht jedoch über das, was an<strong>de</strong>re betrifft. Daher<br />
verlangen die an<strong>de</strong>ren Tugendbereiche nur das Urteil <strong>de</strong>s per<br />
sönlich Tugendhaften, freilich in <strong>de</strong>r erweiterten Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s<br />
Wortes (vgl. Zu 1). Doch in Sachen <strong>Gerechtigkeit</strong> ist darüber<br />
hinaus das Urteil eines Höheren vonnöten, „<strong>de</strong>r bei<strong>de</strong> zurecht<br />
weisen <strong>und</strong> seine Hand auf bei<strong>de</strong> legen darf" (Job 9,33). Daher<br />
gehört die <strong>Recht</strong>sprechung im eigentlichen Sinn viel eher zur<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> als zu irgen<strong>de</strong>iner an<strong>de</strong>ren Tugend.<br />
Zu 4. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist im Fürsten als schöpferische<br />
Tugend, sie befiehlt <strong>und</strong> schreibt gleichsam vor, was gerecht ist.<br />
In <strong>de</strong>n Untergebenen hingegen ist sie ausführen<strong>de</strong> <strong>und</strong> die<br />
nen<strong>de</strong> Tugend. Daher gehört die <strong>Recht</strong>sprechung, durch die das<br />
Gerechte festgelegt wird, zur <strong>Gerechtigkeit</strong>, insofern sie auf<br />
höhere Weise im Staatsoberhaupt ist.<br />
2. ARTIKEL<br />
Ist es erlaubt, <strong>Recht</strong> zu sprechen?<br />
1. Strafe wird nur für Unerlaubtes verhängt. Doch <strong>de</strong>n<br />
Richten<strong>de</strong>n droht Strafe, <strong>de</strong>r Nichtrichten<strong>de</strong> entgehen gem. Mt<br />
7,1: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet wer<strong>de</strong>t!" Also ist<br />
<strong>Recht</strong>sprechen unerlaubt.<br />
2. Rom 14,4 heißt es: „Wie kannst du <strong>de</strong>n Diener eines<br />
an<strong>de</strong>ren richten? Sein Herr entschei<strong>de</strong>t, ob er steht o<strong>de</strong>r fällt."<br />
Der Herr aller aber ist Gott. Also steht es keinem Menschen zu,<br />
<strong>Recht</strong> zu sprechen.<br />
3. Kein Mensch ist ohne Sün<strong>de</strong> gem. 1 Jol,8: „Wenn wir<br />
sagen, daß wir keine Sün<strong>de</strong> haben, führen wir uns selber in die<br />
Irre." Doch nach Rom 2,1 darf <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>r nicht richten: „Du<br />
bist unentschuldbar - wer du auch bist, Mensch -, wenn du<br />
richtest. Denn worin du <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren richtest, darin verurteilst<br />
du dich selber, da du, <strong>de</strong>r Richten<strong>de</strong>, dasselbe tust." Also ist es<br />
nieman<strong>de</strong>m erlaubt, <strong>Recht</strong> zu sprechen.<br />
DAGEGEN steht Dt 16,18: „Innerhalb aller <strong>de</strong>iner Tore<br />
sollst du Richter <strong>und</strong> Vorsteher einsetzen, damit sie das Volk<br />
mit gerechtem Gerichte richten."<br />
43
60. 2 ANTWORT. <strong>Recht</strong>sprechen ist insoweit erlaubt, als es einen<br />
Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> darstellt. Damit aber das <strong>Recht</strong>sprechen<br />
ein Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ist, sind nach <strong>de</strong>m oben Gesagten<br />
(Art. 1 Zu 1 u. 3) drei Dinge nötig: 1. es muß aus <strong>de</strong>r Bereit<br />
schaft zur <strong>Gerechtigkeit</strong> hervorgehen, 2. es muß die Autorität<br />
<strong>de</strong>r Obrigkeit dahinterstehen, 3. es muß mit richtig bedachter<br />
Klugheit vorgetragen wer<strong>de</strong>n. Fehlt einer dieser Punkte, ist die<br />
<strong>Recht</strong>sprechung fehlerhaft <strong>und</strong> unerlaubt. Verstößt sie gegen<br />
die ein<strong>de</strong>utige <strong>Gerechtigkeit</strong>, dann ist sie „pervers" o<strong>de</strong>r „unge<br />
recht". Fällt <strong>de</strong>r Mensch Urteile auf Gebieten, für die er nicht<br />
zuständig ist, spricht man von „angemaßter" <strong>Recht</strong>sprechung.<br />
Fehlt es an rationaler Sicherheit, z. B. wenn jemand aufgr<strong>und</strong><br />
leichter Mutmaßungen über Zweifelhaftes o<strong>de</strong>r Verborgenes<br />
urteilt, dann heißt man dies „Verdachts"- o<strong>de</strong>r „Unbesonnen<br />
heitsurteil".<br />
Zu 1. Der Herr verbietet dort leichtsinniges Urteilen über<br />
innere Absichten o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re unsichere Dinge (vgl. Augustinus:<br />
Bergpredigt II, 18; ML 34,1237). - O<strong>de</strong>r er verbietet das Urteil<br />
über göttliche Dinge, die wir nicht beurteilen dürfen, weil sie<br />
uns übersteigen o<strong>de</strong>r weil wir sie schlicht <strong>und</strong> einfach glauben<br />
müssen, wie Hilarius sagt (Matthäuskommentar c.5; ML 9,<br />
950). - O<strong>de</strong>r er verbietet das Urteil, das nicht aus Wohlwollen,<br />
son<strong>de</strong>rn aus bitterer Gesinnung gefällt wird (so <strong>de</strong>r Unvoll<br />
en<strong>de</strong>te Matthäuskommentar <strong>de</strong>s Cbrysostomus, Horn. 17;<br />
MG 56,725).<br />
Zu 2. Der Richter wird eingesetzt als Diener Gottes. Daher<br />
heißt es im Buch Deuteronomium 1,16: „Richtet, was recht<br />
ist!" <strong>und</strong> weiter (17): „Denn Gottes ist das Gericht".<br />
Zu 3. Wer im Zustand schwerer Sün<strong>de</strong> lebt, darf <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r in<br />
gleiche o<strong>de</strong>r weniger schwere Sün<strong>de</strong>n verstrickt ist, nicht rich<br />
ten, wie Cbrysostomus zu Mt7,1: „Richtet nicht!" (Horn. 23;<br />
MG57,310) sagt. Dies gilt vor allem dann, wenn die Sün<strong>de</strong>n<br />
öffentlich sind, <strong>de</strong>nn dies erregt Ärgernis in <strong>de</strong>n Herzen <strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>ren. Sind sie jedoch nicht öffentlich, son<strong>de</strong>rn geheim, <strong>und</strong><br />
erweist sich ein Urteil von Amts wegen als notwendig, kann er<br />
(<strong>de</strong>r sündige Richter) in Demut <strong>und</strong> Furcht zurechtweisen o<strong>de</strong>r<br />
richten. Darum schreibt Augustinus im Buch Uber die Berg<br />
predigt (11,19; ML34,1299): „Wenn wir uns in <strong>de</strong>mselben<br />
Fehler befin<strong>de</strong>n, laßt uns ihn bedauern <strong>und</strong> uns zu gemeinsamer<br />
Anstrengung aufmuntern." - Damit verurteilt sich <strong>de</strong>r Mensch<br />
nicht selbst, wodurch er sich etwa ein neues Verdienst erwerben<br />
44
wür<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn er beweist, daß er selbst, in<strong>de</strong>m er einen 60.3<br />
an<strong>de</strong>ren verurteilt, wegen <strong>de</strong>r gleichen o<strong>de</strong>r einer ähnlichen<br />
Sün<strong>de</strong> ebenso verurteilungswürdig ist.<br />
3. ARTIKEL<br />
Ist ein Urteil auf bloßen Verdacht hin unerlaubt?<br />
1. Unter Verdacht versteht man eine unsichere Meinung<br />
über etwas Böses. Daher wen<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Verdacht nach<br />
Aristoteles (Etil.VI,3; 1139b 17) <strong>de</strong>m wahren <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Falschen<br />
zu. Doch in <strong>de</strong>r Welt <strong>de</strong>s Zufälligen läßt sich nur eine<br />
unsichere Meinung bil<strong>de</strong>n. Da sich nun das Urteil <strong>de</strong>s Men<br />
schen auf das menschliche Tun bezieht, das sich im Einzelnen<br />
<strong>und</strong> Zufälligen abspielt, scheint jegliches Urteil unerlaubt zu<br />
sein, wenn man überhaupt nicht auf Verdacht hin urteilen darf.<br />
2. Ein unerlaubtes Urteil fügt <strong>de</strong>m Nächsten Unrecht zu.<br />
Doch böse Verdächtigung existiert nur in <strong>de</strong>r Meinung <strong>de</strong>s<br />
Menschen, <strong>und</strong> so wirkt sie sich nicht als Unrecht gegen einen<br />
an<strong>de</strong>ren aus. Also ist Urteil auf Verdacht hin nicht unerlaubt.<br />
3. Ist es unerlaubt, muß es auf die Ungerechtigkeit zurück<br />
geführt wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn das Urteil ist ein Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
(Art. 1). Doch Ungerechtigkeit ist ihrer Art nach Todsün<strong>de</strong><br />
(Fr. 59,4). Also wäre Urteil auf Verdacht hin immer Todsün<strong>de</strong>,<br />
wenn es unerlaubt wäre. Dies jedoch ist falsch, <strong>de</strong>nn „Verdacht<br />
läßt sich nicht vermei<strong>de</strong>n", wie die Glosse Augustins zu 1 Kor.<br />
4,5: „Richtet nicht vor <strong>de</strong>r Zeit!" (ML 191,1566) sagt. Also<br />
scheint ein Urteil auf Verdacht hin nicht unerlaubt zu sein.<br />
DAGEGEN schreibt Cbrysostomus zum Matthäuswort (7,1)<br />
„Richtet nicht!": „Der Herr verbietet mit diesem Befehl nicht,<br />
aus Wohlwollen an<strong>de</strong>re zurechtzuweisen, son<strong>de</strong>rn daß sie aus<br />
Einbildung auf ihre <strong>Gerechtigkeit</strong> als Christen die an<strong>de</strong>ren<br />
Christen verachten, in<strong>de</strong>m sie meist auf bloße Verdachtsgrün<strong>de</strong><br />
hin die an<strong>de</strong>ren hassen <strong>und</strong> verurteilen" (Unvollen<strong>de</strong>ter Mt-<br />
Kommentar, Horn. 17; MG 56,725).<br />
ANTWORT. Wie Cicero sagt, be<strong>de</strong>utet Verdächtigung, wenn<br />
sie schwach begrün<strong>de</strong>t ist, soviel wie Vermutung von etwas<br />
Bösem (Tuscul. 4,7). Und dies geschieht aus dreifachem<br />
Gr<strong>und</strong>. Einmal <strong>de</strong>shalb, weil jemand selber schlecht ist <strong>und</strong><br />
darum im Bewußtsein seiner Schlechtigkeit von an<strong>de</strong>ren leicht<br />
etwas Schlechtes <strong>de</strong>nkt gemäß Prd 10,3: „Wenn <strong>de</strong>r Tor auf<br />
45
60. 3 seinem Wege wan<strong>de</strong>lt, hält er, da er selbst ein Tor ist, alle für<br />
Toren". - Sodann kommt es daher, daß sich jemand mit einem<br />
an<strong>de</strong>ren schlecht versteht. Verachtet o<strong>de</strong>r haßt jemand einen<br />
an<strong>de</strong>ren o<strong>de</strong>r hegt er Zorn- o<strong>de</strong>r Neidgefühle gegen ihn, dann<br />
genügen geringe An<strong>de</strong>utungen, um ihn <strong>de</strong>s Bösen zu verdäch<br />
tigen, <strong>de</strong>nn, was man wünscht, das glaubt man gern. - Drittens<br />
spielt lange Erfahrung noch eine Rolle, weshalb Aristoteles im<br />
II. Buch seiner Rhetorik (c. 13; 1389 b 21) schreibt: „Greise sind<br />
aufs höchste argwöhnisch, da sie oftmals das Versagen ihrer<br />
Mitmenschen erlebt haben".<br />
Die ersten bei<strong>de</strong>n Ursachen <strong>de</strong>s Argwohns sind offensicht<br />
lich <strong>de</strong>r Verkehrtheit <strong>de</strong>r Affekte zuzuschreiben. Die dritte<br />
Ursache jedoch schwächt <strong>de</strong>n Grad <strong>de</strong>r Verdächtigung ab,<br />
in<strong>de</strong>m die Erfahrung die Gewißheit, die ja <strong>de</strong>n Verdacht auf<br />
hebt, wachsen läßt. Verdächtigung trägt also <strong>de</strong>n Makel <strong>de</strong>s<br />
Sündhaften an sich, <strong>und</strong> je mehr sie sich steigert, umso schlim<br />
mer wird sie.<br />
Der Argwohn hat drei Gra<strong>de</strong>. Beim ersten fängt <strong>de</strong>r Mensch<br />
an, auf leichte Grün<strong>de</strong> hin an <strong>de</strong>r Ta<strong>de</strong>llosigkeit <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn zu<br />
zweifeln. Dies ist läßliche <strong>und</strong> leichte Sün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn „es gehört<br />
nun einmal zur menschlichen Versuchung, ohne die unser<br />
Leben nicht vonstatten geht", wie es in <strong>de</strong>r Glosse zu 1 Kor 4,5<br />
(„Richtet nicht vor <strong>de</strong>r Zeit!") heißt (ML 191,1566). - Beim<br />
zweiten Grad nimmt jemand aufgr<strong>und</strong> schwacher Anhalts<br />
punkte Bösartigkeit bei seinem Nächsten als sichere Tatsache<br />
an. Dies ist im Falle schweren Vorwurfs eine Todsün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn es<br />
geht nicht ohne Verachtung <strong>de</strong>s Nächsten ab. Die Glosse fährt<br />
darum dort weiter: „Wenn wir <strong>de</strong>shalb auch nicht allen Arg<br />
wohn mei<strong>de</strong>n können, weil wir Menschen sind, so müssen wir<br />
uns doch mit <strong>de</strong>m endgültigen <strong>und</strong> bestimmten Urteil zurück<br />
halten." - Der dritte Grad wird erreicht, wenn ein Richter auf<br />
gr<strong>und</strong> von Verdacht zur Verurteilung schreitet. Dies fällt unmit<br />
telbar in das Gebiet <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit. Daher ist es schwere<br />
Sün<strong>de</strong>.<br />
Zu 1. Beim menschlichen Tun gibt es eine gewisse Sicher<br />
heit, nicht zwar so wie in <strong>de</strong>n streng beweisbaren Wissenschaf<br />
ten, son<strong>de</strong>rn entsprechend <strong>de</strong>r gegebenen Materie, z. B. wenn<br />
etwas durch geeignete Zeugenaussagen bewiesen wird.<br />
Zu 2. Dadurch, daß sich jemand über einen ohne hinrei<br />
chen<strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong> eine schlechte Meinung bil<strong>de</strong>t, verachtet er ihn<br />
zu Unrecht. Und somit beleidigt er ihn.<br />
46
Zu 3. Weil sich <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Unrecht auf äußere Handlungen 60. 4<br />
beziehen (Fr. 58,8.10.11), fällt das Verdächtigungsurteil, falls<br />
es zum äußeren Akt kommt, direkt in das Gebiet <strong>de</strong>r Ungerech<br />
tigkeit. Und dann ist es, wie soeben gesagt, schwere Sün<strong>de</strong>. Das<br />
innere Urteil jedoch gehört zur <strong>Gerechtigkeit</strong> durch seine Bezo-<br />
genheit zum äußeren Urteil wie <strong>de</strong>r innere Akt zum äußeren,<br />
vergleichbar <strong>de</strong>m-Verhältnis Begier<strong>de</strong> - Unzucht <strong>und</strong> Zorn -<br />
Mord.<br />
4. ARTIKEL<br />
Müssen Zweifel nach <strong>de</strong>r günstigeren Seite hin gelöst<br />
wer<strong>de</strong>n?<br />
1. Die <strong>Recht</strong>sprechung muß sich nach <strong>de</strong>m richten, was in<br />
<strong>de</strong>n meisten Fällen vorkommt. Doch meistens ist es so, daß die<br />
Leute schlecht han<strong>de</strong>ln, <strong>de</strong>nn, wie <strong>de</strong>r Prediger 1,15 sagt, ist<br />
„die Zahl <strong>de</strong>r Toren unendlich groß", <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Genesis 8,21<br />
heißt es: „Der Sinn <strong>de</strong>s Menschen ist zum Bösen geneigt von<br />
Jugend an." Also müssen wir die Zweifel eher nach <strong>de</strong>r schlech<br />
ten als nach <strong>de</strong>r guten Seite hin lösen.<br />
2. Augustinus schreibt (Uber die christliche Lehre 1,27;<br />
ML 34,29): „Fromm <strong>und</strong> gerecht lebt, wer die Dinge unbe<br />
stechlich beurteilt" <strong>und</strong> nach keiner Seite hin abirrt. Jener aber,<br />
<strong>de</strong>r im Zweifel nach <strong>de</strong>r besseren Seite hin auslegt, geht nach<br />
einer Seite hin fehl. Dies darf man nicht tun.<br />
3. Der Mensch muß seinen Nächsten lieben wie sich selbst.<br />
Doch für sich selbst muß er seine Zweifel im ungünstigeren<br />
Licht sehen gemäß Job 9,28: „Ich fürchte alle meine Werke."<br />
Also muß man, was beim Nächsten zweifelhaft erscheint, wohl<br />
im schlechteren Sinne auslegen.<br />
DAGEGEN schreibt die Glosse zu Rom 14,3 („Wer kein<br />
Fleisch ißt, richte <strong>de</strong>n nicht, <strong>de</strong>r es ißt"): „Zweifel müssen nach<br />
<strong>de</strong>r günstigeren Seite hin ausgelegt wer<strong>de</strong>n" (ML 191,1512).<br />
ANTWORT. Wie oben (Art. 3,2) gesagt, fügt jemand, <strong>de</strong>r<br />
sich ohne genügen<strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong> von einem an<strong>de</strong>ren eine schlechte<br />
Meinung bil<strong>de</strong>t, diesem Unrecht zu <strong>und</strong> verachtet ihn. Nie<br />
mand jedoch darf einen an<strong>de</strong>ren ohne zwingen<strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong> ver<br />
achten o<strong>de</strong>r ihm irgen<strong>de</strong>inen Scha<strong>de</strong>n zufügen. Und darum<br />
müssen wir, solange von einem keine sicheren Beweise für seine<br />
47
60. 4 Schlechtigkeit vorliegen, ihn als gut ansehen <strong>und</strong> einen auf<br />
kommen<strong>de</strong>n Zweifel nach <strong>de</strong>r guten Seite hin auslegen.<br />
Zu 1. Es kann vorkommen, daß häufig getäuscht wird, wer<br />
sich von <strong>de</strong>r guten Auslegung leiten läßt. Doch ist es besser, daß<br />
jemand, <strong>de</strong>r von einem schlechten Menschen eine gute Meinung<br />
hat, häufig hereinfällt, als daß er seltener getäuscht wird, in<strong>de</strong>m<br />
er von einem guten Menschen eine schlechte Meinung hat, <strong>de</strong>nn<br />
dadurch wird einem Unrecht getan, nicht jedoch im ersteren<br />
Fall.<br />
Zu 2. Etwas an<strong>de</strong>res ist das Urteil über Sachen <strong>und</strong> etwas<br />
. an<strong>de</strong>res über Menschen. Beim Urteil über Sachen spielen gut<br />
<strong>und</strong> bös auf Seiten <strong>de</strong>r Sache, die wir beurteilen, keine Rolle, sie<br />
trägt keinen Scha<strong>de</strong>n davon, gleich wie wir über sie urteilen.<br />
Hier kommt nur die geistige Verfassung <strong>de</strong>s Urteilen<strong>de</strong>n in<br />
Frage; sie ist gut, falls er richtig, sie ist schlecht, falls er falsch<br />
urteilt, <strong>de</strong>nn „das Wahre ist das Gut <strong>de</strong>s Verstan<strong>de</strong>s, das Falsche<br />
sein Übel", wie Aristoteles im VI. Buch seiner Ethik schreibt<br />
(c. 2; 1130a27). Daher muß ein je<strong>de</strong>r darauf bedacht sein, die<br />
Dinge sachgemäß zu beurteilen. - Doch beim Urteil über Men<br />
schen fällt <strong>de</strong>r Blick vor allem auf das Wohl <strong>und</strong> Wehe <strong>de</strong>ssen,<br />
<strong>de</strong>r beurteilt wird: ergibt sich ein günstiges Urteil, gilt er als<br />
Ehrenmann, kommt er schlecht davon, ist er verachtenswert.<br />
Daher müssen wir bei einer solchen Richtertätigkeit eher<br />
danach streben, <strong>de</strong>n Menschen gut zu beurteilen, es sei <strong>de</strong>nn<br />
ein<strong>de</strong>utig ein Gr<strong>und</strong> für das Gegenteil vorhan<strong>de</strong>n. Für <strong>de</strong>n rich<br />
ten<strong>de</strong>n Menschen jedoch wirkt sich ein falsch getroffenes gutes<br />
Urteil nicht negativ auf seine geistige Verfassung aus, <strong>de</strong>nn ihr<br />
guter Zustand hängt nicht von <strong>de</strong>r Erkenntnis zufälliger Einzel<br />
wahrheiten, son<strong>de</strong>rn vielmehr von <strong>de</strong>r richtigen affektiven Ein<br />
stellung ab.<br />
Zu 3. Auf zweifache Weise geschieht die Auslegung nach <strong>de</strong>r<br />
schlechten o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r guten Seite hin. Einmal dadurch, daß wir<br />
von einer bestimmten Annahme ausgehen. So ist es von Vorteil,<br />
bei <strong>de</strong>r Anwendung eines Heilmittels, sei es bei uns, sei es bei<br />
an<strong>de</strong>ren, das Schlechtere anzunehmen, um so ein wirksameres<br />
Mittel einzusetzen, <strong>de</strong>nn eine Medizin, die gegen ein größeres<br />
Übel hilft, hilft noch viel mehr gegen ein kleineres. - Auf an<strong>de</strong>re<br />
Weise legen wir etwas zum Guten o<strong>de</strong>r Schlechten aus durch<br />
genaue Bestimmung o<strong>de</strong>r durch Entscheidung. So muß man bei<br />
<strong>de</strong>r Beurteilung von Sachen danach trachten, je<strong>de</strong>s Ding so<br />
einzuschätzen, wie es wirklich ist, sich beim Urteil über Men-<br />
48
sehen jedoch für die bessere Seite entschei<strong>de</strong>n (vgl. Antwort u. 60. 5<br />
Zu 2).<br />
5. ARTIKEL<br />
Muß man immer nur nach <strong>de</strong>m geschriebenen Gesetz <strong>Recht</strong><br />
sprechen?<br />
1. Ein ungerechtes Urteil ist stets zu vermei<strong>de</strong>n. Doch bis<br />
weilen enthalten die geschriebenen Gesetze Unrecht gemäß<br />
Is 10,1: „Weh <strong>de</strong>nen, die ungerechte Gesetze erlassen <strong>und</strong><br />
Ungerechtigkeiten nie<strong>de</strong>rschreiben!" Also darf man nicht<br />
immer nach <strong>de</strong>n geschriebenen Gesetzen <strong>Recht</strong> sprechen.<br />
2. Die <strong>Recht</strong>sprechung muß sich mit einzelnen Vorkomm<br />
nissen beschäftigen. Doch ein geschriebenes Gesetz kann nicht<br />
alle einzelnen Vorkommnisse berücksichtigen, wie Aristoteles<br />
im V.Buch seiner Ethik (c. 14; 1137b 13) schreibt. Also darf<br />
man nicht immer nach geschriebenen Gesetzen <strong>Recht</strong> sprechen.<br />
3. Das Gesetz wird schriftlich festgelegt, damit <strong>de</strong>r Wille <strong>de</strong>s<br />
Gesetzgebers <strong>de</strong>utlich zum Ausdruck gelangt. Doch bisweilen<br />
kommt es vor, daß <strong>de</strong>r Gesetzgeber, wäre er selbst zugegen,<br />
an<strong>de</strong>rs urteilen wür<strong>de</strong>. Also darf man nicht immer nach <strong>de</strong>m<br />
geschriebenen Gesetz <strong>Recht</strong> sprechen.<br />
DAGEGEN schreibt Augustinus in seinem Buch Uber die<br />
wahre Religion (c. 3; ML34,148): „So ist es mit <strong>de</strong>n zeitlichen<br />
Gesetzen: obgleich die Menschen, wenn sie sie verfassen, über<br />
sie urteilen, so steht es, sobald sie verfaßt <strong>und</strong> bestätigt sind,<br />
keinem Richter mehr zu, über sie zu urteilen, vielmehr hat er<br />
nach ihnen zu urteilen."<br />
ANTWORT. Wie gesagt (Art. 1), ist <strong>de</strong>r Richterspruch nichts<br />
an<strong>de</strong>res als die Bestimmung <strong>und</strong> Begrenzung <strong>de</strong>ssen, was<br />
gerecht ist. Gerecht aber wird etwas auf zweifache Weise. Ein<br />
mal aus <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>r Sache heraus, <strong>und</strong> dies heißt „Natur<br />
recht". Auf an<strong>de</strong>re Weise durch Vereinbarung unter <strong>de</strong>n Men<br />
schen, <strong>und</strong> dies nennt man „positives <strong>Recht</strong>" (vgl. Fr. 57,2). Zur<br />
Erklärung bei<strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sarten wer<strong>de</strong>n nun schriftlich Gesetze<br />
erlassen, freilich in verschie<strong>de</strong>nem Sinn. Denn das geschriebene<br />
Gesetz enthält zwar das Naturrecht, doch es hat es nicht<br />
begrün<strong>de</strong>t: es schöpft seine Kraft nämlich nicht aus <strong>de</strong>m<br />
Gesetz, son<strong>de</strong>rn aus <strong>de</strong>r Natur. Das positive <strong>Recht</strong> aber ist im<br />
schriftlichen Gesetz enthalten, wur<strong>de</strong> durch es begrün<strong>de</strong>t <strong>und</strong><br />
49
60. 6 erhält von ihm seine autoritative Kraft. Der Richterspruch muß<br />
also nach <strong>de</strong>m geschriebenen Gesetz erfolgen, sonst nämlich<br />
wür<strong>de</strong> er entwe<strong>de</strong>r vom Naturrecht o<strong>de</strong>r vom positiven <strong>Recht</strong><br />
abweichen.<br />
Zu 1. Wie das geschriebene Gesetz <strong>de</strong>m Naturrecht nicht<br />
seine verpflichten<strong>de</strong> Kraft verleiht, so kann es auch seine Kraft<br />
nicht min<strong>de</strong>rn o<strong>de</strong>r aufheben, <strong>de</strong>r menschliche Wille vermag die<br />
Natur nicht zu verän<strong>de</strong>rn. Wenn daher das geschriebene Gesetz<br />
etwas Naturrechtswidriges enthält, dann ist es ungerecht <strong>und</strong><br />
besitzt keine Verbindlichkeit: das postive <strong>Recht</strong> kommt näm<br />
lich nur dort infrage, wo es <strong>de</strong>m Naturrecht gegenüber „keine<br />
Rolle spielt, ob es so o<strong>de</strong>r so gefaßt wird", wie oben (Fr. 57,2,2)<br />
erklärt wor<strong>de</strong>n ist. Daher sind <strong>de</strong>rartige schriftliche Festlegun<br />
gen auch nicht „Gesetze", son<strong>de</strong>rn vielmehr Zerrüttung <strong>de</strong>r<br />
Gesetze zu nennen (vgl. 1-1195,2). Aus diesem Gr<strong>und</strong> darf<br />
man nach ihnen auch nicht <strong>Recht</strong> sprechen.<br />
Zu 2. Wie die ungerechten Gesetze von sich aus <strong>de</strong>m Natur<br />
recht wi<strong>de</strong>rsprechen, sei es immer, sei es in <strong>de</strong>n meisten Fällen,<br />
so bewähren sich auch ordnungsgemäß erlassene positive<br />
Gesetze in gewissen Fällen nicht, <strong>und</strong> wür<strong>de</strong>n sie befolgt, wäre<br />
es gegen das Naturrecht. Daher ist in <strong>de</strong>rartigen Fällen nicht<br />
nach <strong>de</strong>m Buchstaben <strong>de</strong>s Gesetzes <strong>Recht</strong> zu sprechen, son<strong>de</strong>rn<br />
auf die Billigkeit, die <strong>de</strong>r Gesetzgeber im Auge hat, zurück<br />
zugreifen. Der Gesetzesgelehrte sagte <strong>de</strong>nn auch (Dig. 1,3;<br />
KRI, 34): „Keine <strong>Recht</strong>sauffassung o<strong>de</strong>r die Mil<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Billigkeit<br />
dul<strong>de</strong>t es, daß wir das, was zum N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>r Menschen heilsam<br />
eingeführt wird, durch eine härtere Auslegung gegen ihren Vor<br />
teil verschärfen." In solchen Fällen wür<strong>de</strong> auch <strong>de</strong>r Gesetzgeber<br />
an<strong>de</strong>rs urteilen, <strong>und</strong>, hätte er es in Betracht gezogen, auch<br />
gesetzlich so festgelegt haben.<br />
Daraus ergibt sich die Antwort Zu 3.<br />
6. ARTIKEL<br />
Wird die <strong>Recht</strong>sprechung durch Anmaßung beeinträchtigt?<br />
1. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> besteht in einer gewissen <strong>Recht</strong>heit <strong>de</strong>s<br />
Han<strong>de</strong>lns. Der Wahrheit geschieht nun kein Eintrag, gleich von<br />
wem sie ausgesprochen wird, sie ist vielmehr von je<strong>de</strong>m anzu<br />
nehmen. Also wird auch die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht beeinträchtigt,<br />
50
gleich von wem immer das Gerechte bestimmt wird, was ja zum 60. 6<br />
Wesen <strong>de</strong>s Urteilsspruches gehört.<br />
2. Die Sün<strong>de</strong>n zu bestrafen gehört zur <strong>Recht</strong>sprechung. Von<br />
manchen liest man jedoch in loben<strong>de</strong>r Weise, sie hätten Sün<strong>de</strong>n<br />
bestraft, obwohl sie über die Strafwürdigen keine Befugnis<br />
besessen hätten, wie z. B. Moses, <strong>de</strong>r einen Ägypter erschlug<br />
(Ex2,llff.), <strong>und</strong> Phinees, <strong>de</strong>r Sohn <strong>de</strong>s Eleazar, <strong>de</strong>n Cambri,<br />
<strong>de</strong>n Sohn Saloms (Nm25,7ff.), „<strong>und</strong> es wur<strong>de</strong> ihm als Tat <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> angerechnet", wie es im Ps 106,31 heißt. Also hat<br />
Anmaßung <strong>de</strong>r richterlichen Funktion nichts mit Unge<br />
rechtigkeit zu tun.<br />
3. Geistliche <strong>und</strong> weltliche Gewalt sind verschie<strong>de</strong>n. Doch<br />
bisweilen mischen sich kirchliche Vorgesetzte mit geistlicher<br />
Gewalt in weltliche Angelegenheiten ein. Also ist angemaßte<br />
richterliche Tätigkeit nicht unerlaubt.<br />
4. Der ordnungsgemäße Urteilsspruch setzt nicht nur ent<br />
sprechen<strong>de</strong> Befugnis voraus, son<strong>de</strong>rn verlangt vom Richter<br />
auch Wissen <strong>und</strong> die Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> (Art. 1, Zu 1 u.<br />
Zu 2; Art. 2). Doch spricht man nicht von ungerechtem Urteil,<br />
wenn einem Richter die Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> abgeht o<strong>de</strong>r<br />
ihm die nötige <strong>Recht</strong>skenntnis fehlt. Also wird auch angemaß<br />
tes Richten, das trotz mangeln<strong>de</strong>r Autorität ausgeübt wircj,<br />
nicht immer ungerecht sein.<br />
DAGEGEN heißt es Rom 14,4: „Wie kannst du <strong>de</strong>n Diener<br />
eines an<strong>de</strong>ren richten?"<br />
ANTWORT. Da ein Urteil gemäß <strong>de</strong>n geschriebenen Gesetzen<br />
gefällt wer<strong>de</strong>n muß (Art. 5), interpretiert <strong>de</strong>r Richter<br />
irgendwie <strong>de</strong>n Gesetzestext dadurch, daß er ihn auf <strong>de</strong>n Einzel<br />
fall anwen<strong>de</strong>t. Da es nun Sache <strong>de</strong>rselben Autorität ist, ein<br />
Gesetz auszulegen <strong>und</strong> es vorzuschreiben, so kann, wie das<br />
Gesetz nur durch die öffentliche Autorität erlassen wer<strong>de</strong>n<br />
kann, auch ein Urteil nur kraft öffentlicher Autorität - die sich<br />
auf alle Glie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Gesellschaft erstreckt - gefällt wer<strong>de</strong>n. Und<br />
wie es ungerecht wäre, jeman<strong>de</strong>n zur Befolgung eines Gesetzes,<br />
das nicht durch die öffentliche Autorität ge<strong>de</strong>ckt ist, zu zwin<br />
gen, so ist es auch ungerecht, wenn jemand einen dazu bringen<br />
wollte, ein Urteil anzunehmen, das nicht von <strong>de</strong>r öffentlichen<br />
Autorität getragen wird.<br />
Zu 1. Die Verkündigung <strong>de</strong>r Wahrheit nötigt nieman<strong>de</strong>n, ihr<br />
beizustimmen, es steht je<strong>de</strong>m frei, sie nach Gutdünken anzu<br />
nehmen o<strong>de</strong>r nicht anzunehmen. Ein Richterspruch hingegen<br />
51
60. 6 übt einen gewissen Druck aus. Darum ist es unrecht, wenn<br />
einer von jeman<strong>de</strong>m gerichtet wird, <strong>de</strong>r nicht öffentlich autori<br />
siert ist.<br />
Zu 2. Moses hat <strong>de</strong>n Ägypter wohl aufgr<strong>und</strong> einer durch<br />
göttliche Eingebung mitgeteilten Befugnis getötet. Dies scheint<br />
Apg 7,24 f. nahezulegen: „Nach<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>n Ägypter erschlagen<br />
hatte, dachte Moses, seine Brü<strong>de</strong>r wür<strong>de</strong>n begreifen, daß Gott<br />
<strong>de</strong>n Israeliten durch seine Hand Rettung bringen wolle." - O<strong>de</strong>r<br />
man kann sagen, Moses habe <strong>de</strong>n Ägypter getötet, in<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>r Unrecht gelitten hatte, mit <strong>de</strong>m gebotenen Maß <strong>de</strong>r Not<br />
wehr verteidigte. Daher schreibt Ambrosius in seiner Pflichten<br />
lehre (1,36; ML 16,75): „Wer Unrecht von seinem Gefährten<br />
nicht abwehrt, obwohl er kann, ist ebenso in Schuld wie jener,<br />
<strong>de</strong>r es zufügt." - O<strong>de</strong>r es läßt sich mit Augustinus (QQ in<br />
Exod. II; ML 34,597) die Meinung vertreten: „Wie die Er<strong>de</strong> vor<br />
<strong>de</strong>m Aufgehen nützlicher Samen wegen <strong>de</strong>r Fruchtbarkeit<br />
unnützer Kräuter gelobt wird, so war jene Tat <strong>de</strong>s Moses zwar an<br />
sich fehlerhaft, doch barg sie das Zeichen großerFruchtbarkeit",<br />
insofern sie nämlich das Zeichen seiner Kraft war, mit <strong>de</strong>r er<br />
sein Volk befreien sollte.<br />
Von Phinees aber ist zu sagen, daß er das, vom Eifer für Gott<br />
getrieben, auf göttliche Eingebung hin tat. - O<strong>de</strong>r weil er, zwar<br />
nicht Hoherpriester, so doch immerhin sein Sohn war, <strong>und</strong> ihm<br />
dadurch dieses Gericht ebenso zustand wie <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Rich<br />
tern, die zu so etwas verpflichtet waren.<br />
Zu 3. Die weltliche Gewalt ist <strong>de</strong>r geistlichen untenan wie<br />
<strong>de</strong>r Leib <strong>de</strong>r Seele. Es gilt daher nicht als <strong>Recht</strong>sanmaßung,<br />
wenn ein geistlicher Vorgesetzter sich in zeitliche Dinge ein<br />
mischt, soweit ihm die weltliche Gewalt untersteht, o<strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>m, was ihm diese überläßt.<br />
Zu 4. Der Habitus von Wissenschaft <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> sind<br />
Vollkommenheiten <strong>de</strong>r einzelnen Person. Fehlen sie, dann kann<br />
man nicht von angemaßter <strong>Recht</strong>sprechung re<strong>de</strong>n wie im Fall<br />
von fehlen<strong>de</strong>r öffentlicher Autorität, auf <strong>de</strong>r die zwingen<strong>de</strong><br />
Kraft <strong>de</strong>s Urteils beruht.<br />
52
61. FRAGE<br />
DIE TEILE DER GERECHTIGKEIT<br />
Hierauf sind die Teile [14] <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zu betrachten.<br />
Und zwar erstens die subjektiven Teile. Dies sind die Arten <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, nämlich die austeilen<strong>de</strong> <strong>und</strong> die ausgleichen<strong>de</strong><br />
[Tausch-, Verkehrs-] <strong>Gerechtigkeit</strong> [15]. Zweitens die vervoll<br />
ständigen<strong>de</strong>n Teile. Drittens die potentiellen Teile, nämlich die<br />
verwandten Tugen<strong>de</strong>n.<br />
Bezüglich <strong>de</strong>r erstgenannten Teile ergibt sich eine doppelte<br />
Betrachtung: 1. <strong>de</strong>r Teile <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> selbst, 2. <strong>de</strong>r ent<br />
gegenstehen<strong>de</strong>n Laster. Und weil die Rückerstattung (Resti<br />
tution) ein Akt <strong>de</strong>r Tauschgerechtigkeit ist, ist zunächst über<br />
<strong>de</strong>n Unterschied von ausgleichen<strong>de</strong>r <strong>und</strong> austeilen<strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit, sodann über die Restitution nachzu<strong>de</strong>nken.<br />
Zum Ersten ergeben sich 4 Fragen:<br />
1. Gibt es zwei Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong>, nämlich die aus<br />
teilen<strong>de</strong> <strong>und</strong> die ausgleichen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
2. Ist die „Mitte" bei bei<strong>de</strong>n gleich?<br />
3. Haben sie die gleiche o<strong>de</strong>r eine verschie<strong>de</strong>ne Materie?<br />
4. Be<strong>de</strong>utet gerecht bei einer <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Arten soviel wie ein<br />
fach Wie<strong>de</strong>rvergeltung?<br />
1. ARTIKEL<br />
Gibt es zwei Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong>, die austeilen<strong>de</strong><br />
<strong>und</strong> die ausgleichen<strong>de</strong>?<br />
1. Es kann keine Art von <strong>Gerechtigkeit</strong> geben, die <strong>de</strong>r<br />
Gemeinschaft scha<strong>de</strong>t, da die <strong>Gerechtigkeit</strong> ja auf das Gemein<br />
wohl ausgerichtet ist. Doch die gemeinsamen Güter auf viele<br />
verteilen scha<strong>de</strong>t <strong>de</strong>m gemeinen Wohl aller, weil dadurch<br />
sowohl die gemeinsamen Subsistenzmittel erschöpft wer<strong>de</strong>n,<br />
als auch beson<strong>de</strong>rs weil so die Moral <strong>de</strong>r Menschen untergraben<br />
wird. Cicero sagt nämlich in seiner Pflichtenlehre (II, 15): „Wer<br />
empfängt, wird schlechter <strong>und</strong> möchte dauernd dasselbe erwar<br />
ten." Also kann das Verteilen nicht eine Art von <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
bil<strong>de</strong>n.<br />
2. Wie oben (Fr. 58,2) dargelegt, besteht <strong>de</strong>r Akt <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit darin, je<strong>de</strong>m zu geben, was sein ist. Doch beim Verteilen<br />
53
61. l wird nicht je<strong>de</strong>m gegeben, was sein ist, son<strong>de</strong>rn es eignet sich<br />
dabei einer etwas an, was gemeinsam war. Dies gehört nicht zur<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
3. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist nicht nur im Fürsten, son<strong>de</strong>rn auch<br />
in <strong>de</strong>n Untertanen (vgl. Fr. 58,6). Doch das Verteilen ist immer<br />
Sache <strong>de</strong>s Fürsten. Also gehört es nicht zur <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
4. „Das Austeilunsgerechte betrifft die gemeinsamen Gü<br />
ter", sagt Aristoteles im V.Buch seiner Ethik (c.7; 1131 b27).<br />
Doch das Gemeinsame fällt unter die Gesetzesgerechtigkeit.<br />
Also ist die Verteilungsgerechtigkeit keine Art <strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>ren<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit.<br />
5. Eins <strong>und</strong> Viel bewirkt in <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>r Tugend keinen Un<br />
terschied. Nun besteht die Tauschgerechtigkeit darin, daß etwas<br />
einem einzigen gegeben wird, die Verteilungsgerechtigkeit dar<br />
in, daß viele etwas bekommen. Also sind es nicht zwei verschie<br />
<strong>de</strong>ne Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
DAGEGEN spricht Aristoteles im V. Buch seiner Ethik (c. 5;<br />
1130b 31) von zwei Teilen <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> sagt: „die eine<br />
ist für das Zuteilen zuständig, die an<strong>de</strong>re für die Tauschhand<br />
lungen".<br />
ANTWORT. Wie erwähnt (Fr. 58,7), ist die Son<strong>de</strong>rgerechtig<br />
keit auf eine private Person, die sich zur Gemeinschaft wie ein<br />
Teil zum Ganzen verhält, hingeordnet. Der Teil kann jedoch un<br />
ter einem doppelten Ordnungsbezug gesehen wer<strong>de</strong>n. Einmal<br />
als Teil zum Teil, was <strong>de</strong>r Ordnung einer Privatperson zu einer<br />
an<strong>de</strong>ren entspricht. Diese Ordnung regelt die ausgleichen<strong>de</strong><br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, die in einer Tauschhandlung unter zwei Personen<br />
besteht. Die an<strong>de</strong>re Ordnung beruht auf <strong>de</strong>m Verhältnis <strong>de</strong>s<br />
Ganzen zu seinen Teilen <strong>und</strong> entspricht <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r<br />
Gemeinschaftsgüter zu <strong>de</strong>n einzelnen Personen. Diese Ord<br />
nung untersteht <strong>de</strong>r Verteilungsgerechtigkeit, die das Gemein<br />
same in angemessener Weise auf die einzelnen verteilt. Und so<br />
gibt es zwei Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong>, nämlich die ausglei<br />
chen<strong>de</strong> <strong>und</strong> die zuteilen<strong>de</strong>.<br />
Zu 1. Wie beim Geschenkemachen privater Personen Maß<br />
haltung empfohlen <strong>und</strong> Verschwendung geta<strong>de</strong>lt wird, so ist<br />
auch bei <strong>de</strong>r Verteilung <strong>de</strong>r gemeinsamen Güter Mäßigung zu<br />
beachten. Und hierbei greift die Verteilungsgerechtigkeit<br />
regelnd ein.<br />
Zu 2. Wie Teil <strong>und</strong> Ganzes gleichsam Eines sind, so gehört<br />
auch <strong>de</strong>m Teil, was <strong>de</strong>s Ganzen ist. Wenn daher von <strong>de</strong>n<br />
54
gemeinsamen Gütern etwas <strong>de</strong>m Einzelnen zugeteilt wird, so 61. 2<br />
erhält je<strong>de</strong>r in gewisser Weise das, „was sein ist".<br />
Zu 3. Das Verteilen <strong>de</strong>r gemeinschaftlichen Güter steht<br />
allein <strong>de</strong>m Verantwortlichen für die Gemeinschaftsgüter zu.<br />
Dennoch ist die Verteilungsgerechtigkeit auch eine Tugend <strong>de</strong>r<br />
Untergebenen, insofern sie mit <strong>de</strong>r gerechten Verteilung zufrie<br />
<strong>de</strong>n sind. Bisweilen freilich kommt es vor, daß die zur Verteilung<br />
anstehen<strong>de</strong>n Güter nicht <strong>de</strong>m Gemeinwesen, son<strong>de</strong>rn einer<br />
einzelnen Familie gehören. In diesem Fall kann die Verteilung<br />
autoritativ durch eine private Person erfolgen.<br />
Zu 4. Bewegungen wer<strong>de</strong>n spezifisch geprägt durch ihre<br />
Ziele. Und so ist es Sache <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit, die<br />
Belange <strong>de</strong>r Privatpersonen auf das Gemeinwohl hinzuordnen.<br />
Doch, umgekehrt, das Gemeinwohl durch Verteilung auf die<br />
Einzelpersonen auszurichten, ist Sache <strong>de</strong>r Verteilungsgerech<br />
tigkeit.<br />
Zu 5. Verteilungs- <strong>und</strong> Tauschgerechtigkeit unterschei<strong>de</strong>n<br />
sich nicht nur wie Eins <strong>und</strong> Viel, son<strong>de</strong>rn auch nach ihrem ver<br />
schie<strong>de</strong>nen Geschul<strong>de</strong>tsein: etwas an<strong>de</strong>res ist es nämlich,<br />
jeman<strong>de</strong>m etwas vom Gemeingut, etwas an<strong>de</strong>res, ihm sein<br />
Eigengut zu schul<strong>de</strong>n.<br />
2. ARTIKEL<br />
Wird die „Mitte" bei <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> auf gleiche Weise bestimmt?<br />
1. Bei<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>sarten fallen unter die Son<strong>de</strong>rgerech<br />
tigkeit (vgl. Art. 1). Nun wird bei allen Tugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Maßhal<br />
tung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Tapferkeit die „Mitte" in gleicherweise bestimmt.<br />
Also gilt dasselbe auch für die „Mitte" von verteilen<strong>de</strong>r <strong>und</strong> aus<br />
gleichen<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
2. Die Wesensform <strong>de</strong>r sittlichen Tugend ist die von <strong>de</strong>r Ver<br />
nunft bestimmte „Mitte". Da nun eine Tugend nur eine einzige<br />
Wesensform hat, muß die „Mitte" bei bei<strong>de</strong>n in gleicher Weise<br />
bestimmt wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Bei <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> wird die „Mitte" im<br />
Hinblick auf die Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Personen bestimmt. Doch die<br />
Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Personen fin<strong>de</strong>t auch bei <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> Berücksichtigung, wie z. B. im Fall <strong>de</strong>r Bestra<br />
fung: strenger wird bestraft, wer einen Fürsten geschlagen, als<br />
55
61. 2 jemand, <strong>de</strong>r sich an einer Privatperson vergriffen hat. Also wird<br />
bei bei<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong>sarten die „Mitte" in <strong>de</strong>rselben Weise<br />
bestimmt.<br />
DAGEGEN steht <strong>de</strong>s Aristoteles Erklärung im V. Buch seiner<br />
Ethik (c.6u. 7; 1131 a 29, b 32), wonach die Tugendmitte bei <strong>de</strong>r<br />
verteilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> nach <strong>de</strong>m „geometrischen", bei <strong>de</strong>r<br />
ausgleichen<strong>de</strong>n jedoch nach <strong>de</strong>m „arithmetischen Verhältnis"<br />
bestimmt wird.<br />
ANTWORT. Die verteilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> weist einer Pri<br />
vatperson etwas zu, was vonseiten <strong>de</strong>s Ganzen <strong>de</strong>m Teil<br />
zusteht. Dies ist umso größer, je be<strong>de</strong>utsamer die Stellung <strong>de</strong>s<br />
Teils im Ganzen ist. Daher wird bei <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n Gerechtig<br />
keit einem umso mehr von <strong>de</strong>n gemeinsamen Gütern gegeben,<br />
eine je höhere Stellung jene Person in <strong>de</strong>r Gemeinschaft ein<br />
nimmt. In <strong>de</strong>r aristokratischen Gesellschaft wird diese Vorrang<br />
stellung <strong>de</strong>r Tüchtigkeit zuerkannt, in <strong>de</strong>r oligarchischen <strong>de</strong>m<br />
Reichtum, in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>mokratischen <strong>de</strong>r Freiheit <strong>und</strong> in an<strong>de</strong>ren<br />
an<strong>de</strong>rs. Und so wird bei <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> die<br />
„Mitte" nicht nach <strong>de</strong>m Gleichmaß von Sache zu Sache, son<br />
<strong>de</strong>rn nach <strong>de</strong>m Verhältnis von Sachen zu Personen bestimmt,<br />
<strong>und</strong> zwar in <strong>de</strong>r Art, daß, wie eine Person eine an<strong>de</strong>re überragt,<br />
so auch die Sache, die <strong>de</strong>r einen Person gegeben wird, die Sache,<br />
die eine an<strong>de</strong>re erhält, überragt. Daher sagt Aristoteles (vgl.<br />
DAGEGEN), diese „Mitte" bestimme sich nach <strong>de</strong>m „geome<br />
trischen Verhältnis", bei <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Ausgleich nicht nach Quanti<br />
tät, son<strong>de</strong>rn nach Proportionalität erfolge. Es ist das gleiche,<br />
wie wenn wir sagen: wie sich 6 zu 4 verhält, so verhält sich 3 zu<br />
2, <strong>de</strong>nn hier wie dort haben wir das Verhältnis von an<strong>de</strong>rthalb,<br />
wobei das Größere das Ganze <strong>de</strong>s Kleineren <strong>und</strong> dazu noch<br />
<strong>de</strong>ssen Hälfte enthält; nicht jedoch besteht eine Gleichheit <strong>de</strong>s<br />
quantitativen Mehr, <strong>de</strong>nn 6 ist um 2 mehr als 4 <strong>und</strong> 3 um 1 mehr<br />
als 2.<br />
Im Tauschverkehr hingegen gibt man einer einzelnen Person<br />
etwas als Ausgleich für eine von ihr erhaltene Sache. Dies zeigt<br />
sich am <strong>de</strong>utlichsten bei Kauf <strong>und</strong> Verkauf, wo die Gr<strong>und</strong>struk<br />
tur <strong>de</strong>s Tausches zutagetritt. Und darum muß Sache mit Sache<br />
zur Übereinstimmung gebracht wer<strong>de</strong>n, so daß, was <strong>de</strong>r eine<br />
vom an<strong>de</strong>ren zu viel hat, <strong>de</strong>m zurückgegeben wer<strong>de</strong>, <strong>de</strong>m es<br />
gehört. Auf diese Weise entsteht ein Ausgleich entsprechend <strong>de</strong>r<br />
„arithmetischen" Mitte, die auf <strong>de</strong>m gleichen quantitativen<br />
Überhang beruht: so wie 5 die Mitte zwischen 6 <strong>und</strong> 4 ist, also<br />
56
um 1 Einheit darunter- <strong>und</strong> darübergeht. Wenn also bei Beginn 61. 3<br />
je<strong>de</strong>r 5 hatte <strong>und</strong> <strong>de</strong>r eine eine Einheit vom an<strong>de</strong>ren erhielt,<br />
dann hat einer, nämlich <strong>de</strong>r Empfangen<strong>de</strong>, 6 <strong>und</strong> <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren<br />
verbleiben noch 4. Es wird also erst dann <strong>Gerechtigkeit</strong> sein,<br />
wenn bei<strong>de</strong> zur Mitte zurückkehren, so daß, wer 6 hat, eine Ein<br />
heit <strong>de</strong>m abgibt, <strong>de</strong>r 4 besitzt; dann haben bei<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r 5, <strong>und</strong><br />
das ist die Mitte [16].<br />
Zu 1. Bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren sittlichen Tugen<strong>de</strong>n wird die Mitte<br />
von <strong>de</strong>r Vernunft <strong>und</strong> nicht von <strong>de</strong>r Sache her bestimmt. Doch<br />
bei <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ist die Sachmitte maßgeblich. Die Mitte<br />
än<strong>de</strong>rt sich also mit <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Sachbereichen.<br />
Zu 2. Ausgeglichenheit ist die allgemeine Wesensgestalt <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, <strong>und</strong> darin kommen Verteilungs- <strong>und</strong> Tausch<br />
gerechtigkeit überein. Bei <strong>de</strong>r einen jedoch herrscht geome<br />
trische, bei <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren arithmetische Proportionalität.<br />
Zu 3. Bei <strong>de</strong>n Handlungen <strong>und</strong> Lei<strong>de</strong>nschaften spielt die<br />
Stellung <strong>de</strong>r Person in <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>de</strong>s Quantums eine<br />
Rolle: größer nämlich ist das Unrecht, wenn ein Fürst, als wenn<br />
eine Privatperson geschlagen wird. Daher fin<strong>de</strong>t die Stellung<br />
<strong>de</strong>r Person bei <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> an sich Berück<br />
sichtigung, bei <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n jedoch nur insoweit, als sich<br />
dadurch eine Verschie<strong>de</strong>nheit in <strong>de</strong>r Sache ergibt.<br />
3. ARTIKEL<br />
Haben die bei<strong>de</strong>n Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong> verschie<strong>de</strong>ne<br />
Materien?<br />
1. Die Verschie<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>r Materien bil<strong>de</strong>t die Gr<strong>und</strong>lage für<br />
die verschie<strong>de</strong>nen Tugen<strong>de</strong>n, wie dies bei Maßhaltung <strong>und</strong><br />
Tapferkeit leicht zu ersehen ist. Wäre nun die Materie bei aus<br />
teilen<strong>de</strong>r <strong>und</strong> ausgleichen<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> verschie<strong>de</strong>n, dann<br />
könnten sie nicht ein <strong>und</strong> <strong>de</strong>rselben Tugend, nämlich <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, zugewiesen wer<strong>de</strong>n.<br />
2. Die Zuteilung, die zur distributiven <strong>Gerechtigkeit</strong> gehört,<br />
bezieht sich auf „Geld, Ehre <strong>und</strong> an<strong>de</strong>res, was unter die Mitglie<strong>de</strong>r<br />
eines Gemeinwesens verteilt wer<strong>de</strong>n kann", wie Aristoteles<br />
im V. Buch seiner Ethik (c.6; 1130 b 31) schreibt. Bei diesen gibt<br />
es aber auch gegenseitige Tauschgeschäfte, <strong>und</strong> dies fällt<br />
unter die ausgleichen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>. Also besteht zwischen<br />
57
61.3 <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> kein<br />
Unterschied in <strong>de</strong>r Materie.<br />
3. Entspricht <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> wegen ihres spezifischen Unterschie<strong>de</strong>s auch<br />
eine verschie<strong>de</strong>ne Materie, dann darf es dort, wo kein spezifi<br />
scher Unterschied vorhan<strong>de</strong>n ist, auch keine verschie<strong>de</strong>ne<br />
Materie geben. Doch Aristoteles nimmt für die ausgleichen<strong>de</strong><br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, die doch eine vielgestaltige Materie hat, nur eine<br />
einzige Art an. Den genannten <strong>Gerechtigkeit</strong>sarten entspricht<br />
also wohl keine vielgestaltige Materie.<br />
DAGEGEN steht im V. Buch <strong>de</strong>r Ethik (c.5; 1130b31): „Die<br />
eine Art von <strong>Gerechtigkeit</strong> hat die Leitung beim Verteilen, die<br />
an<strong>de</strong>re beim Tauschen."<br />
ANTWORT. Wie oben erklärt, hat es die <strong>Gerechtigkeit</strong> mit<br />
gewissen äußeren Handlungen zu tun, nämlich mit Verteilen<br />
<strong>und</strong> Tauschen. Dabei geht es um <strong>de</strong>n Umgang mit äußeren<br />
Gegebenheiten, seien es Sachen, Personen o<strong>de</strong>r Arbeitsleistun<br />
gen: Sachen, wie z. B. wenn jemand einem seine Sache stiehlt<br />
o<strong>de</strong>r gibt; Personen, wenn jemand einer Person Unrecht antut,<br />
z.B. sie schlägt o<strong>de</strong>r lästert o<strong>de</strong>r auch ihr seine Hochachtung<br />
erweist; Leistungen, wenn z.B. jemand von einem gerechter<br />
weise Arbeit verlangt o<strong>de</strong>r jeman<strong>de</strong>m einen Dienst erweist.<br />
Nehmen wir nun als Materie das an, worüber bei<strong>de</strong> Gerechtig<br />
keitsarten bei ihren Funktionen verfügen, so ist ihre Materie ein<br />
<strong>und</strong> dieselbe, <strong>de</strong>nn Sachen können sowohl vom gemeinsamen<br />
Besitz einzelnen zugeteilt wer<strong>de</strong>n als auch durch Tausch vom<br />
einen zum an<strong>de</strong>ren übergehen. Ebenso gibt es Zuteilung von<br />
beschwerlichen Arbeiten <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren Vergütung.<br />
Nehmen wir jedoch als Materie <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong>s<br />
arten ihre Haupthandlungen selbst, mittels <strong>de</strong>rer wir Personen,<br />
Sachen <strong>und</strong> Arbeitsleistungen in Dienst nehmen, so kommt<br />
jeweils eine an<strong>de</strong>re Materie zum Vorschein. Denn die vertei<br />
len<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> ist führend bei <strong>de</strong>r Verteilung, die aus<br />
gleichen<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n Tauschhandlungen, die zwischen zwei Per<br />
sonen stattfin<strong>de</strong>n können.<br />
Manche ausgleichen<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>sbeziehungen sind unfreiwil<br />
lig, manche freiwillig. Unfreiwilligkeit liegt vor, wenn sich<br />
jemand eine frem<strong>de</strong> Sache, eine Person o<strong>de</strong>r die Arbeit eines<br />
an<strong>de</strong>ren gegen seinen Willen zun<strong>utz</strong>e macht. Dies geschieht bis<br />
weilen heimlich durch Betrug, bisweilen offen durch Gewalt.<br />
Bei<strong>de</strong>s richtet sich gegen eine Sache o<strong>de</strong>r gegen eine Person, die<br />
58
Person selbst o<strong>de</strong>r gegen eine gemeinschaftlich verb<strong>und</strong>ene Per- 61.3<br />
son. Gegen eine Sache: wenn jemand die Sache <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren<br />
heimlich wegnimmt; dies nennt man Diebstahl. Geschieht es<br />
offen, heißt es Raub. Gegen die Person selbst: entwe<strong>de</strong>r durch<br />
Angriff auf ihre leibliche Existenz o<strong>de</strong>r auf ihre Wür<strong>de</strong>. Die leib<br />
liche Existenz einer Person wird heimlich verletzt durch hinter<br />
listiges Töten, Schlagen o<strong>de</strong>r Darreichen von Gift; offen durch<br />
Töten vor aller Augen o<strong>de</strong>r Gefangensetzung, durch Schlagen<br />
<strong>und</strong> Verstümmelung. Die Wür<strong>de</strong> einer Person verletzt man<br />
heimlich durch falsche Aussagen o<strong>de</strong>r Verleumdung, wodurch<br />
jemand ihren guten Ruf schädigt, <strong>und</strong> an<strong>de</strong>res <strong>de</strong>rgleichen;<br />
offen durch falsche Anklage vor Gericht o<strong>de</strong>r durch Beschimp-<br />
f u n §-<br />
Bezüglich einer in Gemeinschaft mit ihm stehen<strong>de</strong>n Person<br />
erlei<strong>de</strong>t jemand Scha<strong>de</strong>n in seiner Gattin durch meist heim<br />
lichen Ehebruch (vonseiten eines an<strong>de</strong>ren), im Knecht, wenn<br />
jemand <strong>de</strong>n Knecht dahin bringt, daß er seinen Herrn verläßt.<br />
Und auch dies kann offen geschehen. Das gleiche gilt von an<strong>de</strong><br />
ren gemeinschaftlich verb<strong>und</strong>enen Personen, gegen die eben<br />
falls auf alle Weise Unrecht begangen wer<strong>de</strong>n kann als ein<br />
Unrecht gegen <strong>de</strong>n hauptsächlich Betroffenen. Doch Ehebruch<br />
<strong>und</strong> Verführung <strong>de</strong>s Knechtes ist eigentlich Unrecht gegen diese<br />
Personen selbst, weil jedoch <strong>de</strong>r Knecht gewissermaßen zum<br />
Eigentum gehört, fällt dies unter Diebstahl.<br />
Freiwillig sind Tauschgeschäfte, wenn jemand seine Sache<br />
aus eigenem Antrieb einem an<strong>de</strong>ren aushändigt. Und wenn er<br />
sie ohne Schuldverpflichtung überträgt wie bei einer Schen<br />
kung, so ist dies kein Akt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Frei<br />
gebigkeit. Insoweit allerdings gehört die freiwillige Eigentums<br />
übertragung zur <strong>Gerechtigkeit</strong>, als dabei ein Geschul<strong>de</strong>tsein<br />
vorliegt. Dies kommt in drei Fällen vor. 1. wenn jemand sein<br />
Eigentum schlechthin als Gegenleistung für eine an<strong>de</strong>re Sache<br />
überträgt, wie dies bei Verkauf <strong>und</strong> Kauf zutrifft. - 2. wenn<br />
jemand sein Eigentum einem an<strong>de</strong>ren zur N<strong>utz</strong>ung überläßt<br />
mit <strong>de</strong>r Auflage, es zurückzuerstatten. Gewährt er freie Nut<br />
zung, dann spricht man bei Dingen, die Frucht bringen, von<br />
Nießbrauch, bei Dingen, die keine Frucht bringen, einfach von<br />
Darlehen o<strong>de</strong>r Leihgut, wie bei Münzen, Gefäßen u. dgl. Wird<br />
<strong>de</strong>r Gebrauch jedoch nicht umsonst gewährt, spricht man von<br />
Vermietung <strong>und</strong> Verpachtung. - 3. wenn jemand sein Eigentum<br />
einem anvertraut mit <strong>de</strong>r Absicht, es zurückzunehmen, nicht<br />
59
61. 4 zur N<strong>utz</strong>ung, son<strong>de</strong>rn entwe<strong>de</strong>r zum Verwahren wie bei <strong>de</strong>r<br />
Hinterlegung o<strong>de</strong>r als Ausdruck seiner Verpflichtung, wie wenn<br />
einer sein Eigentum als Pfand o<strong>de</strong>r als Bürgschaft für einen<br />
an<strong>de</strong>ren einsetzt.<br />
In allen diesen Aktionen, seien sie freiwillig, seien sie unfrei<br />
willig, geht es immer um die „Mitte" gemäß <strong>de</strong>r Gleichheit <strong>de</strong>r<br />
Gegenleistung. Daher sind sie auch alle einer einzigen Art von<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, nämlich <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n, zuzurechnen.<br />
Daraus ergeben sich die Antworten zu <strong>de</strong>n Einwän<strong>de</strong>n.<br />
4. ARTIKEL<br />
Ist <strong>Gerechtigkeit</strong> einfachhin das gleiche wie Vergeltung?<br />
1. Das göttliche Gericht ist schlechthin gerecht. Doch das<br />
göttliche Gericht besteht wesentlich darin, daß jemand Vergel<br />
tung erlei<strong>de</strong>t entsprechend <strong>de</strong>m, was er getan hat, gem. Mt 7,2:<br />
„Wie ihr richtet, so wer<strong>de</strong>t ihr gerichtet wer<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> nach <strong>de</strong>m<br />
Maß, mit <strong>de</strong>m ihr meßt, wird euch zugemessen wer<strong>de</strong>n." Also<br />
ist <strong>Gerechtigkeit</strong> einfach das gleiche wie Vergeltung.<br />
2. Bei bei<strong>de</strong>n Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong> wird etwas nach <strong>de</strong>m<br />
Gr<strong>und</strong>satz <strong>de</strong>s Ausgleichs gegeben: bei <strong>de</strong>r verteilen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> im Hinblick auf die Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Person, eine<br />
Wür<strong>de</strong>, die sich hauptsächlich nach <strong>de</strong>n Leistungen bemißt, die<br />
einer für die Gesellschaft erbracht hat; bei <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> im Hinblick auf die Sache, in <strong>de</strong>r jemand geschä<br />
digt wur<strong>de</strong>. Bei je<strong>de</strong>r dieser Ausgleichsformen wird vergolten<br />
nach <strong>de</strong>m, was einer getan hat. Also scheint die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
einfachhin in <strong>de</strong>r Vergeltung zu bestehen.<br />
3. Gewollt <strong>und</strong> ungewollt spielen in <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r Vergel<br />
tung eine entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle. Wer nämlich ungewollt ein<br />
Unrecht getan hat, wird weniger bestraft. Gewollt <strong>und</strong> unge<br />
wollt nun sind subjektive Größen, die die „Mitte" <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit, die eine sachbestimmte <strong>und</strong> nicht subjektbestimmte ist,<br />
nicht verän<strong>de</strong>rn. Also drückt sich <strong>Gerechtigkeit</strong> einfachhin<br />
durch Vergeltung aus.<br />
DAGEGEN beweist Aristoteles im V. Buch seiner Ethik (c. 8;<br />
1132b23), daß nicht je<strong>de</strong> <strong>Recht</strong>shandlung auf Vergeltung<br />
beruhe.<br />
ANTWORT. „Vergeltung" besagt gleichwertige Reaktion auf<br />
eine leidzufügen<strong>de</strong> Aktion. In seiner eigentlichsten Be<strong>de</strong>utung<br />
60
kommt dies zum Ausdruck, wenn jemand seinem Nächsten 61.4<br />
durch ungerechte Handlungen Leid zufügt, z. B., er hat ihn<br />
geschlagen, - also soll er einen Gegenschlag erlei<strong>de</strong>n! Dieses<br />
<strong>Recht</strong>sverhältnis fin<strong>de</strong>t im Gesetz (Ex 21,23) seine Bestäti<br />
gung: „Leben für Leben, Auge für Auge" usw. - Und weil auch<br />
Stehlen ein Tun ist, so spricht man in zweiter Linie hier ebenfalls<br />
von Vergeltung insofern, als, wer Scha<strong>de</strong>n zugefügt hat, an sei<br />
nem Eigentum Scha<strong>de</strong>n erlei<strong>de</strong>n soll. Auch dieser <strong>Recht</strong>sgr<strong>und</strong><br />
satz fin<strong>de</strong>t sich im Gesetz (Ex22,l): „Wenn jemand ein Rind<br />
o<strong>de</strong>r ein Schaf stiehlt <strong>und</strong> schlachtet es o<strong>de</strong>r verkauft es, so soll<br />
er fünf Rin<strong>de</strong>r für ein Rind zurückgeben <strong>und</strong> vier Schafe für ein<br />
Schaf." - Drittens wird das Wort „Vergeltung" auf freiwillige<br />
Tauschhandlungen übertragen, wo von bei<strong>de</strong>n Seiten Leistung<br />
<strong>und</strong> Gegenleistung erbracht wird, doch wegen <strong>de</strong>r Freiwilligkeit<br />
kann von „Erlei<strong>de</strong>n" kaum die Re<strong>de</strong> sein.<br />
In allen diesen Fällen muß jedoch gemäß <strong>de</strong>m Gr<strong>und</strong>satz <strong>de</strong>r<br />
Tauschgerechtigkeit Vergeltung durch Ausgleich erfolgen, d. h.<br />
die Reaktion muß <strong>de</strong>r Aktion entsprechen. Nicht immer jedoch<br />
wäre Gleichmaß gegeben, wenn einer für seine Tat einen spezi<br />
fisch gleichen Vergeltungsschlag erlei<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>. Denn wenn<br />
einer die Person eines höher Gestellten verletzt, so ist die Untat<br />
größer als was er durch die Vergeltung <strong>de</strong>rselben Art erlei<strong>de</strong>n<br />
wür<strong>de</strong>. Daher wird, wer einen Fürsten schlägt, nicht nur einfach<br />
selber ebenso geschlagen, son<strong>de</strong>rn viel schärfer bestraft. -<br />
Ebenso ist die Untat, durch die jemand <strong>de</strong>m Eigentum eines<br />
an<strong>de</strong>ren gegen seinen Willen Scha<strong>de</strong>n zufügt, größer, als die<br />
Vergeltung durch bloße Wegnahme <strong>de</strong>r [gestohlenen] Sache<br />
wäre, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Scha<strong>de</strong>nsstifter hätte dann an seinem Eigentum<br />
keine Einbuße erlitten. Daher muß er zur Strafe ein vielfaches<br />
herausrücken, hat er doch auch nicht nur eine Privatperson<br />
geschädigt, son<strong>de</strong>rn auch die Sch<strong>utz</strong>funktion <strong>de</strong>s Staates in<br />
Frage gestellt. - Desgleichen wäre auch in <strong>de</strong>n freiwilligen<br />
Tauschgeschäften die Gleichheit <strong>de</strong>r Entschädigung nicht<br />
gewährleistet, wenn unter zweien einfach Sache gegen Sache<br />
ausgewechselt wür<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn die Sache <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren könnte viel<br />
leicht viel wertvoller sein als die seine. Deshalb müssen<br />
Leistung <strong>und</strong> Gegenleistung bei Tauschgeschäften nach einem<br />
ausgewogenen Maßstab ins Gleichgewicht gebracht wer<strong>de</strong>n.<br />
Zu diesem Zweck wur<strong>de</strong> das Geld erf<strong>und</strong>en. Kurzum: Vergel<br />
tung ist das Tauschgerechte.<br />
61
61.4 Dies gilt jedoch nicht für die austeilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>. Denn<br />
hier kommt nicht ein abgewogener Ausgleich zwischen Sache<br />
<strong>und</strong> Sache o<strong>de</strong>r zwischen Aktion <strong>und</strong> Gegenaktion in Betracht,<br />
weswegen man von Vergeltung spricht, son<strong>de</strong>rn das Verhältnis<br />
von Sachen zu Personen, wie oben gesagt wur<strong>de</strong>.<br />
Zu 1. Das göttliche Gericht weist die Struktur <strong>de</strong>r ausglei<br />
chen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> auf: sie vergilt Verdienst mit Belohnung<br />
<strong>und</strong> Sün<strong>de</strong> mit Strafe.<br />
Zu 2. Wenn jemand, <strong>de</strong>r sich um das Gemeinwohl verdient<br />
gemacht hat, für seine Dienste belohnt wür<strong>de</strong>, erfolgte dies<br />
nicht nach <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn nach <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>. Denn die austeilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> schaut nicht<br />
auf <strong>de</strong>n Ausgleich zwischen Belohnung <strong>und</strong> Leistung, son<strong>de</strong>rn<br />
achtet darauf, daß entsprechend <strong>de</strong>n persönlichen Verhältnissen<br />
zugeteilt wird [17].<br />
Zu 3. Ist ein ungerechtes Vorgehen willentlich, so ist das<br />
Unrecht umso größer <strong>und</strong> wird als schwerwiegen<strong>de</strong> Sache<br />
betrachtet. Daher muß es durch eine schwerere Strafe ausgegli<br />
chen wer<strong>de</strong>n, allerdings nicht entsprechend unserer subjektiven<br />
Einstellung, son<strong>de</strong>rn gemäß <strong>de</strong>n sachlichen Unterschie<strong>de</strong>n.<br />
62
62. FRAGE<br />
DIE RÜCKERSTATTUNG [18]<br />
Hierauf ist die Rückerstattung zu betrachten. Dazu ergeben<br />
sich 8 Fragen:<br />
1. Wessen Akt ist sie?<br />
2. Ist es zum ewigen Heil notwendig, alles Entwen<strong>de</strong>te zu<br />
rückzugeben?<br />
3. Muß man ein Vielfaches zurückerstatten?<br />
4. Muß man zurückgeben, was man nicht entwen<strong>de</strong>t hat?<br />
5. Muß man <strong>de</strong>m zurückgeben, von <strong>de</strong>m es stammt?<br />
6. Muß es <strong>de</strong>r zurückgeben, <strong>de</strong>r es weggenommen hat?<br />
7. O<strong>de</strong>r ein an<strong>de</strong>rer?<br />
8. Muß man sofort zurückgeben?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist die Rückerstattung ein Akt <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
1. <strong>Gerechtigkeit</strong> verbin<strong>de</strong>t sich mit <strong>de</strong>m Gedanken <strong>de</strong>s<br />
Geschul<strong>de</strong>tseins. Doch wie man etwas schenken kann, ohne es<br />
zu schul<strong>de</strong>n, so verhält es sich auch mit <strong>de</strong>r Rückerstattung.<br />
Also hat die Rückerstattung nichts mit irgen<strong>de</strong>iner Art von<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> zu tun.<br />
2. Was vorbei ist <strong>und</strong> nicht mehr existiert, läßt sich nicht zu<br />
rückgeben. Nun beziehen sich <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> Ungerechtig<br />
keit auf gewisse Handlungen <strong>und</strong> Leidzufügungen, die nicht<br />
anhalten, son<strong>de</strong>rn vorübergehen. Also hat Rückerstattung wohl<br />
nichts mit irgen<strong>de</strong>iner Art von <strong>Gerechtigkeit</strong> zu tun.<br />
3. Rückerstattung ist eine Art von Ausgleich für eine weg<br />
genommene Sache. Nun kann man einem nicht nur beim Tausch,<br />
son<strong>de</strong>rn auch bei <strong>de</strong>r Zuteilung etwas wegnehmen, z. B. wenn<br />
jemand beim Zuteilen einem weniger gibt, als diesem gebührt.<br />
Also ist Rückgabe ebensosehr ein Akt <strong>de</strong>r verteilen<strong>de</strong>n wie <strong>de</strong>r<br />
ausgleichen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
DAGEGEN ist zu sagen: die Rückerstattung steht in Gegen<br />
satz zur Wegnahme, doch die Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n Sache<br />
ist ein Akt <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s Tausches.<br />
63
62.1 Also gehört die Rückgabe zu jener <strong>Gerechtigkeit</strong>, die im<br />
Tauschgeschäft maßgeblich ist.<br />
ANTWORT. Zurückerstatten (restituere) be<strong>de</strong>utet nichts<br />
an<strong>de</strong>res als jeman<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>rum (iterato) in sein Besitztum o<strong>de</strong>r<br />
ihn als Eigentümer einsetzen (statuere). Und so kommt bei <strong>de</strong>r<br />
Rückerstattung <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sausgleich im Ersatz einer Sache<br />
durch eine Sache zum Ausdruck, <strong>und</strong> das gehört zur ausglei<br />
chen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong>. Darum ist die Rückerstattung ein Akt<br />
<strong>de</strong>r Tauschgerechtigkeit, sei die Sache <strong>de</strong>s einen mit <strong>de</strong>ssen<br />
Zustimmung im Besitz <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren wie bei Tausch o<strong>de</strong>r Hinter<br />
legung, sei es gegen seinen Willen wie bei Raub <strong>und</strong> Diebstahl.<br />
Zu 1. Was einem nicht geschul<strong>de</strong>t wird, gehört ihm streng<br />
genommen nicht, auch wenn es ihm einmal gehört hat. Daher<br />
han<strong>de</strong>lt es sich auch mehr um eine neue Schenkung als um Rück<br />
erstattung, wenn jemand einem gibt, was er ihm nicht zu<br />
geben braucht. Eine gewisse Ähnlichkeit mit <strong>de</strong>r Rückgabe liegt<br />
allerdings vor, da die Sache materiell die gleiche ist. Doch unter<br />
<strong>de</strong>m eigentlichen Gesichtspunkt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, wonach sie<br />
jeman<strong>de</strong>s Eigentum sein muß, ist sie nicht die gleiche.<br />
Zu 2. Rückerstattung setzt, da sie in gewissem Sinn Wie<strong>de</strong>r<br />
holung be<strong>de</strong>utet, das Gleichbleiben <strong>de</strong>r Sache voraus. Darum<br />
kommt Rückgabe in ihrer ersten Be<strong>de</strong>utung vornehmlich bei<br />
materiellen Dingen in Betracht, die, weil sie substantiell <strong>und</strong><br />
eigentumsrechtlich gleichbleiben, von einem zum an<strong>de</strong>ren<br />
übergehen können. Doch weil <strong>de</strong>r Ausdruck „Tausch" von hier<br />
auf Handlungen o<strong>de</strong>r Leidzufügungen, die mit Ehrung o<strong>de</strong>r<br />
Beleidigung, also mit Nachteil o<strong>de</strong>r Vorteil für eine Person zu<br />
tun haben, übertragen wur<strong>de</strong>, so wird auch das Wort „Rücker<br />
stattung" dafür gebraucht, wenngleich [jene Handlungen] in<br />
Wirklichkeit nicht mehr vorhan<strong>de</strong>n sind <strong>und</strong> höchstens als<br />
Nachwirkung weiterdauern, sei es körperlicher Art, z. B. wenn<br />
jemand bei einer Schlägerei verw<strong>und</strong>et wird, sei es als Vorstel<br />
lung in <strong>de</strong>r Meinung <strong>de</strong>r Menschen, z. B. wenn jemand wegen<br />
eines Schimpfwortes seinen Leum<strong>und</strong> verliert o<strong>de</strong>r in seinem<br />
Ansehen geschmälert wird.<br />
Zu 3. Die Zugabe, die <strong>de</strong>r Verteilen<strong>de</strong> <strong>de</strong>m nachreicht, <strong>de</strong>r<br />
weniger als recht von ihm erhalten hat, erfolgt nach <strong>de</strong>m Ver<br />
hältnis von Sache zu Sache, insofern er ihm um so viel mehr<br />
geben muß, als er weniger, als ihm geschul<strong>de</strong>t war, erhalten<br />
hatte.<br />
64
2. ARTIKEL<br />
Ist die Rückgabe einer entwen<strong>de</strong>ten Sache zum ewigen Heil<br />
notwendig?<br />
1. Was unmöglich ist, ist zum ewigen Heil nicht nötig. Nun<br />
ist es bisweilen unmöglich, die weggenommene Sache zurück<br />
zugeben, z. B. wenn jemand einen eines Glie<strong>de</strong>s o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
Lebens beraubt hat. Also ist es zum Heil nicht notwendig, zu<br />
rückzuerstatten, was man einem an<strong>de</strong>ren weggenommen hat.<br />
2. Eine Sün<strong>de</strong> begehen ist zum Heil nicht notwendig, weil<br />
<strong>de</strong>r Mensch sonst nicht wüßte, was er tun soll. Nun läßt sich<br />
bisweilen, was einem genommen wur<strong>de</strong>, nicht ohne Sün<strong>de</strong> zu<br />
rückgeben, z. B. wenn jemand einem durch Ausplau<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r<br />
Wahrheit <strong>de</strong>n guten Ruf geraubt hat. Daher ist es zum Heil<br />
nicht nötig, das Weggenommene zurückzugeben.<br />
3. Was geschehen ist, läßt sich nicht ungeschehen machen.<br />
Nun kommt es vor, daß einer seine persönliche Ehre verliert,<br />
weil ihn jemand ungerecht ta<strong>de</strong>lt. Also kann ihm nicht zurück<br />
gegeben wer<strong>de</strong>n, was ihm geraubt wur<strong>de</strong>. Und so ist es eben<br />
auch zum ewigen Heil nicht notwendig, das Weggenommene<br />
zu restituieren.<br />
4. Wer einen daran hin<strong>de</strong>rt, ein Gut zu erlangen, nimmt es<br />
ihm weg. Nun sagt Aristoteles zwar im II. Buch seiner Physik<br />
(c.5; 197a2): „Fehlt nur wenig, so ist das soviel wie nichts."<br />
Wenn aber jemand einen daran hin<strong>de</strong>rt, eine Pfrün<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r dgl.<br />
zu erhalten, ist er nicht verpflichtet, die Pfrün<strong>de</strong> zu erstatten,<br />
<strong>de</strong>nn manchmal könnte er dies gar nicht. Also ist es zum Heil<br />
nicht notwendig, die weggenommene Sache zurückzugeben.<br />
DAGEGEN schreibt Augustinus (Briefl53; ML33,662):<br />
„Die Sün<strong>de</strong> wird nicht vergeben, wenn Weggenommenes nicht<br />
zurückgegeben."<br />
ANTWORT. Die Wie<strong>de</strong>rerstattung ist, wie gesagt (Art. 1) ein<br />
Akt <strong>de</strong>r Tauschgerechtigkeit, die in einem gewissen Ausgleich<br />
besteht. Daher be<strong>de</strong>utet Wie<strong>de</strong>rerstatten die Rückgabe jener<br />
Sache, die weggenommen wur<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn durch ihre erneute<br />
Übereignung wird <strong>de</strong>r Ausgleich wie<strong>de</strong>rhergestellt. Ist die<br />
Sache jedoch rechtmäßig weggenommen wor<strong>de</strong>n, dann ergäbe<br />
sich durch die Rückgabe Ungleichheit, <strong>de</strong>nn <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
besteht in Gleichheit. Da nun die Beobachtung <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit zum Heil notwendig ist, ist folglich auch die Rückgabe <strong>de</strong>s-<br />
65<br />
62. 2
62. 2 sen, was ungerechterweise einem weggenommen wur<strong>de</strong>, zum<br />
Heil notwendig.<br />
Zu 1. In Fällen, wo <strong>de</strong>r volle Ausgleich nicht möglich ist,<br />
genügt es, das Mögliche zu erstatten, wie dies „bei <strong>de</strong>r Bekun<br />
dung <strong>de</strong>r Ehre gegenüber Gott <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Eltern" offensichtlich ist<br />
(vgl. <strong>de</strong>s Aristoteles Eth.VIII,16; 1163b 16). Wenn daher das<br />
Weggenommene durch etwas Gleichwertiges nicht zu ersetzen<br />
ist, muß man wie<strong>de</strong>rgutmachen, soweit möglich. Wenn z. B.<br />
jemand einen eines Glie<strong>de</strong>s beraubt hat, muß er ihn mit Geld<br />
o<strong>de</strong>r Ehre entschädigen unter Beachtung - nach <strong>de</strong>m Urteil<br />
eines rechtschaffenen Mannes - <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>rseitigen Verhältnisse.<br />
Zu 2. Den guten Ruf kann jemand auf dreifache Weise zer<br />
stören. Einmal, in<strong>de</strong>m er die Wahrheit sagt, <strong>und</strong> zwar mit <strong>Recht</strong>,<br />
z. B. wenn jemand ordnungsgemäß ein Verbrechen zur Anzeige<br />
bringt. In diesem Fall besteht keine Verpflichtung zur Wie<strong>de</strong>r<br />
herstellung <strong>de</strong>s Leum<strong>und</strong>s. - Zweitens, in<strong>de</strong>m jemand unbe<br />
rechtigterweise Falsches aussagt, <strong>und</strong> dann ist er gehalten, <strong>de</strong>n<br />
guten Ruf wie<strong>de</strong>rherzustellen, in<strong>de</strong>m er eingesteht, Falsches<br />
verbreitet zu haben. - Drittens durch ungerechtfertigtes Ver<br />
breiten <strong>de</strong>r Wahrheit, z. B. wenn jemand entgegen <strong>de</strong>r bestehen<br />
<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>sordnung ein Verbrechen auf<strong>de</strong>ckt. In diesem Fall ist<br />
er verpflichtet, <strong>de</strong>n guten Ruf, soweit wie möglich - jedoch ohne<br />
Lüge - wie<strong>de</strong>rherzustellen, z. B. in<strong>de</strong>m er erklärt, er habe ihn<br />
böswillig o<strong>de</strong>r ungerechterweise um seinen guten Ruf gebracht.<br />
O<strong>de</strong>r es muß ihm, falls sich <strong>de</strong>r gute Ruf nicht wie<strong>de</strong>rherstellen<br />
läßt, auf an<strong>de</strong>re Weise Genugtuung verschafft wer<strong>de</strong>n, wie oben<br />
(Zu 1) für an<strong>de</strong>re Fälle ange<strong>de</strong>utet wur<strong>de</strong>.<br />
Zu 3. Beschimpfung kann nicht ungeschehen gemacht wer<br />
<strong>de</strong>n, doch ist es möglich, ihre Wirkung, nämlich die Min<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>s Ansehens einer Person in <strong>de</strong>r Meinung <strong>de</strong>r Menschen, durch<br />
Erweis von Hochachtung zu mil<strong>de</strong>rn.<br />
Zu 4. Jeman<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>r Erlangung einer Pfrün<strong>de</strong> zu hin<strong>de</strong>rn,<br />
ist auf vielfache Weise möglich. Einmal mit vollem <strong>Recht</strong>, z. B.<br />
wenn jemand, von <strong>de</strong>r Sorge für die Ehre Gottes o<strong>de</strong>r das Wohl<br />
<strong>de</strong>r Kirche bewogen, dafür sorgt, daß sie einer würdigeren Per<br />
son verliehen wer<strong>de</strong>. Dann besteht in keiner Weise die Pflicht<br />
zur Restitution o<strong>de</strong>r irgen<strong>de</strong>iner Art von Ersatz. - Sodann un<br />
gerechterweise, z. B. wenn man <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>n man hin<strong>de</strong>rt, aus Haß<br />
o<strong>de</strong>r Rachsucht o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>rgleichen Scha<strong>de</strong>n zufügen möchte.<br />
Falls er dadurch die Verleihung <strong>de</strong>r Pfrün<strong>de</strong> an einen Würdigen<br />
hintertreibt, in<strong>de</strong>m er, bevor die Verleihung bestätigt ist, rät, sie<br />
66
ihm nicht zu geben, ist er zwar, unter Beachtung <strong>de</strong>r persön- 62. 3<br />
liehen Verhältnisse <strong>und</strong> <strong>de</strong>s ganzen Vorgangs nach <strong>de</strong>m Urteil<br />
eines klugen Ratgebers, zu einer gewissen Wie<strong>de</strong>rgutmachung<br />
verpflichtet, nicht jedoch zum vollen Ersatz, weil jener die<br />
Pfrün<strong>de</strong> noch nicht in Besitz hatte <strong>und</strong> auf mancherlei Weise<br />
daran gehin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n konnte. Wenn die Pfrün<strong>de</strong>nverleihung<br />
jedoch bereits bestätigt war <strong>und</strong> einer aus nichtigem Gr<strong>und</strong><br />
ihren Wi<strong>de</strong>rruf bewirkte, so ist das soviel, als ob er ihm die<br />
bereits in Besitz genommene entrissen hätte. Dann ist er zur<br />
Erstattung <strong>de</strong>s gleichen Wertes verpflichtet, freilich entspre<br />
chend seinen Möglichkeiten.<br />
3. ARTIKEL<br />
Genügt es, einfach das zurückzugehen, was zu Unrecht<br />
genommen wur<strong>de</strong>?<br />
1. Ex22,l (21,37) heißt es: „Wenn einer ein Rind o<strong>de</strong>r ein<br />
Schaf stiehlt <strong>und</strong> es schlachtet o<strong>de</strong>r verkauft, soll er fünf Rin<strong>de</strong>r<br />
für ein Rind <strong>und</strong> vier Schafe für ein Schaf als Ersatz geben". Nun<br />
soll je<strong>de</strong>r das Gebot <strong>de</strong>s göttlichen Gesetzes beobachten. Wer<br />
stiehlt, muß also das Vier- o<strong>de</strong>r Fünffache zurückerstatten.<br />
2. „Was geschrieben wur<strong>de</strong>, ist zu unserer Belehrung<br />
geschrieben wor<strong>de</strong>n", heißt es im Römerbrief 15,4. Und bei<br />
Lkl9,8 sagt Zachäus zum Herrn: „Wenn ich jeman<strong>de</strong>n betro<br />
gen habe, gebe ich es vierfach zurück". Also muß <strong>de</strong>r Mensch<br />
das Vielfache <strong>de</strong>ssen, was er ungerecht an sich genommen hat,<br />
zurückerstatten.<br />
3. Keinem darf man gerechterweise nehmen, was er nicht<br />
herzugeben braucht. Doch <strong>de</strong>r Richter nimmt vom Dieb als<br />
Buße mehr, als er gestohlen hat. Also muß <strong>de</strong>r Mensch <strong>de</strong>m<br />
nachkommen. Und <strong>de</strong>shalb genügt die einfache Gegenleistung<br />
nicht.<br />
DAGEGEN steht, daß die Rückgabe das gestörte Gleichmaß<br />
wie<strong>de</strong>rherstellt. Wer nun einfach das, was er genommen hat, zu<br />
rückgibt, stellt das Gleichmaß tatsächlich wie<strong>de</strong>r her. Somit<br />
braucht man nur genau das zu restituieren, was man sich<br />
angeeignet hat.<br />
ANTWORT. Wenn jemand unrechtmäßig eine frem<strong>de</strong> Sache<br />
an sich nimmt, sind zwei Dinge zu beachten. Das eine ist die<br />
Ungleichheit auf <strong>de</strong>r sachlichen Seite, - was bisweilen mit<br />
67
62. 4 Unrecht nichts zu tun hat, wie z. B. beim Tausch. Das an<strong>de</strong>re ist<br />
die persönliche Schuld <strong>de</strong>s Unrechts. Diese kann auch bei sach<br />
licher Ausgeglichenheit bestehen, z. B. wenn jemand Gewalt<br />
anzuwen<strong>de</strong>n versucht, jedoch dabei keinen Erfolg hat. Bezüg<br />
lich <strong>de</strong>s ersten Punktes wird durch Rückerstattung Abhilfe<br />
geschaffen, insofern dadurch die Gleichheit wie<strong>de</strong>rhergestellt<br />
wird, <strong>und</strong> dazu genügt es, wenn genau das zurückgegeben wird,<br />
was einer an frem<strong>de</strong>m Besitz hatte. Doch <strong>de</strong>r Schuld wird durch<br />
Strafe begegnet, <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren Verhängung obliegt <strong>de</strong>m Richter.<br />
Bis zur richterlichen Verurteilung braucht also einer als Restitu<br />
tion nur zurückzugeben, was er weggenommen hat, nach <strong>de</strong>r<br />
Verurteilung jedoch hat er die Strafe abzubüßen.<br />
Zu 1. ist die Antwort also klar, <strong>de</strong>nn jenes Gesetz bestimmt<br />
die vom Richter aufzuerlegen<strong>de</strong> Strafe. Und obwohl nach <strong>de</strong>r<br />
Ankunft Christi niemand mehr zur Beobachtung eines [alt-<br />
testamentlichen] richterlichen Gebotes verpflichtet ist (vgl. I-<br />
11104,3), kann das menschliche Gesetz, für das die gleiche<br />
Überlegung gilt, solches o<strong>de</strong>r ähnliches bestimmen.<br />
Zu 2. Zachäus wollte mit jenem Wort einem Werk <strong>de</strong>r Über<br />
gebühr Ausdruck verleihen. Daher schickte er voraus: „Sieh',<br />
die Hälfte meines Besitzes gebe ich <strong>de</strong>n Armen."<br />
Zu 3. Der Richter kann bei seiner Verurteilung zur Buße mit<br />
<strong>Recht</strong> etwas mehr abnehmen, doch vor <strong>de</strong>r Verurteilung durfte<br />
er es nicht.<br />
4. ARTIKEL<br />
Muß jemand zurückgeben, was er nicht entwen<strong>de</strong>t hat? [19]<br />
1. Wer Scha<strong>de</strong>n zugefügt hat, muß ihn auch beheben. Nun<br />
verursacht bisweilen jemand einen Scha<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r über das<br />
unmittelbar Weggenommene hinausgeht, z. B. wenn einer die<br />
Saat verwüstet, macht er die ganze zukünftige Ernte <strong>de</strong>ssen<br />
zunichte, <strong>de</strong>r sie ausgebracht hat, <strong>und</strong> diese muß er dann eben<br />
falls ersetzen. Also besteht die Verpflichtung, zu erstatten, was<br />
man nicht weggenommen hat.<br />
2. Wer das Geld <strong>de</strong>s Gläubigers über <strong>de</strong>n abgemachten<br />
Rückzahlungstermin hinaus behält, beeinträchtigt ihn am gan<br />
zen Gewinn, <strong>de</strong>n er mit seinem Geld hätte machen können.<br />
Und doch nimmt er ihm diesen nicht weg. Also ist einer ver<br />
pflichtet, für etwas aufzukommen, was er nicht weggenommen<br />
hat.<br />
68
3. Die menschliche <strong>Gerechtigkeit</strong> ist von <strong>de</strong>r göttlichen ab- 62. 4<br />
geleitet. Doch Gott schul<strong>de</strong>t man mehr als man von ihm emp<br />
fangen hat gemäß Mt25,26: „Du hast gewußt, daß ich ernte,<br />
wo ich nicht gesät, <strong>und</strong> sammle, wo ich nicht ausgestreut habe."<br />
Demnach ist es recht, auch einem Menschen zu erstatten, was<br />
man ihm nicht genommen hat.<br />
DAGEGEN steht, daß die Rückgabe zur <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
gehört, insofern sie Ausgleich schafft. Doch wenn jemand zu<br />
rückgäbe, was er nicht genommen hat, diente dies nicht <strong>de</strong>m<br />
Ausgleich. Eine solche Restitution entspricht nicht <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit.<br />
ANTWORT. Wer jeman<strong>de</strong>m Scha<strong>de</strong>n zufügt, nimmt ihm das,<br />
um was er ihn geschädigt hat, weg. Von Scha<strong>de</strong>n spricht man<br />
nämlich nach <strong>de</strong>s Aristoteles Ethik (V, 7; 1132 b 14), wenn einer<br />
weniger hat, als er haben sollte. Daher ist <strong>de</strong>r Mensch für <strong>de</strong>n<br />
angerichteten Scha<strong>de</strong>n restitutionspflichtig. Doch Scha<strong>de</strong>n<br />
erlei<strong>de</strong>t einer auf zweifache Weise. Einmal, wenn ihm, was er<br />
tatsächlich besaß, weggenommen wur<strong>de</strong>. Und dieser Scha<strong>de</strong>n<br />
ist durch Erstattung von etwas Gleichwertigem stets g<strong>utz</strong>u<br />
machen, z. B. wenn jemand einen durch Zerstörung seines<br />
Hauses geschädigt hat, muß er ihm <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>s Hauses erset<br />
zen. - Auf an<strong>de</strong>re Weise schädigt jemand einen, wenn er ihn<br />
daran hin<strong>de</strong>rt, eine aussichtsreiche Sache an sich zu bringen.<br />
Für einen <strong>de</strong>rartigen Scha<strong>de</strong>n braucht er nicht vollständig auf<br />
zukommen, <strong>de</strong>nn etwas nur in Aussicht haben, ist weniger, als<br />
es wirklich besitzen. Wer sich nämlich erst daranmacht, etwas<br />
zu erlangen, besitzt es nur <strong>de</strong>r Erwartung o<strong>de</strong>r Möglichkeit<br />
nach. Und wenn es ihm zurückgegeben wür<strong>de</strong>, so daß er es<br />
tatsächlich hätte, wür<strong>de</strong> ihm nicht <strong>de</strong>r einfache Wert <strong>de</strong>s Weg<br />
genommenen erstattet, son<strong>de</strong>rn ein Vielfaches davon. Dies ist<br />
jedoch kein unbedingtes Erfor<strong>de</strong>rnis <strong>de</strong>r Restitution (Art. 3).<br />
Eine gewisse Wie<strong>de</strong>rgutmachung entsprechend <strong>de</strong>n persön<br />
lichen <strong>und</strong> sachlichen Verhältnissen ist jedoch angebracht.<br />
Zu 1 <strong>und</strong> Zu 2 ist somit die Antwort klar. Denn wer die<br />
Saat auf <strong>de</strong>m Acker ausgebracht hat, besitzt die Ernte noch<br />
nicht in Wirklichkeit, son<strong>de</strong>rn nur <strong>de</strong>r Möglichkeit nach.<br />
Ebenso hat, wer Geld besitzt, <strong>de</strong>n Gewinn noch nicht in seiner<br />
Tasche, son<strong>de</strong>rn erst in Aussicht, <strong>und</strong> bei<strong>de</strong>s kann auf vielfache<br />
Weise mißlingen.<br />
Zu 3. Gott verlangt vom Menschen nur das Gute, das er<br />
selbst in uns gesät hat. Daher ist jenes Wort entwe<strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>r<br />
69
62. 5 törichten Ansicht <strong>de</strong>s faulen Knechtes zu verstehen, <strong>de</strong>r meinte,<br />
er habe nichts empfangen, o<strong>de</strong>r so, daß Gott von uns die<br />
Früchte von <strong>de</strong>n Gaben erwartet, die sowohl von ihm als auch<br />
von uns sind, obwohl die Gaben selbst allein von Gott<br />
herkommen ohne unser Zutun.<br />
5. ARTIKEL<br />
Muß man immer <strong>de</strong>m zurückerstatten, von <strong>de</strong>m man etwas<br />
genommen hat? [20]<br />
1. Man darf nieman<strong>de</strong>m scha<strong>de</strong>n. Doch manchmal fiele es<br />
zum Scha<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Betreffen<strong>de</strong>n aus o<strong>de</strong>r auch an<strong>de</strong>rer, wenn<br />
man ihm das Weggenommene zurückgäbe, z.B. wenn man<br />
einem Geistesgestörten ein hinterlegtes Schwert aushändigte.<br />
Also braucht man nicht immer <strong>de</strong>m Eigentümer zu restituieren.<br />
2. Wer unerlaubterweise etwas hergegeben hat, ist nicht<br />
würdig, es zurückzuerhalten. Doch bisweilen gibt einer uner<br />
laubterweise her, was ein an<strong>de</strong>rer unerlaubterweise annimmt,<br />
wie dies beim simonistischen [21] Geben <strong>und</strong> Nehmen offen<br />
sichtlich <strong>de</strong>r Fall ist. Also braucht man nicht immer <strong>de</strong>m zu<br />
rückzugeben, von <strong>de</strong>m man etwas hat.<br />
3. Niemand ist zum Unmöglichen verpflichtet. Nun ist es<br />
bisweilen unmöglich, <strong>de</strong>m zu restituieren, von <strong>de</strong>m man etwas<br />
hat, etwa weil er gestorben o<strong>de</strong>r zu weit weg o<strong>de</strong>r unbekannt<br />
ist. Also braucht man nicht <strong>de</strong>m zurückzuerstatten, von <strong>de</strong>m<br />
man etwas in Besitz hat.<br />
4. Der Mensch muß eher <strong>de</strong>m zurückerstatten, von <strong>de</strong>m er<br />
die größere Wohltat empfangen hat. Doch von an<strong>de</strong>ren hat <strong>de</strong>r<br />
Mensch mehr Wohltaten empfangen als etwa von einem Han<br />
<strong>de</strong>ls- o<strong>de</strong>r Hinterlegungspartner, z. B. von seinen Eltern. Also<br />
muß man bisweilen einer an<strong>de</strong>ren Person eher etwas zuwen<strong>de</strong>n<br />
als <strong>de</strong>m restituieren, von <strong>de</strong>m man etwas in Besitz hat.<br />
5. Überflüssig ist es, das zurückzugeben, was durch Restitu<br />
tion in die Hand <strong>de</strong>s Restituieren<strong>de</strong>n zurückkehrt. So kommt,<br />
wenn ein Prälat <strong>de</strong>r Kirche auf Unrechte Weise etwas entzogen<br />
hat, dies durch seine Restitution wie<strong>de</strong>rum in seine Hand, da er<br />
ja selber Verwalter <strong>de</strong>r Kirchengüter ist. Also muß er <strong>de</strong>r Kirche,<br />
die er beraubt hat, nicht restituieren.<br />
DAGEGEN steht Rom 13,7: „Gebt allen, was ihr ihnen<br />
schuldig seid, sei es Steuer o<strong>de</strong>r Zoll."<br />
70
ANTWORT. Die Wie<strong>de</strong>rerstattung stellt das Gleichgewicht 62. 5<br />
<strong>de</strong>r Tauschgerechtigkeit, die, wie gesagt (Art. 2), im Ausgleich<br />
<strong>de</strong>r Sachen besteht, wie<strong>de</strong>r her. Dieser Ausgleich <strong>de</strong>r Sachen<br />
kann nur erfolgen, wenn <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r zu wenig, als ihm zusteht,<br />
hat, ergänzt wird, was ihm fehlt. Und damit diese Ergänzung<br />
zustan<strong>de</strong>kommt, muß <strong>de</strong>m Geschädigten Restitution geleistet<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Zu 1. Wenn die Rückgabe einer Sache für <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m wie<strong>de</strong>r<br />
zuerstatten ist, o<strong>de</strong>r für einen an<strong>de</strong>ren sehr gefährlich zu sein<br />
scheint, dann darf ihm nicht restituiert wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn die Resti<br />
tution dient <strong>de</strong>m N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>ssen, <strong>de</strong>m sie geleistet wird. Alles<br />
Eigentum untersteht nämlich <strong>de</strong>m Gesichtspunkt <strong>de</strong>s N<strong>utz</strong>ens.<br />
Der an<strong>de</strong>re darf sich die frem<strong>de</strong> Sache allerdings nicht aneignen,<br />
son<strong>de</strong>rn muß sie bis zu einem geeigneten Zeitpunkt <strong>de</strong>r Rück<br />
gabe bei sich behalten o<strong>de</strong>r sie irgendwohin weggeben, wo sie<br />
sicherer aufbewahrt wird.<br />
Zu 2. Auf zweifache Weise gibt jemand etwas unerlaubter<br />
weise. Einmal, weil das Geben in sich unerlaubt <strong>und</strong> gegen das<br />
Gesetz ist, wie bei <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r simonistisch etwas gibt. Ein solcher<br />
verliert mit Fug <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>, was er gegeben hat, man braucht es<br />
ihm also nicht wie<strong>de</strong>rzuerstatten. Doch auch <strong>de</strong>r Empfänger<br />
darf es nicht behalten, weil er es gesetzwidrig angenommen<br />
hat, son<strong>de</strong>rn muß es für fromme Zwecke weitergeben. - Auf<br />
an<strong>de</strong>re Weise gibt jemand unerlaubt, nicht weil das Geben als<br />
solches, son<strong>de</strong>rn die Sache unerlaubt ist, wie bei <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r für<br />
Unzuchtsgewähr einer Dirne etwas gibt. Daher kann die Frau<br />
das Dargereichte behalten. Hätte sie jedoch auf betrügerische<br />
o<strong>de</strong>r hinterlistige Weise zuviel herausgepreßt, müßte sie dieses<br />
zurückerstatten.<br />
Zu 3. Wenn <strong>de</strong>r, <strong>de</strong>m man zu restituieren hat, vollkommen<br />
unbekannt ist, muß man zurückerstatten soweit eben möglich,<br />
in<strong>de</strong>m man, sorgfältige Umfrage nach <strong>de</strong>r Person <strong>de</strong>s<br />
Restitutionsempfängers vorausgesetzt, für sein Seelenheil<br />
Almosen gibt, sei er gestorben o<strong>de</strong>r noch am Leben. - Ist er<br />
gestorben, muß sein Erbe, <strong>de</strong>r mit ihm sozusagen wie eine<br />
Person zu betrachten ist, bedacht wer<strong>de</strong>n. - Lebt er weit weg,<br />
muß ihm die Sache übersandt wer<strong>de</strong>n, vor allem, wenn sie sehr<br />
wertvoll ist <strong>und</strong> bequem transportiert wer<strong>de</strong>n kann. An<strong>de</strong>rn<br />
falls ist sie an einen sicheren Ort zu verbringen <strong>und</strong> dort für ihn<br />
aufzubewahren, <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Eigentümer hat man hierüber Bericht<br />
zu erstatten.<br />
71
62. 6 Zu 4. Mit seinem eigenen Besitz muß man eher für die<br />
Eltern o<strong>de</strong>r seine größeren Wohltäter etwas tun. Nicht aber darf<br />
man seinen Wohltäter mit frem<strong>de</strong>m Eigentum be<strong>de</strong>nken. Dies<br />
läge vor, wenn man <strong>de</strong>m einen gäbe, was <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren gehört.<br />
Eine Ausnahme bil<strong>de</strong>t höchstens <strong>de</strong>r Fall äußerster Not. Hier<br />
dürfte, ja müßte man mit frem<strong>de</strong>m Gut seinem Vater zu Hilfe<br />
kommen.<br />
Zu 5. Ein kirchlicher Oberer kann Kirchengut auf dreifache<br />
Weise an sich bringen, l.wenn er nicht ihm, son<strong>de</strong>rn einem<br />
an<strong>de</strong>ren zugewiesenes Kirchengut sich selber aneignet, z.B.<br />
wenn ein Bischof das Kapitelsvermögen an sich reißen wür<strong>de</strong>.<br />
Dann ist es klar, daß er restituieren muß, in<strong>de</strong>m er die Sache <strong>de</strong>n<br />
rechtmäßigen Eigentümern zurückgibt. - 2. wenn er das ihm<br />
anvertraute Kirchengut in eines an<strong>de</strong>ren Besitz überführt, z. B.<br />
seines Verwandten o<strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong>es. Dann muß er es <strong>de</strong>r Kirche<br />
zurückerstatten <strong>und</strong> dafür besorgt sein, daß es einmal an seinen<br />
Nachfolger übergeht. - 3. kann sich ein Prälat <strong>de</strong>r bloßen<br />
Absicht nach Kirchengut aneignen, wenn er nämlich mit <strong>de</strong>m<br />
Gedanken spielt, es persönlich <strong>und</strong> nicht im Namen <strong>de</strong>r Kirche<br />
zu besitzen. In diesem Fall besteht die Restitution darin, <strong>de</strong>rlei<br />
Absichten aufzugeben.<br />
6. ARTIKEL<br />
Muß immer jener zurückerstatten, <strong>de</strong>r entwen<strong>de</strong>t hat?<br />
1. Durch die Rückgabe wird das Gleichmaß <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit wie<strong>de</strong>rhergestellt. Dies geschieht dadurch, daß <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r<br />
mehr hat, genommen <strong>und</strong> <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r weniger hat, gegeben wird.<br />
Bisweilen jedoch kommt es vor, daß einer die entwen<strong>de</strong>te Sache<br />
nicht mehr besitzt, da sie in die Hand eines an<strong>de</strong>ren gelangt ist.<br />
Es braucht also nicht mehr <strong>de</strong>r Dieb zu restituieren, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>re, <strong>de</strong>r die Sache in Besitz hat.<br />
2. Niemand braucht seine Untat aufzu<strong>de</strong>cken. Doch biswei<br />
len kommt beim Restituieren die Untat ans Licht, wie dies beim<br />
Diebstahl <strong>de</strong>r Fall ist. Also muß <strong>de</strong>r Dieb die gestohlene Sache<br />
nicht mehr zurückgeben.<br />
3. Eine Sache braucht man nicht mehrmals zurückzuerstat<br />
ten. Manchmal jedoch stehlen viele zusammen etwas, <strong>und</strong> einer<br />
von ihnen gibt alles zurück. Also ist nicht immer je<strong>de</strong>r Dieb zur<br />
Rückgabe verpflichtet.<br />
72
DAGEGEN gilt: <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>r ist zur Genugtuung verpflichtet. 62. 6<br />
Nun gehört die Rückgabe zur Genugtuung. Also muß je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r<br />
entwen<strong>de</strong>t hat, zurückgeben.<br />
ANTWORT. Bei <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r eine frem<strong>de</strong> Sache an sich genom<br />
men hat, sind zwei Dinge ins Auge zu fassen, nämlich die ent<br />
wen<strong>de</strong>te Sache <strong>und</strong> die Wegnahme als solche. Bezüglich <strong>de</strong>r<br />
Sache ist er verpflichtet, sie zurückzugeben, solange er sie bei<br />
sich hat, <strong>de</strong>nn was einer mehr hat, als sein ist, muß ihm abge<br />
nommen <strong>und</strong> nach <strong>de</strong>n Regeln <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n Gerechtig<br />
keit <strong>de</strong>m gegeben wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m es fehlt.<br />
Mit <strong>de</strong>r Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n Sache selbst kann es sich<br />
dreifach verhalten. Bisweilen ist sie ungerecht, nämlich gegen<br />
<strong>de</strong>n Willen ihres Eigentümers gerichtet wie beim Diebstahl <strong>und</strong><br />
Raub. Die Restitutionspflicht ergibt sich dann nicht nur wegen<br />
<strong>de</strong>r Sache, son<strong>de</strong>rn auch wegen <strong>de</strong>r ungerechten Handlung,<br />
selbst wenn die Sache nicht mehr bei ihm verblieben ist. Wie<br />
nämlich jemand, <strong>de</strong>r einen geschlagen hat, verpflichtet ist, <strong>de</strong>m<br />
Leidtragen<strong>de</strong>n für das Unrecht Genugtuung zu leisten, obwohl<br />
er nichts vom Betroffenen in Besitz hat, so muß auch <strong>de</strong>r Dieb<br />
o<strong>de</strong>r Räuber für <strong>de</strong>n verursachten Scha<strong>de</strong>n einstehen, auch<br />
wenn er nichts behalten hat, <strong>und</strong> überdies muß er für das zuge<br />
fügte Unrecht bestraft wer<strong>de</strong>n.<br />
Zweitens nimmt jemand frem<strong>de</strong>s Gut ohne Unrecht in sei<br />
nen Gebrauch, nämlich mit Zustimmung seines Eigentümers,<br />
wie dies bei Leihgeschäften <strong>de</strong>r Fall ist. Der Empfänger ist dann<br />
zur Restitution für die erhaltene Sache verpflichtet - <strong>und</strong> dies<br />
selbst, wenn er sie verloren hat -, nicht allein wegen <strong>de</strong>r Sache,<br />
son<strong>de</strong>rn auch wegen <strong>de</strong>r Annahme [als solcher], <strong>de</strong>nn er muß<br />
<strong>de</strong>m Genugtuung leisten, <strong>de</strong>r ihm die Gefälligkeit [<strong>de</strong>r Leihe]<br />
erwiesen hat, was nicht geschehen wäre, hätte er <strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n<br />
vorausgesehen.<br />
Drittens nimmt jemand ohne Unrecht eine frem<strong>de</strong> Sache an<br />
sich, doch nicht zum eigenen N<strong>utz</strong>en, wie dies bei <strong>de</strong>r Hinter<br />
legung <strong>de</strong>r Fall ist. Aus einer <strong>de</strong>rartigen Übernahme erfließt für<br />
<strong>de</strong>n Annehmen<strong>de</strong>n keinerlei Verpflichtung, vielmehr erweist er<br />
damit eine Gefälligkeit. Verpflichtung ergibt sich jedoch aus <strong>de</strong>r<br />
Sache. Kommt sie ihm ohne eigene Schuld abhan<strong>de</strong>n, braucht er<br />
keine Wie<strong>de</strong>rgutmachung zu leisten. An<strong>de</strong>rs läge hingegen <strong>de</strong>r<br />
Fall, wenn er die hinterlegte Sache aus eigener schwerer Schuld<br />
verlieren wür<strong>de</strong>.<br />
73
62. 7 Zu 1. Die Rückgabe zielt nicht in erster Linie darauf, daß,<br />
wer mehr hat, als ihm gebührt, dies nun verliert, son<strong>de</strong>rn daß<br />
<strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r zu wenig hat, das Fehlen<strong>de</strong> ergänzt wird. Daher hat<br />
dort, wo jemand vom an<strong>de</strong>ren etwas nehmen kann, ohne ihm<br />
zu scha<strong>de</strong>n, die Restitution keinen Platz, z.B. wenn einer sein<br />
Licht an <strong>de</strong>r Kerze eines an<strong>de</strong>ren entzün<strong>de</strong>t. Wenn daher ein<br />
Dieb das gestohlene Gut nicht mehr besitzt, weil er es weiter<br />
gegeben hat, müssen, da <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re seiner Sache beraubt ist,<br />
sowohl <strong>de</strong>r Dieb - wegen seiner ungerechten Handlung -, als<br />
auch <strong>de</strong>r Besitzer <strong>de</strong>s Gestohlenen - <strong>de</strong>r Sache wegen - resti<br />
tuieren [22].<br />
Zu 2. Auch wenn niemand verpflichtet ist, an<strong>de</strong>ren seine<br />
Untat aufzu<strong>de</strong>cken, so ist man doch gehalten, sie Gott in <strong>de</strong>r<br />
Beichte zu offenbaren. Somit kann man durch Vermittlung <strong>de</strong>s<br />
Beichtvaters die Rückgabe <strong>de</strong>r frem<strong>de</strong>n Sache veranlassen.<br />
Zu 3. Weil die Wie<strong>de</strong>rerstattung hauptsächlich <strong>de</strong>n Zweck<br />
verfolgt, Scha<strong>de</strong>n vom zu Unrecht Beraubten abzuwen<strong>de</strong>n,<br />
brauchen, wenn einer genügend wie<strong>de</strong>rgutgemacht hat, die<br />
an<strong>de</strong>ren nicht auch noch zu restituieren, son<strong>de</strong>rn müssen viel<br />
mehr <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r die Rückgabe auf sich genommen, einen Aus<br />
gleich verschaffen, doch kann dieser auch darauf verzichten.<br />
7. ARTIKEL<br />
Sind die, die nichts entwen<strong>de</strong>t haben, zur Wie<strong>de</strong>rerstattung<br />
verpflichtet?<br />
1. Die Wie<strong>de</strong>rerstattung ist eine Art Strafe für <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r etwas<br />
entwen<strong>de</strong>t hat. Doch keiner darf bestraft wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r nicht<br />
gesündigt hat. Also muß nur <strong>de</strong>r zurückgeben, <strong>de</strong>r entwen<strong>de</strong>t<br />
hat.<br />
2. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> verpflichtet nicht, das Eigentum <strong>de</strong>s<br />
an<strong>de</strong>ren zu mehren. Wenn jedoch nicht nur jener, <strong>de</strong>r entwen<strong>de</strong>t<br />
hat, son<strong>de</strong>rn auch alle, die irgendwie mitmachen, restituieren<br />
müßten, dann wür<strong>de</strong> das Eigentum <strong>de</strong>ssen, <strong>de</strong>m etwas weg<br />
genommen wur<strong>de</strong>, vermehrt, <strong>und</strong> zwar einmal, weil ihm viel<br />
fache Restitution zuteil wür<strong>de</strong>, sodann aber auch, weil manche<br />
bisweilen alles versuchen, um einem etwas wegzunehmen, was<br />
dann aber nicht gelingt. Also sind an<strong>de</strong>re nicht zur Wie<strong>de</strong>rer<br />
stattung verpflichtet.<br />
74
3. Niemand braucht sich einer Gefahr auszusetzen, um das 62. 7<br />
Eigentum eines an<strong>de</strong>ren zu retten. Doch durch die Anzeige<br />
eines Räubers o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rstand gegen ihn wür<strong>de</strong> sich<br />
jemand in To<strong>de</strong>sgefahr bringen. Also ist nicht zur Restitution<br />
verpflichtet, wer einen Räuber nicht anzeigt o<strong>de</strong>r ihm keinen<br />
Wi<strong>de</strong>rstand leistet.<br />
DAGEGEN steht im Römerbrief 1,32: „Des To<strong>de</strong>s würdig<br />
sind nicht allein, die [Böses] tun, son<strong>de</strong>rn auch, die <strong>de</strong>nen<br />
zustimmen, die es tun". Also müssen aus gleichem Gr<strong>und</strong> auch<br />
die Zustimmen<strong>de</strong>n restituieren.<br />
ANTWORT. Wie gesagt (Art. 6), ist jemand zur Wie<strong>de</strong>rer<br />
stattung nicht nur wegen <strong>de</strong>r entwen<strong>de</strong>ten Sache verpflichtet,<br />
son<strong>de</strong>rn auch wegen <strong>de</strong>r ungerechten Wegnahme als solcher.<br />
Daher unterliegt je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Entwendung ursächlich betei<br />
ligt ist, <strong>de</strong>r Restitutionspflicht. Dies ergibt sich auf doppelte<br />
Weise: direkt <strong>und</strong> indirekt. Direkt, wenn jemand einen zum<br />
Entwen<strong>de</strong>n verführt. Und dies ist dreifach möglich. 1. in<strong>de</strong>m er<br />
ihn zur Wegnahme anstiftet, was durch Befehl, Rat, ausdrück<br />
liche Zustimmung <strong>und</strong> dadurch geschieht, daß man einen als<br />
„tüchtigen Kerl" lobt, weil er etwas entwen<strong>de</strong>t hat. 2. mit Blick<br />
auf <strong>de</strong>n Dieb, in<strong>de</strong>m er ihn bei sich aufnimmt o<strong>de</strong>r ihm sonstwie<br />
Hilfe gewährt. 3. vom entwen<strong>de</strong>ten Gut aus gesehen, in<strong>de</strong>m er<br />
sich gleichsam als Kumpan <strong>de</strong>r Freveltat am Diebstahl o<strong>de</strong>r<br />
Raub beteiligt. - Indirekt, in<strong>de</strong>m einer die Tat nicht verhin<strong>de</strong>rt,<br />
obwohl er es könnte o<strong>de</strong>r müßte, sei es durch Wie<strong>de</strong>rruf <strong>de</strong>s<br />
Befehls o<strong>de</strong>r Rats, wodurch <strong>de</strong>r Diebstahl o<strong>de</strong>r Raub verhin<strong>de</strong>rt<br />
wird, sei es durch Entzug seiner Hilfe, was die Untat ebenfalls<br />
verhüten könnte, o<strong>de</strong>r sie nachher totschweigt. Dies alles wird<br />
[auf Latein] in <strong>de</strong>m Vers ausgedrückt: „Befehlen, raten, zustim<br />
men, lobhu<strong>de</strong>ln, Sch<strong>utz</strong> bieten, mitmachen, verschweigen,<br />
nicht wi<strong>de</strong>rstehen, nicht ans Licht bringen".<br />
Fünf von diesen Verhaltensweisen verpflichten stets zur Wie<br />
<strong>de</strong>rerstattung. 1. <strong>de</strong>r Befehl, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Befehlen<strong>de</strong> setzt die<br />
Aktion an erster Stelle in Gang, daher ist er auch an erster Stelle<br />
gehalten, Wie<strong>de</strong>rgutmachung zu leisten. 2. die Zustimmung,<br />
je<strong>de</strong>nfalls bei <strong>de</strong>m, ohne <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Raub nicht Zustan<strong>de</strong>kommen<br />
könnte. 3. <strong>de</strong>r Sch<strong>utz</strong>, wobei <strong>de</strong>r gemeint ist, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Räuber<br />
bei sich aufnimmt <strong>und</strong> seine Hand über ihn hält. 4. die Teil<br />
nahme, wenn nämlich einer am Verbrechen <strong>de</strong>s Raubes <strong>und</strong> an<br />
<strong>de</strong>r Beute teilhat. 5. ist jener restitutionspflichtig, <strong>de</strong>r keinen<br />
Wi<strong>de</strong>rstand leistet, obwohl er müßte. So sind die Fürsten,<br />
75
62. 7 <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Sch<strong>utz</strong> <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> auf Er<strong>de</strong>n obliegt, zur<br />
Restitution verpflichtet, wenn durch ihre Nachlässigkeit das<br />
Räuberwesen überhand nimmt, <strong>de</strong>nn die Einkünfte, die sie<br />
beziehen, sind gleichsam <strong>de</strong>r Lohn dafür, daß sie auf Er<strong>de</strong>n die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> unter ihren Sch<strong>utz</strong> nehmen.<br />
In <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren aufgezählten Fällen besteht nicht immer die<br />
Pflicht zur Wie<strong>de</strong>rerstattung. Rat <strong>und</strong> Lob <strong>und</strong> <strong>de</strong>rgleichen sind<br />
nämlich nicht immer wirksame Ursache von Raub. Daher müs<br />
sen Ratgeber o<strong>de</strong>r Schmeichler nur dann für die Wie<strong>de</strong>rerstat<br />
tung einstehen, wenn aus <strong>de</strong>rartigen Einwirkungen aller Wahr<br />
scheinlichkeit nach eine ungerechte Entwendung erfolgt ist.<br />
Zu 1. Nicht nur jener sündigt, <strong>de</strong>r die sündige Tat ausführt,<br />
son<strong>de</strong>rn auch, wer auf irgen<strong>de</strong>ine Weise Ursache <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> ist,<br />
sei es durch Rat, Befehl o<strong>de</strong>r sonstwie.<br />
Zu 2. In erster Linie muß wie<strong>de</strong>rerstatten, wer bei <strong>de</strong>r<br />
Aktion <strong>de</strong>r Ausschlaggeben<strong>de</strong> ist, also zuerst <strong>de</strong>r Befehlen<strong>de</strong>,<br />
dann <strong>de</strong>r Ausführen<strong>de</strong> <strong>und</strong> dann weiter die an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>r Reihe<br />
nach. Erhält <strong>de</strong>r Geschädigte von Einem Genugtuung, dann<br />
braucht ein an<strong>de</strong>rer nicht auch noch zu restituieren. Doch die<br />
Haupträ<strong>de</strong>lsführer bei <strong>de</strong>r Tat, die auch die Beute eingesteckt<br />
haben, müssen <strong>de</strong>nen etwas geben, die restituiert haben. -<br />
Befiehlt aber einer eine ungerechte Entwendung, die jedoch<br />
nicht zustan<strong>de</strong>kommt, so ist keine Restitution zu leisten, <strong>de</strong>nn<br />
sie hat ja hauptsächlich <strong>de</strong>n Zweck, das Eigentum <strong>de</strong>s ungerecht<br />
Geschädigten zu vervollständigen.<br />
Zu 3. Wer <strong>de</strong>n Räuber nicht anzeigt, ihm keinen Wi<strong>de</strong>rstand<br />
leistet o<strong>de</strong>r ihn nicht festhält, braucht nicht immer zu restituie<br />
ren, son<strong>de</strong>rn nur, wenn er von Amts wegen dazu verpflichtet ist,<br />
wie dies bei <strong>de</strong>n Fürsten <strong>de</strong>r Welt zutrifft. Diesen droht daraus<br />
ja auch keine große Gefahr, besitzen sie doch die öffentliche<br />
Gewalt, damit sie die Hüter <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> sein können.<br />
76
8. ARTIKEL<br />
Muß man sofort zurückgeben o<strong>de</strong>r darf man die Restitution<br />
hinauszögern?<br />
1. Die affirmativen Gebote [23] verpflichten nicht je<strong>de</strong>rzeit.<br />
Nun leitet sich die Notwendigkeit <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rerstattung aus<br />
einem affirmativen Gebot her, also ist <strong>de</strong>r Mensch nicht zur<br />
sofortigen Rückgabe verpflichtet.<br />
2. Niemand ist zum Unmöglichen verpflichtet. Doch bis<br />
weilen ist es einem unmöglich, sogleich zurückzugeben. Also<br />
braucht niemand sogleich zu restituieren.<br />
3. Die Rückgabe ist ein Akt <strong>de</strong>r Tugend, nämlich <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit. Der Zeitumstand ist nun eine <strong>de</strong>r Gegebenheiten, die<br />
zum Tugendakt notwendig gehören. Da jedoch die an<strong>de</strong>ren<br />
Umstän<strong>de</strong> für die Tugendakte nicht festgelegt, son<strong>de</strong>rn nach<br />
klugem Ermessen zu bestimmen sind, gibt es auch für die Resti<br />
tution keine Zeitbestimmung, wonach die Rückgabe sofort<br />
erfolgen müßte.<br />
DAGEGEN steht, daß bei je<strong>de</strong>r Restitution die gleiche Über<br />
legung gilt. Doch wer Lohnarbeiter dingt, kann die Aushändi<br />
gung <strong>de</strong>s Lohnes nicht verschieben, wie aus Lv 19,13 ersichtlich<br />
ist: „Der Lohn <strong>de</strong>s Taglöhners soll nicht über Nacht bis zum<br />
Morgen bei dir bleiben." Also darf es auch bei an<strong>de</strong>ren Abgel<br />
tungen kein Hinauszögern geben, son<strong>de</strong>rn die Übergabe muß<br />
sogleich erfolgen.<br />
ANTWORT. Wie die Entwendung einer frem<strong>de</strong>n Sache eine<br />
Sün<strong>de</strong> gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist, so auch, wenn man sie<br />
behält. Denn dadurch, daß einer die frem<strong>de</strong> Sache gegen <strong>de</strong>n<br />
Willen <strong>de</strong>s Eigentümers behält, wird dieser am Gebrauch seines<br />
Eigentums gehin<strong>de</strong>rt, <strong>und</strong> so fügt er ihm Unrecht zu. Es ist aber<br />
klar, daß man auch nicht einen Augenblick lang im Zustand <strong>de</strong>r<br />
Sün<strong>de</strong> verweilen darf, son<strong>de</strong>rn je<strong>de</strong>r ist gehalten, die Sün<strong>de</strong><br />
sofort aufzugeben gemäß Sir 21,2: „Flieh vor <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> wie vor<br />
<strong>de</strong>r Schlange!" Daher muß ein je<strong>de</strong>r sogleich wie<strong>de</strong>rerstatten<br />
o<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Gebrauch <strong>de</strong>r Sache erlauben kann, um<br />
Aufschub bitten.<br />
Zu 1. Das Restitutionsgebot ist zwar affirmativ formuliert,<br />
doch enthält es das negative Gebot [Verbot], eine frem<strong>de</strong> Sache<br />
zu behalten.<br />
77<br />
62. 8
62. 8 Zu 2. Wenn jemand nicht sogleich zurückgeben kann, ent<br />
schuldigt ihn die Unmöglichkeit von <strong>de</strong>r sofortigen Restitution,<br />
wie er gänzlich von <strong>de</strong>r Rückgabepflicht befreit wäre, wenn er<br />
sich dazu absolut außerstan<strong>de</strong> sähe. Er muß dann allerdings sel<br />
ber o<strong>de</strong>r durch einen an<strong>de</strong>ren die entsprechen<strong>de</strong> Person um<br />
Nachlaß o<strong>de</strong>r Aufschub bitten.<br />
Zu 3. Je<strong>de</strong>r Umstand, <strong>de</strong>ssen Mißachtung sich mit <strong>de</strong>r<br />
Tugend nicht vereinbaren läßt, ist als festgelegt zu betrachten<br />
<strong>und</strong> zu beachten. Und weil durch Hinauszögern <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rer<br />
stattung die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ungerechtfertigten <strong>und</strong> ungerechten<br />
Behaltens begangen wird, muß <strong>de</strong>r Umstand <strong>de</strong>r Zeit festgelegt<br />
sein, damit die Restitution sogleich geleistet wird.<br />
78
63. FRAGE<br />
DAS „ANSEHEN DER PERSON"<br />
Nunmehr ist von <strong>de</strong>n Lastern zu re<strong>de</strong>n, die zu <strong>de</strong>n erwähn<br />
ten Teilen <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> im Gegensatz stehen.<br />
Dabei geht es zunächst um das „Ansehen <strong>de</strong>r Person", das<br />
<strong>de</strong>r zuteilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> wi<strong>de</strong>rspricht, sodann um die<br />
Sün<strong>de</strong>n gegen die ausgleichen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Zum ersten Punkt ergeben sich 4 Fragen:<br />
1. Ist das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" eine Sün<strong>de</strong>?<br />
2. Spielt es auch bei <strong>de</strong>r Zuteilung geistlicher Güter eine<br />
Rolle?<br />
3. Auch beim Erweis von Ehrungen?<br />
4. Und vor Gericht?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist das „Ansehen <strong>de</strong>r Person " eine Sün<strong>de</strong>?<br />
1. Unter <strong>de</strong>m Namen „Person" versteht man die Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Person. Doch die Wür<strong>de</strong> von Personen in Betracht ziehen<br />
(„ansehen") gehört zur austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong>. Also ist das<br />
„Ansehen <strong>de</strong>r Person" keine Sün<strong>de</strong>.<br />
2. Im Bereich <strong>de</strong>s Menschlichen steht die Person über <strong>de</strong>n<br />
Dingen, <strong>de</strong>nn die Dinge sind wegen <strong>de</strong>r Menschen da <strong>und</strong> nicht<br />
umgekehrt. Doch die Dinge in Betracht ziehen („ansehen") ist<br />
keine Sün<strong>de</strong>, also noch viel weniger, das gleiche bei Personen zu<br />
tun.<br />
3. Bei Gott kann es keine Ungerechtigkeit noch Sün<strong>de</strong><br />
geben. Doch scheint bei ihm das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" zu gel<br />
ten, <strong>de</strong>nn bisweilen nimmt er von zwei Menschen <strong>de</strong>r gleichen<br />
Lebenslage <strong>de</strong>n einen gna<strong>de</strong>nhaft an <strong>und</strong> läßt <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren in<br />
seiner Sün<strong>de</strong> zurück gemäß <strong>de</strong>m Wort bei Mt 24,40: „Zwei sind<br />
auf einem Lager [Acker], <strong>de</strong>r eine wird mitgenommen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>re zurückgelassen." Also ist das „Ansehen <strong>de</strong>r Person"<br />
keine Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN wird im Gesetz Gottes nichts verboten außer <strong>de</strong>r<br />
Sün<strong>de</strong>. Doch das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" wird im Buche Dt 1,17<br />
untersagt, wo es heißt: „Ihr sollt auf keines Menschen Person<br />
schauen". Also ist das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" eine Sün<strong>de</strong>.<br />
79
63. l ANTWORT. Das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" steht im Gegensatz<br />
zur austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong>. Das Gleichmaß <strong>de</strong>r austeilen<br />
<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> ergibt sich nämlich daraus, daß verschie<strong>de</strong><br />
nen Personen entsprechend ihrer Wür<strong>de</strong> Verschie<strong>de</strong>nes zuge<br />
teilt wird. Zieht man also jene Eigenschaft einer Person in<br />
Betracht, weshalb ihr das gebührt, was sie erhält, so spielt dabei<br />
das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" keine Rolle, son<strong>de</strong>rn die Sachlage.<br />
Daher schreibt die Glosse (ML 192,218) zum Wort <strong>de</strong>s Ephe-<br />
serbriefs (6,9) „Bei Gott gibt es kein Ansehen <strong>de</strong>r Person":<br />
„Der gerechte Richter entschei<strong>de</strong>t nach Sachgrün<strong>de</strong>n, nicht<br />
nach Personen." Beruft z. B. jemand einen wegen seiner wissen<br />
schaftlichen Eignung zum Lehramt, dann ist dabei ein sach<br />
licher Gr<strong>und</strong>, nicht die Person ausschlaggebend. Wer hingegen<br />
bei einem, <strong>de</strong>m er etwas verleiht, nicht darauf sieht, ob es ange<br />
messen o<strong>de</strong>r geschul<strong>de</strong>t ist, son<strong>de</strong>rn ihm nur zuspricht, weil er<br />
dieser bestimmte Mensch ist, sagen wir Peter o<strong>de</strong>r Martin, dann<br />
kommt hier das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" ins Spiel, <strong>de</strong>nn es wird<br />
ihm nicht etwas aus einem sachlichen Gr<strong>und</strong>, <strong>de</strong>r ihn würdig<br />
machte, zugeteilt, son<strong>de</strong>rn einfach, weil er diese Person ist.<br />
Zur „Person" aber gehört alles, was mit <strong>de</strong>n sachlichen<br />
Grün<strong>de</strong>n für die Verleihung dieser o<strong>de</strong>r jener Auszeichnung<br />
nichts zu tun hat; wenn z. B. jemand einen zur Prälatur o<strong>de</strong>r<br />
zum Lehramt beför<strong>de</strong>rt, weil er reich o<strong>de</strong>r sein Verwandter ist,<br />
dann heißt dies „Ansehen <strong>de</strong>r Person". Es kommt jedoch vor,<br />
daß eine persönliche Eigenschaft jeman<strong>de</strong>n für die eine Sache<br />
geeignet macht, für die an<strong>de</strong>re nicht, wie wegen <strong>de</strong>r Blutsver<br />
wandtschaft einer für würdig erachtet wird, als Erbe <strong>de</strong>s väter<br />
lichen Vermögens eingesetzt zu wer<strong>de</strong>n, nicht jedoch ein kirch<br />
liches Amt zu erhalten. So wirkt sich die gleiche persönliche<br />
Eigenschaft bei <strong>de</strong>r einen Angelegenheit als „Ansehen <strong>de</strong>r Per<br />
son" aus, bei <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren nicht.<br />
Das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" steht also zur verteilen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> dadurch in Gegensatz, daß gegen die Verhältnis-<br />
gemäßheit verstoßen wird. Gegen die Tugend jedoch verstößt<br />
nur die Sün<strong>de</strong>. Daraus ergibt sich, daß das „Ansehen <strong>de</strong>r Per<br />
son" Sün<strong>de</strong> ist.<br />
Zu 1. Bei <strong>de</strong>r verteilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> wer<strong>de</strong>n die Eigen<br />
schaften <strong>de</strong>r Person ins Auge gefaßt, die ihre Wür<strong>de</strong> ausmachen<br />
o<strong>de</strong>r für eine moralische Verpflichtung sprechen. Beim „Anse<br />
hen <strong>de</strong>r Person" hingegen kommen Eigenschaften zum Zuge,<br />
die nichts zur sachlichen Begründung beitragen.<br />
80
Zu 2. Die Personen wer<strong>de</strong>n geeignet <strong>und</strong> würdig für das, 63. 2<br />
was ihnen zugeteilt wird, wegen gewisser Dinge, die zu ihrer<br />
Stellung gehören, <strong>und</strong> dies ist daher als eigentlicher Gr<strong>und</strong> (für<br />
die Zuteilung) zu betrachten. Schaut man jedoch auf die Perso<br />
nen (als solche), dann nimmt man als Gr<strong>und</strong>, was keiner ist. So<br />
erklärt sich, daß bestimmte Leute an sich gesehen würdiger<br />
sind, nicht jedoch für eine bestimmte Aufgabe.<br />
Zu 3. Die Gabenzuteilung ist eine zweifache. Bei <strong>de</strong>r einen<br />
gibt jemand einem, was ihm geschul<strong>de</strong>t wird; dies fällt in das<br />
Gebiet <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Bei <strong>de</strong>rlei Gabenzuteilungen spielt<br />
das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" eine Rolle. Die an<strong>de</strong>re Gabenzutei<br />
lung untersteht <strong>de</strong>r Freigebigkeit, die einem umsonst gibt, was<br />
man ihm nicht schul<strong>de</strong>t. Von solcher Art ist die Zuteilung <strong>de</strong>r<br />
Gna<strong>de</strong>ngeschenke, durch die die Sün<strong>de</strong>r von Gott angenom<br />
men wer<strong>de</strong>n. Und bei dieser Gabenzuteilung ist kein Platz für<br />
„Ansehen <strong>de</strong>r Person", <strong>de</strong>nn je<strong>de</strong>r kann ohne Ungerechtigkeit<br />
von <strong>de</strong>m Seinen geben, soviel er will <strong>und</strong> wem er will, gemäß<br />
Mt20,14f.: „Darf ich mit <strong>de</strong>m, was mir gehört, nicht tun, was<br />
ich will? Nimm was Dein ist, <strong>und</strong> geh'!"<br />
2. ARTIKEL<br />
Spielt bei <strong>de</strong>r Verleihung von geistlichen Gütern das „Ansehen<br />
<strong>de</strong>r Person " eine Rolle?<br />
1. Eine kirchliche Wür<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r eine Pfrün<strong>de</strong> jeman<strong>de</strong>m<br />
wegen Blutsverwandtschaft verleihen gehört zum „Ansehen<br />
<strong>de</strong>r Person", <strong>de</strong>nn Blutsverwandtschaft ist nichts, was <strong>de</strong>n Men<br />
schen eines Kirchengutes würdig macht. Doch dies ist keine<br />
Sün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn die Kirchenprälaten haben dies schon immer so<br />
gemacht. Also spielt „Ansehen <strong>de</strong>r Person" bei <strong>de</strong>r Verleihung<br />
geistlicher Güter keine Rolle.<br />
2. „Ansehen <strong>de</strong>r Person" liegt vor, wenn ein Reicher einem<br />
Armen vorgezogen wird, wie aus Jak2,1 ff. hervorgeht. Nun<br />
erhalten Reiche <strong>und</strong> Mächtige leichter Dispens, wenn sie jeman<br />
<strong>de</strong>n aus einem verbotenen Verwandtschaftsgrad heiraten wol<br />
len, als an<strong>de</strong>re. Also spielt die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s „Ansehen <strong>de</strong>r Person"<br />
bei diesen Dispensen keine Rolle.<br />
3. Nach <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>ssammlung (FrdbII,79) genügt es, einen<br />
Guten zu wählen, nicht aber wird verlangt, einem Besseren <strong>de</strong>n<br />
Vorzug zu geben. Doch einen weniger Guten für etwas Höhe-<br />
81
63. 2 res zu wählen, ist ein Fall von „Ansehen <strong>de</strong>r Person". Also ist<br />
„Ansehen <strong>de</strong>r Person" in geistlichen Dingen keine Sün<strong>de</strong>.<br />
4. Nach <strong>de</strong>n kirchlichen Bestimmungen (FrdbII,78) muß<br />
<strong>de</strong>r Wahlkandidat aus „<strong>de</strong>m Schoß <strong>de</strong>r (Kapitels-) Kirche" stam<br />
men. Doch dies sieht nach „Ansehen <strong>de</strong>r Person" aus, <strong>de</strong>nn bis<br />
weilen wür<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rswo Geeignetere gef<strong>und</strong>en. Also ist<br />
„Ansehen <strong>de</strong>r Person" in geistlichen Dingen keine Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN steht Jak2,l: „Haltet <strong>de</strong>n Glauben an unseren<br />
Herrn Jesus Christus frei von je<strong>de</strong>m Ansehen <strong>de</strong>r Person."<br />
Dazu bemerkt die GlosseAugustins (ML33,740): „Wer kann es<br />
ertragen, daß einer einen Reichen auf eine kirchliche Ehrenstelle<br />
wählt <strong>und</strong> einen Armen, <strong>de</strong>r gebil<strong>de</strong>ter <strong>und</strong> heiliger ist, über<br />
geht?"<br />
ANTWORT. Wie gesagt (Art. 1), ist das „Ansehen <strong>de</strong>r Per<br />
son" eine Sün<strong>de</strong>, weil es <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> wi<strong>de</strong>rspricht. Umso<br />
schwerer versündigt sich nun, in je be<strong>de</strong>utsameren Dingen<br />
jemand die <strong>Gerechtigkeit</strong> verletzt. Da nun die geistlichen Güter<br />
höher stehen als die weltlichen, ist es eine schwerere Sün<strong>de</strong>, bei<br />
<strong>de</strong>r Zuteilung geistlicher Güter Rücksicht auf die Person zu<br />
nehmen, als bei <strong>de</strong>r Zuteilung weltlicher Güter.<br />
Und weil „Ansehen <strong>de</strong>r Person" darin besteht, zugunsten <strong>de</strong>r<br />
Person außer <strong>de</strong>m Gewicht ihrer Wür<strong>de</strong> sonst noch etwas zu<br />
berücksichtigen, muß diese ihre Wür<strong>de</strong> nach zwei Gesichts<br />
punkten betrachtet wer<strong>de</strong>n. Einmal schlechthin <strong>und</strong> an sich,<br />
<strong>und</strong> so gesehen zeichnet sich jener durch größere Wür<strong>de</strong> aus,<br />
<strong>de</strong>r die größere Fülle geistlicher Gna<strong>de</strong>ngaben besitzt. Sodann<br />
im Hinblick auf das Gemeinwohl. Da kann es vorkommen, daß<br />
<strong>de</strong>r weniger Heilige <strong>und</strong> weniger Gelehrte für das Gemeinwohl<br />
wegen seiner weltlichen Macht <strong>und</strong> seiner Geschäftstüchtigkeit<br />
o<strong>de</strong>r wegen sonst etwas dieser Art mehr zu leisten vermag. Und<br />
weil die Zuteilung geistlicher Güter auf <strong>de</strong>n gemeinen N<strong>utz</strong>en<br />
ausgerichtet ist gemäß 1 Kor 12,7: „Einem je<strong>de</strong>n wird die<br />
Offenbarung <strong>de</strong>s Geistes geschenkt, damit sie an<strong>de</strong>ren nützt",<br />
wer<strong>de</strong>n bisweilen bei <strong>de</strong>r Verleihung geistlicher Güter die an<br />
sich weniger Guten <strong>de</strong>n Besseren ohne „Ansehen <strong>de</strong>r Person"<br />
vorgezogen. Ähnlich teilt ja auch Gott manchmal seine unver<br />
dienten Gna<strong>de</strong>n an weniger Gute aus.<br />
Zu 1. In Sachen Blutsverwandte eines Prälaten ist zu unter<br />
schei<strong>de</strong>n. Bisweilen sind sie sowohl an sich, als auch im Hin<br />
blick auf das Gemeinwohl weniger würdig, <strong>und</strong> wer<strong>de</strong>n sie <strong>de</strong>n<br />
Würdigeren <strong>de</strong>nnoch vorgezogen, ist dies eine Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
82
„Ansehens <strong>de</strong>r Person" bei <strong>de</strong>r Verleihung geistlicher Güter. 63. 2<br />
Über diese ist <strong>de</strong>r kirchliche Obere ja nicht Herr, so daß er sie<br />
nach Belieben zuteilen könnte, son<strong>de</strong>rn nur Verwalter gemäß 1<br />
Kor 4,1: „So erachte man uns als Diener Christi <strong>und</strong> Verwalter<br />
<strong>de</strong>r Geheimnisse Gottes." - Bisweilen jedoch sind die Blutsver<br />
wandten eines Kirchenprälaten genau so würdig wie an<strong>de</strong>re.<br />
Darum kann er sie ohne „Ansehen <strong>de</strong>r Person" erlaubterweise<br />
vorziehen, <strong>de</strong>nn darin wenigstens besteht ihr Vorzug, daß er<br />
mehr darauf vertrauen darf, daß sie mit ihm zusammen ein<br />
mütig die Geschäfte <strong>de</strong>r Kirche besorgen. Sollten jedoch irgend<br />
welche darin ein schlechtes Beispiel dafür sehen, daß Kirchen<br />
güter nicht nur wegen vorhan<strong>de</strong>ner Würdigkeit an Verwandte<br />
vergeben wer<strong>de</strong>n, dann müßte man <strong>de</strong>s Ärgernisses wegen<br />
davon absehen.<br />
Zu 2. Dispens zur Eheschließung pflegt hauptsächlich<br />
erteilt zu wer<strong>de</strong>n, um <strong>de</strong>n B<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns zu festigen. Dies<br />
ist bei hochgestellten Personen im Hinblick auf das Gemein<br />
wohl von dringen<strong>de</strong>rer Notwendigkeit. Daher gewährt man<br />
ihnen ohne „Ansehen <strong>de</strong>r Person" leichter Dispens.<br />
Zu 3. Damit eine Wahl gerichtlich nicht angefochten wer<strong>de</strong>n<br />
kann, genügt es, einen Guten zu wählen, <strong>de</strong>r Bessere braucht es<br />
nicht zu sein, <strong>de</strong>nn sonst könnte je<strong>de</strong> Wahl in Zweifel gezogen<br />
wer<strong>de</strong>n. Vor seinem Gewissen jedoch muß man <strong>de</strong>n Besseren<br />
wählen, <strong>de</strong>n Besseren schlechthin o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Besseren im Hin<br />
blick auf das Gemeinwohl. Denn steht einer zur Verfügung, <strong>de</strong>r<br />
für eine Wür<strong>de</strong> geeigneter ist <strong>und</strong> wird <strong>de</strong>nnoch ein an<strong>de</strong>rer vor<br />
gezogen, so muß dafür ein sachlicher Gr<strong>und</strong> vorhan<strong>de</strong>n sein.<br />
Liegt dieser in <strong>de</strong>r Eignung für das Amt, dann ist in dieser Hin<br />
sicht <strong>de</strong>r Gewählte auch <strong>de</strong>r Geeignetere. Hat <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong> für die<br />
Wahl mit <strong>de</strong>m Amt jedoch nichts zu tun, dann liegt ein<strong>de</strong>utig<br />
„Ansehen <strong>de</strong>r Person" vor.<br />
Zu 4. Wer bei <strong>de</strong>r Wahl aus <strong>de</strong>m Personenkreis <strong>de</strong>r (Kapitels-)<br />
Kirche hervorgeht, wird für das Gemeinwohl meist nützlicher<br />
sein, weil er die Kirche, in <strong>de</strong>r er groß gewor<strong>de</strong>n ist, mehr liebt.<br />
Deshalb wird in Dt 17,15 befohlen: „Nur aus <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>iner<br />
Brü<strong>de</strong>r darfst du einen König über dich einsetzen."<br />
83
63. 3 3. ARTIKEL<br />
Kommt es bei <strong>de</strong>r Erweisung von Ehre <strong>und</strong> Hochachtung<br />
zum „Ansehen <strong>de</strong>r Person "?<br />
1. Ehre ist nichts an<strong>de</strong>res als Ehrfurcht, die man einem zum<br />
Zeugnis seiner Tugend erweist, wie Aristoteles im I. Buch seiner<br />
Ethik (c. 3; 1095 b26) bemerkt. Nun muß man die kirchlichen<br />
Vorgesetzten <strong>und</strong> die Fürsten ehren, selbst wenn sie schlecht<br />
sind, ebenso auch die Eltern, wie in Ex20,12 geboten wird:<br />
„Ehre <strong>de</strong>inen Vater <strong>und</strong> <strong>de</strong>ine Mutter"; nicht weniger müssen<br />
die Bediensteten ihre Herren ehren, selbst wenn sie schlecht<br />
sind, gemäß <strong>de</strong>m 1. Brief an Tim 6,1: „Die das Joch <strong>de</strong>r Sklave<br />
rei zu tragen haben, sollen ihren Herren alle Ehre erweisen."<br />
Also ist „Ansehen <strong>de</strong>r Person" beim Erweis von Ehre keine<br />
Sün<strong>de</strong>.<br />
2. Im Buch Lvl9,32 wird geboten: „Vor einem ergrauten<br />
Haupt stehe auf <strong>und</strong> ehre die Person <strong>de</strong>s Greises." Doch dies<br />
sieht nach „Ansehen <strong>de</strong>r Person" aus, <strong>de</strong>nn manchmal sind die<br />
Greise nicht tugendhaft, wie Dn 13,5 schreibt: „Die Ungerech<br />
tigkeit ging aus von <strong>de</strong>n Ältesten <strong>de</strong>s Volkes." Also ist „An<br />
sehen <strong>de</strong>r Person" bei Erweis von Ehre keine Sün<strong>de</strong>.<br />
3. Zum Jakobuswort 2,1: „Haltet <strong>de</strong>n Glauben frei von<br />
je<strong>de</strong>m Ansehen <strong>de</strong>r Person", steht in <strong>de</strong>r Glosse Augustins<br />
(ML 33,740): „Gilt das Wort <strong>de</strong>s Jakobus ,Wenn ein Mann mit<br />
gol<strong>de</strong>nem Ring in euere Versammlung kommt usw.', von <strong>de</strong>n<br />
täglichen Zusammenkünften, wer sündigt dann nicht, wenn er<br />
überhaupt sündigt?" Doch „Ansehen <strong>de</strong>r Person" ist es, die Rei<br />
chen wegen ihres Reichtums zu ehren. Gregor sagt nämlich in<br />
einer Homilie (In Evang., hom. 28; ML 76, 1211): „Wie<br />
schwach gewor<strong>de</strong>n ist doch unser Stolz, da wir in <strong>de</strong>n Men<br />
schen nicht die nach <strong>de</strong>m Bil<strong>de</strong> Gottes geschaffene Natur, son<br />
<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n Reichtum ehren!" Und da <strong>de</strong>r Reichtum kein ange<br />
messener Gr<strong>und</strong> für Erweis von Ehre ist, gehört dies zum<br />
„Ansehen <strong>de</strong>r Person". Also ist „Ansehen <strong>de</strong>r Person" bei Ehr<br />
erweisung keine Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN steht das Wort <strong>de</strong>r Glosse zu Jak2,l (ML33,<br />
740): „Wer einen Reichen wegen seines Reichtums ehrt, <strong>de</strong>r sün<br />
digt." Dies gilt ebenso, wenn jemand aus Grün<strong>de</strong>n, die <strong>de</strong>r<br />
Ehrung nicht würdig machen, geehrt wird, - es fällt unter<br />
84
„Ansehen <strong>de</strong>r Person". Also ist „Ansehen <strong>de</strong>r Person" beim 63. 4<br />
Erweis von Ehre sündhaft.<br />
ANTWORT. Ehre be<strong>de</strong>utet Anerkennung <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>s<br />
Geehrten. Daher ist nur die Tugend <strong>de</strong>r maßgebliche Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Ehre. Man muß freilich be<strong>de</strong>nken, daß jemand nicht nur wegen<br />
<strong>de</strong>r eigenen Tugend geehrt wer<strong>de</strong>n kann, son<strong>de</strong>rn auch wegen <strong>de</strong>r<br />
Vollkommenheit eines an<strong>de</strong>ren. So wer<strong>de</strong>n auch die schlechten<br />
Fürsten <strong>und</strong> Prälaten geehrt, insofern sie Stellvertreter Gottes<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gemeinschaft sind, die sie leiten, gemäß Spr 26,8: „Wie<br />
einer, <strong>de</strong>r einen Stein auf Merkurs Steinhaufen wirft, ist, wer<br />
einem Toren Ehre erweist." Weil die Hei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Merkur das<br />
Rechnungswesen zuschreiben, be<strong>de</strong>utet „Haufe <strong>de</strong>s Merkur"<br />
soviel wie „Geldhaufen". Auf ihn wirft <strong>de</strong>r Kaufmann hie <strong>und</strong><br />
da ein kleines Steinchen anstelle von h<strong>und</strong>ert Mark. So wird<br />
auch <strong>de</strong>m Toren Ehre gezollt, weil er die Stelle Gottes <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
ganzen Gemeinschaft vertritt. - Desgleichen muß man die<br />
Eltern <strong>und</strong> Dienstherren ehren, <strong>de</strong>nn sie nehmen teil an <strong>de</strong>r<br />
Wür<strong>de</strong> Gottes, <strong>de</strong>r aller Vater <strong>und</strong> Herr ist. - Den Greisen<br />
jedoch gebührt Ehre, weil ihr Alter Zeugnis <strong>de</strong>r Tugend ist, mag<br />
das Zeugnis bisweilen auch versagen. Daher heißt es im Buch<br />
<strong>de</strong>r Weisheit 4,8: „Ehrenvolles Alter besteht nicht in einem lan<br />
gen Leben <strong>und</strong> wird nicht an <strong>de</strong>r Zahl <strong>de</strong>r Jahre gemessen. Mehr<br />
als graue Haare be<strong>de</strong>utet für die Menschen die Klugheit <strong>und</strong><br />
mehr als Greisenalter wiegt ein Leben ohne Ta<strong>de</strong>l." - Die<br />
Reichen aber sind <strong>de</strong>shalb zu ehren, weil sie in <strong>de</strong>n Gemein<br />
schaften eine höhere Stellung einnehmen. Wer<strong>de</strong>n sie aber nur<br />
wegen ihres Reichtums geehrt, ist dies Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s „Ansehens<br />
<strong>de</strong>r Person".<br />
Daraus ergibt sich die Lösung zu <strong>de</strong>n Einwän<strong>de</strong>n.<br />
4. ARTIKEL<br />
Gibt es bei Gerichtsentscheidungen die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s „Ansehens<br />
<strong>de</strong>r Person "?<br />
1. Das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" steht in Gegensatz zur vertei<br />
len<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> (Art. 1). Doch die Gerichtsentscheidun<br />
gen betreffen vor allem die ausgleichen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>. Also<br />
steht „Ansehen <strong>de</strong>r Person" hier nicht in Frage.<br />
2. Strafen wer<strong>de</strong>n aufgr<strong>und</strong> eines Urteils verhängt. Doch bei<br />
<strong>de</strong>r Strafzumessung gibt es „Ansehen <strong>de</strong>r Person", ohne daß<br />
85
63. 4 damit gesündigt wür<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn schwerer wird bestraft, wer einen<br />
Fürsten, als wer eine an<strong>de</strong>re Person beleidigt. Also gibt es bei<br />
richterlichen Urteilen kein „Ansehen <strong>de</strong>r Person".<br />
3. Sir 4,10 sagt: „Wenn du <strong>Recht</strong> sprichst, sei gegen Waisen<br />
barmherzig". Doch dies sieht nach „Ansehen <strong>de</strong>r Person" aus.<br />
Also ist „Ansehen <strong>de</strong>r Person" bei Gerichtsurteilen keine<br />
Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN heißt es in <strong>de</strong>n Sprichwörtern 18,5: „Ansehen<br />
<strong>de</strong>r Person bei Gericht ist nicht gut".<br />
ANTWORT. Wie gesagt (60,1), ist das Urteil ein Akt <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, insofern <strong>de</strong>r Richter das ins gerechte Gleich<br />
gewicht bringt, was zu Ungleichheit führen kann. Das „Anse<br />
hen <strong>de</strong>r Person" jedoch hat eine gewisse Ungleichheit zur Folge,<br />
insofern einer Person entgegen <strong>de</strong>m ihr Angemessenen - darin<br />
besteht das Gleichmaß <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> - etwas zugesprochen<br />
wird. Somit ist es ein<strong>de</strong>utig, daß durch „Ansehen <strong>de</strong>r Person"<br />
die richterliche Entscheidung verfälscht wird.<br />
Zu 1. Die richterliche Entscheidung kann man unter zwei<br />
fachem Gesichtspunkt betrachten. Einmal in Bezug auf die be<br />
urteilte Sache, <strong>und</strong> so gilt sie gleicherweise für die ausgleichen<strong>de</strong><br />
<strong>und</strong> die verteilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>, <strong>de</strong>nn durch richterliche Ent<br />
scheidung kann festgelegt wer<strong>de</strong>n, was vom Gemeingut an die<br />
einzelnen zu verteilen ist, aber auch, was <strong>de</strong>r eine <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren<br />
zum Ausgleich geben muß. - Sodann kann die Form <strong>de</strong>r richter<br />
lichen Entscheidung ins Auge gefaßt wer<strong>de</strong>n, insofern <strong>de</strong>r Rich<br />
ter auch im Bereich <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>de</strong>m<br />
einen nimmt <strong>und</strong> <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren gibt. Dies jedoch fällt in die<br />
Zuständigkeit <strong>de</strong>r verteilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong>. So kann bei je<strong>de</strong>r<br />
richterlichen Entscheidung das „Ansehen <strong>de</strong>r Person" eine<br />
Rolle spielen.<br />
Zu 2. Wird jemand wegen Beleidigung einer höher gestellten<br />
Person schwerer bestraft, dann hat dies mit „Ansehen <strong>de</strong>r Per<br />
son" nichts zu tun, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Verschie<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>r Personen liegt<br />
in dieser Beziehung auch ein sachlicher Unterschied zugr<strong>und</strong>e,<br />
wie oben (61,2,3) ausgeführt wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Zu 3. Man muß vor Gericht <strong>de</strong>m Armen, soweit möglich, zu<br />
Hilfe kommen, jedoch ohne Verletzung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Sonst tritt das Exoduswort 23,3 in Kraft: „Du sollst auch <strong>de</strong>n<br />
Armen vor Gericht nicht begünstigen".<br />
86
64. FRAGE<br />
DER MORD<br />
Nun sind die <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> entgegen<br />
gesetzten Laster zu behan<strong>de</strong>ln. Dabei stellen sich 1. die Sün<strong>de</strong>n<br />
zur Besprechung an, die auf unfreiwilliger Gegenseitigkeit<br />
beruhen, 2. die Sün<strong>de</strong>n, die in freiwilliger Gegenseitigkeit be<br />
gangen wer<strong>de</strong>n (Fr. 77-78). Bei unfreiwilliger Gegenseitigkeit<br />
wer<strong>de</strong>n die Sün<strong>de</strong>n dadurch begangen, daß <strong>de</strong>m Nächsten<br />
gegen seinen Willen Scha<strong>de</strong>n zugefügt wird, <strong>und</strong> dies kann auf<br />
zweifache Weise geschehen: durch Tat <strong>und</strong> durch Wort. Durch<br />
Tat dadurch, daß <strong>de</strong>r Mitmensch in eigener Person o<strong>de</strong>r in<br />
einem seiner Angehörigen o<strong>de</strong>r in seinem Eigentum Scha<strong>de</strong>n<br />
erlei<strong>de</strong>t. Diese Punkte sind <strong>de</strong>r Reihe nach zu behan<strong>de</strong>ln.<br />
Zunächst stellt sich das Thema Mord, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Mitmenschen<br />
am meisten scha<strong>de</strong>t.<br />
Dabei erheben sich 8 Fragen:<br />
1. Ist das Vernichten von Tieren <strong>und</strong> Pflanzen eine Sün<strong>de</strong>?<br />
2. Ist es erlaubt, einen Sün<strong>de</strong>r zu töten?<br />
3. Darf dies ein Privatmann o<strong>de</strong>r nur eine Amtsperson?<br />
4. Darf es ein Geistlicher?<br />
5. Darf man sich selber töten?<br />
6. Darf man einen Gerechten töten?<br />
7. Darf man in Notwehr jeman<strong>de</strong>n töten?<br />
8. Ist unbeabsichtigte Tötung schwere Sün<strong>de</strong>?<br />
1. ARTIKEL<br />
Darf man irgendwelche Lebewesen töten?<br />
1. Der Apostel schreibt im Römerbrief 13,2: „Wer sich <strong>de</strong>r<br />
Ordnung Gottes wi<strong>de</strong>rsetzt, zieht sich selbst sein Gericht zu".<br />
Nun wer<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r göttlichen Vorsehung alle<br />
Wesen am Leben erhalten gemäß Psalm 146,8: „Er läßt Gras<br />
wachsen auf <strong>de</strong>n Höhen <strong>und</strong> gibt <strong>de</strong>m Vieh seine Nahrung".<br />
Also ist es nicht erlaubt, irgendwelche Lebewesen zu vernich<br />
ten.<br />
2. Mord ist <strong>de</strong>shalb Sün<strong>de</strong>, weil dabei ein Mensch seines Le<br />
bens beraubt wird. Doch Leben ist auch in allen Tieren <strong>und</strong><br />
87
64. l Pflanzen. Also ist es in gleicher Weise Sün<strong>de</strong>, Tiere <strong>und</strong> Pflanzen<br />
zu vernichten.<br />
3. Das göttliche Gesetz spricht nur für die Sün<strong>de</strong> eine beson<br />
<strong>de</strong>re Strafe aus. Nun wird aber dort für <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r eines an<strong>de</strong>ren<br />
Schaf o<strong>de</strong>r Rind tötet, eine bestimmte Strafe ausgesprochen,<br />
wie aus Ex22,1 hervorgeht. Also ist das Töten von Tieren<br />
Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN schreibt Augustinus im I. Buch <strong>de</strong>s Gottesstaates<br />
(c.20; ML41,35): „Wenn wir hören ,Du sollst nicht töten', so<br />
geht es bei diesem Wort nicht um Fruchtpflanzen, <strong>de</strong>nn sie<br />
haben keinerlei Empfin<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> auch nicht um unvernünftige<br />
Tiere, <strong>de</strong>nn sie stehen mit uns nicht auf gleicher Ebene. Das<br />
Wort ,Du sollst nicht töten' können wir sinnvoll also nur auf<br />
Menschen anwen<strong>de</strong>n".<br />
ANTWORT. Von Sün<strong>de</strong> ist keine Re<strong>de</strong>, wenn man eine Sache<br />
entsprechend ihrem Zweck gebraucht. Nun ist in <strong>de</strong>r Hierar<br />
chie <strong>de</strong>r Dinge das Unvollkommene wegen <strong>de</strong>s Vollkommenen<br />
da: so schreitet auch die Natur auf <strong>de</strong>m Weg <strong>de</strong>s Wer<strong>de</strong>ns vom<br />
Unvollkommenen zum Vollkommenen voran. Wie es daher bei<br />
<strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s Menschen zuerst mit etwas Lebendigem<br />
beginnt, hierauf das Sinnenwesen erscheint, <strong>und</strong> schließlich <strong>de</strong>r<br />
Mensch kommt [24], so ist auch das, was bloß Leben hat wie<br />
die Pflanzen im ganzen gesehen wegen <strong>de</strong>r Tiere da, <strong>und</strong> die<br />
Tiere sind wegen <strong>de</strong>r Menschen da. Wenn daher <strong>de</strong>r Mensch die<br />
Pflanzen zum N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>r Tiere gebraucht <strong>und</strong> die Tiere zum<br />
N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>r Menschen, so ist hier nichts Unerlaubtes zu fin<strong>de</strong>n,<br />
wie auch Aristoteles im I.Buch seiner Politik (c. 8; 1256b 15)<br />
meint. Neben an<strong>de</strong>ren Zwecken besteht <strong>de</strong>r wichtigste darin,<br />
daß die Tiere die Pflanzen <strong>und</strong> die Menschen die Tiere als Nah<br />
rung benützen, <strong>und</strong> dies kann nicht geschehen, ohne daß man<br />
ihrem Leben ein En<strong>de</strong> macht. Daher darf man Pflanzen als Tier<br />
futter gebrauchen <strong>und</strong> Tiere zum N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>s Menschen töten,<br />
<strong>und</strong> zwar nach göttlicher Anordnung, wie es in Gnl,29f.<br />
geschrieben steht: „Seht, ich gebe euch alle Kräuter <strong>und</strong> alle<br />
Bäume, damit sie euch <strong>und</strong> allen Tieren als Nahrung dienen".<br />
Und Gn9,3 heißt es: „Alles, was sich regt <strong>und</strong> lebt, soll eure<br />
Speise sein".<br />
Zu 1. Nach göttlicher Ordnung wird das Leben von Tier<br />
<strong>und</strong> Pflanze nicht um ihrer selbst willen erhalten, son<strong>de</strong>rn<br />
wegen <strong>de</strong>s Menschen. Daher schreibt Augustinus im I. Buch sei<br />
nes Gottesstaates (a. a. O.): „Nach <strong>de</strong>r höchsten Ordnung <strong>de</strong>s<br />
88
Schöpfers stehen Leben <strong>und</strong> Tod dieser Wesen zu unserer Ver- 64. 2<br />
fügung".<br />
Zu 2. Tiere <strong>und</strong> Pflanzen besitzen kein Vernunftleben, mit<br />
<strong>de</strong>m sie sich selbst leiten könnten, son<strong>de</strong>rn sie wer<strong>de</strong>n stets<br />
gleichsam von einem an<strong>de</strong>ren, einem gewissen naturhaften<br />
Antrieb, gelenkt. Dies ist ein Zeichen dafür, daß sie von Natur<br />
aus zum Dienst <strong>und</strong> Gebrauch an<strong>de</strong>rer bestimmt sind.<br />
Zu 3. Wer das Rind eines an<strong>de</strong>ren tötet, sündigt, nicht weil er<br />
das Rind getötet, son<strong>de</strong>rn weil er jeman<strong>de</strong>n an seinem Eigen<br />
tum geschädigt hat. Daher fällt dies nicht unter die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Mor<strong>de</strong>s, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Diebstahls o<strong>de</strong>r Raubes.<br />
2. ARTIKEL<br />
Ist es erlaubt, Sün<strong>de</strong>r zu töten?<br />
1. Der Herr verbietet in jenem Gleichnis Mt 13,29f.,<br />
Unkraut - das sind die „Söhne <strong>de</strong>s Bösen", wie es dort (V. 38)<br />
heißt - auszureißen. Nun ist alles, was Gott verbietet, Sün<strong>de</strong>.<br />
Also ist es auch Sün<strong>de</strong>, einen Sün<strong>de</strong>r zu töten.<br />
2. Die menschliche <strong>Gerechtigkeit</strong> gleicht sich <strong>de</strong>r göttlichen<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> an. Doch nach göttlicher <strong>Gerechtigkeit</strong> wer<strong>de</strong>n<br />
die Sün<strong>de</strong>r geschont, damit sie Buße tun gemäß <strong>de</strong>m Ezechielwort<br />
(18,23; 33,11): „Ich will nicht <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs Tod, son<strong>de</strong>rn<br />
daß er sich bekehre <strong>und</strong> lebe". Also ist es durchaus unrecht,<br />
wenn Sün<strong>de</strong>r getötet wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Etwas in sich Schlechtes darf auch wegen eines noch so<br />
guten Zweckes nicht getan wer<strong>de</strong>n, wie aus Augustins Buch<br />
Gegen die Lüge (c. 7; ML 40,528) <strong>und</strong> aus <strong>de</strong>s Aristoteles Ethik,<br />
Buch V (c. 6; 1107al4), hervorgeht. Doch einen Menschen<br />
töten ist in sich schlecht, <strong>de</strong>nn je<strong>de</strong>m Menschen müssen wir uns<br />
in Liebe zuwen<strong>de</strong>n, unsere Fre<strong>und</strong>e aber „sollen leben <strong>und</strong><br />
sein", wie Aristoteles im IX.Buch seiner Ethik (c.4; 1166a4)<br />
bemerkt. Also ist es in keinem Fall erlaubt, einen Sün<strong>de</strong>r zu<br />
töten.<br />
DAGEGEN heißt es Ex22,18: „Zauberer sollst du nicht am<br />
Leben lassen", <strong>und</strong> im Psalm 101,8: „Am Morgen will ich alle<br />
Frevler im Lan<strong>de</strong> töten".<br />
ANTWORT. Wie (Art. 1) gesagt,ist es erlaubt,Tiere zu töten,<br />
insofern sie von Natur aus, so wie das Unvollkommene auf das<br />
Vollkommene, auf die Bedürfnisse <strong>de</strong>r Menschen hingeordnet<br />
89
64. 2 sind. Je<strong>de</strong>r Teil nun ist auf das Ganze wie das Unvollkommene<br />
auf das Vollkommene ausgerichtet. Daher ist je<strong>de</strong>r Teil natürli<br />
cherweise wegen <strong>de</strong>s Ganzen da. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird ein<br />
Glied, wenn es z. B. faulig ist <strong>und</strong> an<strong>de</strong>re anzustecken droht,<br />
zum Wohl <strong>de</strong>s ganzen menschlichen Körpers mit Fug <strong>und</strong><br />
<strong>Recht</strong> abgeschnitten. Je<strong>de</strong> Einzelperson aber steht zur gesamten<br />
Gemeinschaft im Verhältnis <strong>de</strong>s Teils zum Ganzen. Wenn sich<br />
daher ein Mensch wegen einer Sün<strong>de</strong> als gefährlich <strong>und</strong> ver<strong>de</strong>rb<br />
lich für die Gemeinschaft herausstellt, wird er zur Erhaltung<br />
<strong>de</strong>s Gemeinwohls mit Fug <strong>und</strong> <strong>Recht</strong> getötet, <strong>de</strong>nn, wie es im<br />
1. Korintherbrief 5,6 heißt, „verdirbt ein wenig Sauerteig die<br />
ganze Masse".<br />
Zu 1. Der Herr befahl, das Ausreißen <strong>de</strong>s Unkrauts zu<br />
unterlassen, um <strong>de</strong>n Weizen, d. h. die Guten, zu schonen. Dies<br />
ist <strong>de</strong>r Fall, wenn sich die Schlechten nicht ausrotten lassen,<br />
ohne daß man dabei auch die Guten vernichtet, da sie sich unter<br />
die Guten verstecken o<strong>de</strong>r weil sie viele Anhänger haben, so<br />
daß sie ohne Gefahr für die Guten nicht unschädlich gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n können, wie Augustinus in seiner Schrift Gegen<br />
Parmenianus (III, 2; ML 43,89) sagt. Daher lehrt <strong>de</strong>r Herr, man<br />
solle die Schlechten lieber am Leben lassen <strong>und</strong> die Vergeltung<br />
auf <strong>de</strong>n Jüngsten Tag aufsparen, als die Guten zugleich <strong>de</strong>m Tod<br />
ausliefern. - Wenn jedoch die Tötung <strong>de</strong>r Bösen keine Gefahr<br />
für die Guten mit sich bringt, son<strong>de</strong>rn eher ihrem Sch<strong>utz</strong> <strong>und</strong><br />
ihrer Rettung dient, da dürfen die Schlechten mit <strong>Recht</strong> getötet<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Zu 2. Nach <strong>de</strong>r Ordnung seiner Weisheit tötet Gott die Sün<br />
<strong>de</strong>r bisweilen sofort, um die Guten zu befreien, bisweilen aber<br />
gewährt er ihnen eine Frist <strong>de</strong>r Buße, wie es nach seiner Vor<br />
sehung für seine Auserwählten dienlich ist. So verhält sich nach<br />
Möglichkeit ja auch die menschliche <strong>Gerechtigkeit</strong>: die<br />
Gemeingefährlichen tötet sie, die Sün<strong>de</strong>r, die an<strong>de</strong>ren keinen<br />
schweren Scha<strong>de</strong>n zufügen, schont sie, damit sie Buße tun.<br />
Zu 3. Der Mensch steigt durch sein Sündigen aus <strong>de</strong>r Ord<br />
nung <strong>de</strong>r Vernunft aus, <strong>und</strong> damit wirft er auch seine mensch<br />
liche Wür<strong>de</strong> von sich, in <strong>de</strong>r seine natürliche Freiheit <strong>und</strong> ein<br />
Leben um seiner selbst willen beschlossen liegen, <strong>und</strong> sinkt hin<br />
ab in die Sklaverei <strong>de</strong>s Tieres, damit entsprechend seinem Nut<br />
zen für an<strong>de</strong>re über ihn verfügt wird gemäß Ps49,21: „Der<br />
Mensch in Ehren, doch ohne Einsicht, er gleicht <strong>de</strong>m Vieh <strong>und</strong><br />
wird ihm ähnlich", <strong>und</strong> Sprll,29 heißt es: „Der Tor wird <strong>de</strong>s<br />
90
Weisen Knecht". Obwohl es daher in sich schlecht ist, einen 64. 3<br />
seine Wür<strong>de</strong> hochhalten<strong>de</strong>n Menschen zu töten, kann es doch<br />
gut sein, einen sündhaften Menschen ebenso zu töten wie ein<br />
Tier, <strong>de</strong>nn ein schlechter Mensch ist noch schlechter als ein Tier<br />
<strong>und</strong> richtet größeren Scha<strong>de</strong>n an, wie Aristoteles im I. Buch sei<br />
ner Politik (c.2; 1253 a 32) <strong>und</strong> im VII. Buch <strong>de</strong>r Ehtik (c.7;<br />
1150 a 7) schreibt.<br />
3. ARTIKEL<br />
Darf eine Privatperson einen Sün<strong>de</strong>r töten?<br />
1. Im göttlichen Gesetz wird nichts Unerlaubtes befohlen.<br />
Doch Ex 32,27 ordnet Moses an: „Ein je<strong>de</strong>r töte seinen Näch<br />
sten, seinen Bru<strong>de</strong>r <strong>und</strong> seinen Fre<strong>und</strong>" um <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
gegossenen Kalbes willen. Also ist es auch Privatpersonen<br />
erlaubt, Sün<strong>de</strong>r zu töten.<br />
2. Wegen seiner Sün<strong>de</strong>n wird ein Mensch mit <strong>de</strong>n Tieren ver<br />
glichen (vgl. Art. 2 Zu 3). Doch ein schweren Scha<strong>de</strong>n verursa<br />
chen<strong>de</strong>s wil<strong>de</strong>s Tier darf je<strong>de</strong> Privatperson töten. Also mit glei<br />
chem Gr<strong>und</strong> auch einen sündigen Menschen.<br />
3. Lobenswert ist, wenn sich ein Mensch auch als Privatper<br />
son zum N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>s Gemeinwohls einsetzt. Nun schlägt aber<br />
das Töten von Übeltätern zum N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>s Gemeinwohls aus<br />
(vgl. o.). Also ist es lobenswert, wenn auch Privatpersonen<br />
Übeltäter töten.<br />
DAGEGEN schreibt Augustinus im I. Buch <strong>de</strong>s Gottesstaates<br />
(vgl. Frdbl, 965): „Wer ohne öffentlichen Auftrag einen Verbre<br />
cher tötet, wird wie ein Mör<strong>de</strong>r verurteilt, <strong>und</strong> dies umso mehr,<br />
als er sich nicht scheute, sich eine Vollmacht anzumaßen, die er<br />
von Gott nicht erhalten hat."<br />
ANTWORT. Wie gesagt (Art. 2), darf man einen Menschen<br />
töten, insofern dies auf das Wohl <strong>de</strong>r ganzen Gemeinschaft hin<br />
geordnet ist [25]. Daher steht dies nur jenem zu, in <strong>de</strong>ssen Hän<br />
<strong>de</strong>n die Sorge für das Gemeinwohl ruht, wie es Sache <strong>de</strong>s Arztes<br />
ist, ein fauliges Glied abzuschnei<strong>de</strong>n, wenn ihm die Sorge für<br />
<strong>de</strong>n ganzen Körper übertragen wur<strong>de</strong>. Die Sorge für das<br />
Gemeinwohl nun liegt in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r regieren<strong>de</strong>n Fürsten,<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>shalb steht es nur ihnen zu, Übeltäter zu töten, nicht aber<br />
Privatpersonen.<br />
91
64. 4 Zu 1. Wer autoritativ befiehlt, ist <strong>de</strong>r wahre Täter, so Diony<br />
sius in seiner Caelestis hierarchia c. 13 (MG 3,305). Augustinus<br />
bemerkt daher im I.Buch seines Gottesstaates (c. 21;<br />
ML 41,35): „Nicht <strong>de</strong>r tötet, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Befehlen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Dienst<br />
schul<strong>de</strong>t wie ein Schwert <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r es führt." Daher haben jene,<br />
die auf göttlichen Befehl hin ihre Nächsten <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e töte<br />
ten, dies nicht selber getan, son<strong>de</strong>rn vielmehr jener, in <strong>de</strong>ssen<br />
Namen sie es ausgeführt, so wie ein Soldat im Auftrag <strong>de</strong>s Für<br />
sten <strong>de</strong>n Feind tötet, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Henker <strong>de</strong>n Räuber im Namen<br />
<strong>de</strong>s Richters.<br />
Zu 2. Das Tier unterschei<strong>de</strong>t sich von Natur aus vom Men<br />
schen. Daher bedarf es keines richterlichen Urteils, ob es, falls<br />
frei lebend, getötet wer<strong>de</strong>n darf. Bei Haustieren jedoch ist ein<br />
Urteil nötig, zwar nicht wegen ihrer selbst, son<strong>de</strong>rn wegen <strong>de</strong>s<br />
Scha<strong>de</strong>ns für <strong>de</strong>n Eigentümer. Ein sündiger Mensch hingegen<br />
unterschei<strong>de</strong>t sich nicht <strong>de</strong>r Natur nach von <strong>de</strong>n gerechten<br />
Menschen <strong>und</strong> daher ist ein öffentliches Gerichtsverfahren not<br />
wendig, um zu entschei<strong>de</strong>n, ob er wegen <strong>de</strong>s Gemeinwohls<br />
getötet wer<strong>de</strong>n soll.<br />
Zu 3. Etwas Unschädliches für das Wohl <strong>de</strong>r Allgemeinheit<br />
zu tun, ist je<strong>de</strong>r Privatperson erlaubt. Doch wenn dabei Scha<br />
<strong>de</strong>n entsteht, darf es nicht ohne richterliches Urteil <strong>de</strong>ssen<br />
geschehen, <strong>de</strong>m es zusteht, abzuschätzen, was zum Wohl <strong>de</strong>s<br />
Ganzen <strong>de</strong>n Teilen entzogen wer<strong>de</strong>n darf.<br />
4. ARTIKEL<br />
Ist es Geistlichen erlaubt, Verbrecher zu töten?<br />
1. Geistliche müssen ihr Leben gestalten nach <strong>de</strong>m Wort <strong>de</strong>s<br />
Apostels (1 Kor4,6): „Seid meine Nachahmer, wie ich Christi<br />
Nachahmer bin." Damit wird uns nahegelegt, <strong>de</strong>m Beispiel<br />
Gottes <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Heiligen nachzueifern. Doch Gott selbst, <strong>de</strong>n<br />
wir verehren, tötet Verbrecher gemäß Psalm 135,10: „Erschlug<br />
<strong>de</strong>n Ägypter samt seiner Erstgeburt." Auch Moses ließ von <strong>de</strong>n<br />
Leviten 23 000 Menschen töten, weil sie vor <strong>de</strong>m gol<strong>de</strong>nen Kalb<br />
nie<strong>de</strong>rgekniet waren, wie in Ex 32,28 nachzulesen ist. Und <strong>de</strong>r<br />
Priester Pbinees schlug einen Israeliten nie<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r sich mit einer<br />
Midianiterin eingelassen hatte (Nm25,6ff.). Samuel tötete <strong>de</strong>n<br />
König Agag von Amalek (1 Sam 15,33) <strong>und</strong> Elias die Baalsprie<br />
ster (3 Kön 18,40) <strong>und</strong> Mathathias <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r gera<strong>de</strong> opfern wollte<br />
92
(1 Makk2,24), <strong>und</strong> im Neuen Testament Petrus das Ehepaar 64.4<br />
Ananias <strong>und</strong> Saphira (Apg5,3ff.). Also ist es auch <strong>de</strong>n Geistlichen<br />
erlaubt, Übeltäter zu töten.<br />
2. Die geistliche Macht steht über <strong>de</strong>r weltlichen <strong>und</strong> ist Gott<br />
mehr verb<strong>und</strong>en. Nun darf die weltliche Macht als „Dienerin<br />
Gottes", wie es im Römerbrief 13,4 heißt, die Verbrecher töten.<br />
Also steht es noch viel mehr <strong>de</strong>n Geistlichen zu, die als Diener<br />
Gottes geistliche Vollmacht besitzen, Verbrecher zu töten.<br />
3. Wer rechtmäßig ein Amt übernimmt, darf erlaubterweise<br />
tun, was in die Zuständigkeit dieses Amtes fällt. Nun ist es die<br />
amtliche Aufgabe <strong>de</strong>r Fürsten <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>, die Verbrecher zu töten<br />
(vgl. Art. 3), also dürfen auch jene Geistliche, die zugleich Für<br />
sten sind, Verbrecher töten.<br />
DAGEGEN heißt es im 1.Brief an Timotheus 3,2f.: „Der<br />
Bischof soll ohne Ta<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>m Trunk nicht ergeben <strong>und</strong> kein Tot<br />
schläger sein."<br />
ANTWORT. Aus zwei Grün<strong>de</strong>n dürfen die Geistlichen nicht<br />
töten. Erstens, weil sie für <strong>de</strong>n Dienst am Altar ausersehen sind,<br />
an <strong>de</strong>m das Lei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s getöteten Christus dargestellt wird, <strong>de</strong>r,<br />
„da er geschlagen wur<strong>de</strong>, selbst nicht schlug", wie es im<br />
1. Petrusbrief 2,23 heißt. Daher geziemt es sich nicht, daß<br />
Geistliche schlagen o<strong>de</strong>r töten, <strong>de</strong>nn die Diener müssen sich<br />
ihren Herrn zum Vorbild nehmen gemäß <strong>de</strong>m Wort <strong>de</strong>s Jesus<br />
Sirach 10,2: „Wie die Richter <strong>de</strong>s Volkes, so seine Diener" [26].<br />
Zweitens, weil <strong>de</strong>n Geistlichen <strong>de</strong>r Dienst <strong>de</strong>s Neuen B<strong>und</strong>es<br />
obliegt, in <strong>de</strong>m Töten <strong>und</strong> Körperverletzung nicht als Strafe<br />
festgesetzt sind. Sie müssen daher, um „würdige Diener <strong>de</strong>s<br />
Neuen Testamentes zu sein" (2 Kor 3,6), solches unterlassen.<br />
Zu 1. Gott wirkt überall in allem das Gute, für <strong>de</strong>n einzel<br />
nen jedoch das, was ihm angemessen ist. Daher muß je<strong>de</strong>r Gott<br />
in <strong>de</strong>m nachahmen, was für ihn beson<strong>de</strong>rs angemessen ist.<br />
Wenn nun Gott die Missetäter körperlich tötet, ist es nicht<br />
nötig, daß ihn alle hierin nachahmen. - Petras hat nicht aus eigener<br />
Vollmacht o<strong>de</strong>r mit eigener Hand Ananias <strong>und</strong> Saphira<br />
getötet, son<strong>de</strong>rn damit vielmehr <strong>de</strong>n göttlichen Urteilsspruch<br />
über ihren Tod verkün<strong>de</strong>t. - Priester <strong>und</strong> Leviten waren im<br />
Alten Testament Diener <strong>de</strong>s Alten Gesetzes, das körperliche<br />
Strafen verhängte, <strong>und</strong> <strong>de</strong>shalb stand es ihnen auch zu, mit eige<br />
ner Hand zu töten.<br />
Zu 2. Der geistliche Dienst ist auf einen höheren Zweck als<br />
auf Vollstreckung von To<strong>de</strong>sstrafen ausgerichtet, nämlich auf<br />
93
64. 5 das, was zum Seelenheil gehört. Daher ist es für sie unpassend,<br />
sich mit etwas weniger Wichtigem abzugeben.<br />
Zu 3. Kirchenprälaten übernehmen ein fürstliches Amt<br />
nicht, um selber Bluturteile zu vollstrecken, sie geben dazu<br />
an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>n obrigkeitlichen Auftrag [27].<br />
5. ARTIKEL<br />
Darf man sich selber töten? [28]<br />
1. Mord ist Sün<strong>de</strong>, insofern er <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> wi<strong>de</strong>r<br />
spricht. Doch niemand kann sich selber Unrecht antun, wie im<br />
V.Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 15; 1138a4) bewiesen wird. Also sündigt<br />
nicht, wer sich selber tötet.<br />
2. Wer öffentliche Vollmacht besitzt, darf Verbrecher töten.<br />
Doch bisweilen ist <strong>de</strong>r Inhaber öffentlicher Vollmacht selbst ein<br />
Verbrecher. Also darf er sich auch selber töten.<br />
3. Es ist erlaubt, sich aus eigenem Entschluß in eine gerin<br />
gere Gefahr zu begeben, um eine größere zu vermei<strong>de</strong>n, wie es<br />
z. B. erlaubt ist, sich zum Wohl <strong>de</strong>s ganzen Körpers selbst ein<br />
fauliges Glied abzuschnei<strong>de</strong>n. Nun kann es sein, daß einer<br />
durch Selbsttötung einem größeren Übel, einem elen<strong>de</strong>n Leben<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Schan<strong>de</strong> einer Sün<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m Weg geht. Also ist es<br />
erlaubt, sich selbst zu töten.<br />
4. Samson tötete sich selber wie im Buch <strong>de</strong>r Richter (16,30)<br />
steht, <strong>und</strong> <strong>de</strong>nnoch zählt er zu <strong>de</strong>n Heiligen (Hebr 11,32). Also<br />
ist es erlaubt, sich selbst zu töten.<br />
5. Im 2. Makkabäerbuch 14,41 ff. wird berichtet, daß ein<br />
gewisser Razias (Rasis) sich selbst das Leben nahm, „<strong>de</strong>nn er<br />
wollte lieber in Ehren sterben, als <strong>de</strong>n Frevlern in die Hän<strong>de</strong> fal<br />
len <strong>und</strong> eine schimpfliche Behandlung erfahren, die seiner edlen<br />
Herkunft unwürdig war". Nichts aber, was e<strong>de</strong>lmütig <strong>und</strong> tap<br />
fer getan wird, ist unerlaubt. Also ist gegen Selbstmord nichts<br />
einzuwen<strong>de</strong>n.<br />
DAGEGEN schreibt Augustinus im I. Buch <strong>de</strong>s Gottesstaates<br />
(c.20; ML41,35): „Es bleibt nur übrig, das Verbot ,Du sollst<br />
nicht töten' vom Menschen zu verstehen: we<strong>de</strong>r einen an<strong>de</strong>ren<br />
noch dich selbst sollst du töten. Denn wer sich selbst tötet, tötet<br />
eben auch einen Menschen."<br />
ANTWORT. Sich selbst zu töten ist aus dreifachem Gr<strong>und</strong><br />
ganz <strong>und</strong> gar unerlaubt.<br />
94
1. Weil sich je<strong>de</strong>s Wesen von Natur aus liebt, <strong>und</strong> dazu 64. 5<br />
gehört, daß es aus naturhaftem Drang sich seine Existenz<br />
sichert <strong>und</strong> sich allem Zerstörerischen nach Kräften entgegen<br />
stellt. Daher ist Selbstmord gegen <strong>de</strong>n Naturtrieb <strong>und</strong> die Cari<br />
tas gerichtet, mit <strong>de</strong>r ein je<strong>de</strong>r sich selber lieben muß. Aus die<br />
sem Gr<strong>und</strong> ist Selbstmord auch immer schwere Sün<strong>de</strong>, eben<br />
weil er gegen das Naturgesetz <strong>und</strong> gegen die Caritas verstößt.<br />
2. Weil je<strong>de</strong>r Teil als Teil <strong>de</strong>m Ganzen gehört. Der Mensch<br />
jedoch ist Teil <strong>de</strong>r Gemeinschaft, <strong>und</strong> so gehört er als solcher ihr<br />
an. Daher fügt er <strong>de</strong>r Gemeinschaft, wenn er sich das Leben<br />
nimmt, einen Scha<strong>de</strong>n zu, wie Aristoteles im V.Buch seiner<br />
Ethik (c. 15; 1138all) erklärt.<br />
3. Weil das Leben ein Geschenk Gottes für <strong>de</strong>n Menschen ist<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Macht <strong>de</strong>ssen unterworfen bleibt, „<strong>de</strong>r tötet <strong>und</strong> leben<br />
dig macht". Wer sich das Leben nimmt, sündigt daher gegen<br />
Gott genau so, wie sich einer, <strong>de</strong>r einen frem<strong>de</strong>n Sklaven tötet,<br />
gegen <strong>de</strong>n Herrn <strong>de</strong>s Sklaven versündigt, <strong>und</strong> wie einer sündigt,<br />
<strong>de</strong>r sich ein Urteil über eine Sache anmaßt, für die er nicht<br />
zuständig ist. Gott allein nämlich steht das Urteil über Tod <strong>und</strong><br />
Leben zu gemäß <strong>de</strong>m Wort in Dt 32,39: „Ich bin es, <strong>de</strong>r tötet<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r lebendig macht."<br />
Zu 1. Der Mord ist nicht nur Sün<strong>de</strong>, weil er sich gegen die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, son<strong>de</strong>rn auch weil er sich gegen die Liebe richtet,<br />
die man zu sich selber haben muß. Und so gesehen be<strong>de</strong>utet<br />
Selbstmord Sün<strong>de</strong> gegen sich selbst. In Bezug auf die Gemein<br />
schaft <strong>und</strong> auf Gott ist er aber auch eine Sün<strong>de</strong> gegen die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Zu 2. Der Inhaber <strong>de</strong>r öffentlichen Gewalt kann einen Mis<br />
setäter erlaubterweise töten, weil er ihn richten kann. Niemand<br />
aber ist Richter seiner selbst. Daher darf sich <strong>de</strong>r Inhaber <strong>de</strong>r<br />
öffentlichen Gewalt nicht selber töten, was auch immer sein<br />
Vergehen sein mag. Doch bleibt es ihm unbenommen, sich <strong>de</strong>m<br />
Gericht an<strong>de</strong>rer zu stellen.<br />
Zu 3. Der Mensch wird Herr seiner selbst durch seine Wil<br />
lensfreiheit. Er kann daher frei über sich verfügen in allen Berei<br />
chen <strong>de</strong>s Lebens, die seiner freien Entscheidung unterliegen.<br />
Doch <strong>de</strong>r Übergang von diesem Leben in ein an<strong>de</strong>res glückli<br />
cheres fällt nicht in die Kompetenz <strong>de</strong>r menschlichen Willens<br />
freiheit, son<strong>de</strong>rn hängt von <strong>de</strong>r Macht Gottes ab. Deshalb darf<br />
<strong>de</strong>r Mensch nicht Hand an sich legen, um in ein glücklicheres<br />
Leben hinüberzugehen.<br />
95
64. 5 Ebensowenig, um <strong>de</strong>m Elend <strong>de</strong>r irdischen Existenz zu ent<br />
gehen. Denn „das letzte" aller Übel dieses Lebens <strong>und</strong> „das<br />
schrecklichste" ist <strong>de</strong>r Tod, wie Aristoteles im III. Buch seiner<br />
Ethik (c.9; 1115 a 26) bemerkt. Und daher be<strong>de</strong>utet, sich <strong>de</strong>n<br />
Tod antun, um <strong>de</strong>r Drangsal dieses Lebens zu entfliehen, ein<br />
größeres Übel auf sich nehmen, um ein kleineres zu vermei<strong>de</strong>n.<br />
Ebensowenig ist es erlaubt, seinem Leben wegen einer be<br />
gangenen Sün<strong>de</strong> freiwillig ein En<strong>de</strong> zu setzen. Denn einmal fügt<br />
man sich dadurch <strong>de</strong>n größten Scha<strong>de</strong>n zu, daß man sich <strong>de</strong>r<br />
nötigen Zeit zur Buße beraubt, <strong>und</strong> sodann darf man einen Mis<br />
setäter ja auch nur aufgr<strong>und</strong> eines Urteils <strong>de</strong>r öffentlichen<br />
Gewalt seines Lebens berauben.<br />
Ebensowenig ist es einer Frau erlaubt, sich zu töten, um einer<br />
Vergewaltigung zu entrinnen. Denn sie darf nicht selbst das<br />
größte Verbrechen begehen - nämlich Selbstmord -, um das<br />
Verbrechen eines an<strong>de</strong>ren zu verhin<strong>de</strong>rn. Sie selber macht sich<br />
durch die Vergewaltigung ja keines Verbrechens schuldig, wenn<br />
sie ihr nicht zustimmt, <strong>de</strong>nn „nur das innere Einverständnis<br />
befleckt <strong>de</strong>n Leib", sagt die heilige Luzia (vgl. Jacobus <strong>de</strong> Vora-<br />
gine: Legenda aurea 4,1). Unzucht <strong>und</strong> Ehebruch sind aber<br />
sicher weniger schlimm als Mord, vor allem seiner selbst, er ist<br />
eine sehr schwere Sün<strong>de</strong>, weil man <strong>de</strong>m scha<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>m man doch<br />
die größte Liebe schul<strong>de</strong>t. Zu<strong>de</strong>m ist sie höchst gefährlich, weil<br />
keine Zeit mehr bleibt, um sie durch Buße zu sühnen.<br />
Ebensowenig ist Selbstmord erlaubt aus Furcht, man könnte<br />
in eine Sün<strong>de</strong> einwilligen. Denn „man darf nichts Schlechtes<br />
tun, damit etwas Gutes daraus entspringt" (Rom 3,8), o<strong>de</strong>r um<br />
Übel zu verhüten, beson<strong>de</strong>rs kleinere <strong>und</strong> weniger wahrschein<br />
liche. Es ist nämlich keineswegs sicher, daß man <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> spä<br />
ter zustimmen wird, ist Gott doch mächtig genug, <strong>de</strong>n Men<br />
schen, wenn die Versuchung über ihn kommt, vor <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> zu<br />
bewahren.<br />
Zu 4. Im I.Buch seines Gottesstaates (c.21; ML41,35)<br />
schreibt Augustinus: „Auch Samson, <strong>de</strong>r sich selbst mitsamt <strong>de</strong>n<br />
Fein<strong>de</strong>n unter <strong>de</strong>n Trümmern seines Hauses begrub, fin<strong>de</strong>t nur<br />
darin eine Entschuldigung, daß ihm <strong>de</strong>r Geist, <strong>de</strong>r durch ihn<br />
W<strong>und</strong>er tat, dies heimlich befahl." Die gleiche Begründung<br />
führt er zugunsten gewisser heiliger Frauen, die sich in <strong>de</strong>r Ver<br />
folgungszeit selbst das Leben nahmen <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren An<strong>de</strong>nken in<br />
<strong>de</strong>r Kirche gefeiert wird.<br />
96
Zu 5. Die Tapferkeit verlangt, sich um <strong>de</strong>r Tugend willen 64. 6<br />
<strong>und</strong> um die Sün<strong>de</strong> zu vermei<strong>de</strong>n, von einem an<strong>de</strong>ren töten zu<br />
lassen. Doch selber Hand an sich zu legen, um Grausamkeiten<br />
zu entrinnen, sieht zwar nach Tapferkeit aus, <strong>und</strong> manche<br />
haben Selbstmord begangen in <strong>de</strong>r Meinung, damit eine Hel<br />
<strong>de</strong>ntat zu begehen - in diese Reihe gehört auch Razias -, doch in<br />
Wirklichkeit han<strong>de</strong>lt es sich dabei nicht um echte Tapferkeit,<br />
son<strong>de</strong>rn eher um seelische Schwäche, die nicht imstan<strong>de</strong> ist,<br />
Grausamkeiten zu ertragen (vgl. Aristoteles: Eth. III, 11;<br />
1116a 12. Augustinus: Gottesstaat 1,22 u.23; ML41,35ff.).<br />
6. ARTIKEL<br />
Darf man in bestimmten Fällen einen Unschuldigen töten?<br />
1. Sün<strong>de</strong> ist gewiß kein Zeichen von Gottesfurcht, <strong>de</strong>nn<br />
„Gottesfurcht vertreibt vielmehr die Sün<strong>de</strong>", wie es bei Jesus<br />
Sirach 1,27 heißt. Doch Abraham wur<strong>de</strong> als gottesfurchtig<br />
gepriesen, weil er seinen unschuldigen Sohn töten wollte. Also<br />
kann jemand einen Unschuldigen töten, ohne zu sündigen.<br />
2. Eine Sün<strong>de</strong> gegen <strong>de</strong>n Nächsten wiegt umso schwerer, je<br />
größer <strong>de</strong>r Scha<strong>de</strong>n ist, <strong>de</strong>n man einem an<strong>de</strong>ren zufügt. Doch<br />
schlimmeren Scha<strong>de</strong>n fügt man durch Tötung einem Sün<strong>de</strong>r als<br />
einem Unschuldigen zu, <strong>de</strong>nn dieser geht aus <strong>de</strong>m Jammertal<br />
dieses Lebens nach <strong>de</strong>m Tod in die himmlische Glorie ein. Da<br />
man nun gegebenenfalls einen Sün<strong>de</strong>r töten darf, ist es noch viel<br />
mehr erlaubt, einen Unschuldigen o<strong>de</strong>r Gerechten zu töten.<br />
3. Was nach <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung geschieht, ist keine Sün<strong>de</strong>.<br />
Doch bisweilen wird jemand gezwungen, entsprechend <strong>de</strong>r<br />
<strong>Recht</strong>sordnung einen Unschuldigen zu töten, z.B. wenn ein<br />
Richter, <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>n vorgebrachten Aussagen richten muß,<br />
einen, von <strong>de</strong>ssen Unschuld er überzeugt ist, unter <strong>de</strong>r Beweis<br />
last falscher Zeugen zum Tod verurteilt. Also kann jemand ohne<br />
Sün<strong>de</strong> einen Unschuldigen töten.<br />
DAGEGEN heißt es im Buch Ex 23,7: „Wer unschuldig <strong>und</strong><br />
im <strong>Recht</strong> ist, <strong>de</strong>n bring' nicht um sein Leben."<br />
ANTWORT. Der Mensch kann unter einem zweifachen Ge<br />
sichtspunkt betrachtet wer<strong>de</strong>n: einmal an sich, <strong>und</strong> sodann in<br />
Beziehung zu etwas an<strong>de</strong>rem. Betrachtet man ihn an sich, so<br />
darf man keinen Menschen töten, <strong>de</strong>nn in je<strong>de</strong>m, auch im Sün<br />
<strong>de</strong>r, müssen wir die von Gott geschaffene Natur lieben, die<br />
97
64. 6 durch Tötung zerstört wird. Doch, wie oben (Art. 2) dargelegt,<br />
wird die Tötung <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs im Hinblick auf das Gemeinwohl,<br />
das die Sün<strong>de</strong> zugr<strong>und</strong>erichtet, erlaubt. Das Leben <strong>de</strong>r Gerech<br />
ten hingegen erhält das Gemeinwohl <strong>und</strong> bringt es zur Blüte,<br />
<strong>de</strong>nn sie bil<strong>de</strong>n die Elite <strong>de</strong>r Gesellschaft. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist<br />
es niemals erlaubt, einen Unschuldigen zu töten.<br />
Zu 1. Gott hält Leben <strong>und</strong> Tod in seiner Hand, <strong>de</strong>nn nach<br />
seinem Willen sterben Sün<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Gerechte. Wer darum auf<br />
Befehl Gottes einen Unschuldigen tötet, sündigt so wenig wie<br />
Gott selbst, <strong>de</strong>ssen Vollstrecker er ist, <strong>und</strong> in<strong>de</strong>m er seinen<br />
Geboten gehorcht, erweist er sich als gottesfürchtig.<br />
Zu 2. Bei <strong>de</strong>r Beurteilung <strong>de</strong>r Schwere einer Sün<strong>de</strong> muß<br />
man mehr die Sache an sich als das zufällig Hinzukommen<strong>de</strong><br />
ins Auge fassen. Daher sündigt schwerer, wer einen Unschuldi<br />
gen als wer einen Sün<strong>de</strong>r tötet, <strong>und</strong> zwar 1. weil er <strong>de</strong>m Scha<strong>de</strong>n<br />
zufügt, <strong>de</strong>n er mehr lieben muß, <strong>und</strong> so verstößt er auch mehr<br />
gegen das Gebot <strong>de</strong>r Liebe. 2. weil er <strong>de</strong>m Unrecht antut, <strong>de</strong>r es<br />
am wenigsten verdient. Er versündigt sich also in erhöhtem<br />
Maße gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>. 3. weil er dadurch die Gemein<br />
schaft eines wertvolleren Gutes beraubt. 4. weil er Gott<br />
dadurch mehr verachtet gemäß <strong>de</strong>m Lukaswort 10,16: „Wer<br />
euch verachtet, verachtet mich." - Daß Gott <strong>de</strong>n getöteten<br />
Gerechten in die ewige Herrlichkeit geleitet, hat mit <strong>de</strong>r Tötung<br />
nur zufällig etwas zu tun.<br />
Zu 3. Wenn <strong>de</strong>r Richter von <strong>de</strong>r Unschuld eines Angeklag<br />
ten, <strong>de</strong>r durch falsche Zeugen überführt wur<strong>de</strong>, überzeugt ist,<br />
muß er die Zeugen, um <strong>de</strong>n Unschuldigen zu retten, nach<br />
drücklicher verhören, so wie es Daniel gemacht hat (Dnl3,<br />
51 ff.). Gelingt ihm dies nicht, hat er <strong>de</strong>n Angeklagten an die<br />
höhere Instanz zu überweisen. Läßt sich auch dies nicht<br />
machen, sündigt er nicht, wenn er sein Urteil nach <strong>de</strong>n vorlie<br />
gen<strong>de</strong>n Beweisen fällt, <strong>de</strong>nn nicht er ist es dann, <strong>de</strong>r einen<br />
Unschuldigen ums Leben bringt, son<strong>de</strong>rn jene sind es, die seine<br />
Schuld behaupten. - Enthält <strong>de</strong>r Richterspruch einen unerträg<br />
lichen Irrtum, dann muß <strong>de</strong>r Vollstreckungsbeamte <strong>de</strong>s Rich<br />
ters, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Unschuldigen verurteilt hat, <strong>de</strong>n Gehorsam ver<br />
weigern, <strong>de</strong>nn sonst gingen die Henker schuldlos aus, die Glau<br />
benszeugen zu To<strong>de</strong> gebracht haben. Liegt jedoch keine offen<br />
bare Ungerechtigkeit vor, dann sündigt er durch die Ausfüh<br />
rung <strong>de</strong>r richterlichen Anordnung nicht, <strong>de</strong>nn er hat <strong>de</strong>n Spruch<br />
98
seines Vorgesetzten nicht <strong>de</strong>r Prüfung zu unterziehen, <strong>und</strong> 64. 7<br />
schließlich tötet nicht er, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Richter, in <strong>de</strong>ssen<br />
Diensten er steht.<br />
7. ARTIKEL<br />
Darf man in Notwehr jeman<strong>de</strong>n töten?<br />
1. Augustinus schreibt an Publicola (Brief 47; ML 33,186):<br />
„Der Rat, Menschen zu töten, damit man von diesen nicht<br />
selbst ums Leben gebracht wird, gefällt mir keineswegs, es<br />
handle sich <strong>de</strong>nn um einen Soldaten o<strong>de</strong>r einen Beamten, <strong>de</strong>r<br />
dies nicht im eigenen Interesse, son<strong>de</strong>rn für an<strong>de</strong>re tut, <strong>und</strong><br />
zwar mit legitimer, ihm angemessener Vollmacht." Doch wer in<br />
Notwehr jeman<strong>de</strong>n tötet, tut dies, damit nur er selbst nicht ums<br />
Leben kommt. Also ist dies unerlaubt.<br />
2. Im I. Buch Über die Willensfreiheit (c.5; ML 32,1228)<br />
schreibt Augustinus: „Wie sollen die vor <strong>de</strong>r göttlichen Vor<br />
sehung von Sün<strong>de</strong> frei sein, die sich wegen Dingen, die man ver<br />
achten soll, mit Mord beflecken?"Jene Dinge aber seien zu ver<br />
achten, sagt er entsprechend <strong>de</strong>m Zusammenhang, welche die<br />
Menschen gegen ihren Willen verlieren können. Dazu aber<br />
gehört das leibliche Leben. Also darf niemand, um sein leib<br />
liches Leben zu retten, einen Menschen töten.<br />
3. Papst Nikolaus I. sagt (ML 119,1131) - das Zitat fin<strong>de</strong>t<br />
sich in <strong>de</strong>n Dekreten (dist. 50; Frdbl, 179) - : „Du hast mich um<br />
Rat gefragt, ob jene Geistlichen, die in Notwehr einen Hei<strong>de</strong>n<br />
getötet haben, nach verrichteter Buße ihren früheren Rang wie<br />
<strong>de</strong>r einnehmen o<strong>de</strong>r in einen höheren aufsteigen könnten.<br />
Wisse nun, daß Wir es für keinen Fall rechtfertigen <strong>und</strong> ihnen in<br />
keiner Weise gestatten können, irgen<strong>de</strong>inen Menschen auf<br />
irgen<strong>de</strong>ine Weise zu töten." Doch allgemein sind Geistliche wie<br />
Laien auf die Einhaltung <strong>de</strong>r sittlichen Gebote verpflichtet. Also<br />
ist es auch Laien nicht erlaubt, jeman<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Selbstverteidi<br />
gung zu töten.<br />
4. Mord ist schlimmer als einfache Unzucht o<strong>de</strong>r Ehebruch.<br />
Doch niemand darf Unzucht treiben o<strong>de</strong>r Ehebruch o<strong>de</strong>r eine<br />
an<strong>de</strong>re schwere Sün<strong>de</strong> begehen, um sein Leben zu retten, <strong>de</strong>nn<br />
das Leben <strong>de</strong>r Seele ist <strong>de</strong>m <strong>de</strong>s Leibes vorzuziehen. Also darf<br />
niemand in Notwehr einen an<strong>de</strong>ren töten, um selber mit <strong>de</strong>m<br />
Leben davonzukommen.<br />
99
64. 7 5. Ist <strong>de</strong>r Baum schlecht, dann auch die Frucht, wie es bei Mt<br />
7,17 heißt. Doch die Selbstverteidigung als solche ist schlecht<br />
gemäß Rom 12,19: „Ihr sollt euch nicht selbst verteidigen, liebe<br />
Brü<strong>de</strong>r." Also ist das Töten eines Menschen, das sich dabei<br />
ergibt, unerlaubt.<br />
DAGEGEN heißt es im Buch Ex 22,2: „Wenn ein Dieb in ein<br />
Haus einbricht o<strong>de</strong>r es untergräbt <strong>und</strong> dabei ertappt wird <strong>und</strong><br />
an einer zugefügten Verletzung stirbt, zieht sich, wer ihn<br />
erschlagen, keine Blutschuld zu." Doch noch viel mehr als sein<br />
Haus darf man sein Leben verteidigen. Also ist jemand, <strong>de</strong>r in<br />
Verteidigung seines Lebens einen an<strong>de</strong>ren tötet, keines Mor<strong>de</strong>s<br />
schuldig.<br />
ANTWORT. Ein einziger Akt kann durchaus zwei Wirkun<br />
gen hervorbringen, von <strong>de</strong>nen nur die eine beabsichtigt, die<br />
an<strong>de</strong>re jedoch nicht gewollt ist. Die Art einer sittlichen Hand<br />
lung wird jedoch von <strong>de</strong>m geprägt, was beabsichtigt ist, <strong>und</strong><br />
nicht von <strong>de</strong>m, was ihr fern liegt, <strong>de</strong>nn dies stellt sich nur als un<br />
gewollte Nebenwirkung ein, wie oben auseinan<strong>de</strong>rgelegt wur<strong>de</strong><br />
(43,3; I-II72,1). Die Selbstverteidigung kann nun zwei Wir<br />
kungen zur Folge haben: die eine ist die Erhaltung <strong>de</strong>s eigenen<br />
Lebens, die an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Tod <strong>de</strong>s Angreifers. Ein solcher Akt hat,<br />
weil die Erhaltung <strong>de</strong>s eigenen Lebens dabei beabsichtigt wird,<br />
nichts Unerlaubtes an sich, <strong>de</strong>nn je<strong>de</strong>r möchte sich natürlich<br />
nach Kräften in seiner Existenz erhalten. Eine gut gemeinte<br />
Handlung kann jedoch fragwürdig wer<strong>de</strong>n, wenn sie ihrem<br />
Zweck nicht angepaßt ist. Daher ist es unerlaubt, bei <strong>de</strong>r Vertei<br />
digung <strong>de</strong>s eigenen Lebens mehr Gewalt einzusetzen als nötig.<br />
Wird <strong>de</strong>r Angriff jedoch maßvoll abgewehrt, dann ist die Vertei<br />
digung moralisch in Ordnung, <strong>de</strong>nn nach <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>ssammlung<br />
(Frdbll, 801) „ist es erlaubt, ,mit moralisch abgewogener<br />
Sch<strong>utz</strong>maßnahme' Gewalt zurückzuweisen". Dabei ist es nicht<br />
heilsnotwendig, die moralisch abgewogene Sch<strong>utz</strong>maßnahme<br />
zu unterlassen, um <strong>de</strong>n Tod <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren zu vermei<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn<br />
<strong>de</strong>r Mensch muß mehr für das eigene als für ein frem<strong>de</strong>s Leben<br />
Sorge tragen.<br />
Weil das Töten eines Menschen nur <strong>de</strong>r öffentlichen Gewalt<br />
um <strong>de</strong>s Gemeinwohls willen zusteht (vgl. Art. 3), darf nur <strong>de</strong>r<br />
Inhaber <strong>de</strong>r öffentlichen Autorität <strong>de</strong>n Tod eines Menschen bei<br />
<strong>de</strong>r Selbstverteidigung beabsichtigen, <strong>de</strong>nn jener richtet sein<br />
Tun auf das öffentliche Wohl aus. Dies trifft auf <strong>de</strong>n Soldaten,<br />
<strong>de</strong>r gegen <strong>de</strong>n Feind kämpft, <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Justizbeamten bei seinem<br />
100
Einsatz gegen Räuber zu. Ist bei ihnen jedoch persönliche Will- 64. 8<br />
kür im Spiel, dann versündigen sich auch diese [29].<br />
Zu 1. Augustins Worte gelten für <strong>de</strong>n Fall <strong>de</strong>r absichtlichen<br />
Tötung zur Befreiung aus eigener To<strong>de</strong>sgefahr.<br />
Auf <strong>de</strong>n gleichen Fall <strong>de</strong>utet die zitierte Bemerkung aus<br />
Augustins Buch Über die Willensfreiheit. Daher wird dort das<br />
„für diese Fälle" unterstrichen, um damit die Absicht zu<br />
bezeichnen.<br />
Daraus ergibt sie die Antwort Zu 2.<br />
Zu 3. Auch wenn Tötung ohne Sün<strong>de</strong> ist, folgt daraus Irre<br />
gularität (Weiheunwürdigkeit), wie dies beim Richter <strong>de</strong>r Fall<br />
ist, <strong>de</strong>r jeman<strong>de</strong>n gerechterweise zum To<strong>de</strong> verurteilt. So ist<br />
auch <strong>de</strong>r Kleriker, <strong>de</strong>r in Notwehr jeman<strong>de</strong>n getötet hat, irregu<br />
lär, obwohl er nicht töten, son<strong>de</strong>rn nur sich verteidigen wollte<br />
[30].<br />
Zu 4. Unzucht <strong>und</strong> Ehebruch haben nicht notwendig etwas<br />
mit Rettung <strong>de</strong>s eigenen Lebens zu tun, wie im Fall einer Hand<br />
lung mit möglicher To<strong>de</strong>sfolge [31].<br />
Zu 5. Mit <strong>de</strong>r angeführten Bibelstelle wird nur jene Selbst<br />
verteidigung verboten, die <strong>de</strong>n Makel <strong>de</strong>r Rache an sich trägt.<br />
Daher sagt die Glosse (ML 191,1502): „Ihr sollt euch nicht<br />
verteidigen", d. h. „ihr sollt eueren Gegnern nicht heimzahlen."<br />
8. ARTIKEL<br />
Verstrickt sich, wer zufällig einen Menschen tötet, in Schuld?<br />
1. Gn 4,23 (Midrosch) lesen wir, Lantech habe, in <strong>de</strong>r Mei<br />
nung, ein Tier zu erlegen, einen Menschen getötet, <strong>und</strong> dies<br />
wur<strong>de</strong> ihm als Schuld angerechnet. Also macht sich schuldig,<br />
wer zufällig einen Menschen tötet.<br />
2. Ex 21,22 f. steht geschrieben: „Wer eine schwangere Frau<br />
schlägt, <strong>und</strong> sie wegen einer dadurch erfolgten Fehlgeburt<br />
stirbt, soll Leben für Leben geben." Dies kann aber geschehen,<br />
ohne die Absicht zu töten. Also ist, wer durch Zufall jeman<strong>de</strong>n<br />
tötet, als schuldig zu erklären.<br />
3. In <strong>de</strong>n Dekreten (dist. 50; Frdbl, 178 ff.), wer<strong>de</strong>n mehrere<br />
Canones angeführt, in <strong>de</strong>nen unbeabsichtigte Tötung unter<br />
Strafe gestellt wird. Doch Strafe gibt es nicht ohne Schuld. Also<br />
macht sich schuldig, wer zufällig einen Menschen tötet.<br />
101
64. 8 DAGEGEN schreibt Augustinus an Publicola (Brief 47;<br />
ML 33,167): „Nie soll uns als Schuld angerechnet wer<strong>de</strong>n,<br />
wenn bei <strong>de</strong>m, was wir in guter Absicht <strong>und</strong> erlaubterweise tun,<br />
gegen unseren Willen etwas Schlechtes entsteht." Nun kommt<br />
es tatsächlich vor, daß <strong>de</strong>nen, die etwas Gutes tun, durch Zufall<br />
die Tötung eines Menschen unterläuft. Also wird ihnen dies<br />
nicht als Schuld angerechnet.<br />
ANTWORT. Nach Aristoteles (Phys Al, 6; 197b 18) geht <strong>de</strong>r<br />
Zufall von einer Ursache aus, die in keinem Zusammenhang<br />
mit <strong>de</strong>r Absicht <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n steht. Daher ist das zufällig<br />
Geschehen<strong>de</strong> an sich eben we<strong>de</strong>r beabsichtigt noch gewollt.<br />
Und weil nach Augustinus (Uber die wahre Religion, c. 14;<br />
ML 34,133) je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m freien Willen hervorgeht, ist<br />
das zufällig Geschehen<strong>de</strong> als solches auch keine Sün<strong>de</strong>. Das tat<br />
sächlich <strong>und</strong> an sich nicht Gewollte o<strong>de</strong>r Beabsichtigte kann<br />
jedoch unter Umstän<strong>de</strong>n als Nebenfolge gewollt <strong>und</strong> beabsich<br />
tigt sein, insofern die Nebenursache nach einem Aristoteleswon<br />
(Phys. VIII, 4; 255 b 24) „hin<strong>de</strong>rnisbeseitigend" wirkt. Daher<br />
führt, wer das, woraus <strong>de</strong>r Tod folgt, nicht vermei<strong>de</strong>t, obwohl er<br />
es müßte, in gewissem Sinne willentlich <strong>de</strong>n Tod eines Men<br />
schen herbei.<br />
Der Fall stellt sich in doppelter Weise. Einmal, wenn sich<br />
jemand mit unerlaubten Dingen, die er lassen müßte, abgibt<br />
<strong>und</strong> dabei <strong>de</strong>n Tod verursacht. Ein an<strong>de</strong>res Mal, wenn er es an<br />
<strong>de</strong>r nötigen Sorgfalt fehlen läßt. Wer sich daher - so die <strong>Recht</strong>s<br />
sammlung (Frdbl, 197 u. II, 803) - mit erlaubten Dingen abgibt<br />
<strong>und</strong> dabei trotz aufgewandter Sorgfalt <strong>de</strong>r Tod eintritt, entgeht<br />
<strong>de</strong>m Vorwurf schuldhafter Tötung. Beschäftigt er sich jedoch<br />
mit etwas Unerlaubtem o<strong>de</strong>r auch mit etwas Erlaubtem, jedoch<br />
ohne die nötige Sorgfalt, dann ist er von Schuld nicht frei, falls<br />
sein Tun <strong>de</strong>n Tod eines Menschen zur Folge hat.<br />
Zu 1. Lantech hat nicht genügend Sorgfalt aufgewandt, um<br />
<strong>de</strong>n Tod eines Menschen zu verhüten, <strong>und</strong> darum ist er für die<br />
Tötung verantwortlich.<br />
Zu 2. Wer eine schwangere Frau schlägt, tut damit etwas<br />
Unerlaubtes. Wenn daraus <strong>de</strong>r Tod <strong>de</strong>r Frau o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r belebten<br />
Leibesfrucht folgt, ist er dafür verantwortlich, vor allem, wenn<br />
<strong>de</strong>r Tod sehr rasch nach seiner Mißhandlung eintritt.<br />
Zu 3. Nach <strong>de</strong>n Canones wer<strong>de</strong>n die mit Strafe belegt, die<br />
bei unerlaubtem Tun o<strong>de</strong>r fehlen<strong>de</strong>r Sorgfalt <strong>de</strong>n Tod eines<br />
Menschen zufällig verursachen [32].<br />
102
65. FRAGE<br />
ANDERE ARTEN VON UNRECHT<br />
GEGEN PERSONEN<br />
Nun muß noch von an<strong>de</strong>ren Unrechtssün<strong>de</strong>n gegen Perso<br />
nen die Re<strong>de</strong> sein. Dabei stellen sich 4 Fragen:<br />
1. Die Verstümmelung.<br />
2. Die körperliche Züchtigung.<br />
3. Die Einkerkerung.<br />
4. Wird eine <strong>de</strong>rartige Sün<strong>de</strong> gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
dadurch schwerer, daß sie sich gegen eine mit an<strong>de</strong>ren<br />
verb<strong>und</strong>ene Person richtet?<br />
1. ARTIKEL<br />
Kann es gegebenenfalls erlaubt sein, jeman<strong>de</strong>n zu<br />
verstümmeln?<br />
1. Der Damaszener schreibt im II. Buch (De fi<strong>de</strong> orth. 4,20;<br />
MG94,1196), die Sün<strong>de</strong> bestehe „in <strong>de</strong>r Abwendung vom<br />
Naturgemäßen <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Hinwendung zum Naturwidrigen".<br />
Nun ist <strong>de</strong>r von Gott eingerichteten Natur gemäß, daß <strong>de</strong>r Kör<br />
per alle seine Glie<strong>de</strong>r besitzt, gegen die Natur ist es, wenn er ein<br />
Glied verliert. Also ist es immer Sün<strong>de</strong>, jeman<strong>de</strong>n eines Glie<strong>de</strong>s<br />
zu berauben.<br />
2. Wie sich die ganze Seele zum ganzen Leib verhält, so ver<br />
halten sich nach <strong>de</strong>m II. Buch <strong>de</strong>s Aristoteles Uber die Seele (c. 1;<br />
412 b 23) die Teile <strong>de</strong>r Seele zu <strong>de</strong>n Teilen <strong>de</strong>s Leibes. Doch nie<br />
mand darf einen seiner Seele berauben, in<strong>de</strong>m er ihn tötet, es sei<br />
<strong>de</strong>nn die öffentliche Gewalt. Also ist auch Verstümmelung nicht<br />
erlaubt außer mit Zustimmung <strong>de</strong>r öffentlichen Gewalt.<br />
3. Das Heil <strong>de</strong>r Seele ist <strong>de</strong>m Heil <strong>de</strong>s Leibes vorzuziehen.<br />
Doch wegen <strong>de</strong>s Seelenheils darf sich niemand verstümmeln.<br />
Nach <strong>de</strong>n Bestimmungen <strong>de</strong>s Konzils von Nizäa (Mansi<br />
II, 667) wer<strong>de</strong>n die bestraft, die sich verstümmelt haben, um die<br />
Keuschheit zu bewahren. Also ist es auch aus an<strong>de</strong>rem Gr<strong>und</strong><br />
nicht erlaubt, jeman<strong>de</strong>n zu verstümmeln.<br />
DAGEGEN heißt es im Buch Ex 21,24: „Aug um Auge, Zahn<br />
um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß."<br />
103
65. 1 ANTWORT. Ein Glied als Glied ist Teil im Gesamt <strong>de</strong>s<br />
menschlichen Körpers. Darum steht es auch im Dienst <strong>de</strong>s<br />
Ganzen, so wie eben das Unvollkommene im Dienst <strong>de</strong>s Voll<br />
kommenen steht. Daher muß man mit einem Glied <strong>de</strong>s Körpers<br />
so umgehen, wie es für das Ganze gut ist. An sich nun dient ein<br />
Glied <strong>de</strong>m Wohl <strong>de</strong>s ganzen Körpers, doch unter Umstän<strong>de</strong>n<br />
kann es auch einmal Scha<strong>de</strong>n stiften, z. B. wenn es wegen Fäul<br />
nis <strong>de</strong>n übrigen Körper zu ver<strong>de</strong>rben droht. Ist also ein Glied<br />
ges<strong>und</strong> <strong>und</strong> funktionstüchtig, kann es ohne Beeinträchtigung<br />
<strong>de</strong>s ganzen Körpers nicht entfernt wer<strong>de</strong>n. Weil aber <strong>de</strong>r ganze<br />
Mensch auf die ganze Gemeinschaft, <strong>de</strong>ren Teil er ist, zielhaft<br />
ausgerichtet ist (vgl. 61,1), mag es vorkommen, daß die Beseiti<br />
gung eines Glie<strong>de</strong>s, obwohl sie zum Nachteil <strong>de</strong>s ganzen Kör<br />
pers ausschlägt, <strong>de</strong>nnoch <strong>de</strong>m Wohl <strong>de</strong>r Gemeinschaft dient,<br />
insofern sie einem als Strafe zur Verhin<strong>de</strong>rung von Sün<strong>de</strong>n auf<br />
erlegt wird. Wie daher einer durch die öffentliche Gewalt wegen<br />
größerer Schuld erlaubterweise sein Leben verliert, so wird er<br />
auch wegen geringerer Schuld eines Glie<strong>de</strong>s beraubt. Eine Pri<br />
vatperson darf dies jedoch nicht tun, auch nicht mit Einver<br />
ständnis <strong>de</strong>ssen, <strong>de</strong>m das Glied gehört, <strong>de</strong>nn dadurch geschieht<br />
<strong>de</strong>r Gemeinschaft, in die <strong>de</strong>r Mensch mit allen seinen Teilen ein<br />
geb<strong>und</strong>en ist, Unrecht.<br />
Droht jedoch ein fauliges Glied <strong>de</strong>n ganzen Körper anzustek-<br />
ken, dann darf das infizierte Glied mit Einverständnis <strong>de</strong>ssen,<br />
<strong>de</strong>m es gehört, um <strong>de</strong>r Ges<strong>und</strong>heit <strong>de</strong>s ganzen Körpers willen<br />
entfernt wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn einem je<strong>de</strong>n ist die Sorge für die eigene<br />
Ges<strong>und</strong>heit anvertraut. Die gleiche Überlegung gilt für <strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>m die Ges<strong>und</strong>heitsüberwachung für einen Menschen, <strong>de</strong>r ein<br />
schadhaftes Glied hat, obliegt. Sonst jedoch ist es ganz <strong>und</strong> gar<br />
unerlaubt, jeman<strong>de</strong>n zu verstümmeln.<br />
Zu 1. Was im einzelnen Fall gegen die Natur ist, kann im ge<br />
samten gesehen durchaus <strong>de</strong>r Natur entsprechen. So sind Tod<br />
<strong>und</strong> Auflösung in <strong>de</strong>r Welt <strong>de</strong>r natürlichen Dinge zwar gegen die<br />
Natur <strong>de</strong>s Einzeldinges, das davon betroffen wird, sie fügen<br />
sich jedoch in das Geschehen <strong>de</strong>r Gesamtnatur harmonisch ein.<br />
Ähnlich verhält es sich mit <strong>de</strong>r Verstümmelung: sie ist zwar im<br />
einzelnen gegen die körperliche Natur <strong>de</strong>s Verstümmelten, <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>nnoch entspricht sie im Hinblick auf das Gesamtwohl <strong>de</strong>r<br />
vernünftigen Ordnung <strong>de</strong>r Natur.<br />
Zu 2. Das Leben <strong>de</strong>s Menschen als Ganzes ist nicht auf<br />
etwas <strong>de</strong>m Menschen zu eigen Gehöriges hingeordnet, son<strong>de</strong>rn<br />
104
vielmehr dient alles, was zum Menschen gehört, seinem Leben. 65. 2<br />
Daher steht es einzig <strong>und</strong> allein <strong>de</strong>r öffentlichen Gewalt zu,<br />
jeman<strong>de</strong>m das Leben zu nehmen, <strong>de</strong>nn ihr ist die Sorge für das<br />
Gemeinwohl aufgetragen. Doch die Entfernung eines Glie<strong>de</strong>s<br />
kann <strong>de</strong>m persönlichen Wohl eines einzelnen Menschen dienen,<br />
<strong>und</strong> darum auch ihm persönlich zustehen.<br />
Zu 3. Man darf ein Glied wegen <strong>de</strong>r körperlichen Ges<strong>und</strong><br />
heit <strong>de</strong>s Ganzen nur dann entfernen, wenn sonst nicht zu helfen<br />
ist. Für die geistige Ges<strong>und</strong>heit jedoch läßt sich immer an<strong>de</strong>rs<br />
als durch Entfernung eines Glie<strong>de</strong>s sorgen, <strong>de</strong>nn die Sün<strong>de</strong><br />
hängt vom Willen ab. Daher ist die Entfernung eines Glie<strong>de</strong>s<br />
zur Vermeidung irgendwelcher Sün<strong>de</strong>n in keinem Fall erlaubt.<br />
Cbrysostomus schreibt <strong>de</strong>shalb in seiner Auslegung <strong>de</strong>s Mat<br />
thäuswortes (19,12) „Es gibt Eunuchen, die sich wegen <strong>de</strong>s<br />
Himmelreiches selber kastriert haben" in <strong>de</strong>r Homilie 62<br />
(MG 58,599): „Dabei han<strong>de</strong>lt es sich nicht um das Abschnei<br />
<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Glie<strong>de</strong>r, son<strong>de</strong>rn um das Ausmerzen <strong>de</strong>r schlechten<br />
Gedanken. Denn <strong>de</strong>m Fluch verfällt, wer sich ein Glied<br />
abschnei<strong>de</strong>t. Ein solcher nämlich nimmt sich heraus, was die<br />
Mör<strong>de</strong>r tun." Und dann fügt er noch bei (MG 58,600): „Auch<br />
wird die Begier<strong>de</strong> damit nicht etwa gebändigt, son<strong>de</strong>rn nur<br />
noch heftiger. Denn <strong>de</strong>r Same hat seine Quelle ganz woan<strong>de</strong>rs<br />
in uns, er kommt vor allem aus einem ungezügelten Gemüt <strong>und</strong><br />
einem ungeregelten Gedankenleben. Das Abschnei<strong>de</strong>n eines<br />
Glie<strong>de</strong>s dämpft die Versuchungen viel weniger als die Beherr<br />
schung <strong>de</strong>r Gedanken."<br />
2. ARTIKEL<br />
Dürfen die Väter ihre Kin<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r die Herren ihre Diener<br />
schlagen?<br />
1. Der Apostel schreibt im Epheserbrief 6,4: „Ihr Väter, reizt<br />
eure Kin<strong>de</strong>r nicht zum Zorn." Und später (V. 9) fügt er hinzu:<br />
„Und ihr Herren, han<strong>de</strong>lt in gleicher Weise gegen eure Sklaven,<br />
ohne zu drohen." Nun wird mancheiner wegen körperlicher<br />
Züchtigungen zum Zorn gereizt. Auch sind sie schwerwiegen<br />
<strong>de</strong>r als Drohungen. Also dürfen we<strong>de</strong>r Väter ihre Kin<strong>de</strong>r, noch<br />
Herren ihre Diener schlagen.<br />
I.Aristoteles schreibt im X.Buch seiner Ethik (c. 10;<br />
1180 a 18): „Das Wort <strong>de</strong>s Vaters be<strong>de</strong>utet nur Mahnung, nicht<br />
105
65. 2 aber Zwang." Doch bisweilen wird Zwang mit Schlägen ausge<br />
übt. Also ist es <strong>de</strong>n Eltern nicht erlaubt, ihre Kin<strong>de</strong>r zu schlagen.<br />
3. Je<strong>de</strong>r darf einen an<strong>de</strong>ren in Zucht nehmen, dies gehört<br />
nämlich zum Austeilen geistlicher Almosen, wie oben (32,2)<br />
erwähnt wur<strong>de</strong>. Wenn also die Eltern <strong>de</strong>r Zucht wegen ihre Kin<br />
<strong>de</strong>r schlagen dürfen, dann ist es aus gleichem Gr<strong>und</strong> je<strong>de</strong>rmann<br />
erlaubt, je<strong>de</strong>n zu schlagen. Doch das ist offensichtlich falsch.<br />
Also auch das erste.<br />
DAGEGEN heißt es in <strong>de</strong>n Sprichwörtern 13,24: „Wer die<br />
Rute spart, haßt seinen Sohn", <strong>und</strong> weiter (23,13): „Versäume<br />
an einem Knaben die Zucht nicht! Wenn du ihn nämlich mit <strong>de</strong>r<br />
Rute schlägst, wird er davon nicht sterben. Du wirst ihn mit <strong>de</strong>r<br />
Rute schlagen <strong>und</strong> seine Seele vor <strong>de</strong>r Hölle bewahren." Und<br />
Jesus Sirach schreibt 33,28: „Einem böswilligen Sklaven gebühren<br />
Folter <strong>und</strong> Fußeisen."<br />
ANTWORT. Durch Schläge wird <strong>de</strong>m Körper <strong>de</strong>s Geschla<br />
genen ein gewisser Scha<strong>de</strong>n zugefügt, an<strong>de</strong>rs jedoch als bei <strong>de</strong>r<br />
Verstümmelung. Denn die Verstümmelung zerstört die Unver<br />
sehrtheit <strong>de</strong>s Körpers, Schläge jedoch fügen nur sinnliche<br />
Schmerzen zu. Daher entsteht ein viel geringerer Scha<strong>de</strong>n als<br />
bei <strong>de</strong>r Verstümmelung. Einen Scha<strong>de</strong>n darf man jeman<strong>de</strong>m<br />
jedoch nur als gerechte Strafe zufügen. Gerechterweise kann<br />
man aber nur einen Untergebenen strafen. Daher darf nur stra<br />
fen, wer Machtbefugnis über <strong>de</strong>n zu Bestrafen<strong>de</strong>n besitzt. Und<br />
weil <strong>de</strong>r Sohn <strong>de</strong>r väterlichen Gewalt untersteht <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Diener<br />
<strong>de</strong>r Gewalt seines Herrn, darf <strong>de</strong>r Vater seinen Sohn <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Herr seinen Diener aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Besserung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Zucht<br />
erlaubterweise schlagen.<br />
Zu 1. Weil <strong>de</strong>r Zorn Rachgier in sich schließt, wird er beson<br />
<strong>de</strong>rs entfacht, wenn sich jemand ungerecht verletzt fühlt, wie<br />
Aristoteles im II. Buch seiner Rhetorik (c.2; 1378a31) bemerkt.<br />
Wenn daher <strong>de</strong>n Vätern untersagt wird, ihre Kin<strong>de</strong>r zum Zorn<br />
zu reizen, be<strong>de</strong>utet dies kein Verbot, sie aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Zucht<br />
zu schlagen, son<strong>de</strong>rn nur, sie nicht maßlos mit Schlägen zu trak<br />
tieren. -Wenn aber Herren nahegelegt wird, Drohungen zu un<br />
terlassen, so kann dies auf zweifache Weise verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
Einmal als Empfehlung, mit Drohungen sparsam umzugehen, -<br />
dies gehört zur pädagogischen Selbstbeherrschung; in an<strong>de</strong>rer<br />
Weise, daß man die Drohung nicht immer wahr macht, - dies<br />
be<strong>de</strong>utet, daß die ausgesprochene Strafandrohung bisweilen<br />
durch barmherzige Unterlassung gemil<strong>de</strong>rt wird.<br />
106
Zu 2. Die größere Gewalt muß auch größeren Zwang aus- 65. 3<br />
üben können. Wie nun aber <strong>de</strong>r Staat die vollkommene<br />
Gemeinschaft darstellt, so hat das Staatsoberhaupt die voll<br />
kommene Zwangsgewalt, <strong>und</strong> <strong>de</strong>shalb kann sie auch unwi<strong>de</strong>r<br />
rufliche Strafen verhängen, nämlich Tod <strong>und</strong> Verstümmelung.<br />
Der Vater jedoch o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Herr, die <strong>de</strong>r unvollkommenen<br />
Gemeinschaft <strong>de</strong>s Hauswesens vorstehen, besitzen nur die un<br />
vollkommene Zwangsgewalt leichter Bestrafung, die keinen<br />
nichtwie<strong>de</strong>rg<strong>utz</strong>umachen<strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n mit sich bringt. Und von<br />
dieser Art ist körperliche Züchtigung.<br />
Zu 3. Je<strong>de</strong>r darf einen an<strong>de</strong>ren in Zucht nehmen, vorausge<br />
setzt, daß dieser zustimmt. Doch einen, <strong>de</strong>r nicht will, in Zucht<br />
zu nehmen, steht nur <strong>de</strong>m zu, <strong>de</strong>ssen Obsorge jener anvertraut<br />
ist. Und dazu gehört es, ihn mit Schlägen zu züchtigen.<br />
3. ARTIKEL<br />
Ist es erlaubt, einen Menschen einzukerkern?<br />
1. Wie oben (I—II 18,2) bemerkt, ist ein Akt, <strong>de</strong>r sich auf ein<br />
unangemessenes Objekt bezieht, seiner Art nach schlecht. Nun<br />
ist <strong>de</strong>r Mensch mit seiner naturgegebenen Willensfreiheit ein<br />
unangemessenes Objekt <strong>de</strong>r Einkerkerung, <strong>de</strong>nn diese läuft <strong>de</strong>r<br />
Freiheit zuwi<strong>de</strong>r. Also ist es unerlaubt, jeman<strong>de</strong>n einzukerkern.<br />
2. Die menschliche <strong>Gerechtigkeit</strong> muß sich nach <strong>de</strong>r gött<br />
lichen ausrichten. Nun heißt es aber bei Jesus Sirach 15,14:<br />
„Gott hat <strong>de</strong>n Menschen seiner eigenen Entscheidung über<br />
lassen." Also darf man nieman<strong>de</strong>n mit Ketten o<strong>de</strong>r Kerker zur<br />
Ordnung zwingen.<br />
3. Nur vom schlechten Tun darf jemand abgehalten wer<strong>de</strong>n;<br />
daran einen zu hin<strong>de</strong>rn, steht je<strong>de</strong>rmann zu. Wäre nun das Ein<br />
kerkern zur Verhin<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Bösen erlaubt, dürfte je<strong>de</strong>r sei<br />
nen Nächsten ins Gefängnis bringen. Dies ist offensichtlich<br />
falsch. Also auch das erste.<br />
DAGEGEN liest man bei Lv24,11 f., jemand sei wegen <strong>de</strong>r<br />
Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Gotteslästerung eingekerkert wor<strong>de</strong>n.<br />
ANTWORT. Bei <strong>de</strong>n Gütern <strong>de</strong>s Körpers müssen drei Dinge<br />
<strong>de</strong>r Ordnung nach beachtet wer<strong>de</strong>n. 1. die Unversehrtheit <strong>de</strong>s<br />
Körpers als solchen: ihm wird durch Tötung o<strong>de</strong>r Verstümme<br />
lung Scha<strong>de</strong>n zugefügt. 2. das Wohlsein o<strong>de</strong>r die Ruhe <strong>de</strong>r<br />
Sinne: <strong>de</strong>m entgegen steht körperliche Züchtigung <strong>und</strong> alles,<br />
107
65. 4 was sinnlichen Schmerz bereitet. 3. die Bewegungsfreiheit <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Gebrauch <strong>de</strong>r Glie<strong>de</strong>r: dies wird unterb<strong>und</strong>en durch Fesse<br />
lung o<strong>de</strong>r Einkerkerung o<strong>de</strong>r durch irgendwelches Festhalten.<br />
Daher ist es unerlaubt, jeman<strong>de</strong>n einzukerkern o<strong>de</strong>r irgendwie<br />
festzuhalten, es sei <strong>de</strong>nn gemäß <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung o<strong>de</strong>r zur<br />
Strafe o<strong>de</strong>r als Vorbeugung eines Übels.<br />
Zu 1. Wer die ihm übertragene Gewalt mißbraucht, ver<br />
dient, daß er sie verliert. Daher ist <strong>de</strong>r Mensch, <strong>de</strong>r durch Sündi<br />
gen das freie Verfügungsrecht über seine Glie<strong>de</strong>r mißbraucht<br />
hat, ein geeignetes Objekt <strong>de</strong>r Einkerkerung.<br />
Zu 2. Bisweilen hin<strong>de</strong>rt Gott nach <strong>de</strong>r Ordnung seiner<br />
Weisheit die Sün<strong>de</strong>r daran, ihre sündhaften Pläne auszuführen<br />
gemäß Job 5,12: „ ... <strong>de</strong>r die Anschläge <strong>de</strong>r Boshaften zunichte<br />
macht, daß ihre Hän<strong>de</strong> nicht ausführen können, was sie begon<br />
nen haben." Bisweilen jedoch läßt er sie tun, was sie wollen.<br />
Und ähnlich wer<strong>de</strong>n die Menschen nach <strong>de</strong>r menschlichen<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> nicht für je<strong>de</strong>s schuldhafte Vergehen eingesperrt,<br />
son<strong>de</strong>rn nur für bestimmte.<br />
Zu 3. Je<strong>de</strong>r darf einen, <strong>de</strong>r im nächsten Augenblick etwas<br />
Unerlaubtes tun möchte, sogleich von seinem Vorhaben zu<br />
rückhalten, z. B. packen, damit er sich nicht irgendwo hinab<br />
stürzt o<strong>de</strong>r einen an<strong>de</strong>ren schlägt. Doch schlechthin einen ein<br />
zusperren o<strong>de</strong>r zu fesseln, steht nur <strong>de</strong>m zu, <strong>de</strong>r allgemein über<br />
Tun <strong>und</strong> Leben <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren zu bestimmen hat. Denn durch<br />
Einkerkerung wird er nicht nur daran gehin<strong>de</strong>rt, Böses, son<br />
<strong>de</strong>rn auch Gutes zu tun.<br />
4. ARTIKEL<br />
Wird die Sün<strong>de</strong> schwerer, wenn durch die gegen bestimmte<br />
Personen begangenen Unrechtstaten an<strong>de</strong>re mitbetroffen<br />
wer<strong>de</strong>n?<br />
1. Unrechtstaten dieser Art sind insofern Sün<strong>de</strong>, als jeman<br />
<strong>de</strong>m gegen seinen Willen Scha<strong>de</strong>n zugefügt wird. Nun ist das<br />
Böse, das einen selber trifft, mehr gegen <strong>de</strong>n Willen als das<br />
Unrecht gegen eine irgendwie verb<strong>und</strong>ene Person. Also ist das<br />
Unrecht gegen eine verb<strong>und</strong>ene Person geringer.<br />
2. In <strong>de</strong>r Hl. Schrift wird vor allem geta<strong>de</strong>lt, wer Waisen <strong>und</strong><br />
Witwen Unrecht antut. Daher heißt es bei Jesus Sirach 35,17:<br />
„Er mißachtet die Bitten <strong>de</strong>r Waisen nicht, noch auch die Witwe,<br />
108
wenn sie sich in Klagen ergeht." Doch Witwen <strong>und</strong> Waisen sind 65.4<br />
keine mit an<strong>de</strong>ren verb<strong>und</strong>ene Personen. Also wird durch das<br />
Unrecht, das auch noch an<strong>de</strong>re trifft, die Sün<strong>de</strong> nicht schwerer.<br />
3. Die mitbetroffene Person hat einen eigenen Willen wie<br />
auch die Hauptperson. Sie kann also mit etwas einverstan<strong>de</strong>n<br />
sein, was <strong>de</strong>r Hauptperson wi<strong>de</strong>rstrebt, wie dies beim Ehe<br />
bruch zutagetritt, an <strong>de</strong>m die Ehefrau Gefallen fin<strong>de</strong>t, während<br />
er <strong>de</strong>m Mann mißfällt. Nun sind <strong>de</strong>rlei Unrechtstaten insofern<br />
Sün<strong>de</strong>, als sie in unfreiwilliger Wechselseitigkeit bestehen. Also<br />
sind solche Unrechtstaten weniger sündhaft [33].<br />
DAGEGEN heißt es in Dt 28,32 mit einer gewissen Übertrei<br />
bung: „Deine Söhne <strong>und</strong> Töchter wer<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>inen Augen<br />
einem an<strong>de</strong>ren Volk gegeben wer<strong>de</strong>n."<br />
ANTWORT. Je mehr ein Unrecht an<strong>de</strong>re mitbetrifft, umso<br />
schwerer ist - unter sonst gleichen Voraussetzungen - die<br />
Sün<strong>de</strong>. Daher ist es schwerer sündhaft, einen Fürsten als eine<br />
Privatperson zu schlagen, <strong>de</strong>nn dadurch wird die ganze<br />
Gemeinschaft mitbetroffen, wie oben erklärt wur<strong>de</strong> (I—II 73,9).<br />
Wenn ein Unrecht gegen eine irgendwie mit an<strong>de</strong>ren zusam<br />
mengehören<strong>de</strong> Person begangen wird, erstreckt sich das<br />
Unrecht eben auf zwei Personen. Daher verschärft sich - unter<br />
sonst gleichen Voraussetzungen - die Schwere <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>. Bis<br />
weilen jedoch ist eine Sün<strong>de</strong> gegen eine unabhängige Person<br />
unter gewissen Umstän<strong>de</strong>n schwerer, sei es wegen ihrer Wür<strong>de</strong>,<br />
sei es wegen <strong>de</strong>r Größe <strong>de</strong>s zugefügten Scha<strong>de</strong>ns.<br />
Zu 1. Das Unrecht, das eine an<strong>de</strong>re Person mitbetrifft, ver<br />
ursacht bei dieser weniger Scha<strong>de</strong>n, als wenn es ihr unmittelbar<br />
angetan wür<strong>de</strong>, <strong>und</strong> insoweit ist es eine geringere Sün<strong>de</strong>. Doch<br />
dies alles, was mit <strong>de</strong>m Unrecht gegen die mittelbar betroffene<br />
Person zusammenhängt, häuft sich auf die Sün<strong>de</strong>, die jemand<br />
dadurch begeht, daß er einer Person unmittelbaren Scha<strong>de</strong>n<br />
zufügt.<br />
Zu 2. Unrechtstaten gegen Witwen <strong>und</strong> Waisen wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
halb so stark hervorgehoben, weil sie <strong>de</strong>r Barmherzigkeit schär<br />
fer wi<strong>de</strong>rsprechen, wie auch <strong>de</strong>r Scha<strong>de</strong>n für diese Personen<br />
schwerer wiegt, da sie nieman<strong>de</strong>n haben, <strong>de</strong>r ihnen hilft.<br />
Zu 3. Dadurch daß die Gattin <strong>de</strong>m Ehebruch freiwillig<br />
zustimmt, wird die Sün<strong>de</strong> <strong>und</strong> das Unrecht auf seiten <strong>de</strong>r Frau<br />
geringer. Es wäre nämlich schwerer, wenn <strong>de</strong>r Ehebrecher mit<br />
Gewalt gegen sie vorginge. Dennoch wird dadurch das Unrecht<br />
vonseiten <strong>de</strong>s Mannes nicht aufgehoben, <strong>de</strong>nn „die Frau hat",<br />
109
65. 4 wie es im 1. Korintherbrief 7,4 heißt, „kein Verfügungsrecht<br />
über ihren Leib, son<strong>de</strong>rn ihr Mann". Und gleiches gilt für ähn<br />
liche Fälle. Vom Ehebruch, <strong>de</strong>r nicht nur <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, son<br />
<strong>de</strong>rn auch <strong>de</strong>r Keuschheit wi<strong>de</strong>rspricht, wird später, im Traktat<br />
über die Maßhaltung, die Re<strong>de</strong> sein.<br />
110
66. FRAGE<br />
DIEB STAHL UND RAUB<br />
Nunmehr sind die <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> entgegengesetzten Sün<br />
<strong>de</strong>n zu betrachten, durch die <strong>de</strong>m Nächsten Sachscha<strong>de</strong>n zuge<br />
fügt wird, nämlich Diebstahl <strong>und</strong> Raub. Dazu ergeben sich 9<br />
Fragen:<br />
1. Kommt materieller Besitz <strong>de</strong>m Menschen von Natur aus<br />
zu?<br />
2. Ist Privateigentum erlaubt?<br />
3. Besteht Diebstahl in <strong>de</strong>r heimlichen Wegnahme einer<br />
frem<strong>de</strong>n Sache?<br />
4. Unterschei<strong>de</strong>t sich Raub spezifisch vom Diebstahl?<br />
5. Ist je<strong>de</strong>r Diebstahl Sün<strong>de</strong>?<br />
6. Ist Diebstahl Todsün<strong>de</strong>?<br />
7. Darf man in Not stehlen?<br />
8. Ist je<strong>de</strong>r Raub Todsün<strong>de</strong>?<br />
9. Ist Raub eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Diebstahl?<br />
1. ARTIKEL<br />
Kommt materieller Besitz <strong>de</strong>m Menschen von Natur aus zu?<br />
[34]<br />
1. Niemand darf sich aneignen, was Gott gehört. Doch Gott<br />
gebührt das Eigentumsrecht über alles Geschaffene gemäß <strong>de</strong>m<br />
Psalmwort (23) 24,1: „Des Herrn ist die Er<strong>de</strong>" usw. Also steht<br />
materieller Besitz <strong>de</strong>m Menschen nicht von Natur aus zu.<br />
2. Bei Auslegung jener Stelle Lkl2,18, wo <strong>de</strong>r Reiche sagt:<br />
„Ich wer<strong>de</strong> (in meinen Scheunen) mein ganzes Getrei<strong>de</strong> <strong>und</strong><br />
meine Vorräte unterbringen", schreibt Basilius (Horn. sup.<br />
Luc. 12,18sq.; MG31.276): „Sag' mir, was ist Dein? Woher<br />
hast du es genommen <strong>und</strong> ins Leben mitgebracht?" Von <strong>de</strong>m,<br />
was <strong>de</strong>r Mensch jedoch von Natur aus besitzt, kann er mit<br />
<strong>Recht</strong> sagen: es gehört mir. Also besitzt <strong>de</strong>r Mensch nicht von<br />
Natur aus äußere Güter.<br />
3. Ambrosius schreibt in seinem Buch Über die Dreifaltigkeit<br />
(ML 16,530): ,„Herr' ist Name <strong>de</strong>r Macht." Doch <strong>de</strong>r Mensch<br />
besitzt keine Macht über die materiellen Dinge, kann er doch<br />
111
66. l ihr Wesen nicht verän<strong>de</strong>rn. Also ist <strong>de</strong>r Besitz äußerer Güter für<br />
<strong>de</strong>n Menschen nicht natürlich.<br />
DAGEGEN heißt es im Psalm 8,8: „Alles hast du unter seine<br />
- nämlich <strong>de</strong>s Menschen - Füße gelegt."<br />
ANTWORT. Eine materielle Sache kann auf zweifache Weise<br />
betrachtet wer<strong>de</strong>n. Einmal im Hinblick auf ihr Wesen. Dieses<br />
unterliegt nicht <strong>de</strong>r menschlichen Macht, son<strong>de</strong>rn allein <strong>de</strong>r<br />
Macht Gottes, <strong>de</strong>m alles auf seinen Wink hin gehorcht. Sodann<br />
im Hinblick auf <strong>de</strong>n Gebrauch <strong>de</strong>r Sache. So gesehen besitzt <strong>de</strong>r<br />
Mensch ein natürliches Herrschaftsrecht über die materiellen<br />
Dinge, <strong>de</strong>nn mit Vernunft <strong>und</strong> freiem Willen kann er sie gleich<br />
sam als für ihn bereitgestellte Schöpfung zu seinem N<strong>utz</strong>en<br />
gebrauchen, - immer nämlich hat das Unvollkommenere <strong>de</strong>m<br />
Vollkommeneren zu dienen, wie oben (64,1) bemerkt wur<strong>de</strong>.<br />
Von dieser Überlegung ausgehend beweist Aristoteles im<br />
I. Buch seiner Politik (c. 8; 1256 b 7), daß <strong>de</strong>r Besitz materieller<br />
Güter für <strong>de</strong>n Menschen natürlich ist. Dieses natürliche<br />
Herrschaftsrecht über die unter ihm stehen<strong>de</strong> Kreatur, das <strong>de</strong>m<br />
Menschen aufgr<strong>und</strong> seiner Geistigkeit, in <strong>de</strong>r seine Gotteben<br />
bildlichkeit beschlossen liegt, zusteht, offenbart sich bei <strong>de</strong>r<br />
Schöpfung <strong>de</strong>s Menschen selbst, wo es Gnl,26 heißt: „Laßt<br />
uns <strong>de</strong>n Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich, <strong>und</strong> er<br />
soll herrschen über die Fische <strong>de</strong>s Meeres" usw.<br />
Zu 1. Gott, <strong>de</strong>r die Oberherrschaft über alle Dinge innehat,<br />
bestimmte davon in seiner Vorsehung einen gewissen Teil für<br />
<strong>de</strong>n leiblichen Unterhalt <strong>de</strong>s Menschen. Daher besitzt <strong>de</strong>r<br />
Mensch die natürliche Herrschaft über diese Dinge im Sinn <strong>de</strong>r<br />
seinem N<strong>utz</strong>en dienen<strong>de</strong>n Verfügungsmacht.<br />
Zu 2. Jener Reiche wird geta<strong>de</strong>lt, weil er glaubte, die mate<br />
riellen Güter gehörten ihm als ursprünglichem Besitzer <strong>und</strong> er<br />
habe sie nicht von einem an<strong>de</strong>ren, nämlich von Gott, erhalten.<br />
Zu 3. Jene Überlegung geht aus von <strong>de</strong>r Herrschaft über die<br />
Natur <strong>de</strong>r materiellen Dinge, doch diese Herrschaft steht, wie<br />
gesagt, Gott allein zu.<br />
112
2. ARTIKEL 66. 2<br />
Ist Privateigentum erlaubt?<br />
1. Alles, was <strong>de</strong>m Naturrecht wi<strong>de</strong>rspricht, ist unerlaubt.<br />
Nun gehört nach <strong>de</strong>m Naturrecht alles allen. Zu diesem<br />
Gemeinschaftsbesitz steht Eigenbesitz in Wi<strong>de</strong>rspruch. Also ist<br />
es keinem Menschen erlaubt, sich irgen<strong>de</strong>ine materielle Sache<br />
anzueignen.<br />
2. Basilius schreibt bei <strong>de</strong>r Auslegung <strong>de</strong>s erwähnten Wortes<br />
jenes Reichen (Lkl2,18; MG 31,276): „Die Reichen, die, je<strong>de</strong>m<br />
zuvorkommend, als Privateigentum betrachten, was allen<br />
gehört, gleichen <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r zuerst am Theater anlangt <strong>und</strong> die<br />
an<strong>de</strong>ren am Eintritt hin<strong>de</strong>rn wollte, in<strong>de</strong>m er für sich allein<br />
genießen möchte, was für alle vorgesehen ist" [35]. Doch wäre<br />
es unerlaubt, an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>n Weg zu <strong>de</strong>n gemeinsamen Gütern zu<br />
verlegen. Also ist es unerlaubt, sich eine materielle Sache als<br />
Privateigentum anzueignen.<br />
3. Ambrosius sagt (Sermo 81; ML 17,613) - zu fin<strong>de</strong>n auch in<br />
<strong>de</strong>n Dekreten (dist. 47; Frdbl,171) -: „Keiner nenne Privat<br />
eigentum, was gemeinsam ist". Er bezeichnet aber als Gemein<br />
besitz die materiellen Dinge, wie aus <strong>de</strong>m Zusammenhang<br />
ersichtlich ist. Also ist es unerlaubt, sich irgen<strong>de</strong>ine materielle<br />
Sache anzueignen.<br />
DAGEGEN schreibt Augustinus in seinem Buch Uber die Irr<br />
lehren (Haeres.40; ML 42,32): „Mit einer Anmaßung son<strong>de</strong>r<br />
gleichen nennen sie sich ,apostolisch', weil sie in ihre Gemein<br />
schaft keine Verheirateten <strong>und</strong> Leute mit Privatbesitz aufneh<br />
men, wo es doch in <strong>de</strong>r katholischen Kirche eine große Anzahl<br />
von solchen unter <strong>de</strong>n Mönchen <strong>und</strong> Klerikern gibt" [36]. Doch<br />
sie sind Häretiker <strong>und</strong> haben sich von <strong>de</strong>r Kirche getrennt, weil<br />
ihrer Meinung nach jene, die Dinge gebrauchen, auf die sie sel<br />
ber verzichten, keine Hoffnung haben auf das ewige Heil. Es ist<br />
also falsch, zu behaupten, es sei <strong>de</strong>m Menschen nicht erlaubt,<br />
Privateigentum zu besitzen.<br />
ANTWORT. In bezug auf eine materielle Sache steht <strong>de</strong>m<br />
Menschen zweierlei zu. Das ist einmal die Berechtigung <strong>de</strong>s Er<br />
werbs <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Verwaltung. Und im Hinblick darauf ist es <strong>de</strong>m<br />
Menschen erlaubt, Privateigentum zu besitzen. Dies ist zum<br />
menschlichen Leben auch nötig, <strong>und</strong> zwar aus drei Grün<strong>de</strong>n,<br />
113
66. 2 1. weil jemand mit einer Sache sorgfältiger umgeht, wenn sie<br />
ihm allein, als wenn sie allen o<strong>de</strong>r vielen gehört. Gerne überläßt<br />
man nämlich aus Bequemlichkeit die Arbeit am gemeinsamen<br />
Eigentum an<strong>de</strong>ren, wie das bekanntlich vorkommt, wo die Ver<br />
antwortung auf viele verteilt ist. - 2. weil die Dinge ordnungsge<br />
mäßer an die Hand genommen wer<strong>de</strong>n, wenn <strong>de</strong>r einzelne für<br />
ihre Beschaffung selber sorgen muß. Es entstün<strong>de</strong> nämlich ein<br />
heilloses Durcheinan<strong>de</strong>r, falls je<strong>de</strong>r unbekümmert alles besor<br />
gen wür<strong>de</strong>. - 3. weil <strong>de</strong>r friedliche Zustand unter <strong>de</strong>n Menschen<br />
besser gewahrt bleibt, wenn je<strong>de</strong>r mit seiner Sache zufrie<strong>de</strong>n ist.<br />
Wir stellen ja fest, daß dort, wo gemeinsamer <strong>und</strong> unterschieds<br />
loser Besitz herrscht, häufig Streitigkeiten ausbrechen.<br />
Das an<strong>de</strong>re, was <strong>de</strong>m Menschen in bezug auf die materiellen<br />
Dinge zusteht, ist ihre N<strong>utz</strong>ung. In dieser Hinsicht darf <strong>de</strong>r<br />
Mensch die materiellen Güter nicht als Privateigentum, son<br />
<strong>de</strong>rn muß er sie als Gemeingut betrachten, so daß er sie ohne<br />
weiteres für <strong>de</strong>n Bedarf an<strong>de</strong>rer ausgibt. Daher sagt <strong>de</strong>r Apostel<br />
im letzten Kapitel 1 Tim 17f: „Den Reichen dieser Welt gebiete,<br />
... sie sollen freigebig sein <strong>und</strong> mit an<strong>de</strong>ren teilen".<br />
Zu 1. Die Gemeinsamkeit <strong>de</strong>r Dinge geht auf das Natur<br />
recht zurück, nicht weil es gebieten wür<strong>de</strong>, alles gemeinsam zu<br />
besitzen <strong>und</strong> nichts als Privateigentum zu betrachten, son<strong>de</strong>rn<br />
weil es keinen Unterschied in <strong>de</strong>n Besitzweisen kennt: diese<br />
hängen vielmehr von menschlicher Ubereinkunft ab, die Sache<br />
<strong>de</strong>s positiven <strong>Recht</strong>s ist, wie oben (57,2.3) erklärt wur<strong>de</strong>. Daher<br />
richtet sich das Privateigentum nicht gegen das Naturrecht,<br />
son<strong>de</strong>rn es be<strong>de</strong>utet eine Ausweitung <strong>de</strong>s Naturrechts, welche<br />
die menschliche Vernunft herausgef<strong>und</strong>en hat. [37].<br />
Zu 2. Wer auf <strong>de</strong>m Weg zum Theater an<strong>de</strong>ren vorauseilt,<br />
han<strong>de</strong>lt nicht unerlaubt, doch fragwürdig wird sein Verhalten,<br />
wenn er an<strong>de</strong>re am Eintritt hin<strong>de</strong>rt. Ahnlich han<strong>de</strong>lt <strong>de</strong>r Reiche<br />
nicht unerlaubt, wenn er von <strong>de</strong>m, was zu Anfang Gemein<br />
besitz war, etwas als Eigentum vorwegnimmt, um an<strong>de</strong>re daran<br />
teilnehmen zu lassen. Er sündigt aber, falls er an<strong>de</strong>re vom<br />
Genuß jener Sache rücksichtslos ausschließt. Daher schreibt<br />
Basilius an <strong>de</strong>r erwähnten Stelle (MG 31,276): „Warum lebst<br />
du im Überfluß, während <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re betteln geht? Nicht etwa<br />
<strong>de</strong>shalb, damit du das Verdienst für gute Verwaltung erlangst,<br />
während jener mit <strong>de</strong>m Lohn <strong>de</strong>r Geduld gekrönt wer<strong>de</strong>?"<br />
Zu 3. Wenn Ambrosius sagt: „Niemand soll als Privateigen<br />
tum erklären, was allen gehört" (Sermo 81; ML17,613f),<br />
114
spricht er vom Eigentum im Hinblick auf seinen Genuß. Darum 66. 3<br />
fügt er hinzu: „Was über die Lebenskosten hinausgeht, ist mit<br />
Gewalt erworben".<br />
3. ARTIKEL<br />
Besteht Diebstahl in <strong>de</strong>r geheimen Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n<br />
Sache?<br />
1. Was die Sündhaftigkeit verringert, gehört nicht zum<br />
Wesen <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>. Doch im Geheimen sündigen be<strong>de</strong>utet Ver<br />
ringerung <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>, wie es umgekehrt, um die Größe gewisser<br />
Sün<strong>de</strong>n zu zeigen, bei Is 3,9 heißt: „Sie re<strong>de</strong>n von ihren Sün<strong>de</strong>n<br />
wie Sodoma in aller Öffentlichkeit <strong>und</strong> verbergen sie nicht".<br />
Also gehört die geheime Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n Sache nicht<br />
zum Wesen <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>.<br />
2. Ambrosius sagt (ML 17,613-614) - das Wort fin<strong>de</strong>t sich<br />
auch in <strong>de</strong>n Dekreten dist.47 (Frdbl,171): „Auch ist es kein<br />
kleineres Verbrechen, <strong>de</strong>m Besitzer etwas zu nehmen, als -<br />
wenn du kannst <strong>und</strong> Überfluß hast - <strong>de</strong>m Bedürftigen etwas zu<br />
verweigern". Wie also <strong>de</strong>r Diebstahl in <strong>de</strong>r Wegnahme einer<br />
frem<strong>de</strong>n Sache besteht, so nicht weniger darin, sie zu behalten.<br />
3. Man kann heimlich jeman<strong>de</strong>m etwas wegnehmen, was<br />
einem selbst gehört, z. B. eine Sache, die man bei einem hinter<br />
legt hat, o<strong>de</strong>r die von ihm ungerechterweise entwen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>.<br />
Geheime Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n Sache gehört also nicht<br />
zum Wesen <strong>de</strong>s Diebstahls.<br />
DAGEGEN steht das Wort in Isidors Etymologie (X, ad F;<br />
ML82,378): „Für (das Wort ,Dieb') kommt von furvus, das<br />
heißt ,dunkel', <strong>de</strong>nn er nützt die Zeit <strong>de</strong>r Nacht" [38].<br />
ANTWORT. Im Begriff <strong>de</strong>s Diebstahls fließen drei Dinge zu<br />
sammen. Das erste besteht in seinem Gegensatz zur Gerechtig<br />
keit, die je<strong>de</strong>m das Seine gibt <strong>und</strong> läßt. Von hier aus gesehen<br />
besagt Diebstahl Aneignung einer frem<strong>de</strong>n Sache. - Das zweite<br />
gehört zum Begriff <strong>de</strong>s Diebstahls, insofern er sich von <strong>de</strong>n<br />
Sün<strong>de</strong>n gegen Personen unterschei<strong>de</strong>t, wie etwa von Mord o<strong>de</strong>r<br />
Ehebruch. Dabei geht es immer um eine Sache im Besitzver<br />
hältnis. Wer nämlich etwas wegnimmt, was nicht <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren<br />
Besitz, son<strong>de</strong>rn ein Teil von ihm ist, wie z. B. wenn er ihn eines<br />
Glie<strong>de</strong>s beraubt, o<strong>de</strong>r als verwandte Person mit ihm verb<strong>und</strong>en<br />
ist, z.B. wenn er die Tochter o<strong>de</strong>r Gattin entführt, dann liegt<br />
115
66. 4 hier nicht <strong>de</strong>r strenge Begriff <strong>de</strong>s Diebstahls vor. - Der dritte<br />
Unterschied macht <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>s Diebstahls vollständig,<br />
nämlich daß die frem<strong>de</strong> Sache heimlich entwen<strong>de</strong>t wird. So<br />
stellt sich das eigentliche Wesen <strong>de</strong>s Diebstahls dar als: „Heim<br />
liche Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n Sache" [39].<br />
Zu 1. Bisweilen ist die Verheimlichung Ursache <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>,<br />
z.B. wenn jemand Verheimlichung als Mittel zum Sündigen<br />
einsetzt, wie bei Betrug <strong>und</strong> List. Dadurch wird die Sün<strong>de</strong> kei<br />
neswegs gemil<strong>de</strong>rt, son<strong>de</strong>rn die Heimlichkeit begrün<strong>de</strong>t viel<br />
mehr die Art <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>. - Doch kann die Verheimlichung auch<br />
ein einfacher Umstand <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> sein <strong>und</strong> sie dadurch<br />
abschwächen, weil sie entwe<strong>de</strong>r Zeichen <strong>de</strong>r Scham ist o<strong>de</strong>r<br />
Ärgernis verhütet.<br />
Zu 2. Eine Sache behalten, die einem an<strong>de</strong>ren gehört, ist,<br />
vom Scha<strong>de</strong>n her gesehen, soviel wie Diebstahl. Daher versteht<br />
man unter ungerechter Wegnahme auch ungerechtes Behalten.<br />
Zu 3. Was jeman<strong>de</strong>m schlechthin gehört, kann ohne weite<br />
res in gewisser Hinsicht einem an<strong>de</strong>ren gehören. So gehört eine<br />
hinterlegte Sache schlechthin <strong>de</strong>m Hinterleger, doch bezüglich<br />
<strong>de</strong>s Aufbewahrens gehört sie <strong>de</strong>m, bei <strong>de</strong>m sie hinterlegt ist.<br />
Und was durch Raub entwen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>, gehört <strong>de</strong>m Räuber,<br />
zwar nicht schlechthin, so doch in Bezug auf das Innehaben<br />
[40].<br />
4. ARTIKEL<br />
Sind Diebstahl <strong>und</strong> Raub spezifisch verschie<strong>de</strong>ne Sün<strong>de</strong>n?<br />
1. Diebstahl <strong>und</strong> Raub unterschei<strong>de</strong>n sich durch geheim <strong>und</strong><br />
offen. Diebstahl be<strong>de</strong>utet nämlich heimliche Wegnahme, Raub<br />
gewaltsame <strong>und</strong> offene. Doch bei an<strong>de</strong>ren Sün<strong>de</strong>narten spielt<br />
geheim <strong>und</strong> offen für die spezifische Unterscheidung keine<br />
Rolle. Also sind Diebstahl <strong>und</strong> Raub keine <strong>de</strong>r Art nach ver<br />
schie<strong>de</strong>nen Sün<strong>de</strong>n.<br />
2. Sittliche Akte wer<strong>de</strong>n durch ihr Ziel spezifiert, wie oben<br />
(I—II 1,3; 18,6) dargelegt wur<strong>de</strong>. Nun verfolgen Diebstahl <strong>und</strong><br />
Raub das gleiche Ziel, nämlich Besitznahme frem<strong>de</strong>n Gutes.<br />
Also besteht zwischen ihnen kein Artunterschied.<br />
3. Wie etwas geraubt wird, um es zu besitzen, so wird eine<br />
Frau geraubt, um sich an ihr zu ergötzen. Daher schreibt<br />
Isidor in seiner Etymologie (X, adR; ML 82,392): „Raptor (<strong>de</strong>r<br />
116
Räuber) heißt soviel wie corruptor (Ver<strong>de</strong>rber) <strong>und</strong> rapta (die 66. 4<br />
Geraubte) corrupta (die Verdorbene)." Von „Raub" spricht man<br />
aber, gleich ob die Frau offen o<strong>de</strong>r im Geheimen geraubt wur<strong>de</strong>.<br />
Also heißt es auch „Raub", ob eine Sache nun heimlich o<strong>de</strong>r<br />
offen geraubt wor<strong>de</strong>n ist. Somit unterschei<strong>de</strong>t sich Diebstahl<br />
nicht von Raub.<br />
DAGEGEN unterschei<strong>de</strong>t Aristoteles im V. Buch seiner Ethik<br />
(c. 5; 1131 a6) Diebstahl vom Raub, in<strong>de</strong>m er Diebstahl als<br />
etwas Geheimes, Raub als etwas Gewaltsames kennzeichnet.<br />
ANTWORT. Die Sün<strong>de</strong>n Diebstahl <strong>und</strong> Raub stehen insofern<br />
in Gegensatz zur <strong>Gerechtigkeit</strong>, als dabei einer <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren<br />
Unrecht zufügt. „Niemand" jedoch „erlei<strong>de</strong>t Unrecht, wenn er<br />
einverstan<strong>de</strong>n ist", wie im V.Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 15; 1138al2)<br />
bewiesen wird. Daher sind Diebstahl <strong>und</strong> Raub Sün<strong>de</strong>n, weil<br />
die Wegnahme ohne Willen <strong>de</strong>ssen geschieht, <strong>de</strong>m etwas<br />
genommen wird. „Ungewollt" aber be<strong>de</strong>utet etwas Zweifaches,<br />
nämlich einmal „ohne Wissen" <strong>und</strong> sodann „mit Gewalt", wie<br />
im II. Buch <strong>de</strong>r Ethik steht (c. 1; 1109 b 35). Daher ist Raub be<br />
grifflich etwas an<strong>de</strong>res als Diebstahl, <strong>und</strong> <strong>de</strong>shalb unterschei<br />
<strong>de</strong>n sie sich auch <strong>de</strong>r Art nach.<br />
Zu 1. Bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Sün<strong>de</strong>narten spielt das Ungewollt<br />
sein für <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> keine Rolle, dies ist nur bei <strong>de</strong>n<br />
Sün<strong>de</strong>n gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>de</strong>r Fall. Wo daher ein verschie<br />
<strong>de</strong>nes Ungewolltsein gegeben ist, liegt auch eine verschie<strong>de</strong>ne<br />
Art <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> vor.<br />
Zu 2. Das weitere Ziel ist bei Raub <strong>und</strong> Diebstahl das<br />
gleiche, doch dieses genügt zur Bildung spezifisch gleicher<br />
Akte nicht, <strong>de</strong>nn es bleibt <strong>de</strong>r Unterschied in <strong>de</strong>n unmittelbaren<br />
Zielen. Der Räuber nämlich möchte durch Gewalt erlangen, <strong>de</strong>r<br />
Dieb hingegen durch List.<br />
Zu 3. Frauenraub kann für die geraubte Frau keine heim<br />
liche Angelegenheit sein. Wenn daher auch die an<strong>de</strong>ren, <strong>de</strong>nen<br />
sie geraubt wird, davon nichts merken, so han<strong>de</strong>lt es sich für die<br />
gewaltsam ergriffene Frau <strong>de</strong>nnoch um eigentlichen Raub.<br />
117
66. 5 5. ARTIKEL<br />
Ist Diebstahl immer Sün<strong>de</strong>?<br />
1. Eine Sün<strong>de</strong> wird nie von Gott befohlen, heißt es doch bei<br />
Jesus Sirach 15,21: „Niemand hat er geboten, gottlos zu han<br />
<strong>de</strong>ln." Doch fin<strong>de</strong>t sich im Buche Exl2,35f. eine Stelle, wo<br />
Gott <strong>de</strong>n Diebstahl vorschreibt: „Die Söhne Israels taten, wie<br />
<strong>de</strong>r Herr <strong>de</strong>m Moses befohlen hatte, <strong>und</strong> raubten die Ägypter<br />
aus." Also ist Diebstahl nicht immer Sün<strong>de</strong>.<br />
2. Wer eine gef<strong>und</strong>ene Sache, die ihm nicht gehört, an sich<br />
nimmt, scheint einen Diebstahl zu begehen, <strong>de</strong>nn er eignet sich<br />
eine frem<strong>de</strong> Sache an. Doch ist dies, wie die Juristen sagen (s. u.<br />
Zu 2), aufgr<strong>und</strong> natürlicher Billigkeit erlaubt. Also ist Diebstahl<br />
nicht immer Sün<strong>de</strong>.<br />
3. Wer an sich nimmt, was ihm gehört, sündigt nicht, da er<br />
nicht gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> han<strong>de</strong>lt, <strong>de</strong>ren Gleichmaß er nicht<br />
aufhebt. Doch wer sein Eigentum, das ein an<strong>de</strong>rer aufbewahrt<br />
o<strong>de</strong>r bewacht, heimlich wegnimmt, begeht auch einen Dieb<br />
stahl. Also ist Diebstahl nicht immer Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN heißt es im Buche Ex20,15: „Du sollst nicht<br />
stehlen."<br />
ANTWORT. Wer <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>s Diebstahls untersucht, wird<br />
dabei zwei Grün<strong>de</strong> für seine Sündhaftigkeit ent<strong>de</strong>cken.<br />
Zunächst trifft man auf <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rspruch zur <strong>Gerechtigkeit</strong>, die<br />
je<strong>de</strong>m gibt <strong>und</strong> läßt, was sein ist. Und so steht <strong>de</strong>r Diebstahl zu<br />
ihr in Gegensatz, insofern er Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n Sache<br />
be<strong>de</strong>utet. Weiter zeigt sich noch <strong>de</strong>r Gesichtspunkt <strong>de</strong>r Arglist<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Betrugs, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Dieb begeht, in<strong>de</strong>m er sich heimlich<br />
<strong>und</strong> gleichsam aus <strong>de</strong>m Hinterhalt heraus einer frem<strong>de</strong>n Sache<br />
bemächtigt. Mithin ist es offensichtlich, daß je<strong>de</strong>r Diebstahl<br />
Sün<strong>de</strong> ist.<br />
Zu 1. Wer eine frem<strong>de</strong> Sache heimlich o<strong>de</strong>r offen aufgr<strong>und</strong><br />
eines autoritativen Entscheids <strong>de</strong>s Richters wegnimmt, begeht<br />
keinen Diebstahl, <strong>de</strong>nn sie ist ihm geschul<strong>de</strong>t, weil durch rich<br />
terliches Urteil ihm zugesprochen. Daher war es noch viel weni<br />
ger Diebstahl, als die Söhne Israels die Ägypter auf Befehl <strong>de</strong>s<br />
Herrn beraubten, <strong>de</strong>r ihnen dies zuerkannte für die Drangsale,<br />
mit <strong>de</strong>nen die Ägypter sie ohne Gr<strong>und</strong> heimgesucht hatten.<br />
Daher sagt Weish. 10,19 ausdrücklich: „Die Gerechten trugen<br />
<strong>de</strong>n Raub von <strong>de</strong>n Gottlosen hinweg" [41].<br />
118
Zu 2. Bei gef<strong>und</strong>enen Sachen ist zu unterschei<strong>de</strong>n. Manche 66. 5<br />
waren nie Eigentum von irgendjemand, wie Perlen <strong>und</strong> E<strong>de</strong>l<br />
steine, die man am Meeresstrand fin<strong>de</strong>t. Diese wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Fin<br />
<strong>de</strong>r überlassen (Dig. 1,8,3; Inst. 2,1,18). Das gleiche gilt von<br />
<strong>de</strong>n Schätzen, die in alter Zeit in <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> vergraben wur<strong>de</strong>n;<br />
auch sie haben keinen Besitzer, es sei <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Fin<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong><br />
nach <strong>de</strong>m Zivilgesetz gehalten, die Hälfte <strong>de</strong>m Eigentümer <strong>de</strong>s<br />
Gr<strong>und</strong>stücks zu überlassen, falls er <strong>de</strong>n F<strong>und</strong> auf frem<strong>de</strong>m<br />
Bo<strong>de</strong>n gemacht hat (Inst. 2,1,39; Cod. 10,15). Daher heißt es<br />
auch im Gleichnis <strong>de</strong>s Evangeliums nach Mt 13,44 vom Fin<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>s „verborgenen Schatzes im Acker", er habe „<strong>de</strong>n Acker<br />
gekauft", um damit <strong>de</strong>n ganzen Schatz rechtmäßig zu besitzen.<br />
- Manche Dinge befan<strong>de</strong>n sich jedoch bis vor kurzem in irgend<br />
eines Besitz. Wer sie dann an sich nimmt ohne Absicht, sie zu<br />
behalten, son<strong>de</strong>rn um sie <strong>de</strong>m Besitzer, <strong>de</strong>r sie nicht als „verlas<br />
sen" betrachtet, zurückzugeben, begeht keinen Diebstahl<br />
(Inst. 2,1,47). Ebenso begeht <strong>de</strong>r Fin<strong>de</strong>r keinen Diebstahl, <strong>de</strong>r<br />
Sachen behält, von <strong>de</strong>nen er annimmt, daß sie aufgegeben wur<br />
<strong>de</strong>n. Sonst versündigt er sich durch Diebstahl (Dig. XLI, 1,9;<br />
Inst. 2,1,48). Daher sagt Augustinus in einer Predigt<br />
(Sermol78; ML38,965): „Hast du etwas gef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> nicht<br />
zurückgegeben, hast du geraubt."<br />
Zu 3. Wer heimlich sein hinterlegtes Eigentum an sich<br />
nimmt, belastet <strong>de</strong>n Verwahrer, <strong>de</strong>nn er ist zur Restitution o<strong>de</strong>r<br />
zum Beweis seiner Unschuld verpflichtet. Daher versündigt er<br />
sich ohne Zweifel <strong>und</strong> ist gehalten, <strong>de</strong>r Beschwernis <strong>de</strong>s Ver<br />
wahrers ein En<strong>de</strong> zu machen. - Wer jedoch sein Eigentum heim<br />
lich bei einem, <strong>de</strong>r es zu Unrecht besitzt, wegnimmt, sündigt<br />
zwar nicht, weil er <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r es ihm vorenthält, Beschwer<strong>de</strong>n<br />
verschafft - <strong>de</strong>shalb ist er auch nicht zur Restitution verpflichtet<br />
-, son<strong>de</strong>rn er sündigt gegen die allgemeine <strong>Gerechtigkeit</strong>, da er<br />
sich unter Umgehung <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung ein Gerichtsurteil in<br />
eigener Sache anmaßt. Daher muß er Gott Genugtuung leisten<br />
<strong>und</strong> nach Kräften das Ärgernis, das etwa dadurch entstan<strong>de</strong>n<br />
ist, beseitigen [42].<br />
119
66. 6 6. ARTIKEL<br />
Ist Diebstahl schwere Sün<strong>de</strong>?<br />
1. In <strong>de</strong>n Sprichwörtern 6,30 heißt es: „So groß ist die<br />
Schuld nicht, wenn jemand stiehlt. "Doch je<strong>de</strong> Todsün<strong>de</strong> besagt<br />
große Schuld. Also ist Diebstahl keine Todsün<strong>de</strong>.<br />
2. Der Todsün<strong>de</strong> gebührt To<strong>de</strong>sstrafe.Doch für <strong>de</strong>nDiebstahl<br />
wird nach <strong>de</strong>m Gesetz keine To<strong>de</strong>sstrafe verhängt, son<strong>de</strong>rn nur<br />
Buße gemäß Ex 22,1: „Wenn jemand ein Rind o<strong>de</strong>r Schaf<br />
stiehlt,... so soll er fünf Rin<strong>de</strong>r für ein Rind zurückgeben <strong>und</strong><br />
vier Schafe für ein Schaf." Also ist Diebstahl keine Todsün<strong>de</strong>.<br />
3. Stehlen kann man im kleinen wie im großen. Es wäre<br />
jedoch unangemessen, jeman<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n Diebstahl einer gerin<br />
gen Sache, z. B. einer Na<strong>de</strong>l o<strong>de</strong>r einer Fe<strong>de</strong>r, mit <strong>de</strong>m ewigen<br />
Tod zu bestrafen. Also ist <strong>de</strong>r Diebstahl keine Todsün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN verdammt das göttliche Gericht nieman<strong>de</strong>n, es<br />
sei <strong>de</strong>nn wegen einer Todsün<strong>de</strong>. Nach Zach 5,3 wird jedoch ein<br />
Verdammungsurteil wegen Diebstahls ausgesprochen: „Dies ist<br />
<strong>de</strong>r Fluch, <strong>de</strong>r ausgeht über das ganze Land: je<strong>de</strong>r Dieb, wie<br />
dort geschrieben steht, wird verdammt wer<strong>de</strong>n." Also ist Dieb<br />
stahl eine schwere Sün<strong>de</strong>.<br />
ANTWORT. Die Caritas erfüllt die Seele mit geistlichem<br />
Leben. Darum ist ein Tun, das ihm wi<strong>de</strong>rspricht, Todsün<strong>de</strong>. Die<br />
Caritas besteht nun in erster Linie in <strong>de</strong>r Liebe zu Gott, in zwei<br />
ter in <strong>de</strong>r Liebe zum Nächsten, <strong>und</strong> dazu gehört es, ihm Gutes<br />
zu wollen <strong>und</strong> anzutun. Durch <strong>de</strong>n Diebstahl fügt <strong>de</strong>r Mensch<br />
seinem Nächsten jedoch Scha<strong>de</strong>n an seinen Gütern zu, <strong>und</strong><br />
wenn die Menschen einan<strong>de</strong>r unterschiedslos bestehlen wür<br />
<strong>de</strong>n, wäre es um die menschliche Gesellschaft geschehen. Daher<br />
ist Diebstahl, als Gegensatz zur Caritas, Todsün<strong>de</strong>.<br />
Zu 1. Mit geringer Schuld ist Diebstahl aus doppeltem<br />
Gr<strong>und</strong> behaftet. Erstens wegen einer Notlage, die zum Dieb<br />
stahl führt, was die Schuld min<strong>de</strong>rt o<strong>de</strong>r gänzlich aufhebt, wie<br />
weiter unten ausgeführt wird (Art. 7). Daher heißt es dort<br />
(Spr 6,30) weiter: „Er stiehlt ja, um seinen Hunger zu stillen." -<br />
Zweitens läßt sich bei Diebstahl von geringer Schuld sprechen<br />
im Vergleich zum Vergehen <strong>de</strong>s Ehebruchs, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Tod<br />
bestraft wird (Lv20,10; Dt22,22). Daher heißt es vom Dieb<br />
weiter (V.31 f.): „Wenn er ertappt wird, soll er es siebenfach<br />
ersetzen, wer aber Ehebrecher ist, wird sein Leben verlieren."<br />
120
Zu 2. Die Strafen im gegenwärtigen Leben dienen mehr <strong>de</strong>r 66. 7<br />
Besserung als <strong>de</strong>r Vergeltung. Die Vergeltung nämlich bleibt<br />
<strong>de</strong>m göttlichen Gericht vorbehalten, das „<strong>de</strong>r Wahrheit gemäß"<br />
(Rom 2,2) über die Sün<strong>de</strong>r ergehen wird. Daher verhängt das<br />
irdische Gericht nicht für je<strong>de</strong> Todsün<strong>de</strong> die To<strong>de</strong>sstrafe, son<br />
<strong>de</strong>rn nur für jene, die unwie<strong>de</strong>rbringlichen Scha<strong>de</strong>n verursa<br />
chen, o<strong>de</strong>r auch für jene, die Ausdruck höchster Verkommen<br />
heit sind. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird für Diebstahl, <strong>de</strong>r wie<strong>de</strong>rgut<br />
zumachen<strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n verursacht, im irdischen Gericht keine<br />
To<strong>de</strong>sstrafe ausgesprochen, außer wenn die Schwere <strong>de</strong>s Dieb<br />
stahls durch irgen<strong>de</strong>inen Umstand be<strong>de</strong>utend verschärft wird,<br />
wie dies offenk<strong>und</strong>ig beim Diebstahl einer gottgeweihten<br />
Sache, bei Unterschlagung öffentlicher Gel<strong>de</strong>r (vgl. Augustinus,<br />
Johanneskommentar, Tr. 50; ML 35,1762) <strong>und</strong> bei Menschen<br />
raub <strong>de</strong>r Fall ist, worauf die To<strong>de</strong>sstrafe steht, wie aus Ex 21,16<br />
hervorgeht.<br />
Zu 3. Etwas Geringwertiges betrachtet die Vernunft gleich<br />
sam als Nichts. Daher fühlt sich <strong>de</strong>r Mensch durch Verlust von<br />
ganz wenigem nicht geschädigt, <strong>und</strong> wer dieses wegnimmt, darf<br />
voraussetzen, daß ihm <strong>de</strong>r Eigentümer sein Verhalten nicht<br />
übelnimmt. Insoweit kann <strong>de</strong>r Dieb solch geringer Dinge von<br />
Todsün<strong>de</strong> freigesprochen wer<strong>de</strong>n. Hat er aber die Absicht, zu<br />
stehlen <strong>und</strong> dabei zu schädigen, dann kann sogar <strong>de</strong>r Diebstahl<br />
von <strong>de</strong>rlei Kleinigkeiten Todsün<strong>de</strong> sein, wie ja auch ein<br />
bloßer Gedanke dazu genügt, falls man ihm zustimmt.<br />
7. ARTIKEL<br />
Darf man aus Not stehlen?<br />
1. Buße wird nur einem Sün<strong>de</strong>r auferlegt. Doch in <strong>de</strong>r Extra<br />
(Frdbll, 810) heißt es: „Wer durch Not <strong>de</strong>s Hungers o<strong>de</strong>r Klei<br />
<strong>de</strong>rmangels Speise, Kleidung o<strong>de</strong>r Vieh gestohlen hat, soll drei<br />
Wochen Buße tun." Also ist es nicht erlaubt, aus Not zu stehlen.<br />
2. Im II. Buch seiner Ethik (c. 6; 1107a9) schreibt Aristote<br />
les: „Manche Handlungen besagen schon ihrem Namen nach<br />
etwas Schlechtes", <strong>und</strong> dabei nennt er <strong>de</strong>n Diebstahl. Was<br />
jedoch in sich schlecht ist, kann wegen eines guten Zweckes<br />
nicht gut wer<strong>de</strong>n. Also kann man auch nicht erlaubterweise<br />
stehlen, um seiner Not abzuhelfen.<br />
121
66. 7 3. Der Mensch muß seinen Nächsten lieben wie sich selbst.<br />
Nun darf man, wie Augustinus in seinem Buch Gegen die Sün<strong>de</strong><br />
(c. 7; ML 40,528) bemerkt, nicht stehlen, um seinem Nächsten<br />
mit einem Almosen zu helfen. Also ist es auch nicht erlaubt,<br />
sich durch Diebstahl selber zu helfen.<br />
DAGEGEN lautet <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>satz: Im Notfall gehört alles<br />
allen. Somit ist es keine Sün<strong>de</strong>, sich eines an<strong>de</strong>ren Eigentum an<br />
zueignen, <strong>de</strong>nn die Not hat es zu einer Sache für alle gemacht.<br />
ANTWORT. Menschliches <strong>Recht</strong> kann <strong>de</strong>m natürlichen o<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>m göttlichen <strong>Recht</strong> keinen Abbruch tun. Nach <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r<br />
göttlichen Vorsehung eingerichteten Naturordnung nun sind<br />
die niedrigen Dinge dazu bestimmt, <strong>de</strong>r menschlichen Bedürf<br />
tigkeit zu dienen. Daher hin<strong>de</strong>rn Verteilung <strong>und</strong> Besitznahme<br />
<strong>de</strong>r Dinge - ein Werk <strong>de</strong>s menschlichen <strong>Recht</strong>s - nicht, eben-<br />
diese Dinge zur Lin<strong>de</strong>rung menschlicher Not einzusetzen. Des<br />
halb ist das, was einige im Uberfluß besitzen, aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s<br />
Naturrechts, <strong>de</strong>n Armen zu ihrem Lebensunterhalt geschul<strong>de</strong>t.<br />
So sagt Ambrosius (ML 17,613-614) - es steht auch in <strong>de</strong>n<br />
Dekreten dist. 47 (Frdbl, 171) -: „Was du zurückhältst, ist Brot<br />
<strong>de</strong>r Hungrigen, was du einschließest, Kleidung <strong>de</strong>r Nackten,<br />
das Geld, das du im Bo<strong>de</strong>n vergräbst, Loskauf <strong>und</strong> Befreiung<br />
<strong>de</strong>r Elen<strong>de</strong>n." Weil es jedoch viele Notlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> gibt <strong>und</strong> einer<br />
mit <strong>de</strong>m, was er hat, nicht allen zu helfen vermag, bleibt es <strong>de</strong>m<br />
einzelnen überlassen, seine Sachen so einzuteilen, daß er damit<br />
<strong>de</strong>n Notlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n beispringen kann. Ist die Not jedoch einmal<br />
ein<strong>de</strong>utig so groß, daß man im drängen<strong>de</strong>m Fall mit <strong>de</strong>m, was<br />
sich gera<strong>de</strong> anbietet, offenk<strong>und</strong>ig Abhilfe schaffen muß, z. B.<br />
wenn einer Person Gefahr droht <strong>und</strong> an<strong>de</strong>rs nicht geholfen wer<br />
<strong>de</strong>n kann, dann darf man mit einer frem<strong>de</strong>n Sache, sei sie nun<br />
offen o<strong>de</strong>rheimlich weggenommen, ihre Not beheben. VonDieb-<br />
stahl o<strong>de</strong>r Raub kann dann eigentlich nicht die Re<strong>de</strong> sein [43].<br />
Zu 1. Jene Bestimmung <strong>de</strong>r Dekrete faßt <strong>de</strong>n Fall ins Auge,<br />
wo keine dringen<strong>de</strong> Not vorliegt.<br />
Zu 2. Eine heimlich weggenommene frem<strong>de</strong> Sache zur<br />
Behebung äußerster Not gebrauchen, hat streng genommen<br />
mit Diebstahl nichts zu tun. Denn eine <strong>de</strong>rartige Lebenslage<br />
bewirkt, daß das, was jemand an sich nimmt, um sich am Leben<br />
zu halten, „das Seine" wird.<br />
Zu 3. Im Falle ähnlicher Not kann man heimlich etwas ent<br />
wen<strong>de</strong>n, um auch seinem in Schwierigkeit geratenen Nächsten<br />
zu helfen.<br />
122
8. ARTIKEL 66. 8<br />
Kann Raub Sün<strong>de</strong> sein?<br />
1. Beute wird gewaltsam weggenommen, dies gehört zum<br />
Wesen <strong>de</strong>s Raubes (vgl. Art.4). Doch Beute machen bei <strong>de</strong>n<br />
Fein<strong>de</strong>n ist erlaubt, wie bei Ambrosius in seinem Buch über die<br />
Patriarchen (ML 14,427) steht: „Wenn die Beute in die Hand<br />
<strong>de</strong>s Siegers gefallen ist, verlangt die soldatische Zucht, alles <strong>de</strong>m<br />
König zu übergeben", nämlich zur Verteilung. Also ist Raub in<br />
gewissen Fällen erlaubt.<br />
2. Was einem nicht gehört, darf man ihm nehmen. Nun ist<br />
<strong>de</strong>r Besitz <strong>de</strong>r Ungläubigen nicht ihr Eigentum. Augustinus<br />
schreibt nämlich im Brief an <strong>de</strong>n Donatisten Vincentius (Brief<br />
33; ML 33,345): „Ihr nennt Dinge fälschlich euer eigen, doch<br />
besitzt ihr sie nicht rechtmäßig <strong>und</strong> müßtet sie nach <strong>de</strong>n Geset<br />
zen <strong>de</strong>r weltlichen Könige herausgeben." Also dürfte man die<br />
Ungläubigen erlaubterweise berauben.<br />
3. Die Lan<strong>de</strong>sfürsten pressen aus ihren Untertanen mit<br />
Gewalt viel heraus, <strong>und</strong> dies ist doch wohl nichts an<strong>de</strong>res als<br />
Raub. Es wäre jedoch be<strong>de</strong>nklich, zu sagen, daß sie damit sün<br />
digen, <strong>de</strong>nn sonst kämen fast alle Fürsten in die Hölle. Also ist<br />
Raub in gewissen Fällen erlaubt.<br />
DAGEGEN steht, daß von allem rechtmäßig Erworbenen<br />
Gott ein Opfer o<strong>de</strong>r eine Gabe dargebracht wer<strong>de</strong>n kann. Mit<br />
Raubgut darf dies jedoch nicht geschehen gemäß Is61,8:<br />
„Denn ich, <strong>de</strong>r Herr, liebe das <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> hasse <strong>de</strong>n Raub als<br />
Brandopfer." Also ist es nicht erlaubt, sich durch Raub etwas zu<br />
verschaffen.<br />
ANTWORT. Raub be<strong>de</strong>utet Gewalt <strong>und</strong> Zwang, wodurch,<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zuwi<strong>de</strong>r, jeman<strong>de</strong>m weggenommen wird, was<br />
sein ist. In <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft besitzt jedoch<br />
Zwangsrecht nur die öffentliche Gewalt. Wer daher jeman<strong>de</strong>m<br />
als Privatperson ohne öffentliche Gewalt eigenmächtig etwas<br />
nimmt, han<strong>de</strong>lt unerlaubt <strong>und</strong> begeht einen Raub genau so wie<br />
die Räuber.<br />
Den Fürsten jedoch wird öffentliche Gewalt übertragen,<br />
damit sie Hüter <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> seien. Daher dürfen sie nur<br />
nach Maßgabe <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> Gewalt <strong>und</strong> Zwang anwen<br />
<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> das heißt entwe<strong>de</strong>r im Kampf gegen die Fein<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r<br />
bei Strafaktionen gegen verbrecherische Bürger. Was bei <strong>de</strong>rar-<br />
123
66.8 tigen Gewaltanwendungen weggenommen wird, ist nicht<br />
Raub, da dies nicht gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> verstößt. Wird<br />
jedoch gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> von irgendwelchen im Namen<br />
<strong>de</strong>r öffentlichen Gewalt frem<strong>de</strong>s Gut entwen<strong>de</strong>t, so han<strong>de</strong>ln<br />
diese unerlaubt <strong>und</strong> begehen Raub <strong>und</strong> sind zur Restitution<br />
verpflichtet [44].<br />
Zu 1. In Sachen Beute ist zu unterschei<strong>de</strong>n. Führen die<br />
Beutemacher einen gerechten Krieg, dann geht, was sie dabei<br />
gewaltsam an sich reißen, in ihr Eigentum über. Es han<strong>de</strong>lt sich<br />
dann streng genommen nicht um Beute, <strong>und</strong> zur Restitution<br />
besteht darum auch kein Anlaß. Freilich können sich die Beute<br />
macher in einem gerechten Krieg in schlechter Absicht durch<br />
Besitzgier versündigen, wenn sie hauptsächlich nicht wegen <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, son<strong>de</strong>rn um <strong>de</strong>r Beute willen kämpfen. Augustinus<br />
sagt nämlich in seinem Buch über die Worte <strong>de</strong>s Herrn<br />
(Sermo 82; ML 39,1904): „Um <strong>de</strong>r Beute willen Kriegsdienst<br />
zu leisten ist Sün<strong>de</strong>." - Wer jedoch in einem ungerechten Krieg<br />
Beute macht, begeht Raub <strong>und</strong> ist zur Restitution verpflichtet.<br />
Zu 2. Gewisse Ungläubige besitzen ihr Eigentum insofern<br />
ungerechterweise, als sie es „nach <strong>de</strong>n Gesetzen <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sfür<br />
sten abtreten müssen." Daher kann es ihnen gewaltsam abge<br />
nommen wer<strong>de</strong>n, jedoch nicht mit privater, son<strong>de</strong>rn nur mit<br />
öffentlicher Autorität.<br />
Zu 3. Wenn die Fürsten von ihren Untertanen verlangen,<br />
was ihnen zur Erhaltung <strong>de</strong>s Gemeinwohls gerechterweise<br />
zusteht, so ist dies kein Raub, auch wenn dabei mit Gewalt vor<br />
gegangen wird. Erpressen die Fürsten jedoch etwas ungerech<br />
terweise mit Gewalt, dann ist dies genauso Raub, wie an<strong>de</strong>re<br />
Räuberei. Daher schreibt Augustinus im 4. Buch seines Gottes<br />
staates (c.4; ML41,115): „Was sind die Königreiche ohne<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> an<strong>de</strong>res als große Räuberban<strong>de</strong>n? Denn auch die<br />
Räuberban<strong>de</strong>n, - sind sie nicht etwa kleine Königreiche?" Und<br />
bei Ez22,27 steht: „Die Fürsten in seiner Mitte gleichen Beute<br />
rauben<strong>de</strong>n Wölfen." Daher sind sie genau wie die Räuber zu<br />
Restitution verpflichtet. Dabei sündigen sie umso mehr als die<br />
Räuber, je ver<strong>de</strong>rblicher <strong>und</strong> allgemeiner sie die <strong>Gerechtigkeit</strong>,<br />
als <strong>de</strong>ren Hüter sie berufen wur<strong>de</strong>n, mit Füßen treten.<br />
124
9. ARTIKEL 66. 9<br />
Ist Raub eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Diebstahl?<br />
1. Zur Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n Sache kommt beim Dieb<br />
stahl noch Betrug <strong>und</strong> Arglist hinzu, was beim Raub nicht <strong>de</strong>r<br />
Fall ist. Nun sind Betrug <strong>und</strong> Arglist schon für sich genommen<br />
Sün<strong>de</strong>, wie oben (55,4.5) dargelegt wur<strong>de</strong>. Also ist Diebstahl<br />
eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Raub.<br />
2. Scham ist Furcht vor schimpflichem Tun, wie es im<br />
IV. Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 15; 1128 b 11) heißt. Doch die Menschen<br />
empfin<strong>de</strong>n mehr Scham über Diebstahl als über Raub. Also ist<br />
Diebstahl schimpflicher als Raub [45].<br />
3. Je mehr Menschen eine Sün<strong>de</strong> scha<strong>de</strong>t, umso schwerer scheint<br />
sie zu sein. Nun kann Diebstahl Große <strong>und</strong> Kleine treffen, Raub<br />
jedoch nur Schwache, gegen die man mit Gewalt vorgehen kann.<br />
Also ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Diebstahls schwerer als die <strong>de</strong>s Raubes.<br />
DAGEGEN steht, daß nach <strong>de</strong>m Gesetz Raub schwerer<br />
bestraft wird als Diebstahl.<br />
ANTWORT. Wie oben (Art. 4) erklärt wur<strong>de</strong>, sind Raub <strong>und</strong><br />
Diebstahl Sün<strong>de</strong>n, weil dabei je<strong>de</strong>smal gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>s<br />
Eigentümers etwas weggenommen wird, jedoch mit <strong>de</strong>m Un<br />
terschied, daß beim Diebstahl Ungewolltsein wegen Nichtwis<br />
sens, beim Raub hingegen Ungewolltsein wegen offener<br />
Gewalt vorliegt. Bei Gewaltanwendung wird <strong>de</strong>r Wille aber<br />
wirksamer ausgeschaltet als durch Nichtwissen, weil Gewalt<br />
unmittelbarer als Nichtwissen auf <strong>de</strong>n Willen einwirkt. Und<br />
<strong>de</strong>shalb ist Raub eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Diebstahl.<br />
Dazu kommt noch ein an<strong>de</strong>rer Gesichtspunkt. Beim Raub<br />
wird nicht nur Sachscha<strong>de</strong>n angerichtet, son<strong>de</strong>rn er wen<strong>de</strong>t sich<br />
auch schmachvoll <strong>und</strong> entehrend gegen die Person. Und dies ist<br />
schlimmer als Betrug o<strong>de</strong>r Arglist, die <strong>de</strong>n Diebstahl begleiten.<br />
Daraus ergibt sich die Lösung Zu 1.<br />
Zu 2. Auf Äußerlichkeiten eingestellte Menschen begeistern<br />
sich mehr für körperliche Kraftakte, wie sie beim Raub in<br />
Erscheinung treten, als für die innere Kraft <strong>de</strong>r Tugend, die<br />
durch die Sün<strong>de</strong> verlorengeht. Daher empfin<strong>de</strong>n sie über <strong>de</strong>n<br />
Raub weniger Scham als über <strong>de</strong>n Diebstahl.<br />
Zu 3. Durch Diebstahl kann wohl eine größere Anzahl als<br />
durch Raub geschädigt wer<strong>de</strong>n, doch <strong>de</strong>r Scha<strong>de</strong>n durch Raub<br />
ist größer als <strong>de</strong>r durch Diebstahl. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e ist <strong>de</strong>r<br />
Raub auch verabscheuungswürdiger.<br />
125
67 FRAGE<br />
DIE MISSACHTUNG<br />
DER GERECHTIGKEIT BEI DER<br />
AUSÜBUNG DES RICHTERAMTES<br />
Nunmehr sind die Verfehlungen gegen die ausgleichen<strong>de</strong><br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> zu behan<strong>de</strong>ln, die zum Scha<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Nächsten<br />
durch Worte begangen wer<strong>de</strong>n. Dabei sind zunächst die Tätig<br />
keiten beim Gerichtsverfahren zu untersuchen (Fr. 67-71),<br />
sodann die Verbalinjurien außerhalb <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sprechung<br />
(Fr. 72-76).<br />
Bezüglich <strong>de</strong>s ersten Punktes drängen sich 5 Themen auf:<br />
1. Die Ungerechtigkeit <strong>de</strong>s Richters bei <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sprechung.<br />
2. Die Ungerechtigkeit <strong>de</strong>s Anklägers bei seiner Anklage.<br />
3. Die Ungerechtigkeit <strong>de</strong>s Angeklagten bei seiner Verteidi-<br />
4. Die Ungerechtigkeit <strong>de</strong>s Zeugen bei <strong>de</strong>r Zeugenaussage.<br />
5. Die Ungerechtigkeit <strong>de</strong>s Anwalts bei <strong>de</strong>r Verteidigung.<br />
Zum ersten Thema ergeben sich vier Fragen:<br />
1. Kann <strong>de</strong>r Richter über jeman<strong>de</strong>n urteilen, für <strong>de</strong>n er nicht<br />
zuständig ist?<br />
2. Ist es erlaubt, im Hinblick auf die vorgelegten Aussagen<br />
gegen das eigene bessere Wissen ein Urteil zu fällen?<br />
3. Kann <strong>de</strong>r Richter einen Nichtangeklagten gerechterweise<br />
verurteilen?<br />
4. Ist es erlaubt, eine Strafe zu erlassen?<br />
1. ARTIKEL<br />
Kann <strong>de</strong>r Richter über jeman<strong>de</strong>n urteilen, für <strong>de</strong>n er nicht<br />
zuständig ist?<br />
1. Dn 13,45 ff. ist zu lesen, daß Daniel die <strong>de</strong>s falschen<br />
Zeugnisses überführten Ältesten verurteilte. Nun waren diese<br />
Ältesten nicht Daniels Untergebene, im Gegenteil, sie waren<br />
Richter <strong>de</strong>s Volkes. Also darf jemand erlaubterweise einen rich<br />
ten, für <strong>de</strong>n er nicht zuständig ist.<br />
2. Christus, „<strong>de</strong>r König <strong>de</strong>r Könige <strong>und</strong> Herr <strong>de</strong>r Herren"<br />
(Apkl7,14) war keinem Menschen Untertan, <strong>und</strong> <strong>de</strong>nnoch<br />
126
stellte er sich einem menschlichen Gericht. Also darf man 67 1<br />
jeman<strong>de</strong>n richten, für <strong>de</strong>n man nicht zuständig ist.<br />
3. Nach <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> ist ein Fall vor jenem Gericht zu verhan<br />
<strong>de</strong>ln, in <strong>de</strong>ssen Bereich die Verfehlung begangen wur<strong>de</strong>. Doch<br />
bisweilen untersteht <strong>de</strong>r Delinquent nicht <strong>de</strong>m Gericht jenes<br />
Ortes, z. B. wenn er einer an<strong>de</strong>ren Diözese angehört o<strong>de</strong>r<br />
exempt ist. Also kann jemand einen richten, für <strong>de</strong>n er nicht<br />
zuständig ist.<br />
DAGEGEN steht das Wort Gregors zur Stelle Dt23,25:<br />
„Wenn du auf <strong>de</strong>n Fruchtacker kommst [darfst du Ähren abrei<br />
ßen, aber nichts mit <strong>de</strong>r Sichel abschnei<strong>de</strong>n]": „Er kann mit <strong>de</strong>r<br />
Sichel <strong>de</strong>s Richterspruches nicht in eine Sache eingreifen, die<br />
<strong>de</strong>r Zuständigkeit eines an<strong>de</strong>ren untersteht" (Regist. XI, ep. 64;<br />
ML 77,1192; Frdb 1,561).<br />
ANTWORT. Der Spruch <strong>de</strong>s Richters ist gleichsam ein auf<br />
<strong>de</strong>n Einzelfall zugeschnittenes Gesetz. Wie daher das allge<br />
meine Gesetz nach Aristoteles (Eth.X,10; 1180 a 21) Zwangs<br />
gewalt haben muß, so auch <strong>de</strong>r Spruch <strong>de</strong>s Richters. Dadurch<br />
wer<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong> Teile gezwungen, sich an das Urteil zu halten,<br />
<strong>de</strong>nn sonst wäre es wirkungslos. Erzwingungsgewalt besitzt<br />
im Staat jedoch nur <strong>de</strong>r Inhaber <strong>de</strong>r öffentlichen Gewalt. Und<br />
die sie ausüben, gelten als Vorgesetzte jener, über die sie, wie<br />
über Untergebene, Macht erhalten haben. So ist es klar, daß nie<br />
mand einen richten kann, wenn ihm dieser nicht irgendwie un<br />
tergeben ist, entwe<strong>de</strong>r aufgr<strong>und</strong> einer Vollmachtsübertragung<br />
o<strong>de</strong>r or<strong>de</strong>ntlicher Amtsbefugnis.<br />
Zu 1. Daniel wur<strong>de</strong> die Vollmacht, jene Ältesten zu richten,<br />
gewissermaßen durch göttliche Eingebung übertragen. Dies<br />
wird ange<strong>de</strong>utet durch das Wort (V. 45): „Der Herr erweckte<br />
<strong>de</strong>n Geist eines noch jungen Mannes."<br />
Zu 2. In menschlichen Dingen kann sich jemand freiwillig<br />
<strong>de</strong>m Urteil an<strong>de</strong>rer unterstellen, auch wenn sie nicht seine Vor<br />
gesetzten sind. Dies trifft z. B. bei jenen zu, die einen Schieds<br />
richter anrufen. Freilich muß dann <strong>de</strong>r Schiedsspruch durch<br />
eine Strafe gesichert wer<strong>de</strong>n; die Schiedsrichter, die nicht Vor<br />
gesetzte sind, besitzen von sich aus ja keine Erzwingungsge<br />
walt. So unterwarf sich auch Christus freiwillig <strong>de</strong>m menschli<br />
chen Gericht, <strong>de</strong>sgleichen Papst Leo (IV.) <strong>de</strong>m Gericht <strong>de</strong>s Kai<br />
sers (MansiXIV,887; Frdbl,496).<br />
Zu 3. Der Bischof, in <strong>de</strong>ssen Diözese sich einer vergangen<br />
hat, wird <strong>de</strong>ssen Vorgesetzter aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Deliktes, selbst<br />
127
67. 2 wenn er exempt ist, es sei <strong>de</strong>nn, er habe sich in einer exempten<br />
Sache vergangen, z. B. in <strong>de</strong>r Verwaltung eines exempten Klo<br />
sters. Hat ein Exempter jedoch Diebstahl, Mord o<strong>de</strong>r ähnliches<br />
verschul<strong>de</strong>t, kann er durch <strong>de</strong>n Bischof rechtmäßig verurteilt<br />
wer<strong>de</strong>n [46].<br />
2. ARTIKEL<br />
Ist es erlaubt, angesichts <strong>de</strong>r vorgebrachten Aussagen ein Urteil<br />
gegen das eigene bessere Wissen zu fällen?<br />
1. Dt 17,9 heißt es: „Du sollst vor die Priester vom<br />
Geschlecht Levi treten <strong>und</strong> vor <strong>de</strong>n Richter, <strong>de</strong>r dann im Amte<br />
ist, <strong>und</strong> Umfragen anstellen lassen; so wer<strong>de</strong>n sie dir das <strong>de</strong>r<br />
Wahrheit gemäße Urteil verkün<strong>de</strong>n." Doch bisweilen wird<br />
Unwahres vorgebracht, wie z. B. wenn etwas durch falsche<br />
Zeugen bewiesen wird. Also ist es <strong>de</strong>m Richter nicht erlaubt,<br />
nach <strong>de</strong>m, was vorgebracht <strong>und</strong> bewiesen wird, gegen sein eige<br />
nes besseres Wissen ein Urteil zu fällen.<br />
2. Der richten<strong>de</strong> Mensch muß sich <strong>de</strong>m Gericht Gottes an<br />
gleichen, <strong>de</strong>nn „Gottes ist das Gericht", wie es Dt 1,7 heißt. Nun<br />
„ist Gottes Gericht <strong>de</strong>r Wahrheit gemäß" (Rom 2,2) <strong>und</strong><br />
Is 11,3 f. wird von Christus geweissagt: „Er richtet nicht nach<br />
<strong>de</strong>m Augenschein, noch urteilt er nach <strong>de</strong>m Hörensagen, son<br />
<strong>de</strong>rn er richtet die Armen nach <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> urteilt mit<br />
Billigkeit über die Demütigen <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>." Also darf <strong>de</strong>r Richter<br />
angesichts <strong>de</strong>r ihm vorgelegten Beweise nicht ein Urteil gegen<br />
sein eigenes besseres Wissen fällen.<br />
3. Vor Gericht wer<strong>de</strong>n Beweise verlangt, damit sich <strong>de</strong>r Rich<br />
ter eine Meinung vom wahren Sachverhalt bil<strong>de</strong>n kann. Zur<br />
Klarstellung bekannter Dinge bedarf es daher keines Gerichts<br />
verfahrens gemäß 1 Tim 5,24: „Die Sün<strong>de</strong>n mancher Leute lie<br />
gen offen zutage, sie laufen ihnen gleichsam voraus zum<br />
Gericht." Kennt <strong>de</strong>r Richter also von sich aus die Wahrheit, darf<br />
er auf die vorgebrachten Beweise keine Rücksicht nehmen, son<br />
<strong>de</strong>rn muß seinen Spruch nach <strong>de</strong>r ihm bekannten Wahrheit fäl<br />
len.<br />
4. „Gewissen" heißt soviel wie Anwendung <strong>de</strong>s Wissens auf<br />
das Tun (vgl.I 79,13). Doch gegen das Gewissen han<strong>de</strong>ln ist<br />
Sün<strong>de</strong>. Also sündigt <strong>de</strong>r Richter, wenn er entgegen seinem Wis-<br />
128
sen um die Wahrheit nach <strong>de</strong>n vorliegen<strong>de</strong>n Prozeßakten sein 67 2<br />
Urteil fällt.<br />
DAGEGEN steht, was Ambrosius in einer Homilie zum<br />
Psalm 118 (ML15,1571) schreibt: „Ein guter Richter entschei<br />
<strong>de</strong>t nicht nach eigenem Gutdünken, son<strong>de</strong>rn er fällt seinen<br />
Spruch nach Gesetz <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>." Dies be<strong>de</strong>utet aber nach <strong>de</strong>m<br />
urteilen, was im Gericht vorgebracht <strong>und</strong> bewiesen wird. Also<br />
muß sich <strong>de</strong>r Richter daran halten <strong>und</strong> darf nicht seiner eigenen<br />
Meinung folgen.<br />
ANTWORT. Wie (60,6) gesagt, kommt das <strong>Recht</strong>sprechen<br />
<strong>de</strong>m Richter zu als bestelltem Vertreter <strong>de</strong>r öffentlichen Macht.<br />
Deshalb darf ihn bei seiner Tätigkeit nicht das leiten, was er als<br />
Privatperson weiß, son<strong>de</strong>rn die Kenntnis, die er als öffentliche<br />
Person besitzt. Diese Kenntnis nun wird ihm vermittelt im all<br />
gemeinen <strong>und</strong> im beson<strong>de</strong>ren. Im allgemeinen durch die öffent<br />
lichen Gesetze, göttliche <strong>und</strong> menschliche: gegen sie darf er<br />
keine Beweise gelten lassen. Im beson<strong>de</strong>ren, d. h. im einzelnen<br />
Fall, durch Beweismittel, Zeugen <strong>und</strong> an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>rgleichen recht<br />
mäßige Bürgschaften. Diesen muß er bei <strong>de</strong>r Verhandlung mehr<br />
folgen als seinem Wissen als Privatperson. Er kann jedoch seine<br />
eigene Uberzeugung mitspielen lassen, in<strong>de</strong>m er die vor<br />
gebrachten Beweise einer schärferen Prüfung unterzieht, um<br />
ihre Schwachstellen herauszustellen. Kann er sie jedoch recht<br />
lich nicht zurückweisen, dann muß er, wie gesagt (DAGEGEN),<br />
sein Urteil darauf stützen [47].<br />
Zu 1. Jener Text über die Umfrage durch die Richter wird<br />
vorausgeschickt, um klarzustellen, daß die Richter nach <strong>de</strong>m<br />
urteilen müssen, was ihnen vorgelegt wur<strong>de</strong>.<br />
Zu 2. Gott fällt seine Urteile aus eigener Machtbefugnis,<br />
<strong>und</strong> daher richtet er sich dabei nach <strong>de</strong>r Wahrheit, die er selber<br />
weiß, <strong>und</strong> nicht nach <strong>de</strong>m, was er von an<strong>de</strong>ren erfährt. Das<br />
gleiche gilt von Christus, <strong>de</strong>r wahrer Gott <strong>und</strong> wahrer Mensch<br />
ist. Die übrigen Richter j edoch fällen ihre Urteile nicht aus eigener<br />
Machtbefugnis. Daher sind die bei<strong>de</strong>n Fälle nicht vergleichbar.<br />
Zu 3. Der Apostel spricht von <strong>de</strong>m Fall, daß <strong>de</strong>r Tatbestand<br />
nicht nur <strong>de</strong>m Richter, son<strong>de</strong>rn auch an<strong>de</strong>ren bekannt ist.<br />
Daher kann <strong>de</strong>r Schuldige auf keine Weise sein Verbrechen in<br />
Abre<strong>de</strong> stellen, son<strong>de</strong>rn er wird sogleich durch <strong>de</strong>n offenk<strong>und</strong>i<br />
gen Tatbestand überführt. Ist er aber nur <strong>de</strong>m Richter, jedoch<br />
nicht an<strong>de</strong>ren bekannt o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren <strong>und</strong> nicht <strong>de</strong>m Richter,<br />
dann läßt sich ein Prozeßverfahren nicht umgehen.<br />
129
67 3 Zu 4. Für sich selber muß <strong>de</strong>r Mensch sein Gewissen nach<br />
eigenem Wissen bil<strong>de</strong>n. Han<strong>de</strong>lt er jedoch in öffentlicher Funk<br />
tion, dann gilt für seine Gewissensinformation nur, was in<br />
einem öffentlichen Gerichtsverfahren herauskommen kann<br />
usw.<br />
3. ARTIKEL<br />
Kann <strong>de</strong>r Richter tätig wer<strong>de</strong>n, auch wenn kein Kläger<br />
vorhan<strong>de</strong>n ist?<br />
1. Die menschliche <strong>Gerechtigkeit</strong> leitet sich von <strong>de</strong>r göttli<br />
chen ab. Doch Gott richtet die Sün<strong>de</strong>r auch dann, wenn es kei<br />
nen Ankläger gibt. Also kann in gleicher Weise <strong>de</strong>r Mensch<br />
gerichtlich jeman<strong>de</strong>n verurteilen, wenn kein Kläger vorhan<strong>de</strong>n<br />
ist.<br />
2. Der Ankläger ist bei einem Gerichtsverfahren nötig,<br />
damit das Verbrechen <strong>de</strong>m Richter vorgetragen wird. Doch bis<br />
weilen kann das Verbrechen auf an<strong>de</strong>re Weise als auf <strong>de</strong>m<br />
Anklageweg vor <strong>de</strong>n Richter gelangen, z. B. durch Anzeige,<br />
durch üblen Ruf o<strong>de</strong>r wenn <strong>de</strong>r Richter selbst darauf stößt. Also<br />
kann <strong>de</strong>r Richter jeman<strong>de</strong>n ohne Ankläger verurteilen.<br />
3. Die Taten <strong>de</strong>r Heiligen wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Hl. Schrift als Vor<br />
bil<strong>de</strong>r für das menschliche Leben erzählt. Nun war Daniel zu<br />
gleich Ankläger <strong>und</strong> Richter im Fall <strong>de</strong>r ruchlosen Ältesten, wie<br />
bei Dn 13,45 ff. geschrieben steht. Also ist es nicht gegen die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, wenn jemand als Richter einen verurteilt <strong>und</strong> zu<br />
gleich als Ankläger gegen ihn auftritt.<br />
DAGEGEN steht, was Ambrosius bei <strong>de</strong>r Auslegung von<br />
1 Kor 5,2 (ML 17,208) zur Ansicht <strong>de</strong>s Apostels über <strong>de</strong>n<br />
Unzüchtigen schreibt: „Der Richter darf nicht ohne Ankläger<br />
verurteilen, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Herr hat <strong>de</strong>n Judas, <strong>de</strong>r ein Dieb war, in<br />
keiner Weise von sich gestoßen, <strong>und</strong> zwar <strong>de</strong>shalb, weil er nicht<br />
angeklagt war."<br />
ANTWORT. Der Richter sagt, was im einzelnen Gerechtig<br />
keit ist. „Daher nehmen die Leute", wie Aristoteles im V. Buch<br />
seiner Ethik (c.4; 1132 a 20) bemerkt, „ihre Zuflucht zum Rich<br />
ter wie zur lebendigen <strong>Gerechtigkeit</strong>." Die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
bezieht sich jedoch, wie oben (58,2) betont, nicht auf einen<br />
selbst, son<strong>de</strong>rn regelt die Beziehungen zu an<strong>de</strong>ren. Daher muß<br />
<strong>de</strong>r Richter zwischen Zweien entschei<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> dies setzt vor-<br />
130
aus, daß <strong>de</strong>r eine Kläger <strong>und</strong> <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Angeklagter ist. Aus 67 3<br />
diesem Gr<strong>und</strong>e kann <strong>de</strong>r Richter jeman<strong>de</strong>n in Kriminalfällen<br />
nur verurteilen, wenn ein Kläger auftritt gemäß jenem Wort<br />
Apg25,16: „Bei <strong>de</strong>n Römern ist es nicht üblich, einen Men<br />
schen zu verurteilen, bevor <strong>de</strong>r Angeklagte <strong>de</strong>n Anklägern ge<br />
genübergestellt <strong>und</strong> ihm Gelegenheit zur Verteidigung gegeben<br />
wur<strong>de</strong>, um sich von <strong>de</strong>n Verbrechen, die ihm vorgeworfen wer<br />
<strong>de</strong>n, zu entlasten" [48].<br />
Zu 1. In seinem Gericht weist Gott <strong>de</strong>m Gewissen <strong>de</strong>s Sün<br />
<strong>de</strong>rs die Funktion <strong>de</strong>s Anklägers zu gemäß Röm2,15: „Ihre<br />
Gedanken klagen sich gegenseitig an <strong>und</strong> verteidigen sich."<br />
Auch spielt die Evi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r Tatsachen die gleiche Rolle gemäß<br />
Gn 4,10: „Das Blut <strong>de</strong>ines Bru<strong>de</strong>rs Abel schreit auf zu mir von<br />
<strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>."<br />
Zu 2. Der schlechte Ruf in <strong>de</strong>r Öffentlichkeit übt das<br />
Geschäft <strong>de</strong>s Anklägers aus. Daher schreibt die Glosse (interlin.<br />
1,45 v) zu Gn 4,10 „Das Blut <strong>de</strong>ines Bru<strong>de</strong>rs Abel" usw.: „Die<br />
Offenk<strong>und</strong>igkeit <strong>de</strong>s Verbrechens braucht keinen Ankläger." -<br />
Die Anzeige jedoch hat, wie oben (33,7) erwähnt, nicht die<br />
Bestrafung <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs zum Ziel, son<strong>de</strong>rn seine Besserung.<br />
Daher geschieht nichts gegen <strong>de</strong>n angezeigten Sün<strong>de</strong>r, son<strong>de</strong>rn<br />
man tut etwas für ihn. Aus diesem Gr<strong>und</strong> bedarf es hier eben<br />
falls keines Anklägers. Wi<strong>de</strong>rspenstigkeit gegen die Kirche wird<br />
hingegen ohne beson<strong>de</strong>ren Ankläger bestraft, <strong>de</strong>nn dieses Ver<br />
gehen ist ebenfalls offenk<strong>und</strong>ig <strong>und</strong> klagt sich selber an. - Ent<br />
<strong>de</strong>ckt <strong>de</strong>r Richter persönlich ein Verbrechen, so kann er ein<br />
Urteil nur nach <strong>de</strong>n Regeln <strong>de</strong>r offiziellen <strong>Recht</strong>sordnung<br />
fällen.<br />
Zu 3. Gott steht für sein Gericht die eigene Kenntnis <strong>de</strong>r<br />
Wahrheit zur Verfügung, nicht aber <strong>de</strong>m Menschen (Art. 2,3).<br />
Daher kann <strong>de</strong>r Mensch nicht wie Gott zugleich Ankläger,<br />
Richter <strong>und</strong> Zeuge sein. Daniel jedoch war in seiner Person<br />
Ankläger <strong>und</strong> Richter <strong>und</strong> vollzog unter Gottes Eingebung<br />
gleichsam an <strong>de</strong>ssen Stelle das Gericht (Art. 1,1).<br />
131
4. ARTIKEL<br />
Darf <strong>de</strong>r Richter die Strafe erlassen?<br />
1. Bei Jak2,13 steht: „Ein Gericht ohne Erbarmen hat zu<br />
erwarten, wer kein Erbarmen kennt." Doch niemand wird<br />
bestraft, weil er nicht tut, was er erlaubterweise nicht tun kann.<br />
Also kann je<strong>de</strong>r Richter Barmherzigkeit üben, in<strong>de</strong>m er die<br />
Strafe erläßt.<br />
2. Menschliches Richten muß das göttliche Gericht nachah<br />
men. Nun läßt Gott <strong>de</strong>n reuigen Sün<strong>de</strong>rn die Strafe nach, <strong>de</strong>nn<br />
„er will nicht <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs Tod", wie es bei Ez 18,23 heißt. Also<br />
kann auch <strong>de</strong>r menschliche Richter <strong>de</strong>m reuigen Angeklagten<br />
die Strafe erlassen.<br />
3. Je<strong>de</strong>r kann tun, was ihm nützt <strong>und</strong> an<strong>de</strong>ren nicht scha<strong>de</strong>t.<br />
Dem Schuldigen die Strafe erlassen ist jedoch für diesen von<br />
N<strong>utz</strong>en <strong>und</strong> scha<strong>de</strong>t keinem. Also kann <strong>de</strong>r Richter <strong>de</strong>m Schul<br />
digen erlaubterweise die Strafe erlassen.<br />
DAGEGEN heißt es Dt 13,8 f. von <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Rat gibt,<br />
an<strong>de</strong>ren Göttern zu dienen: „Dein Auge schone seiner nicht,<br />
daß du vielleicht Mitleid habest <strong>und</strong> ihn verbergen möchtest,<br />
son<strong>de</strong>rn töte ihn auf <strong>de</strong>r Stelle." Und vom Mör<strong>de</strong>r heißt es<br />
Dt 19,12 f: „Er soll sterben <strong>und</strong> du sollst kein Erbarmen mit<br />
ihm haben."<br />
ANTWORT. Wie aus <strong>de</strong>m obigen (2,3) hervorgeht, sind in<br />
<strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Frage beim Richter zwei Gesichtspunkte zu<br />
be<strong>de</strong>nken. Einmal muß er zwischen Ankläger <strong>und</strong> Schuldigem<br />
richten, sodann aber fällt er seinen Spruch nicht aus eigener<br />
Machtbefugnis, son<strong>de</strong>rn als Vertreter <strong>de</strong>r öffentlichen Autorität.<br />
Zwei Grün<strong>de</strong> also verbieten es <strong>de</strong>m Richter, <strong>de</strong>m Schuldigen die<br />
Strafe zu erlassen. Erstens die Rücksicht auf <strong>de</strong>n Ankläger, <strong>de</strong>r<br />
die Bestrafung wegen eines erlittenen Unrechts mit gutem<br />
Gr<strong>und</strong> erwarten kann. Ein Nachlaß liegt nicht im Belieben <strong>de</strong>s<br />
Richters, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r muß je<strong>de</strong>m sein <strong>Recht</strong> geben.<br />
Zweitens verwehrt es ihm <strong>de</strong>r Staat, in <strong>de</strong>ssen Namen er sein<br />
Amt ausübt <strong>und</strong> zu <strong>de</strong>ssen Gemeinwohl es gehört, daß die<br />
Übeltäter bestraft wer<strong>de</strong>n. Dennoch gibt es hier einen Unter<br />
schied zwischen <strong>de</strong>n untergeordneten Richtern <strong>und</strong> <strong>de</strong>m ober<br />
sten Richter, nämlich <strong>de</strong>m Fürsten, <strong>de</strong>m die öffentliche Gewalt<br />
in vollem Umfang anvertraut ist. Der untergeordnete Richter<br />
nämlich besitzt keine Befugnis, einem Schuldigen gegen die von<br />
132
seinem Vorgesetzten im auferlegten Gesetze die Strafe zu erlas- 67. 4<br />
sen. Daher bemerkt Augustinus zum Johanneswort (19,11) „Du<br />
hättest keine Macht über mich": „Gott hat <strong>de</strong>m Pilatus nur eine<br />
<strong>de</strong>rart <strong>de</strong>m Kaiser untergeordnete Macht verliehen, daß es nicht<br />
in seinem Belieben stand, <strong>de</strong>n Angeklagten freizugeben" (In<br />
Joh.,Tr. 116; ML35,1943). Doch <strong>de</strong>r Fürst, <strong>de</strong>rvolle Macht im<br />
Staate besitzt, kann, wenn das Opfer <strong>de</strong>r Untat damit einver<br />
stan<strong>de</strong>n ist <strong>und</strong> es <strong>de</strong>m Gemeinwohl nicht zum Scha<strong>de</strong>n aus<br />
schlägt, <strong>de</strong>n Schuldigen erlaubterweise ohne Strafe davonkom<br />
men lassen.<br />
Zu 1. Barmherzigkeit kann <strong>de</strong>r Richter in Dingen walten<br />
lassen, die seinem Ermessen freistehen, wo es nach <strong>de</strong>n Worten<br />
<strong>de</strong>s Aristoteles (Eth.V, 14; 1138 a 1) „Zeichen <strong>de</strong>s guten Men<br />
schen ist, die Strafe zu mil<strong>de</strong>rn." Wo jedoch die Bestimmungen<br />
<strong>de</strong>s göttlichen o<strong>de</strong>r menschlichen Gesetzes herrschen, steht es<br />
ihm nicht zu, Nachsicht zu üben.<br />
Zu 2. Gott besitzt die höchste richterliche Gewalt, <strong>und</strong> ihm<br />
unterliegt alles, was gegen irgendjemand gesündigt wird. Daher<br />
steht es ihm frei, die Strafe zu erlassen, zumal die Sün<strong>de</strong> vor<br />
allem <strong>de</strong>shalb die Strafe verdient, weil sie gegen ihn gerichtet ist.<br />
Doch verzichtet er nur <strong>de</strong>shalb auf Bestrafung, weil dies seiner<br />
Güte, diesem Quellgr<strong>und</strong> all seiner Gesetze, entspricht.<br />
Zu 3. Wenn <strong>de</strong>r Richter unter Mißachtung <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sord<br />
nung Strafe erließe, fügte er <strong>de</strong>r Gemeinschaft Scha<strong>de</strong>n zu, für<br />
die es gut ist, wenn die Übeltäter bestraft wer<strong>de</strong>n, damit das<br />
Sündigen unterbleibt. Daher fährt Dt 13,11 nach <strong>de</strong>r Erwäh<br />
nung <strong>de</strong>r Strafe für <strong>de</strong>n Verführer fort: „Damit ganz Israel es<br />
höre <strong>und</strong> sich fürchte <strong>und</strong> fernerhin nicht mehr etwas <strong>de</strong>rglei<br />
chen tue." Der Richter scha<strong>de</strong>te aber auch <strong>de</strong>m Opfer <strong>de</strong>r Un<br />
gerechtigkeit, das in <strong>de</strong>r Bestrafung <strong>de</strong>s Übeltäters eine gewisse<br />
Wie<strong>de</strong>rherstellung seiner Ehre erblickt.<br />
133
68. FRAGE<br />
DIE UNGERECHTE ANKLAGE<br />
Nun steht das Thema „ungerechte Anklage" zur Behandlung<br />
an. Dabei ergeben sich vier Fragen:<br />
1. Ist man verpflichtet, Anklage zu erheben?<br />
2. Muß die Anklage schriftlich abgefaßt wer<strong>de</strong>n?<br />
3. Wodurch wird eine Anklage verwerflich?<br />
4. Wie sind böswillige Ankläger zu bestrafen?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist man verpflichtet, Anklage zu erheben ?<br />
1. Niemand wird wegen einer Sün<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Erfüllung eines<br />
göttlichen Gebotes entschuldigt, <strong>de</strong>nn sonst zöge er aus seiner<br />
Sün<strong>de</strong> einen Vorteil. Doch manche wer<strong>de</strong>n wegen einer Sün<strong>de</strong><br />
unfähig, als Kläger aufzutreten, wie z. B. die Exkommunizier<br />
ten, die Ehrlosen <strong>und</strong> die größerer Verbrechen Angeklagten,<br />
bevor ihre Unschuld erwiesen ist. Also ist man durch göttliches<br />
Gebot nicht gehalten, Anklage zu erheben.<br />
2. Je<strong>de</strong> Pflicht hängt von <strong>de</strong>r Liebe ab, die „das Ziel <strong>de</strong>s<br />
Gesetzes ist". Daher heißt es Rom 13,8: „Bleibt niemand etwas<br />
schuldig, nur die Liebe schul<strong>de</strong>t ihr einan<strong>de</strong>r immer." Doch die<br />
Liebe schul<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Mensch allen, <strong>de</strong>n Großen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Kleinen,<br />
<strong>de</strong>n Untergebenen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Vorgesetzten. Da nun die Unterge<br />
benen nicht die Vorgesetzten <strong>und</strong> die Kleinen nicht die Großen<br />
anklagen sollen, wie durch mehrere Kapitel in <strong>de</strong>n Dekreten<br />
II, q. 7 (Frdb1,483 ff.) dargelegt wird, ist offenbar niemand ver<br />
pflichtet, Klage zu erheben.<br />
3. Niemand ist verpflichtet, gegen die Treue zu han<strong>de</strong>ln, die<br />
er <strong>de</strong>m Fre<strong>und</strong> schul<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>nn er darf einem an<strong>de</strong>ren nicht<br />
antun, was er selbst von ihm nicht zugefügt haben möchte. Nun<br />
be<strong>de</strong>utet jeman<strong>de</strong>n anklagen bisweilen einen Verstoß gegen die<br />
Treue, die man <strong>de</strong>m Fre<strong>und</strong> schul<strong>de</strong>t, wie es Sprll,13 heißt:<br />
„Wer trügerisch wan<strong>de</strong>lt, <strong>de</strong>ckt Geheimnisse auf, wer aber treu<br />
ist, schweigt über das, was <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong> ihm anvertraut hat." Also<br />
ist man nicht gehalten, Anklage zu erheben.<br />
134
DAGEGEN heißt es Lv 5,1: „Wenn jemand dadurch sündigt, 68. 1<br />
daß er einem Fluchen<strong>de</strong>n zuhört <strong>und</strong> also Augenzeuge ist, es<br />
jedoch nicht anzeigt, macht er sich schuldig."<br />
ANTWORT. Wie oben (67,3,2) dargelegt, besteht <strong>de</strong>r Unter<br />
schied zwischen Anzeige <strong>und</strong> Anklage darin, daß die Anzeige<br />
die Besserung <strong>de</strong>s Mitbru<strong>de</strong>rs im Auge hat, während die<br />
Anklage auf die Bestrafung <strong>de</strong>s Verbrechens ausgeht. Die Stra<br />
fen <strong>de</strong>s gegenwärtigen Lebens jedoch sind nicht an sich gefor<br />
<strong>de</strong>rt - <strong>de</strong>nn hienie<strong>de</strong>n ist nicht die endgültige Zeit <strong>de</strong>r Vergel<br />
tung -, son<strong>de</strong>rn als Heilmittel zur Besserung <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs o<strong>de</strong>r<br />
zum Wohl <strong>de</strong>s Gemeinwesens, <strong>de</strong>ssen Frie<strong>de</strong> durch die Bestra<br />
fung <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>r gesichert wird. Das erste hat, wie gesagt, die<br />
Anzeige im Sinn, das zweite bezweckt man mit <strong>de</strong>r Anklage.<br />
Wenn daher ein Verbrechen ein Ausmaß angenommen hat, daß<br />
es <strong>de</strong>n Staat bedroht, besteht die Verpflichtung zur Klageerhe<br />
bung - ausreichen<strong>de</strong>r Beweis vorausgesetzt; sich <strong>de</strong>ssen zu ver<br />
sichern, ist Pflicht <strong>de</strong>s Anklägers -, z. B. wenn jeman<strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong><br />
zum leiblichen o<strong>de</strong>r geistlichen Ver<strong>de</strong>rben <strong>de</strong>s Volkes aus<br />
schlägt. Erreicht die Sün<strong>de</strong> aber nicht eine <strong>de</strong>rartige soziale<br />
Auswirkung o<strong>de</strong>r läßt sie sich nicht genügend beweisen, so<br />
besteht keine Verpflichtung, eine Klage anzustrengen, <strong>de</strong>nn nie<br />
mand ist zu etwas verpflichtet, was er nicht sachgerecht zu lei<br />
sten vermag.<br />
Zu 1. Es stimmt tatsächlich, daß <strong>de</strong>r Mensch wegen einer<br />
Sün<strong>de</strong> unfähig wird, zu tun, was alle tun müssen, z. B. das<br />
ewige Leben verdienen o<strong>de</strong>r die Sakramente empfangen. Doch<br />
zieht <strong>de</strong>r Mensch daraus keineswegs einen Vorteil, in Wirklich<br />
keit nämlich be<strong>de</strong>utet nicht tun können, was man tun sollte,<br />
schwerste Strafe, <strong>de</strong>nn seine Vollkommenheit erlangt <strong>de</strong>r<br />
Mensch durch tugendhaftes Tun.<br />
Zu 2. Untergebene, die das Leben ihrer Vorgesetzten „nicht<br />
aus Liebe, son<strong>de</strong>rn in bösartiger Absicht in Verruf bringen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Kritik aussetzen wollen", dürfen gegen sie keine Klage erhe<br />
ben (Frdbl,488). Das gleiche gilt nach <strong>de</strong>n Dekreten II,q. 7<br />
(Frdbl,488) für verbrecherische Untergebene. Sonst jedoch<br />
dürfen Untergebene ihre Vorgesetzten aus Liebe anklagen, falls<br />
sie die nötigen Voraussetzungen dazu haben.<br />
Zu 3. Geheimnisse zum Scha<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r betreffen<strong>de</strong>n Person<br />
enthüllen, verstößt gegen die Treue, nicht aber wenn sie ans<br />
Licht <strong>de</strong>r Öffentlichkeit gezogen wer<strong>de</strong>n zum Vorteil <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls, das <strong>de</strong>m Wohl <strong>de</strong>s einzelnen stets vorgeht. Des-<br />
135
68. 2 halb darf man sich auch auf kein Geheimnis einlassen, das sich<br />
gegen das Gemeinwohl richtet. - Jedoch ist das, was sich durch<br />
vollgültige Zeugen beweisen läßt, kein Geheimnis [49].<br />
2. ARTIKEL<br />
Muß die Anklage schriftlich abgefaßt wer<strong>de</strong>n?<br />
1. Die Schrift wur<strong>de</strong> zur Unterstützung <strong>de</strong>s Gedächtnisses<br />
erf<strong>und</strong>en, damit es das Vergangene besser behalten kann. Doch<br />
eine Anklage hat Gegenwärtiges zum Thema. Also ist es nicht<br />
nötig, sie schriftlich abzufassen.<br />
2. In <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 8 (Frdbl,503) steht: „Ein Abwe<br />
sen<strong>de</strong>r kann we<strong>de</strong>r anklagen noch von jemand angeklagt wer<br />
<strong>de</strong>n." Die Schrift aber dient gera<strong>de</strong> dazu, Abwesen<strong>de</strong>n etwas<br />
mitzuteilen (vgl. Augustinus: Über die Dreifaltigkeit, 10,1;<br />
ML 42,972). Also ist eine schriftliche Abfassung <strong>de</strong>r Anklage<br />
überflüssig, zumal ein Kanon bestimmt, daß „keine Anklage<br />
schriftlich angenommen wer<strong>de</strong>n darf" (Frdb 1,503).<br />
3. Man kann jemand eines Verbrechens überführen sowohl<br />
durch Anklage wie durch Anzeige. Doch eine Anzeige braucht<br />
man nicht schriftlich abzufassen. Also auch nicht eine Anklage.<br />
DAGEGEN heißt es in <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 3 (Frdb 1,503):<br />
„Ankläger ohne schriftlich aufgesetzten Text dürfen nicht zuge<br />
lassen wer<strong>de</strong>n".<br />
ANTWORT. Wie oben (67,3) bemerkt, ist <strong>de</strong>r Ankläger in<br />
einem Kriminalprozeß Partei, so daß <strong>de</strong>r Richter zur Prüfung<br />
<strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>slage in <strong>de</strong>r Mitte zwischen <strong>de</strong>m Ankläger <strong>und</strong> <strong>de</strong>m<br />
Angeklagten steht. Dabei muß er zu möglichst sicheren<br />
Erkenntnissen gelangen. Weil jedoch nur mündlich Vorgebrach<br />
tes leicht vergessen wird, stün<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Richter bei seiner Urteils<br />
verkündung das Was- <strong>und</strong> Wie-Gesagte nicht sicher vor Augen.<br />
Daher gibt es die kluge Bestimmung, daß die Anklage, wie<br />
überhaupt alles, was zu einer Gerichtsverhandlung gehört,<br />
schriftlich abzufassen ist [50].<br />
Zu 1. Es ist schwer, sich bei <strong>de</strong>r Menge <strong>und</strong> Mannigfaltigkeit<br />
<strong>de</strong>s Gesprochenen einzelne Worte zu merken. Beweis dafür ist<br />
die Tatsache, daß viele, die das gleiche gehört haben, schon nach<br />
kurzer Zeit, wenn man sie danach fragt, verschie<strong>de</strong>ne Antwor<br />
ten geben. Und doch än<strong>de</strong>rt schon ein geringer Unterschied in<br />
<strong>de</strong>n Worten <strong>de</strong>n Sinn! Daher ist es für die Sicherheit <strong>de</strong>s Urteils,<br />
136
auch wenn es <strong>de</strong>r Richter schon bald nach Abschluß <strong>de</strong>r Ver- 68. 3<br />
handlung verkün<strong>de</strong>n muß, von Vorteil, wenn die Anklage<br />
schriftlich abgefaßt wird.<br />
Zu 2. Schriftliche Abfassung ist nicht nur nötig, wenn die<br />
Person, die etwas mitteilt o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r etwas mitgeteilt wer<strong>de</strong>n<br />
muß, abwesend ist, son<strong>de</strong>rn auch wenn die Sache sich zeitlich<br />
hinzieht (Zul). Wenn daher <strong>de</strong>r Kanon sagt, daß „keine<br />
Anklage schriftlich angenommen wer<strong>de</strong>n darf", so ist dies vom<br />
Abwesen<strong>de</strong>n zu verstehen, <strong>de</strong>r seine Anklage brieflich ein<br />
reicht. Dies schließt jedoch nicht aus, daß, wenn <strong>de</strong>r Ankläger<br />
anwesend ist, ein Schriftsatz verlangt wird.<br />
Zu 3. Wer anzeigt, verpflichtet sich nicht, Beweise vorzule<br />
gen. Deshalb wird er auch nicht bestraft, wenn er keine hat. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> ist für die Anzeige auch keine Nie<strong>de</strong>rschrift<br />
nötig, son<strong>de</strong>rn ausreichend, wenn die Anzeige <strong>de</strong>r kirchlichen<br />
Autorität mündlich vorgetragen wird, die dann von Amts<br />
wegen zusieht, daß <strong>de</strong>r Mitbru<strong>de</strong>r auf bessere Wege kommt<br />
[51].<br />
3. ARTIKEL<br />
Wird die Anklage ungerecht durch Verleumdung, Verheimlichung<br />
(praevaricatio) <strong>und</strong> Wi<strong>de</strong>rruf (tergiversatio)? [52]<br />
1. In <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 3 (Frdb 1,453) steht: „Verleum<strong>de</strong>n<br />
heißt falsche Verbrechen angeben". Doch bisweilen wirft<br />
jemand einem aus entschuldbarer Unkenntnis <strong>de</strong>r Tatsachen ein<br />
falsches Verbrechen vor. Also wird die Anklage im Fall von Ver<br />
leumdung nicht immer ungerecht.<br />
2. Ebendort heißt es: „Praevaricari be<strong>de</strong>utet: wahre Verbre<br />
chen verheimlichen". Doch dies scheint nicht unerlaubt zu sein,<br />
<strong>de</strong>nn man ist nicht gehalten, alle Verbrechen aufzu<strong>de</strong>cken, wie<br />
oben (Art. 1; 33,7) gesagt wur<strong>de</strong>. Also wird die Anklage durch<br />
eine <strong>de</strong>rartige Verheimlichung nicht ungerecht.<br />
3. Ebenfalls steht dort: „Tergiversari heißt: gänzlich von <strong>de</strong>r<br />
Anklage zurücktreten". Doch dies kann ohne Ungerechtigkeit<br />
geschehen; man liest dort nämlich weiter: „Reut es einen, über<br />
etwas nicht Beweisbares eine Strafklage eingereicht <strong>und</strong> schrift<br />
lich nie<strong>de</strong>rgelegt zu haben, so soll er sich mit <strong>de</strong>m Angeklagten<br />
verständigen, <strong>und</strong> die Sache ist beigelegt". Also wird die<br />
Anklage durch Wi<strong>de</strong>rruf nicht ungerecht.<br />
137
68. 3 DAGEGEN heißt es an <strong>de</strong>r gleichen Stelle: „Die Unbedacht<br />
samkeit <strong>de</strong>s Anklägers zeigt sich auf dreierlei Weise: entwe<strong>de</strong>r<br />
verleum<strong>de</strong>t er o<strong>de</strong>r er verheimlicht o<strong>de</strong>r er leistet Wi<strong>de</strong>rruf".<br />
ANTWORT. Wer eine Klage erhebt, möchte durch die<br />
Bekanntmachung <strong>de</strong>s Verbrechens <strong>de</strong>m Gemeinwohl einen<br />
Dienst erweisen. Niemand aber darf einem ungerecht Scha<strong>de</strong>n<br />
zufügen, um das Gemeinwohl zu för<strong>de</strong>rn. Daher wird die<br />
Anklage aus zweifachem Gr<strong>und</strong> sündhaft. Einmal durch unge<br />
rechtes Vorgehen gegen <strong>de</strong>n Angeklagten, in<strong>de</strong>m man ihn<br />
erf<strong>und</strong>ener Verbrechen bezichtigt, <strong>und</strong> das heißt „verleum<strong>de</strong>n".<br />
- Sodann im Hinblick auf <strong>de</strong>n Staat, <strong>de</strong>ssen Wohl man durch die<br />
Anklage hauptsächlich dienen will: eine solche Absicht wird<br />
zunichte, wenn man böswillig die Bestrafung <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> hinter<br />
treibt, was wie<strong>de</strong>rum auf zweifache Weise geschehen kann. Ein<br />
mal durch betrügerische Machenschaften in <strong>de</strong>r Anklage; dies<br />
fällt unter „Verheimlichung (praevaricatio) zugunsten <strong>de</strong>s<br />
Angeklagten", <strong>de</strong>nn „ein praevaricator ist gewissermaßen einer,<br />
<strong>de</strong>r, auf krummen Wegen geht', in<strong>de</strong>m er die eigene Sache verrät<br />
<strong>und</strong> es heimlich mit <strong>de</strong>r Gegenpartei hält" (ebda.). - Auf an<strong>de</strong>re<br />
Weise dadurch, daß man die Anklage völlig wi<strong>de</strong>rruft, <strong>und</strong> dies<br />
heißt „tergiversari", „<strong>de</strong>n Rücken wen<strong>de</strong>n", <strong>de</strong>nn wi<strong>de</strong>rruft<br />
jemand das, was er begonnen hat, so „wen<strong>de</strong>t er gleichsam <strong>de</strong>n<br />
Rücken".<br />
Zu 1. Man darf eine Anklage nur dann erheben, wenn man<br />
seiner Sache unbedingt sicher ist <strong>und</strong> keine Zweifel über die Tat<br />
sachen bestehen. Doch verleum<strong>de</strong>t nicht je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r einem<br />
fälschlich ein Verbrechen zur Last legt, son<strong>de</strong>rn nur, wer sich<br />
böswillig zu einer falschen Anklage hinreißen läßt. Es kommt<br />
nämlich bisweilen vor, daß jemand aus Leichtsinn zur Anklage<br />
schreitet, weil er in seiner Unbesonnenheit allzu leicht glaubt,<br />
was er hört. Bisweilen jedoch wird jemand auch durch einen un<br />
vermeidlichen Irrtum zur Klage veranlaßt. All dies hat ein klu<br />
ger Richter auseinan<strong>de</strong>rzuhalten, damit er nicht voreilig Ver<br />
leumdung vermutet, wo es sich nur um Leichtsinn han<strong>de</strong>lt o<strong>de</strong>r<br />
um falsche Anklage aufgr<strong>und</strong> unvermeidlichen Irrtums [53].<br />
Zu 2. Nicht je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r über wahre Verbrechen schweigt, ver<br />
heimlicht sie im vorliegen<strong>de</strong>n Sinn, son<strong>de</strong>rn nur, wenn er betrü<br />
gerisch verschweigt, was zu seiner Anklage gehört, <strong>und</strong> mit<br />
<strong>de</strong>m Angeklagten gemeinsame Sache macht, in<strong>de</strong>m er zu <strong>de</strong>s<br />
sen Gunsten Beweise unterschlägt <strong>und</strong> falsche Entlastungen<br />
zuläßt.<br />
138
Zu 3. „Wi<strong>de</strong>rrufen" heißt die Anklage zurückziehen, in<strong>de</strong>m 68.4<br />
man die Absicht anzuklagen völlig aufgibt, <strong>und</strong> zwar nicht<br />
irgendwie, son<strong>de</strong>rn auf eine rechtswidrige Weise. Einwandfrei<br />
kann jemand eine Anklage auf zweifache Art aufgeben. Einmal,<br />
wenn er im Verlauf <strong>de</strong>s Prozesses erkennt, daß seine Anklage<br />
nicht stimmt <strong>und</strong> Kläger <strong>und</strong> Angeklagter dann durch gegensei<br />
tige Übereinkunft die Sache für erledigt erklären. Sodann, wenn<br />
<strong>de</strong>r Fürst in seiner Sorge um das Gemeinwohl, <strong>de</strong>m ja die<br />
Anklage dienen wollte, das Verfahren einstellt.<br />
4. ARTIKEL<br />
Verfällt ein Ankläger, <strong>de</strong>r in seiner Beweisführung versagt, <strong>de</strong>r<br />
Strafe <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvergeltung? [54]<br />
1. Es kommt bisweilen vor, daß jemand aus unvermeidli<br />
chem Irrtum zur Anklage schreitet. In diesem Fall muß <strong>de</strong>r<br />
Richter <strong>de</strong>n Ankläger straflos ausgehen lassen, wie in <strong>de</strong>n<br />
Dekreten II, q. 3 (Frdb 1,454) gesagt wird. Der Ankläger, <strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>r Beweisführung versagt, unterliegt also nicht <strong>de</strong>r Strafe <strong>de</strong>r<br />
Wie<strong>de</strong>rvergeltung.<br />
2. Sollte die Strafe <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvergeltung <strong>de</strong>m ungerechten<br />
Ankläger auferlegt wer<strong>de</strong>n, dann wegen eines gegen jemand be<br />
gangenen Unrechts. Nicht aber wegen eines Unrechts gegen die<br />
Person <strong>de</strong>s Anklagten, <strong>de</strong>nn dann könnte <strong>de</strong>r Fürst diese Strafe<br />
nicht erlassen. Aber auch nicht wegen eines Unrechts gegen das<br />
Gemeinwesen, <strong>de</strong>nn dann könnte ihn <strong>de</strong>r Angeklagte nicht frei<br />
geben. Also gebührt <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Anklage versagt hat, nicht<br />
die Strafe <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvergeltung.<br />
3. Ein<strong>und</strong>dieselbe Sün<strong>de</strong> darf nicht mit doppelter Strafe ge<br />
ahn<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. So gemäß Nah 1,9: „Gott wird nicht zweimal<br />
verurteilen für dasselbe Vergehen" (Septuagintatext). Doch<br />
wer in <strong>de</strong>r Beweisführung versagt, zieht sich die Strafe <strong>de</strong>r Ehr<br />
losigkeit zu, die, wie es scheint, selbst <strong>de</strong>r Papst nicht erlassen<br />
kann gemäß <strong>de</strong>m Wort <strong>de</strong>s Papstes Gelasius: „Wenn wir auch<br />
die Seelen durch Buße retten können, am Verlust <strong>de</strong>r Ehre kön<br />
nen wir nichts än<strong>de</strong>rn". Also verdient <strong>de</strong>r Ankläger nicht auch<br />
noch die Strafe <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvergeltung.<br />
DAGEGEN steht das Wort <strong>de</strong>s Papstes Hadrian (In capitu-<br />
lari, c. 52; MansiXII,912): „Wer seinen Vorwurf nicht beweisen<br />
139
68. 4 kann, soll die <strong>de</strong>m Angeklagten zugedachte Strafe selbst erlei<br />
<strong>de</strong>n".<br />
ANTWORT. Wie oben (Art. 2) besprochen, gehört <strong>de</strong>r<br />
Ankläger im Klageprozeß zur Partei, die eine Bestrafung <strong>de</strong>s<br />
Angeklagten durchsetzen will. Die Aufgabe <strong>de</strong>s Richters jedoch<br />
besteht darin, <strong>de</strong>n rechtlichen Ausgleich zwischen bei<strong>de</strong>n her<br />
zustellen. Dies nun verlangt, daß einer <strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n er <strong>de</strong>m<br />
an<strong>de</strong>ren zugedacht hat, selbst erlei<strong>de</strong>t gemäß Ex 21,24: „Aug'<br />
um Auge, Zahn um Zahn". Somit ist es nur gerecht, daß, wer<br />
jeman<strong>de</strong>n durch seine Anklage in die Gefahr schwerer Bestra<br />
fung gebracht hat, selbst eine ähnliche Strafe erlei<strong>de</strong>t.<br />
Zu 1. Wie es bei Aristoteles im V.Buch seiner Ethik (c.8;<br />
1132 b 31) heißt, ist „Wie<strong>de</strong>rvergeltung" auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> schlechthin nicht immer angebracht, <strong>de</strong>nn viel<br />
kommt darauf an, ob einer <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren absichtlich o<strong>de</strong>r unfrei<br />
willig geschädigt hat. Was mit Absicht geschieht, verdient<br />
Strafe, <strong>de</strong>m Unfreiwilligen jedoch gebührt Nachsicht. Wenn<br />
daher <strong>de</strong>r Richter feststellt, daß einer jeman<strong>de</strong>n fälschlich ange<br />
klagt hat, ohne <strong>de</strong>n Willen zu scha<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn aus Unkenntnis<br />
aufgr<strong>und</strong> von unverschul<strong>de</strong>tem Irrtum <strong>und</strong> somit unabsicht<br />
lich, legt er ihm die Strafe <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvergeltung nicht auf.<br />
Zu 2. Wer böswillig anklagt, sündigt gegen die Person <strong>de</strong>s<br />
Angeklagten <strong>und</strong> auch gegen das Gemeinwesen. Daher wird er<br />
für bei<strong>de</strong>s bestraft. In diesem Sinn ist Dt 19,18 ff. zu verstehen:<br />
„Wenn sie (die Priester <strong>und</strong> Richter) nach sorgfältiger Untersu<br />
chung gef<strong>und</strong>en haben, daß <strong>de</strong>r falsche Zeuge gegen seinen<br />
Bru<strong>de</strong>r eine Lüge gesprochen hat, so sollen sie ihm antun, was<br />
er seinem Bru<strong>de</strong>r anzutun gedachte". Dies zum Unrecht gegen<br />
die Person; sodann zum Unrecht gegen das Gemeinwesen:<br />
„Und so sollst du das Böse aus <strong>de</strong>iner Mitte fortschaffen, damit<br />
die übrigen es hören <strong>und</strong> sich fürchten <strong>und</strong> nie mehr solches zu<br />
tun wagen". Insbeson<strong>de</strong>re jedoch geschieht bei falscher Anklage<br />
<strong>de</strong>r Person <strong>de</strong>s Angeklagten Unrecht. Daher kann <strong>de</strong>r Ange<br />
klagte, wenn er unschuldig ist, <strong>de</strong>m Kläger sein Unrecht verzei<br />
hen, vor allem, wenn dieser nicht verleum<strong>de</strong>risch, son<strong>de</strong>rn aus<br />
Gedankenlosigkeit gegen ihn vorgegangen ist. Verzichtet er<br />
nach Verabredung mit seinem Gegner auf Erhebung <strong>de</strong>r<br />
Anklage, bleibt aber <strong>de</strong>nnoch das Unrecht gegen das Gemein<br />
wesen, <strong>und</strong> dieses kann vom Angeklagten nicht vergeben wer<br />
<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn nur vom Fürsten, <strong>de</strong>r die Sorge für das Gemein<br />
wohl trägt.<br />
140
Zu 3. Der Ankläger verdient die Strafe <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvergel- 68. 4<br />
tung als Ausgleich für <strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n er <strong>de</strong>m Nächsten antun<br />
wollte. Die Strafe <strong>de</strong>s Ehrverlusts jedoch gebührt ihm wegen<br />
<strong>de</strong>r Bosheit seiner verleum<strong>de</strong>rischen Anklage. Bisweilen ver<br />
zichtet <strong>de</strong>r Fürst auf Bestrafung, läßt jedoch die Ehrlosigkeit<br />
weiter bestehen; manchmal aber hebt er auch diese auf. Daher<br />
kann auch <strong>de</strong>r Papst die Ehrlosigkeit aufheben, <strong>und</strong> jenes Wort<br />
<strong>de</strong>s Papstes Gelasius: „Ehrlosigkeit können wir nicht aufheben",<br />
ist zu verstehen entwe<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r tatbezogenen Ehrlosigkeit<br />
(infamia facti), o<strong>de</strong>r weil es bisweilen nicht ratsam ist, sie auf<br />
zuheben. O<strong>de</strong>r er spricht dort von <strong>de</strong>r Ehrlosigkeit, die <strong>de</strong>r<br />
weltliche Richter verhängt hat, wie Gratian sagt (Frdb 1,453)<br />
[55].<br />
141
69. FRAGE<br />
DIE SÜNDEN DES ANGEKLAGTEN<br />
GEGEN DIE GERECHTIGKEIT<br />
Nun ist über die Sün<strong>de</strong>n zu re<strong>de</strong>n, die vom Angeklagten<br />
gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> begangen wer<strong>de</strong>n. Dabei stellen sich<br />
vier Fragen:<br />
1. Begeht einer eine Todsün<strong>de</strong> durch Leugnen <strong>de</strong>r Wahrheit,<br />
die seine Verurteilung zur Folge hätte?<br />
2. Darf man sich mit unredlichen Mitteln verteidigen?<br />
3. Ist es erlaubt, Berufung einzulegen, um <strong>de</strong>r Verurteilung<br />
zu entgehen?<br />
4. Darf sich ein Verurteilter mit Gewalt wehren, wenn er die<br />
Möglichkeit dazu hat?<br />
1. ARTIKEL<br />
Kann <strong>de</strong>r Angeklagte, ohne eine Todsün<strong>de</strong> zu begehen, die<br />
Wahrheit leugnen, die seine Verurteilung zur Folge hätte?<br />
1. Cbrysostomus schreibt (Horn. 31 zum Hebräerbrief;<br />
MG 63,216): „Ich sage dir nicht, du sollest dich öffentlich bloß<br />
stellen o<strong>de</strong>r dich bei einem anklagen." Wenn jedoch ein Ange<br />
klagter vor Gericht mit <strong>de</strong>r Wahrheit herausrückte, wür<strong>de</strong> er<br />
sich bloßstellen <strong>und</strong> anklagen. Also ist er nicht gehalten, die<br />
Wahrheit zu sagen, <strong>und</strong> darum sündigt er auch nicht schwer,<br />
wenn er vor Gericht lügt.<br />
2. Wie es eine Gefälligkeitslüge ist, wenn jemand die<br />
Unwahrheit sagt, um einen vor <strong>de</strong>m Tod zu retten, so ist es auch<br />
eine Gefälligkeitslüge, wenn jemand lügt, um dadurch selbst<br />
<strong>de</strong>m Tod zu entgehen, <strong>de</strong>nn man ist sich selber mehr schuldig<br />
als an<strong>de</strong>ren. Die Gefälligkeitslüge wird jedoch nicht als Tod<br />
sün<strong>de</strong> angesehen, son<strong>de</strong>rn gilt als läßlich. Also sündigt ein<br />
Angeklagter nicht schwer, wenn er vor Gericht die Wahrheit<br />
leugnet, um <strong>de</strong>m Tod zu entgehen.<br />
3. Je<strong>de</strong> Todsün<strong>de</strong> ist gegen die Caritas gerichtet (vgl. 24,12).<br />
Wenn nun ein Angeklagter lügt, in<strong>de</strong>m er die Verantwortung für<br />
ein ihm vorgeworfenes Vergehen von sich weist, richtet sich dies<br />
nicht gegen die Caritas, d. h. we<strong>de</strong>r gegen die Liebe zu Gott,<br />
142
noch gegen die Liebe zum Nächsten. Also ist eine <strong>de</strong>rartige 69. l<br />
Lüge keine Todsün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN steht: alles, was <strong>de</strong>r Ehre Gottes zuwi<strong>de</strong>rläuft,<br />
ist Todsün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn wir sind verpflichtet, „alles zur Ehre Gottes<br />
zu tun", wie es 1 Kor 10,31 heißt. Nun han<strong>de</strong>lt <strong>de</strong>r Angeklagte<br />
zur Ehre Gottes, wenn er bekennt, was gegen ihn steht. Dies<br />
drückt ganz <strong>de</strong>utlich das Wort <strong>de</strong>s Josue an Achar aus (Jos 7,19):<br />
„Mein Sohn, gib <strong>de</strong>m Herrn, <strong>de</strong>m Gott Israels, die Ehre <strong>und</strong><br />
bekenne <strong>und</strong> zeige mir an, was du getan hast, <strong>und</strong> verheimliche<br />
es nicht." Wer also mit einer Falschaussage seine Sün<strong>de</strong> leugnet,<br />
begeht eine Todsün<strong>de</strong>.<br />
ANTWORT. Wer immer gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> verstößt,<br />
begeht eine Todsün<strong>de</strong>, wie oben (59,4) dargelegt wur<strong>de</strong>. Nun<br />
verlangt die <strong>Gerechtigkeit</strong>, <strong>de</strong>m Vorgesetzten in <strong>de</strong>m, was zu<br />
<strong>de</strong>ssen Amtsbereich gehört, Gehorsam zu leisten. Der Richter<br />
aber ist, wie bemerkt (67,1), Vorgesetzter <strong>de</strong>ssen, <strong>de</strong>r gerichtet<br />
wird. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist <strong>de</strong>r Angeklagte verpflichtet, <strong>de</strong>m<br />
Richter die Wahrheit, wie er sie in rechtlicher Form verlangt,<br />
offenzulegen [56]. Wenn er also die Wahrheit, die er zu sagen<br />
hat, nicht preisgeben will o<strong>de</strong>r sie lügenhaft leugnet, sündigt er<br />
schwer. Stellt <strong>de</strong>r Richter jedoch Fragen außerhalb <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>s<br />
ordnung, so braucht ihm <strong>de</strong>r Angeklagte nicht zu antworten,<br />
son<strong>de</strong>rn kann sich entwe<strong>de</strong>r durch Berufung o<strong>de</strong>r auf eine<br />
an<strong>de</strong>re einwandfreie Weise aus seiner Lage herauswin<strong>de</strong>n.<br />
Lügen jedoch darf er nicht.<br />
Zu 1. Wer vom Richter <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung gemäß gefragt<br />
wird, stellt sich nicht selber bloß, son<strong>de</strong>rn wird von einem an<strong>de</strong><br />
ren bloßgestellt, insofern ihm <strong>de</strong>r, <strong>de</strong>m er gehorchen muß, die<br />
Antworten abnötigt.<br />
Zu 2. Lügen, um einen aus To<strong>de</strong>snot zu retten, in<strong>de</strong>m man<br />
einem Dritten Unrecht tut, ist keine schlichte Gefälligkeitslüge,<br />
son<strong>de</strong>rn hat etwas Bösartiges an sich. Wenn nun jemand vor<br />
Gericht zu seiner Entlastung lügt, tut er <strong>de</strong>m Unrecht, <strong>de</strong>m er<br />
zum Gehorsam verpflichtet ist, in<strong>de</strong>m er ihm verweigert, was er<br />
ihm schul<strong>de</strong>t, nämlich das Bekenntnis <strong>de</strong>r Wahrheit.<br />
Zu 3. Wer vor Gericht zu seiner Entschuldigung lügt, han<br />
<strong>de</strong>lt sowohl gegen die Liebe zu Gott, „<strong>de</strong>ssen das Gericht ist"<br />
[Dt 1,17], als auch gegen die Liebe zum Nächsten, <strong>und</strong> dies ein<br />
mal im Hinblick auf <strong>de</strong>n Richter, <strong>de</strong>m er das Geschul<strong>de</strong>te ver<br />
weigert, sodann im Hinblick auf <strong>de</strong>n Ankläger, <strong>de</strong>r bestraft<br />
wird, wenn er in seiner Beweisführung versagt. Daher heißt es<br />
143
69.2 im Ps 140,4: „Laß mein Herz sich nicht boshaften Dingen<br />
zuneigen, um Entschuldigungen zu suchen für meine Sün<strong>de</strong>n."<br />
Dazu bemerkt die Glosse (ML 70,1001): „Dies ist bei <strong>de</strong>n Un<br />
verschämten Sitte, daß sie sich, wenn sie ertappt wer<strong>de</strong>n, mit<br />
irgendwelchen Lügen herausre<strong>de</strong>n." Und Gregor schreibt in<br />
seinen Moralia (22,15; ML 76,230) bei <strong>de</strong>r Erklärung <strong>de</strong>r Job<br />
stelle 31,33 „Nicht verhehlte ich nach Menschenweise meine<br />
Sün<strong>de</strong>": „Es ist ein Gewohnheitslaster <strong>de</strong>r Menschen, heimlich<br />
Sün<strong>de</strong>n zu begehen <strong>und</strong> sie dann durch Leugnen zu vertuschen<br />
<strong>und</strong>, wenn sie überführt sind, sie bei <strong>de</strong>r Verteidigung noch zu<br />
vermehren."<br />
2. ARTIKEL<br />
Darf sich <strong>de</strong>r Angeklagte mit unredlichen Mitteln verteidigen?<br />
1. Nach <strong>de</strong>m bürgerlichen <strong>Recht</strong> (KRII, 96 a) darf im<br />
<strong>Recht</strong>sverfahren über to<strong>de</strong>swürdige Missetaten je<strong>de</strong>r seinen<br />
Gegner bestechen. Doch dies be<strong>de</strong>utet, sich im höchsten Grad<br />
mit allen Schikanen verteidigen. Also sündigt <strong>de</strong>r Angeklagte<br />
nicht, wenn er sich mit unredlichen Mitteln zur Wehr setzt.<br />
2. „Der Ankläger, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Angeklagten gemeinsame<br />
Sache macht, erhält die vom Gesetz bestimmte Strafe", wie es in<br />
<strong>de</strong>n Dekreten II,q. 3 (Frdbl,453) heißt. Dem Angeklagten<br />
jedoch wird keine Strafe auferlegt, wenn er mit <strong>de</strong>m Ankläger<br />
gemeinsame Sache macht. Also darf sich <strong>de</strong>r Angeklagte mit<br />
unredlichen Mitteln verteidigen.<br />
3. Spr 14,16 heißt es: „Der Weise fürchtet <strong>und</strong> mei<strong>de</strong>t das<br />
Böse; <strong>de</strong>r Tor setzt sich darüber hinweg <strong>und</strong> fühlt sich sicher."<br />
Was aber aus Weisheit geschieht, ist keine Sün<strong>de</strong>. Also sündigt<br />
nicht, wer mit welchen Mitteln auch immer sich ein Übel vom<br />
Hals zu schaffen sucht.<br />
DAGEGEN steht, daß man auch in einem Strafprozeß <strong>de</strong>n<br />
Kalumnieneid [57] ablegen muß (Extra; FrdbII,265). Dies<br />
wäre nicht <strong>de</strong>r Fall, wenn sich <strong>de</strong>r Angeklagte mit allen Schika<br />
nen verteidigen dürfte.<br />
ANTWORT. Etwas an<strong>de</strong>res ist die Wahrheit verschweigen,<br />
<strong>und</strong> etwas an<strong>de</strong>res Falsches behaupten. Das erste geht in gewis<br />
sen Fällen hin, <strong>de</strong>nn niemand muß alle Wahrheit sagen, son<strong>de</strong>rn<br />
nur jene, die <strong>de</strong>r Richter entsprechend <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung von<br />
ihm verlangen kann <strong>und</strong> muß. So z. B. wenn üble Nachre<strong>de</strong><br />
144
vorausgegangen ist o<strong>de</strong>r ein<strong>de</strong>utige Verdachtsgrün<strong>de</strong> vorliegen 69. 2<br />
o<strong>de</strong>r die Sache schon halbwegs bewiesen ist. Etwas Falsches<br />
behaupten darf man jedoch auf keinen Fall.<br />
Was aber erlaubt ist, kann entwe<strong>de</strong>r auf einwandfreien <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>m erstrebten Zweck angemessenen Wegen unternommen<br />
wer<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> dies gehört zur Klugheit; o<strong>de</strong>r auf unerlaubten<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>m beabsichtigten Zweck unangemessenen Wegen, <strong>und</strong><br />
dies gehört zur Schläue, die sich durch Betrug <strong>und</strong> List aus<br />
zeichnet (55,3 ff.). Der erste Weg ist lobenswert, <strong>de</strong>r zweite ist<br />
sündhaft. So darf sich also <strong>de</strong>r schuldige Angeklagte verteidi<br />
gen, in<strong>de</strong>m er die Wahrheit, die er nicht zu bekennen braucht,<br />
auf unta<strong>de</strong>lige Weise verschweigt, z. B. dadurch, daß er nicht<br />
antwortet, worauf er nicht zu antworten braucht. Dies hat mit<br />
unredlicher Verteidigung nichts zu tun, son<strong>de</strong>rn heißt einfach,<br />
sich mit Klugheit in Sicherheit bringen. - Nicht jedoch darf er<br />
Falsches aussagen o<strong>de</strong>r die Wahrheit verschweigen, die er<br />
pflichtgemäß bekennen muß; auch darf er nicht Betrug o<strong>de</strong>r<br />
List anwen<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn Betrug <strong>und</strong> List kommen <strong>de</strong>r Lüge gleich,<br />
<strong>und</strong> das heißt, sich mit unredlichen Mitteln aus <strong>de</strong>r Gefahr zie<br />
hen.<br />
Zu 1. Die menschlichen Gesetze lassen vieles ungestraft,<br />
was nach <strong>de</strong>m göttlichen Gericht Sün<strong>de</strong> ist, wie dies z. B. bei <strong>de</strong>r<br />
Unzucht unter Ledigen <strong>de</strong>r Fall ist. Das menschliche Gesetz<br />
verlangt nämlich vom Menschen nicht vollen<strong>de</strong>te Tugend, die<br />
nur Sache von wenigen ist <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r großen Masse, wie das<br />
menschliche Gesetz sie notwendig ertragen muß, nicht durch<br />
wegs gef<strong>und</strong>en wer<strong>de</strong>n kann. Daß aber jemand in einem<br />
<strong>Recht</strong>sverfahren über to<strong>de</strong>swürdige Verbrechen <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong><br />
wi<strong>de</strong>rsteht, die <strong>de</strong>n Schuldigen vor <strong>de</strong>m leiblichen Tod retten<br />
könnte, ist wahrlich vollen<strong>de</strong>te Tugend, <strong>de</strong>nn „das Schreck<br />
lichste von allem auf <strong>de</strong>r Welt ist <strong>de</strong>r Tod", heißt es im III. Buch<br />
<strong>de</strong>r Ethik (c.9; 1115 a26). Wenn nun <strong>de</strong>r Schuldige in einem<br />
solchen Verfahren seinen Gegner besticht, sündigt er zwar, weil<br />
er ihn zu einer unsauberen Sache verführt, doch im bürgerlichen<br />
Gesetz ist dafür keine Strafe vorgesehen. Und insofern läßt sich<br />
sagen, es sei erlaubt.<br />
Zu 2. Der Ankläger, <strong>de</strong>r mit einem schuldigen Angeklagten<br />
gemeinsame Sache macht, verfällt <strong>de</strong>r Strafe. Dies ist ein klarer<br />
Beweis dafür, daß er sündigt. Da es nun Sün<strong>de</strong> ist, jeman<strong>de</strong>n zur<br />
Sün<strong>de</strong> zu verführen o<strong>de</strong>r sonstwie an einer Sün<strong>de</strong> teilzuhaben -<br />
<strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s würdig seien, die <strong>de</strong>n Sün<strong>de</strong>rn zustimmen, sagt <strong>de</strong>r<br />
145
69. 3 Apostel [Rom 1,32] -, sündigt offensichtlich auch <strong>de</strong>r Ange<br />
klagte, wenn er mit <strong>de</strong>m Gegner gemeinsame Sache macht.<br />
Dennoch zieht er sich nach <strong>de</strong>n menschlichen Gesetzen aus<br />
<strong>de</strong>m erwähnten Gr<strong>und</strong> keine Strafe zu.<br />
Zu 3. Der Weise braucht we<strong>de</strong>r List noch Tücke, um etwas<br />
zu verbergen, er bringt das mit Klugheit zuwege [58].<br />
3. ARTIKEL<br />
Darf <strong>de</strong>r Schuldige Berufung einlegen, um <strong>de</strong>r Verurteilung zu<br />
entgehen?<br />
1. Der Apostel schreibt Rom 13,1: „Je<strong>de</strong>rmann unterwerfe<br />
sich <strong>de</strong>n obrigkeitlichen Gewalten." Doch <strong>de</strong>r Schuldige, <strong>de</strong>r<br />
Berufung einlegt, lehnt es ab, sich <strong>de</strong>r obrigkeitlichen Gewalt -<br />
das ist hier <strong>de</strong>r Richter - zu unterwerfen. Also sündigt er.<br />
2. Stärker ist die bin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Autorität <strong>de</strong>r or<strong>de</strong>ntlichen<br />
Gewalt als die eines selbst gewählten Richters. In <strong>de</strong>n Dekreten<br />
II,q. 6 (Frdbl,478) aber steht zu lesen: „Es ist nicht erlaubt,<br />
über die Köpfe <strong>de</strong>r gemeinsam (von bei<strong>de</strong>n Parteien) gewählten<br />
Richter hinweg Berufung einzulegen." Also ist dies noch viel<br />
weniger <strong>de</strong>n or<strong>de</strong>ntlichen Richtern gegenüber erlaubt.<br />
3. Was einmal erlaubt ist, ist immer erlaubt. Doch ist nicht<br />
erlaubt, noch nach <strong>de</strong>m zehnten Tag Berufung einzulegen<br />
(Frdb 1,474), <strong>und</strong> auch nicht, dreimal in <strong>de</strong>r gleichen Sache<br />
(Frdbl,481). Also ist Berufung an sich nicht erlaubt.<br />
DAGEGEN steht, daß Paulus Berufung beim Kaiser eingelegt<br />
hat (Apg25,ll).<br />
ANTWORT. Aus zwei Grün<strong>de</strong>n kann jemand Berufung ein<br />
legen. Einmal im Vertrauen auf die gerechte Sache nach unge<br />
rechter Verurteilung durch <strong>de</strong>n Richter. In diesem Fall ist Beru<br />
fung erlaubt, <strong>de</strong>nn dies heißt, sich in kluger Weise <strong>de</strong>r Verurtei<br />
lung entziehen. Daher steht in <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 6<br />
(Frdb 1,467): „Je<strong>de</strong>r Unterdrückte kann nach Belieben frei das<br />
Gericht <strong>de</strong>r Priester anrufen, <strong>und</strong> niemand darf ihn daran hin<br />
<strong>de</strong>rn."<br />
Sodann legt jemand Berufung ein, um Zeit zu gewinnen <strong>und</strong><br />
die gerechte Verurteilung hinauszuzögern. Dies ist schikanöse<br />
Verteidigungstaktik <strong>und</strong>, wie oben bemerkt, unerlaubt. Sie<br />
be<strong>de</strong>utet nämlich Unrecht sowohl gegen <strong>de</strong>n Richter, <strong>de</strong>m er in<br />
<strong>de</strong>r Ausübung seines Amtes Schwierigkeiten macht, als auch<br />
146
gegen seinen Kontrahenten, <strong>de</strong>ssen <strong>Recht</strong>sansprüche er zu ver- 69. 3<br />
wirren sucht. Deshalb ist nach <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 6 (Frdbl, 473)<br />
„unbedingt zu bestrafen, wer eine ungerechtfertigte Berufung<br />
eingereicht hat".<br />
Zu 1. Einer untergeordneten Gewalt muß man sich insoweit<br />
fügen, als sie die über ihr stehen<strong>de</strong> Ordnung beachtet. Sobald<br />
sie davon abrückt, ist die Unterordnung zu been<strong>de</strong>n, z. B.<br />
„wenn <strong>de</strong>r Prokonsul etwas an<strong>de</strong>res befiehlt als <strong>de</strong>r Kaiser", wie<br />
die Glosse zu Rom 13 (ML 191,1505) bemerkt. Wenn nun ein<br />
Richter jeman<strong>de</strong>n ungerecht verurteilt, so verläßt er hierin die<br />
Ordnung <strong>de</strong>r übergeordneten Gewalt, die ihn beauftragt hat,<br />
unbedingt nach <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> zu richten. Daher ist<br />
es <strong>de</strong>m ungerecht Verurteilten erlaubt, die höher stehen<strong>de</strong><br />
Instanz anzurufen, sei es vor, sei es nach <strong>de</strong>r Verkündung <strong>de</strong>s<br />
Urteils. - Und weil anzunehmen ist, daß dort, wo <strong>de</strong>r wahre<br />
Glaube fehlt, auch kein richtiges Verhältnis zu <strong>de</strong>m, was gerecht<br />
ist, besteht, darf ein Katholik nicht an einen ungläubigen Rich<br />
ter Berufung einlegen gemäß <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 6 (Frdb 1,478):<br />
„Ein Katholik, <strong>de</strong>r seine Klage, sei sie gerecht o<strong>de</strong>r ungerecht,<br />
vor das Gericht eines an<strong>de</strong>rsgläubigen Richters zieht, sei <strong>de</strong>m<br />
Banne verfallen" (verliert seine kirchlichen <strong>Recht</strong>e). Denn auch<br />
<strong>de</strong>r Apostel ta<strong>de</strong>lt jene, die ihre Streitsachen vor <strong>de</strong>m Gericht<br />
<strong>de</strong>r Ungläubigen austrugen [1 Kor 6,1].<br />
Zu 2. Wer sich einem Gericht unterwirft, <strong>de</strong>ssen <strong>Recht</strong>spre<br />
chung er nicht traut, hat dies seiner eigenen Sorglosigkeit<br />
zuzuschreiben. Auch scheint es mit <strong>de</strong>r Standfestigkeit <strong>de</strong>ssen<br />
nicht weit her zu sein, <strong>de</strong>r nicht bei <strong>de</strong>m bleibt, was er einmal für<br />
gut bef<strong>und</strong>en hat. Daher wird ihm das Hilfsmittel <strong>de</strong>r Berufung<br />
gegen die selbstgewählten Richter, die ihre Vollmacht nur aus<br />
<strong>de</strong>r Ubereinkunft <strong>de</strong>r streiten<strong>de</strong>n Parteien besitzen, verweigert.<br />
- Die Vollmacht <strong>de</strong>s or<strong>de</strong>ntlichen Richters jedoch hängt nicht<br />
von <strong>de</strong>r Zustimmung <strong>de</strong>ssen ab, <strong>de</strong>r sich seinem Gericht unter<br />
wirft, son<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>r Autorität <strong>de</strong>s berufen<strong>de</strong>n Königs o<strong>de</strong>r<br />
Fürsten. Daher gewährt das Gesetz gegen seine ungerechte<br />
Entscheidung das Hilfsmittel <strong>de</strong>r Berufung, so daß man, auch<br />
wenn er or<strong>de</strong>ntlicher <strong>und</strong> selbstgewählter Richter zugleich ist,<br />
gegen ihn Berufung einlegen kann. Denn die or<strong>de</strong>ntliche Voll<br />
macht scheint <strong>de</strong>r Anlaß dazu zu sein, ihn zum Schiedsrichter<br />
zu wählen. Und es darf <strong>de</strong>m kein Nachteil entstehen, <strong>de</strong>r sich<br />
für <strong>de</strong>n als Schiedsrichter entschei<strong>de</strong>n wollte, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Fürst<br />
mit or<strong>de</strong>ntlicher Vollmacht ausgestattet hat.<br />
147
69. 4 Zu 3. Der Ausgleich <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s kommt <strong>de</strong>r einen Partei so<br />
zugute, daß <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren kein Nachteil entsteht. Daher gewährt<br />
es zur Berufung eine Frist von zehn Tagen, während <strong>de</strong>r man<br />
genügsam überlegen kann, ob sich eine Berufung lohnt. Gäbe<br />
es jedoch für die Berufung keine Zeitbeschränkung, bliebe die<br />
endgültige Entscheidung zum Nachteil <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite end<br />
los in <strong>de</strong>r Schwebe. - Niemand darf ein drittes Mal in <strong>de</strong>r glei<br />
chen Sache Berufung einlegen, weil es unwahrscheinlich ist, daß<br />
die Richter so oft das richtige Urteil verfehlen.<br />
4. ARTIKEL<br />
Darf sich ein zum Tod Verurteilter verteidigen, wenn er kann?<br />
1. Das, wozu die Natur uns hintreibt, ist immer erlaubt, es<br />
besitzt gleichsam <strong>de</strong>n Charakter eines Naturrechts. Nun wen<br />
<strong>de</strong>t sich die Natur instinktiv gegen das Zerstörerische, nicht nur<br />
bei Menschen <strong>und</strong> Tieren, son<strong>de</strong>rn auch bei nicht sinnbegabten<br />
Wesen. Also ist es <strong>de</strong>m Verurteilten erlaubt, sich zu wehren,<br />
wenn er kann, damit er nicht <strong>de</strong>m Tod ausgeliefert wird.<br />
2. Wie sich jemand <strong>de</strong>m To<strong>de</strong>surteil durch Wi<strong>de</strong>rstand ent<br />
ziehen kann, so auch durch Flucht. Doch durch Flucht darf man<br />
sich aus To<strong>de</strong>sgefahr befreien gemäß <strong>de</strong>m Wort Sir 9,18: „Halte<br />
dich fern von einem Menschen, <strong>de</strong>r die Macht hat zu töten, aber<br />
nicht, lebendig zu machen." Also ist es auch erlaubt, Wi<strong>de</strong>r<br />
stand zu leisten.<br />
3. Spr24,11 heißt es: „Rette, die man zum To<strong>de</strong> führt, <strong>und</strong><br />
unterlaß nicht, die zu befreien, die man zum Untergang<br />
schleppt." Nun schul<strong>de</strong>t man sich selbst mehr als an<strong>de</strong>ren. Also<br />
ist es einem Verurteilten erlaubt, sich zu wehren, daß er nicht<br />
<strong>de</strong>m Tod ausgeliefert wird.<br />
DAGEGEN sagt <strong>de</strong>r Apostel Rom 13,2: „Wer sich <strong>de</strong>r staatli<br />
chen Gewalt wi<strong>de</strong>rsetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes,<br />
<strong>und</strong> wer sich ihm entgegenstellt, wird <strong>de</strong>m Gericht verfallen."<br />
Nun leistet <strong>de</strong>r Verurteilte, <strong>de</strong>r sich wehrt, <strong>de</strong>r staatlichen<br />
Gewalt gera<strong>de</strong> darin Wi<strong>de</strong>rstand, wozu sie von Gott eingesetzt<br />
wur<strong>de</strong>, nämlich „zur Bestrafung <strong>de</strong>r Bösen <strong>und</strong> zur Belobigung<br />
<strong>de</strong>r Guten" [IPetr 2,14]. Also sündigt er, wenn er sich ver<br />
teidigt.<br />
ANTWORT. Die Verurteilung zum Tod ist auf zweifache<br />
Weise möglich. Einmal gerecht, <strong>und</strong> dann darf sich <strong>de</strong>r Ver-<br />
148
urteilte nicht dagegen zur Wehr setzen. Tut er es <strong>de</strong>nnoch, ist es 69. 4<br />
<strong>de</strong>m Richter erlaubt, seinen Wi<strong>de</strong>rstand zu brechen, <strong>de</strong>nn vom<br />
Verbrecher aus gesehen han<strong>de</strong>lt es sich um einen ungerechten<br />
Krieg. Daher versündigt er sich ohne Zweifel.<br />
An<strong>de</strong>rs liegt <strong>de</strong>r Fall bei ungerechter Verurteilung. Ein sol<br />
ches Urteil gleicht einem Gewaltakt nach Räuberart, so wie es<br />
bei Ez 22,27 steht: „Die Fürsten in seiner Mitte, sind wie Beute<br />
rauben<strong>de</strong> Wölfe, nur darauf bedacht, Blut zu vergießen." Wie<br />
man nun <strong>de</strong>n Räubern Wi<strong>de</strong>rstand leisten darf, so ist es auch<br />
erlaubt, sich gegen schlechte Fürsten zur Wehr zu setzen, es sei<br />
<strong>de</strong>nn, ein Ärgernis, in <strong>de</strong>ssen Gefolge schwere Verwirrung zu<br />
befürchten wäre, müßte vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
Zu 1. Der Mensch besitzt die Gabe <strong>de</strong>r Vernunft, damit er<br />
seinen natürlichen Neigungen nicht nur irgendwie, son<strong>de</strong>rn mit<br />
Überlegung nachgeht. Daher ist Selbstverteidigung nicht auf<br />
jedwe<strong>de</strong> Art <strong>und</strong> Weise erlaubt, son<strong>de</strong>rn nur nach <strong>de</strong>n Regeln<br />
einer abgewogenen Sch<strong>utz</strong>maßnahme.<br />
Zu 2. Keiner wird dazu verurteilt, sich selbst <strong>de</strong>n Tod zu<br />
geben, son<strong>de</strong>rn daß er <strong>de</strong>n Tod erlei<strong>de</strong>. Daher braucht er nicht<br />
zu tun, was <strong>de</strong>n Tod nach sich zöge,z. B. an <strong>de</strong>m Ort zu bleiben,<br />
von <strong>de</strong>m aus er zur Hinrichtung geführt wird. Jedoch darf er<br />
sich <strong>de</strong>m Henker nicht wi<strong>de</strong>rsetzen, um nicht zu erlei<strong>de</strong>n, was<br />
er nach <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> zu erlei<strong>de</strong>n hat. Doch sündigt<br />
ein zum Hungertod Verurteilter nicht, wenn er heimlich ihm<br />
zugesteckte Speise annimmt, <strong>de</strong>nn nicht annehmen wäre soviel<br />
wie Selbstmord.<br />
Zu 3. Jener Spruch <strong>de</strong>s Weisen will nicht dazu verleiten,<br />
jeman<strong>de</strong>n gegen die <strong>Recht</strong>sordnung vom Tod zu erretten.<br />
Daher darf sich auch niemand selbst durch Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r Hin<br />
richtung entziehen.<br />
149
70. FRAGE<br />
DIE VERSTÖSSE<br />
GEGEN DIE GERECHTIGKEIT<br />
DURCH DEN ZEUGEN.<br />
Hierauf sind die Verstöße gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>, die <strong>de</strong>r<br />
Zeuge begeht, ins Auge zu fassen. Dabei ergeben sich vier Fra<br />
gen:<br />
1. Ist man zur Zeugenaussage verpflichtet?<br />
2. Genügen zwei o<strong>de</strong>r drei Zeugen?<br />
3. Kann man die Aussage eines Zeugen zurückweisen, ohne<br />
daß bei diesem ein schuldhaftes Vergehen vorliegt?<br />
4. Ist falsches Zeugnis Todsün<strong>de</strong>?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist man zur Zeugenaussage verpflichtet?<br />
1. Augustinus schreibt in seinen „Fragen zur Genesis [zum<br />
Heptateuch]" (1,26; ML 34,554), daß Abraham, als er von sei<br />
ner Frau sagte: „Es ist meine Schwester", nicht log, son<strong>de</strong>rn nur<br />
die Wahrheit verbergen wollte. Wer aber die Wahrheit verbirgt,<br />
legt kein Zeugnis ab. Also ist man nicht verpflichtet, Zeugen<br />
aussage zu machen.<br />
2. Niemand ist verpflichtet, trügerisch zu han<strong>de</strong>ln. Doch<br />
Spr 11,13 heißt es: „Wer trügerisch wan<strong>de</strong>lt, <strong>de</strong>ckt Geheimnisse<br />
auf, wer aber treu ist, verbirgt, was <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong> ihm anvertraut<br />
hat". Also ist man nicht immer zur Zeugenaussage verpflichtet,<br />
beson<strong>de</strong>rs über Dinge, die einem <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong> unter vier Augen<br />
anvertraut hat.<br />
3. Kleriker <strong>und</strong> Priester sind mehr als an<strong>de</strong>re zu <strong>de</strong>m ver<br />
pflichtet, was zum ewigen Heil notwendig ist. Doch ist es ihnen<br />
nicht gestattet, in <strong>Recht</strong>sverfahren über to<strong>de</strong>swürdige Misseta<br />
ten Zeugnis abzulegen. Also ist Zeugnisgeben zum ewigen Heil<br />
nicht notwendig.<br />
DAGEGEN sagt Augustinus (Frdbl,665; 11,817): „Wer die<br />
Wahrheit verheimlicht <strong>und</strong> wer eine Lüge sagt, ist schuldig; <strong>de</strong>r<br />
eine, weil er nicht helfen will, <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re, weil er scha<strong>de</strong>n<br />
möchte".<br />
150
ANTWORT. Bei <strong>de</strong>r Zeugenaussage ist zu unterschei<strong>de</strong>n. 70. 1<br />
Denn bisweilen wird sie verlangt, bisweilen nicht. Wird die Zeu<br />
genaussage eines Untergebenen aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Autorität <strong>de</strong>s<br />
Vorgesetzten verlangt, <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Untergebene im <strong>Recht</strong>sbereich<br />
Gehorsam schul<strong>de</strong>t, so ist dieser ohne Zweifel zur Zeugnisab<br />
gabe über alles verpflichtet, was im Rahmen <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung<br />
diesbezüglich von ihm erwartet wer<strong>de</strong>n kann, z. B. über offen<br />
k<strong>und</strong>ige Verbrechen o<strong>de</strong>r über solche, <strong>de</strong>nen üble Nachre<strong>de</strong><br />
vorausging. Wür<strong>de</strong> man von ihm aber Zeugenaussage über<br />
an<strong>de</strong>re Dinge verlangen, z. B. über geheime Tatsachen o<strong>de</strong>r<br />
solche, die noch nicht durch üble Nachre<strong>de</strong> in die Öffentlichkeit<br />
gedrungen sind, dann ist er zur Zeugenaussage nicht verpflich<br />
tet.<br />
Wird er jedoch nicht aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Autorität eines Vorgesetz<br />
ten, <strong>de</strong>m er Gehorsam schul<strong>de</strong>t, um Zeugenaussage ersucht, so<br />
muß man wie<strong>de</strong>rum unterschei<strong>de</strong>n. Ist sein Zeugnis erfor<strong>de</strong>r<br />
lich, um ungerechten Tod o<strong>de</strong>r irgen<strong>de</strong>ine Strafe, verleum<strong>de</strong>ri<br />
schen Leum<strong>und</strong> o<strong>de</strong>r auch ungerecht zugefügten Scha<strong>de</strong>n von<br />
jeman<strong>de</strong>m abzuwen<strong>de</strong>n, so wird Zeugenaussage zur Pflicht.<br />
Verlangt niemand sein Zeugnis, muß er sein Möglichstes tun,<br />
um die Wahrheit einer Person anzuvertrauen, die in <strong>de</strong>r Sache<br />
nützlich sein kann. Es steht ja im Ps81,4 geschrieben: „Rettet<br />
<strong>de</strong>n Armen <strong>und</strong> befreit <strong>de</strong>n Hilflosen aus <strong>de</strong>r Hand <strong>de</strong>s Sün<br />
<strong>de</strong>rs", <strong>und</strong> Spr24,11: „Errette die, welche zum To<strong>de</strong> geführt<br />
wer<strong>de</strong>n." Und Rom 1,32 heißt es: „Den Tod verdienen nicht<br />
nur, die solches tun, son<strong>de</strong>rn auch, die <strong>de</strong>n Übeltätern noch<br />
Beifall spen<strong>de</strong>n." Dazu bemerkt die Glosse (ML 191,1337):<br />
„Schweigen, wo du einen Gegenbeweis führen könntest, heißt<br />
zustimmen."<br />
Über das jedoch, was zur Verurteilung eines Menschen führt,<br />
braucht niemand eine Zeugenaussage zu machen, höchstens<br />
wenn er nach <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung von seinem Vorgesetzten<br />
dazu gedrängt wird. Denn ein Verschweigen <strong>de</strong>r Wahrheit wirkt<br />
sich in einem solchen Fall zu keines Menschen beson<strong>de</strong>rem<br />
Scha<strong>de</strong>n aus. Auch braucht man sich um das Risiko für <strong>de</strong>n<br />
Ankläger nicht zu kümmern, <strong>de</strong>nn er ist es ja aus freien Stücken<br />
eingegangen. An<strong>de</strong>rs verhält es sich, wenn es um <strong>de</strong>n Ange<br />
klagten geht, <strong>de</strong>nn er ist gegen seinen Willen in Gefahr ge<br />
raten.<br />
Zu 1. Augustinus spricht von <strong>de</strong>r Verheimlichung <strong>de</strong>r Wahr<br />
heit für <strong>de</strong>n Fall, daß jemand nicht durch obrigkeitlichen Befehl<br />
151
70. 2 zur Offenlegung <strong>de</strong>r Wahrheit veranlaßt wird <strong>und</strong> das Ver<br />
schweigen keinem zu beson<strong>de</strong>rem Scha<strong>de</strong>n ausschlägt.<br />
Zu 2. Was einem Menschen unter <strong>de</strong>m Siegel <strong>de</strong>s Beichtge<br />
heimnisses anvertraut wur<strong>de</strong>, darf niemals in einer Zeugenaus<br />
sage preisgegeben wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn das dort Gesagte weiß <strong>de</strong>r<br />
Beichtvater nicht als Mensch, son<strong>de</strong>rn als Diener Gottes, <strong>und</strong><br />
strenger ist die sakramentale Schweigepflicht als je<strong>de</strong>s mensch<br />
liche Gebot.<br />
Bei <strong>de</strong>n Geheimnissen, die einem sonstwie unter <strong>de</strong>m Siegel<br />
<strong>de</strong>r Verschwiegenheit k<strong>und</strong>getan wer<strong>de</strong>n, ist zu unterschei<strong>de</strong>n.<br />
Bisweilen sind sie von <strong>de</strong>r Art, daß man sie gleich nach Kennt<br />
nisnahme bekanntgeben muß, z. B. wenn ein Geheimnis zum<br />
geistlichen o<strong>de</strong>r materiellen Ver<strong>de</strong>rben <strong>de</strong>s Volkes o<strong>de</strong>r zum<br />
großen Scha<strong>de</strong>n irgen<strong>de</strong>iner Person führen wür<strong>de</strong>, o<strong>de</strong>r um was<br />
<strong>de</strong>rgleichen es sich auch immer handle, das man durch Zeugen<br />
aussage o<strong>de</strong>r Anzeige offenbaren muß. Diese Pflicht kann<br />
durch das anvertraute Geheimnis nicht außer Kraft gesetzt wer<br />
<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn sonst wür<strong>de</strong> man gegen die Loyalität verstoßen, die<br />
man <strong>de</strong>m Mitmenschen schul<strong>de</strong>t. - Es gibt aber auch Geheim<br />
nisse, die man nicht unbedingt weitergeben muß. Die Tatsache,<br />
daß sie jeman<strong>de</strong>m unter <strong>de</strong>m Siegel <strong>de</strong>r Verschwiegenheit<br />
anvertraut wur<strong>de</strong>n, verpflichtet, <strong>und</strong> dann darf er sie auf keinen<br />
Fall preisgeben, auch nicht auf Befehl eines Vorgesetzten,<br />
<strong>de</strong>nn Treue wahren ist Naturrecht. Es kann <strong>de</strong>m Menschen aber<br />
nichts befohlen wer<strong>de</strong>n, was <strong>de</strong>m Naturrecht wi<strong>de</strong>rspricht.<br />
Zu 3. Die Diener <strong>de</strong>s Altars haben nicht die Tötung eines<br />
Menschen zu besorgen o<strong>de</strong>r dabei mitzuhelfen, wie oben (64,4;<br />
40,2) betont wur<strong>de</strong>. Daher können sie nach <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung<br />
nicht dazu veranlaßt wer<strong>de</strong>n, in einem Verfahren über to<strong>de</strong>s<br />
würdige Missetaten als Zeugen aufzutreten.<br />
2. Artikel<br />
Genügt die Aussage von zwei o<strong>de</strong>r drei Zeugen?<br />
1. Das Urteil verlangt Sicherheit, doch sichere Wahrheit ist<br />
durch die Aussage von zwei Zeugen nicht zu erreichen. 3 Kön<br />
21,9 ff. liest man nämlich, daß Nabotb auf die Aussage von zwei<br />
Zeugen hin unschuldig zum Tod verurteilt wur<strong>de</strong>. Also genügen<br />
die Aussagen von zwei o<strong>de</strong>r drei Zeugen nicht.<br />
152
2. Damit das Zeugnis glaubwürdig sei, müssen die Aussagen 70.2<br />
übereinstimmen. Doch meistens gehen die Aussagen von zwei<br />
o<strong>de</strong>r drei Zeugen auseinan<strong>de</strong>r. Also reichen sie nicht aus, um die<br />
Wahrheit vor Gericht zu beweisen.<br />
3. In <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 4 (Frdbl,466) steht: „Ein Bischof<br />
soll nur auf die Aussagen von 72 Zeugen hin verurteilt wer<strong>de</strong>n.<br />
Ein Kardinalpriester ist nur bei 44 Zeugenaussagen abzuset<br />
zen. Zur Verurteilung eines Kardinaldiakons <strong>de</strong>r Stadt Rom<br />
müssen 28 Zeugenaussagen zusammenkommen. Ein Subdia-<br />
kon, Akolyth, Exorzist, Lektor <strong>und</strong> Ostiarius soll nur aufgr<strong>und</strong><br />
von 7 Zeugenaussagen verurteilt wer<strong>de</strong>n." Doch die Sün<strong>de</strong><br />
eines in höherer Wür<strong>de</strong> Stehen<strong>de</strong>n ist unheilvoller <strong>und</strong> <strong>de</strong>shalb<br />
weniger zu dul<strong>de</strong>n. Also genügt auch zur Verurteilung <strong>de</strong>r an<strong>de</strong><br />
ren die Zeugenaussage von zwei o<strong>de</strong>r drei nicht.<br />
DAGEGEN heißt es Dt 17,6: „Wenn es um Leben o<strong>de</strong>r Tod<br />
eines Angeklagten geht, darf er nur auf die Aussagen von zwei<br />
o<strong>de</strong>r drei Zeugen hin zum Tod verurteilt wer<strong>de</strong>n." Und weiter<br />
19,15: „Auf die Aussage von zwei o<strong>de</strong>r drei Zeugen hin darf<br />
eine Sache <strong>Recht</strong> bekommen."<br />
ANTWORT. Nach <strong>de</strong>s AristotelesEthik (1,1 u.7; 1094b 12 u.<br />
1098 a 26) „darf man in verschie<strong>de</strong>nen Bereichen nicht <strong>de</strong>n glei<br />
chen Grad von Sicherheit verlangen". Die menschlichen Hand<br />
lungen nun, über die Gericht gehalten wird <strong>und</strong> Zeugenaussa<br />
gen entschei<strong>de</strong>n, lassen sich nicht mit absoluter Sicherheit beur<br />
teilen, <strong>de</strong>nn sie wirken auf <strong>de</strong>m Feld <strong>de</strong>s Zufälligen <strong>und</strong> Ver<br />
än<strong>de</strong>rlichen. Es genügt hier <strong>de</strong>swegen eine wahrscheinliche<br />
Sicherheit, wie sie in <strong>de</strong>n meisten Fällen gegeben ist, auch wenn<br />
sie sich ausnahmsweise mit <strong>de</strong>r Wahrheit einmal nicht <strong>de</strong>ckt. Es<br />
ist aber wahrscheinlich, daß die Aussage vieler <strong>de</strong>r Wahrheit<br />
näher kommt, als die Aussage nur einer Person. Weil nun <strong>de</strong>r<br />
Angeklagte <strong>de</strong>r einzige ist, <strong>de</strong>r leugnet, viele Zeugen in ihren<br />
Aussagen mit <strong>de</strong>m Ankläger jedoch einig gehen, ist es vom gött<br />
lichen <strong>und</strong> menschlichen <strong>Recht</strong> vernünftigerweise so bestimmt<br />
wor<strong>de</strong>n, daß man sich an die Aussage <strong>de</strong>r Zeugen halten muß.<br />
Je<strong>de</strong> Vielheit ist in ihren drei Elementen beschlossen, näm<br />
lich in Anfang, Mitte <strong>und</strong> En<strong>de</strong>. Daher schreibt Aristoteles im<br />
I.Buch seiner Himmelsk<strong>und</strong>e (c. 1; 268a9): „In <strong>de</strong>r Zahl drei<br />
lassen wir Universalität <strong>und</strong> Totalität sich grün<strong>de</strong>n." Nun wird<br />
die Dreizahl <strong>de</strong>r Aussagen erreicht, wenn zwei Zeugen mit <strong>de</strong>m<br />
Ankläger übereinstimmen. Daher sind zwei Zeugen erfor<strong>de</strong>r<br />
lich o<strong>de</strong>r zur größeren Sicherheit drei, um die Dreiheit zu errei-<br />
153
70. 2 chen, in <strong>de</strong>r die vollkommene Vielheit beruht. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> heißt es auch Prd4,12: „Eine dreifache Schnur reißt<br />
nicht so leicht." Augustinus aber sagt zum Wort bei Joh 8,17<br />
„Das Zeugnis von zwei Menschen ist wahr" : „Dadurch wird<br />
symbolisch an das Geheimnis <strong>de</strong>r Dreifaltigkeit erinnert, in <strong>de</strong>r<br />
ewig unverän<strong>de</strong>rlich die Wahrheit ruht" (In Joh, Tr. 36; ML 35,<br />
1669).<br />
Zu 1. Wie hoch auch immer die Anzahl <strong>de</strong>r Zeugen<br />
bestimmt wird, es kann <strong>de</strong>nnoch zu einer falschen Bezeugung<br />
kommen, steht doch Ex 23,2 geschrieben: „Du sollst <strong>de</strong>r gro<br />
ßen Menge nicht folgen, um Böses zu tun." Und trotz<strong>de</strong>m darf<br />
man, da hier eine unfehlbare Sicherheit eben nicht erreicht wer<br />
<strong>de</strong>n kann, auf die wahrscheinliche Sicherheit, die durch zwei<br />
o<strong>de</strong>r drei Zeugen zu erlangen ist, nicht verzichten.<br />
Zu 2. Stimmen die Zeugen in <strong>de</strong>n Aussagen über einige<br />
wichtige Umstän<strong>de</strong>, die <strong>de</strong>n Sachverhalt wesentlich berühren,<br />
z. B. in <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r Zeit, <strong>de</strong>s Ortes o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r beteiligten Perso<br />
nen, nicht überein, so besitzt ihr Zeugnis keinen Wert. Denn<br />
wenn sie in diesen Punkten nicht einig sind, haben ihre Aus<br />
sagen nichts miteinan<strong>de</strong>r zu tun <strong>und</strong> beziehen sich augen<br />
scheinlich auf verschie<strong>de</strong>ne Ereignisse, z.B. wenn <strong>de</strong>r eine<br />
behauptet, dieser Vorfall habe zu dieser Zeit o<strong>de</strong>r an diesem Ort<br />
stattgef<strong>und</strong>en, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re erklärt, zu an<strong>de</strong>rer Zeit <strong>und</strong> an<br />
einem an<strong>de</strong>ren Ort, dann re<strong>de</strong>n sie wohl nicht von <strong>de</strong>r gleichen<br />
Sache. Die Zeugenaussage wird jedoch nicht wertlos, wenn sich<br />
<strong>de</strong>r eine mit einer Erinnerungslücke entschuldigt, während <strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>re Zeit <strong>und</strong> Ort genau angeben kann.<br />
Wenn sich bei diesen Aussagen die Zeugen <strong>de</strong>s Anklägers<br />
<strong>und</strong> die <strong>de</strong>s Angeklagten völlig wi<strong>de</strong>rsprechen, dann wird, falls<br />
sie an Zahl <strong>und</strong> Gewicht gleich sind, zugunsten <strong>de</strong>s Angeklag<br />
ten entschie<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Richter muß eher zu Freispruch als<br />
zu Verurteilung neigen, es sei <strong>de</strong>nn, es handle sich um Fälle von<br />
Vergünstigung, wie Befreiung o<strong>de</strong>r dgl. [59]. - Sind sich die<br />
Zeugen <strong>de</strong>rselben Partei jedoch nicht einig, dann muß <strong>de</strong>r Rich<br />
ter entsprechend ihrer Zahl o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Gewicht ihrer Aussagen<br />
o<strong>de</strong>r mit Rücksicht auf mil<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Umstän<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r die Lage <strong>de</strong>s<br />
Falles <strong>und</strong> all <strong>de</strong>ssen, was vorgebracht wur<strong>de</strong>, herausfin<strong>de</strong>n, für<br />
welche Partei zu entschei<strong>de</strong>n ist.<br />
Noch viel mehr ist die Aussage eines Zeugen zurückzuwei<br />
sen, <strong>de</strong>r sich auf die Frage, was er gesehen habe <strong>und</strong> wisse,<br />
selbst wi<strong>de</strong>rspricht. Nicht jedoch, wenn er sich, nach seiner<br />
154
Meinung <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Hörensagen befragt, in Wi<strong>de</strong>rsprüche ver- 70.3<br />
wickelt, <strong>de</strong>nn er kann je nach <strong>de</strong>m Gesehenen <strong>und</strong> Gehörten<br />
innerlich zu verschie<strong>de</strong>nen Antworten gedrängt wer<strong>de</strong>n.<br />
Beziehen sich wi<strong>de</strong>rsprüchliche Aussagen auf nebensäch<br />
liche Dinge, z. B. ob das Wetter neblich o<strong>de</strong>r schön gewesen, das<br />
Haus bemalt war o<strong>de</strong>r nicht o<strong>de</strong>r dgl., so spielen solche<br />
Unstimmigkeiten für <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>s Zeugnisses keine Rolle,<br />
<strong>de</strong>nn auf <strong>de</strong>rlei achten die Leute meist nicht beson<strong>de</strong>rs, weshalb<br />
sie es auch leicht vergessen. Ein wenig Unstimmigkeit macht im<br />
Gegenteil das Zeugnis umso glaubhafter, wie Chrysostomus in<br />
seinem Matthäuskommentar (Horn. 1; MG 57,16) bemerkt.<br />
Denn wi<strong>de</strong>rsprächen sie sich auch in <strong>de</strong>n geringsten Neben<br />
sächlichkeiten nicht, dann könnte es <strong>de</strong>n Anschein haben, als<br />
hätten sie ihre gleichlauten<strong>de</strong>n Aussagen untereinan<strong>de</strong>r abge<br />
macht.<br />
Zu 3. Jene Vorschrift ist eine Son<strong>de</strong>rregelung für Bischöfe,<br />
Priester, Diakone <strong>und</strong> Kleriker <strong>de</strong>r Römischen Kirche mit<br />
Rücksicht auf <strong>de</strong>ren Wür<strong>de</strong>. Und zwar aus dreifachem Gr<strong>und</strong>.<br />
1. weil in ihr nur solche ein Amt erlangen dürfen, <strong>de</strong>ren Heilig<br />
keit mehr Glaube verdient als die Einwendungen vieler Zeugen.<br />
- 2. weil Menschen, die an<strong>de</strong>re richten müssen, um <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit willen oft viele Gegner haben. Daher soll man <strong>de</strong>n gegen<br />
sie auftreten<strong>de</strong>n Zeugen nicht so einfach Glauben schenken, es<br />
sei <strong>de</strong>nn, sie erschienen in großer Zahl. - 3. weil die Verurteilung<br />
eines von ihnen in <strong>de</strong>n Augen <strong>de</strong>r Menschen <strong>de</strong>r Wür<strong>de</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>m Ansehen jener Teilkirche Abbruch tun wür<strong>de</strong>. Und dies<br />
hätte dort Schlimmeres zur Folge als das Ertragen eines Sün<br />
<strong>de</strong>rs, es sei <strong>de</strong>nn sein unmoralisches Verhalten dringe in die<br />
breite Öffentlichkeit <strong>und</strong> verursache schweres Ärgernis.<br />
3. ARTIKEL<br />
Kann die Aussage eines Zeugen, ohne daß bei ihm Schuld<br />
vorliegt, zurückgewiesen wer<strong>de</strong>n?<br />
1. Uber manche wird als Strafe verhängt, daß sie als Zeugen<br />
nicht zugelassen wer<strong>de</strong>n, wie dies bei <strong>de</strong>n (rechtlich) Ehrlosen<br />
zutrifft. Doch Strafe darf nur für schuldhaftes Vergehen auf<br />
erlegt wer<strong>de</strong>n. Also ist niemand von <strong>de</strong>r Zeugenaussage aus<br />
zuschließen, es sei <strong>de</strong>nn, wegen einer Schuld.<br />
155
70. 3 2. „Je<strong>de</strong>r ist bis zum Beweis <strong>de</strong>s Gegenteils als ehrenhaft zu<br />
betrachten" (Gregor IX., c. Dudum <strong>de</strong> Praesumpt.; Frdb<br />
II, 359). Doch ein ehrenhafter Mensch gibt ein wahres Zeugnis<br />
ab. Weil also das Gegenteil nur bei erwiesener Schuld <strong>de</strong>r Fall<br />
sein kann, darf niemand als Zeuge zurückgewiesen wer<strong>de</strong>n, es<br />
sei <strong>de</strong>nn, wegen einer Schuld.<br />
3. Nur die Sün<strong>de</strong> macht <strong>de</strong>n Menschen unfähig, das zu tun,<br />
was zum ewigen Heil notwendig ist. Doch Zeugnis für die<br />
Wahrheit ablegen ist notwendig zum ewigen Heil (vgl. Art. 1).<br />
Also darf niemand vom Zeugnisgeben ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n,<br />
es sei <strong>de</strong>nn, wegen einer Schuld.<br />
DAGEGEN steht das Wort Gregors (Regist. XIII, ep. 45;<br />
ML 77,1299) - es fin<strong>de</strong>t sich auch in <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 1<br />
(Frdbl, 442): „Wird ein Bischof von seinen Dienern verklagt, so<br />
ist zu wissen, daß diese auf keinen Fall gehört wer<strong>de</strong>n dürfen."<br />
ANTWORT. Eine Zeugenaussage besitzt, wie betont, keine<br />
unfehlbare Sicherheit, son<strong>de</strong>rn nur eine wahrscheinliche. Daher<br />
macht alles, was die Wahrscheinlichkeit ins Gegenteil verkehrt,<br />
die Zeugenaussage wertlos. Nun wird die Festigkeit in <strong>de</strong>r<br />
Bezeugung <strong>de</strong>r Wahrheit bisweilen in Frage gestellt, <strong>und</strong> zwar<br />
trifft dies einmal bei <strong>de</strong>n schuldhaft Ungläubigen zu, bei Leuten<br />
mit schlechtem Leum<strong>und</strong> sowie bei <strong>de</strong>nen, die ein öffentliches<br />
Verbrechen begangen haben; alle diese können auch nicht als<br />
Ankläger auftreten. Bisweilen liegt jedoch auch keine Schuld<br />
vor. So im Fall mangeln<strong>de</strong>r Vernunft wie bei Kin<strong>de</strong>rn, Geistes<br />
kranken <strong>und</strong> Frauen, o<strong>de</strong>r wenn Lei<strong>de</strong>nschaften mit ins Spiel<br />
kommen, wie bei Fein<strong>de</strong>n, verwandten Personen <strong>und</strong> Dienst<br />
personal, o<strong>de</strong>r auch bei Leuten in gewissen sozialen Verhältnis<br />
sen, wie <strong>de</strong>n Armen, <strong>de</strong>n Sklaven <strong>und</strong> <strong>de</strong>nen, die Befehle emp<br />
fangen, die alle, wie zu befürchten, leicht zu unwahren Zeugen<br />
aussagen zu bringen sind. Somit ist also verständlich, daß<br />
sowohl Schuldige wie auch Menschen ohne persönliche Schuld<br />
von <strong>de</strong>r Zeugenaussage ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n.<br />
Zu 1. Die Zurückweisung eines Zeugen ist weniger Strafe<br />
als vielmehr Sicherung gegen falsche Aussagen. Also ist <strong>de</strong>r Ein<br />
wand nicht stichhaltig.<br />
Zu 2. Bis zum Gegenbeweis ist je<strong>de</strong>r als ehrenhaft zu<br />
betrachten, solange bei dieser Annahme ein Dritter nicht in<br />
Gefahr kommt. Denn dann muß man Vorsicht walten lassen<br />
<strong>und</strong> darf nicht leicht je<strong>de</strong>m Glauben schenken gemäß 1JO4, 1:<br />
„Traue nicht je<strong>de</strong>m Geist."<br />
156
Zu 3. Bezeugen ist heilsnotwendig, vorausgesetzt <strong>de</strong>r 70.4<br />
Zeuge ist geeignet <strong>und</strong> wird <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung entsprechend<br />
aufgerufen. Es steht also nichts im Weg, daß einige zum Zeug<br />
nisgeben nicht zugelassen wer<strong>de</strong>n, wenn sie <strong>de</strong>n gesetzlichen<br />
Bedingungen nicht entsprechen.<br />
4. ARTIKEL<br />
Ist falsche Zeugenaussage immer Todsün<strong>de</strong>?<br />
1. Falsche Zeugenaussage kann auf Unkenntnis <strong>de</strong>s Tatbe<br />
stands beruhen. Doch solche Unkenntnis entschuldigt von <strong>de</strong>r<br />
Todsün<strong>de</strong>. Also ist falsche Zeugenaussage nicht immer Tod<br />
sün<strong>de</strong>.<br />
2. Eine Lüge, die nützt <strong>und</strong> nieman<strong>de</strong>m scha<strong>de</strong>t, ist Gefällig<br />
keitslüge, <strong>und</strong> diese ist keine Todsün<strong>de</strong>. Doch bisweilen besteht<br />
ein falsches Zeugnis aus einer solchen Lüge, z. B. wenn jemand<br />
ein falsches Zeugnis ablegt, um einen vom Tod zu erretten o<strong>de</strong>r<br />
vor einem ungerechten Urteil zu bewahren, das an<strong>de</strong>re falsche<br />
Zeugen o<strong>de</strong>r ein verkommener Richter durchbringen möchten.<br />
Also ist falsches Zeugnis dieser Art keine Todsün<strong>de</strong>.<br />
3. Vom Zeugen wird ein Eid verlangt, damit er sich bei sei<br />
nem feierlichen Schwur davor hüte, schwer zu sündigen. Dies<br />
wür<strong>de</strong> sich jedoch erübrigen, wenn das falsche Zeugnis selbst<br />
Todsün<strong>de</strong> wäre. Also ist falsches Zeugnis nicht immer Tod<br />
sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN steht Sprl9,5: „Ein falscher Zeuge bleibt nicht<br />
ungestraft."<br />
ANTWORT. Eine falsche Zeugenaussage ist auf dreifache<br />
Weise eine entstellte Aussage. Einmal durch <strong>de</strong>n Meineid. Zeu<br />
gen wer<strong>de</strong>n ja erst nach Ablegung <strong>de</strong>s Zeugenei<strong>de</strong>s zugelassen.<br />
Und <strong>de</strong>swegen ist ihre falsche Aussage immer Todsün<strong>de</strong>. -<br />
Sodann durch die Verletzung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Und <strong>de</strong>shalb ist<br />
sie ihrer Art nach Todsün<strong>de</strong>, wie je<strong>de</strong> Ungerechtigkeit. Aus die<br />
sem Gr<strong>und</strong> wird das falsche Zeugnis in <strong>de</strong>n Zehn Geboten<br />
(Ex20,16) in folgen<strong>de</strong>r Form untersagt: „Du sollst kein fal<br />
sches Zeugnis geben gegen <strong>de</strong>inen Nächsten." Denn jeman<strong>de</strong>n<br />
daran hin<strong>de</strong>rn, Unrecht zu tun, be<strong>de</strong>utet nicht, gegen ihn han<br />
<strong>de</strong>ln: dies trifft nur zu, wenn man ihm nimmt, was ihm rechtens<br />
zusteht. - Drittens durch die Falschaussage als solche, die<br />
157
70. 4 Sün<strong>de</strong> ist wie je<strong>de</strong> Lüge. Doch daraus folgt nicht, daß falsches<br />
Zeugnis immer Todsün<strong>de</strong> ist.<br />
Zu 1. Bei <strong>de</strong>r Zeugenaussage darf man nicht etwas als siche<br />
res Wissen ausgeben, was man in Wirklichkeit doch nicht genau<br />
kennt, son<strong>de</strong>rn was zweifelhaft ist, muß als Zweifel vor<br />
gebracht, <strong>und</strong> was sicher ist, als sicher vorgetragen wer<strong>de</strong>n.<br />
Wegen <strong>de</strong>r Unzuverlässigkeit <strong>de</strong>s Gedächtnisses jedoch meint<br />
man bisweilen, etwas sicher zu wissen, was tatsächlich nicht<br />
stimmt. Wenn nun jemand nach sorgfältiger Prüfung für sicher<br />
wahr hält, was jedoch falsch ist, so begeht er durch eine entspre<br />
chen<strong>de</strong> Behauptung keine Todsün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn er macht an sich <strong>und</strong><br />
seiner Absicht nach keine falsche Aussage, sie hat nur rein<br />
äußerlich <strong>und</strong> zufällig etwas damit zu tun <strong>und</strong> ist gegen das, was<br />
er eigentlich will.<br />
Zu 2. Ein ungerechtes Urteil ist überhaupt kein Urteil.<br />
Daher ist eine falsche Zeugenaussage, die in einer ungerechten<br />
Gerichtsverhandlung gemacht wird, um eine Ungerechtigkeit<br />
zu verhüten, keine Todsün<strong>de</strong> (gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>, weil<br />
keine vorhan<strong>de</strong>n), aber <strong>de</strong>nnoch Todsün<strong>de</strong>, <strong>und</strong> zwar wegen<br />
<strong>de</strong>s gebrochenen Ei<strong>de</strong>s.<br />
Zu 3. DieMenschenschreckenammeistenvorSün<strong>de</strong>ngegen<br />
Gott zurück, sind sie ja doch die schwersten. Darunter fällt auch<br />
<strong>de</strong>r Meineid. Die Sün<strong>de</strong>n gegen <strong>de</strong>n Nächsten verabscheuen sie<br />
nicht so sehr. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird zur größeren Sicherheit<br />
<strong>de</strong>r gerichtlichen Aussage <strong>de</strong>r Zeugeneid verlangt.<br />
158
71. FRAGE<br />
DIE UNGERECHTIGKEITEN,<br />
DIE VOR GERICHT DURCH DIE<br />
ANWÄLTE BEGANGEN WERDEN<br />
Nun ist noch von Ungerechtigkeiten zu re<strong>de</strong>n, die vor<br />
Gericht durch die <strong>Recht</strong>sanwälte begangen wer<strong>de</strong>n.<br />
Hierbei stellen sich vier Fragen:<br />
1. Ist <strong>de</strong>r Anwalt verpflichtet, als <strong>Recht</strong>sbeistand im Prozeß<br />
eines Armen mitzuwirken?<br />
2. Darf jemand vom Amt <strong>de</strong>s Anwalts ausgeschlossen wer<br />
<strong>de</strong>n?<br />
3. Sündigt <strong>de</strong>r Anwalt, <strong>de</strong>r als Verteidiger einer ungerechten<br />
Sache auftritt?<br />
4. Sündigt er, wenn er für seinen Beistand Geld nimmt?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist <strong>de</strong>r Anwalt verpflichtet, als <strong>Recht</strong>sheistand im Prozeß eines<br />
Armen mitzuwirken?<br />
1. Ex 25,5 heißt es: „Wenn du <strong>de</strong>n Esel <strong>de</strong>ssen, <strong>de</strong>r dich haßt,<br />
unter seiner Last liegen siehst, so sollst du nicht vorübergehen,<br />
son<strong>de</strong>rn ihm helfen, <strong>de</strong>n Esel aufzurichten." Doch nicht weni<br />
ger Gefahr droht <strong>de</strong>m Armen, wenn seine Sache vor Gericht<br />
gegen alle <strong>Gerechtigkeit</strong> in Bedrängnis gerät, als seinem Esel,<br />
wenn die Last ihn zu Bo<strong>de</strong>n drückt. Also ist <strong>de</strong>r Anwalt ver<br />
pflichtet, die Sache <strong>de</strong>s Armen in seine Hand zu nehmen.<br />
2. In einer Homilie (In Evang., hom9; ML76,1100) sagt<br />
Gregor. „Wer Verstand <strong>und</strong> Wissen hat, schweige nicht; wer<br />
Überfluß an Hab <strong>und</strong> Gut besitzt, lasse <strong>de</strong>r Barmherzigkeit<br />
großzügigen Lauf; wer die Kunst <strong>de</strong>s Regierens versteht, wirke<br />
damit zum Wohl <strong>de</strong>s Nächsten; wer mit <strong>de</strong>n Reichen ins<br />
Gespräch kommt, verwen<strong>de</strong> sich für die Armen! Je<strong>de</strong> Bega<br />
bung, <strong>und</strong> sei sie noch so gering, wird nämlich einem je<strong>de</strong>n als<br />
,Talent' angerechnet." Sein anvertrautes Talent darf man aber<br />
nicht vergraben, son<strong>de</strong>rn muß es treu verwalten. Dies beweist<br />
<strong>de</strong>utlich die Strafe <strong>de</strong>s Knechts, <strong>de</strong>r sein Talent vergrub<br />
159
71. l (Mt 25,24 ff.). Also ist <strong>de</strong>r Anwalt verpflichtet, Fürsprecher <strong>de</strong>r<br />
Armen zu sein.<br />
3. Das Gebot, die Werke <strong>de</strong>r Barmherzigkeit zu tun, ist posi<br />
tiv <strong>und</strong> daher entsprechend Ort <strong>und</strong> Zeit verpflichtend, vor<br />
allem im Fall <strong>de</strong>r Not. Dies ist nun gegeben, wenn die Sache<br />
eines Armen in Schwierigkeiten kommt. Also ist <strong>de</strong>r Anwalt in<br />
einem solchen Fall gehalten, <strong>de</strong>n Armen mit seiner <strong>Recht</strong>shilfe<br />
beizuspringen.<br />
DAGEGEN steht: <strong>de</strong>r Arme, <strong>de</strong>r Nahrung braucht, ist in<br />
einer nicht geringeren Not als <strong>de</strong>r Arme, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>sbei<br />
stand <strong>de</strong>s Anwalts braucht. Wer jedoch <strong>de</strong>s Armen Hunger zu<br />
stillen vermag, ist nicht verpflichtet, dies immer zu tun. Also ist<br />
auch <strong>de</strong>r Anwalt nicht immer verpflichtet, <strong>de</strong>r Sache <strong>de</strong>s Armen<br />
seinen Beistand zu gewähren.<br />
ANTWORT. Da <strong>Recht</strong>shilfe für die Armen zu <strong>de</strong>n Werken<br />
<strong>de</strong>r Barmherzigkeit gehört, ist hier das gleiche zu sagen wie<br />
oben, wo von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Werken <strong>de</strong>r Barmherzigkeit die Re<strong>de</strong><br />
war (32,5.9). Keiner vermag nämlich allen Armen mit einem<br />
Werk <strong>de</strong>r Barmherzigkeit zu Hilfe zu kommen. Daher sagt<br />
Augustinus im I.Buch seiner Christlichen Lehre (c.28;<br />
ML 34,30): „Da du nicht allen helfen kannst, mußt du <strong>de</strong>nen<br />
vor allem beispringen, die dir nach Ort <strong>und</strong> Zeit <strong>und</strong> an<strong>de</strong>ren<br />
günstigen Umstän<strong>de</strong>n näher stehen <strong>und</strong> gleichsam schicksal<br />
haft mit dir verb<strong>und</strong>en sind." Er spricht also vom „günstigen<br />
Umstand <strong>de</strong>s Ortes", das heißt: man braucht nicht in <strong>de</strong>r gan<br />
zen Welt die Armen zusammenzusuchen, son<strong>de</strong>rn es genügt,<br />
<strong>de</strong>nen, die einem gera<strong>de</strong> begegnen, das Werk <strong>de</strong>r Barmherzig<br />
keit zuzuwen<strong>de</strong>n. Daher heißt es Ex23,4: „Wenn du zufällig<br />
<strong>de</strong>ines Fein<strong>de</strong>s verirrten Ochsen o<strong>de</strong>r Esel siehst, dann bring sie<br />
ihm zurück." - Er fügt auch hinzu: „nach Zeit", <strong>de</strong>nn niemand<br />
braucht für die zukünftige Not <strong>de</strong>s Nächsten Vorsorge zu tref<br />
fen, son<strong>de</strong>rn es genügt, jetzt <strong>und</strong> heute etwas für ihn zu tun.<br />
Deshalb heißt es 1JO3, 17: „Wer seinen Bru<strong>de</strong>r Not lei<strong>de</strong>n sieht<br />
<strong>und</strong> sein Herz vor ihm verschließt" usw. - Schließlich bemerkt<br />
er noch: „nach an<strong>de</strong>ren günstigen Umstän<strong>de</strong>n", <strong>de</strong>nn man muß<br />
seinen Verwandten in je<strong>de</strong>r Not am meisten seine Fürsorge<br />
ange<strong>de</strong>ihen lassen gemäß 1 Tim 5,8: „Wer aber für seine Ver<br />
wandten, beson<strong>de</strong>rs für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt,<br />
<strong>de</strong>r verleugnet damit <strong>de</strong>n Glauben."<br />
Wenn dies alles zutrifft, bleibt <strong>de</strong>nnoch zu sehen, ob sich<br />
jemand in einer <strong>de</strong>rartigen Notlage befin<strong>de</strong>t, daß man nicht<br />
160
weiß, wie ihm rasch in an<strong>de</strong>rer Weise zu helfen sei. In diesem 71. 2<br />
Fall ist ihm das Werk <strong>de</strong>r Barmherzigkeit zuzuwen<strong>de</strong>n. -<br />
Erblickt man aber eine an<strong>de</strong>re Möglichkeit, etwas für ihn zu<br />
tun, sei es im Sinn <strong>de</strong>r Hilfe zur Selbsthilfe, sei es, daß eine noch<br />
näher stehen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r eine vermögen<strong>de</strong>re Person bereitsteht, so<br />
braucht man <strong>de</strong>m Armen nicht unbedingt beizuspringen, so<br />
daß man sich bei Unterlassung versündigen wür<strong>de</strong>, obwohl es<br />
löblich ist, dies auch ohne eine beson<strong>de</strong>re Notlage zu tun.<br />
Daher ist <strong>de</strong>r Anwalt nicht verpflichtet, <strong>de</strong>m Armen immer<br />
seinen <strong>Recht</strong>sbeistand zu gewähren, son<strong>de</strong>rn nur unter <strong>de</strong>n<br />
oben angeführten Bedingungen. Sonst müßte er nämlich alle<br />
an<strong>de</strong>ren Geschäfte liegen lassen <strong>und</strong> sich nur <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sbeihilfe<br />
für die Armen widmen. - Das gleiche wäre vom Arzt in Sachen<br />
Armenfürsorge zu sagen.<br />
Zu 1. Liegt <strong>de</strong>r Esel zusammengebrochen unter seiner Last,<br />
können ihm nur gera<strong>de</strong> Vorbeikommen<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r auf die Beine<br />
helfen, <strong>und</strong> <strong>de</strong>shalb müssen sie es auch tun. Sie brauchten es<br />
aber nicht, wenn von an<strong>de</strong>rswoher Hilfe käme.<br />
Zu 2. Der Mensch muß das ihm anvertraute Talent hilfreich<br />
einsetzen, doch, wie betont, unter Berücksichtigung von Ort,<br />
Zeit <strong>und</strong> an<strong>de</strong>ren Gegebenheiten.<br />
Zu 3. Nicht je<strong>de</strong> Not for<strong>de</strong>rt notwendig Hilfe heraus, son<br />
<strong>de</strong>rn nur jene, wie oben beschrieben.<br />
2. ARTIKEL<br />
Ist es in Ordnung, daß bestimmte Personen rechtmäßig vom<br />
Amt <strong>de</strong>s Anwalts ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n?<br />
1. Von Werken <strong>de</strong>r Barmherzigkeit darf niemand ferngehal<br />
ten wer<strong>de</strong>n. Doch <strong>Recht</strong>sbeistand leisten gehört, wie gesagt, zu<br />
<strong>de</strong>n Werken <strong>de</strong>r Barmherzigkeit. Also darf niemand von diesem<br />
Amt ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n.<br />
2. Aus zwei entgegengesetzten Ursachen kann nicht die<br />
gleiche Wirkung hervorgehen. Doch sich göttlichen Dingen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>m Sündigen hingeben sind Gegensätze. Es ist also ungereimt,<br />
wenn vom Amt <strong>de</strong>s Anwalts manche, wie die Mönche <strong>und</strong> Kle<br />
riker, wegen <strong>de</strong>r Religion, manche aber wegen Sün<strong>de</strong>nschuld,<br />
wie die Ehrlosen <strong>und</strong> Irrlehrer, ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Man muß <strong>de</strong>n Nächsten lieben wie sich selbst. Nun<br />
drängt die Liebe <strong>de</strong>n Anwalt, sich <strong>de</strong>r Sache seines Nächsten<br />
161
71. 2 anzunehmen. So ist es also nicht in Ordnung, wenn manche<br />
zwar ihre eigene Angelegenheit vor Gericht vertreten können,<br />
die Fälle an<strong>de</strong>rer jedoch nicht übernehmen dürfen.<br />
DAGEGEN steht in <strong>de</strong>n Dekreten III, q.7 (Frdbl,525),<br />
wonach viele Personen vom Amt <strong>de</strong>s Anwalts ausgeschlossen<br />
sind.<br />
ANTWORT. Aus doppeltem Gr<strong>und</strong> wird jeman<strong>de</strong>m eine<br />
Tätigkeit untersagt. Einmal wegen Unfähigkeit <strong>und</strong> sodann<br />
wegen Unschicklichkeit. Bei Unfähigkeit kommt das <strong>Recht</strong> auf<br />
gewisse Handlungen überhaupt nicht in Frage. Unschicklich<br />
keit hingegen schließt sie nicht völlig aus, weil Notwendigkeit<br />
die Unschicklichkeit aufheben kann. So wer<strong>de</strong>n manche vom<br />
Amt <strong>de</strong>s Anwalts wegen Unfähigkeit ausgeschlossen, weil<br />
ihnen an ihrer sinnhaften Ausstattung etwas abgeht, sei es<br />
innerlich, wie bei <strong>de</strong>n Geisteskranken <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn, sei es<br />
äußerlich, wie bei <strong>de</strong>n Tauben <strong>und</strong> Stummen. Der Anwalt muß<br />
nämlich geistig imstan<strong>de</strong> sein, in angemessener Weise die recht<br />
liche Seite <strong>de</strong>s übernommenen Falles aufzuzeigen, <strong>und</strong> die<br />
nötige Ausdrucksfähigkeit <strong>und</strong> das aufmerksame Ohr besitzen,<br />
um genau hinzuhören <strong>und</strong> wie<strong>de</strong>rzugeben, was ihm vorgetra<br />
gen wird. Wer hier also Mängel aufweist, kann als Anwalt nie<br />
mals in Frage kommen, we<strong>de</strong>r für sich selbst, noch für an<strong>de</strong>re.<br />
Aus zwei Grün<strong>de</strong>n schickt es sich für gewisse Personengrup<br />
pen nicht, das Amt <strong>de</strong>s Anwalts auszuüben. Einmal für jemand,<br />
<strong>de</strong>r durch höhere Verpflichtungen geb<strong>und</strong>en ist. So geziemt es<br />
sich für Mönche <strong>und</strong> Priester nicht, in irgen<strong>de</strong>iner Sache als<br />
Anwälte zu wirken, ebensowenig für Kleriker vor einem weltli<br />
chen Gericht, <strong>de</strong>nn alle diese Leute haben für Gott <strong>und</strong> seine<br />
Sache da zu sein. - Sodann für Personen, die an gewissen Män<br />
geln lei<strong>de</strong>n, seien sie körperlicher Art, wie dies bei <strong>de</strong>n Blin<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Fall ist, die vernünftigerweise nicht vor <strong>de</strong>m Richter erschei<br />
nen können, seien sie geistiger Art, weil es sich für einen, <strong>de</strong>r die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> für sich selbst verachtet hat, nicht geziemt, für<br />
an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n Anwalt zu spielen. Daher können Ehrlose, Ungläu<br />
bige <strong>und</strong> wegen schwerer Verbrechen Verurteilte geziemen<strong>de</strong>r<br />
weise nicht als <strong>Recht</strong>sanwälte auftreten.<br />
Zu 1. Manche wer<strong>de</strong>n wegen Unfähigkeit, manche aus<br />
Schicklichkeitsgrün<strong>de</strong>n daran gehin<strong>de</strong>rt, Werke <strong>de</strong>rBarmherzig-<br />
keit zu tun. Denn es ziemt sich nicht für alle, alle Werke <strong>de</strong>r Barm<br />
herzigkeit auszuüben, wie etwa für die Einfältigen, Ratschläge<br />
zu geben, <strong>und</strong> für die Nichtswisser, Unterricht zu erteilen.<br />
162
Zu 2. Wie die Tugend durch ein Zuviel o<strong>de</strong>r ein Zuwenig 71.3<br />
aufgehoben wird, so ergibt sich das Unangemessene durch ein<br />
Zuhoch <strong>und</strong> ein Zunie<strong>de</strong>r. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wer<strong>de</strong>n manche<br />
vom Anwaltsamt ausgeschlossen, weil sie zu hoch über dieser<br />
Tätigkeit stehen, wie die Or<strong>de</strong>nsleute <strong>und</strong> die Kleriker, an<strong>de</strong>re<br />
wie<strong>de</strong>rum, weil sie unterhalb <strong>de</strong>r Erfor<strong>de</strong>rnisse für dieses Amt<br />
stehen, wie die Ehrlosen <strong>und</strong> die Ungläubigen.<br />
Zu 3. Der Mensch hat eine größere Verpflichtung, sich sei<br />
ner eigenen <strong>Recht</strong>sangelegenheiten anzunehmen als <strong>de</strong>r Sache<br />
an<strong>de</strong>rer. Denn die an<strong>de</strong>ren können selber sehen, wie sie weiter<br />
kommen. Der Einwand gilt daher nicht.<br />
3. ARTIKEL<br />
Sündigt <strong>de</strong>r Anwalt, <strong>de</strong>r eine ungerechte Sache vertritt?<br />
1. Wie ein Arzt seine Tüchtigkeit dadurch beweist, daß er<br />
einen hoffnungslos Kranken heilt, so <strong>de</strong>r Anwalt sein Können<br />
dadurch, daß er auch eine ungerechte Sache zu verteidigen ver<br />
steht. Nun wird <strong>de</strong>r Arzt gelobt, wenn er einen hoffnungslos<br />
Kranken heilt. Also sündigt auch <strong>de</strong>r Anwalt nicht, son<strong>de</strong>rn ist<br />
noch mehr zu loben, wenn er eine ungerechte Sache verteidigt.<br />
2. Eine sündhafte Handlung darf man abbrechen. Nun wird<br />
nach <strong>de</strong>n Dekreten II, q. 3 (Frdb 1,454) <strong>de</strong>r Anwalt bestraft,<br />
wenn er seinen Fall aufgibt. Also sündigt <strong>de</strong>r Anwalt nicht,<br />
wenn er eine ungerechte Sache, die er zur Verteidigung über<br />
nommen hat, weiterführt.<br />
3. Schwerer sündigt, wer Ungerechtigkeit zur Verteidigung<br />
einer gerechten Sache einsetzt, in<strong>de</strong>m er z. B. falsche Zeugen<br />
vorführt o<strong>de</strong>r falsche Gesetze heranzieht, als wer eine unge<br />
rechte Sache verteidigt, <strong>de</strong>nn jene Sün<strong>de</strong> bezieht sich auf die<br />
Form, die zweite auf <strong>de</strong>n Inhalt. Doch <strong>de</strong>m Anwalt sind <strong>de</strong>rlei<br />
Winkelzüge wohl erlaubt, wie es auch <strong>de</strong>m Soldaten erlaubt ist,<br />
aus <strong>de</strong>m Hinterhalt heraus zu kämpfen. Also sündigt <strong>de</strong>r<br />
Anwalt nicht, wenn er eine ungerechte Sache verteidigt.<br />
DAGEGEN heißt es 2 Chrl9,2: „Du leistest <strong>de</strong>m Gottlosen<br />
Hilfe..., darum verdienst du <strong>de</strong>n Zorn <strong>de</strong>s Herrn." Nun<br />
gewährt <strong>de</strong>r Anwalt durch die Verteidigung einer ungerechten<br />
Sache <strong>de</strong>m Gottlosen Hilfe. Also verdient er wegen dieser<br />
Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Zorn Gottes.<br />
163
71. 3 ANTWORT. Es ist unerlaubt, zum Bösen mitzuwirken, sei es<br />
durch Rat, sei es durch Hilfe o<strong>de</strong>r durch irgen<strong>de</strong>ine Art von<br />
Zustimmung, <strong>de</strong>nn wer rät <strong>und</strong> mithilft, ist irgendwie selbst <strong>de</strong>r<br />
Täter. Und <strong>de</strong>r Apostel schreibt Rom 1,32: „Nicht nur die,<br />
welche die Sün<strong>de</strong> tun, sind <strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s würdig, son<strong>de</strong>rn auch alle,<br />
die damit einverstan<strong>de</strong>n sind." Daher wur<strong>de</strong> auch oben (62,7)<br />
betont, daß alle diese zur Wie<strong>de</strong>rgutmachung verpflichtet sind.<br />
Es ist nun offensichtlich, daß <strong>de</strong>r Anwalt <strong>de</strong>m Hilfe <strong>und</strong> Rat<br />
zuteil wer<strong>de</strong>n läßt, <strong>de</strong>ssen Sache er vertritt. Wenn er daher<br />
bewußt ein ungerechtes Anliegen verteidigt, so begeht er ohne<br />
Zweifel eine schwere Sün<strong>de</strong> <strong>und</strong> ist verpflichtet, <strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>n die an<strong>de</strong>re Seite durch seine Hilfe gegen alle <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
erlitten hat, wie<strong>de</strong>rg<strong>utz</strong>umachen. Verteidigt er jedoch unwis<br />
send eine ungerechte Sache in <strong>de</strong>r Meinung, sie sei gerecht,<br />
dann ist er entschuldigt, soweit Unwissenheit entschuldigen<br />
kann.<br />
Zu 1. Wenn sich <strong>de</strong>r Arzt mit einem hoffnungslos Kranken<br />
abgibt, tut er nieman<strong>de</strong>m Unrecht. Der Anwalt jedoch, <strong>de</strong>r eine<br />
ungerechte Sache übernimmt, verletzt die <strong>Gerechtigkeit</strong> jenem<br />
gegenüber, gegen <strong>de</strong>n er zugunsten seines Mandanten auftritt.<br />
Daher sind bei<strong>de</strong> Fälle nicht zu vergleichen. So lobenswert sein<br />
juristisches Talent auch erscheinen mag, - sein ungerechtes Wol<br />
len zeiht ihn <strong>de</strong>nnoch <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn er gebraucht seine Mei<br />
sterschaft zum Bösen.<br />
Zu 2. Wenn ein Anwalt zunächst <strong>de</strong>r Meinung ist, seine<br />
Sache sei gerecht, <strong>und</strong> im Verlauf <strong>de</strong>s Prozesses die Ungerechtig<br />
keit zutage tritt, darf er sie nicht aufgeben, um <strong>de</strong>r Gegenpartei<br />
zu helfen o<strong>de</strong>r ihr die Geheimnisse seiner Akten zuzuspielen.<br />
Er kann <strong>und</strong> muß jedoch seine Teilnahme am Verfahren einstel<br />
len o<strong>de</strong>r seinen Mandanten zur Aufgabe o<strong>de</strong>r zu einem Ver<br />
gleich ohne Scha<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n Gegner veranlassen.<br />
Zu 3. Wie oben (40,3) erklärt, darf ein Soldat o<strong>de</strong>r Heerfüh<br />
rer in einem gerechten Krieg aus <strong>de</strong>m Hinterhalt heraus manö<br />
vrieren, in<strong>de</strong>m er seine Bewegungen klug verschleiert, es darf<br />
jedoch nicht in gemeine Hinterhältigkeit ausarten, <strong>de</strong>nn „auch<br />
<strong>de</strong>m Feind ist noch die Treue zu wahren", wie Cicero im<br />
III. Buch seiner Pflichtenlehre (c. 29) schreibt. Daher darf auch<br />
ein Anwalt in <strong>de</strong>r Verteidigung einer gerechten Sache klug ver<br />
bergen, was seinem Vorgehen scha<strong>de</strong>n könnte, zu Betrügereien<br />
allerdings darf es nicht kommen.<br />
164
4. ARTIKEL 71. 4<br />
D
71.4 zufor<strong>de</strong>rn, nicht jedoch, was nach erträglicher Gewohnheit<br />
gegeben wor<strong>de</strong>n ist."<br />
Zu 1. Nicht alles, was man aus Barmherzigkeit tun kann,<br />
braucht man immer umsonst zu machen, sonst dürfte ja nie<br />
mand etwas verkaufen, <strong>de</strong>nn je<strong>de</strong>n Dienst kann man aus Barm<br />
herzigkeit erweisen. Leistet er ihn aber aus reiner Barmherzig<br />
keit, dann soll er nicht menschlichen, son<strong>de</strong>rn göttlichen Lohn<br />
erwarten. Ahnliches gilt für <strong>de</strong>n Anwalt, wenn er aus Barm<br />
herzigkeit die Sache <strong>de</strong>r Armen vertritt: er soll dann nicht mit<br />
menschlicher, son<strong>de</strong>rn mit göttlicher Vergeltung rechnen. Doch<br />
ist er nicht verpflichtet, seine Anwaltsarbeit stets gratis zu ver<br />
richten.<br />
Zu 2. Obwohl die <strong>Recht</strong>swissenschaft etwas Geistiges ist,<br />
setzt sie sich in <strong>de</strong>r Praxis in körperliche Leistung um. Daher<br />
darf man als Ausgleich Geld annehmen, sonst wäre es ja auch<br />
keinem Künstler erlaubt, aus seiner Kunst Gewinn zu ziehen.<br />
Zu 3. Richter <strong>und</strong> Zeugen sind für bei<strong>de</strong> Parteien in gleicher<br />
Weise da, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Richter muß ein gerechtes Urteil fällen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Zeuge eine wahre Aussage machen. <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong><br />
Wahrheit dürfen sich jedoch nicht stärker nach <strong>de</strong>r einen als<br />
nach <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite neigen. Daher wer<strong>de</strong>n für die Richter als<br />
Arbeitsentschädigung Gehälter aus öffentlichen Mitteln bereit<br />
gestellt, <strong>und</strong> die Zeugen erhalten - nicht als Lohn für ihre Aus<br />
sage, son<strong>de</strong>rn als Entgelt für ihre Mühe - eine finanzielle<br />
Zuwendung entwe<strong>de</strong>r von bei<strong>de</strong>n Parteien o<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Seite,<br />
die sie eingeführt hat, <strong>de</strong>nn, so heißt es 1 Kor 9,7: „Niemand<br />
leistet Kriegsdienst auf eigene Kosten." Der Anwalt jedoch ver<br />
tritt nur die eine Seite. Daher kann er erlaubterweise von <strong>de</strong>r<br />
Partei, die seine <strong>Recht</strong>shilfe erfährt, Honorar beanspruchen.<br />
166
72. FRAGE<br />
DIE SCHMÄHUNG<br />
Nun sind die Verstöße gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> zu untersu<br />
chen, die durch Worte außerhalb <strong>de</strong>s Gerichtsverfahrens began<br />
gen wer<strong>de</strong>n. Dabei han<strong>de</strong>lt es sich erstens um Schmähung,<br />
zweitens um Ehrabschneidung, drittens um Ohrenbläserei,<br />
viertens um Verspottung <strong>und</strong> fünftens um Verwünschung.<br />
Zum ersten Punkt stellen sich vier Fragen:<br />
1. Worin besteht die Schmähung?<br />
2. Ist je<strong>de</strong> Schmähung Todsün<strong>de</strong>?<br />
3. Muß man Schmähungen zurückweisen?<br />
4. Woraus entspringt die Schmähung?<br />
1. ARTIKEL<br />
Besteht die Schmähung in Worten?<br />
1. Durch Schmähung wird <strong>de</strong>m Nächsten Scha<strong>de</strong>n zuge<br />
fügt, <strong>de</strong>nn sie gehört in <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit. Doch<br />
Worte bewirken für <strong>de</strong>n Nächsten keinerlei Scha<strong>de</strong>n, we<strong>de</strong>r an<br />
seinen Sachen noch an seiner Person. Also besteht Schmähung<br />
nicht in Worten.<br />
2. Schmähung ist eine Art von Entehrung. Doch durch<br />
Handlungen kann man mehr entehren o<strong>de</strong>r schmähen, als<br />
durch Worte. Also drückt sich Schmähung nicht in Worten, son<br />
<strong>de</strong>rn eher in Handlungen aus.<br />
3. Entehrung durch Worte nennt man Beschimpfung o<strong>de</strong>r<br />
Vorhaltung. Doch Schmähung unterschei<strong>de</strong>t sich von Be<br />
schimpfung <strong>und</strong> Vorhaltung. Also besteht Schmähung nicht in<br />
Worten.<br />
DAGEGEN nimmt das Gehör nichts an<strong>de</strong>res wahr als das<br />
Wort. Nun wird Schmähung mit <strong>de</strong>m Gehör wahrgenommen<br />
gemäß Jr20,10: „Ich hörte die Schmähungen ringsum." Also<br />
drückt sich Schmähung in Worten aus.<br />
ANTWORT. Schmähung be<strong>de</strong>utet Entehrung eines Men<br />
schen, <strong>und</strong> dies geschieht auf doppelte Weise. Da Ehre eine<br />
überragen<strong>de</strong> Eigenschaft zur Voraussetzung hat, entehrt man<br />
jeman<strong>de</strong>n einmal dadurch, daß man ihn <strong>de</strong>s Vorzuges beraubt,<br />
<strong>de</strong>r ihm die Ehre einbrachte. Dies geschieht durch die Tatsün-<br />
167
72.1 <strong>de</strong>n, von <strong>de</strong>nen oben (Fr. 64 ff.) die Re<strong>de</strong> war. - Sodann<br />
dadurch, daß man ihm Dinge, die gegen die Ehre sprechen, vor<br />
hält o<strong>de</strong>r vor an<strong>de</strong>ren ausbreitet. Und darin besteht im eigentli<br />
chen Sinn die Schmähung. Dies geschieht nun durch gewisse<br />
Zeichen. Doch, wie Augustinus im II. Buch seiner Christlichen<br />
Lehre (c.3; ML 34,37) bemerkt, „sind im Vergleich zu <strong>de</strong>n<br />
Worten alle Zeichen von geringerer Be<strong>de</strong>utung, <strong>de</strong>nn die Worte<br />
stehen bei <strong>de</strong>n Menschen an erster Stelle, wenn es gilt, die<br />
innere Gesinnung zum Ausdruck zu bringen". Daher besteht<br />
die Schmähung, genau genommen, in Worten. Isidor schreibt<br />
<strong>de</strong>nn auch im X. Buch seiner Etymologie (ad C; ML 82,372),<br />
schmähsüchtig heiße jemand, „weil er rasch mit schwülstigen<br />
Worten <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit zur Hand ist".<br />
Weil jedoch auch durch Handlungen etwas bezeichnet wer<br />
<strong>de</strong>n kann <strong>und</strong> sie dadurch die Ausdruckskraft von Worten<br />
erhalten, wird „Schmähung" im weiteren Sinn auch von Hand<br />
lungen ausgesagt. Daher schreibt die Glosse (ML 191,1335)<br />
zum Wort <strong>de</strong>s Römerbriefs (1,30) „...schmähsüchtig, hoch<br />
mütig...": schmähsüchtig sind jene, „die mit Worten o<strong>de</strong>r<br />
Handlungen jeman<strong>de</strong>m Schmähungen <strong>und</strong> Schimpflichkeiten<br />
zufügen."<br />
Zu 1. Von Ihrem Wesen her gesehen, also insofern Worte<br />
nichts an<strong>de</strong>res als hörbare Töne sind, verursachen sie bei nie<br />
man<strong>de</strong>m Scha<strong>de</strong>n, es sei <strong>de</strong>nn, sie belasten das Gehör, falls<br />
jemand zu laut re<strong>de</strong>t. Insofern sie jedoch Zeichen darstellen, die<br />
an<strong>de</strong>ren etwas zur Kenntnis bringen, können sie vielseitigen<br />
Scha<strong>de</strong>n anrichten. Darunter fällt auch die Schmälerung <strong>de</strong>r<br />
geschul<strong>de</strong>ten Ehre o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Ehrerbietung. Deshalb ist die<br />
Schmähung größer, wenn jemand einem an<strong>de</strong>ren seine Fehler in<br />
<strong>de</strong>r Öffentlichkeit vorhält. Doch kann auch von Schmähung die<br />
Re<strong>de</strong> sein, wenn dies unter vier Augen geschieht, insofern <strong>de</strong>r<br />
Re<strong>de</strong>n<strong>de</strong> gegen die Ehrfurcht vor <strong>de</strong>m Hören<strong>de</strong>n verstößt.<br />
Zu 2. Handlungen haben entehren<strong>de</strong>n Charakter, insofern<br />
sie das bewirken o<strong>de</strong>r bezeichnen, was sich gegen die Ehre rich<br />
tet. Das erste fällt nicht unter Schmähung, son<strong>de</strong>rn unter<br />
an<strong>de</strong>re Arten von Ungerechtigkeit, von <strong>de</strong>nen oben (Fr. 64 ff.)<br />
die Re<strong>de</strong> war. Das zweite jedoch gehört zur Schmähung, inso<br />
fern Handlungen die Aussagekraft von Worten haben.<br />
Zu 3. Beschimpfung <strong>und</strong> Vorhaltung [60] bestehen ebenso<br />
wie die Schmähung in Worten, <strong>de</strong>nn durch all dies wird <strong>de</strong>m<br />
an<strong>de</strong>ren zum Scha<strong>de</strong>n seiner Ehre ein Gebrechen vorgehalten.<br />
168
Das Gebrechen aber ist dreifach. Einmal das Gebrechen <strong>de</strong>r 72. 2<br />
Schuld; dieses wird durch Schmähworte gebrandmarkt. Dann<br />
allgemein das Gebrechen von Schuld <strong>und</strong> Strafe, das in <strong>de</strong>r<br />
Beschimpfung zum Ausdruck kommt, <strong>de</strong>nn „Schimpfliches"<br />
wird nicht nur von <strong>de</strong>r Seele, son<strong>de</strong>rn auch vom Körper aus<br />
gesagt. Wenn daher jemand in beleidigen<strong>de</strong>r Weise zu einem<br />
sagt, er sei blind, so spricht er eine Beschimpfung, aber nicht<br />
eine Schmähung aus. Wirft er jedoch einem vor, er sei ein Dieb,<br />
dann ist dies nicht nur eine Beschimpfung, son<strong>de</strong>rn auch eine<br />
Schmähung. - Schließlich erinnert jemand einen an seine nie<br />
<strong>de</strong>re Herkunft o<strong>de</strong>r seine Armut; auch dies tut <strong>de</strong>r Ehre<br />
Abbruch, die ja auf irgen<strong>de</strong>inem Vorzug beruht. Und dies<br />
geschieht durch ein Wort <strong>de</strong>r „Vorhaltung", wodurch jemand<br />
einen auf beleidigen<strong>de</strong> Art an die Unterstützung erinnert, die er<br />
ihm in seiner Not ange<strong>de</strong>ihen ließ. Daher heißt es Sir 20,15:<br />
„Wenig gibt er <strong>und</strong> viel hält er einem vor." Bisweilen jedoch wird<br />
das eine Wort für das an<strong>de</strong>re genommen.<br />
2. ARTIKEL<br />
Ist Schmähung o<strong>de</strong>r Beschimpfung Todsün<strong>de</strong>?<br />
1. Todsün<strong>de</strong> ist nie Akt einer Tugend. Doch Schimpfen ist<br />
Akt einer Tugend, nämlich <strong>de</strong>r Geselligkeit. Dazu gehört nach<br />
Aristoteles (Eth. IV, 14; 1128 a32), „tüchtig" zu schimpfen. Also<br />
ist Schimpfen o<strong>de</strong>r Schmähen keine Todsün<strong>de</strong>.<br />
2. Todsün<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>t sich nicht bei vollkommenen Menschen.<br />
Diese aber sprechen bisweilen Beschimpfungen <strong>und</strong> Schmä<br />
hungen aus, wie dies beim Apostel <strong>de</strong>r Fall ist, <strong>de</strong>r an die Gala-<br />
ter schreibt (3,1): „O ihr unvernünftigen Galater! "Und <strong>de</strong>r Herr<br />
selbst sagt bei Lk 24,25: „O ihr Unverständigen <strong>und</strong> langsamen<br />
Herzens!" Also ist Beschimpfung o<strong>de</strong>r Schmähung keine Tod<br />
sün<strong>de</strong>.<br />
3. Was seiner Art nach läßliche Sün<strong>de</strong> ist, kann zwar Tod<br />
sün<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n, nicht jedoch kann eine <strong>de</strong>r Art nach schwere<br />
Sün<strong>de</strong> sich in eine leichte verwan<strong>de</strong>ln, wie oben (1-1188,4.6)<br />
dargelegt wur<strong>de</strong>. Wenn also Schimpfen o<strong>de</strong>r Schmähen seiner<br />
Art nach Todsün<strong>de</strong> wäre, dann folgte, daß es immer schwer<br />
sündhaft wäre. Dies scheint jedoch falsch zu sein, wie bei <strong>de</strong>m<br />
ins Auge springt, <strong>de</strong>r nur eben leichthin <strong>und</strong> aus Überraschung<br />
169
72. 2 o<strong>de</strong>r ein bißchen zornig ein Schmähwort von sich gibt. Schmä<br />
hung o<strong>de</strong>r Beschimpfung ist also nicht ihrer Art nach Todsün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN steht: Nichts verdient die ewige Strafe <strong>de</strong>r Hölle<br />
außer <strong>de</strong>r Todsün<strong>de</strong>. Doch Schmähung o<strong>de</strong>r Beschimpfung ver<br />
dient die Strafe <strong>de</strong>r Hölle gemäß Mt 5,22: „Wer zu seinem Bru<br />
<strong>de</strong>r sagt: ,Du Narr!', soll <strong>de</strong>m höllischen Feuer verfallen." Also<br />
ist Beschimpfung o<strong>de</strong>r Schmähung Todsün<strong>de</strong>.<br />
ANTWORT. Wie oben (Art. 1,2) bemerkt, richten die Worte<br />
als reine Töne bei an<strong>de</strong>ren keinen Scha<strong>de</strong>n an, son<strong>de</strong>rn nur<br />
insofern sie etwas be<strong>de</strong>uten. Diese Be<strong>de</strong>utung kommt ihnen<br />
aus <strong>de</strong>r inneren Gesinnung zu. Daher muß man bei <strong>de</strong>n Wort<br />
sün<strong>de</strong>n vor allem darauf achten, aus welcher Gesinnung<br />
heraus jemand seine Worte vorbringt. Beschimpfung o<strong>de</strong>r<br />
Schmähung besagt nun ihrer Natur nach eine gewisse Ent<br />
ehrung, <strong>und</strong> wenn die Absicht <strong>de</strong>s Sprechen<strong>de</strong>n darauf ausgeht,<br />
durch seine Worte <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren die Ehre zu nehmen, dann<br />
heißt dies eigentlich <strong>und</strong> an sich beschimpfen o<strong>de</strong>r schmähen.<br />
Dies ist nicht weniger Todsün<strong>de</strong> als Diebstahl o<strong>de</strong>r Raub, <strong>de</strong>nn<br />
<strong>de</strong>r Mensch liebt seine Ehre nicht weniger als seinen Besitz.<br />
Sagt jedoch jemand einem ein Wort <strong>de</strong>r Beschimpfung o<strong>de</strong>r<br />
Schmähung ohne Absicht zu entehren, son<strong>de</strong>rn vielleicht als<br />
Zurechtweisung o<strong>de</strong>r aus einem ähnlichen Gr<strong>und</strong>, dann spricht<br />
er im eigentlichen Sinn <strong>und</strong> an sich keine Beschimpfung o<strong>de</strong>r<br />
Schmähung aus, son<strong>de</strong>rn nur zufällig <strong>und</strong> materiell, insofern er<br />
Worte gebraucht, die Beschimpfung o<strong>de</strong>r Schmähung sein<br />
könnten. Daher kann dies bisweilen läßliche, bisweilen jedoch<br />
überhaupt keine Sün<strong>de</strong> sein. - Doch ist hier Zurückhaltung <strong>und</strong><br />
maßvoller Umgang mit <strong>de</strong>rlei Worten geboten. Denn unbe<br />
dacht könnte eine so schwerwiegen<strong>de</strong> Beschimpfung heraus<br />
kommen, daß die Ehre <strong>de</strong>s Betroffenen zugr<strong>und</strong>egerichtet<br />
wäre. Dann könnte jemand schwer sündigen, auch wenn die<br />
Entehrung <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren nicht in seiner Absicht lag. Sowenig ist<br />
ja auch einer von Schuld frei, <strong>de</strong>r einen beim Spiel unvorsichtig<br />
schlägt <strong>und</strong> dabei schwer verletzt.<br />
Zu 1. Zum Spaßmacher gehört es, ein bißchen zu schimp<br />
fen, nicht um <strong>de</strong>n Angesprochenen zu entehren o<strong>de</strong>r zu krän<br />
ken, son<strong>de</strong>rn mehr zur Belustigung <strong>und</strong> zum Scherz. Dies kann<br />
ohne Sün<strong>de</strong> sein, wenn die nötigen Umstän<strong>de</strong> beachtet wer<strong>de</strong>n.<br />
Scheut sich aber jemand nicht, <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m <strong>de</strong>rlei witzige<br />
Beschimpfung gilt, zu betrüben, während er die an<strong>de</strong>ren zum<br />
170
Lachen bringt, so ist er von Schuld nicht frei, wie es dort Ii. 3<br />
(Eth.IV,14; 1128a4) heißt.<br />
Zu 2. Wie es aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Zucht erlaubt ist, jeman<strong>de</strong>n<br />
zu schlagen o<strong>de</strong>r an seinem Eigentum zu schädigen, so darf<br />
man aus gleichem Gr<strong>und</strong> einem, <strong>de</strong>n es zurechtzuweisen gilt,<br />
ein Schimpfwort zurufen. In diesem Sinn nannte unser Herr<br />
seine Jünger „unverständig" <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Apostel die Galater „un<br />
vernünftig". - Nach Augustins Wort im Buch Über die Berg<br />
predigt (II, 19; ML 34,1299) „sind Schimpfworte jedoch nur im<br />
äußersten Notfall zu gebrauchen <strong>und</strong> nicht mit <strong>de</strong>r Absicht,<br />
unserem Vorteil, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>m Herrn zu dienen".<br />
Zu 3. Weil die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Beschimpfung o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Schmä<br />
hung von <strong>de</strong>r Gesinnung <strong>de</strong>s Sprechen<strong>de</strong>n abhängt, ist sie läß-<br />
lich, falls es sich nur um eine geringe, <strong>de</strong>n Menschen wenig ent<br />
ehren<strong>de</strong> Beschimpfung han<strong>de</strong>lt <strong>und</strong> sie ohne viel Überlegung<br />
o<strong>de</strong>r aus einer leichten Zornesanwandlung dahergere<strong>de</strong>t wird<br />
ohne festen Entschluß, jeman<strong>de</strong>n zu entehren, z. B. wenn<br />
jemand einen mit einem solchen Wort nur leicht kränken will.<br />
3. ARTIKEL<br />
Muß man zugefügte Schmähung dul<strong>de</strong>n?<br />
1. Wer eine zugefügte Schmähung hinnimmt, unterstützt die<br />
Frechheit <strong>de</strong>s Beschimpfen<strong>de</strong>n. Doch so etwas soll man nicht<br />
tun. Also darf man eine zugefügte Schmähung nicht dul<strong>de</strong>n,<br />
son<strong>de</strong>rn muß <strong>de</strong>m Schmähen<strong>de</strong>n vielmehr eine Abfuhr erteilen.<br />
2. Der Mensch muß sich selbst mehr als an<strong>de</strong>re lieben. Nun<br />
darf man nicht zulassen, daß ein an<strong>de</strong>rer geschmäht wird, wes<br />
halb es Spr 26,10 heißt: „Wer einen Toren zum Schweigen<br />
bringt, besänftigt Erbitterung." Also darf man auch die uns<br />
selbst zugefügten Schmähungen nicht dul<strong>de</strong>n.<br />
3. Entsprechend <strong>de</strong>m Wort (Hebrl0,30) „Mein ist die<br />
Rache, ich wer<strong>de</strong> vergelten" darf man sich selbst nicht rächen.<br />
Wenn jedoch jemand <strong>de</strong>r Schmähung nicht wi<strong>de</strong>rsteht, rächt er<br />
sich gemäß <strong>de</strong>m Wort <strong>de</strong>s Chrysostomus (Horn. 22 in ep. ad<br />
Rom.; MG 60,612): „Willst du dich rächen, dann schweige,<strong>und</strong><br />
du hast ihm einen tödlichen Schlag versetzt." Also darf man<br />
Schmähworte nicht mit Schweigen übergehen, son<strong>de</strong>rn muß<br />
vielmehr mit einer Antwort entgegentreten.<br />
171
72. 3 DAGEGEN steht das Psalmwort 37,13 f.: „Die mir Böses<br />
wünschten, re<strong>de</strong>ten Eitles", <strong>und</strong> weiter: „Ich aber hörte einem<br />
Tauben gleich nicht hin <strong>und</strong> war wie ein Stummer, <strong>de</strong>r seinen<br />
M<strong>und</strong> nicht auf tut."<br />
ANTWORT. Wie man gegen uns gerichtete Machenschaften<br />
aushalten muß, so auch gegen uns gerichtetes Geschwätz. Die<br />
Verpflichtung, zu ertragen, was uns wi<strong>de</strong>rfährt, versteht sich<br />
jedoch nur als innere Bereitschaft, entsprechend <strong>de</strong>r Auslegung<br />
<strong>de</strong>s Herrengebotes „Schlägt dich einer auf die eine Wange, dann<br />
halt' ihm auch die an<strong>de</strong>re hin" (Mt 5,30) bei Augustinus in sei<br />
nem I.Buch Über die Bergpredigt (c.19; ML34,1260): Der<br />
Mensch muß bereit sein, dies zu tun, wenn es nötig ist; er ist<br />
jedoch nicht verpflichtet, es immer so zu tun, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Herr<br />
selbst hat es auch nicht immer getan, son<strong>de</strong>rn sagte, als er einen<br />
Backenstreich erhielt: „Warum schlägst du mich?" (fol8,23).<br />
Das gleiche gilt auch für <strong>de</strong>n Fall, daß Schmähworte gegen uns<br />
gerichtet wer<strong>de</strong>n. Wir müssen innerlich bereit sein, Schmähun<br />
gen zu ertragen, wenn es angebracht ist. Bisweilen jedoch gilt<br />
es, eine Schmähung zurückzuweisen, hauptsächlich aus zwei<br />
Grün<strong>de</strong>n. Erstens zum Vorteil <strong>de</strong>s Schmähen<strong>de</strong>n selbst, damit<br />
seine Frechheit einen Dämpfer bekomme <strong>und</strong> er so etwas nicht<br />
noch einmal versuche. Dazu paßt Spr26,5: „Antworte <strong>de</strong>m<br />
Toren nach seiner Torheit, damit er sich nicht weise dünke."<br />
Zweitens um <strong>de</strong>s Wohles vieler willen, <strong>de</strong>ren geistlicher Fort<br />
schritt durch die uns zugefügten Schmähungen gefähr<strong>de</strong>t wird.<br />
Daher sagt Gregor (Sup.Ezech.,hom. 9; ML76,877): „Jene,<br />
die als lebendige Vorbil<strong>de</strong>r für an<strong>de</strong>re bestellt sind, müssen,<br />
wenn sie können, die Vorwürfe ihrer Verleum<strong>de</strong>r zum Schwei<br />
gen bringen, damit, wer hören kann, ihre Predigt hört, <strong>und</strong> wer<br />
im Sumpf seiner Laster steckt, ein tugendhaftes Leben nicht<br />
verschmäht."<br />
Zu 1. Die Frechheit <strong>de</strong>s schmähen<strong>de</strong>n Beschimpfers muß<br />
man gelassen zurückweisen als Erfüllung einer Liebespflicht,<br />
nicht im Interesse persönlicher Ehre. Daher heißt es Spr 26,4:<br />
„Antworte <strong>de</strong>m Toren nicht nach seiner Torheit, damit du ihm<br />
nicht gleich wer<strong>de</strong>st."<br />
Zu 2. Weist jemand die gegen einen an<strong>de</strong>ren gerichteten<br />
Schmähungen zurück, ist das Streben nach persönlicher Ehre<br />
nicht so zu fürchten, als wenn jemand die gegen ihn selbst erho<br />
benen Schmähungen abwehrt; vielmehr scheint jenes <strong>de</strong>m<br />
Beweggr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Caritas zu entspringen.<br />
172
Zu 3. Wenn jemand nur <strong>de</strong>shalb schwiege, um durch sein 72. 4<br />
Schweigen <strong>de</strong>n Schmähen<strong>de</strong>n zum Zorn zu reizen, dann<br />
geschähe dies aus Rache. Schweigt aber jemand, um „<strong>de</strong>m Zorn<br />
[Gottes] Raum zu geben" [Rom 12,19], dann ist das lobens<br />
wert. Daher heißt es Sir 8,4: „Streite nicht mit einem zungen<br />
fertigen Menschen, <strong>und</strong> lege nicht Holz in sein Feuer."<br />
4. ARTIKEL<br />
Entspringt die Schmähung <strong>de</strong>m Zorn?<br />
1. Spr. 11,2 heißt es: „Wo Hochmut, da ist Schmähung."<br />
Doch das Laster <strong>de</strong>s Zornes ist etwas an<strong>de</strong>res als Hochmut.<br />
Also entspringt die Schmähung nicht <strong>de</strong>m Zorn.<br />
2. Spr. 20,3 heißt es: „Alle Toren lassen sich zu Schmähre<br />
<strong>de</strong>n hinreißen." Doch die Torheit ist ein <strong>de</strong>r Weisheit entgegen<br />
gesetztes Laster, wie oben (46,1) dargelegt wur<strong>de</strong>. Der Zorn<br />
hingegen steht zur Sanftmut in Gegensatz. Also entspringt die<br />
Schmähung nicht <strong>de</strong>m Zorn.<br />
3. Keine Sün<strong>de</strong> wird je nach ihrer Ursache geringer. Doch<br />
die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Schmähung wird geringer, wenn sie im Zorn<br />
ihren Ursprung hat. Schwerer sündigt nämlich, wer aus Haß als<br />
wer aus Zorn eine Schmähung ausstößt. Also entspringt die<br />
Schmähung nicht <strong>de</strong>m Zorn.<br />
DAGEGEN schreibt Gregor in seinen Moralia (31,45;<br />
ML 76,621), aus <strong>de</strong>m Zorn entspringe Schmähung.<br />
ANTWORT. Eine Sün<strong>de</strong> kann verschie<strong>de</strong>ne Ursachen<br />
haben. Ihre hauptsächliche Quelle jedoch liegt dort, wo sie in<br />
<strong>de</strong>n meisten Fällen zu entspringen pflegt, <strong>und</strong> zwar wegen <strong>de</strong>r<br />
Nähe zu ihrem Ziel. Nun liegen die Ziele von Schmähung <strong>und</strong><br />
Zorn ganz nah beieinan<strong>de</strong>r: bei<strong>de</strong>n geht es um Rache. Keine<br />
Form <strong>de</strong>r Rache liegt <strong>de</strong>m Zornigen nämlich näher, als gegen<br />
<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Schmähungen auszustoßen. Also entspringt die<br />
Schmähung hauptsächlich <strong>de</strong>m Zorn.<br />
Zu 1. Die Schmähung ist nicht auf das Ziel <strong>de</strong>s Hochmuts,<br />
das in <strong>de</strong>r Selbstüberhebung liegt, ausgerichtet. Deshalb ent<br />
springt die Schmähung auch nicht unmittelbar <strong>de</strong>m Hochmut.<br />
Doch bereitet <strong>de</strong>r Hochmut auf die Schmähung vor, insofern<br />
jene, die sich über an<strong>de</strong>re erhaben dünken, diese leicht verach<br />
ten <strong>und</strong> beleidigen. Sie geraten auch rascher in Zorn, weil sie<br />
sich über alles entrüsten, was gegen ihren Willen geschieht.<br />
173
72.4 Zu 2. Nach Aristoteles (Eth.VII,7; 1149a25) „hört <strong>de</strong>r<br />
Zorn nicht genügend auf die Vernunft", <strong>und</strong> so setzt sich beim<br />
Zornigen die Vernunft nicht immer durch, - genau so verhält es<br />
sich auch mit <strong>de</strong>r Torheit. Deshalb entspringt die Schmähung<br />
aus <strong>de</strong>r Torheit wegen ihrer Nachbarschaft zum Zorn.<br />
Zu 3. Nach^rato£e/es(Rhet.II,2; 1378a31) „geht <strong>de</strong>r Zor<br />
nige auf die offene Beleidigung aus; <strong>de</strong>r Hassen<strong>de</strong> kümmert<br />
sich darum nicht". Daher ist die Schmähung, die offene Beleidi<br />
gung be<strong>de</strong>utet, mehr <strong>de</strong>m Zorn als <strong>de</strong>m Haß zuzurechnen.<br />
174
73. FRAGE<br />
DIE EHRABSCHNEIDUNG<br />
Nun ist die Ehrabschneidung zu betrachten. Dabei ergeben<br />
sich vier Fragen:<br />
1. Was ist Ehrabschneidung?<br />
2. Ist sie Todsün<strong>de</strong>?<br />
3. Vergleich mit an<strong>de</strong>ren Sün<strong>de</strong>n.<br />
4. Sündigt, wer Ehrabschneidung anhört?<br />
1. ARTIKEL<br />
Besteht die Ehrabschneidung in <strong>de</strong>r Anschwärzung frem<strong>de</strong>n<br />
Leum<strong>und</strong>s durch heimliche Worte?<br />
1. Es scheint, daß Ehrabschneidung nicht „Anschwärzung<br />
frem<strong>de</strong>n Leum<strong>und</strong>s durch heimliche Worte" ist, wie sie von<br />
einigen <strong>de</strong>finiert wird. Denn „heimlich" <strong>und</strong> „offen" sind keine<br />
Gegebenheiten, die eine Sün<strong>de</strong>nart begrün<strong>de</strong>n. Für die Sün<strong>de</strong><br />
spielt es ja keine Rolle, ob sie vielen o<strong>de</strong>r nur wenigen bekannt<br />
ist. Doch was die Art einer Sün<strong>de</strong> nicht begrün<strong>de</strong>t, gehört nicht<br />
zu ihrem Wesen <strong>und</strong> darf auch nicht in ihrer Definition erschei<br />
nen. Also darf auch die Ehrabschneidung nicht damit <strong>de</strong>finiert<br />
wer<strong>de</strong>n, daß sie durch heimliche Worte geschieht.<br />
2. Zum Begriff <strong>de</strong>s Leum<strong>und</strong>s gehört seine öffentliche<br />
Bekanntheit. Soll er nun durch Ehrabschneidung angeschwärzt<br />
wer<strong>de</strong>n, so kann dies nicht durch heimliche Worte geschehen,<br />
son<strong>de</strong>rn nur durch öffentlich ausgesprochene.<br />
3. Ehrabschnei<strong>de</strong>r ist, wer von <strong>de</strong>m, was vorhan<strong>de</strong>n ist,<br />
etwas „abschnei<strong>de</strong>t" o<strong>de</strong>r wegnimmt. Doch bisweilen schwärzt<br />
jemand <strong>de</strong>n guten Ruf an, ohne von <strong>de</strong>r Wahrheit etwas „weg<br />
zunehmen", z. B. wenn einer die wahren Untaten seines Näch<br />
sten verbreitet. Also ist nicht je<strong>de</strong> Anschwärzung <strong>de</strong>s Leu<br />
m<strong>und</strong>s Ehrabschneidung.<br />
DAGEGEN steht PrdlO,ll: „Wer heimlich verleum<strong>de</strong>t, un<br />
terschei<strong>de</strong>t sich in nichts von einer Schlange, die heimlich<br />
beißt." Also heißt ehrabschnei<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n Ruf an<strong>de</strong>rer heimlich<br />
zugr<strong>und</strong>erichten.<br />
ANTWORT. Wie man durch die Tat jeman<strong>de</strong>n auf doppelte<br />
Weise schädigt: offen wie bei Raub o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer Gewalteinwir-<br />
175
73. 1 kung, heimlich wie bei Diebstahl <strong>und</strong> heimtückischem Schla<br />
gen, so kann man auch durch das Wort jeman<strong>de</strong>n auf doppelte<br />
Weise verletzen: einmal offen durch Schmähung (vgl. oben)<br />
<strong>und</strong> einmal heimlich, <strong>und</strong> dies geschieht durch Ehrabschnei<br />
dung. Tritt einer offen mit Worten gegen jemand auf, so be<strong>de</strong>u<br />
tet dies Geringschätzung <strong>und</strong> daraus ergibt sich ohne weiteres<br />
Entehrung, <strong>und</strong> so bewirken Schmähworte für <strong>de</strong>n Geschmäh<br />
ten Verlust <strong>de</strong>r Ehre. Wer sich jedoch im geheimen gegen jeman<br />
<strong>de</strong>n ausläßt, scheint ihn mehr zu fürchten als geringzuscbätzen.<br />
Daher schädigt er nicht direkt seine Ehre, son<strong>de</strong>rn seinen Leu<br />
m<strong>und</strong>, insofern sich durch <strong>de</strong>rlei hinter seinem Rücken vor<br />
gebrachte Re<strong>de</strong>n - soweit es an ihnen liegt - bei <strong>de</strong>n Zuhörern<br />
eine schlechte Meinung von <strong>de</strong>m Betroffenen bil<strong>de</strong>t. Dies<br />
scheint er zu beabsichtigen, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Ehrabschnei<strong>de</strong>r tut alles,<br />
damit man seinen Worten glaubt.<br />
Die Ehrabschneidung unterschei<strong>de</strong>t sich also von <strong>de</strong>r Schmä<br />
hung auf doppelte Weise. Einmal durch die Art <strong>de</strong>s Re<strong>de</strong>ns: <strong>de</strong>r<br />
Schmähen<strong>de</strong> geht gegen seinen Wi<strong>de</strong>rsacher offen vor, <strong>de</strong>r<br />
Ehrabschnei<strong>de</strong>r im geheimen. Sodann durch <strong>de</strong>n angestrebten<br />
Zweck bzw. <strong>de</strong>n verursachten Scha<strong>de</strong>n: <strong>de</strong>r Schmähredner reißt<br />
die Ehre herunter, <strong>de</strong>r Ehrabschnei<strong>de</strong>r macht <strong>de</strong>n guten Ruf<br />
zunichte.<br />
Zu 1. Bei <strong>de</strong>n unfreiwilligen Tauschhandlungen, zu <strong>de</strong>nen<br />
alles gehört, was beim Nächsten durch Wort o<strong>de</strong>r Tat Scha<strong>de</strong>n<br />
verursacht, bewirkt „heimlich" <strong>und</strong> „offen" einen wesentlichen<br />
Unterschied in <strong>de</strong>r Qualität <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>. Jeweils an<strong>de</strong>rs liegt ja<br />
<strong>de</strong>r Fall von Unfreiwilligkeit unter Gewalteinwirkung bzw. bei<br />
Unwissenheit, wie oben (66,4) erklärt wur<strong>de</strong>.<br />
Zu 2. Die Worte <strong>de</strong>r Ehrabschneidung sind nicht schlecht<br />
hin geheim, son<strong>de</strong>rn nur in bezug auf <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m sie gelten: sie<br />
wer<strong>de</strong>n nämlich in <strong>de</strong>ssen Abwesenheit <strong>und</strong> ohne sein Wissen<br />
ausgesprochen. Im Gegensatz dazu schleu<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r Schmähred<br />
ner seine Worte <strong>de</strong>m Gegner gera<strong>de</strong>wegs ins Gesicht. Re<strong>de</strong>t<br />
daher jemand vor vielen Leuten Schlechtes über einen an<strong>de</strong>ren<br />
hinter <strong>de</strong>ssen Rücken, so ist dies Ehrabschneidung; geschieht es<br />
mit ihm unter vier Augen, dann heißt es Schmähung. Aber auch<br />
wenn einer nur mit einem einzigen über einen Abwesen<strong>de</strong>n<br />
schlecht re<strong>de</strong>t, schädigt er <strong>de</strong>ssen guten Ruf, zwar nicht gänz<br />
lich, so doch zum Teil.<br />
Zu 3. „Ehrabschnei<strong>de</strong>r" heißt einer nicht, weil er die Wahr<br />
heit, son<strong>de</strong>rn weil er <strong>de</strong>n guten Ruf schmälert. Bisweilen<br />
176
geschieht dies indirekt, bisweilen direkt. Direkt auf vierfache 73. 2<br />
Weise: 1. wenn man jeman<strong>de</strong>m etwas Falsches zur Last legt,<br />
2. wenn man seine Sün<strong>de</strong> mit Worten übertreibt, 3. wenn man<br />
Geheimes ausplau<strong>de</strong>rt <strong>und</strong> 4. wenn man guten Taten schlechte<br />
Absichten unterschiebt. Indirekt, in<strong>de</strong>m man <strong>de</strong>m Nächsten<br />
Gutes abspricht o<strong>de</strong>r es böswillig verschweigt.<br />
2. ARTIKEL<br />
Ist Ehrabschneidung Todsün<strong>de</strong>?<br />
1. Ein Tugendakt ist keine Todsün<strong>de</strong>. Doch eine geheime<br />
Sün<strong>de</strong> offenbaren, was, wie gesagt (1,3), zur Ehrabschneidung<br />
gehört, ist ein Akt <strong>de</strong>r Tugend, entwe<strong>de</strong>r nämlich <strong>de</strong>r Caritas,<br />
im Fall, daß einer die Sün<strong>de</strong> seines Bru<strong>de</strong>rs anzeigt mit <strong>de</strong>r<br />
Absicht, seine Besserung herbeizuführen, o<strong>de</strong>r auch <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, wenn jemand seinen Bru<strong>de</strong>r anklagt. Also ist<br />
Ehrabschneidung keine Todsün<strong>de</strong>.<br />
2. Zum Wort Spr24,21 „Mache mit <strong>de</strong>m Ehrabschnei<strong>de</strong>r<br />
keine gemeinsame Sache" schreibt die Glosse (ML 111,759):<br />
„Vor allem durch dieses Laster kommt das ganze Menschenge<br />
schlecht in Gefahr." Doch fin<strong>de</strong>t sich keine Todsün<strong>de</strong>, die über<br />
das ganze Menschengeschlecht verbreitet wäre. Viele nämlich<br />
mei<strong>de</strong>n die Todsün<strong>de</strong>, die läßlichen Sün<strong>de</strong>n hingegen sind es,<br />
die überall vorkommen. Also ist Ehrabschneidung eine läßliche<br />
Sün<strong>de</strong>.<br />
3. In seiner Homilie über das Fegfeuer (Serm. 104;<br />
ML 39,1947) zählt Augustinus unter die „kleinen Sün<strong>de</strong>n",<br />
„wenn wir höchst gedankenlos o<strong>de</strong>r leichtfertig üble Nachre<strong>de</strong><br />
führen", also das tun, was Ehrabschneidung ist. Somit ist<br />
Ehrabschneidung läßliche Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN heißt es im Römerbrief 1,30: „Ehrabschnei<strong>de</strong>r,<br />
Gotteshasser", was, wie die Glosse (ML 191,1335) sagt, <strong>de</strong>shalb<br />
beigefügt wird, „damit man ihre Sün<strong>de</strong> nicht für gering erachtet,<br />
nur weil sie mit Worten begangen wird".<br />
ANTWORT. Wie oben (72,2) bemerkt, muß man die Wort<br />
sün<strong>de</strong>n vor allem nach <strong>de</strong>r Absicht <strong>de</strong>s Sprechen<strong>de</strong>n beurteilen.<br />
Die Ehrabschneidung aber bezweckt ihrer Natur nach die<br />
Anschwärzung <strong>de</strong>s guten Rufes. Daher ist, an sich gesprochen,<br />
jener Ehrabschnei<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r über einen Abwesen<strong>de</strong>n re<strong>de</strong>t, um<br />
seinen guten Ruf zu schädigen. Den guten Ruf eines Menschen<br />
177
73. 2 zerstören ist jedoch eine sehr schwerwiegen<strong>de</strong> Sache, <strong>de</strong>nn un<br />
ter <strong>de</strong>n zeitlichen Gütern bil<strong>de</strong>t er etwas höchst Kostbares. Ist<br />
er verloren, sieht sich <strong>de</strong>r Mensch weithin nicht mehr in <strong>de</strong>r<br />
Lage, Gutes zu tun. Deshalb heißt es Sir 41,15: „Trage Sorge für<br />
<strong>de</strong>inen guten Namen, <strong>de</strong>nn dieser bleibt dir länger als tausend<br />
große <strong>und</strong> kostbare Schätze". Und darum ist Ehrabschneidung<br />
eine Todsün<strong>de</strong>.<br />
Es kommt jedoch bisweilen vor, daß jemand mit irgen<strong>de</strong>inem<br />
Wort <strong>de</strong>n Ruf eines an<strong>de</strong>ren beeinträchtigt, ohne dies zu beab<br />
sichtigen, er hatte nämlich etwas ganz an<strong>de</strong>res im Sinn. An sich<br />
<strong>und</strong> genau genommen ist dies dann keine Ehrabschneidung,<br />
höchstens materiell <strong>und</strong> zufällig. Und wenn jemand Worte, die<br />
<strong>de</strong>n guten Ruf schädigen, wegen eines Gutes o<strong>de</strong>r um einer<br />
Notwendigkeit willen <strong>und</strong> unter Beachtung <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Umstän<strong>de</strong> ausspricht, dann kann von Sün<strong>de</strong> keine Re<strong>de</strong> sein,<br />
<strong>und</strong> man darf es nicht Ehrabschneidung nennen. - Re<strong>de</strong>t er aber<br />
leichtsinnig daher o<strong>de</strong>r ohne notwendigen Gr<strong>und</strong>, dann ist es<br />
keine Todsün<strong>de</strong>, es sei <strong>de</strong>nn, das ausgesprochene Wort habe ein<br />
solches Gewicht, daß es jeman<strong>de</strong>s Ruf beträchtlich schädigt,<br />
<strong>und</strong> beson<strong>de</strong>rs in Dingen, die zur Ehrenhaftigkeit <strong>de</strong>s Lebens<br />
gehören; solche Worte tragen nämlich schon ihrer Art nach die<br />
Todsün<strong>de</strong> in sich.<br />
Im übrigen ist man gehalten, <strong>de</strong>n guten Ruf wie<strong>de</strong>rherzustel<br />
len entsprechend <strong>de</strong>r aügemeinen Verpflichtung, angerichteten<br />
Scha<strong>de</strong>n an frem<strong>de</strong>m Eigentum wie<strong>de</strong>rg<strong>utz</strong>umachen. Vgl. dazu<br />
im einzelnen, was oben im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Restitution<br />
gesagt wur<strong>de</strong> (62,2,2).<br />
Zu 1. Die geheime Sün<strong>de</strong> von jeman<strong>de</strong>m offenbaren, in<strong>de</strong>m<br />
man durch Anzeige seine Besserung erreichen will, o<strong>de</strong>r<br />
Anklage erheben wegen <strong>de</strong>s Gutes <strong>de</strong>r öffentlichen Ordnung<br />
ist, wie gesagt, nicht Ehrabschneidung.<br />
Zu 2. Jene Glosse behauptet nicht, Ehrabschneidung sei<br />
über das ganze Menschengeschlecht verbreitet, son<strong>de</strong>rn<br />
schränkt ein mit <strong>de</strong>m Wörtchen „beinah". So heißt es auch<br />
[Prd 1,15]: „Die Zahl <strong>de</strong>r Toren ist unendlich", <strong>und</strong> nur wenige<br />
sind es, die auf <strong>de</strong>m Weg <strong>de</strong>s Heiles wan<strong>de</strong>ln. Und es gibt nur<br />
wenige o<strong>de</strong>r überhaupt keine, die nicht bisweilen aus Unbe<br />
dachtsamkeit etwas sagen, wodurch bei einem, wenn auch nur<br />
leicht, <strong>de</strong>r gute Ruf getrübt wird. In diesem Sinn heißt es bei Jak<br />
3,2: „Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkom<br />
mener Mann".<br />
178
Zu 3. Augustinus hat dort <strong>de</strong>n Fall im Auge, wo jemand 73. 3<br />
einen an<strong>de</strong>ren ein wenig schlecht macht, jedoch nicht in <strong>de</strong>r<br />
Absicht zu scha<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn aus Unüberlegtheit o<strong>de</strong>r mit<br />
einem Wort, das ihm eben so entschlüpft ist.<br />
3. ARTIKEL<br />
Ist Ehrabschneidung die schwerste aller Sün<strong>de</strong>n gegen <strong>de</strong>n<br />
Nächsten?<br />
1. Zum Psalmwort 108,4: „Statt mich zu lieben, nehmen sie<br />
mir die Ehre", schreibt die Glosse (ML 191,988): „Mehr scha<br />
<strong>de</strong>n jene, die Christus in seinen Glie<strong>de</strong>rn herabsetzen - <strong>de</strong>nn sie<br />
töten die Seelen seiner Gläubigen - als die Mör<strong>de</strong>r seines Leibes,<br />
<strong>de</strong>r bald wie<strong>de</strong>r auferstehen sollte." Daraus geht hervor, daß<br />
Ehrabschneidung eine schwerere Sün<strong>de</strong> ist als Mord: die Seele<br />
töten ist ja wahrlich viel schlimmer als <strong>de</strong>n Leib vernichten.<br />
Doch Mord ist die schwerste aller Sün<strong>de</strong>n gegen <strong>de</strong>n Nächsten.<br />
Also ist Ehrabschneidung schlechthin unter allen Sün<strong>de</strong>n die<br />
schwerste.<br />
2. Die Ehrabschneidung ist eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Schmä<br />
hung, <strong>de</strong>nn gegen diese kann <strong>de</strong>r Mensch sich wehren, gegen die<br />
im Verborgenen wirken<strong>de</strong> Ehrabschneidung jedoch nicht. Nun<br />
ist die Schmähung schlimmer als Ehebruch, <strong>de</strong>nn dieser einigt<br />
zwei zu einem Fleisch, während Schmähung die Geeinten in<br />
viele auseinan<strong>de</strong>rbringt. Also ist Ehrabschneidung eine größere<br />
Sün<strong>de</strong> als Ehebruch, <strong>de</strong>r doch zum Schlimmsten gehört, was<br />
man seinem Nächsten antun kann.<br />
3. Die Schmähung geht aus <strong>de</strong>m Zorn hervor, die Ehrab<br />
schneidung jedoch aus <strong>de</strong>m Neid, wie Gregor'm seinen Moralia<br />
(31,45; ML 76,621) sagt. Doch <strong>de</strong>r Neid ist eine größere Sün<strong>de</strong><br />
als <strong>de</strong>r Zorn. Also ist auch Ehrabschneidung eine größere<br />
Sün<strong>de</strong> als Schmähung. Und so haben wir dasselbe wie zuvor.<br />
4. Eine Sün<strong>de</strong> ist umso schwerer, je schlimmer <strong>de</strong>r Scha<strong>de</strong>n<br />
ist, <strong>de</strong>n sie anrichtet. Die Ehrabschneidung nun bringt <strong>de</strong>n<br />
schlimmsten Scha<strong>de</strong>n mit sich, nämlich die Erblindung <strong>de</strong>s Gei<br />
stes. Gregor sagt nämlich [Regist. XI, ep. 2; ML 77,1120]: „Was<br />
tun die Ehrabschnei<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>res als Staub aufwirbeln <strong>und</strong> sich<br />
Sand in die Augen blasen, so daß sie, je mehr sie ihre verleum<strong>de</strong><br />
rischen Behauptungen verbreiten, umso weniger die Wahrheit<br />
179
73. 3 sehen." Also ist die Ehrabschneidung die schwerste aller Sün<br />
<strong>de</strong>n, die gegen <strong>de</strong>n Nächsten begangen wer<strong>de</strong>n.<br />
DAGEGEN steht: man sündigt schwerer durch die Tat, als<br />
durch das Wort. Doch Ehrabschneidung ist Wort-Sün<strong>de</strong>, Ehe<br />
bruch, Mord <strong>und</strong> Diebstahl hingegen sind Tat-Sün<strong>de</strong>n. Also ist<br />
Ehrabschneidung nicht schlimmer als die an<strong>de</strong>ren Sün<strong>de</strong>n<br />
gegen <strong>de</strong>n Nächsten.<br />
ANTWORT. Die Sün<strong>de</strong>n gegen an<strong>de</strong>re sind an sich (objek<br />
tiv) nach <strong>de</strong>m Scha<strong>de</strong>n zu beurteilen, <strong>de</strong>n sie beim Nächsten<br />
anrichten, <strong>de</strong>nn daraus ergibt sich ihr Schuldcharakter. Der<br />
Scha<strong>de</strong>n aber ist umso größer, ein je höheres Gut zerstört wird.<br />
Nun besitzt <strong>de</strong>r Mensch ein dreifach gestuftes Gut, nämlich das<br />
Gut <strong>de</strong>r Seele, das Gut <strong>de</strong>s Leibes <strong>und</strong> das Gut äußeren Besit<br />
zes. Das Gut <strong>de</strong>r Seele - das höchste - kann einem nicht genom<br />
men wer<strong>de</strong>n, es sei <strong>de</strong>nn indirekt, z. B. durch Überredung zum<br />
Bösen, wodurch jedoch kein Zwang entsteht. Die bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong><br />
ren Güter hingegen - Leib <strong>und</strong> äußerer Besitz - können einem<br />
gewaltsam entrissen wer<strong>de</strong>n. Weil aber das Gut <strong>de</strong>s Leibes über<br />
<strong>de</strong>m <strong>de</strong>s äußeren Besitzes steht, sind die Sün<strong>de</strong>n, die <strong>de</strong>m Leib<br />
Scha<strong>de</strong>n zufügen, schwerer als an<strong>de</strong>re, die nur die äußeren<br />
Dinge beeinträchtigen. Daher ist unter allen Sün<strong>de</strong>n gegen <strong>de</strong>n<br />
Nächsten <strong>de</strong>r Mord, <strong>de</strong>r das Leben eines bereits existieren<strong>de</strong>n<br />
Menschen vernichtet, die schwerste. Danach folgt <strong>de</strong>r Ehe<br />
bruch, <strong>de</strong>r sich gegen die rechte Ordnung <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Zeugung - das ist <strong>de</strong>n Weg zum Leben - richtet. Schließlich fol<br />
gen die äußeren Güter. Hier kommt <strong>de</strong>r gute Ruf vor <strong>de</strong>m<br />
Reichtum, weil er <strong>de</strong>n geistigen Gütern näher steht. Daher heißt<br />
es Spr 22,1: „Ein guter Name ist mehr wert als viele Reichtü<br />
mer." Und aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die Ehrabschneidung ihrer Art<br />
nach auch eine schwerere Sün<strong>de</strong> als <strong>de</strong>r Diebstahl, weniger<br />
schwer jedoch als Mord o<strong>de</strong>r Ehebruch. - Es kann sich aber<br />
wegen erschweren<strong>de</strong>r bzw. erleichtern<strong>de</strong>r Umstän<strong>de</strong> auch eine<br />
an<strong>de</strong>re Reihenfolge ergeben.<br />
Die Schwere <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> ist auch noch (subjektiv) vom Sün<strong>de</strong>r<br />
her zu beurteilen. Er sündigt schwerer, wenn er aus Überlegung,<br />
als wenn er aus Schwachheit o<strong>de</strong>r Unvorsichtigkeit sündigt.<br />
Unter diesem Gesichtspunkt ist <strong>de</strong>n Wortsün<strong>de</strong>n eine gewisse<br />
Geringfügigkeit eigen, weil sie leicht <strong>und</strong> ohne viel Nach<strong>de</strong>nken<br />
von <strong>de</strong>r Zunge gehen.<br />
Zu 1. Wer Christus in Verruf bringt <strong>und</strong> dadurch <strong>de</strong>n Glau<br />
ben seiner Glie<strong>de</strong>r erschwert, vergreift sich an seiner Gottheit,<br />
180
auf die sich <strong>de</strong>r Glaube stützt. Daher geht es hier nicht um ein- 73. 3<br />
fache Ehrabschneidung, son<strong>de</strong>rn um Gotteslästerung.<br />
Zu 2. Schwerer als Ehrabschneidung ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Schmähung, <strong>de</strong>nn in dieser drückt sich mehr Menschenverach<br />
tung aus, vergleichbar <strong>de</strong>m Raub, <strong>de</strong>r auch schwerer ist als<br />
Diebstahl, wie oben (66,9) dargelegt wur<strong>de</strong>. Hingegen ist<br />
Schmähung nicht sündhafter als Ehebruch, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>ssen<br />
Schwere ergibt sich nicht aus <strong>de</strong>r Vereinigung <strong>de</strong>r Leiber, son<br />
<strong>de</strong>rn aus <strong>de</strong>r Unordnung in <strong>de</strong>r menschlichen Zeugung. Der<br />
Schmähen<strong>de</strong> ist auch keine eigentliche Ursache für ein Feind<br />
schafts Verhältnis, son<strong>de</strong>rn lediglich Anlaß von Entzweiung,<br />
insofern er durch Ausplau<strong>de</strong>rn von eines an<strong>de</strong>ren Schlechtigkei<br />
ten vorhan<strong>de</strong>ne Fre<strong>und</strong>schaftsban<strong>de</strong>, soweit es an ihm liegt,<br />
zerstört, obgleich dazu aufgr<strong>und</strong> seiner Worte kein echter<br />
Gr<strong>und</strong> besteht. So ist <strong>de</strong>r Ehrabschnei<strong>de</strong>r indirekt auch Mör<strong>de</strong>r,<br />
insofern er durch seine Worte jeman<strong>de</strong>n veranlaßt, <strong>de</strong>n Näch<br />
sten zu hassen o<strong>de</strong>r zu verachten. Daher sagt <strong>de</strong>r Klemens-<br />
brief (Mansi 1,505; Frdbl, 1164), „die Ehrabschnei<strong>de</strong>r seien<br />
Mör<strong>de</strong>r", nämlich indirekt, <strong>de</strong>nn „wer seinen Bru<strong>de</strong>r haßt, ist<br />
ein Mör<strong>de</strong>r", wie bei 1 Jo 3,15 steht.<br />
Zu 3. Nach Aristoteles (Rhet.11,2; 1378a31) „sucht <strong>de</strong>r<br />
Zorn, offen Rache zu nehmen". Somit ist die Ehrabschneidung,<br />
die im Verborgenen geschieht, keine Tochter <strong>de</strong>s Zornes wie die<br />
Schmähung, son<strong>de</strong>rn eher <strong>de</strong>s Nei<strong>de</strong>s, die auf je<strong>de</strong> Weise das<br />
Ansehen <strong>de</strong>s Nächsten herabsetzen möchte. Daraus folgt<br />
jedoch nicht, daß die Ehrabschneidung schwerer ist als die<br />
Schmähung, <strong>de</strong>nn aus einem geringeren Laster kann eine grö<br />
ßere Sün<strong>de</strong> hervorgehen, wie z. B. Mord <strong>und</strong> Gotteslästerung<br />
aus <strong>de</strong>m Zorn entstehen. Die Herkunft <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>n ist nämlich<br />
aus ihrer Zielrichtung ersichtlich, d. h. aus ihrer „Hinwendung",<br />
ihre Schwere hingegen mehr aus ihrer „Abkehr" [61].<br />
4. Weil „sich <strong>de</strong>r Mensch freut am Ausspruch seines Mun<br />
<strong>de</strong>s", wie es Spr 15,23 heißt, ist <strong>de</strong>r Ehrabschnei<strong>de</strong>r geneigt,<br />
immer mehr zu lieben <strong>und</strong> zu glauben, was er sagt, <strong>und</strong> infolge<br />
<strong>de</strong>ssen seinen Nächsten immer mehr zu hassen <strong>und</strong> sich so<br />
immer mehr von <strong>de</strong>r Erkenntnis <strong>de</strong>r Wahrheit zu entfernen.<br />
Diese Wirkung kann sich allerdings auch aus an<strong>de</strong>ren Sün<strong>de</strong>n,<br />
die zum Nächstenhaß gehören, ergeben.<br />
181
73.4 4. ARTIKEL<br />
Sündigt <strong>de</strong>r Zuhörer, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Ehrabschnei<strong>de</strong>r gewähren läßt,<br />
schwer?<br />
1. Niemand ist einem an<strong>de</strong>ren gegenüber mehr verpflichtet,<br />
als sich selbst. Doch selber mit Geduld seine Verleum<strong>de</strong>r ertra<br />
gen ist etwas Lobenswertes, sagt doch Gregor (Sup.<br />
Ezech.,hom. 9; ML76,877): „Wie wir die Zungen <strong>de</strong>r Ver<br />
leum<strong>de</strong>r nicht absichtlich reizen dürfen, damit sie nicht verloren<br />
gehen, so müssen wir die durch ihre eigene Bosheit aufgebrach<br />
ten ertragen, damit unser Verdienst wächst." Also sündigt nicht,<br />
wer die Ehrabschneidungen an<strong>de</strong>rer nicht unterbin<strong>de</strong>t.<br />
2. Sir 4,30 heißt es: „Du sollst <strong>de</strong>m Wort <strong>de</strong>r Wahrheit in<br />
keiner Weise wi<strong>de</strong>rsprechen." Zuweilen aber wird jemand zum<br />
Ehrabschnei<strong>de</strong>r, in<strong>de</strong>m er die Wahrheit sagt, wie oben (1,3)<br />
erklärt wur<strong>de</strong>. Also ist man nicht immer verpflichtet, <strong>de</strong>n<br />
Ehrabschneidungen zu wi<strong>de</strong>rstehen.<br />
3. Was an<strong>de</strong>ren nützt, soll man nicht verhin<strong>de</strong>rn. Doch oft<br />
dient die Ehrabschneidung <strong>de</strong>m N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>rer, gegen die sie<br />
gerichtet ist. Papst Pius [L] sagt nämlich (Frdb 1,556): „Biswei<br />
len wer<strong>de</strong>n ehrenhafte Leute in Verruf gebracht, damit sie,<br />
<strong>de</strong>nen die Schmeicheleien <strong>de</strong>r Hausgenossen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer<br />
Gunst <strong>de</strong>n Kamm schwellen ließ, durch Ehrabschneidung zur<br />
Demut zurückfin<strong>de</strong>n." Also braucht man Ehrabschneidung<br />
nicht zu unterbin<strong>de</strong>n.<br />
DAGEGEN schreibt Hieronymus (ML 22,538): „Hüte dich<br />
vor lüsterner Zunge <strong>und</strong> gierigen Ohren, das heißt: du sollst<br />
we<strong>de</strong>r selbst an<strong>de</strong>re herunterreißen, noch zuhören, wie an<strong>de</strong>re<br />
das tun."<br />
ANTWORT. Nach <strong>de</strong>m Römerbrief <strong>de</strong>s Apostels (1,32)<br />
„sind <strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s würdig nicht nur, die Sün<strong>de</strong>n tun, son<strong>de</strong>rn<br />
auch, die <strong>de</strong>n Übeltätern noch Beifall spen<strong>de</strong>n." Dies geschieht<br />
nun auf zweifache Weise. Einmal direkt durch Verführung zur<br />
Sün<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r durch Wohlgefallen an <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>. Sodann indirekt,<br />
wenn man nicht dagegen auftritt, obwohl man könnte. Und die<br />
ses Versagen hat seinen Gr<strong>und</strong> nicht etwa im Wohlgefallen an<br />
<strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Menschenfurcht. Es ist also zu sagen:<br />
Wer sich Ehrabschnei<strong>de</strong>reien anhört, ohne dagegen aufzutre<br />
ten, stimmt <strong>de</strong>m Ehrabschnei<strong>de</strong>r zu, <strong>und</strong> damit macht er sich an<br />
seiner Sün<strong>de</strong> mitschuldig. Verführt er ihn zur Ehrabschneidung<br />
182
o<strong>de</strong>r fin<strong>de</strong>t er aus Haß gegen <strong>de</strong>n Betroffenen daran Gefallen, 73. 4<br />
dann sündigt er nicht weniger als <strong>de</strong>r Ehrabschnei<strong>de</strong>r selbst, bis<br />
weilen sogar noch mehr. Daher schreibt Bernhard (ML 182,<br />
756). „Ehrabschnei<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Ehrabschnei<strong>de</strong>r anhören, - ich<br />
kann nicht leicht sagen, was von <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n das Schlimmere<br />
ist." - Empfin<strong>de</strong>t er jedoch keinen Gefallen an <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>, son<br />
<strong>de</strong>rn scheut aus Furcht o<strong>de</strong>r Gleichgültigkeit o<strong>de</strong>r auch aus<br />
einer gewissen Scham davor zurück, <strong>de</strong>n Ehrabschnei<strong>de</strong>r in die<br />
Schranken zu weisen, so sündigt er, doch weit weniger als <strong>de</strong>r<br />
Ehrabschnei<strong>de</strong>r, <strong>und</strong> gewöhnlich nur läßlich. Bisweilen jedoch<br />
kann es auch schwere Sün<strong>de</strong> sein, sei es für <strong>de</strong>n Fall, daß jemand<br />
amtlich verpflichtet ist, <strong>de</strong>n Ehrabschnei<strong>de</strong>r eines besseren zu<br />
belehren, sei es wegen einer daraus entstehen<strong>de</strong>n Gefahr, sei es<br />
schließlich, daß sein Stillschweigen in einer Menschenfurcht be<br />
grün<strong>de</strong>t ist, die, wie oben (19,3) dargelegt wur<strong>de</strong>, Todsün<strong>de</strong><br />
sein kann.<br />
Zu 1. Keiner hört selbst die gegen ihn ausgesprochenen<br />
Ehrabschnei<strong>de</strong>reien. Das Schlechte nämlich, das in seiner<br />
Gegenwart von ihm gesagt wird, ist nicht Ehrabschneidung,<br />
son<strong>de</strong>rn, streng genommen, Schmähung (vgl. 1,2). Doch kön<br />
nen die gegen jemand ausgesprochenen Ehrverletzungen durch<br />
Dritte zu seiner Kenntnis gelangen. Dann mag er selbst ent<br />
schei<strong>de</strong>n, ob er die Schädigung seines Leum<strong>und</strong>s zulassen will,<br />
es sei <strong>de</strong>nn, sie wer<strong>de</strong> zur Gefahr für an<strong>de</strong>re (72,3). Je<strong>de</strong>nfalls<br />
verdient er volles Lob, wenn er die angetane Verunglimpfung<br />
mit Gelassenheit erträgt. - Es steht jedoch nicht in seinem Belie<br />
ben, die Rufschädigung eines an<strong>de</strong>ren geduldig hinzunehmen.<br />
Daher macht er sich schuldig, wenn er nicht dagegen auftritt,<br />
falls er kann, <strong>und</strong> zwar aus <strong>de</strong>m gleichen Gr<strong>und</strong>, wie jemand<br />
gehalten ist, „<strong>de</strong>m Esel seines Nächsten, <strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>r Last zu<br />
sammengesunken ist, wie<strong>de</strong>r auf die Beine zu helfen", wie es<br />
Dt 22,4 geboten ist.<br />
Zu 2. Man braucht <strong>de</strong>n Ehrabschnei<strong>de</strong>r nicht immer<br />
dadurch zum Schweigen zu bringen, daß man ihm die Unwahr<br />
heit nachweist. Dies erübrigt sich von vornherein, wenn er die<br />
Wahrheit sagt. Doch muß man ihm beibringen, daß er eine<br />
Sün<strong>de</strong> begeht, wenn er seinen Bru<strong>de</strong>r so heruntermacht, o<strong>de</strong>r<br />
man muß ihm wenigstens durch einen traurigen Blick sein Miß-<br />
fallen an <strong>de</strong>r Ehrabschneidung k<strong>und</strong>geben. Denn wie es<br />
Spr25,23 heißt, „vertreibt <strong>de</strong>r Nordwind <strong>de</strong>n Regen <strong>und</strong> ein<br />
finsteres Gesicht die verleum<strong>de</strong>rische Zunge".<br />
183
73. 4 Zu 3. Der N<strong>utz</strong>en, <strong>de</strong>n die Ehrabschneidung mit sich bringt,<br />
fließt nicht aus <strong>de</strong>r Absicht <strong>de</strong>s Ehrabschnei<strong>de</strong>rs, son<strong>de</strong>rn aus<br />
<strong>de</strong>m Willen Gottes, <strong>de</strong>r alles Böse zum Guten wen<strong>de</strong>n kann.<br />
Dennoch muß man <strong>de</strong>n Ehrabschnei<strong>de</strong>rn entgegentreten, ge<br />
nau wie <strong>de</strong>n Räubern <strong>und</strong> Unterdrückern, mag auch bei <strong>de</strong>n<br />
Unterdrückten <strong>und</strong> Beraubten wegen ihrer standhaften Geduld<br />
das Verdienst sich mehren.<br />
184
74. FRAGE<br />
DIE OHRENBLÄSEREI<br />
Nunmehr ist die Ohrenbläserei zu behan<strong>de</strong>ln. Und hier stel<br />
len sich zwei Fragen:<br />
1. Unterschei<strong>de</strong>t sich die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ohrenbläserei von <strong>de</strong>r<br />
Ehrabschneidung ?<br />
2. Welche von <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Sün<strong>de</strong>n ist die schwerere?<br />
1. ARTIKEL<br />
Unterschei<strong>de</strong>t sich die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ohrenbläserei von <strong>de</strong>r<br />
Ehrabschneidung?<br />
1. Im X.Buch seiner Etymologie (adS; ML 82,394) schreibt<br />
Isidor. „Susurro (<strong>de</strong>r Ohrenbläser) ist ein lautmalen<strong>de</strong>s Wort,<br />
<strong>de</strong>nn da spricht jemand einem verleum<strong>de</strong>risch nicht ins Gesicht,<br />
son<strong>de</strong>rn ins Ohr." Doch in herabsetzen<strong>de</strong>r Weise über einen<br />
re<strong>de</strong>n ist Ehrabschneidung. Also unterschei<strong>de</strong>t sich die Sün<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Ohrenbläserei nicht von <strong>de</strong>r Ehrabschneidung.<br />
2. Lvl9,16 heißt es: „Du sollst kein Verleum<strong>de</strong>r noch<br />
Ohrenbläser im Volke sein." Doch verleum<strong>de</strong>n scheint das<br />
gleiche wie ehrabschnei<strong>de</strong>n zu sein. Also unterschei<strong>de</strong>t sich<br />
auch die Ohrenbläserei nicht von <strong>de</strong>r Ehrabschneidung.<br />
3. Sir 28,15 steht: „Ohrenbläser <strong>und</strong> Doppelzüngige sollen<br />
verflucht sein." Doch <strong>de</strong>r Doppelzüngige ist das gleiche wie <strong>de</strong>r<br />
Verleum<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>nn ehrabschnei<strong>de</strong>n heißt mit doppelter Zunge<br />
re<strong>de</strong>n: an<strong>de</strong>rs in Abwesenheit, an<strong>de</strong>rs in Gegenwart <strong>de</strong>s Betrof<br />
fenen. Also ist Ohrenbläserei das gleiche wie Ehrabschneidung.<br />
DAGEGEN schreibt die Glosse (ML 191,1335) zu Rom 1,29<br />
f. „Ohrenbläserei, Verleum<strong>de</strong>r": „Ohrenbläser säen Zwietracht<br />
unter Fre<strong>und</strong>en, Ehrabschnei<strong>de</strong>r streiten bei an<strong>de</strong>ren das Gute<br />
ab o<strong>de</strong>r setzen es herunter."<br />
ANTWORT. Ohrenbläserei <strong>und</strong> Ehrabschneidung kommen<br />
in <strong>de</strong>r Sache wie auch in <strong>de</strong>r Form, d. h. in <strong>de</strong>r Art <strong>und</strong> Weise zu<br />
re<strong>de</strong>n, überein: bei<strong>de</strong> Male wird nämlich vom Nächsten etwas<br />
Schlechtes ausgesagt. Wegen dieser Ähnlichkeit nimmt man bis<br />
weilen auch eins für das an<strong>de</strong>re. Darum schreibt die Glosse (in-<br />
terlin. III, 393 r) zum Sirachwort (5,16) „Laß dich nicht Ohren<br />
bläser nennen": „das heißt,Ehrabschnei<strong>de</strong>r'". Der Unterschied<br />
185
74. 2 liegt jedoch im Zweck. Der Ehrabschnei<strong>de</strong>r will nämlich <strong>de</strong>n<br />
guten Ruf <strong>de</strong>s Nächsten anschwärzen, weshalb er von ihm vor<br />
allem jenes Schlechte vorbringt, das seinen Leum<strong>und</strong> zugrun<br />
<strong>de</strong>richten o<strong>de</strong>r wenigstens beeinträchtigen kann. Der Ohren<br />
bläser hingegen möchte Fre<strong>und</strong>e auseinan<strong>de</strong>rbringen, wie die<br />
erwähnte Glosse bemerkt <strong>und</strong> Spr26,20 an<strong>de</strong>uten: „Ist <strong>de</strong>r<br />
Ohrenbläser weg, hören die Streitereien auf." Daher flüstert <strong>de</strong>r<br />
Ohrenbläser jenes Schlechte vom Nächsten zu, das <strong>de</strong>n Hören<br />
<strong>de</strong>n gegen ihn aufbringt gemäß Sir 28,11: „Ein Mann <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong><br />
bringt Fre<strong>und</strong>e gegeneinan<strong>de</strong>r auf <strong>und</strong> stiftet Feindschaft unter<br />
<strong>de</strong>nen, die in Frie<strong>de</strong>n leben."<br />
Zu 1. Insofern <strong>de</strong>r Ohrenbläser von an<strong>de</strong>ren Schlechtes<br />
sagt, ist er Ehrabschnei<strong>de</strong>r. Er unterschei<strong>de</strong>t sich jedoch von<br />
ihm, weil er nicht ausgesprochen etwas Schlechtes sagen will,<br />
son<strong>de</strong>rn nur, was <strong>de</strong>n einen gegen <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren aufbringen<br />
kann, auch wenn es sich dabei um etwas an sich Gutes han<strong>de</strong>lt,<br />
was jedoch insofern als schlecht erscheint, als es <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r es<br />
hört, mißfällt.<br />
Zu 2. Der Verleum<strong>de</strong>r unterschei<strong>de</strong>t sich vom Ohrenbläser<br />
<strong>und</strong> vom Ehrabschnei<strong>de</strong>r. Der Verleum<strong>de</strong>r legt an<strong>de</strong>ren ent<br />
we<strong>de</strong>r durch Anklage o<strong>de</strong>r durch Lästerung öffentlich Verbre<br />
chen zur Last. Dies jedoch ist bei Ehrabschneidung <strong>und</strong> Ohren<br />
bläserei nicht <strong>de</strong>r Fall.<br />
Zu 3. Der Doppelzüngige wird recht <strong>und</strong> eigentlich Ohren<br />
bläser genannt. Besteht nämlich zwischen Zweien ein Fre<strong>und</strong><br />
schaftsverhältnis, so sucht <strong>de</strong>r Ohrenbläser, es von bei<strong>de</strong>n Sei<br />
ten aus zu zerstören. Darum spricht er zu bei<strong>de</strong>n mit zwei ver<br />
schie<strong>de</strong>nen Zungen, in<strong>de</strong>m er jeweils beim einen Schlechtes<br />
über <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren re<strong>de</strong>t. Daher heißt es Sir 28,15: „Fluch <strong>de</strong>m<br />
Ohrenbläser <strong>und</strong> Doppelzüngigen!", <strong>und</strong> weiter: „Denn viele,<br />
die in Frie<strong>de</strong>n leben, entzweit er."<br />
2. ARTIKEL<br />
Ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ehrabschneidung schwerer als die<br />
Ohrenbläserei?<br />
1. Die Wortsün<strong>de</strong>n bestehen darin, daß jemand Böses re<strong>de</strong>t.<br />
Der Ehrabschnei<strong>de</strong>r nun re<strong>de</strong>t vom Nächsten, was schlechthin<br />
böse ist, <strong>de</strong>nn daraus entsteht Ehrlosigkeit o<strong>de</strong>r Min<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s<br />
guten Rufes. Dem Ohrenbläser jedoch liegt nur daran, schein-<br />
186
ar Böses, etwas nämlich, das <strong>de</strong>m Hören<strong>de</strong>n mißfällt, vor- 74. 2<br />
zubringen. Also ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ehrabschneidung schwerer als<br />
die Ohrenbläserei.<br />
2. Wer einem <strong>de</strong>n guten Ruf nimmt, nimmt ihm nicht nur<br />
einen Fre<strong>und</strong>, son<strong>de</strong>rn viele Fre<strong>und</strong>e, <strong>de</strong>nn je<strong>de</strong>r mei<strong>de</strong>t die<br />
Fre<strong>und</strong>schaft mit Leuten von schlechtem Ruf. Darum heißt es<br />
2 Chr 19,2 gegen irgendjeman<strong>de</strong>n: „Du schließest Fre<strong>und</strong>schaft<br />
mit <strong>de</strong>nen, die <strong>de</strong>n Herrn hassen." Durch Ohrenbläserei verliert<br />
man hingegen nur einen einzigen Fre<strong>und</strong>. Schwerer also ist die<br />
Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ehrabschneidung als die Ohrenbläserei.<br />
3. Jak4,ll heißt es: „Wer seinen Bru<strong>de</strong>r herabsetzt, setzt<br />
das Gesetz herab", <strong>und</strong> folglich Gott, <strong>de</strong>n Gesetzgeber. So ist<br />
die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ehrabschneidung gegen Gott gerichtet, <strong>und</strong> das<br />
ist das allerschlimmste, wie oben (20,3; 1-1173,3) dargelegt<br />
wur<strong>de</strong>. Die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ohrenbläserei hingegen richtet sich<br />
gegen <strong>de</strong>n Nächsten. Also ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ehrabschneidung<br />
schwerer als die Ohrenbläserei.<br />
DAGEGEN heißt es Sir 5,17: „Über <strong>de</strong>n Doppelzüngigen<br />
kommt schärfster Ta<strong>de</strong>l, über <strong>de</strong>n Ohrenbläser jedoch Haß,<br />
Feindschaft <strong>und</strong> Schan<strong>de</strong>."<br />
ANTWORT. Wie oben (73,3; 1-1173,8) dargelegt, ist die<br />
Sün<strong>de</strong> gegen <strong>de</strong>n Nächsten umso schwerer, je größerer Scha<strong>de</strong>n<br />
ihm zugefügt wird. Die Größe <strong>de</strong>s Scha<strong>de</strong>ns jedoch bemißt sich<br />
nach <strong>de</strong>m Gut, das verlorengeht. Unter <strong>de</strong>n äußeren Gütern<br />
nun steht <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong> an <strong>de</strong>r Spitze, <strong>de</strong>nn „ohne Fre<strong>und</strong>e kann<br />
man nicht leben", wie Aristoteles im VIII. Buch seiner Ethik<br />
(c. 1; 1155a5) sagt. Daher heißt es auch Sir6,15: „Mit einem<br />
treuen Fre<strong>und</strong> ist nichts zu vergleichen." Ein guter Leum<strong>und</strong> -<br />
durch Ehrabschneidung zerstörbar - ist nun unbedingt nötig,<br />
damit ein Mensch <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong>schaft würdig sei. Darum ist<br />
Ohrenbläserei eine größere Sün<strong>de</strong> als Ehrabschneidung <strong>und</strong><br />
auch als Schmähung, <strong>de</strong>nn „<strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong> ist mehr wert als Ehre<br />
<strong>und</strong> geliebt wer<strong>de</strong>n mehr als geehrt wer<strong>de</strong>n", wie Aristoteles<br />
schreibt (Eth.VIII,9; 1159a25).<br />
Zu 1. Art <strong>und</strong> Schwere einer Sün<strong>de</strong> sind mehr von ihrem<br />
Zweck als von ihren materiellen Gegebenheiten her zu beurtei<br />
len. Von ihrem Zweck aus gesehen, ist die Ohrenbläserei darum<br />
auch schwerer, wenngleich <strong>de</strong>r Ehrabschnei<strong>de</strong>r bisweilen zu<br />
schlimmeren Aussagen greift.<br />
Zu 2. Guter Ruf ist Voraussetzung zu Fre<strong>und</strong>schaft, schlech<br />
ter Ruf zu Feindschaft. Die Voraussetzung aber steht tiefer im<br />
187
74. 2 Rangais das, wozusie Voraussetzungist. Daher sündigt weniger,<br />
wer nur etwas tut, um die Voraussetzung zur Feindschaft<br />
zu schaffen, als wer diese direkt herbeizuführen trachtet.<br />
Zu 3. Wer seinen Bru<strong>de</strong>r herabsetzt, setzt insoweit auch das<br />
Gesetz herab, als er das Gebot <strong>de</strong>r Nächstenliebe verachtet.<br />
Gegen sie han<strong>de</strong>lt direkter, wer Fre<strong>und</strong>schaft zu zerstören<br />
sucht. Daher richtet sich diese Sün<strong>de</strong> am meisten gegen Gott,<br />
<strong>de</strong>nn „Gott ist Liebe" (1JO4,8.16). Und <strong>de</strong>shalb heißt es<br />
Spr6,16: „Sechs Dinge sind's, die <strong>de</strong>r Herr haßt,<strong>und</strong> das siebte<br />
verabscheut seine Seele"; <strong>und</strong> als dieses Siebte nennt er (19)<br />
„<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r unter Brü<strong>de</strong>rn Zwietracht sät."<br />
188
75. FRAGE<br />
DIE VERSPOTTUNG<br />
Hierauf ist über die Verspottung zu re<strong>de</strong>n. Dabei stellen sich<br />
zwei Fragen?<br />
1. Unterschei<strong>de</strong>t sich die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Verspottung spezifisch<br />
von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Sün<strong>de</strong>n, durch die <strong>de</strong>m Nächsten durch<br />
Worte Scha<strong>de</strong>n zugefügt wird?<br />
2. Ist Verspottung schwere Sün<strong>de</strong>?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist die Verspottung eine beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong>?<br />
1. Verhöhnung ist das gleiche wie Verspottung. Doch Ver<br />
höhnung gehört zur Schmähung. Also unterschei<strong>de</strong>t sich Ver<br />
spottung nicht von Schmähung.<br />
2. Verspottet wird jemand nur wegen einer schimpflichen<br />
Sache, über die <strong>de</strong>r Mensch errötet, <strong>und</strong> von solcher Art ist die<br />
Sün<strong>de</strong>. Spricht man sie offen aus, dann han<strong>de</strong>lt es sich um<br />
Schmähung, wird sie im geheimen weitererzählt, dann ist es<br />
Ehrabschneidung o<strong>de</strong>r Ohrenbläserei. Also ist die Verspottung<br />
keine von <strong>de</strong>n vorgenannten verschie<strong>de</strong>ne Sün<strong>de</strong>.<br />
3. Diese Sün<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Scha<strong>de</strong>n unterschie<strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>n sie <strong>de</strong>m Nächsten zufügen. Doch durch Verspottung wird<br />
<strong>de</strong>m Nächsten auch an nichts an<strong>de</strong>rem als an <strong>de</strong>r Ehre, <strong>de</strong>m<br />
guten Ruf o<strong>de</strong>r durch Beeinträchtigung <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong>schaft<br />
gescha<strong>de</strong>t. Verspottung unterschei<strong>de</strong>t sich also nicht von <strong>de</strong>n<br />
vorgenannten Sün<strong>de</strong>n.<br />
DAGEGEN steht, daß Verspottung auf lustige Weise<br />
geschieht [vgl. Aristoteles, Eth.IV,14; 1128a4], weshalb man<br />
auch sagt: „sich über einen lustig machen". Die vorgenannten<br />
Sün<strong>de</strong>n haben jedoch mit Sich-lustig-machen nichts zu tun, sie<br />
geschehen im Ernst. Also unterschei<strong>de</strong>t sich Verspottung von<br />
allem Vorgenannten.<br />
ANTWORT. Wie oben (72,2) bemerkt, sind die Wortsün<strong>de</strong>n<br />
vor allem nach <strong>de</strong>r Absicht <strong>de</strong>s Sprechen<strong>de</strong>n zu beurteilen. Und<br />
so wer<strong>de</strong>n die Sün<strong>de</strong>n je nach <strong>de</strong>m, was einer mit seinen gegen<br />
<strong>de</strong>n Nächsten gerichteten Worten bezweckt, unterschie<strong>de</strong>n.<br />
Wie nun aber jemand mit seinen Beschimpfungen die Ehre <strong>de</strong>s<br />
189
75. 1 Beschimpften herabsetzen, durch Ehrabschneidung seinen<br />
guten Ruf schädigen <strong>und</strong> durch Ohrenbläserei Fre<strong>und</strong>schaft<br />
zerstören möchte, so hat auch <strong>de</strong>r Spötter die Absicht, <strong>de</strong>n Ver<br />
spotteten zum Erröten zu bringen. Und weil sich dieser Zweck<br />
von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Zwecken unterschei<strong>de</strong>t, ist auch die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Verspottung von <strong>de</strong>n vorgenannten Sün<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>n.<br />
Zu 1. Verhöhnung <strong>und</strong> Verspottung haben <strong>de</strong>n gleichen<br />
Zweck, doch sie unterschei<strong>de</strong>n sich durch die Art <strong>und</strong> Weise,<br />
<strong>de</strong>nn „die Verspottung geschieht mit <strong>de</strong>r Zunge", d. h. mit Wor<br />
ten <strong>und</strong> schallen<strong>de</strong>m Gelächter, „die Verhöhnung hingegen<br />
durch Naserümpfen" [62], wie die Glosse (ML 191,71) zum<br />
Psalmwort (2,4) „Der im Himmel thront, lacht über sie",<br />
schreibt. Aus einem solchen Unterschied ergibt sich aber keine<br />
An<strong>de</strong>rsartigkeit. Bei<strong>de</strong> jedoch (Verspottung <strong>und</strong> Verhöhnung)<br />
unterschei<strong>de</strong>n sich von <strong>de</strong>r Schmähung wie die Scham von <strong>de</strong>r<br />
Entehrung, <strong>de</strong>nn die Scham ist die „Furcht vor Entehrung", wie<br />
Johannes von Damaskus sagt (MG94,932).<br />
Zu 2. Eine tugendhafte Tat bringt Hochachtung <strong>und</strong> guten<br />
Ruf bei an<strong>de</strong>ren ein, bei sich selbst <strong>de</strong>n Ruhm eines guten<br />
Gewissens gemäß 2 Kor 1,12: „Das ist unser Ruhm: das Zeug<br />
nis unseres Gewissens." Umgekehrt verliert <strong>de</strong>r Mensch durch<br />
schimpfliche, d. h. lasterhafte Handlungen bei an<strong>de</strong>ren Ehre<br />
<strong>und</strong> guten Namen. Und um dieses zu bewirken, sagt <strong>de</strong>r<br />
Schmähsüchtige <strong>und</strong> Ehrabschnei<strong>de</strong>r Schimpfliches von an<strong>de</strong><br />
ren aus. Der Betroffene verliert jedoch wegen <strong>de</strong>r Verbreitung<br />
seiner Schandtaten <strong>de</strong>n „Ruhm <strong>de</strong>s Gewissens", in<strong>de</strong>m er in<br />
Verwirrung gerät <strong>und</strong> Scham empfin<strong>de</strong>t. Und um dies zu errei<br />
chen, spricht <strong>de</strong>r Spötter von schimpflichen Dingen. So ist klar,<br />
daß die Verspottung mit <strong>de</strong>n vorgenannten Sün<strong>de</strong>n materiell<br />
übereinstimmt, sich in <strong>de</strong>r Zwecksetzung jedoch davon abhebt<br />
Zu 3. Sicherheit <strong>und</strong> Ruhe <strong>de</strong>s Gewissens sind ein hohes<br />
Gut gemäß Spr 15,15: „Ein ruhiger Geist ist ein beständiges<br />
Freu<strong>de</strong>nmahl". Wer darum das Gewissen <strong>de</strong>s Nächsten durch<br />
Verwirrung beunruhigt, fügt ihm einen beson<strong>de</strong>ren Scha<strong>de</strong>n zu.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die Verspottung auch eine beson<strong>de</strong>re<br />
Sün<strong>de</strong>.<br />
190
2. ARTIKEL 75. 2<br />
Kann Verspottung Todsün<strong>de</strong> sein?<br />
1. Je<strong>de</strong> Todsün<strong>de</strong> wi<strong>de</strong>rspricht <strong>de</strong>r Caritas. Doch bei <strong>de</strong>r<br />
Verspottung ist dies nicht <strong>de</strong>r Fall, han<strong>de</strong>lt es sich dabei doch<br />
meist nur um Spaß unter Fre<strong>und</strong>en, weshalb es ja auch „Spaß-<br />
macherei" heißt. Also kann Verspottung keine Todsün<strong>de</strong> sein.<br />
2. Jener Spott ist <strong>de</strong>r schlimmste, mit <strong>de</strong>m jemand Gott<br />
beleidigen will. Doch nicht je<strong>de</strong>r Spott, durch <strong>de</strong>n Gott belei<br />
digt wird, ist schwere Sün<strong>de</strong>. Denn sonst sündigte je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r in<br />
eine bereute läßliche Sün<strong>de</strong> zurückfällt, schwer. Isidor sagt näm<br />
lich (II De summo Bono, 16; ML83,619): „Spötter ist ein<br />
Unbußfertiger, <strong>de</strong>r weitertut, was er bereut." Desgleichen<br />
wür<strong>de</strong> folgen, daß jegliche Heuchelei Todsün<strong>de</strong> wäre, <strong>de</strong>nn, wie<br />
Gregor schreibt (Moralia 31,15; ML 76,588), mit <strong>de</strong>m „Strauß"<br />
[Job 39,13.18] ist <strong>de</strong>r Heuchler gemeint, <strong>de</strong>r das „Roß", d. h.<br />
<strong>de</strong>n gerechten Menschen, <strong>und</strong> <strong>de</strong>n „Reiter", d. h. Gott, verlacht.<br />
Also kann Verspottung keine Todsün<strong>de</strong> sein.<br />
3. Schmähung <strong>und</strong> Ehrabschneidung sind schwerere Sün<br />
<strong>de</strong>n als Verspottung, <strong>de</strong>nn es ist schlimmer, etwas (Böses) im<br />
Ernst als im Scherz zu tun. Doch nicht je<strong>de</strong> Ehrabschneidung<br />
o<strong>de</strong>r Schmähung ist schwere Sün<strong>de</strong>. Also viel weniger noch Ver<br />
spottung.<br />
DAGEGEN heißt es Spr3,34: „Er spottet <strong>de</strong>r Spötter". Der<br />
Spott Gottes besteht jedoch darin, daß er die Todsün<strong>de</strong> ewig<br />
bestraft, wie sich klar aus <strong>de</strong>m Psalmwort 2,4 ergibt: „Der im<br />
Himmel thront, lacht über sie." Also ist Verspottung Todsün<strong>de</strong>.<br />
ANTWORT. Man verspottet nur irgen<strong>de</strong>in Übel o<strong>de</strong>r Gebre<br />
chen. Ist das Übel groß, wird es freilich nicht als Spaß genom<br />
men, son<strong>de</strong>rn als ernste Sache. Zieht man es ins Spaßhafte o<strong>de</strong>r<br />
Lächerliche - daher „Spaßmacherei" <strong>und</strong> „auslachen" -, so <strong>de</strong>s<br />
halb, weil es für etwas Unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s gehalten wird. Als „un<br />
be<strong>de</strong>utend" läßt sich nun etwas auf zweifache Weise verstehen:<br />
einmal an sich, <strong>und</strong> dann in Bezug auf die Person. Verspöttelt<br />
<strong>und</strong> verlacht jemand das Übel o<strong>de</strong>r Gebrechen einer Person,<br />
weil es an sich dabei um etwas Unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s geht, so ist dies<br />
seiner Art nach nur eine läßliche <strong>und</strong> leichte Sün<strong>de</strong>. - Hält man<br />
jedoch etwas für unbe<strong>de</strong>utend wegen <strong>de</strong>r Person, wie wir etwa<br />
Mängel bei Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Beschränkten leicht zu nehmen pfle<br />
gen, so be<strong>de</strong>utet verspotten <strong>und</strong> auslachen, ihn völlig gering-<br />
191
75. 2 schätzen <strong>und</strong> ihn für so nichtig halten, daß man sich um sein<br />
Gebrechen nicht zu kümmern braucht, son<strong>de</strong>rn es sozusagen<br />
als Spaßobjekt ben<strong>utz</strong>en darf. Eine <strong>de</strong>rartige Verspottung ist<br />
Todsün<strong>de</strong>. Und sie ist, was auf <strong>de</strong>r Hand liegt, schwerer als<br />
Schmähung, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Schmähen<strong>de</strong> nimmt das Gebrechen <strong>de</strong>s<br />
an<strong>de</strong>ren wenigstens ernst, <strong>de</strong>r Spötter aber zieht es ins Lächer<br />
liche. Deshalb liegt darin eine größere Verachtung <strong>und</strong> Ent<br />
ehrung.<br />
Demnach ist Verspottung schwere Sün<strong>de</strong>, <strong>und</strong> umso schwe<br />
rer, eine je größere Ehrfurcht <strong>de</strong>r Person gebührt, die verspottet<br />
wird. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist es eine sehr schwere Sün<strong>de</strong>, Gott<br />
<strong>und</strong> was Gottes ist, zu verspotten gemäß Is 37,23: „Wen hast du<br />
beschimpft <strong>und</strong> verhöhnt? Und gegen wen die Stimme erho<br />
ben?" Und dann fügt er hinzu: „Gegen <strong>de</strong>n Heiligen Israels!" -<br />
An zweiter Stelle kommt dann die Verspottung <strong>de</strong>r Eltern.<br />
Daher heißt es Spr 30,17: „Das Auge, das <strong>de</strong>n Vater verspottet<br />
<strong>und</strong> die alte Mutter verachtet, hacken die Raben am Bache aus<br />
<strong>und</strong> die Adlerjungen fressen es." - Sodann ist auch die Verspot<br />
tung <strong>de</strong>r Gerechten schwer sündhaft, <strong>de</strong>nn „<strong>de</strong>r Tugend Lohn<br />
ist die Ehre" [Aristoteles, Eth.IV,7; 1123 b 35]. Auch Job 12,4<br />
beklagt sich: „Die Aufrichtigkeit <strong>de</strong>r Gerechten wird verlacht."<br />
Derlei Verspottung ist höchst verhängnisvoll, <strong>de</strong>nn dadurch<br />
wer<strong>de</strong>n die Menschen davon abgehalten, Gutes zu tun gemäß<br />
Gregor (Moralia 20,14; ML 76,155): „Die da im Wirken an<strong>de</strong>rer<br />
das Gute aufkeimen sehen, reißen es mit <strong>de</strong>r Hand ihres gif<br />
tigen Spottes bald heraus."<br />
Zu 1. Spaßmachen verstößt nicht gegen die Liebe zu <strong>de</strong>m,<br />
mit <strong>de</strong>m Spaß gemacht wird, es kann jedoch Lieblosigkeit<br />
gegen <strong>de</strong>n ins Spiel kommen, über <strong>de</strong>n man lacht, wegen <strong>de</strong>r<br />
Verachtung, wie soeben bemerkt.<br />
Zu 2. Wer in die bereute Sün<strong>de</strong> zurückfällt <strong>und</strong> wer heu<br />
chelt, verspottet Gott nicht ausdrücklich, son<strong>de</strong>rn nur <strong>de</strong>m<br />
Anschein nach, insofern er sich wie ein Spötter verhält. Auch ist<br />
nicht schlechthin rückfällig o<strong>de</strong>r heuchlerisch, wer läßlich sün<br />
digt, son<strong>de</strong>rn es liegt nur eine Bereitschaft <strong>und</strong> eine unvollkom<br />
mene Regung dazu vor.<br />
Zu 3. Die Verspottung ist ihrer Natur nach etwas weniger<br />
Belangvolles als Ehrabschneidung <strong>und</strong> Schmähung, <strong>de</strong>nn sie<br />
be<strong>de</strong>utet nicht Verachtung, son<strong>de</strong>rn Spiel. Bisweilen jedoch<br />
schließt sie größere Verachtung ein als selbst Schmähung, wie<br />
oben (ANTW.) dargelegt wur<strong>de</strong>. Und dann ist sie Todsün<strong>de</strong>.<br />
192
76. FRAGE<br />
DIE VERFLUCHUNG<br />
Nunmehr ist die Verfluchung zu besprechen. Hierbei stellen<br />
sich vier Fragen:<br />
1. Ist es erlaubt, jemand zu verfluchen?<br />
2. Darf man etwas Vernunftloses verfluchen?<br />
3. Ist Verfluchung Todsün<strong>de</strong>?<br />
4. Vergleich mit an<strong>de</strong>ren Sün<strong>de</strong>n.<br />
1. ARTIKEL<br />
Darf man jemand verfluchen?<br />
1. Es ist nicht erlaubt, das Gebot <strong>de</strong>s Apostels zu übertreten,<br />
<strong>de</strong>r im Namen Christi sprach, wie es 2 Kor 13.3 heißt. Der<br />
Apostel selbst aber befiehlt Rom 12,14: „Segnet, <strong>und</strong> flucht<br />
nicht!" Also ist es nicht erlaubt, jeman<strong>de</strong>n zu verfluchen.<br />
2. Alle sind verpflichtet, Gott zu segnen (preisen) gemäß<br />
Dn3,82: „Segnet (preiset), ihr Menschenkin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Herrn!"<br />
Aus <strong>de</strong>mselben M<strong>und</strong> kann aber nicht zugleich Segnung (Prei<br />
sung) Gottes <strong>und</strong> Verfluchung <strong>de</strong>s Menschen hervorgehen, wie<br />
Jakobus (3,9ff) darlegt. Also ist es nicht erlaubt, jeman<strong>de</strong>n zu<br />
verfluchen.<br />
3. Wer jeman<strong>de</strong>n verflucht, wünscht ihm das Übel <strong>de</strong>r<br />
Schuld o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Strafe, <strong>de</strong>nn Verfluchung ist eine Art von Ver<br />
wünschung. Doch darf man einem an<strong>de</strong>ren nicht Böses wün<br />
schen, vielmehr muß man für alle beten, damit sie vom Bösen<br />
befreit wer<strong>de</strong>n. Also ist es nieman<strong>de</strong>m erlaubt, zu fluchen.<br />
4. Der Teufel ist wegen seiner Verstocktheit am meisten <strong>de</strong>r<br />
Bosheit ausgeliefert. Doch niemand darf <strong>de</strong>n Teufel verfluchen,<br />
so wenig wie sich selbst. Es heißt nämlich Sir21,30: „Wenn <strong>de</strong>r<br />
Gottlose <strong>de</strong>n Teufel verflucht, verflucht er seine Seele (sich<br />
selbst)". Also darf man noch viel weniger einen Menschen ver<br />
fluchen.<br />
5. Zu Nm23,8 „Wie soll ich <strong>de</strong>n verfluchen, <strong>de</strong>n Gott nicht<br />
verflucht?" sagt die Glosse (MG 12,687): „Wo die Gesinnung<br />
<strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs nicht bekannt ist, liegt da ein gerechter Gr<strong>und</strong> zur<br />
Verfluchung vor?" Nun kann niemand die Gesinnung eines<br />
an<strong>de</strong>ren Menschen kennen, <strong>und</strong> auch nicht wissen, ob er von<br />
193
76. l Gott verflucht ist. Also ist es nieman<strong>de</strong>m erlaubt, einem Men<br />
schen zu fluchen.<br />
DAGEGEN steht Dt27,26: „Verflucht sei, wer die Gebote<br />
dieses Gesetzes nicht hält." Auch Elisäus verfluchte die Knaben,<br />
die ihn verspotteten (4Kön2,24).<br />
ANTWORT. Verfluchen (maledicere = malum dicere=Böses<br />
sagen) ist soviel wie „Böses aussagen". Aussagen steht nun in<br />
einem dreifachen Verhältnis zu <strong>de</strong>m, was ausgesagt wird. Ein<br />
mal nämlich als schlichte Aussage, wie dies durch Indikativform<br />
ausgedrückt wird. So be<strong>de</strong>utet „Böses aussagen" nichts an<strong>de</strong>res<br />
als Böses über <strong>de</strong>n Nächsten berichten. Dies gehört zur Ehr<br />
abschneidung. Daher nennt man die, welche Übles re<strong>de</strong>n, auch<br />
Ehrabschnei<strong>de</strong>r. - Zweitens wird das Wort „sagen" zur Bezeich<br />
nung <strong>de</strong>r Verursachung gebraucht. So steht es in erster Linie<br />
<strong>und</strong> hauptsächlich Gott zu, <strong>de</strong>r alles durch sein Wort erschaffen<br />
hat, gemäß Ps32,9: „Er sagte (sprach), <strong>und</strong> es ward." In <strong>de</strong>r<br />
Folge kommt es auch <strong>de</strong>n Menschen zu, die durch ihr Befehls<br />
wort an<strong>de</strong>re veranlassen, etwas zu tun. In diesem Sinn gibt es<br />
die imperativische Aussageform. - Drittens wird „sagen" noch<br />
gebraucht, um die in einem Wort enthaltenen Wünsche zum<br />
Ausdruck zu bringen. Und zu diesem Zweck wur<strong>de</strong> die Optative<br />
Wortform eingeführt.<br />
Die erste Weise, durch die schlicht <strong>und</strong> einfach Böses ausge<br />
sagt wird, sei übergangen, <strong>und</strong> es sei nur von <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong><br />
ren die Re<strong>de</strong>. Dabei muß man wissen, daß „etwas tun" <strong>und</strong> „es<br />
wollen" sich moralisch nicht unterschei<strong>de</strong>n: bei<strong>de</strong> Akte sind<br />
jeweils gut o<strong>de</strong>r böse, wie oben (1-1120,3) dargelegt wur<strong>de</strong>.<br />
Folglich gilt auch für die imperative wie für die Optative Aus<br />
sageform das gleiche bezüglich erlaubt <strong>und</strong> unerlaubt. Wenn<br />
nämlich einer Böses für seinen Nächsten befiehlt o<strong>de</strong>r wünscht,<br />
<strong>und</strong> zwar absichtlich Böses als Böses, dann ist solches „Böses<br />
aussagen" auf je<strong>de</strong> Art unerlaubt. Und dies heißt im eigentli<br />
chen Sinn „verfluchen". - Befiehlt o<strong>de</strong>r wünscht jedoch einer<br />
Böses für seinen Nächsten unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt <strong>de</strong>s<br />
Guten, dann ist es erlaubt. Dies ist eigentlich auch gar kein ver<br />
fluchen, son<strong>de</strong>rn sieht nur danach aus, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Sprechen<strong>de</strong> hat<br />
in erster Linie nicht das Böse, son<strong>de</strong>rn das Gute im Auge.<br />
Böses kann man jedoch unter einem doppelten Gesichts<br />
punkt <strong>de</strong>s Guten befehlen o<strong>de</strong>r wünschen. Bisweilen nämlich<br />
unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt <strong>de</strong>s Gerechten. So „verdammt" <strong>de</strong>r<br />
Richter erlaubterweise einen, <strong>de</strong>m er gerechte Strafe aufzuerle-<br />
194
gen befiehlt. Und in dieser Weise „verurteilt" auch die Kirche, 76. 2<br />
in<strong>de</strong>m sie <strong>de</strong>n Kirchenbann (das Anathem) ausspricht. Ebenso<br />
haben auch die Propheten <strong>de</strong>n Sün<strong>de</strong>rn bisweilen Böses ange<br />
droht, in<strong>de</strong>m sie gleichsam ihren Willen mit <strong>de</strong>r göttlichen<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> gleichsetzten, - doch kann man <strong>de</strong>rlei Verwün<br />
schungen auch als Verkündigung kommen<strong>de</strong>n Unheils verste<br />
hen. - Bisweilen wird etwas Böses unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt<br />
<strong>de</strong>s Nützlichen ausgesprochen, z. B. wenn jemand einem Sün<br />
<strong>de</strong>r Krankheit o<strong>de</strong>r sonst eine hin<strong>de</strong>rliche Sache wünscht, damit<br />
er sich entwe<strong>de</strong>r bessert o<strong>de</strong>r wenigstens aufhört, an<strong>de</strong>ren zu<br />
scha<strong>de</strong>n.<br />
Zu 1. Der Apostel verbietet das eigentliche Verfluchen, d. h.<br />
jenes, das mit schlechter Absicht verb<strong>und</strong>en ist.<br />
Die gleiche Antwort gilt für Zu 2.<br />
Zu 3: Jeman<strong>de</strong>m etwas Böses unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt <strong>de</strong>s<br />
Guten wünschen wi<strong>de</strong>rspricht nicht <strong>de</strong>r Absicht, einem<br />
schlechthin Gutes zu erweisen, son<strong>de</strong>rn steht damit vielmehr in<br />
Einklang.<br />
Zu 4. Beim Teufel ist zwischen Natur <strong>und</strong> Schuld zu unter<br />
schei<strong>de</strong>n. Seine Natur ist gut <strong>und</strong> stammt von Gott, darum darf<br />
man sie auch nicht verfluchen. Seine Schuld jedoch ist zu verflu<br />
chen gemäß Job 3,8: „Es sollen ihr (nämlich <strong>de</strong>r Nacht, in <strong>de</strong>r er<br />
geboren wur<strong>de</strong>) fluchen, die <strong>de</strong>m Tag fluchen." Wenn aber <strong>de</strong>r<br />
Sün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Teufel flucht wegen <strong>de</strong>ssen Schuld, so hält er sich<br />
selbst aus ähnlichem Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Verfluchung wert. In diesem<br />
Sinn ist auch das Wort „Seine Seele verfluchen" zu verstehen.<br />
Zu 5. Auch wenn die Gesinnung <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs an sich nicht<br />
zu sehen ist, so läßt sie sich aus einer offenk<strong>und</strong>igen Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>n<br />
noch erkennen, <strong>und</strong> dafür wird ihm die Strafe auferlegt. Ebenso<br />
gilt: wenngleich man nicht wissen kann, wen Gott im Hinblick<br />
auf die endgültige Verwerfung verflucht, so kann man immer<br />
hin wissen, wen Gott angesichts einer hier <strong>und</strong> jetzt vorliegen<br />
<strong>de</strong>n Schuld verflucht.<br />
2. ARTIKEL<br />
Darf man etwas Vernunftloses verfluchen?<br />
1. Die Verfluchung scheint vor allem als Strafe für ein Vergehen<br />
erlaubt zu sein. Doch die vernunftlose Kreatur ist we<strong>de</strong>r einer<br />
Schuld noch Strafe fähig. Also darf man sie nicht verfluchen.<br />
195
76. 2 2. Bei <strong>de</strong>r vernunftlosen Schöpfung fin<strong>de</strong>t sich nichts an<strong>de</strong><br />
res als die Natur, die Gott geschaffen hat. Diese jedoch darf<br />
man selbst beim Teufel nicht verfluchen (o. Zu 4). Also darf<br />
man die vernunftlose Kreatur überhaupt nicht verfluchen.<br />
3. Das Vernunftlose ist entwe<strong>de</strong>r etwas Bleiben<strong>de</strong>s, wie die<br />
Körper, o<strong>de</strong>r etwas Vorübergehen<strong>de</strong>s, wie die Zeit. Nach Gre<br />
gor (Moralia4,2; ML 75,634) ist es nun „müßig, zu verfluchen,<br />
was nicht existiert, sündhaft jedoch, wenn es existierte". Also<br />
darf man etwas Vernunftloses überhaupt nicht verfluchen.<br />
DAGEGEN steht, daß <strong>de</strong>r Herr <strong>de</strong>n Feigenbaum verflucht<br />
hat (Mt21,19), <strong>und</strong> „Job verfluchte seinen Tag" (Job 3,1).<br />
ANTWORT. Nur etwas, <strong>de</strong>m Gutes o<strong>de</strong>r Böses wi<strong>de</strong>rfahren<br />
kann, läßt sich streng genommen segnen o<strong>de</strong>r verfluchen, <strong>und</strong><br />
das ist die vernunftbegabte Kreatur. Den vernunftlosen Wesen<br />
jedoch wird „gut" <strong>und</strong> „böse" zugeschrieben im Hinblick auf<br />
die vernunftbegabte Kreatur, <strong>de</strong>r sie zu dienen hat. In vielfacher<br />
Weise nun sind sie auf diese hingeordnet. Einmal als Hilfe, inso<br />
fern die Bedürfnisse <strong>de</strong>s Menschen durch die vernunftlosen<br />
Geschöpfe befriedigt wer<strong>de</strong>n. In diesem Sinn sprach Gott zum<br />
Menschen Gn3,17: „Die Er<strong>de</strong> sei verflucht wegen <strong>de</strong>iner<br />
Taten", nämlich auf daß <strong>de</strong>r Mensch durch ihre Unfruchtbarkeit<br />
bestraft wer<strong>de</strong>. So ist auch Dt28,5 zu verstehen: „Gesegnet<br />
seien <strong>de</strong>ine Scheuern", <strong>und</strong> danach: „Verflucht sei <strong>de</strong>ine<br />
Scheuer". In diesem Sinn auch verfluchte David die Berge Gel<br />
boes, [2 Sam 1,21] gemäß <strong>de</strong>r Auslegung Gregors (Moralia 4,4;<br />
ML 75,636). - Sodann dienen die vernunftlosen Dinge <strong>de</strong>r ver<br />
nunftbegabten Kreatur als Sinnbil<strong>de</strong>r. Auf diese Weise verfluch<br />
te <strong>de</strong>r Herr <strong>de</strong>n Feigenbaum als Zeichen für Juda. - Drittens<br />
nimmt die vernünftige Kreatur vernunftlose Dinge als zeitli<br />
chen o<strong>de</strong>r ortsbestimmen<strong>de</strong>n Rahmen. So verfluchte Job <strong>de</strong>n<br />
Tag seiner Geburt, weil ihn da, bei seiner Geburt, die Erbschuld<br />
traf, <strong>und</strong> wegen <strong>de</strong>r daraus folgen<strong>de</strong>n Strafen. Aus <strong>de</strong>mselben<br />
Gr<strong>und</strong> verfluchte David - so kann man 2 Sam 1,21 verstehen -<br />
die Berge Gelboes, weil sein Volk dort eine Nie<strong>de</strong>rlage erlitten<br />
hatte.<br />
Vernunftlose Dinge zu verfluchen, insofern sie Schöpfung<br />
Gottes sind, ist eine Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Gotteslästerung . - Sie verflu<br />
chen, weil sie sind, wie sie sind, ist müßig <strong>und</strong> sinnlos <strong>und</strong> daher<br />
unerlaubt.<br />
196<br />
Daraus ergibt sich die Lösung <strong>de</strong>r Einwän<strong>de</strong>.
3. ARTIKEL 76. 3<br />
Ist Verfluchen Todsün<strong>de</strong>?<br />
1. Augustinus rechnet in seiner Homilie Über das Fegfeuer<br />
(Sermol04; ML 30,1947) die Verfluchung unter die leichten<br />
Sün<strong>de</strong>n. Solcher Art aber sind die läßlichen. Also ist Verflu<br />
chung nicht Todsün<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn nur läßliche.<br />
2. Was einer flüchtigen Geistesregung entspringt, ist nicht<br />
Todsün<strong>de</strong>. Doch Verfluchung entsteht zuweilen aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong>. Also ist sie nicht Todsün<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn nur läßliche.<br />
3. Schlimmer ist Böses tun als „Böses sagen" (fluchen).<br />
Doch Böses tun ist nicht immer Todsün<strong>de</strong>. Also noch viel weni<br />
ger „Böses sagen".<br />
DAGEGEN steht, daß nichts vom Reich Gottes ausschließt<br />
außer <strong>de</strong>r Todsün<strong>de</strong>. Doch Verfluchung schließt vom Reich<br />
Gottes aus gemäß lKor6,10: „We<strong>de</strong>r Verflucher noch Räuber<br />
wer<strong>de</strong>n das Reich Gottes besitzen". Also ist Verfluchung Tod<br />
sün<strong>de</strong>.<br />
ANTWORT. Die Verfluchung, von <strong>de</strong>r hier die Re<strong>de</strong> ist,<br />
besteht im Aussprechen von etwas Bösem gegen jemand, sei es<br />
in Befehls-, sei es in Wunschform. Dem Nächsten aber etwas<br />
Böses wünschen o<strong>de</strong>r durch Befehl dazu bewegen wi<strong>de</strong>rspricht<br />
an sich <strong>de</strong>r Caritas, mit <strong>de</strong>r wir <strong>de</strong>n Nächsten lieben, in<strong>de</strong>m wir<br />
Gutes für ihn wollen. Daher ist jenes Han<strong>de</strong>ln seiner Art nach<br />
Todsün<strong>de</strong>, <strong>und</strong> eine umso schwerere, je mehr wir die Person, die<br />
wir verfluchen, lieben <strong>und</strong> verehren müssen. Daher heißt es<br />
Lv20,9: „Wer seinem Vater o<strong>de</strong>r seiner Mutter flucht, soll <strong>de</strong>s<br />
To<strong>de</strong>s sterben".<br />
Es kommt jedoch vor, daß ein Verfluchungswort nur läßliche<br />
Sün<strong>de</strong> ist, sei es wegen <strong>de</strong>r Geringfügigkeit <strong>de</strong>s Übels, das<br />
jemand einem an<strong>de</strong>ren verfluchend wünscht, sei es wegen <strong>de</strong>r<br />
Geistesverfassung <strong>de</strong>s Verfluchen<strong>de</strong>n, wenn er aus flüchtiger<br />
Erregung o<strong>de</strong>r im Spaß o<strong>de</strong>r irgendwie spontan <strong>de</strong>rlei Worte<br />
von sich gibt. Wortsün<strong>de</strong>n sind ja, wie oben (72,2) bemerkt, vor<br />
allem nach <strong>de</strong>r Gesinnung zu beurteilen.<br />
Daraus ergibt sich die Lösung <strong>de</strong>r Einwän<strong>de</strong>.<br />
197
76. 4 4. ARTIKEL<br />
Ist Verfluchen eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Ehrabschneidung?<br />
1. Verfluchung ist eine Art Lästerung, wie aus <strong>de</strong>m Judasbrief<br />
(V. 9) hervorgeht: „Als <strong>de</strong>r Erzengel Michael mit <strong>de</strong>m Teu<br />
fel rechtete <strong>und</strong> um <strong>de</strong>n Leib <strong>de</strong>s Moses stritt, hat er nicht<br />
gewagt, ein lästerliches Urteil zu fällen". Und „Lästerung"<br />
nimmt die Glosse (interlin.VI,238r) hier für Verfluchung.<br />
Lästerung aber ist eine schwerere Sün<strong>de</strong> als Ehrabschneidung.<br />
Also auch Verfluchung.<br />
2. Mord ist schwerer als Ehrabschneidung, wie oben (73,3)<br />
erklärt wur<strong>de</strong>. Doch Verfluchung <strong>und</strong> Mord sind gleich schwer.<br />
Cbrysostomus schreibt nämlich in seinem Matthäuskommentar<br />
(Horn. 19; MG57,285): „Wenn du sagst: ,Fluch ihm, reiße sein<br />
Haus ein <strong>und</strong> laß alles zugr<strong>und</strong>egehen', so bist du nichts an<strong>de</strong>res<br />
als ein Mör<strong>de</strong>r". Also ist Verfluchung schwerer als Ehrabschnei<br />
dung.<br />
3. Eine Ursache ist wirksamer als ein Zeichen. Doch wer<br />
verflucht, verursacht durch seinen Befehl ein Übel. Wer hinge<br />
gen die Ehre abschnei<strong>de</strong>t, zeigt nur ein bereits bestehen<strong>de</strong>s<br />
Übel an. Also sündigt <strong>de</strong>r Verfluchen<strong>de</strong> mehr als <strong>de</strong>r Ehrab<br />
schnei<strong>de</strong>r.<br />
DAGEGEN steht, daß Ehrabschneidung niemals gut wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Die Verfluchung hingegen läßt sich, wie dargelegt wur<strong>de</strong>,<br />
im guten <strong>und</strong> schlechten Sinn anwen<strong>de</strong>n. Also ist Ehrabschnei<br />
dung schwerer sündhaft als Verfluchung.<br />
ANTWORT. Wie im I. Buch (148,5) erklärt wur<strong>de</strong>, gibt es ein<br />
zweifaches Übel: das <strong>de</strong>r Schuld <strong>und</strong> das <strong>de</strong>r Strafe. Das Übel<br />
<strong>de</strong>r Schuld aber ist schlimmer (ebda). Und so ist das Aussagen<br />
von Schuld auch schlimmer als das Aussagen von Strafe, vor<br />
ausgesetzt, die Art <strong>de</strong>s Aussagens ist die gleiche. Bei Schmä<br />
hung nun wie auch bei Ohrenbläserei <strong>und</strong> Ehrabschneidung<br />
sowie bei Verspottung wird Schuld ausgesagt, doch <strong>de</strong>r Verflu<br />
cher, wie jetzt von ihm die Re<strong>de</strong> ist, spricht Strafübel, aber kein<br />
Schuldübel aus, - dieses höchstens unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt<br />
<strong>de</strong>r Strafe. Die Art <strong>und</strong> Weise <strong>de</strong>s Sprechens ist jedoch verschie<br />
<strong>de</strong>n. Denn um die vier vorgenannten Laster auszusprechen,<br />
genügt es, die Schuld einfach zu nennen; bei <strong>de</strong>r Verfluchung<br />
jedoch wird Strafe ausgesprochen, in<strong>de</strong>m man sie entwe<strong>de</strong>r in<br />
Form eines Befehls o<strong>de</strong>r eines Wunsches verursacht. Das Aus-<br />
198
sagen von Schuld ist nun Sün<strong>de</strong>, insofern dadurch <strong>de</strong>m Nach- 76. 4<br />
sten Scha<strong>de</strong>n zugefügt wird. Schwerer jedoch wiegt Scha<strong>de</strong>n<br />
zufügen als - unter gleichen Voraussetzungen - Scha<strong>de</strong>n nur<br />
wünschen. Daher ist Ehrabschneidung nach gemeinem Ver<br />
ständnis eine schwerere Sün<strong>de</strong> als jene Verfluchung, die nur<br />
einen einfachen Wunsch zum Ausdruck bringt. Die Verfluchung<br />
jedoch in Form eines Befehls kann wegen ihres Ursachecharak<br />
ters schwerer als Ehrabschneidung sein, falls sie mehr Scha<strong>de</strong>n<br />
bewirkt als es Anschwärzung ist, - o<strong>de</strong>r bei geringem Scha<strong>de</strong>n<br />
auch leichter.<br />
All dies versteht sich entsprechend <strong>de</strong>m, was zu <strong>de</strong>n wesent<br />
lichen Elementen dieser Sün<strong>de</strong>n gehört. Es können freilich auch<br />
noch zufällige Umstän<strong>de</strong> in Betracht kommen, wodurch sich<br />
die Sündhaftigkeit verschlimmert o<strong>de</strong>r abschwächt.<br />
Zu 1. Die Verfluchung <strong>de</strong>r Schöpfung, insofern sie Schöp<br />
fung ist, fällt auf Gott zurück <strong>und</strong> nimmt dadurch <strong>de</strong>n Charak<br />
ter <strong>de</strong>r Gotteslästerung an. Nicht so verhielte es sich, wenn die<br />
Schöpfung verflucht wür<strong>de</strong> wegen einer Schuld. Und das<br />
gleiche gilt von <strong>de</strong>r Ehrabschneidung.<br />
Zu 2. Wie gesagt (s. o.), verbin<strong>de</strong>t sich eine Form von Verflu<br />
chung mit <strong>de</strong>m Wunsch, daß Böses geschehe. Wenn daher<br />
jemand in seinen Fluch <strong>de</strong>n Gedanken <strong>de</strong>s Mor<strong>de</strong>s an seinem<br />
Nächsten miteinbezieht, so unterschei<strong>de</strong>t er sich <strong>de</strong>r Absicht<br />
nach nicht von einem Mör<strong>de</strong>r. Ein Unterschied besteht freilich<br />
darin, daß durch die äußere Ausführung zum reinen Willensakt<br />
noch etwas hinzukommt.<br />
Zu 3. Diese Überlegung gilt nur für die imperative Verflu<br />
chung.<br />
199
77. FRAGE<br />
DER BETRUG<br />
BEI KAUF UND VERKAUF<br />
Nun sind die Sün<strong>de</strong>n zu besprechen, die bei freiwilligen<br />
Tauschhandlungen vorkommen.<br />
Dabei geht es erstens um Betrug bei Kauf <strong>und</strong> Verkauf, zwei<br />
tens um <strong>de</strong>n Wucher bei Leihgeschäften. Bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren frei<br />
willigen Tauschhandlungen gibt es nämlich keine von Raub<br />
o<strong>de</strong>r Diebstahl verschie<strong>de</strong>nen Arten von Sün<strong>de</strong>.<br />
Bezüglich <strong>de</strong>s ersten Punktes ergeben sich vier Fragen:<br />
1. Der Preis beim ungerechten Verkauf, d. h. darf man etwas<br />
über seinen Wert verkaufen?<br />
2. Der ungerechte Verkauf von <strong>de</strong>r Ware her gesehen.<br />
3. Muß <strong>de</strong>r Verkäufer auf einen Warenfehler hinweisen?<br />
4. Darf bei Han<strong>de</strong>lsgeschäften <strong>de</strong>r Verkaufspreis höher sein<br />
als <strong>de</strong>r Einkaufspreis?<br />
1. ARTIKEL<br />
Darf man etwas über seinen Wert verkaufen?<br />
1. Das Gerechte bei <strong>de</strong>n Tauschgeschäften wird in <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Gesellschaft nach bürgerlichen Gesetzen be<br />
stimmt. Doch danach (KRII,179b u. 180a) ist es Käufer <strong>und</strong><br />
Verkäufer erlaubt, sich gegenseitig zu hintergehen. Dies ge<br />
schieht dadurch, daß <strong>de</strong>r Verkäufer seine Ware über Wert ver<br />
kauft, <strong>de</strong>r Käufer sie hingegen unter Wert bezahlt. Also darf<br />
man eine Sache über Wert verkaufen.<br />
2. Was unter <strong>de</strong>n Menschen allgemein verbreitet ist, scheint<br />
etwas Natürliches zu sein. Augustinus gibt nun im XIII. Buch<br />
Über die Dreifaltigkeit (c. 3; ML 42,1017) das Wort eines von<br />
allen beklatschten Schauspielers wie<strong>de</strong>r: „Ihr wollt billig ein<br />
kaufen <strong>und</strong> teuer verkaufen." Damit stimmt auch Spr20,14<br />
überein: „,Schlecht, schlecht!' sagt je<strong>de</strong>r Käufer, ist er aber weg,<br />
dann prahlt er." Also ist es erlaubt, etwas teurer zu verkaufen<br />
<strong>und</strong> billiger einzukaufen, als es wert ist.<br />
3. Es scheint nicht unerlaubt, auf-Vereinbarung hin zu tun,<br />
was man schon nach <strong>de</strong>n Regeln <strong>de</strong>r Ehrbarkeit tun muß. Nun<br />
200
hat nach Aristoteles (Eth.VIII, 15; 1163 a 16) unter Fre<strong>und</strong>en 77 1<br />
jener, <strong>de</strong>r eine Wohltat empfangen hat, entsprechend <strong>de</strong>m<br />
erlangten N<strong>utz</strong>en einen Ausgleich zugunsten <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren zu<br />
leisten [64]. Diese Gegenleistung übersteigt bisweilen <strong>de</strong>n Wert<br />
<strong>de</strong>r erhaltenen Sache, z. B. wenn jemand etwas sehr nötig hat,<br />
um einer Gefahr zu begegnen o<strong>de</strong>r einen Vorteil zu erlangen.<br />
Also ist es erlaubt, im Kauf- <strong>und</strong> Verkaufsvertrag etwas um<br />
höheren Preis, als es wert ist, abzugeben.<br />
DAGEGEN steht bei Mt7,12: „Alles, was ihr von an<strong>de</strong>ren<br />
erwartet, das tut auch ihnen." Niemand aber will, daß ihm eine<br />
Sache teurer verkauft wer<strong>de</strong>, als sie wert ist. Also darf niemand<br />
<strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren eine Sache über Wert verkaufen.<br />
ANTWORT. Betrug anwen<strong>de</strong>n, um etwas über <strong>de</strong>m gerech<br />
ten Preis zu verkaufen, ist unter allen Umstän<strong>de</strong>n Sün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn<br />
dadurch wird <strong>de</strong>r Nächste zu seinem Scha<strong>de</strong>n hintergangen.<br />
Daher sagt auch Cicero im III. Buch seiner Pflichtenlehre<br />
(c. 15): „Von Verträgen ist je<strong>de</strong> Lüge fernzuhalten; <strong>de</strong>r Verkäu<br />
fer soll keinen Mehrbieten<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Käufer keinen, <strong>de</strong>r ihn unter<br />
bietet, zulassen."<br />
Sehen wir vom Betrug einmal ab, so können wir über Kauf<br />
<strong>und</strong> Verkauf in doppelter Weise sprechen. Einmal an sich. Und<br />
so scheinen Kauf <strong>und</strong> Verkauf zum gemeinsamen N<strong>utz</strong>en bei<br />
<strong>de</strong>r Teile eingeführt wor<strong>de</strong>n zu sein, in<strong>de</strong>m nämlich <strong>de</strong>r eine die<br />
Sache <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren nötig hat <strong>und</strong> umgekehrt, wie Aristoteles im<br />
I.Buch seiner Politik (c.9; 1257a6) bemerkt. Was nun zum<br />
gemeinsamen N<strong>utz</strong>en eingeführt wur<strong>de</strong>, darf <strong>de</strong>n einen nicht<br />
mehr belasten als <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren. Daher muß <strong>de</strong>r Vertrag zwi<br />
schen ihnen unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt <strong>de</strong>s sachlichen Aus<br />
gleichs abgeschlossen wer<strong>de</strong>n. Der Wert <strong>de</strong>r Dinge aber, die<br />
zum N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>s Menschen in Umlauf kommen, wird nach <strong>de</strong>m<br />
bezahlten Preis bemessen. Zu diesem Zweck wur<strong>de</strong> das Geld<br />
erf<strong>und</strong>en, wie es im V.Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 8; 1133a29) heißt.<br />
Wenn daher <strong>de</strong>r Preis <strong>de</strong>n Sachwert übersteigt o<strong>de</strong>r, umgekehrt,<br />
<strong>de</strong>r Sachwert <strong>de</strong>n Preis übersteigt, ist von ausgleichen<strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> keine Re<strong>de</strong> mehr. Teurer verkaufen o<strong>de</strong>r billiger<br />
einkaufen, als eine Sache wert ist, ist also an sich ungerecht <strong>und</strong><br />
unerlaubt.<br />
In an<strong>de</strong>rer Weise können wir von Kauf <strong>und</strong> Verkauf spre<br />
chen, sofern daraus zufällig <strong>de</strong>m einen ein Vorteil <strong>und</strong> <strong>de</strong>m<br />
an<strong>de</strong>ren ein Nachteil entsteht, z. B. wenn einer etwas sehr nötig<br />
hat <strong>und</strong> <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re geschädigt wür<strong>de</strong>, wenn er es entbehren<br />
201
77. l müßte. In diesem Fall ergibt sich <strong>de</strong>r gerechte Preis nicht nur im<br />
Hinblick auf die Sache, die verkauft wird, son<strong>de</strong>rn auch im Hin<br />
blick auf <strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Verkäufer aus <strong>de</strong>m Verkauf ent<br />
steht. Und so kann etwas teurer verkauft wer<strong>de</strong>n, als es an sich<br />
wert ist, obwohl es nicht teurer verkauft wer<strong>de</strong>n sollte, als es<br />
<strong>de</strong>m Besitzer wert ist.<br />
Hat aber jemand einen großen N<strong>utz</strong>en von <strong>de</strong>r erhaltenen<br />
Sache, <strong>de</strong>r Verkäufer durch die Weggabe jedoch keinen Nach<br />
teil, so darf er sie nicht teurer verkaufen. Denn <strong>de</strong>r Vorteil, <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren zufällt, entsteht nicht aus <strong>de</strong>m Verkauf, son<strong>de</strong>rn<br />
aus <strong>de</strong>r Lage <strong>de</strong>s Käufers. Niemand aber darf jeman<strong>de</strong>m etwas<br />
verkaufen, was ihm nicht gehört, wenn er ihm auch <strong>de</strong>n Scha<br />
<strong>de</strong>n berechnen kann, <strong>de</strong>n er erlei<strong>de</strong>t. Wer hingegen durch die<br />
erhaltene Sache eine große Hilfe erfährt, kann <strong>de</strong>m Verkäufer<br />
freiwillig etwas dreingeben, - dies wäre eine ehrenhafte Geste.<br />
Zu 1. Wie oben (1-1196,2) bemerkt, beansprucht das<br />
menschliche Gesetz seine Gültigkeit für die ganze Gesellschaft,<br />
in <strong>de</strong>r es viele lasterhafte Glie<strong>de</strong>r gibt, <strong>und</strong> nicht nur für die<br />
Tugendhaften. Daher konnte es nicht alles verhin<strong>de</strong>rn, was <strong>de</strong>r<br />
Tugend wi<strong>de</strong>rspricht, es genügt ihm, das zu verhin<strong>de</strong>rn, was das<br />
Zusammenleben <strong>de</strong>r Menschen unmöglich macht. An<strong>de</strong>re<br />
Dinge hingegen gelten ihm als „erlaubt", nicht weil es sie gut<br />
hieße, son<strong>de</strong>rn nur, weil es sie nicht bestraft. So hält es gleich<br />
sam auch für erlaubt <strong>und</strong> for<strong>de</strong>rt dafür keine Bestrafung, wenn<br />
<strong>de</strong>r Verkäufer, ohne zu betrügen, seine Sache teurer verkauft<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Käufer billiger einkauft, immer vorausgesetzt, <strong>de</strong>r Un<br />
terschied ist nicht zu groß, <strong>de</strong>nn dann zwingt auch das mensch<br />
liche Gesetz zur Restitution, z. B. wenn jemand um mehr als die<br />
Hälfte <strong>de</strong>s gerechten Preises betrogen wur<strong>de</strong> (KRII, 179 b). Das<br />
göttliche Gesetz jedoch läßt nichts, was <strong>de</strong>r Tugend wi<strong>de</strong>r<br />
spricht, ungestraft. Daher gilt nach ihm als unerlaubt, wenn bei<br />
Kauf <strong>und</strong> Verkauf <strong>de</strong>r gerechte Ausgleich nicht gewahrt wird.<br />
Und wer zuviel an sich genommen hat, muß <strong>de</strong>m Geschädigten<br />
Ersatz leisten, falls es sich um nennenswerten Scha<strong>de</strong>n han<strong>de</strong>lt.<br />
Ich sage dies <strong>de</strong>shalb, weil sich <strong>de</strong>r gerechte Preis nicht immer<br />
auf <strong>de</strong>n i-Punkt genau ausmachen läßt, son<strong>de</strong>rn mehr auf Schät<br />
zung beruht, so daß ein geringes Mehr o<strong>de</strong>r Weniger <strong>de</strong>n<br />
gerechten Ausgleich nicht aufzuheben scheint.<br />
Zu 2. Augustinus sagt ebendort: „Beim Gedanken an sich<br />
selbst o<strong>de</strong>r die Erfahrung mit an<strong>de</strong>ren vor Augen meinte jener<br />
Schauspieler, billig einkaufen <strong>und</strong> teuer verkaufen wollen sei<br />
202
allgemein verbreitet. Weil dies aber tatsächlich Sün<strong>de</strong> ist, kann 77. 2<br />
hier je<strong>de</strong>r dadurch <strong>Gerechtigkeit</strong> erlangen, daß er <strong>de</strong>m siegreich<br />
wi<strong>de</strong>rsteht." Und er bringt ein Beispiel von einem, <strong>de</strong>r, obgleich<br />
ihm jemand aus Unwissenheit nur eine geringe Summe für ein<br />
Buch abverlangte, <strong>de</strong>n gerechten Preis bezahlte. Daraus folgt,<br />
daß jenes allgemeine Bestreben nicht aus <strong>de</strong>r Natur, son<strong>de</strong>rn<br />
aus <strong>de</strong>m Laster folgt. Es ist nur jenen vielen allgemein geläufig,<br />
die auf <strong>de</strong>r breiten Straße <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> einhergehen.<br />
Zu 3. Bei <strong>de</strong>r Tauschgerechtigkeit wird vor allem auf <strong>de</strong>n<br />
sachlichen Ausgleich geachtet. Doch die auf N<strong>utz</strong>en beruhen<strong>de</strong><br />
Fre<strong>und</strong>schaft sieht eben auf <strong>de</strong>n N<strong>utz</strong>en, <strong>und</strong> daher muß sich<br />
die Gegenleistung nach <strong>de</strong>m herausgekommenen N<strong>utz</strong>en rich<br />
ten, beim Kauf hingegen entsprechend <strong>de</strong>m Ausgleich in <strong>de</strong>r<br />
Sache.<br />
2. ARTIKEL<br />
Wird <strong>de</strong>r Verkauf ungerecht <strong>und</strong> unerlaubt wegen Fehlerhaftigkeit<br />
<strong>de</strong>r verkauften Sache?<br />
1. Ist <strong>de</strong>r wesentliche Bestand einer Sache vorhan<strong>de</strong>n, so fällt<br />
das übrige weniger mehr ins Gewicht. Nun scheint <strong>de</strong>r Verkauf<br />
nicht unerlaubt zu sein, selbst wenn <strong>de</strong>r wesentliche Bestand<br />
nicht vorhan<strong>de</strong>n ist, z. B. wenn jemand Alchimiesilber o<strong>de</strong>r<br />
-gold anstelle von echtem verkauft, das man für alle Gebrauchs<br />
gegenstän<strong>de</strong> aus Silber <strong>und</strong> Gold benötigt, z. B. zur Herstellung<br />
von Gefäßen <strong>und</strong> <strong>de</strong>rgleichen. Also ist <strong>de</strong>r Verkauf noch viel<br />
weniger unerlaubt, wenn es sich um an<strong>de</strong>re Mängel han<strong>de</strong>lt.<br />
2. Mengenmäßige Mängel in <strong>de</strong>r Sache scheinen <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit, die im Gleichmaß besteht, am meisten zu wi<strong>de</strong>rspre<br />
chen. Die Menge aber wird durch das Maß festgestellt. Die<br />
Meßgrößen für die Dinge, die <strong>de</strong>m Menschen zum Gebrauch<br />
dienen, sind jedoch nicht genau festgelegt, son<strong>de</strong>rn hier größer,<br />
dort kleiner, wie aus <strong>de</strong>s Aristoteles V.Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 10;<br />
1135a 1) hervorgeht. Ein quantitativer Mangel bei <strong>de</strong>r verkauf<br />
ten Sache läßt sich also nicht vermei<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> darum wird <strong>de</strong>r<br />
Verkauf <strong>de</strong>swegen wohl nicht unerlaubt sein.<br />
3. Ein Mangel an <strong>de</strong>r Sache liegt vor, wenn ihr die entspre<br />
chen<strong>de</strong> Qualität fehlt. Wer jedoch über Qualität einer Sache<br />
Bescheid wissen will, braucht umfassen<strong>de</strong> Kenntnisse, die <strong>de</strong>n<br />
meisten Kaufleuten abgehen. Also wird <strong>de</strong>r Verkauf nicht uner<br />
laubt wegen eines Fehlers <strong>de</strong>r Sache. .<br />
203
77. 2 DAGEGEN schreibt Ambrosius im III. Buch seiner Pflichten<br />
lehre (c. 11; ML 16,175): „Es ist eine klare Regel <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit, daß es sich für <strong>de</strong>n rechtschaffenen Mann nicht geziemt,<br />
vom Wahren abzuweichen, noch irgendwem einen Scha<strong>de</strong>n<br />
zuzufügen, noch seine Sache irgendwie mit Betrug in Verbin<br />
dung zu bringen."<br />
ANTWORT. Eine Sache, die verkauft wird, kann einen dreifa<br />
chen Mangel aufweisen. Der erste bezieht sich auf ihren<br />
Wesensbestand. Ist ein solcher Mangel <strong>de</strong>m Verkäufer beim<br />
Verkauf <strong>de</strong>r Sache bekannt, dann begeht er dabei einen Betrug;<br />
daher wird <strong>de</strong>r Verkauf unerlaubt. Und das ist es, was bei<br />
Is 1,22 gegen gewisse Leute gesagt wird: „Dein Silber wur<strong>de</strong> zu<br />
Schlacke, <strong>de</strong>in Wein ist mit Wasser vermischt." Was vermischt<br />
ist, verliert nämlich seinen spezifischen Wesensbestand. - Der<br />
zweite Mangel liegt in <strong>de</strong>r Quantität, die durch Messung festge<br />
stellt wird. Wer darum wissentlich beim Verkauf zu wenig mißt,<br />
begeht Betrug, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Verkauf ist unerlaubt. Daher heißt es<br />
Dt 25,13 f.: „Du sollst nicht zweierlei Gewicht im Beutel haben,<br />
ein größeres <strong>und</strong> ein kleineres; auch sollst du in <strong>de</strong>inem Hause<br />
nicht einen größeren <strong>und</strong> einen kleineren Scheffel haben." Und<br />
nachher (V. 16) wird hinzugefügt: „Denn <strong>de</strong>r Herr verabscheut<br />
<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r solches tut, <strong>und</strong> ist ein Feind aller Ungerechtigkeit." -<br />
Der dritte Mangel bezieht sich auf die Qualität, z. B. wenn einer<br />
ein krankes Tier als ges<strong>und</strong>es verkauft. Wer dies bewußt tut, be<br />
geht Betrug beim Verkauf, <strong>de</strong>shalb ist <strong>de</strong>r Verkauf unerlaubt.<br />
Und bei alle<strong>de</strong>m sündigt einer nicht nur durch ungerechten<br />
Verkauf, son<strong>de</strong>rn er ist auch zur Restitution verpflichtet. Fin<strong>de</strong>t<br />
sich aber ohne sein Wissen einer <strong>de</strong>r erwähnten Mängel in <strong>de</strong>r<br />
verkauften Sache, sündigt <strong>de</strong>r Verkäufer zwar nicht, weil er nur<br />
materiell etwas Ungerechtes tut, auch ist sein Verhalten nicht<br />
ungerecht, wie aus <strong>de</strong>m Obigen (59,2) hervorgeht. Doch<br />
sobald <strong>de</strong>r Mangel bekannt wird, ist er verpflichtet, <strong>de</strong>m Käufer<br />
<strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n zu ersetzen.<br />
Was vom Verkäufer gesagt wur<strong>de</strong>, gilt auch für <strong>de</strong>n Käufer.<br />
Es kommt nämlich zuweilen vor, daß <strong>de</strong>r Verkäufer seine Sache<br />
für weniger wertvoll hält, als sie in Wirklichkeit ist. So kauft<br />
jemand, <strong>de</strong>m Gold anstelle von Messing angeboten wird, unge<br />
recht ein, falls er es merkt, <strong>und</strong> ist zur Restitution verpflichtet.<br />
Dasselbe gilt bei qualitativen <strong>und</strong> quantitativen Mängeln.<br />
Zu 1. Gold <strong>und</strong> Silber sind nicht nur teuer wegen <strong>de</strong>s Nut<br />
zens <strong>de</strong>r Gefäße, die daraus hergestellt wer<strong>de</strong>n, o<strong>de</strong>r wegen<br />
204
an<strong>de</strong>rer <strong>de</strong>rgleichen Dinge, son<strong>de</strong>rn auch wegen <strong>de</strong>r Schönheit 77. 2<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Reinheit ihrer natürlichen Beschaffenheit. Wenn daher<br />
das von Alchimisten hergestellte Gold o<strong>de</strong>r Silber <strong>de</strong>n Charakter<br />
von echtem Gold o<strong>de</strong>r Silber nicht besitzt, so ist <strong>de</strong>r Verkauf<br />
betrügerisch <strong>und</strong> ungerecht. Dies vor allem auch <strong>de</strong>shalb, weil<br />
es für echtes Gold <strong>und</strong> Silber wegen ihrer natürlichen Wirksam<br />
keit Verwendungszwecke gibt, die alchimistisch vorgetäusch<br />
tem Gold nicht zukommen, wie z. B. daß es die Eigenschaft hat,<br />
Freu<strong>de</strong> zu wecken o<strong>de</strong>r medizinisch gegen gewisse Krankheiten<br />
zu helfen. Außer<strong>de</strong>m läßt sich echtes Gold auch in vielfältiger<br />
Weise verwen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> bewahrt seine Reinheit länger als Schein<br />
gold. - Käme jedoch bei alchimistischen Verfahren echtes Gold<br />
heraus, dann dürfte man es auch als echtes verkaufen, <strong>de</strong>nn<br />
nichts steht im Weg, daß ein künstliches Verfahren mit Hilfe<br />
natürlicher Ursachen natürliche <strong>und</strong> echte Wirkungen hervor<br />
bringt, wie Augustinus im III. Buch Über die Dreifaltigkeit<br />
(c. 8; ML42, 875) zu <strong>de</strong>m bemerkt, was die Dämonen zu<br />
stan<strong>de</strong>bringen.<br />
Zu 2. Die Maße für die Han<strong>de</strong>lswaren müssen an verschie<br />
<strong>de</strong>nen Orten wegen <strong>de</strong>s verschie<strong>de</strong>n großen Angebots verschie<br />
<strong>de</strong>n sein; <strong>de</strong>nn wo es mehr Ware gibt, sind die Maßeinheiten<br />
meist größer. An je<strong>de</strong>m Ort jedoch ist es Sache <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong><br />
vorsteher, in Anbetracht <strong>de</strong>r örtlichen Verhältnisse <strong>und</strong> <strong>de</strong>r vor<br />
han<strong>de</strong>nen Dinge die richtigen Maße für die Waren zu bestim<br />
men. Daher darf man diese von <strong>de</strong>r öffentlichen Autorität o<strong>de</strong>r<br />
durch Gewohnheit festgelegten Maße nicht außer acht lassen.<br />
Zu 3. Wie Augustinus im XI. Buch seines Gottesstaates<br />
(c. 16; ML 41,331) schreibt, richtet sich <strong>de</strong>r Preis von Han<strong>de</strong>ls<br />
waren nicht nach ihrem natürlichen Rang, da bisweilen ein<br />
Pferd teurer zu stehen kommt als ein Sklave, son<strong>de</strong>rn danach,<br />
welchen N<strong>utz</strong>wert eine Sache für <strong>de</strong>n Gebrauch <strong>de</strong>s Menschen<br />
besitzt. Daher braucht <strong>de</strong>r Verkäufer o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Käufer die ver<br />
borgene Qualität <strong>de</strong>r verkauften Sache nicht zu kennen, son<br />
<strong>de</strong>rn nur jene, die sie für <strong>de</strong>n menschlichen Gebrauch geeignet<br />
machen, z. B. daß ein Pferd kräftig sei <strong>und</strong> tüchtig laufe, <strong>und</strong> so<br />
in ähnlichen Fällen. Diese Eigenschaften können Käufer <strong>und</strong><br />
Verkäufer jedoch leicht erkennen.<br />
205
3. ARTIKEL<br />
Muß <strong>de</strong>r Verkäufer auf einen Warenfehler hinweisen?<br />
1. Da <strong>de</strong>r Verkäufer <strong>de</strong>n Käufer zum Kauf nicht zwingt,<br />
scheint er die Ware, die er verkauft, <strong>de</strong>ssen Urteil zu überlassen.<br />
Doch eine Ware beurteilen <strong>und</strong> sich genaue Kenntnis von ihr<br />
verschaffen, ist Sache <strong>de</strong>rselben Person. Also ist es wohl nicht<br />
<strong>de</strong>m Verkäufer anzurechnen, wenn <strong>de</strong>r K<strong>und</strong>e wegen über<br />
stürzten Kaufs <strong>und</strong> ohne sorgfältige Prüfung <strong>de</strong>s Warenzustands<br />
in seinem Urteil fehlgeht.<br />
2. Töricht ist, wer durch ein bestimmtes Han<strong>de</strong>ln sein Vor<br />
haben zunichte macht. Doch wenn einer die Mängel seiner Ware<br />
auf<strong>de</strong>ckt, macht er <strong>de</strong>n Verkauf zunichte. So führt Cicero in sei<br />
ner Pflichtenlehre (111,13) einen an, <strong>de</strong>r sagt: „Was gäbe es<br />
Wi<strong>de</strong>rsinnigeres, als wenn auf Befehl <strong>de</strong>s Eigentümers <strong>de</strong>r Aus<br />
rufer ankündigen wür<strong>de</strong>: Ich biete ein verseuchtes Haus zum<br />
Kaufe an!" Also ist <strong>de</strong>r Verkäufer nicht verpflichtet, die Mängel<br />
<strong>de</strong>r verkauften Sache anzugeben.<br />
3. Für einen Menschen ist es wichtiger, <strong>de</strong>n Weg <strong>de</strong>r Tugend<br />
zu kennen als die Mängel von Han<strong>de</strong>lswaren. Doch man ist<br />
nicht verpflichtet, einem je<strong>de</strong>n Ratschläge zu erteilen <strong>und</strong> über<br />
<strong>de</strong>n Tugendweg Aufklärung zu verschaffen, - wenngleich man<br />
nieman<strong>de</strong>m etwas Falsches sagen darf. Viel weniger also ist <strong>de</strong>r<br />
Verkäufer gehalten, auf Mängel einer verkauften Sache hinzu<br />
weisen, in<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>m Käufer gleichsam guten Rat erteilt.<br />
4. Wäre man verpflichtet, Warenmangel anzugeben, so<br />
könnte dies nur eine Senkung <strong>de</strong>s Preises zur Folge haben.<br />
Doch bisweilen fällt <strong>de</strong>r Preis auch ohne Warenmängel aus<br />
einem an<strong>de</strong>ren Gr<strong>und</strong>, z. B. wenn <strong>de</strong>r Verkäufer, <strong>de</strong>r seinen<br />
Weizen an einen Ort bringt, wo Getrei<strong>de</strong>mangel herrscht, weiß,<br />
daß da viele mit ihren Erzeugnissen hinkommen können; wenn<br />
die Käufer dies wüßten, wür<strong>de</strong>n sie einen geringeren Preis zah<br />
len. Einen diesbezüglichen Hinweis braucht <strong>de</strong>r Verkäufer<br />
jedoch wohl nicht zu geben. Also aus gleichem Gr<strong>und</strong> auch<br />
keine Auskunft über Mängel seiner verkauften Ware.<br />
DAGEGEN schreibt Ambrosius im III. Buch seiner Pflichten<br />
lehre (c. 10; ML 16,173): „Bei Kaufverträgen muß auf Waren<br />
mängel hingewiesen wer<strong>de</strong>n. Und falls <strong>de</strong>r Verkäufer dies un-<br />
terläßt, ist <strong>de</strong>r Verkauf, obwohl die Ware an <strong>de</strong>n Käufer überge<br />
gangen ist, wegen Betrugs hinfällig."<br />
206
ANTWORT. Jeman<strong>de</strong>n in Gefahr bringen o<strong>de</strong>r einem Scha- 77. 3<br />
<strong>de</strong>n aussetzen ist immer unerlaubt, obwohl <strong>de</strong>r Mensch einem<br />
an<strong>de</strong>ren nicht immer notwendigerweise Hilfe gewähren o<strong>de</strong>r<br />
einen Ratschlag erteilen muß, um ihm irgendwelche För<strong>de</strong>rung<br />
zuteil wer<strong>de</strong>n zu lassen; dies ist nur in einem bestimmten Fall<br />
vonnöten, z. B. wenn jemand seiner Obhut anvertraut ist o<strong>de</strong>r<br />
wenn ihm kein an<strong>de</strong>rer zu Hilfe kommen kann. Der Verkäufer<br />
nun, <strong>de</strong>r eine Ware anbietet, bringt <strong>de</strong>n Käufer dadurch, daß er<br />
ihm ein fehlerhaftes Produkt anbietet, in eine scha<strong>de</strong>ndrohen<strong>de</strong><br />
o<strong>de</strong>r gefährliche Lage, falls ihm <strong>de</strong>r Fehler tatsächlich zum<br />
Scha<strong>de</strong>n ausschlagen o<strong>de</strong>r eine Gefahr für ihn be<strong>de</strong>uten kann.<br />
Ein Scha<strong>de</strong>n entsteht dadurch, daß die Ware wegen solchen<br />
Mangels im Wert gemin<strong>de</strong>rt wird, <strong>de</strong>r Verkäufer jedoch <strong>de</strong>n<br />
Preis <strong>de</strong>nnoch nicht herabsetzt. Eine Gefahr, z. B. wenn ein <strong>de</strong>r<br />
artiger Mangel <strong>de</strong>n Gebrauch <strong>de</strong>r Sache unmöglich macht o<strong>de</strong>r<br />
Scha<strong>de</strong>n verursacht, so etwa, wenn jemand einem ein lahmen<br />
<strong>de</strong>s Pferd für ein schnelles, ein baufälliges Haus für eine soli<strong>de</strong>s<br />
o<strong>de</strong>r eine verdorbene o<strong>de</strong>r vergiftete Speise für eine gute ver<br />
kauft. Sind <strong>de</strong>rlei Fehler verborgen <strong>und</strong> gibt sie <strong>de</strong>r Verkäufer<br />
nicht an, dann ist <strong>de</strong>r Verkauf unerlaubt <strong>und</strong> betrügerisch, <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Verkäufer ist zu Scha<strong>de</strong>nersatz verpflichtet.<br />
Ist <strong>de</strong>r Fehler jedoch offensichtlich, z.B. wenn das Pferd ein<br />
äugig ist o<strong>de</strong>r wenn die Ware zwar für <strong>de</strong>n Verkäufer keinen<br />
Wert hat, jedoch an<strong>de</strong>ren nützlich sein kann <strong>und</strong> wenn er wegen<br />
eines <strong>de</strong>rartigen Fehlers vom Preis entsprechend heruntergeht,<br />
ist er nicht verpflichtet, <strong>de</strong>n Fehler aufzu<strong>de</strong>cken, weil <strong>de</strong>r Käufer<br />
dann <strong>de</strong>n Preis wegen dieses Fehlers mehr als angemessen her<br />
unterdrücken möchte. Daher darf <strong>de</strong>r Verkäufer sich vor Scha<br />
<strong>de</strong>n schützen, in<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>n Fehler verschweigt.<br />
Zu 1. Beurteilen kann man nur, was offen zutage liegt.<br />
Denn, wie es im I. Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 1; 1094 b27) heißt, „rich<br />
tet sich ein Urteil eines je<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m, was er kennt". Wenn<br />
daher die Warenmängel verborgen sind <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Verkäufer sie<br />
nicht erwähnt, wird <strong>de</strong>m Käufer nicht genügend Möglichkeit<br />
zur Beurteilung gegeben. An<strong>de</strong>rs wäre es im Fall, wo die Män<br />
gel auf <strong>de</strong>r Hand liegen.<br />
Zu 2. Es ist nicht nötig, daß jemand durch einen Ausrufer<br />
die Mängel seiner Ware bekanntmachen läßt. Ankündigungen<br />
dieser Art wür<strong>de</strong>n die Käufer nur vom Kauf abschrecken <strong>und</strong><br />
sie über die Güte <strong>und</strong> Nützlichkeit <strong>de</strong>r Sache in Unkenntnis las<br />
sen. Doch im einzelnen ist je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r mit Kaufabsichten heran-<br />
207
77. 4 tritt, auf <strong>de</strong>n Mangel hinzuweisen, damit er dann alle Eigen<br />
schaften, die guten <strong>und</strong> die schlechten, miteinan<strong>de</strong>r vergleichen<br />
kann, <strong>de</strong>nn nichts steht im Weg, daß etwas in einem Punkt feh<br />
lerhaft, in vielen an<strong>de</strong>ren aber nützlich sein kann.<br />
Zu 3. Obwohl <strong>de</strong>r Mensch nicht gehalten ist, schlechthin<br />
je<strong>de</strong>n bezüglich <strong>de</strong>ssen, was zur Tugend gehört, aufzuklären, so<br />
wäre er <strong>de</strong>nnoch für <strong>de</strong>n Fall dazu verpflichtet, daß durch sein<br />
Tun einem an<strong>de</strong>ren Gefahr zum Scha<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Tugend drohte,<br />
wenn er die Wahrheit verschwiege. Und so liegt die Sache hier.<br />
Zu 4. Ein Fehler an einer Sache bewirkt, daß sie im Augen<br />
blick von geringerem Wert ist, als es <strong>de</strong>n Anschein hat. Doch im<br />
erwähnten Fall wird eine Wertmin<strong>de</strong>rung erst in Zukunft<br />
erwartet wegen <strong>de</strong>r Zahl <strong>de</strong>r herbeiströmen<strong>de</strong>n Händler, von<br />
<strong>de</strong>nen die Käufer nichts wissen. Daher han<strong>de</strong>lt <strong>de</strong>r Verkäufer,<br />
<strong>de</strong>r seine Ware zum augenblicklich gültigen Preis absetzt, nicht<br />
gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>, wenn er sich über die zukünftigen Ver<br />
hältnisse nicht ausläßt. Käme er jedoch darauf zu sprechen o<strong>de</strong>r<br />
ginge er im Preis herunter, dann wäre dies ein Zeichen vollkom<br />
menerer Tugend. Doch scheint er dazu aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit nicht verpflichtet zu sein.<br />
4. ARTIKEL<br />
Darf bei Han<strong>de</strong>lsgeschäften <strong>de</strong>r Verkaufspreis höher sein als <strong>de</strong>r<br />
Einkaufspreis?<br />
1. Cbrysostomus schreibt zu Mt21,12 (MG56,840): „Wer<br />
immer eine Sache kauft, um sie, wie sie ist, mit Gewinn wie<strong>de</strong>r<br />
zu verkaufen, <strong>de</strong>r ist <strong>de</strong>r Händler, <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>m Tempel Gottes<br />
hinausgetrieben wird". Und das gleiche sagt Cassiodor (ML 700,<br />
500) zum Psalmwort 70,15 „Weil ich unerfahren bin in <strong>de</strong>r Wis<br />
senschaft" o<strong>de</strong>r, nach einer an<strong>de</strong>ren Leseart (Septuaginta), „in<br />
Han<strong>de</strong>lsgeschäften" [65]: „Was - sagt er - ist <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l an<strong>de</strong><br />
res als billig einkaufen <strong>und</strong> teurer verkaufen wollen?" <strong>und</strong> fügt<br />
hinzu: „Derlei Händler treibt <strong>de</strong>r Herr aus <strong>de</strong>m Tempel hinaus".<br />
Doch niemand wird aus <strong>de</strong>m Tempel hinausgetrieben, es sei<br />
<strong>de</strong>nn wegen einer Sün<strong>de</strong>. Also ist ein so ausgeübter Han<strong>de</strong>l<br />
sündhaft.<br />
2. Gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> verstößt, wer etwas teurer ver<br />
kauft o<strong>de</strong>r billiger einkauft, als es wert ist (vgl. Art. 1). Doch wer<br />
im Han<strong>de</strong>l teurer verkauft als einkauft, hat entwe<strong>de</strong>r unter Wert<br />
208
eingekauft o<strong>de</strong>r zu teuer verkauft. Eine Sün<strong>de</strong> läßt sich dabei 77. 4<br />
nicht vermei<strong>de</strong>n.<br />
3. Hieronymus schreibt an Nepotian (ML22,531): „Einen<br />
Kleriker, <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l treibt, <strong>de</strong>r aus einem Armen ein Reicher,<br />
aus einem Unbekannten ein berühmter Mann wird, <strong>de</strong>n fliehe<br />
wie die Pest". Doch Han<strong>de</strong>lsgeschäfte sind für die Kleriker nur<br />
zu verbieten wegen <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>. Also ist es Sün<strong>de</strong>, im Han<strong>de</strong>l<br />
etwas billig einzukaufen <strong>und</strong> teurer zu verkaufen.<br />
DAGEGEN schreibt Augustinus (ML 36,886) zum Psalm<br />
wort 70,15 „Weil ich in <strong>de</strong>r Wissenschaft nicht bewan<strong>de</strong>rt bin":<br />
„Ein Kaufmann, <strong>de</strong>r darauf aus ist, zum Scha<strong>de</strong>n [<strong>de</strong>s Näch<br />
sten] Gewinn zu erzielen, lästert Gott; um <strong>de</strong>r Preise willen<br />
lügt <strong>und</strong> schwört er. Doch dies sind Mängel <strong>de</strong>s Menschen,<br />
nicht <strong>de</strong>r kaufmännischen Kunst, die ohne diese Laster ausgeübt<br />
wer<strong>de</strong>n kann". Also ist Han<strong>de</strong>ltreiben an sich nicht unerlaubt.<br />
ANTWORT. Die Aufgabe <strong>de</strong>r Kaufleute besteht darin, sich<br />
mit <strong>de</strong>m Tausch von Waren zu beschäftigen. Wie nun Aristoteles<br />
im I.Buch seiner Politik (c.9; 1257a 19) schreibt, gibt es eine<br />
doppelte Art von Warentausch. Die eine ist gleichsam natürlich<br />
<strong>und</strong> notwendig. Bei ihr wird Sache gegen Sache o<strong>de</strong>r Sache<br />
gegen Geld getauscht um <strong>de</strong>r Bedürfnisse <strong>de</strong>s Lebens willen.<br />
Diese Art von Tausch ist nicht eigentlich Angelegenheit <strong>de</strong>r<br />
Händler, son<strong>de</strong>rn eher <strong>de</strong>r Haushaltsvorstän<strong>de</strong> <strong>und</strong> staatlichen<br />
Stellen, die sich um die lebensnotwendigen Dinge im Haus o<strong>de</strong>r<br />
Gemeinwesen zu kümmern haben. Die an<strong>de</strong>re Art von Tausch<br />
besteht darin, Geld gegen Geld o<strong>de</strong>r irgendwelche Waren gegen<br />
Geld zu tauschen, <strong>und</strong> zwar nicht wegen notwendiger Lebens<br />
bedürfnisse, son<strong>de</strong>rn mit <strong>de</strong>m Ziel, Gewinn zu machen. Und in<br />
diesen Geschäften liegt das eigentliche Betätigungsfeld <strong>de</strong>r<br />
Kaufleute. Nach Aristoteles nun (Pol. 1,10; 1258 a 38) gebührt<br />
<strong>de</strong>r ersten Art von Tauschgeschäft Lob, <strong>de</strong>nn sie dient einer<br />
natürlichen Notwendigkeit. Die zweite jedoch wird aus gutem<br />
Gr<strong>und</strong> geta<strong>de</strong>lt, <strong>de</strong>nn an sich gesehen dient sie <strong>de</strong>m Gewinn<br />
streben, das keine Grenzen kennt, son<strong>de</strong>rn endlos weitergeht.<br />
Daher haftet am Han<strong>de</strong>lsgeschäft, in sich betrachtet, eine<br />
gewisse Schimpflichkeit, insofern es seiner Natur nach keine<br />
ehrenhafte o<strong>de</strong>r notwendige Zweckbestimmung besitzt.<br />
Der Gewinn jedoch - Ziel <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls - hat, obwohl er in<br />
seinem Begriff nichts über ehrenhaft o<strong>de</strong>r notwendig aussagt,<br />
<strong>de</strong>nnoch nicht etwas Lasterhaftes o<strong>de</strong>r Tugendwidriges in sich.<br />
Daher besteht keine Schwierigkeit, ihn einem notwendigen<br />
209
77 4 o<strong>de</strong>r auch einem ehrenhaften Ziel dienstbar zu machen. Und<br />
somit wird das Han<strong>de</strong>lsgeschäft eine erlaubte Sache, z. B. wenn<br />
einer <strong>de</strong>n maßvollen Gewinn, <strong>de</strong>n er beim Han<strong>de</strong>l sucht, für die<br />
Erhaltung seines Hauses verwen<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r wenn er damit die<br />
Armen unterstützt o<strong>de</strong>r auch, wenn er Han<strong>de</strong>l treibt zum öffent<br />
lichen N<strong>utz</strong>en, damit seinem Land das Notwendige zum Leben<br />
nicht fehle, <strong>und</strong> er <strong>de</strong>n Gewinn dabei weniger als Ziel, son<strong>de</strong>rn<br />
sozusagen als Arbeitsentgelt auffaßt.<br />
Zu 1. Das Chrysostomuswort ist vom Han<strong>de</strong>l zu verstehen,<br />
<strong>de</strong>r sein letztes Ziel im Gewinn sieht, was vor allem dann <strong>de</strong>r<br />
Fall ist, wenn einer eine unverän<strong>de</strong>rte Sache teurer verkauft.<br />
Verkauft er nämlich seine zum besseren verän<strong>de</strong>rte Sache um<br />
höheren Preis, dann nimmt er damit einfach <strong>de</strong>n Lohn für seine<br />
Arbeit entgegen. Doch darf man <strong>de</strong>n Gewinn auch selbst<br />
erlaubterweise erstreben, zwar nicht als letztes Ziel, aber, wie ge<br />
sagt, wegen eines an<strong>de</strong>ren notwendigen o<strong>de</strong>r ehrenhaften Zieles.<br />
Zu 2. Nicht wer etwas teurer verkauft, als er eingekauft hat,<br />
treibt schon Han<strong>de</strong>l, son<strong>de</strong>rn nur, wer mit <strong>de</strong>r bewußten<br />
Absicht einkauft, teurer zu verkaufen. Kauft aber jemand etwas<br />
ein, nicht um es zu verkaufen, son<strong>de</strong>rn um es zu behalten,<br />
möchte es aber später aus irgen<strong>de</strong>inem Gr<strong>und</strong> abstoßen, so<br />
treibt er nicht Han<strong>de</strong>l, auch wenn er es teurer verkauft. Er kann<br />
dies nämlich erlaubterweise tun, weil er entwe<strong>de</strong>r die Sache<br />
irgendwie aufgewertet hat o<strong>de</strong>r weil <strong>de</strong>r Preis entsprechend <strong>de</strong>n<br />
Umstän<strong>de</strong>n von Ort o<strong>de</strong>r Zeit gestiegen ist o<strong>de</strong>r auch wegen<br />
<strong>de</strong>r Gefahr, <strong>de</strong>r er sich o<strong>de</strong>r seine Beauftragten beim Transport<br />
<strong>de</strong>r Sache von einem zum an<strong>de</strong>ren Ort ausgesetzt hat. Und<br />
<strong>de</strong>mentsprechend ist we<strong>de</strong>r Kauf noch Verkauf ungerecht.<br />
Zu 3. Die Kleriker müssen nicht nur das an sich Schlechte,<br />
son<strong>de</strong>rn auch das scheinbar Schlechte mei<strong>de</strong>n. Dies ist <strong>de</strong>r Fall<br />
bei Han<strong>de</strong>lsgeschäften, <strong>und</strong> zwar sowohl weil sie auf irdischen<br />
Gewinn hingeordnet sind, <strong>de</strong>n die Kleriker verachten müssen,<br />
als auch wegen <strong>de</strong>r häufigen Laster <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>ltreiben<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn<br />
„nur schwer bleibt ein Händler frei von Zungensün<strong>de</strong>n", wie es<br />
Sir26,28 heißt. Dazu kommt noch, daß das Han<strong>de</strong>lsgeschäft<br />
<strong>de</strong>n Geist zu sehr in irdische Sorgen verstrickt <strong>und</strong> in Folge<br />
davon vom geistlichen Leben abhält. Daher schreibt <strong>de</strong>r Apo<br />
stel 2Tim2,4: „Keiner, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Krieg zieht, läßt sich in All<br />
tagsgeschäfte verwickeln". - Erlaubt ist jedoch <strong>de</strong>n Klerikern<br />
die erste Art von Tauschgeschäften, wo bei Kauf <strong>und</strong> Verkauf<br />
<strong>de</strong>n Bedürfnissen <strong>de</strong>s Lebens Rechnung getragen wird.<br />
210
78. FRAGE<br />
DIE SÜNDE DES ZINSNEHMENS [66]<br />
Nun ist von <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zinsnehmens, die bei Leihge<br />
schäften begangen wird, zu re<strong>de</strong>n.<br />
Dabei ergeben sich vier Fragen:<br />
1. Ist es Sün<strong>de</strong>, Geld als Bezahlung für geliehenes Geld<br />
anzunehmen, was dasselbe wie Zinsnehmen ist?<br />
2. Ist es erlaubt, dafür als Gegenleistung irgen<strong>de</strong>ine Gefällig<br />
keit entgegenzunehmen?<br />
3. Muß einer <strong>de</strong>n Gewinn restituieren, <strong>de</strong>n er aus <strong>de</strong>m Zins<br />
auf gerechtem Weg gemacht hat?<br />
4. Darf man Geld gegen Zins ausleihen?<br />
1. ARTIKEL<br />
Ist es Sün<strong>de</strong>, Zins für geliehenes Geld anzunehmen?<br />
1. Niemand sündigt, wenn er <strong>de</strong>m Beispiel Christi folgt.<br />
Doch <strong>de</strong>r Herr sagt von sich selbst Lkl9,23: „Bei meiner<br />
Rückkehr hätte ich es mit Zinsen zurückgefor<strong>de</strong>rt", nämlich das<br />
ausgeliehene Geld. Also ist es keine Sün<strong>de</strong>, für geliehenes Geld<br />
Zins zu nehmen.<br />
2. Im Psalm 18,8 heißt es: „Das Gesetz <strong>de</strong>s Herrn ist unbe<br />
fleckt", weil es die Sün<strong>de</strong> verbietet. Doch im Gesetz Gottes wird<br />
ein gewisser Zins gestattet gemäß Dt23,19f.: „Du sollst <strong>de</strong>i<br />
nem Bru<strong>de</strong>r we<strong>de</strong>r Geld noch Früchte noch irgen<strong>de</strong>twas an<strong>de</strong><br />
res auf Zins leihen, wohl aber <strong>de</strong>m Frem<strong>de</strong>n." Und, was noch<br />
mehr ist: für die Beobachtung <strong>de</strong>s Gesetzes wird sogar eine<br />
Belohnung versprochen gemäß Dt 28,12: „Du wirst vielen Völ<br />
kern Darlehen geben können <strong>und</strong> selbst von nieman<strong>de</strong>m entlei<br />
hen müssen." Also ist Zinsnehmen keine Sün<strong>de</strong>.<br />
3. In <strong>de</strong>n Beziehungen unter <strong>de</strong>n Menschen wird die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> durch bürgerliche Gesetze bestimmt. Nach ihnen<br />
ist das Zinsnehmen jedoch gestattet. Also scheint dies nicht un<br />
erlaubt zu sein.<br />
4. Die Beobachtung <strong>de</strong>r Räte verpflichtet nicht unter Sün<strong>de</strong>.<br />
Doch Lk6,35 steht unter an<strong>de</strong>ren Räten: „Leiht aus, ohne<br />
etwas dafür zu erhoffen." Also kann man, ohne zu sündigen,<br />
Zins entgegennehmen.<br />
211
78.1 5. Lohn für etwas annehmen, das man zu tun nicht ver<br />
pflichtet ist, scheint an sich keine Sün<strong>de</strong> zu sein. Doch wer Geld<br />
hat, ist nicht in je<strong>de</strong>m Fall verpflichtet, es seinem Nächsten zu<br />
leihen. Also ist es irgendwann einmal erlaubt, Entgelt für ein<br />
Darlehen zu nehmen.<br />
6. Zwischen zu Münzen geprägtem <strong>und</strong> zu Gefäßen ver<br />
arbeitetem Silber besteht kein wesentlicher Unterschied. Doch<br />
für ausgeliehene Silbergefäße darf man Geld annehmen. Also<br />
gilt das gleiche auch für ausgeliehene Silbermünzen. Zinsneh<br />
men ist also an sich keine Sün<strong>de</strong>.<br />
7. Je<strong>de</strong>rmann darf erlaubterweise eine Sache annehmen, die<br />
ihm <strong>de</strong>ssen Besitzer freiwillig überläßt. Wer nun ein Darlehen<br />
entgegennimmt, übergibt dafür freiwillig Zins. Also darf ihn <strong>de</strong>r<br />
Entleiher erlaubterweise annehmen.<br />
DAGEGEN steht Ex22,25: „Leihst du einem aus meinem<br />
Volk, einem Armen, <strong>de</strong>r neben dir wohnt, Geld, dann sollst du<br />
dich gegen ihn nicht wie ein Wucherer benehmen. Ihr sollt von<br />
ihm keinen Wucherzins for<strong>de</strong>rn."<br />
ANTWORT. Für geliehenes Geld Zins verlangen ist in sich<br />
unrecht, <strong>de</strong>nn es wird dabei verkauft, was nicht existiert.<br />
Dadurch ergibt sich ein<strong>de</strong>utig eine Ungleichheit, die <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> wi<strong>de</strong>rspricht. Hierzu muß man wissen, daß es<br />
gewisse Dinge gibt, <strong>de</strong>ren Gebrauch in ihrem Verbrauch<br />
besteht. So verbrauchen wir <strong>de</strong>n Wein, in<strong>de</strong>m wir ihn als Trank<br />
gebrauchen, <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Weizen verbrauchen wir, in<strong>de</strong>m wir ihn als<br />
Speise gebrauchen. Bei diesen Dingen darf man also <strong>de</strong>n<br />
Gebrauch <strong>de</strong>r Sache nicht von <strong>de</strong>r Sache selbst trennen, son<strong>de</strong>rn<br />
wem immer <strong>de</strong>r Gebrauch zugestan<strong>de</strong>n wird, <strong>de</strong>m wird auch<br />
die Sache zugestan<strong>de</strong>n. Deshalb be<strong>de</strong>utet hier Leihe zugleich<br />
Besitzübertragung. Wollte daher jemand <strong>de</strong>n Wein verkaufen<br />
<strong>und</strong> außer<strong>de</strong>m noch <strong>de</strong>n Gebrauch <strong>de</strong>s Weines, dann wür<strong>de</strong> er<br />
diesselbe Sache zweimal verkaufen, o<strong>de</strong>r er wür<strong>de</strong> etwas ver<br />
kaufen, das nicht vorhan<strong>de</strong>n ist. Damit versündigt er sich ein<br />
<strong>de</strong>utig gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>. In gleicher Weise begeht ein<br />
Unrecht, wer Wein o<strong>de</strong>r Weizen leiht <strong>und</strong> dafür zweifaches Ent<br />
gelt verlangt, eines als Gegenleistung zum sachlichen Ausgleich<br />
<strong>und</strong> eines als Preis für <strong>de</strong>n Gebrauch, was soviel be<strong>de</strong>utet wie<br />
„Zins".<br />
Es gibt jedoch Dinge, <strong>de</strong>ren Gebrauch nicht in ihrem Ver<br />
brauch liegt. So besteht <strong>de</strong>r Gebrauch eines Hauses im Bewoh<br />
nen, nicht jedoch im Zerstören. Daher kann bei <strong>de</strong>rlei Dingen<br />
212
ei<strong>de</strong>s getrennt gestattet wer<strong>de</strong>n, z.B. wenn jemand sein Haus 78. l<br />
einem an<strong>de</strong>ren zu Eigentum überträgt <strong>und</strong> für sich eine Zeit<br />
lang <strong>de</strong>n Gebrauch vorbehält, o<strong>de</strong>r, umgekehrt, wenn jemand<br />
einem <strong>de</strong>n Gebrauch <strong>de</strong>s Hauses einräumt, es aber als Eigen<br />
tum behält. Und <strong>de</strong>shalb darf man einen Preis für <strong>de</strong>n Gebrauch<br />
<strong>de</strong>s Hauses for<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> außer<strong>de</strong>m das geliehene Haus zurück<br />
verlangen, wie dies bei Verpachtung o<strong>de</strong>r Vermietung eines<br />
Hauses <strong>de</strong>r Fall ist.<br />
Das Geld aber wur<strong>de</strong> nach Aristoteles (Eth.V,8; 1133a20,<br />
<strong>und</strong> Pol. 1,9; 1257a35) hauptsächlich erf<strong>und</strong>en, um Tausch<br />
handlungen vorzunehmen. Daher besteht <strong>de</strong>r eigentliche <strong>und</strong><br />
vorrangige Gebrauch <strong>de</strong>s Gel<strong>de</strong>s in seinem Verbrauch o<strong>de</strong>r sei<br />
ner Verausgabung, wie dies bei Tauschgeschäften getätigt wird.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist es in sich unerlaubt, für <strong>de</strong>n Gebrauch<br />
geliehenen Gel<strong>de</strong>s eine Entschädigung anzunehmen, die „Zins"<br />
heißt. Und wie an<strong>de</strong>res unrechtmäßig Erworbenes zurückgege<br />
ben wer<strong>de</strong>n muß, so auch das Geld, das man als Zins erhaltenhat.<br />
Zu 1. „Zins" wird dort im übertragenen Sinn als Zuwachs<br />
an geistigen Gütern genommen, <strong>de</strong>n Gott erwartet. Er will<br />
nämlich, daß wir einen immer besseren Gebrauch von <strong>de</strong>n von<br />
ihm empfangenen Gaben machen, - dies zu unserem, nicht zu<br />
seinem Gewinn.<br />
Zu 2. Den Ju<strong>de</strong>n war es verboten, „von ihren Brü<strong>de</strong>rn" Zins<br />
zu nehmen, nämlich eben von <strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n. Damit wird zu verste<br />
hen gegeben, daß Zins von irgendjeman<strong>de</strong>m zu verlangen abso<br />
lut schlecht ist, müssen wir doch je<strong>de</strong>n Menschen „gleichsam als<br />
Nächsten <strong>und</strong> Bru<strong>de</strong>r" betrachten, vor allem wir, die unter <strong>de</strong>m<br />
Gesetz <strong>de</strong>s Evangeliums stehen, zu <strong>de</strong>m alle berufen sind [67].<br />
Daher heißt es im Psalm 14,5 ohne Einschränkung: „Er gibt<br />
sein Geld nicht auf Zins", <strong>und</strong> Ezl8,17: „Er nimmt keinen<br />
Zins." Daß sie (die Ju<strong>de</strong>n) aber von <strong>de</strong>n Volksfrem<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Zins<br />
nahmen, war ihnen nicht als erlaubt zugestan<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn nur<br />
zur Vermeidung größeren Übels gestattet, nämlich damit sie<br />
nicht aus Geiz, <strong>de</strong>m sie nach Is 56,11 verfallen waren, von <strong>de</strong>n<br />
Ju<strong>de</strong>n, die Gott verehren, Zins nahmen. - Wenn aber Lohn ver<br />
sprochen wird mit <strong>de</strong>n Worten: „Du wirst vielen Völkern Dar<br />
lehen geben usw.", so ist dort „Darlehen" im weiteren Sinn zu<br />
verstehen, wie es auch Sir29,10 heißt: „Viele geben nicht aus<br />
Bosheit kein Darlehen", d. h. sie leihen nicht. Den Ju<strong>de</strong>n wird<br />
also als Belohnung Fülle <strong>de</strong>s Reichtums versprochen, <strong>de</strong>r es<br />
ihnen möglich macht, an<strong>de</strong>ren auszuleihen.<br />
213
78. l Zu 3. Die menschlichen Gesetze lassen wegen <strong>de</strong>s Zustan-<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r unvollkommenen Menschen manche Sün<strong>de</strong>n ungestraft<br />
durchgehen. Wür<strong>de</strong>n nämlich alle Sün<strong>de</strong>n mit Strafen streng<br />
unterdrückt, dann wür<strong>de</strong> bei ihnen mancher gute Dienst unge<br />
tan bleiben. Daher hat das menschliche Gesetz das Zinsnehmen<br />
erlaubt, nicht als ob es dieses als gerecht ansähe, son<strong>de</strong>rn um<br />
vielen einen Vorteil zu verschaffen. Deshalb heißt es auch im<br />
bürgerlichen <strong>Recht</strong> (Inst.,KR1,13b): „Dinge, die durch <strong>de</strong>n<br />
Gebrauch verzehrt wer<strong>de</strong>n, lassen we<strong>de</strong>r vom natürlichen noch<br />
vom zivilrechtlichen Standpunkt aus eine N<strong>utz</strong>nießung zu",<br />
<strong>und</strong>: „Der Senat hat die N<strong>utz</strong>nießung dieser Dinge nicht zuge<br />
lassen, er konnte es auch gar nicht, son<strong>de</strong>rn er gewährte nur<br />
eine Art von N<strong>utz</strong>nießung", in<strong>de</strong>m er nämlich <strong>de</strong>n Zins gestat<br />
tete. Und von natürlicher Überlegung geleitet, schreibt Aristote<br />
les im I. Buch <strong>de</strong>r Politik (c. 10; 1258b7): „Gel<strong>de</strong>rwerb durch<br />
Zinsnehmen ist in höchstem Maße gegen die Natur."<br />
Zu 4. Der Mensch ist nicht immer verpflichtet zu leihen,<br />
<strong>und</strong> darum wird von <strong>de</strong>r Leihe nur in <strong>de</strong>n Räten gesprochen.<br />
Doch das Verbot, aus <strong>de</strong>m Darlehen Gewinn zu ziehen, fällt<br />
unter das Gebot. - Es kann aber als „Rat" bezeichnet wer<strong>de</strong>n im<br />
Hinblick auf die Aussprüche <strong>de</strong>r Pharisäer, die meinten, ein<br />
gewisser Zins sei erlaubt; in diesem Sinn ist auch die Fein<strong>de</strong>s<br />
liebe ein „Rat". - O<strong>de</strong>r er (Christus) spricht dort nicht von <strong>de</strong>r<br />
Aussicht auf Zinsgewinn, son<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>r Erwartung, die man<br />
an einen Menschen stellt. Wir dürfen nämlich kein Darlehen<br />
geben o<strong>de</strong>r sonst etwas Gutes tun in <strong>de</strong>r erwartungsvollen<br />
Hoffnung auf einen Menschen, son<strong>de</strong>rn nur wegen <strong>de</strong>r Hoff<br />
nung auf Gott.<br />
Zu 5. Wer leiht, ohne dazu verpflichtet zu sein, kann eine<br />
Vergütung für seine Leistung annehmen, aber nichts darüber<br />
hinaus. Diese Vergütung entspricht <strong>de</strong>m Gleichmaß <strong>de</strong>r Ge<br />
rechtigkeit, wenn er genau so viel zurückerhält, als er ausgelie<br />
hen hat. Verlangt er mehr für die N<strong>utz</strong>nießung einer Sache,<br />
<strong>de</strong>ren Gebrauch ausschließlich im Verbrauch besteht, dann ver<br />
langt er einen Preis für etwas, das nicht existiert. Dies ist <strong>de</strong>m<br />
nach eine ungerechte For<strong>de</strong>rung.<br />
Z u 6. Die vorzügliche Verwendung silberner Gefäße besteht<br />
nicht in ihrem Verbrauch <strong>und</strong> daher kann für ihre Ben<strong>utz</strong>ung<br />
unter Vorbehalt <strong>de</strong>s Eigentumsrechts erlaubterweise Geld ver<br />
langt wer<strong>de</strong>n. Silbergeld hingegen dient in erster Linie <strong>de</strong>m Ver<br />
brauch bei Tauschgeschäften. Daher darf man seinen Gebrauch<br />
214
nicht verkaufen <strong>und</strong> dann auch noch die Rückgabe <strong>de</strong>ssen ver- 78. 2<br />
langen, was man einem als Darlehen gegeben hat.<br />
Es ist jedoch zu be<strong>de</strong>nken, daß Silbergefäße auch noch als<br />
Objekte im Tauschhan<strong>de</strong>l gebraucht wer<strong>de</strong>n können. Einen sol<br />
chen Gebrauch dürfte man nicht verkaufen. Und in gleicher<br />
Weise kann es auch noch einen zweiten Gebrauch von Silber<br />
geld geben, z. B. wenn jemand geprägte Münzen für eine Schau<br />
stellung hergibt o<strong>de</strong>r sie anstelle eines Pfan<strong>de</strong>s verwen<strong>de</strong>t.<br />
Einen solchen Gebrauch <strong>de</strong>s Gel<strong>de</strong>s kann man erlaubterweise<br />
verkaufen [68].<br />
Zu 7. Wer Zins gibt, gibt ihn nicht schlechthin freiwillig, son<br />
<strong>de</strong>rn unter <strong>de</strong>m Druck einer gewissen Notwendigkeit, insofern<br />
er ein Darlehen nötig hat, das <strong>de</strong>r Darlehensgeber nicht ohne<br />
Zins gewähren will.<br />
2. ARTIKEL<br />
Kann man für ein Darlehen irgen<strong>de</strong>ine an<strong>de</strong>re Gefälligkeit<br />
erbitten?<br />
1. Je<strong>de</strong>r kann erlaubterweise dafür sorgen, daß ihm kein<br />
Scha<strong>de</strong>n entsteht. Doch bisweilen erlei<strong>de</strong>t jemand einen Scha<br />
<strong>de</strong>n durch Gewährung eines Darlehens. Also darf er zum gelie<br />
henen Geld noch etwas für <strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n erbitten o<strong>de</strong>r verlan<br />
gen.<br />
2. Je<strong>de</strong>r ist aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Anständigkeit gehalten, „<strong>de</strong>m,<br />
<strong>de</strong>r ihm eine Gefälligkeit erwiesen hat, mit einer Gegenleistung<br />
zu vergelten", wie es im V. Buch <strong>de</strong>r Ethik (c. 8; 1133 a 4) heißt.<br />
Nun erweist, wer einem, <strong>de</strong>r sich in Bedrängnis befin<strong>de</strong>t, Geld<br />
leiht, eine Gefälligkeit, daher gebührt ihm ein Zeichen <strong>de</strong>s Dan<br />
kes. Also ist <strong>de</strong>r Empfänger aus natürlicher Pflicht gehalten,<br />
irgen<strong>de</strong>ine Gegenleistung zu erbringen. Es scheint aber nicht<br />
unerlaubt zu sein, sich zu etwas zu verpflichten, wozu jemand<br />
durch das Naturrecht gehalten ist. Also scheint es auch nicht<br />
unerlaubt, wenn einer, <strong>de</strong>r jeman<strong>de</strong>m ein Darlehen gibt, von<br />
ihm eine gewisse Gegenleistung verlangt.<br />
3. Wie es ein „Handgeld" gibt, so gibt es auch ein „M<strong>und</strong><br />
geld" <strong>und</strong> ein „Dienstgeld" [69], wie die Glosse zu Is33,15:<br />
„Selig, wer seine Hän<strong>de</strong> von je<strong>de</strong>m Geschenk rein hält" (inter-<br />
lin. IV, 61 r) schreibt. Doch ist es erlaubt, einen Dienst o<strong>de</strong>r auch<br />
ein Lob von <strong>de</strong>m anzunehmen, <strong>de</strong>m man ein Gelddarlehen<br />
215
78. 2 gewährt hat. Also ist es aus gleichem Gr<strong>und</strong> erlaubt, irgen<strong>de</strong>in<br />
an<strong>de</strong>res Geschenk anzunehmen.<br />
4. Das Verhältnis von einer Gabe zu einer an<strong>de</strong>ren ist das<br />
gleiche wie von einem Darlehen zu einem an<strong>de</strong>ren Darlehen.<br />
Nun ist es erlaubt, Geld gegen an<strong>de</strong>res Geld anzunehmen. Also<br />
ist es auch erlaubt, für ein gewährtes Darlehen als Gegenlei<br />
stung ein an<strong>de</strong>res Darlehen entgegenzunehmen.<br />
5. Wer durch Darlehensgewährung sein Besitzrecht über<br />
trägt, trennt sich mehr von seinem Geld, als wer es einem Kauf<br />
mann o<strong>de</strong>r Handwerker anvertraut. Nun ist es erlaubt, aus <strong>de</strong>m<br />
Geld, das man einem Kaufmann o<strong>de</strong>r Handwerker anvertraut,<br />
Gewinn zu ziehen. Also ist es auch erlaubt, mit einem Gelddar<br />
lehen Gewinn zu machen.<br />
6. Für ein Gelddarlehen kann man ein Pfand nehmen, <strong>de</strong>s<br />
sen Gebrauch sich für einen gewissen Preis verkaufen ließe, so,<br />
wenn ein Acker o<strong>de</strong>r ein bewohntes Haus verpfän<strong>de</strong>t wird.<br />
Also darf man auch aus geliehenem Geld einen gewissen<br />
Gewinn haben.<br />
7. Es kommt bisweilen vor, daß jemand seine Sachen wegen<br />
eines Darlehens teurer verkauft o<strong>de</strong>r die eines an<strong>de</strong>ren billiger<br />
einkauft, o<strong>de</strong>r wegen Zahlungsverzögerung <strong>de</strong>n Preis erhöht<br />
o<strong>de</strong>r für frühzeitige Rückzahlung senkt. In all diesen Fällen<br />
ergibt sich sozusagen ein vorteilhafter Ausgleich für das Auslei<br />
hen <strong>de</strong>s Gel<strong>de</strong>s. Dies nun scheint nicht ein<strong>de</strong>utig unerlaubt zu<br />
sein. Also ist es wohl auch erlaubt, für das ausgeliehene Geld<br />
eine Vergünstigung zu erwarten o<strong>de</strong>r zu verlangen.<br />
DAGEGEN steht Ezl8,17 unter an<strong>de</strong>rem, was von einem<br />
gerechten Mann verlangt wird: „Zins <strong>und</strong> Zuschlag nimmt er<br />
nicht."<br />
ANTWORT. Nach Aristoteles (Eth.IV,l; 1119 b 26) gilt als<br />
Geld alles, „<strong>de</strong>ssen Wert sich mit Geld messen läßt". Wie daher<br />
je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r für ein Gelddarlehen o<strong>de</strong>r etwas an<strong>de</strong>res, das im<br />
Gebrauch verbraucht wird, Geld annimmt, sei es nach still<br />
schweigen<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r ausdrücklicher Abmachung, gegen die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> sündigt (Art. 1), so begeht die gleiche Sün<strong>de</strong>, wer<br />
nach stillschweigen<strong>de</strong>ro<strong>de</strong>rausdrücklicherÜbereinkunft irgend<br />
etwas an<strong>de</strong>res annimmt, <strong>de</strong>ssen Wert mit Geld gemessen wer<br />
<strong>de</strong>n kann. Nimmt er etwas <strong>de</strong>rgleichen jedoch we<strong>de</strong>r als For<strong>de</strong><br />
rung noch als stillschweigen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r ausdrückliche Verpflich<br />
tung, son<strong>de</strong>rn als freiwilliges Geschenk an, so sündigt er nicht,<br />
<strong>de</strong>nn bereits vor <strong>de</strong>r Gewährung <strong>de</strong>s Darlehens konnte er<br />
216
erlaubterweise ein Geschenk umsonst annehmen, <strong>und</strong> er 78.2<br />
kommt wegen seiner Darlehensvergabe nicht in eine schlech<br />
tere Lage. - Eine Gegenleistung jedoch, die man mit Geld nicht<br />
messen kann, darf man für ein Darlehen verlangen, z.B. Wohl<br />
wollen o<strong>de</strong>r Zuneigung <strong>de</strong>s Darlehensnehmers o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>rglei<br />
chen.<br />
Zu 1. Der Darlehensgeber kann mit <strong>de</strong>m Darlehensnehmer<br />
ohne Sün<strong>de</strong> eine Entschädigung für <strong>de</strong>n Nachteil vereinbaren,<br />
<strong>de</strong>n er durch die Weggabe <strong>de</strong>ssen, was sein ist, erlei<strong>de</strong>t. Dies<br />
heißt nämlich nicht, <strong>de</strong>n Gebrauch <strong>de</strong>s Gel<strong>de</strong>s verkaufen, son<br />
<strong>de</strong>rn Scha<strong>de</strong>n von sich fernhalten. Dabei ist es möglich, daß <strong>de</strong>r<br />
Darlehensnehmer einen größeren Scha<strong>de</strong>n vermei<strong>de</strong>t als <strong>de</strong>r<br />
Geber riskiert. Der Darlehensnehmer gleicht also mit seiner<br />
Gefälligkeit <strong>de</strong>n Verlust <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren aus. - Der Ersatz <strong>de</strong>s Scha<br />
<strong>de</strong>ns jedoch, <strong>de</strong>r darin besteht, daß dieser mit seinem Geld kei<br />
nen Gewinn macht, kann nicht vertraglich abgesichert wer<strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>nn er darf nicht verkaufen, was er noch nicht hat <strong>und</strong> <strong>de</strong>ssen<br />
Erwerb sich vielfache Hin<strong>de</strong>rnisse in <strong>de</strong>n Weg stellen können.<br />
Zu 2. Der Ausgleich für eine empfangene Wohltat kann auf<br />
zweifache Weise geschehen. Einmal unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt<br />
rechtlicher Verpflichtung, an die jemand aufgr<strong>und</strong> eines ge<br />
nauen Vertrags geb<strong>und</strong>en sein kann, <strong>und</strong> diese Verpflichtung<br />
richtet sich nach <strong>de</strong>r Größe <strong>de</strong>r empfangenen Wohltat. Daher<br />
braucht <strong>de</strong>r Empfänger eines Gelddarlehens o<strong>de</strong>r von etwas<br />
an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>rgleichen, <strong>de</strong>ssen Gebrauch im Verbrauch besteht,<br />
nicht mehr zu erstatten, als er im Darlehen erhalten hat. Es ver<br />
stößt also gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>, ihn zu einer größeren<br />
Gegenleistung zu verpflichten. - In an<strong>de</strong>rer Weise ist einer zum<br />
Entgelt einer Wohltat aus fre<strong>und</strong>schaftlicher Verb<strong>und</strong>enheit<br />
verpflichtet. Hierbei ist mehr die Zuneigung zu beachten, aus<br />
<strong>de</strong>r die Wohltat entsprungen ist, als die Größe <strong>de</strong>r erwiesenen<br />
Gefälligkeit selbst. Eine Schuld von dieser Art liegt nicht auf <strong>de</strong>r<br />
Ebene bürgerlicher Verpflichtung, <strong>de</strong>nn diese übt einen gewis<br />
sen Zwang aus, so daß sich eine spontane Bezeugung <strong>de</strong>r Dank<br />
barkeit nicht mehr entfalten kann.<br />
Zu 3. Wenn jemand für sein dargeliehenes Geld gleichsam<br />
als stillschweigen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r ausdrückliche Vertragspflicht eine<br />
Entschädigung in Form von körperlicher o<strong>de</strong>r geistiger Lei<br />
stung erwartet o<strong>de</strong>r verlangt, so ist dies soviel, als erwarte o<strong>de</strong>r<br />
verlange er ein „Handgeld", <strong>de</strong>nn bei<strong>de</strong>s läßt sich mit Geld<br />
bemessen, wie dies <strong>de</strong>utlich bei <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Fall ist, die ihre mit<br />
217
78. 2 Körperkraft o<strong>de</strong>r mit geistigen Mitteln ausgeübte Arbeit ver<br />
dingen. Bietet <strong>de</strong>r Darlehensnehmer seine körperlichen Dienste<br />
o<strong>de</strong>r seine geistigen Fähigkeiten nicht als Verpflichtung an, son<br />
<strong>de</strong>rn aus Fre<strong>und</strong>lichkeit, die man mit Geld nicht bemessen<br />
kann, so darf man sie annehmen, for<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> erwarten [70].<br />
Zu 4. Geld kann nicht um mehr Geld verkauft wer<strong>de</strong>n als<br />
um die Summe <strong>de</strong>s Darlehens, das man zurückzahlen muß.<br />
Auch ist dabei nichts zu for<strong>de</strong>rn o<strong>de</strong>r zu erwarten als Wohlwol<br />
len, das sich nicht mit Geld berechnen läßt, jedoch Ursache für<br />
ein frei angebotenes Darlehen sein kann. Dies zieht aber keines<br />
wegs die Verpflichtung für ein Darlehen in <strong>de</strong>r Zukunft nach<br />
sich, <strong>de</strong>nn auch eine solche Verpflichtung könnte mit Geld<br />
bemessen wer<strong>de</strong>n. Und so ist es zwar <strong>de</strong>m Darlehensgeber<br />
erlaubt, zugleich von seinem Darlehensnehmer ein Darlehen<br />
aufzunehmen, er darf diesen aber nicht verpflichten, ihm auch<br />
in Zukunft ein Darlehen zu gewähren.<br />
Zu 5. Wer ein Gelddarlehen gibt, überträgt das Besitzrecht<br />
<strong>de</strong>s Gel<strong>de</strong>s auf <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m er es leiht. Daher liegt es nun beim<br />
Empfänger auf seine Gefahr, <strong>und</strong> dieser ist verpflichtet, es voll<br />
ständig zurückzubezahlen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> darf <strong>de</strong>r Darle<br />
hensgeber nichts darüber hinaus verlangen. Doch wer sein Geld<br />
einem Kaufmann o<strong>de</strong>r Handwerker etwa wie einem Gesell<br />
schafter zur Verfügung stellt, überträgt diesem sein Eigentums<br />
recht nicht, son<strong>de</strong>rn behält es, so daß <strong>de</strong>r Kaufmann auf <strong>de</strong>s<br />
Geldgebers Gefahr Han<strong>de</strong>l treibt o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Handwerker damit<br />
arbeitet. Und <strong>de</strong>shalb darf er auch einen Teil <strong>de</strong>s Gewinns, <strong>de</strong>r<br />
dabei herauskommt, als etwas, das ihm gehört, für sich bean<br />
spruchen [71].<br />
Zu 6. Wenn jemand für sein Gelddarlehen etwas verpfän<strong>de</strong>t,<br />
<strong>de</strong>ssen Gebrauch sich mit Geld bemessen läßt, muß <strong>de</strong>r Darle<br />
hensgeber <strong>de</strong>n Gebrauch dieser Sache bei <strong>de</strong>r Rückzahlung <strong>de</strong>s<br />
Darlehens miteinberechnen. Wollte er nämlich <strong>de</strong>n Gebrauch<br />
jener Sache gleichsam als Gratiszulage behalten, so wäre dies<br />
soviel, als nähme er Geld für das Darlehen, also Zins, an. Frei<br />
lich mag es hingehen, wenn es sich um eine Sache han<strong>de</strong>lt, mit<br />
<strong>de</strong>ren Gebrauch man unter Fre<strong>und</strong>en ohne Entgelt einverstan<br />
<strong>de</strong>n ist, wie etwa bei <strong>de</strong>r Ausleihe eines Buches [72].<br />
Zu 7. Wer seine Waren über <strong>de</strong>n gerechten Preis verkaufen<br />
wollte, um <strong>de</strong>m Käufer einen Zahlungsaufschub einzuräumen,<br />
versündigt sich ohne Zweifel durch Wucher, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Zahlungs<br />
aufschub be<strong>de</strong>utet soviel wie ein Darlehen. Was immer also<br />
218
über die gerechte Vergütung für einen solchen Aufschub ver- 78. 3<br />
langt wird, hat die Be<strong>de</strong>utung von Wucherzins. - Das gleiche<br />
gilt, wenn ein Käufer etwas um einen geringeren als <strong>de</strong>n gerech<br />
ten Preis einkaufen wollte mit <strong>de</strong>r Begründung, daß er bereits<br />
vor <strong>de</strong>r Übergabe <strong>de</strong>r Ware bezahlt habe: auch dies wäre Sün<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Wuchers, weil diese Vorauszahlung ebenfalls <strong>de</strong>n Charakter<br />
eines Darlehens aufweist, <strong>de</strong>ssen Preis in <strong>de</strong>r vom or<strong>de</strong>ntlichen<br />
Zahlungsbetrag abgezogenen Summe besteht. - Wer jedoch <strong>de</strong>n<br />
gerechten Preis herabsetzt, um schneller an sein Geld zu kom<br />
men, verfehlt sich nicht durch die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Wuchers.<br />
3. ARTIKEL<br />
Muß man <strong>de</strong>n Gewinn aus Wucherzinsen zurückerstatten?<br />
1. Der Apostel schreibt Rom 11,16: „Ist die Wurzel heilig,<br />
dann sind es auch die Zweige." Also gilt gleicherweise: Ist die<br />
Wurzel vergiftet, dann sind es auch die Zweige. Nun war die<br />
Wurzel wucherisch, also ist alles, was aus ihr gezogen wird,<br />
wucherisch, <strong>und</strong> folglich muß man dies restituieren.<br />
2. Im Buch Extra „Über <strong>de</strong>n Wucher" steht in jener Dekre<br />
tale „Da du, wie du sagst" (Frdbll, 812): „Besitz, <strong>de</strong>r mit<br />
Wucherzinsen gekauft wur<strong>de</strong>, muß veräußert wer<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Erlös ist <strong>de</strong>nen zurückzugeben, von <strong>de</strong>nen die Zinsen erpreßt<br />
wur<strong>de</strong>n." Also muß aus gleichem Gr<strong>und</strong> alles restituiert wer<br />
<strong>de</strong>n, was sonstwie aus Wucherzinsen erworben wur<strong>de</strong>.<br />
3. Was jemand mit Wucherzinsen kauft, gehört ihm auf<br />
gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Geldausgabe, die er dafür geleistet hat. Er besitzt also<br />
kein größeres <strong>Recht</strong> auf die Sache als auf das Geld, daß er dafür<br />
aufwandte. Doch dieses Wuchergeld muß er zurückerstatten,<br />
also auch das, was er dafür gekauft hat.<br />
DAGEGEN steht: Je<strong>de</strong>r darf erlaubterweise behalten, was er<br />
rechtmäßig erworben hat. Doch was mit Wuchergeld erworben<br />
wird, ist bisweilen zu <strong>Recht</strong> erworben. Also kann man es<br />
erlaubterweise behalten.<br />
ANTWORT. Wie oben betont, besteht <strong>de</strong>r Gebrauch gewis<br />
ser Dinge in ihrem Verbrauch, <strong>und</strong> sie lassen daher nach <strong>de</strong>r<br />
<strong>Recht</strong>ssammlung (Inst.,KR1,13b) keinen Nießbrauch zu.<br />
Wenn nun solche Dinge, wie z. B. Geld, Weizen, Wein <strong>und</strong><br />
an<strong>de</strong>res <strong>de</strong>rgleichen, als Zinsen erpreßt wur<strong>de</strong>n, muß man nur<br />
zurückgeben, was man erhalten hat, <strong>de</strong>nn das Weitere, was<br />
219
78. 4 damit erstan<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>, ist nicht Frucht jener Dinge, son<strong>de</strong>rn<br />
<strong>de</strong>r menschlichen Geschäftstüchtigkeit, es sei <strong>de</strong>nn, <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />
erlei<strong>de</strong> durch ihre Zurückhaltung Scha<strong>de</strong>n wegen teilweisen<br />
Verlusts seiner Güter. Dann muß für <strong>de</strong>n Scha<strong>de</strong>n Ersatz gelei<br />
stet wer<strong>de</strong>n.<br />
Es gibt jedoch Dinge, <strong>de</strong>ren Gebrauch nicht in ihrem Ver<br />
brauch besteht, <strong>und</strong> diese lassen Nießbrauch zu, wie z. B. ein<br />
Haus, ein Acker <strong>und</strong> an<strong>de</strong>res <strong>de</strong>rgleichen. Wenn nun jemand<br />
eines an<strong>de</strong>ren Haus o<strong>de</strong>r Acker als Zins erpreßt hätte, wäre er<br />
nicht nur gehalten, das Haus o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Acker zurückzugeben,<br />
son<strong>de</strong>rn auch die Früchte von Dingen, <strong>de</strong>ren Herr <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />
ist, <strong>und</strong> die folglich diesem gehören [73].<br />
Zul. Die Wurzel ist nicht nur „Materie" nach Art <strong>de</strong>s<br />
Wucherzinses, son<strong>de</strong>rn hat in etwa auch die Funktion einer<br />
Wirkursache, insofern sie <strong>de</strong>r Ernährung (<strong>de</strong>s Baumes) dient.<br />
Daher ist es nicht das gleiche.<br />
Zu 2. Besitz, <strong>de</strong>r aus Wucherzins erworben wur<strong>de</strong>, gehört<br />
nicht <strong>de</strong>nen, von <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Wucherzins stammt, son<strong>de</strong>rn<br />
<strong>de</strong>nen, die ihn gekauft haben. Er bleibt jedoch <strong>de</strong>n Zinsgebern<br />
verpfän<strong>de</strong>t gleich wie auch alle an<strong>de</strong>ren Güter <strong>de</strong>s Wucherers.<br />
Deshalb besteht keine Vorschrift, jenen Besitz auf die Zinsgeber<br />
zu übertragen, <strong>de</strong>nn vielleicht ist er mehr Wert als die Zinsen,<br />
die sie bezahlt haben. Doch wird vorgeschrieben, <strong>de</strong>n Besitz<br />
zu verkaufen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Erlös davon entsprechend <strong>de</strong>r Höhe<br />
<strong>de</strong>s eingenommenen Wucherzinses zurückzuerstatten.<br />
Zu 3. Was jemand mit Wucherzins erwirbt, gehört <strong>de</strong>m Käu<br />
fer, zwar nicht wegen <strong>de</strong>s dafür ausgegebenen Wuchergel<strong>de</strong>s<br />
gleichsam als <strong>de</strong>r Instrumentalursache, son<strong>de</strong>rn wegen seiner<br />
Geschäftstüchtigkeit als Hauptursache. Daher besitzt er mehr<br />
<strong>Recht</strong> an <strong>de</strong>r mit Wucherzins bezahlten Sache als am Wucher<br />
geld selbst.<br />
4. ARTIKEL<br />
Ist es erlaubt, gegen Zins ein Darlehen aufzunehmen?<br />
1. Der Apostel schreibt Rom 1,32: „Des To<strong>de</strong>s würdig sind<br />
nicht nur, die Sün<strong>de</strong> tun, son<strong>de</strong>rn auch, die <strong>de</strong>nen bereitwillig<br />
zustimmen, die sie tun." Doch wer ein Darlehen gegen Zinsen<br />
aufnimmt, stimmt <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Wucherers zu <strong>und</strong> veranlaßt<br />
ihn zu sündigen. Also sündigt auch er.<br />
220
2. Man darf einem an<strong>de</strong>ren um keines zeitlichen Vorteils 78. 4<br />
willen Gelegenheit zur Sün<strong>de</strong> geben, dies be<strong>de</strong>utet nämlich<br />
aktives Ärgernisgeben [74], was, wie oben [11-1143,2)<br />
bemerkt, immer Sün<strong>de</strong> ist. Nun gibt, wer ein Darlehen vom<br />
Wucherer verlangt, ausdrücklich Gelegenheit zur Sün<strong>de</strong>. Also<br />
ist er durch keinen zeitlichen Vorteil entschuldigt.<br />
3. Die Notwendigkeit, sein Geld bisweilen beim Wucherer<br />
zu hinterlegen, ist wohl nicht geringer, als bei ihm ein Darlehen<br />
aufzunehmen. Doch sein Geld <strong>de</strong>m Wucherer anzuvertrauen<br />
scheint ebenso gänzlich unerlaubt zu sein wie ein Schwert bei<br />
einem Wahnsinnigen aufzubewahren o<strong>de</strong>r eine Jungfrau einem<br />
Wüstling zu überlassen o<strong>de</strong>r Nahrungsmittel einem Schlem<br />
mer. Also ist es auch nicht erlaubt, ein Darlehen beim Wucherer<br />
aufzunehmen.<br />
DAGEGEN verfehlt sich, nach Aristoteles (Eth.V, 15;<br />
1138 a 34) nicht, wer Unrecht erlei<strong>de</strong>t. Daher steht die Gerech<br />
tigkeit auch nicht in <strong>de</strong>r Mitte zwischen zwei Lastern, wie es<br />
dort (c.9; 1138b32) heißt. Doch <strong>de</strong>r Wucherer sündigt, inso<br />
fern er <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r gegen Zins ein Darlehen aufnimmt, Unrecht<br />
tut. Also sündigt, wer ein Darlehen gegen Zins aufnimmt, nicht.<br />
ANTWORT. Einen Menschen zum Sündigen verleiten ist in<br />
keiner Weise erlaubt. Die Sün<strong>de</strong> eines an<strong>de</strong>ren zum Guten<br />
gebrauchen ist hingegen erlaubt. Auch Gott gebraucht alle Sün<br />
<strong>de</strong>n zu etwas Gutem, aus je<strong>de</strong>m Bösen lockt er etwas Gutes<br />
hervor, wie es im Enchiridion heißt (Augustinus: Enchiridion <strong>de</strong><br />
fi<strong>de</strong>, spe et caritate, c. 11; ML 40,236). Daher antwortet<br />
Augustinus <strong>de</strong>m Publicola (Ep. 47; ML 33,184) auf die Frage, ob<br />
es erlaubt sei, sich <strong>de</strong>n Eid <strong>de</strong>ssen zun<strong>utz</strong>e zu machen, <strong>de</strong>r bei<br />
falschen Göttern schwört, (wobei er offenk<strong>und</strong>ig sündigt,<br />
in<strong>de</strong>m er ihnen göttliche Ehrung erweist): „Wer sich die Über<br />
zeugung <strong>de</strong>ssen, <strong>de</strong>r bei falschen Göttern schwört, zun<strong>utz</strong>e<br />
macht, nicht zum Bösen, son<strong>de</strong>rn zum Guten, verstrickt sich<br />
nicht in seine Sün<strong>de</strong>, durch die er bei <strong>de</strong>n bösen Geistern<br />
geschworen hat, son<strong>de</strong>rn verbin<strong>de</strong>t sich nur mit <strong>de</strong>r guten Seite<br />
seiner Ei<strong>de</strong>sformel, durch die jener sich verpflichtet hat, die<br />
Treue zu wahren." Wür<strong>de</strong> er ihn aber dazu verleiten, bei fal<br />
schen Göttern zu schwören, dann beginge er eine Sün<strong>de</strong>.<br />
So ist auch im vorliegen<strong>de</strong>n Fall zu sagen, daß es unter kei<br />
nen Umstän<strong>de</strong>n erlaubt ist, jeman<strong>de</strong>n zu veranlassen, Darlehen<br />
gegen Zins zu geben. Man darf jedoch bei einem, <strong>de</strong>r dazu<br />
bereit ist <strong>und</strong> Zinsen nimmt, um eines Gutes willen, d. h. um<br />
221
78. 4 sich selbst o<strong>de</strong>r einen an<strong>de</strong>ren aus einer Notlage zu befreien,<br />
ein Darlehen gegen Zins aufnehmen. So darf ja auch einer, um<br />
<strong>de</strong>m Tod zu entgehen, die Räuber, unter die er gefallen ist, auf<br />
seine mitgeführten Sachen hinweisen, obwohl die Banditen<br />
durch <strong>de</strong>ren Raub eine Sün<strong>de</strong> begehen. Dies entspricht genau<br />
<strong>de</strong>m Beispiel <strong>de</strong>r zehn Männer, die zu Ismael sagten: „Töte uns<br />
nicht, <strong>de</strong>nn wir haben einen versteckten Schatz im Acker"<br />
(Jer41,8).<br />
Zu 1. Wer ein Darlehen gegen Zins aufnimmt, stimmt <strong>de</strong>r<br />
Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Wucherers nicht zu, son<strong>de</strong>rn macht sie sich nur<br />
zun<strong>utz</strong>e. Auch fin<strong>de</strong>t er keinen Gefallen am Einheimsen <strong>de</strong>s<br />
Zinses, son<strong>de</strong>rn am Darlehen, <strong>und</strong> das ist eine gute Sache.<br />
Zu 2. Wer ein Darlehen gegen Zins entgegennimmt, ver<br />
anlaßt <strong>de</strong>n Wucherer nicht, Zinsen zu verlangen, son<strong>de</strong>rn nur,<br />
ein Darlehen auszuhändigen. Für <strong>de</strong>n Wucherer hingegen ist<br />
dies eine Gelegenheit, aus Bosheit zu sündigen. Daher liegt die<br />
Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ärgernisses auf seiner Seite, <strong>de</strong>r Darlehensnehmer<br />
jedoch hat damit ursächlich nichts zu tun. Er braucht sich<br />
wegen eines solchen Ärgernisses von einem dringlichen Darle<br />
hensgesuch auch nicht abhalten zu lassen, <strong>de</strong>nn jenes Ärgernis<br />
kommt nicht aus Schwäche o<strong>de</strong>r Unwissenheit, son<strong>de</strong>rn aus<br />
Bosheit.<br />
Zu 3. Wenn einer sein Geld <strong>de</strong>m Wucherer brächte, <strong>de</strong>r sonst<br />
nichts hätte, womit er sich Zinsen verschaffen könnte, o<strong>de</strong>r es<br />
ihm mit <strong>de</strong>r Absicht übergäbe, damit größeren Zinsgewinn<br />
zu erzielen, dann böte er ihm das „Material" zur Sün<strong>de</strong>. Daher<br />
wür<strong>de</strong> er auch sich selbst in die Schuld verstricken. Ubergäbe<br />
aber jemand einem Wucherer, <strong>de</strong>r sonst genug hat, um damit<br />
sein Wuchergeschäft zu betreiben, sein Geld, damit es bei ihm<br />
sicherer aufgehoben ist, so sündigt er nicht, son<strong>de</strong>rn gebraucht<br />
<strong>de</strong>n Sün<strong>de</strong>r nur für einen guten Zweck.<br />
222
79. FRAGE<br />
DIE DER VERVOLLSTÄNDIGUNG<br />
DIENENDEN TEILTUGENDEN<br />
DER GERECHTIGKEIT.<br />
Schließlich sind noch die Teiltugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zu<br />
behan<strong>de</strong>ln, die ihrer Vervollständigung dienen, nämlich: das<br />
Gute tun <strong>und</strong> das Böse mei<strong>de</strong>n, sowie die entgegenstehen<strong>de</strong>n<br />
Laster.<br />
Dabei ergeben sich vier Fragen:<br />
1. Sind die bei<strong>de</strong>n vorgenannten Tugen<strong>de</strong>n Teile <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit?<br />
2. Ist die Übertretung eine Sün<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rer Art?<br />
3. Ist die Unterlassung eine Sün<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rer Art?<br />
4. Vergleich zwischen Unterlassung <strong>und</strong> Übertretung.<br />
1. ARTIKEL<br />
Sind Das-Gute-tun <strong>und</strong> Das-Böse-mei<strong>de</strong>n Teile <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>?<br />
1. „Das Gute tun" <strong>und</strong> „das Böse mei<strong>de</strong>n" gehören zu je<strong>de</strong>r<br />
Tugend. Die Teile aber gehen nicht über das Ganze hinaus. Also<br />
dürfen „Das Böse mei<strong>de</strong>n" <strong>und</strong> „Das Gute tun" nicht als Teile<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, die eine Tugend beson<strong>de</strong>rer Art ist, ange<br />
sehen wer<strong>de</strong>n.<br />
2. Zum Psalmwort 33,15 „Mei<strong>de</strong> das Böse <strong>und</strong> tue das<br />
Gute" sagt die Glosse (ML191,343): „Jenes vermei<strong>de</strong>t die<br />
Schuld", nämlich das Mei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Bösen, „dieses verdient Leben<br />
<strong>und</strong> Siegespalme", nämlich das Tun <strong>de</strong>s Guten. Doch je<strong>de</strong>r Teil<br />
<strong>de</strong>r Tugend verdient Leben <strong>und</strong> Siegespalme. Also ist „das Böse<br />
mei<strong>de</strong>n" nicht Teil <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
3. Wenn die eine Sache in <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren enthalten ist, unter<br />
schei<strong>de</strong>n sie sich nicht voneinan<strong>de</strong>r wie Teile eines Ganzen.<br />
„Das Böse mei<strong>de</strong>n" aber ist im „das Gute tun" enthalten, <strong>de</strong>nn<br />
niemand tut zugleich Böses <strong>und</strong> Gutes. Also sind „Böses mei<br />
<strong>de</strong>n" <strong>und</strong> „Gutes tun" nicht Teile <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
223
79. l DAGEGEN hält Augustinus im Buch De correptione et gratia<br />
(c. 1; ML 44,917) dafür, daß zur Gesetzesgerechtigkeit „Böses<br />
mei<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Gutes tun" gehören.<br />
ANTWORT. Wenn wir vom Guten <strong>und</strong> Bösen im allgemei<br />
nen sprechen dann gehören „Gutes tun" <strong>und</strong> „Böses mei<strong>de</strong>n"<br />
zu je<strong>de</strong>r Tugend. Und so gesehen können sie nicht Teile <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> sein, es sei <strong>de</strong>nn, man nehme <strong>Gerechtigkeit</strong> im<br />
Sinn von „je<strong>de</strong> Tugend" („je<strong>de</strong> Tugend ist <strong>Gerechtigkeit</strong>").<br />
Gleichwohl stellt sich das Gute auch in einer so verstan<strong>de</strong>nen<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> von einer beson<strong>de</strong>ren Seite dar, nämlich in seiner<br />
Hinordnung auf das göttliche o<strong>de</strong>r das menschliche Gesetz.<br />
Doch als beson<strong>de</strong>re Tugend erfaßt die <strong>Gerechtigkeit</strong> das<br />
Gute unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt <strong>de</strong>s Geschul<strong>de</strong>tseins gegenüber<br />
<strong>de</strong>m Nächsten. Und so gehört es zur Einzelgerechtigkeit, das<br />
Gute als Geschul<strong>de</strong>tes gegenüber <strong>de</strong>m Nächsten zu tun <strong>und</strong> das<br />
entgegengesetzte Böse zu unterlassen, nämlich das, was <strong>de</strong>m<br />
Nächsten scha<strong>de</strong>t. Zur allgemeinen <strong>Gerechtigkeit</strong> jedoch<br />
gehört es, das geschul<strong>de</strong>te Gute in Hinordnung auf das<br />
Gemeinwesen o<strong>de</strong>r auf Gott zu tun <strong>und</strong> das entgegengesetzte<br />
Böse zu mei<strong>de</strong>n.<br />
Nun wer<strong>de</strong>n diese bei<strong>de</strong>n Teile <strong>de</strong>r allgemeinen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Son<br />
<strong>de</strong>rgerechtigkeit als „gleichsam vervollständigen<strong>de</strong> Teile"<br />
bezeichnet, weil sie für die Vollkommenheit <strong>de</strong>s gerechten<br />
Aktes unerläßlich sind. <strong>Gerechtigkeit</strong> muß bekanntlich <strong>de</strong>n<br />
Ausgleich in <strong>de</strong>n sachlichen Beziehungen zu <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren her<br />
stellen, wie oben (58,2) dargelegt wur<strong>de</strong>. Nun ist beim Herstel<br />
len <strong>und</strong> beim Erhalten <strong>de</strong>s Hergestellten das gleiche Prinzip<br />
wirksam. Das Gleichmaß <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> stellt aber einer<br />
dadurch her, daß er das Gute tut, d. h. <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren läßt <strong>und</strong><br />
gibt, was sein ist. Er bewahrt <strong>de</strong>n Ausgleich <strong>de</strong>r bereits her<br />
gestellten <strong>Gerechtigkeit</strong>, in<strong>de</strong>m er das Böse mei<strong>de</strong>t, d. h. seinem<br />
Nächsten keinerlei Scha<strong>de</strong>n zufügt.<br />
Zu 1. Gut <strong>und</strong> böse wer<strong>de</strong>n hier unter einem beson<strong>de</strong>ren<br />
Gesichtspunkt <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zugeordnet. Die bei<strong>de</strong>n<br />
erscheinen nämlich wegen einer eigenen Art von gut <strong>und</strong> böse<br />
als Teile nur <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> nicht einer an<strong>de</strong>ren sittlichen<br />
Tugend, weil die an<strong>de</strong>ren sittlichen Tugen<strong>de</strong>n sich auf die Lei<br />
<strong>de</strong>nschaften beziehen, wobei es beim Tun <strong>de</strong>s Guten um das<br />
Erreichen <strong>de</strong>r Tugendmitte geht, d. h. um das Vermei<strong>de</strong>n eines<br />
fragwürdigen Extremverhaltens. Und so kommt bei diesen<br />
an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n Gutes tun <strong>und</strong> Böses lassen auf dasselbe her-<br />
224
aus. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> hingegen hat es mit Handlungen <strong>und</strong> 79. 2<br />
äußeren Dingen zu tun, wobei es etwas an<strong>de</strong>res ist, das Gleich<br />
maß herzustellen, <strong>und</strong> etwas an<strong>de</strong>res, das hergestellte nicht zu<br />
gefähr<strong>de</strong>n.<br />
Zu 2. Sich vom Bösen abwen<strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utet als Teil <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> nicht reine Verneinung im Sinn von „Böses nicht<br />
tun", <strong>de</strong>nn dies verdiente nicht die Siegespalme (ewigen Lohn),<br />
son<strong>de</strong>rn vermie<strong>de</strong> nur Strafe; es be<strong>de</strong>utet vielmehr einen positi<br />
ven Willensakt, <strong>de</strong>r das Böse von sich weist, wie dies ja auch im<br />
Wort „sich abwen<strong>de</strong>n" zum Ausdruck kommt. So etwas ist ver<br />
dienstlich, vor allem, wenn jemand angefochten wird, das Böse<br />
zu tun, <strong>und</strong> <strong>de</strong>m dann wi<strong>de</strong>rsteht.<br />
Zu 3. Im Tun <strong>de</strong>s Guten liegt die Vollendung <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit, es ist gleichsam ihr hauptsächlichster Teil. Sich vom Bösen<br />
abwen<strong>de</strong>n hingegen ist <strong>de</strong>r unvollkommenere Akt <strong>und</strong> ihr zweit<br />
rangiger Teil. Er bil<strong>de</strong>t daher sozusagen die materielle Seite,<br />
ohne die <strong>de</strong>r eigentliche <strong>und</strong> vollen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Teil nicht sein kann.<br />
2. ARTIKEL<br />
Ist die Übertretung eine Sün<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rer Art?<br />
1. Die Art wird nicht in die Definition <strong>de</strong>r Gattung auf<br />
genommen. „Übertretung" aber fin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r allgemeinen<br />
Definition <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>. Ambrosius schreibt nämlich (De Paradiso,<br />
c.8; ML 14,292), die Sün<strong>de</strong> bestehe in <strong>de</strong>r „Übertretung <strong>de</strong>s<br />
göttlichen Gesetzes". Also bietet die Übertretung keine beson<br />
<strong>de</strong>re Art <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>.<br />
2. Keine Art geht über ihre Gattung hinaus. Doch die Über<br />
tretung geht über <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> hinaus, <strong>de</strong>nn nach<br />
Augustins Contra Faustum, BuchXXII (c.27; ML42,418) ist<br />
die Sün<strong>de</strong> „Wort o<strong>de</strong>r Tat o<strong>de</strong>r ein Begehren gegen das Gesetz<br />
Gottes". Übertretung aber gibt es auch gegen die Natur o<strong>de</strong>r die<br />
Gewohnheit. Also ist Übertretung keine beson<strong>de</strong>re Art von<br />
Sün<strong>de</strong>.<br />
3. Die Art enthält in sich nicht alle Teile, aus <strong>de</strong>r die Gattung<br />
besteht. Doch die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Übertretung erstreckt sich auf alle<br />
Hauptsün<strong>de</strong>n <strong>und</strong> auch auf die Gedanken-, Wort- <strong>und</strong> Tatsün<br />
<strong>de</strong>n. Also ist die Übertretung keine beson<strong>de</strong>re Art von Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN steht, daß sie einer beson<strong>de</strong>ren Tugend wi<strong>de</strong>r<br />
spricht, nämlich <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
225
ANTWORT. Der Ausdruck „Übertretung" wur<strong>de</strong> von kör<br />
perlichen Bewegungen auf sittliche Akte übertragen. Wenn nun<br />
jemand in körperlicher Bewegung „übertritt", so heißt dies, er<br />
„tritt über" die für ihn bestimmte Grenze. Auf sittlichem Gebiet<br />
sind es die negativen Gebote, die <strong>de</strong>m Menschen eine Grenze<br />
vorschreiben, die er nicht überschreiten darf. Daher spricht man<br />
im eigentlichen Sinn von Übertretung, wenn jemand gegen ein<br />
negatives Gebot han<strong>de</strong>lt.<br />
Materiell gesehen kann dies bei allen Sün<strong>de</strong>narten ebenso<br />
sein, <strong>de</strong>nn bei je<strong>de</strong>r Art von Todsün<strong>de</strong> übertritt <strong>de</strong>r Mensch ein<br />
göttliches Gebot. - Nimmt man es aber im eigentlichen Sinn,<br />
nämlich unter <strong>de</strong>m beson<strong>de</strong>ren Gesichtspunkt <strong>de</strong>s Verstoßes<br />
gegen ein negatives Gebot, so han<strong>de</strong>lt es sich in zweifacher<br />
Weise um eine beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong>. Einmal, insofern sie sich von<br />
<strong>de</strong>n Sün<strong>de</strong>narten unterschei<strong>de</strong>t, die <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n ent<br />
gegengesetzt sind: wie nämlich die Gesetzesgerechtigkeit ihren<br />
eigentlichen Ausdruck darin fin<strong>de</strong>t, daß sie auf die Verpflich<br />
tung gegenüber <strong>de</strong>m Gesetz achtet, so ist die Übertretung<br />
wesentlich dadurch gekennzeichnet, daß sie auf die Verachtung<br />
<strong>de</strong>s Gesetzes hinausläuft. Sodann, insofern sie sich von <strong>de</strong>r<br />
„Unterlassung" abhebt, die <strong>de</strong>m positiven Gebot gegenüber<br />
steht.<br />
Zu 1. Wie die Gesetzesgerechtigkeit von ihrem Subjekt<br />
(Willen) <strong>und</strong> gewissermaßen von ihrem materiellen Umfang<br />
her gesehen „allumfassen<strong>de</strong> Tugend" ist, so liegt in je<strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong><br />
ein Verstoß gegen die Gesetzesgerechtigkeit. Und so hat<br />
Ambrosius die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>finiert, nämlich nach <strong>de</strong>m Gesichtspunkt<br />
<strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit [75].<br />
Zu 2. Die naturhafte Neigung gehört zu <strong>de</strong>n Geboten <strong>de</strong>s<br />
Naturgesetzes. Auch ehrenhafte Gewohnheit hat das Gewicht<br />
eines Gebotes, <strong>de</strong>nn, wie Augustinus in seinem Brief über das<br />
Samstagsfasten schreibt (ep.33; ML 33,136), „sind die Sitten<br />
<strong>de</strong>s Volkes Gottes als Gesetze zu betrachten". Daher kann es<br />
sowohl Sün<strong>de</strong> als auch Übertretung gegen die ehrenhafte<br />
Gewohnheit <strong>und</strong> gegen die naturhafte Neigung geben.<br />
Zu 3. Bei allen aufgezählten Sün<strong>de</strong>narten kann eine Über<br />
tretung vorkommen, zwar nicht gemäß ihrer spezifischen<br />
Natur, son<strong>de</strong>rn unter einem beson<strong>de</strong>ren Gesichtspunkt, wie<br />
gesagt wur<strong>de</strong>. - Die Unterlassungssün<strong>de</strong> jedoch ist unbedingt<br />
von <strong>de</strong>r Übertretung zu unterschei<strong>de</strong>n.<br />
226
3. ARTIKEL<br />
Ist die Unterlassung eine Sün<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rer Art?<br />
1. Die Sün<strong>de</strong> ist entwe<strong>de</strong>r Erbsün<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r persönliche<br />
Sün<strong>de</strong>. Doch die Unterlassung ist nicht Erbsün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>nn man<br />
bekommt sie nicht durch die Geburt, sie ist aber auch nicht per<br />
sönlich getan, weil sie ohne unser Zutun entstehen kann, wie<br />
oben dargelegt wur<strong>de</strong>, als es um die Sün<strong>de</strong>n im allgemeinen<br />
ging (I-II71,5). Also ist Unterlassung keine Sün<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rer<br />
Art.<br />
2. Je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> wird freiwillig getan. Doch die Unterlassung<br />
ist bisweilen nicht freiwillig, son<strong>de</strong>rn ergibt sich ohne willentli<br />
ches Zutun, z. B. wenn eine nicht mehr jungfräuliche Frau,<br />
Jungfräulichkeit gelobt hat, o<strong>de</strong>r wenn jeman<strong>de</strong>m eine Sache,<br />
die er zurückgeben muß, abhan<strong>de</strong>n gekommen ist, o<strong>de</strong>r wenn<br />
ein Priester Messe lesen sollte <strong>und</strong> durch irgen<strong>de</strong>twas daran<br />
gehin<strong>de</strong>rt wird. Also ist die Unterlassung nicht immer Sün<strong>de</strong>.<br />
3. Für je<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong> kann man <strong>de</strong>n Zeitpunkt ange<br />
ben, wann sie beginnt. Doch dies ist bei <strong>de</strong>r Unterlassung nicht<br />
möglich, weil sie während <strong>de</strong>r ganzen Zeit, in <strong>de</strong>r das Han<strong>de</strong>ln<br />
ruht, andauert, <strong>und</strong> <strong>de</strong>nnoch sündigt man nicht ohne Unterlaß.<br />
Also ist die Unterlassung keine Sün<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rer Art.<br />
4. Je<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>re Sün<strong>de</strong> ist einer beson<strong>de</strong>ren Tugend entge<br />
gengesetzt. Doch gibt es keine beson<strong>de</strong>re Tugend, die <strong>de</strong>r Un<br />
terlassung entgegengesetzt wäre, einmal, weil das Gut je<strong>de</strong>r<br />
Tugend Objekt von Unterlassung sein kann, <strong>und</strong> sodann, weil<br />
die <strong>Gerechtigkeit</strong>, <strong>de</strong>r sie am meisten entgegensetzt zu sein<br />
scheint, stets einen Akt verlangt, selbst um sich vom Bösen<br />
abzuwen<strong>de</strong>n (Art. 1,2). Die Unterlassung jedoch kann ohne<br />
je<strong>de</strong>n Akt geschehen. Also ist sie keine Sün<strong>de</strong>.<br />
DAGEGEN heißt es bei Jak4,17: „Wer das Gute tun kann<br />
<strong>und</strong> es nicht tut, <strong>de</strong>r sündigt."<br />
ANTWORT. Unterlassung be<strong>de</strong>utet Auslassung <strong>de</strong>s Guten,<br />
jedoch nicht irgendwelchen, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s geschul<strong>de</strong>ten Guten.<br />
Das Gute als etwas Geschul<strong>de</strong>tes gehört jedoch im eigentlichen<br />
Sinn zur <strong>Gerechtigkeit</strong>: zur Gesetzesgerechtigkeit, falls das<br />
Geschul<strong>de</strong>te aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s göttlichen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s menschlichen<br />
Gesetzes zu leisten ist, zur Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit, wenn sich das<br />
Geschul<strong>de</strong>te auf eine Verpflichtung gegenüber <strong>de</strong>m Nächsten<br />
bezieht. Ebenso also wie die <strong>Gerechtigkeit</strong> eine beson<strong>de</strong>re<br />
227<br />
79. 3
79. 3 Tugend ist (vgl. 58,5), ist auch die Unterlassung eine beson<strong>de</strong>re<br />
Sün<strong>de</strong>, die sich von <strong>de</strong>n Sün<strong>de</strong>n gegen an<strong>de</strong>re Tugen<strong>de</strong>n unter<br />
schei<strong>de</strong>t. In <strong>de</strong>rselben Weise aber wie „Das Gute tun", <strong>de</strong>m die<br />
Unterlassung gegenübersteht, ein beson<strong>de</strong>rer Teil <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit ist - unterschie<strong>de</strong>n vom „Das Böse mei<strong>de</strong>n", <strong>de</strong>m<br />
Gegensatz zur Übertretung -, unterschei<strong>de</strong>t sich auch die Un<br />
terlassung von <strong>de</strong>r Übertretung.<br />
Zu 1. Die Unterlassung ist nicht Erbsün<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn persön<br />
lich begangene Sün<strong>de</strong>, nicht weil sie aus einem ihr wesentlich<br />
eigenen Akt bestün<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn weil <strong>de</strong>r NichtVollzug einer<br />
Handlung <strong>de</strong>r Gattung <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lns zugerechnet wird. Dem<br />
entsprechend wird, wie oben erklärt, Nichttun als eine Art Tun<br />
genommen.<br />
Zu 2. Die Unterlassung bezieht sich, wie erklärt, nurauf das<br />
Gute, das man hätte tun müssen. Niemand aber ist zum<br />
Unmöglichen verpflichtet. Daher sündigt niemand durch Un<br />
terlassung, <strong>de</strong>r nicht tut, was er nicht tun kann. Die Frau also,<br />
die Jungfräulichkeit gelobt hat, ohne sie noch zu besitzen, be<br />
geht dadurch, daß sie nicht mehr Jungfrau ist, keine Unterlas<br />
sungssün<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn nur dann, wenn sie ihre begangene Sün<strong>de</strong><br />
nicht bereut o<strong>de</strong>r wenn sie nicht durch Beobachtung <strong>de</strong>r<br />
Keuschheit nach Kräften ihr Gelüb<strong>de</strong> zu erfüllen trachtet. Auch<br />
<strong>de</strong>r Priester ist nur zur Meßfeier verpflichtet, wenn die nötigen<br />
Voraussetzungen gegeben sind; fehlen sie, dann begeht er keine<br />
Unterlassungssün<strong>de</strong>. Ebenso ist nur zur Restitution verpflich<br />
tet, wer die Möglichkeit dazu besitzt; hat er sie nicht <strong>und</strong> kann<br />
er sie nicht haben, ist, falls er nur sein Möglichstes tut, von Un<br />
terlassungssün<strong>de</strong> nicht die Re<strong>de</strong>. Und ähnliches gilt für an<strong>de</strong>re<br />
Fälle.<br />
Zu 3. Wie die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Übertretung <strong>de</strong>n negativen Gebo<br />
ten, die sich auf das „Sich vom Bösen abwen<strong>de</strong>n" beziehen, ent<br />
gegengesetzt ist, so bil<strong>de</strong>t die Unterlassungssün<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Gegen<br />
satz zu <strong>de</strong>n positiven Geboten, die „Das Gute tun" vorschrei<br />
ben. Die positiven Gebote verpflichten jedoch nicht ununter<br />
brochen, son<strong>de</strong>rn nur, wenn es darauf ankommt. Han<strong>de</strong>lt man<br />
dann nicht, beginnt die Unterlassungssün<strong>de</strong>.<br />
Es kann jedoch vorkommen, daß sich einer dann nicht<br />
imstan<strong>de</strong> sieht, zu tun, was er soll. Trägt er daran keine Schuld,<br />
dann ist, wie gesagt, von Unterlassungssün<strong>de</strong> keine Re<strong>de</strong>. -<br />
Beruht die Unterlassung jedoch auf vorausgehen<strong>de</strong>r Schuld,<br />
z. B. wenn sich einer am Abend betrunken hat <strong>und</strong> sich <strong>de</strong>shalb<br />
228
zu <strong>de</strong>n pflichtgemäßen Metten nicht erheben kann, dann fängt 79. 4<br />
nach einigen die Unterlassungssün<strong>de</strong> in <strong>de</strong>m Augenblick an, wo<br />
er <strong>de</strong>n unerlaubten <strong>und</strong> mit seiner Pflicht nicht zu vereinbaren<br />
<strong>de</strong>n Akt begeht. Doch dies scheint nicht richtig zu sein. Denn<br />
angenommen, er wür<strong>de</strong> mit Gewalt aus <strong>de</strong>m Schlaf gerissen<br />
<strong>und</strong> ginge zu <strong>de</strong>n Metten, dann wür<strong>de</strong> er keine Unterlassungs<br />
sün<strong>de</strong> begehen. Somit ist es klar, daß <strong>de</strong>r vorausgehen<strong>de</strong> Trun<br />
kenheitszustand nicht die Unterlassungssün<strong>de</strong> selbst, son<strong>de</strong>rn<br />
<strong>de</strong>ren Ursache war. - Man muß daher sagen: die Unterlassung<br />
wird ihm erst dann als Schuld angerechnet, wenn die Zeit zum<br />
Han<strong>de</strong>ln gekommen ist, allerdings wegen <strong>de</strong>r vorausgehen<strong>de</strong>n<br />
Ursache, wodurch die nachfolgen<strong>de</strong> Unterlassung zur freiwilli<br />
gen wird.<br />
Zu 4. Die Unterlassung ist, wie gesagt, direkt <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit entgegengesetzt, <strong>de</strong>nn es gibt Unterlassung <strong>de</strong>s Guten<br />
irgen<strong>de</strong>iner Tugend nur, wenn dieses Gut <strong>de</strong>n Charakter <strong>de</strong>s<br />
Geschul<strong>de</strong>ten trägt, <strong>und</strong> dadurch fällt es unter die Gerechtig<br />
keit. Mehr aber verlangt <strong>de</strong>r verdienstliche Tugendakt als das<br />
Mißverdienst <strong>de</strong>r Schuld, <strong>de</strong>nn „das Gute kommt nur zustan<strong>de</strong><br />
durch Erfüllung sämtlicher Bedingungen, das Schlechte ergibt<br />
sich aus jeglichem Versagen" (Dionysius Areopagita: De div.<br />
nom.; MG 3,729).<br />
4. ARTIKEL<br />
Ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Unterlassung schwerer als die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Übertretung?<br />
1. Verfehlung ist das gleiche wie „Fehlen", <strong>und</strong> folglich das<br />
selbe wie Unterlassung. Doch eine Verfehlung ist schwerer als<br />
eine sündhafte Übertretung, weil sie nach Lv 5,15 größerer<br />
Sühne bedurfte. Also ist die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Unterlassung schwerer<br />
als die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Übertretung.<br />
2. Dem größeren Gut steht das größere Übel gegenüber, wie<br />
Aristoteles im V.Buch seiner Ethik (c. 12; 1160b9) erklärt.<br />
Doch „Das Gute tun", <strong>de</strong>m die Unterlassung entgegensteht, ist<br />
ein vornehmerer Teil <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> als „Das Böse mei<strong>de</strong>n",<br />
<strong>de</strong>m als Gegensatz die Übertretung entspricht (Art. 1,3). Also<br />
ist die Unterlassung eine schwerere Sün<strong>de</strong> als die Übertretung.<br />
3. Die Tatsün<strong>de</strong> kann leicht <strong>und</strong> schwer sein. Doch die Un<br />
terlassungssün<strong>de</strong> scheint immer schwer zu sein, <strong>de</strong>nn sie wi<strong>de</strong>r-<br />
229
79. 4 setzt sich einem positiven Gebot. Also ist die Unterlassung<br />
wohl eine schwerere Sün<strong>de</strong> als die Übertretung.<br />
4. Die ewige Verdammnis, d. h. <strong>de</strong>r Ausschluß von Gottes<br />
Anschauung, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Unterlassungssün<strong>de</strong>r droht, ist eine grö<br />
ßere Strafe als die Qual <strong>de</strong>r Sinne, die <strong>de</strong>m Übertretungssün<strong>de</strong>r<br />
bevorsteht, wie Cbrysostomus in seinem Matthäuskommentar<br />
(Horn. 23; MG57,317) schreibt. Doch die Strafe entspricht <strong>de</strong>r<br />
Schuld. Also ist die Unterlassung schwerer sündhaft als die<br />
Übertretung.<br />
DAGEGEN steht: es ist leichter, das Böse zu lassen als das<br />
Gute zu tun. Also sündigt schwerer, wer das Böse nicht läßt,<br />
also durch Übertretung sündigt, als wer das Gute nicht tut,<br />
was sündhafte Unterlassung be<strong>de</strong>utet.<br />
ANTWORT. Die Schwere <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> wächst mit ihrem<br />
Abstand von <strong>de</strong>r Tugend. „Gegensätzlichkeit" ist jedoch „<strong>de</strong>r<br />
größte Abstand", wie es (bei Aristoteles) im X. Buch <strong>de</strong>r Meta<br />
physik (c.4; 1055a9) heißt. Daher steht das Entgegengesetzte<br />
von seinem Entgegengesetzten weiter ab als seine bloße Vernei<br />
nung, wie etwa schwarz weiter absteht von weiß als das bloße<br />
nicht-weiss. Alles Schwarze ist nämlich nicht weiß, aber nicht<br />
umgekehrt. Ganz ein<strong>de</strong>utig ist nun die Übertretung <strong>de</strong>m Akt<br />
<strong>de</strong>r Tugend entgegengesetzt, die Unterlassung hingegen besagt<br />
nur seine Verneinung. Wer z. B. <strong>de</strong>n Eltern die geschul<strong>de</strong>te Ehr<br />
erbietung nicht erweist, begeht eine Unterlassungssün<strong>de</strong>, eine<br />
Übertretungssün<strong>de</strong> aber, wenn er sie schmäht o<strong>de</strong>r sonstwie<br />
beleidigt. Schlechthin <strong>und</strong> absolut gesagt ist die Übertretung<br />
ohne Zweifel eine schwerere Sün<strong>de</strong> als die Unterlassung, wenn<br />
gleich gegebenenfalls eine Unterlassung schwerer wiegen kann<br />
als eine Übertretung.<br />
Zu 1. Das Wort „Verfehlung" be<strong>de</strong>utet in seinem allgemei<br />
nen Sinn Unterlassung irgendwelcher Art. Bisweilen aber wird<br />
es streng genommen für die Unterlassung unserer Pflichten<br />
gegen Gott, z. B. wenn <strong>de</strong>r Mensch wissentlich <strong>und</strong> mit einer<br />
gewissen Verachtung das unterläßt, was er tun sollte. So erhält<br />
die Verfehlung eine beson<strong>de</strong>re Schwere <strong>und</strong> bedarf daher grö<br />
ßerer Sühne.<br />
Zu 2. Dem Tun <strong>de</strong>s Guten ist sowohl das Nichttun <strong>de</strong>s<br />
Guten, d. h. das Unterlassen, als auch das Bösestun, d. h. die<br />
Übertretung, entgegengesetzt, doch das erstere kontradikto<br />
risch, das zweite konträr, <strong>und</strong> dies be<strong>de</strong>utet einen größeren<br />
Abstand. Daher ist die Übertretung eine schwerere Sün<strong>de</strong>.<br />
230
Zu 3. Wie die Unterlassung positiven Geboten entgegenge- 79. 4<br />
setzt ist, so die Übertretung negativen. Und daher fallen bei<strong>de</strong>,<br />
nimmt man sie im strengen Sinn, in die Kategorie <strong>de</strong>r Todsün<strong>de</strong>.<br />
„Übertretung" o<strong>de</strong>r „Unterlassung" lassen sich jedoch auch<br />
weiter fassen: als etwas, das einfach außerhalb positiver o<strong>de</strong>r<br />
negativer Gebote liegt <strong>und</strong> zu ihren Gegensätzen disponiert.<br />
Und so gesehen können bei<strong>de</strong> läßliche Sün<strong>de</strong> sein.<br />
Zu 4. Der Übertretungssün<strong>de</strong> entspricht die Strafe <strong>de</strong>r Ver<br />
dammnis wegen ihrer Abwendung von Gott <strong>und</strong> die <strong>de</strong>r Sinne<br />
wegen ihrer Hinwendung zu vergänglichen Dingen. In gleicher<br />
Weise gebührt auch <strong>de</strong>r Unterlassung nicht nur die Strafe <strong>de</strong>r<br />
Verdammnis, son<strong>de</strong>rn auch die Strafe <strong>de</strong>r Sinne gemäß Mt 7,19:<br />
„Je<strong>de</strong>r Baum, <strong>de</strong>r keine guten Früchte bringt, wird ausgehauen<br />
<strong>und</strong> ins Feuer geworfen." Und dies wegen <strong>de</strong>r Wurzel, aus <strong>de</strong>r<br />
die Unterlassung hervorgeht, wenngleich sie nicht notwendi<br />
gerweise eine tatsächliche Hinwendung zu vergänglichen Din<br />
gen besagt.<br />
231
ANMERKUNGEN
[1] Thomas macht hier auf <strong>de</strong>n Unterschied zwischen <strong>Recht</strong><br />
<strong>und</strong> Gesetz aufmerksam. Das Gesetz ist die Begründung <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s. Der Inhalt <strong>de</strong>s Gesetzes wird durch das Soll <strong>de</strong>s Geset<br />
zes zum <strong>Recht</strong>. Das <strong>Recht</strong> be<strong>de</strong>utet also <strong>de</strong>n Inhalt <strong>de</strong>s Geset<br />
zes, insofern er zwischen zwei Ansprüchen die Frie<strong>de</strong>nsord<br />
nung herstellt o<strong>de</strong>r, wie Thomas im Artikel sagt, <strong>de</strong>n Ausgleich<br />
schafft. Es ist nun be<strong>de</strong>utsam, daß Thomas nicht irgen<strong>de</strong>ine<br />
logische Deduktion als solche bereits zur rechtsbegrün<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Instanz macht, son<strong>de</strong>rn eben das Gesetz. Die <strong>Recht</strong>spositivi-<br />
sten, so vor allem Kelsen, werfen es <strong>de</strong>r Naturrechtslehre vor, sie<br />
operiere mit logischen Ableitungen, um das <strong>Recht</strong> zu begrün<br />
<strong>de</strong>n. Damit aber wür<strong>de</strong> ein außerjuristischer Prozeß eingeleitet,<br />
<strong>de</strong>r niemals zu <strong>Recht</strong> führen könne. Thomas stimmt ganz mit<br />
<strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen <strong>Recht</strong>sphilosophen überein, daß nur das Gesetz<br />
<strong>Recht</strong> begrün<strong>de</strong>n kann. Der logische Prozeß hat bei ihm nicht<br />
als solcher rechtsbegrün<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Funktion, son<strong>de</strong>rn insofern er<br />
gesetzbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Bewandtnis hat. Es han<strong>de</strong>lt sich nämlich in <strong>de</strong>n<br />
naturrechtlichen Ableitungen nicht um irgendwelche Deduk<br />
tionen unserer Vernunft, son<strong>de</strong>rn um die Deduktionen <strong>de</strong>r<br />
praktischen Vernunft. Die praktische Vernunft aber hat bei<br />
Thomas, sofern sie allgemeine sittliche Ableitungen aus <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Natur im Hinblick auf das geordnete Zusam<br />
menleben <strong>de</strong>r Menschen macht, gesetzgeben<strong>de</strong> Bewandtnis. Es<br />
ist also auch nicht einfach die Finalität <strong>de</strong>s geordneten Zusam<br />
menlebens als solche, welche rechtserzeugend wirkt. Auch hie<br />
rin wur<strong>de</strong> die scholastische Naturrechtslehre miß<strong>de</strong>utet, als ob<br />
sie annähme, die Zweckdienlichkeit irgendwelcher Einsicht<br />
bewirke das <strong>Recht</strong>." Gewiß spielt diese Zweckdienlichkeit eine<br />
Rolle, insofern sie nämlich im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r gesell<br />
schaftlichen Ordnung steht. Aber nicht die Zweckdienlichkeit<br />
als solche bewirkt das Gesetz, son<strong>de</strong>rn die praktische Vernunft,<br />
welche diese Zweckdienlichkeit in naturhaftem Soll zur For<strong>de</strong><br />
rung <strong>de</strong>s Zusammenseins erhebt. Die thomasische Natur<br />
rechtslehre verbleibt also voll <strong>und</strong> ganz im reotelogischen Pro<br />
zeß. Vgl. hierzu Kommentar zu Art. 2.<br />
[2] Unter <strong>de</strong>r menschlichen Natur, die als „verän<strong>de</strong>rlich"<br />
bezeichnet wird, ist hier nicht etwa die spezifische Wesenheit<br />
<strong>de</strong>s Menschen verstan<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn die konkrete Natur, wie sie<br />
entsprechend <strong>de</strong>r geschichtlichen Befindlichkeit sich wan<strong>de</strong>lt.<br />
Das Naturrecht, sofern es auf <strong>de</strong>r allgemeinen Natur, d. h. <strong>de</strong>r<br />
235
spezifischen Wesenheit <strong>de</strong>s Menschen, aufbaut, ist unwan<strong>de</strong>l<br />
bar. Was gegen diese Natur verstößt, be<strong>de</strong>utet einen Wi<strong>de</strong>r<br />
spruch gegen das Naturrecht „an sich", wovon Thomas in <strong>de</strong>r<br />
Lösung <strong>de</strong>s zweiten Einwan<strong>de</strong>s spricht. Thomas will also das<br />
Naturrecht nicht nur im allgemeinen Sinn verstan<strong>de</strong>n wissen,<br />
son<strong>de</strong>rn auch im konkreten Sachbestand, als <strong>Recht</strong>, das sich<br />
hier <strong>und</strong> jetzt aus <strong>de</strong>r Sachanalyse ergibt. Natürlich wird die<br />
sachliche Analyse nach Normen beurteilt. Diese Normen sind<br />
<strong>de</strong>r Natur „an sich" entnommen. Da diese Normen zweckbe<br />
stimmte Normen sind, nämlich Normen im Hinblick auf die<br />
Vervollkommnung <strong>de</strong>r menschlichen Natur, wird <strong>de</strong>r konkrete<br />
Fall, d. h. die sachliche Analyse <strong>de</strong>r konkreten Wirklichkeit nach<br />
dieser Zweckbestimmung o<strong>de</strong>r Zweckentsprechung beurteilt.<br />
<strong>Recht</strong> wird also entsprechend dieser Finalität, d. h. dasjenige ist<br />
Naturrecht im konkreten Sinne, was <strong>de</strong>n Sinn, die innere<br />
Zweckhaftigkeit <strong>de</strong>r Normen am besten erfüllt. Es wur<strong>de</strong> aber<br />
bereits in <strong>de</strong>r Anmerkung [1] gesagt, daß nicht eigentlich die<br />
Finalität als solche die rechts erzeugen<strong>de</strong> Kraft besitzt, son<strong>de</strong>rn<br />
die Vernunft, welche diese Finalität erkennt <strong>und</strong> als Norm aus<br />
spricht. Das Naturrecht in diesem konkreten Sinn ist also etwas<br />
Wan<strong>de</strong>lbares. Es ist kein Schema, son<strong>de</strong>rn wird je <strong>und</strong> je neu<br />
geformt von <strong>de</strong>r menschlichen Vernunft, die nach Thomas, wie<br />
bereits gesagt, rechtserzeugen<strong>de</strong> Kraft ist, sofern sie wahrheits<br />
getreu <strong>de</strong>n objektiven Sachverhalt trifft. Damit ist spekulativ<br />
(wenngleich noch nicht praktisch) <strong>de</strong>r Vorwurf beseitigt, <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>m Naturrechts<strong>de</strong>nken namentlich von Seiten <strong>de</strong>r Positivisten<br />
gemacht wur<strong>de</strong>, daß nämlich das Naturrecht zu allem nütze sei<br />
<strong>und</strong> je<strong>de</strong>r politischen Zielsetzung dienen könne. Das Natur<br />
recht <strong>de</strong>s hl. Thomas ist weit entfernt von dieser subjektiven<br />
Zielsetzung. Seine Sachanalyse ist außerhalb <strong>de</strong>r politischen<br />
Zielsetzung. Diese ergibt sich erst aus jener.<br />
Um das Gesagte, das für ein richtiges Verständnis <strong>de</strong>r thoma<br />
sischen Naturrechtslehre so überaus wichtig ist, etwas auf<br />
zuhellen, sei ein Beispiel angeführt. Thomas hält dafür, daß die<br />
„Sklavenschaft", d.h. bei ihm das Verhältnis <strong>de</strong>r Leibeigen<br />
schaft (vgl. Kommentar zu 57,4), ein „naturrechtlicher"<br />
Zustand sei. Wir wür<strong>de</strong>n uns heute über diese Ausdrucksweise<br />
entsetzen, da für uns das Naturrecht nur im Sinne <strong>de</strong>r unwan<br />
<strong>de</strong>lbaren Normen genommen wird. Thomas aber — Aristoteles<br />
folgend — analysiert die konkrete Befindlichkeit <strong>de</strong>r Gesell<br />
schaft <strong>und</strong> erklärt, daß tatsächlich viele Menschen von Natur<br />
236
einfach keine Veranlagung haben, sich selbst zü regieren <strong>und</strong> ihr<br />
Leben nach eigener Verantwortung einzurichten. Wenn sie<br />
darum in lebenslänglichem Dienstverhältnis unter <strong>de</strong>r<br />
Herrschaft eines an<strong>de</strong>ren stehen, erfüllen sie in <strong>de</strong>r menschli<br />
chen Gesellschaft noch einen nützlichen Beruf. Die Feststel<br />
lung, daß manche Menschen einfach nicht fähig sind, ein völlig<br />
freies Leben zu führen, son<strong>de</strong>rn besser immer in Abhängigkeit<br />
<strong>und</strong> Unterordnung bleiben, wer<strong>de</strong>n wir wohl auch heute noch<br />
nicht abstreiten können, wenngleich wir darum nicht zum<br />
Schluß kommen, daß <strong>de</strong>swegen alle diese Menschen natur<br />
rechtlich ins Verhältnis <strong>de</strong>r Leibeigenschaft gehören. Im allge<br />
meinen gelangen bei uns heute solche Menschen von selbst in<br />
untergeordnete Stellungen, da sie <strong>de</strong>n Konkurrenzkampf nicht<br />
bestehen. Sofern diese nie<strong>de</strong>re Stellung im sozialen Ganzen<br />
nicht menschenunwürdig ist, wer<strong>de</strong>n doch wohl auch wir sagen<br />
müssen, daß damit <strong>de</strong>n betreffen<strong>de</strong>n Menschen <strong>de</strong>r ihrer Natur<br />
entsprechen<strong>de</strong> Platz eingeräumt wor<strong>de</strong>n sei. Thomas wür<strong>de</strong><br />
diesen „naturentsprechen<strong>de</strong>n" Platz als <strong>de</strong>n „naturrechtlichen"<br />
Ort bezeichenen, naturrechtlich entsprechend ihrer Natur <strong>und</strong><br />
entsprechend <strong>de</strong>m soziologischen Bestand <strong>de</strong>r Gesellschaft. So<br />
ist das konkrete Naturrecht nichts Starres, son<strong>de</strong>rn ungeheuer<br />
beweglich, an<strong>de</strong>rerseits aber auch nichts durch irgendwelche<br />
politischen Willensbildungen willkürlich Bestimmbares, son<br />
<strong>de</strong>rn zu bestimmen gemäß <strong>de</strong>m objektiven Sachverhalt.<br />
Dieser objektive Sachverhalt kann allerdings auch die Wil<br />
lensbildung <strong>de</strong>r Menschen miteinschließen, aber nicht, weil<br />
etwa diese Willensbildung <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong> für die nähere Bestim<br />
mung <strong>de</strong>s Naturrechts wäre, son<strong>de</strong>rn weil die Willensbildung<br />
ein objektiver, unabän<strong>de</strong>rlicher soziologischer Sachverhalt ist.<br />
So nimmt z.B. Thomas die Willensbildung <strong>de</strong>s Tyrannen in<br />
Kauf <strong>und</strong> bestimmt danach das, was Naturrecht ist, nicht weil<br />
<strong>de</strong>r Wille <strong>de</strong>s Tyrannen das Naturrecht festlegen wür<strong>de</strong>, son<br />
<strong>de</strong>rn weil dieser Wille in seiner Unabän<strong>de</strong>rlichkeit einen sozio<br />
logischen Bef<strong>und</strong> darstellt, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Sachanalyse ins Gewicht<br />
fällt. Darum kann sich Thomas die Erlaubtheit <strong>de</strong>s Tyrannen<br />
mor<strong>de</strong>s nicht vorstellen, wenn sich daraus eine größere soziale<br />
Unordnung ergeben wür<strong>de</strong>, als sie schon besteht. Es wird also<br />
nicht irgen<strong>de</strong>in politisches Ziel (etwa gar <strong>de</strong>r Wille <strong>de</strong>s Tyran<br />
nen) zum Bestimmungsgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Naturrechts gemacht, son<br />
<strong>de</strong>rn einzig die objektive Sachanalyse in Hinordnung auf die<br />
ewigen Normen <strong>de</strong>r menschlichen Natur.<br />
237
[3] Wie das menschliche <strong>Recht</strong> viele Dinge enthält, die an<br />
sich schon von Natur <strong>Recht</strong> sind, so ist auch im göttlichen <strong>Recht</strong><br />
vieles enthalten, was nicht vom göttlichen Willen her die innere<br />
Bestimmung empfängt, son<strong>de</strong>rn bereits „an sich" gut <strong>und</strong><br />
gerecht ist. Mit dieser Feststellung will <strong>de</strong>r hl. Thomas keines<br />
wegs die rationalistische Auffassung von Hugo Grotius vertre<br />
ten, nach <strong>de</strong>r es ein Naturrecht gäbe, das besteht, auch wenn es<br />
Gott nicht gäbe. Nach Thomas wird das Naturrecht von Gott<br />
nicht frei erf<strong>und</strong>en. Es ist vielmehr wie die Wesenheiten <strong>de</strong>r<br />
Dinge im Wesen Gottes selbst begrün<strong>de</strong>t. In<strong>de</strong>m Gott, vor Sei<br />
nem Wollen <strong>und</strong> Lieben, Sein eigenes Wesen erkennt, erkennt<br />
Er auch alle möglich seien<strong>de</strong>n Wesenheiten. Sie auszuwählen ist<br />
selbstre<strong>de</strong>nd Seinem freien Entscheid anheimgestellt. Aber ihre<br />
innere Formung haben sie bereits vor <strong>de</strong>m Wollen Gottes, nicht<br />
aber — wie <strong>de</strong>r Ausspruch von Grotius es nahelegt — vor Gott.<br />
Im göttlichen Wesen <strong>und</strong> im göttlichen Selbsterkennen liegt im<br />
tiefsten die Rationalität <strong>de</strong>s Naturrechts begrün<strong>de</strong>t. Sie ist also<br />
niemals eine Rationalität außerhalb Gottes. Wenngleich Gott<br />
die Welt schaffen, d.h. ins Dasein rufen mußte, damit das<br />
Naturrecht überhaupt da sei, so ist doch nicht <strong>de</strong>r Schöpferwille<br />
Gottes die Ursache <strong>de</strong>s Naturrechts. Es ist vielmehr seine prak<br />
tische Erkenntnis, welche allen Wesenheiten die ihnen eigene<br />
Finalität vorschreibt <strong>und</strong> so zu ihrem Gesetzgeber wird. Die<br />
thomasische Naturrechtsauffassung bleibt also auch hier, wo sie<br />
in die göttliche Begründung hineinsteigt, voll <strong>und</strong> ganz auf <strong>de</strong>n<br />
Bahnen <strong>de</strong>s rechtslogischen Prozesses. Gott wird nicht einge<br />
führt als irgen<strong>de</strong>in allmächtiges Wesen, son<strong>de</strong>rn als <strong>de</strong>r ewige<br />
Gesetzgeber. Wenn es nur <strong>de</strong>r Wille Gottes wäre, welcher das<br />
Naturrecht begrün<strong>de</strong>t, dann allerdings könnte nur <strong>de</strong>r religiöse<br />
Glaube die Erkenntnis <strong>de</strong>s Naturrechts vermitteln. Und dann<br />
könnte man es begreifen, wenn ein Nicht-Gläubiger, wie z. B.<br />
Kelsen, erklärt, daß das Naturrecht eine primitive Auffassung<br />
von <strong>Recht</strong> sei, da rechtsfrem<strong>de</strong> Kategorien eingeführt wür<strong>de</strong>n.<br />
Selbstre<strong>de</strong>nd kann Gott, wie <strong>de</strong>r hl. Thomas hier ausdrücklich<br />
erklärt, durch Seinen freien Entscheid <strong>Recht</strong> schaffen. Er kann<br />
aber auf diese Weise nicht Autorrecht schaffen, weil das Natur<br />
recht in sich inhaltlich bestimmt ist, ehe <strong>de</strong>r Schöpferwille die<br />
Welt schafft. Während <strong>de</strong>r Mensch <strong>de</strong>m Schöpferwillen Ehr<br />
furcht <strong>und</strong> Furcht entgegenbringt, bringt er Gott als <strong>de</strong>m ewi<br />
gen Gesetzgeber Gehorsam entgegen. Es ist darum falsch,<br />
wenn Kelsen meint, daß die Naturrechtsauffassung nichts<br />
238
an<strong>de</strong>res sei als die Äußerung einer primitiven Furcht vor einem<br />
überweltlichen Wesen, das Blitz <strong>und</strong> Donner zu schicken<br />
imstan<strong>de</strong> ist.<br />
[4] Unter <strong>de</strong>m jus gentium, das wir hier mit „Völkerrecht"<br />
übersetzen, ist nicht das mo<strong>de</strong>rne Völkerrecht zu verstehen.<br />
Wie im Kommentar dargelegt wird, be<strong>de</strong>utet dieser Ausdruck<br />
„das bei allen Völkern gelten<strong>de</strong> <strong>Recht</strong>", ein <strong>Recht</strong>, das als<br />
ursprüngliches Gewohnheitsrecht zum positiven römischen<br />
<strong>Recht</strong> erhoben wur<strong>de</strong>. Der Inhalt dieses bei allen Völkern gel<br />
ten<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>s bestand durchwegs aus Sachverhalten, die sich<br />
aus <strong>de</strong>r naturgemäß <strong>de</strong>nken<strong>de</strong>n Vernunft ergaben, also in <strong>de</strong>r<br />
thomasischen Sicht als Naturrecht zu gelten hatten. Für Tho<br />
mas bestand nun das spekulativ schwere <strong>und</strong> historisch überaus<br />
wichtige Problem, dieses jus gentium entsprechend einzuord<br />
nen. Vgl. hierzu <strong>de</strong>n Kommentar.<br />
Lei<strong>de</strong>r konnte in <strong>de</strong>r Ubersetzung nicht die sinngemäßere<br />
Formulierung „das bei allen Völkern gelten<strong>de</strong> <strong>Recht</strong>" gebraucht<br />
wer<strong>de</strong>n, weil sich sonst Tautologien ergeben hätten.<br />
[5] Während die Güter aus sich keine Zueignung an private<br />
Personen haben, so erklärt Thomas hier, wer<strong>de</strong>n sie doch klu<br />
gerweise im Hinblick auf die konkrete Befindlichkeit <strong>de</strong>r Men<br />
schen von <strong>de</strong>n einzelnen in verschie<strong>de</strong>ner <strong>und</strong> verteilter Weise<br />
verwaltet, um so eine bessere Verwendung, d. h. eine größere<br />
Produktivität zu erzielen. Es ist dies die Begründung <strong>de</strong>s Privat<br />
eigentums, von <strong>de</strong>r Thomas in 66,2 eingehen<strong>de</strong>r sprechen wird<br />
(vgl. <strong>de</strong>n Kommentar dazu). Es ist nun eigentümlich, daß dort<br />
nicht auf Aristoteles zurückgegriffen wird, während hier die<br />
eigentliche Quelle <strong>de</strong>r Befürwortung <strong>de</strong>s Privateigentums ange<br />
geben wird. Es ist daher hier <strong>de</strong>r Ort, um näher auf die Bezie<br />
hung <strong>de</strong>r thomasischen Eigentumslehre zu Aristoteles einzuge<br />
hen.<br />
Aristoteles (Pol. 2,5) hat sich schon sehr präzis die Frage<br />
gestellt, „ob es besser ist, daß Besitzungen <strong>und</strong> N<strong>utz</strong>nießungen<br />
gemeinsam sind, nämlich entwe<strong>de</strong>r so, daß die Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Privateigentum bleiben, die Erträgnisse aber als Gemeingut zu<br />
sammengetan <strong>und</strong> verbraucht wer<strong>de</strong>n — wie dies einige Völker<br />
stämme tun —, o<strong>de</strong>r umgekehrt so, daß das Land gemeinsam ist<br />
<strong>und</strong> seine Bestellung gemeinsam geschieht, dagegen die Erträg<br />
nisse zum Privatverbrauch verteilt wer<strong>de</strong>n — auch diese Art<br />
239
von Gemeinschaft soll sich bei einigen Barbarenvölkern fin<strong>de</strong>n<br />
—, o<strong>de</strong>r endlich so, daß Gr<strong>und</strong>stücke so gut wie Erträgnisse<br />
Gemeingut sind".<br />
Aristoteles setzt sich mit <strong>de</strong>m von Plato befürworteten Kom<br />
munismus auseinan<strong>de</strong>r. Er meint zwar, daß trotz <strong>de</strong>r privaten<br />
Aufteilung eine gewisse Gemeinsamkeit im Gebrauch <strong>und</strong> in<br />
<strong>de</strong>r Ben<strong>utz</strong>ung <strong>de</strong>r Güter das Gemeinschaftsgefühl steigern<br />
wür<strong>de</strong>. Er verweist dabei auch auf die Verwirklichung einer<br />
gewissen Gütergemeinschaft in Lazedämon (vgl. <strong>de</strong>n Text im<br />
Kommentar zu 66,2). Er fin<strong>de</strong>t aber doch, daß Plato sehr über<br />
trieben hat. Außer<strong>de</strong>m meint er, daß die Befürwortung <strong>de</strong>s<br />
Kommunismus bei Plato doch nur bei reichlich allgemeinen<br />
Angaben stehengeblieben sei. Wenn man <strong>de</strong>r Sache einmal auf<br />
<strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong> gehe, dann sei nicht abzusehen, wie im einzelnen die<br />
Durchführung gedacht sei. „Man darf aber auch nicht überse<br />
hen, daß die lange Zeit <strong>und</strong> die vielen Jahre be<strong>de</strong>nklich machen<br />
müssen, in <strong>de</strong>nen es nicht verborgen geblieben wäre, wenn<br />
solche Einrichtungen wirklich etwas für sich hätten. Denn man<br />
ist schon so ziemlich auf alles verfallen, aber manches hat man<br />
nicht gesammelt, <strong>und</strong> manches war zwar gesammelt <strong>und</strong><br />
bekannt, aber es wird doch nicht eingeführt. Die Sache wür<strong>de</strong><br />
aber am klarsten wer<strong>de</strong>n, wenn man eine solche Verfassung ein<br />
mal tatsächlich durchgeführt sähe. Denn man wür<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r<br />
Einrichtung <strong>de</strong>s Staates nicht zurechtkommen ohne Teilung<br />
<strong>und</strong> Son<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r gemeinsamen Güter, einmal unter Tischge<br />
nossenschaften <strong>und</strong> dann unter Geschlechterverbän<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
Stämmen, so daß bei dieser Gesetzgebung keine an<strong>de</strong>re beson<br />
<strong>de</strong>re Bestimmung sich ergäbe als die, daß die Wächter <strong>de</strong>s Staa<br />
tes keinen Ackerbau treiben sollen, was ja auch die Lazedämo-<br />
nier schon jetzt bei sich einführen wollen". Aristoteles ist also<br />
gegenüber Plato sehr skeptisch. Er nimmt <strong>de</strong>n Menschen, wie er<br />
nun einmal ist, <strong>und</strong> meint, daß das Zusammenleben <strong>und</strong> die<br />
Gemeinschaft in allen menschlichen Dingen schwer sei, beson<br />
<strong>de</strong>rs aber hinsichtlich <strong>de</strong>r materiellen Güter. „Man sieht das an<br />
<strong>de</strong>n Gesellschaften <strong>de</strong>r Reisegefährten, wo fast die meisten über<br />
Kleinigkeiten <strong>und</strong> das erste beste, was ihnen in <strong>de</strong>n Weg<br />
kommt, sich entzweien <strong>und</strong> aneinan<strong>de</strong>rgeraten." Aristoteles<br />
schätzt auch das ganz eigene Gefühl, das <strong>de</strong>r Mensch empfin<br />
<strong>de</strong>t, wenn er etwas als sein eigen bezeichnen kann: „Es ist auch<br />
mit Worten nicht zu sagen, welche eigenartige Befriedigung es<br />
gewährt, wenn man etwas sein eigen nennen kann. Sicherlich<br />
240
nicht umsonst hat je<strong>de</strong>r die Liebe zu sich selbst, son<strong>de</strong>rn es ist<br />
uns von <strong>de</strong>r Natur so eingepflanzt, <strong>und</strong> nur die egoistische Liebe<br />
erfährt <strong>de</strong>n gerechten Ta<strong>de</strong>l; sie ist aber auch nicht dasselbe wie<br />
die Selbstliebe, son<strong>de</strong>rn ist die übertriebene Liebe zu sich<br />
selbst, wie man auch <strong>de</strong>n Habsüchtigen ta<strong>de</strong>lt, obgleich doch im<br />
einzelnen je<strong>de</strong>r an seiner Habe Freu<strong>de</strong> hat." Nur in einer gesell<br />
schaftlichen Ordnung, in welcher das Privateigentum ordnen<br />
<strong>de</strong>s Prinzip ist, kann auch, so meint Aristoteles, die Tugend <strong>de</strong>r<br />
Freigebigkeit <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gastfre<strong>und</strong>schaft geübt wer<strong>de</strong>n: „Aber<br />
auch das bereitet hohe Lust, <strong>de</strong>n Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Gästen o<strong>de</strong>r<br />
Gefährten Gunst <strong>und</strong> Hilfe zu erweisen, was nur geschehen<br />
kann, wenn es ein Eigentum gibt." Darum bleibt Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
<strong>de</strong>r gesellschaftlichen Ordnung für Aristoteles das Privateigen<br />
tum.<br />
Allerdings solle zugleich <strong>de</strong>r Eigentümer aus sittlicher Ver<br />
antwortung, d. h. „um <strong>de</strong>r Tugend willen", gerne von seinem<br />
Eigentum an an<strong>de</strong>re abgeben <strong>und</strong> vor allem die Ben<strong>utz</strong>ung <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>n Gebrauch seiner Güter als etwas Gemeinsames betrachten:<br />
„Fre<strong>und</strong>en ist alles gemein." Und Aristoteles meint sogar, daß<br />
die Gesetzgeber eine solche Gesinnung in <strong>de</strong>n Bürgern wachru<br />
fen sollten.<br />
Den Einwand, daß mit <strong>de</strong>r Teilung in Privateigentum die<br />
<strong>Recht</strong>shän<strong>de</strong>l sich mehren <strong>und</strong> Unfrie<strong>de</strong> entstän<strong>de</strong>, erledigt<br />
Aristoteles mit <strong>de</strong>r Bemerkung, daß solche Hän<strong>de</strong>l nicht von <strong>de</strong>r<br />
fehlen<strong>de</strong>n Gütergemeinschaft, son<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Schlechtheit herrühren, „da ja doch erfahrungsgemäß solche,<br />
die etwas gemeinsam haben <strong>und</strong> n<strong>utz</strong>en, viel mehr Streit mit<br />
einan<strong>de</strong>r bekommen als die Inhaber von Privateigentum".<br />
Thomas hat nun diese aristotelische Lehre in ihren Einzelhei<br />
ten übernommen, ohne allerdings sich ihr ganz zu ergeben. Er<br />
nimmt die allgemeine menschliche Schwäche, wie sie nun ein<br />
mal besteht, zur Kenntnis als einen soziologischen Bef<strong>und</strong>, um<br />
danach die soziale Ordnung einzurichten. Das Argument man<br />
cher Kirchenväter (vgl. Kommentar zu 66,2), daß die Aneig<br />
nung privaten Gutes eigentlich einem egoistischen Triebe folge<br />
<strong>und</strong> somit gr<strong>und</strong>sätzlich ein moralisches Übel sei, <strong>de</strong>m man zu<br />
Leibe rücken müsse, wird abgeschwächt zugunsten eines Be<br />
griffs von Selbstliebe, <strong>de</strong>r je<strong>de</strong> egoistische Note fehlt, im Hin<br />
blick darauf, daß das Eigenwohl leichter gesucht wird als das<br />
Gemeinwohl. Thomas konnte hierfür aus <strong>de</strong>r Theologie <strong>de</strong>r<br />
Erbsün<strong>de</strong>, <strong>de</strong>ren physische <strong>und</strong> moralische Folgen nun einmal<br />
241
nicht aus <strong>de</strong>r Welt zu schaffen sind, eine noch tiefere Begrün<br />
dung für die Befürwortung <strong>de</strong>r privaten Ordnung schöpfen.<br />
Thomas hat von Aristoteles gelernt, die Selbstliebe, die zunächst<br />
das eigene Individuum betrachtet <strong>und</strong> erst in <strong>de</strong>r Folge das<br />
Gemeinwohl, als einen ganz natürlichen Bef<strong>und</strong> einzuschätzen.<br />
Mit Aristoteles betont dann Thomas die gemeinsame Nut<br />
zung <strong>de</strong>r Güter. Mit ihm unterstreicht er ebenfalls die sittliche<br />
Gestalt <strong>de</strong>r Verpflichtung, welche je<strong>de</strong>m Besitzer in dieser Hin<br />
sicht obliegt. Hier greift er allerdings zu schärferen Formulie<br />
rungen als etwa Aristoteles, in<strong>de</strong>m er erklärt, daß <strong>de</strong>r Uberfluß<br />
<strong>de</strong>n Armen vom Naturrecht her geschul<strong>de</strong>t sei (66,7). Damit<br />
spricht nun eigentlich <strong>de</strong>r Theologe in Thomas, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n<br />
Vätern <strong>de</strong>n negativen Kommunismus (vgl. Kommentar zu<br />
66,2) kennen <strong>und</strong> schätzen gelernt hat <strong>und</strong> mit ihnen für <strong>de</strong>n<br />
ethischen Kommunismus <strong>de</strong>s Paradiesesmenschen eintritt (vgl.<br />
hierzu Anm. [34]).<br />
So bringt die Übernahme <strong>de</strong>s negativen Kommunismus, wie<br />
die Väter ihn lehrten, in die aristotelisch-thomasische Eigen<br />
tumslehre eine ganz neue Note, <strong>de</strong>rgestalt, daß die aristote<br />
lische Sicht im Gr<strong>und</strong>e doch verlassen ist, wenngleich die ein<br />
zelnen Elemente noch <strong>de</strong>utlich erkennbar bleiben. In<strong>de</strong>m näm<br />
lich Thomas mit <strong>de</strong>n Vätern dafür einsteht, daß die Güter aus<br />
sich nieman<strong>de</strong>m gehören <strong>und</strong> daß auch die menschliche Natur<br />
als solche eine Aufteilung nicht for<strong>de</strong>rt, wird <strong>de</strong>r aristotelische<br />
Gedanke, daß das Privateigentum <strong>de</strong>r „Natur" <strong>de</strong>s Menschen<br />
entspräche, zurückgestellt. Das — im Zustand <strong>de</strong>r Erbsün<strong>de</strong> lei<br />
<strong>de</strong>r nicht durchführbare — I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>r Natur bleibt für Thomas<br />
eben doch <strong>de</strong>r freie Kommunismus. Zwar hat auch Aristoteles<br />
um <strong>de</strong>s Guten <strong>de</strong>r Tugend willen die Gemeinsamkeit <strong>de</strong>r Güter<br />
gepriesen. Thomas kommt aber zu diesem Gedanken aus einer<br />
ganz an<strong>de</strong>ren Richtung, nicht etwa nur wegen irgendwelcher<br />
Übung sittlicher Tugen<strong>de</strong>n wie <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong>schaft o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Frei<br />
gebigkeit, son<strong>de</strong>rn aus <strong>de</strong>r Überlegung, daß <strong>de</strong>r innere Sinn <strong>de</strong>r<br />
Güter niemals auf diesen o<strong>de</strong>r jenen Menschen abzielen kann,<br />
son<strong>de</strong>rn nur auf <strong>de</strong>n Menschen überhaupt. Er kommt daher zur<br />
Formulierung, daß es nach <strong>de</strong>m „Naturrecht" keine Unter<br />
scheidung im Besitz gäbe (66,2 Zu 1). Und da für Thomas, <strong>de</strong>n<br />
Theologen, die innere Zweckbestimmung <strong>de</strong>r Güter einer ewi<br />
gen Absicht Gottes entspricht, lastet in seiner Lehre die soziale<br />
Verpflichtung auf <strong>de</strong>m Menschen zugleich als eine religiöse Ver<br />
antwortung. So hat es Thomas verstan<strong>de</strong>n, Aristoteles auf-<br />
242
zunehmen <strong>und</strong> im Sinne <strong>de</strong>s christlichen Denkens weiterzufüh<br />
ren.<br />
[6] Dasjenige, was durch die menschliche Vernunft erschlos<br />
sen wird, zählt nach Thomas zu <strong>de</strong>n naturgegebenen Sachver<br />
halten. Nimmt man nun die Lehre <strong>de</strong>s zweiten Artikels hinzu,<br />
dann muß man sagen, daß das durch die Vernunft Erschlossene<br />
zum Naturrecht gehört. Thomas aber kann hier, wo es um die<br />
Erklärung <strong>de</strong>s Begriffs <strong>de</strong>s „jus gentium" geht, diese Formulie<br />
rung nicht anwen<strong>de</strong>n, weil es ja nun gera<strong>de</strong> darauf ankommt,<br />
jenes Eigentümliche herauszuheben, das gemäß <strong>de</strong>r Tradition<br />
im jus gentium enthalten ist, nämlich ein <strong>Recht</strong> zu sein, das bei<br />
allen Menschen „im Gebrauch" ist. Da <strong>de</strong>m jus gentium <strong>de</strong>r<br />
stoische Naturrechtsbegriff gegenübersteht, wonach Natur<br />
recht alles das ist, was unmittelbar im animalischen Trieb <strong>de</strong>s<br />
Menschen beschlossen ist, kann Thomas nicht sagen, das jus<br />
gentium sei Naturrecht. Denn das stoische Naturrecht ist da,<br />
bevor die Menschen <strong>de</strong>nken, es ist also nicht erst <strong>de</strong>swegen<br />
<strong>Recht</strong>, weil die Menschen irgendwie im vernünftigen Verkehr es<br />
gestalten, also „gebrauchen". Die vernünftige <strong>Recht</strong>sgestaltung<br />
<strong>de</strong>s Menschen ist aber ebenfalls als etwas Natürliches für <strong>de</strong>n<br />
Menschen zu bezeichnen. Und sofern diese Vernunft auf einer<br />
objektiven Sachanalyse beruht, ist dieses <strong>Recht</strong> Naturrecht.<br />
Das jus gentium ist aber kein an<strong>de</strong>res als das vernünftige, auf<br />
objektiver Sachanalyse beruhen<strong>de</strong> <strong>Recht</strong>, darum Naturrecht.<br />
[7] Die Ehe be<strong>de</strong>utet zwar eine Liebesgemeinschaft <strong>und</strong><br />
insofern begrün<strong>de</strong>t sie eine Gemeinschaft, die über die <strong>Recht</strong>s<br />
ordnung herausragt. An<strong>de</strong>rerseits baut dieses gemeinschaft<br />
liche Leben auf einem gegenseitigen Vertrag auf. Und zwar<br />
bestimmt dieser Vertrag das Wesen <strong>de</strong>r Ehe. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong>e bewahrheitet sich hier die Bewandtnis <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s aus<br />
geprägter als etwa im Verhältnis vom Vater zum Sohn.<br />
[8] Aus diesem Gr<strong>und</strong>e sprechen wir auch vom Menschen<br />
recht <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s gegenüber <strong>de</strong>n Eltern. Das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s<br />
auf eine angemessene Erziehung ist darum nicht nur ein <strong>Recht</strong>,<br />
das sich an die Gesellschaft o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Staat, son<strong>de</strong>rn in erster<br />
Linie an die Eltern richtet. Der Staat hat darum in subsidiärer<br />
Dienstleistung zunächst Maßnahmen zu ergreifen, daß von Sei<br />
ten <strong>de</strong>r Eltern die Pflicht <strong>de</strong>r Erziehung erfüllt wer<strong>de</strong>n kann. Die<br />
243
Eltern ihrerseits haben wie<strong>de</strong>rum mit ihrer Pflicht gegenüber<br />
<strong>de</strong>m Kin<strong>de</strong> zugleich auch ein <strong>Recht</strong>, die Erziehung ihres Kin<strong>de</strong>s<br />
selbst zu bestimmen. (Näheres bei A. F. Utz, Sozialethik, Teil<br />
III, Bonn 1986, 131 ff.)<br />
[9] Wie Th. Graf (De subjecto psychico gratiae et virtutum<br />
sec. doctrinam scholasticorum usque ad medium saeculum<br />
XIV. Pars prima, De subjecto virtutum cardinalium, Roma<br />
1935, 27f.) nachwies, hat Aristoteles mit größter Wahrschein<br />
lichkeit die <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht in <strong>de</strong>n Willen, son<strong>de</strong>rn in das<br />
sinnliche Strebevermögen verlegt. Daß dabei in <strong>de</strong>r aristoteli<br />
schen Definition <strong>de</strong>s Willens Erwähnung getan wird, kann diese<br />
Ansicht von Graf nicht entkräften, weil dies auch bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong><br />
ren Tugen<strong>de</strong>n geschieht. Dem thomasischen Schema <strong>de</strong>r Tugen<br />
<strong>de</strong>n lag es näher, die <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>de</strong>m Willen zuzuteilen. Im<br />
sinnlichen Strebevermögen war in <strong>de</strong>r thomasischen Vorstel<br />
lung für die <strong>Gerechtigkeit</strong> kein Raum mehr. Darum wird <strong>de</strong>r in<br />
Art. 1, Einwand 1 zitierte aristotelische Text nach <strong>de</strong>m thomasi<br />
schen Schema ausgelegt. Allerdings ergeben sich für die Erklä<br />
rung, warum <strong>de</strong>r Wille einer Tugend bedarf <strong>und</strong> nicht schon von<br />
Natur auf das Gute <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ausgerichtet sei, beson<br />
<strong>de</strong>re Schwierigkeiten. Die Frage wur<strong>de</strong> eingehend besprochen<br />
in meinem Kommentar zu I—II 56,6 (DT, Bd. 11, S. 545 ff.).<br />
[10] Der Artikel han<strong>de</strong>lt von <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit.<br />
Dabei ist <strong>de</strong>r Zugang zu diesem Objekt bei Thomas ein ganz<br />
an<strong>de</strong>rer als etwa bei uns heute. Wir wür<strong>de</strong>n das Problem formu<br />
lieren: Gibt es eine Gemeinwohlgerechtigkeit? Thomas aber<br />
kommt hier vom aristotelischen Gedankengut her (das seiner<br />
seits platonische Elemente enthält) <strong>und</strong> fragt: In welchem Sinne<br />
kann die <strong>Gerechtigkeit</strong> eine umfassen<strong>de</strong> Tugend sein? Nach<br />
platonischer Auffassung mün<strong>de</strong>te je<strong>de</strong> Tugend in die Gerechtig<br />
keit, ja im Gr<strong>und</strong>e war je<strong>de</strong> Tugend <strong>Gerechtigkeit</strong>. Nach Aristo<br />
teles ist die <strong>Gerechtigkeit</strong> die überragen<strong>de</strong>, alle Tugen<strong>de</strong>n um<br />
greifen<strong>de</strong> sittliche Haltung. Es stellt sich also für Thomas, <strong>de</strong>r<br />
bisher von <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> als einer eigenen, nämlich einer<br />
Kardinaltugend gesprochen hat, die Frage, in welchem Sinne<br />
diese nun eine allgemeine Tugend sein könne. Bei <strong>de</strong>r Untersu<br />
chung <strong>de</strong>s Begriffes „allgemein" stellt sich sodann heraus, daß<br />
man in einem doppelten Sinn von einer allgemeinen Gerechtig<br />
keit sprechen kann: 1. im Sinne von Gemeinwohlgerechtigkeit,<br />
244
die <strong>de</strong>swegen allgemein genannt wird, weil ihr eigentümlicher<br />
Gegenstand ein vielen gemeinsames Objekt ist, die aber um<br />
ihres eigenen, nur ihr zugehörigen Gegenstan<strong>de</strong>s willen zu<br />
gleich von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n klar unterschie<strong>de</strong>n ist; 2. im<br />
Sinne einer Tugend mit universalem, allgemeinem Einfluß auf<br />
das gesamte sittliche Leben. In dieser Weise ist die Gemein<br />
wohlgerechtigkeit zugleich auch „allgemein", da sie alle Tugen<br />
<strong>de</strong>n auf das Gemeinwohl ausrichtet. Die Gemeinwohlgerech<br />
tigkeit ist ihrer Kraft nach gewissermaßen in allen Tugen<strong>de</strong>n<br />
„investiert", da sie allen ihre sittliche Stärke leiht, wie ähnlich<br />
die göttliche Liebe in alle Tugen<strong>de</strong>n einfließt. Vom ersten Ge<br />
sichtspunkt spricht Thomas hier im fünften Artikel, vom zwei<br />
ten in Art. 6.<br />
[11] Die Gesetzesgerechtigkeit (= Gemeinwohlgerechtig<br />
keit) regelt mittelbar, wie Thomas hier ausführt, auch die<br />
<strong>Recht</strong>sverhältnisse zwischen <strong>de</strong>n einzelnen Menschen. Dage<br />
gen bezieht sich die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit, z.B. die Verkehrsge<br />
rechtigkeit, nur auf das Verhältnis zum einzelnen Menschen.<br />
Die Gesetzesgerechtigkeit ist darum ein umspannen<strong>de</strong>res Ord<br />
nungsprinzip als die Verkehrsgerechtigkeit. Mit an<strong>de</strong>ren Wor<br />
ten: Die Verkehrsgerechtigkeit mit ihrem Aquivalenzprinzip<br />
hat sich <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit unterzuordnen. Damit<br />
ist <strong>de</strong>m Liberalismus <strong>und</strong> Individualismus <strong>de</strong>r Kampf angesagt.<br />
Es ist <strong>de</strong>r Gedanke ausgesprochen, <strong>de</strong>n Leo XIII. in „Rerum<br />
novarum" <strong>und</strong> Pius XL in „Quadragesimo anno" unterstrichen<br />
haben, daß vom Gemeinwohl her jegliche individualrechtliche<br />
Freiheit ihre Begrenzung erhält. Wir fin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nselben Gedan<br />
ken noch schärfer in Art. 9 Zu 3 formuliert. Und es könnte dort<br />
scheinen, daß das Kollektiv über die Person gestellt wür<strong>de</strong>.<br />
Jedoch ist zu be<strong>de</strong>nken, daß das Gemeinwohl bei Thomas das<br />
gemeinsame Wohl vieler Personen ist. Dieses Gut geht über das<br />
Gut einer einzelnen Person.<br />
[12] Die Tugendmitte ist ein altes <strong>und</strong> beliebtes Thema <strong>de</strong>r<br />
Moral. Thomas hat es bereits in I—II 64 (vgl. meinen Kommen<br />
tar in DT, Bd. 11, S. 606ff.) behan<strong>de</strong>lt. Für die <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
ergibt sich hier eine beson<strong>de</strong>re Schwierigkeit, weil sie, streng<br />
genommen, keine Mitte hat, da sie nicht zwischen zwei Lastern<br />
als Extremen steht. Denn gibt man <strong>de</strong>m Nächsten wissentlich<br />
mehr, als ihm zusteht, so ist dies Liebe. Gibt man ihm weniger,<br />
245
als ihm zusteht, dann ist dies Ungerechtigkeit. Dennoch kann<br />
man, so erklärt Thomas, sagen, die <strong>Gerechtigkeit</strong> sei zwischen<br />
zwei Extremen, insofern <strong>de</strong>r Sachverhalt, nämlich das<br />
Gerechte, zwischen mehr <strong>und</strong> zu wenig liegt. Die Tugendmitte<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ist <strong>de</strong>mnach eine sachbestimmte Mitte.<br />
[13] Gemeint ist <strong>de</strong>r übernatürlich leben<strong>de</strong> Mensch, <strong>de</strong>r sein<br />
„geistliches Leben" pflegt. Die göttliche Liebe ist die Wurzel <strong>de</strong>r<br />
Gaben <strong>de</strong>s Heiligen Geistes, wie Thomas in I—II 68,5 ausführt.<br />
In beson<strong>de</strong>rer Weise wird die Weisheit als die höchste Gabe <strong>de</strong>r<br />
vornehmsten Tugend, nämlich <strong>de</strong>r Liebe, zugeteilt (vgl. Fr. 45,<br />
Art. 1 u. 2).<br />
[14] Der Ausdruck „Teile" wird hier analog gebraucht (vgl.<br />
hierzu meinen Kommentar in DT, Bd. 11, S. 519). Der Begriff<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ist ein Sammelbegriff, in <strong>de</strong>m eine Vielheit<br />
von sittlichen Haltungen <strong>und</strong> Kräften enthalten ist, die als<br />
„Teile" bezeichnet wer<strong>de</strong>n. Je nach<strong>de</strong>m nun <strong>de</strong>r Denkprozeß<br />
von <strong>de</strong>m allgemeinen Begriff <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zu <strong>de</strong>n einzel<br />
nen, dazu gehören<strong>de</strong>n Elementen fortschreitet, spricht man in<br />
verschie<strong>de</strong>ner Weise von „Teilen" <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Geht <strong>de</strong>r<br />
logische Prozeß vom Gattungsbegriff zu <strong>de</strong>n Arten, dann<br />
kommt man, wie Thomas mit Aristoteles sagt, zu <strong>de</strong>n subjekti<br />
ven Teilen. Geht er aber von <strong>de</strong>r noch unklaren zur klareren,<br />
„<strong>de</strong>taillierten" Betrachtung ein <strong>und</strong> <strong>de</strong>rselben Tugend, dann<br />
spricht Thomas von vervollständigen<strong>de</strong>n (integralen) Teilen.<br />
Wen<strong>de</strong>t sich schließlich die Betrachtung zu <strong>de</strong>n seelischen Ver<br />
haltensweisen, die wohl mit <strong>de</strong>m Allgemeinbegriff <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit in Beziehung stehen, weil sie in irgen<strong>de</strong>iner, wenn auch<br />
abgeschwächten Weise noch etwas von <strong>Gerechtigkeit</strong> besagen,<br />
die aber doch nicht im strengen Sinn <strong>Gerechtigkeit</strong> sind, dann<br />
spricht man von potentiellen Teilen <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Hierzu<br />
gehören z. B. die Gottesverehrung, die Pietät u. a. (vgl. DT,<br />
Bd. 11, a.a.O.).<br />
[15] Das lateinische Wort „justitia commutativa" kann in<br />
dreifacher Weise sinngemäß übersetzt wer<strong>de</strong>n: 1. ausgleichen<strong>de</strong><br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, 2.Verkehrsgerechtigkeit, 3.Tauschgerechtigkeit.<br />
„Ausgleichen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>" drückt das eigentliche Wesen<br />
<strong>de</strong>ssen aus, was unter <strong>de</strong>r „kommutativen <strong>Gerechtigkeit</strong>" be<br />
griffen ist, <strong>de</strong>nn das Eigene <strong>de</strong>r kommutativen <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
246
esteht in <strong>de</strong>r vollen Äquivalenz, im mathematischen Ausgleich<br />
zwischen Leistung <strong>und</strong> Gegenleistung. Diese Art <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit heißt Verkehrsgerechtigkeit, insofern dieses strenge<br />
<strong>Recht</strong>sverhältnis zwischen <strong>de</strong>n Menschen untereinan<strong>de</strong>r im<br />
gegenseitigen Verkehr von Individuum zu Individuum her<br />
gestellt wird. Sie heißt Tauschgerechtigkeit, weil dieser individu<br />
alrechtliche Verkehr in <strong>de</strong>r überwiegen<strong>de</strong>n Mehrheit sich in<br />
Form <strong>de</strong>r Tauschgeschäfte abspielt.<br />
[16] Thomas setzt hier <strong>de</strong>n strengen Begriff <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit auseinan<strong>de</strong>r, in<strong>de</strong>m er erklärt, daß bei <strong>de</strong>r Verkehrsgerech<br />
tigkeit das Äquivalenzprinzip im eigentlichen Sinne gelte, so<br />
daß die Verkehrsgerechtigkeit <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> in<br />
ausgeprägtester Weise wie<strong>de</strong>rgibt. Eine an<strong>de</strong>re Frage aber ist<br />
nun, ob dieser Begriff in solch reiner Form in <strong>de</strong>r Wirklichkeit<br />
auch vorkommt. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon<br />
ab, ob <strong>de</strong>r Mensch überhaupt als Nur-Individuum <strong>de</strong>nkbar ist<br />
o<strong>de</strong>r ob er nicht wesentlich das Verhältnis zum Nächsten <strong>und</strong><br />
zu einem Ganzen, in welchem er lebt, einschließt. Wie bereits<br />
aus Anm.[11] hervorgeht, gibt es keine Verkehrsgerechtigkeit,<br />
die von <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit unabhängig wäre. Dar<br />
aus wird klar, daß die Vorstellung <strong>de</strong>r reinen Verkehrsgesell<br />
schaft <strong>und</strong> <strong>de</strong>s sich aus ihr ergeben<strong>de</strong>n Äquivalenzprinzips eine<br />
reine Abstraktion be<strong>de</strong>utet, wie etwa in <strong>de</strong>r Wirtschaftstheorie<br />
<strong>de</strong>r sogenannte homo oeconomicus.<br />
[17] Wenngleich <strong>de</strong>r Mensch sein ganzes Tun auf das<br />
Gemeinwohl abstellen muß, kann er an<strong>de</strong>rerseits nicht erwar<br />
ten, daß er die ganze Leistung durch die austeilen<strong>de</strong> Gerechtig<br />
keit wie<strong>de</strong>rum zurückerhalte. Der Reiche zahlt mehr Steuern<br />
als <strong>de</strong>r Arme, während <strong>de</strong>r Arme mehr empfängt als <strong>de</strong>r Reiche.<br />
Man erkennt hier <strong>de</strong>utlich die Verschie<strong>de</strong>nheit in <strong>de</strong>r Bewe<br />
gung, welche <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Arten <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, Gemein<br />
wohlgerechtigkeit <strong>und</strong> austeilen<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, eigen ist:<br />
vom einzelnen zum Gemeinwohl (Gesetzesgerechtigkeit) <strong>und</strong><br />
von dort zum einzelnen (austeilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>). Diese Ver<br />
schie<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>r Bewegung, die sich in einer Verschie<strong>de</strong>nheit<br />
<strong>de</strong>r Leistung <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Empfangens ausdrückt, ist für uns heute<br />
unter <strong>de</strong>m Namen <strong>de</strong>r Sozialgerechtigkeit in einem begriffen<br />
(vgl. Exkurs II). Denn im Gr<strong>und</strong>e ist es bei<strong>de</strong> Male das Gemein<br />
wohl, welches die Verschie<strong>de</strong>nheit in <strong>de</strong>r Leistung <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Gegenleistung for<strong>de</strong>rt.<br />
247
[18] Der Traktat <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rerstattung bereitet, so einfach er<br />
in <strong>de</strong>r Theorie sein mag, in <strong>de</strong>r Praxis vielfältige Schwierigkei<br />
ten. Alphonsv. Liguori schreibt, daß er in diesem Traktat wohl<br />
kaum <strong>de</strong>m Wertempfin<strong>de</strong>n aller entsprechen könne, obwohl er<br />
sich die größte Mühe gebe, das Gerechte zu treffen. Und er<br />
übertreibt nicht, wenn er schreibt: „Manchmal habe ich zur<br />
Ermittlung eines gerechten Urteils tagelang daran gearbeitet"<br />
(Theologia Moralis, Editio Leon. Gau<strong>de</strong>, II Nr. 547). Vor allem<br />
heikel <strong>und</strong> verwickelt wird die Frage nach <strong>de</strong>r Pflicht zur Wie<br />
<strong>de</strong>rerstattung dort, wo keine Schuld vorliegt: beim gutgläubi<br />
gen Besitzer frem<strong>de</strong>n Eigentums, bei Schädigung durch Unge<br />
schicklichkeit, Versehen, bei leichter Fahrlässigkeit.<br />
[19] Thomas spricht hier von <strong>de</strong>r Pflicht zur Wie<strong>de</strong>rgutma<br />
chung in folgen<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Fällen: bei Schädigung am bereits<br />
bestehen<strong>de</strong>n Eigentum durch Diebstahl <strong>und</strong> bei Schädigung an<br />
<strong>de</strong>m zu erwarten<strong>de</strong>n Eigentumszuwachs (vgl. <strong>de</strong>n Text). Es<br />
wäre aber noch <strong>de</strong>r Fall <strong>de</strong>nkbar, daß einer einem an<strong>de</strong>rn einen<br />
Scha<strong>de</strong>n zufügt, ohne sittlich schwer o<strong>de</strong>r überhaupt verant<br />
wortlich zu sein (leichte Fahrlässigkeit o<strong>de</strong>r überhaupt völlige<br />
Schuldlosigkeit). Der Moralist kann die Verpflichtung zur Wie<br />
<strong>de</strong>rgutmachung nur im Verhältnis zur schuldhaften Handlung<br />
for<strong>de</strong>rn. Darum kann nach ihm aus einer leichten Schuld — un<br />
besehen <strong>de</strong>s dadurch entstan<strong>de</strong>nen großen Scha<strong>de</strong>ns — niemals<br />
eine schwere Verpflichtung zur Wie<strong>de</strong>rgutmachung entstehen.<br />
Aus einer völlig schuldlosen Schädigung ergibt sich überhaupt<br />
keine Restitutionspflicht. Solche schuldlose Schädigung fällt<br />
unter das Kapitel „Betriebsunfall <strong>de</strong>r Menschlichkeit". Mit sol<br />
chen Betriebsunfällen muß je<strong>de</strong>rmann ebensogut rechnen wie<br />
mit einer rein naturhaften Einwirkung wie Blitz <strong>und</strong> Hagel.<br />
Die Sachlage än<strong>de</strong>rt sich allerdings, wenn das richterliche Urteil<br />
dazwischengreift, weil dann im Hinblick auf eine allgemeine<br />
Ordnung <strong>de</strong>r einzelne um <strong>de</strong>s Gemeinwohls willen zu einem<br />
Scha<strong>de</strong>nersatz sittlich <strong>und</strong> rechtlich verpflichtet wird, wozu er<br />
sonst nicht gehalten wäre. Die diesbezüglichen Ausführungen<br />
bei Alphonsv. Liguori sind klar <strong>und</strong> tief durchdacht.<br />
[20] Es ist hier nicht nur von <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rerstattung gestohle<br />
nen Gutes die Re<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn überhaupt von <strong>de</strong>r Rückgabe jeg<br />
lichen Gutes, wie immer man es erhalten hat, selbst auch als<br />
Gut <strong>de</strong>r Aufbewahrung. Ein Gut ist, wie im Artikel dargelegt<br />
wird, <strong>de</strong>m zurückzuerstatten, von <strong>de</strong>m es rechtlich stammt.<br />
248
[21] Unter Simonie versteht man <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l mit geistlichen<br />
Dingen.<br />
[22] Im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r hier besprochenen Rück<br />
gabe steht die Frage nach <strong>de</strong>r Rückerstattung von frem<strong>de</strong>n<br />
Gütern, die man guten Glaubens übernommen hat. Es sei hier<br />
für auf die Moralbücher verwiesen. D. Prümmer (Manuale<br />
Theologiae Moralis, II, Ed. 9,Friburgi 1940, pg. 187f.) erklärt<br />
mit <strong>Recht</strong>, daß es wenige moraltheologische Traktate gäbe, in<br />
welchen die Autoren unter sich so uneins seien wie in diesem.<br />
[23] Die Scholastik unterschei<strong>de</strong>t die Gebote in for<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />
Gebote <strong>und</strong> Verbote. Das for<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r affirmative Gebot<br />
verlangt von <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r ihm unterworfen ist, eine ganz<br />
bestimmte Handlung, unter Umstän<strong>de</strong>n, sogar eventuell zu<br />
einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort (z. B. Sonntags<br />
heiligung durch Besuch <strong>de</strong>r heiligen Messe). Das Verbot unter<br />
sagt bestimmte Handlungen, verlangt also eine Unterlassung<br />
von bestimmten Akten (nicht stehlen, nicht töten.)<br />
[24] Über diese Meinung, die Thomas im Anschluß an Ari<br />
stoteles auch sonst vorträgt, vergleiche beson<strong>de</strong>rs I 118,2 Zu 2,<br />
DT, Bd. 8, S. 301 ff., ebendort in Anm. [94] S.383 die Lite<br />
ratur zu dieser Frage <strong>und</strong> im Kommentar S. 596 die heutige<br />
Auffassung.<br />
[25] Es ist wohl zu beachten, daß es sich um einen Verbre<br />
cher han<strong>de</strong>lt, <strong>de</strong>ssen To<strong>de</strong>sstrafe <strong>de</strong>m Gemeinwohl zugeordnet<br />
wird. Es wi<strong>de</strong>rspräche völlig <strong>de</strong>m Gedanken <strong>de</strong>s hl. Thomas,<br />
wollte man <strong>de</strong>n Satz dahin auslegen, daß überhaupt je<strong>de</strong><br />
Tötung, „sofern sie auf das Wohl <strong>de</strong>r ganzen Gemeinschaft hin<br />
geordnet ist", erlaubt sei.<br />
[26] Vgl. hierzu Canon 9 <strong>de</strong>s 4. Laterankonzils (1215): „Kein<br />
Kleriker darf ein To<strong>de</strong>surteil befehlen o<strong>de</strong>r fällen, auch darf er<br />
die To<strong>de</strong>sstrafe nicht ausführen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Vollstreckung beiwoh<br />
nen."<br />
[27] Thomas spricht hier von <strong>de</strong>r doppelten <strong>Recht</strong>sausrü<br />
stung eines Klerikers (Bischofs o<strong>de</strong>r Abtes): <strong>de</strong>r kirchlichen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r weltlichen. Ein Bischof konnte damals als weltlicher Fürst<br />
249
auch die Jurisdiktion in weltlichen Dingen haben. Er hätte also<br />
an sich auch die rechtliche Befugnis haben müssen, die To<strong>de</strong>s<br />
strafe zu verhängen. „Dennoch", so sagt Cajetan, <strong>de</strong>r diese<br />
Stelle im Sinne <strong>de</strong>s hl. Thomas erklärt, „war es klar, daß ein<br />
Bischof als weltlicher Herr nicht ein To<strong>de</strong>surteil fällen, Krieg<br />
führen <strong>und</strong> ähnliches vollführen kann, was er zwar könnte,<br />
wenn er nur weltlicher Herr wäre. Jedoch wird die weltliche<br />
Herrschaft durch die geistliche gemäßigt, so daß, was immer<br />
sich für <strong>de</strong>n Prälaten nicht ziemt, auch <strong>de</strong>m Herrn nicht ziemt,<br />
<strong>de</strong>r zugleich Prälat <strong>und</strong> Herr ist."<br />
[28] Der Artikel hat seine beson<strong>de</strong>re geschichtliche Be<strong>de</strong>u<br />
tung im Hinblick auf die Sekte <strong>de</strong>r Katharer. Manche „Vollkom<br />
menen" (die Vollkommenen bil<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>r Sekte),<br />
namentlich solche, die in schwerer Krankheit die sogenannte<br />
Geistestaufe empfangen hatten, suchten die Gefahr <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong><br />
<strong>und</strong> damit eine Verletzung <strong>de</strong>s Sakramentes dadurch zu ver<br />
mei<strong>de</strong>n, daß sie sich <strong>de</strong>m Hungertod (Endura) preisgaben. Vgl.<br />
Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte, 2.Teil: Das Mittelalter,<br />
1948 12 , S.212.<br />
[29] Cajetan gibt in seinem Kommentar <strong>de</strong>n Sinn <strong>de</strong>s Arti<br />
kels treffend wie<strong>de</strong>r: „Auf zweifache Weise kann die Tötung <strong>de</strong>s<br />
an<strong>de</strong>rn auf die Bewahrung <strong>de</strong>s eigenen Lebens hingeordnet<br />
sein: 1. als Mittel zum Ziel, 2. als Folge aus <strong>de</strong>r Notwendigkeit<br />
<strong>de</strong>s Zieles ... Sowohl das Ziel wie das Mittel zum Ziele fallen<br />
unter die Absicht, wie dies beim Arzt offenbar ist, <strong>de</strong>r durch<br />
einen Trunk o<strong>de</strong>r eine Diät die Ges<strong>und</strong>heit beabsichtigt. Das<br />
aber, was aus <strong>de</strong>r Notwendigkeit <strong>de</strong>s Zieles sich ergibt, fällt<br />
nicht unter die Absicht, son<strong>de</strong>rn ergibt sich als etwas Nicht-<br />
Beabsichtigtes, wie dies z.B. bezüglich <strong>de</strong>r Schwächung <strong>de</strong>s<br />
Kranken, die aus <strong>de</strong>r heilen<strong>de</strong>n Medizin folgt, offenbar ist.<br />
Gemäß diesen bei<strong>de</strong>n Arten kann je verschie<strong>de</strong>n eine Amtsper<br />
son <strong>und</strong> eine Privatperson erlaubterweise töten. Die Amtsper<br />
son ordnet wie <strong>de</strong>r Soldat die Tötung <strong>de</strong>s Fein<strong>de</strong>s als Mittel auf<br />
das <strong>de</strong>m Gemeinwohl untergeordnete Ziel hin... Die Privat<br />
person hat nicht die Absicht zu töten, um sich zu retten, son<br />
<strong>de</strong>rn beabsichtigt, sich zu retten <strong>und</strong> sich <strong>de</strong>r Selbstverteidigung<br />
nicht zu enthalten, auch wenn aus dieser sich <strong>de</strong>r Tod <strong>de</strong>s<br />
an<strong>de</strong>rn notwendigerweise ergeben wür<strong>de</strong>. Und so tötet dieser<br />
nur beiläufig, jener aber an sich."<br />
250
[30] Thomas spricht hier von <strong>de</strong>n Irregularitäten, wodurch<br />
<strong>de</strong>rjenige, welcher ihnen verfallen ist, sowohl von <strong>de</strong>m Empfang<br />
einer Weihevollmacht ausgeschlossen wie auch an <strong>de</strong>ren Aus<br />
übung gehin<strong>de</strong>rt ist. Abgesehen von gewissen schuldhaften<br />
Handlungen, auf welche eine Irregularität folgt, anerkennt das<br />
kanonische <strong>Recht</strong> auch Irregularitäten auf Gr<strong>und</strong> irgendwel<br />
cher äußerer, <strong>de</strong>m Stand <strong>de</strong>s Klerikers wi<strong>de</strong>rsprechen<strong>de</strong>r<br />
Unziemlichkeiten. Unter diese gehörte zu Thomas' Zeiten<br />
auch die unfreiwillige Tötung in <strong>de</strong>r Selbstverteidigung. Heute<br />
jedoch nicht mehr, ebenso wenig <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re von Thomas<br />
erwähnte Fall.<br />
[31] Unzucht <strong>und</strong> Ehebruch sind an sich schlecht, können<br />
also niemals auf ein gutes Ziel hingeordnet wer<strong>de</strong>n. Dagegen ist<br />
die Tötung eines Menschen in sich nicht schlecht; <strong>de</strong>nn sie<br />
geschieht auch auf gerechte Weise, wie z. B. in <strong>de</strong>r Vollstrek-<br />
kung eines gerechten To<strong>de</strong>surteils.<br />
[32] /. Le Foyer (Expose du droit penal normand au XIIP<br />
siecle, Paris 1931,53) berichtet von einer Bestimmung <strong>de</strong>s nor<br />
mannischen <strong>Recht</strong>s <strong>de</strong>s 13. Jahrh<strong>und</strong>erts, wonach <strong>de</strong>rjenige,<br />
<strong>de</strong>r einen an<strong>de</strong>rn durch Zufall getötet hat, zwar keiner Strafe<br />
unterliegt, jedoch die von <strong>de</strong>r Kirche verhängte Buße überneh<br />
men muß.<br />
[33] Der Einwand ist in seinem logischen Aufbau ziemlich<br />
verwickelt. Es han<strong>de</strong>lt sich in diesem Artikel um die Beleidigun<br />
gen, die man jeman<strong>de</strong>m zufügt, <strong>de</strong>r mit einer an<strong>de</strong>rn Person<br />
(Hauptperson) als verwandt angenommen wird. Z.B. sei <strong>de</strong>r<br />
Ehemann die in Frage stehen<strong>de</strong> Hauptperson. Wer nun die Ehe<br />
frau beleidigt, beleidigt zugleich <strong>de</strong>n Mann. Nun ist aber die<br />
Frau, wenn sie freiwillig mit einem frem<strong>de</strong>n Manne Unzucht<br />
treibt, selbst nicht beleidigt (<strong>de</strong>nn gemäß 59,3 ist niemand<br />
Opfer einer Beleidigung, wenn er mit <strong>de</strong>r Handlung <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn<br />
einverstan<strong>de</strong>n ist). Also, so scheint es, kann auch <strong>de</strong>r Mann<br />
nicht beleidigt sein, weil <strong>de</strong>r Mann als verwandte Hauptperson<br />
nur beleidigt wird, sofern seine Verwandte, d. h. in diesem Falle<br />
die Ehefrau, wirklich beleidigt ist.<br />
[34] Der Ausdruck „Besitz" darf nicht etwa schon im Sinne<br />
von Privateigentum aufgefaßt wer<strong>de</strong>n. Im Vergleich zu <strong>de</strong>n Be-<br />
251
griffenproprietas (Eigentum) <strong>und</strong> dominium (Herrschaft) ist <strong>de</strong>r<br />
Begriff possessio (Besitz) <strong>de</strong>r allgemeinste bei Thomas (vgl.<br />
hierzu: C. Spicq, Notes <strong>de</strong> lexicographie philosophique medie-<br />
vale: „Dominium, possessio, proprietas" chez S.Thomas et<br />
chez les juristes romains, RSPTh 18, 1929, 269-281; <strong>de</strong>rs., La<br />
notion analogique <strong>de</strong> „Dominium" et le droit <strong>de</strong> propriete,<br />
RSPTh 20,1931,52-76). Wenn also Thomas hier erklärt, daß es<br />
<strong>de</strong>m Menschen natürlich sei, die äußeren Güter zu besitzen,<br />
dann hat dies noch nichts mit einer Verteidigung <strong>de</strong>s Naturrech<br />
tes auf Privateigentum zu tun. Der Artikel ist keineswegs ari<br />
stotelisch (vgl. Anm. [5]). Er hält sich voll <strong>und</strong> ganz in <strong>de</strong>r Linie<br />
<strong>de</strong>r Väter. Eine aristotelische Auslegung allerdings müßte aus<br />
diesem Artikel herauslesen, <strong>de</strong>r Einzelmensch habe eine natür<br />
liche Veranlagung, die Dinge für sich selbst zu besitzen, ent<br />
sprechend <strong>de</strong>m aristotelischen Gedanken, daß <strong>de</strong>r Mensch von<br />
Natur (!) zunächst auf das eigene Wohl <strong>und</strong> dann erst auf das<br />
Gemeinwohl abziele. Doch kann hiervon in unserem Artikel<br />
keine Re<strong>de</strong> sein, wenngleich Thomas <strong>de</strong>n Philosophen Aristote<br />
les als Gewährsmann heranzieht. Thomas bleibt hier <strong>de</strong>m alt<br />
christlichen Gedankengut treu, daß Gott die Welt für <strong>de</strong>n Men<br />
schen geschaffen habe, damit <strong>de</strong>r Mensch, nicht irgen<strong>de</strong>in ein<br />
zelner, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Mensch überhaupt, sie zu Seiner Ehre<br />
„benütze", d. h. über die Dinge herrsche, sie sich zu eigen mache,<br />
soweit die Dinge überhaupt <strong>de</strong>m Menschen gehorchen können.<br />
Es ist also auch nicht, wie man es gemeint hat, davon die Re<strong>de</strong>,<br />
daß <strong>de</strong>r Einzelmensch nur ein N<strong>utz</strong>recht habe. Denn sobald man<br />
<strong>de</strong>n Einzelmenschen einführt, steigt man ins Private hinab.<br />
Thomas will aber hier nicht vom Individuellen <strong>und</strong> Privaten<br />
re<strong>de</strong>n. Der Einzelne wird gegen <strong>de</strong>n Einzelnen nicht abgeho<br />
ben. Es ist nur die Re<strong>de</strong> vom Menschen als solchem. Dieser<br />
Mensch ist eine abstrakte, i<strong>de</strong>elle Größe, die zwar potentiell die<br />
einzelnen in sich birgt, aber nicht ausspricht. Es ist daher meta<br />
physisch unmöglich, daß im ersten Artikel von Privateigentum<br />
gesprochen wer<strong>de</strong>. Aus <strong>de</strong>mselben Gr<strong>und</strong> ist es aber auch aus<br />
geschlossen, daß irgendwie ein Kollektiv gemeint sei; <strong>de</strong>nn die<br />
Vorstellung <strong>de</strong>s Kollektivs schließt bereits <strong>de</strong>n ausdrücklichen<br />
Gedanken an die vielen in sich, die als viele eins sein sollen. Der<br />
Universalbegriff „Mensch" ist kein Kollektivbegriff, er ist eine<br />
Einheit, die potentiell viele einschließt. In diesem Zusammen<br />
hang ist es zu begreifen, daß Thomas, <strong>de</strong>r die ganze Ethik <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt <strong>de</strong>r universalen natura<br />
252
humana sieht, nicht sagen konnte, das „Privateigentum" sei<br />
„naturrechtlich" im Sinne <strong>de</strong>r natura humana. In <strong>de</strong>r natura<br />
humana gibt es eben noch kein „privat", wie ebensowenig ein<br />
„kollektiv".<br />
Dieses nach <strong>de</strong>m Privaten <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Kommunistischen (Kol<br />
lektiven) hin noch Indifferentsein <strong>de</strong>r materiellen Güter<br />
bezeichnet man als negativen Kommunismus.<br />
Von hier aus ergeben sich nun zunächst zwei Möglichkeiten<br />
<strong>de</strong>s Abstiegs ins Individuelle:<br />
X.Privateigentum, 2.Gütergemeinschaft (Kollektivbesitz),<br />
d. h. positiver Kommunismus, <strong>de</strong>r natürlich verschie<strong>de</strong>n stark<br />
ausgeprägt sein kann (bezüglich <strong>de</strong>r Produktionsgüter <strong>und</strong><br />
Konsumgüter). Der positive Kommunismus aber ist wie<strong>de</strong>rum<br />
doppelt möglich: a) als ethischer Kommunismus, insofern alle<br />
Einzelglie<strong>de</strong>r aus innerer Freiheit <strong>und</strong> I<strong>de</strong>alismus alles ins<br />
Gemeinwohl tragen (in diesem Sinne sprachen die Kirchenväter<br />
im allgemeinen von <strong>de</strong>r Gütergemeinschaft <strong>de</strong>s Paradiesesmen<br />
schen <strong>und</strong> sprachen sich manche Väter für das I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s Kom<br />
munismus auch nach <strong>de</strong>m Sün<strong>de</strong>nfalle aus); b) als rechtlicher<br />
Zwangskommunismus. Thomas nimmt nun erst hier, wo es<br />
darum geht, vom negativen Kommunismus aus sich für eine <strong>de</strong>r<br />
potentiell <strong>de</strong>nkbaren Formen <strong>de</strong>r konkreten Verwirklichung<br />
<strong>de</strong>r Eigentumsordnung zu entschei<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n aristotelischen<br />
Gedanken auf. Das Privateigentum wird darum bei ihm erst<br />
zum Naturrecht in <strong>de</strong>r konkreten Situation <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Natur, nicht schon in <strong>de</strong>r natura humana als solcher (vgl. <strong>de</strong>n<br />
Kommentar).<br />
[35] Die Stelle stammt aus Cicero, <strong>de</strong>r sie seinerseits Chrysipp<br />
entleiht (vgl. Kommentar).<br />
[36] Thomas zitiert diesen Augustinustext wohl im Hinblick<br />
auf die damals die Kirche stark beunruhigen<strong>de</strong>n Apostoliker<br />
o<strong>de</strong>r Apostelbrü<strong>de</strong>r, die auf Gerard Segarelli von Parma zurück<br />
gehen. Dieser versuchte, von <strong>de</strong>n Franziskanern abgewiesen,<br />
seit 1260 in eigener Institution <strong>und</strong> unabhängig von <strong>de</strong>r kirchli<br />
chen Obrigkeit mit Gleichgesinnten das apostolische Leben in<br />
Armut <strong>und</strong> Wan<strong>de</strong>rpredigt zu erneuern. Honorius IV. (1286)<br />
<strong>und</strong> Nikolaus IV (1290) haben gegen die Bru<strong>de</strong>rschaft dieser<br />
„Pseudoapostel" scharfe Verbote erlassen. Gerard Segarelli<br />
wur<strong>de</strong> 1294 von <strong>de</strong>r Inquisition zu dauern<strong>de</strong>m Kerker verurteilt<br />
253
<strong>und</strong> 1300 als „rückfälliger Häretiker" verbrannt. Vgl. Bihlmeyer-<br />
Tüchle, a. a. 0.309.<br />
[37] Daß das Privateigentum durch eine „Ausweitung", d. h.<br />
einen logischen Denkprozeß zum allgemeinen Naturrecht<br />
erschlossen wird, läßt sich leicht begreifen, wenn man sich an<br />
das in Anm. [34] Gesagte erinnert, daß nämlich im allgemeinen<br />
Naturrecht (d. h. in jenem <strong>Recht</strong>, das in <strong>de</strong>r allgemeinen natura<br />
humana unmittelbar enthalten ist) nur <strong>de</strong>r negative Kommunis<br />
mus steht.<br />
[38] Die isidorische Wort<strong>de</strong>utung stützt sich auf die Institu<br />
tionen Justinians (IV. I §2). Etymologisch ist sie nicht richtig.<br />
Der Stamm von furtum ist für, <strong>und</strong> für kommt vom griechischen<br />
phor (= Dieb). Was nun die inhaltliche Verwandtschaft angeht,<br />
so steht, wie Thomas in Fr. 108,8 Zu 3 sagt, furtum (Diebstahl)<br />
<strong>de</strong>m Begriff fraus (Betrug) nahe.<br />
[39] Thomas gibt hier eine Erklärung <strong>de</strong>r Justinianischen<br />
Institutionen (IV, I §9). Dort wird nämlich als Gegenstand <strong>de</strong>s<br />
Diebstahls dasjenige bezeichnet, was in <strong>de</strong>r Gewalt <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn<br />
steht. Da die Gattin nicht als willenlose Sache unter <strong>de</strong>r Gewalt<br />
<strong>de</strong>s Mannes steht, kann die Entführung <strong>de</strong>r Gattin nicht als<br />
Diebstahl bezeichnet wer<strong>de</strong>n. Dagegen haben die Justiniani<br />
schen Institutionen die heimliche Entführung eines Kin<strong>de</strong>s als<br />
Diebstahl angesehen.<br />
[40] Es klingt vielleicht eigenartig, wenn Thomas hier <strong>de</strong>m<br />
Dieb einer Sache ein gewisses <strong>Recht</strong> auf die Sache einräumt.<br />
Und <strong>de</strong>nnoch hat <strong>de</strong>r Dieb die Sache nicht ganz rechtsunab<br />
hängig in Besitz, insofern er, solange er die gestohlene Sache<br />
nicht zurückgegeben hat, die Pflicht hat, dieselbe im Interesse<br />
<strong>de</strong>s Eigentümers unversehrt zu bewahren. Wenn also ein Eigen<br />
tümer seine Sache auf geheimem Wege zurückholen wollte,<br />
dann wür<strong>de</strong> er damit die innere sittliche Verpflichtung <strong>de</strong>s Die<br />
bes zur Rückgabe nicht beheben, da <strong>de</strong>r Dieb immer noch sitt<br />
lich als Dieb zu betrachten ist, wenngleich er es vielleicht posi<br />
tivrechtlich nicht mehr sein mag. Vgl. Art. 5 Zu 1.<br />
[41] Das Beispiel vom Raub <strong>de</strong>r Israeliten in Ägypten fin<strong>de</strong>t<br />
sich bereits bei Irenaus. Vgl. Kommentar zu 66,2.<br />
254
[42] Vgl. Anm. [40]. Thomas beweist hier wie<strong>de</strong>rum seinen<br />
Sinn für die Ordnung in <strong>de</strong>r Gesellschaft. Der or<strong>de</strong>ntliche Weg,<br />
seine Habe aus Diebeshand zurückzuholen, ist nicht die<br />
geheime Heimholung, son<strong>de</strong>rn, sofern <strong>de</strong>r Dieb sie nicht frei<br />
willig zurückerstattet, <strong>de</strong>r gerichtliche Prozeß.<br />
[43] Die Lehre <strong>de</strong>s Artikels wird leicht einsichtig, wenn man<br />
sich vergegenwärtigt, daß <strong>de</strong>r ursprüngliche Sinn <strong>de</strong>r Güterwelt<br />
nicht <strong>de</strong>r einzelne, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Mensch überhaupt ist. Vgl.<br />
Anm. [34] <strong>und</strong> [37] sowie Kommentar zu 66,2. Auch hier wird<br />
wie<strong>de</strong>r einmal mehr <strong>de</strong>utlich, wie stark Thomas es mit <strong>de</strong>r<br />
Väterlehre vom negativen Kommunismus hält.<br />
[44] Die augustinische Auffassung hängt mit <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r<br />
Stoa beeinflußten Lehre zusammen, daß man nur das in Wirk<br />
lichkeit als sein Eigentum betrachten könne, wovon man einen<br />
sittlich-guten Gebrauch macht. Da nun die Ungläubigen keinen<br />
für das ewige Leben gültigen Gebrauch von <strong>de</strong>n Gütern<br />
machen können, so scheinen sie vom Eigentumsrecht ausge<br />
schlossen zu sein. Vgl. Kommentar zu 66,2, wo die Väterlehre<br />
<strong>de</strong>s näheren dargestellt ist.<br />
[45] Thomas sieht in <strong>de</strong>r Scham eine Furchtempfindung, die<br />
sowohl vor wie nach <strong>de</strong>r schlechten Tat steht. Denn theologisch<br />
gesehen ist es je<strong>de</strong>smal dieselbe Furcht vor <strong>de</strong>m einen ewigen<br />
Richter, <strong>de</strong>r vor einer schlechten Tat warnt, wie Er auch nachher<br />
sie zu strafen willens ist.<br />
[46] Ein Kloster ist exemt, wenn es <strong>de</strong>r bischöflichen Juris<br />
diktion entzogen ist.<br />
[47] Wie <strong>de</strong>r Kommentar von Cajetan beweist, wur<strong>de</strong> die<br />
Frage <strong>de</strong>s Artikels viel diskutiert. Die rechtsformalistische<br />
Ansicht <strong>de</strong>s hl. Thomas, wonach <strong>de</strong>r Richter nicht nach eige<br />
nem, wenn auch noch so sicherem Wissen, son<strong>de</strong>rn nach <strong>de</strong>n<br />
Zeugenaussagen, d.h. nach <strong>de</strong>r rechtlichen Form zu urteilen<br />
habe, scheint in <strong>de</strong>r Tat gegen das Naturrecht zu stehen, gemäß<br />
welchem ein Unschuldiger ein naturgegebenes <strong>Recht</strong> auf Frei<br />
spruch hat. Heute tritt ein Richter, <strong>de</strong>r nach privatem Wissen<br />
„gerechter" zu urteilen versteht als nach <strong>de</strong>m Wissen, das er<br />
durch die Zeugenaussagen gewinnt, in <strong>de</strong>n Ausstand. Auch<br />
255
Thomas kennt diese Pflicht <strong>de</strong>s Richters, wie aus 64,6 Zu 3 her<br />
vorgeht. Damit ist <strong>de</strong>m Artikel je<strong>de</strong> Härte genommen.<br />
[48] Vgl. hierzu E. Chenon, Histoire generale du Droit fran-<br />
cais publique et prive <strong>de</strong>s origines ä 1815,1, Paris 1926, 663:<br />
„Das Prozeßverfahren war dasselbe in Zivil- <strong>und</strong> in Strafsa<br />
chen. In Strafsachen gab es nämlich keine amtliche Klage. Das<br />
Verfahren ging immer vom Kläger aus, d. h. die rechtliche Ver<br />
folgung war einzig Sache <strong>de</strong>s Beleidigten o<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>ssen Ver<br />
wandten. Wenn diese nicht eingriffen, gab es keinen Prozeß,<br />
auch nicht in Strafsachen". Dagegen steht die Entwicklung zum<br />
Inquisitionsverfahren. Vgl. Anmerkung [51].<br />
[49] Wir übersetzen hier „sufficiens" sinngemäß mit „voll<br />
gültig", nicht mit „genügend". Denn es ist Thomas hier um eine<br />
wirksame, nicht etwa nur hinlängliche Zeugenaussage zu<br />
tun. Vgl. zum Begriff „sufficiens" M.-D. Chenu, Sufficiens, in<br />
RSPTh 22, 1933, 251-259.<br />
[50] Das gerichtliche Verfahren war bis ins 12. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
hinein nur mündlich. Erst gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrh<strong>und</strong>erts tritt<br />
<strong>de</strong>r Gerichtsschreiber auf. Vgl. E. Chenon, a. a. 0.663.<br />
[51] Thomas <strong>de</strong>utet hier bereits das Verfahren <strong>de</strong>s Inquisi<br />
tionsprozesses an. Im Gegensatz zum Anklageprozeß über<br />
nimmt hier das Gericht selbst die Aufspürung <strong>de</strong>s strafwürdi<br />
gen Gegenstan<strong>de</strong>s, meist geführt durch eine Anzeige (nicht also<br />
durch eine eigentliche Klage). Vgl. E. Chenon, a. a. 0.712f. All<br />
gemein über die Entwicklung <strong>de</strong>s Inquisitionsverfahrens orien<br />
tiert <strong>de</strong>r Artikel „Inquisition" von G. Schnürerim LThK V, 1933,<br />
419ff.<br />
[52] Durch die Anklage tritt nach Ansicht <strong>de</strong>s hl. Thomas <strong>de</strong>r<br />
Kläger nach Art eines Prozeßkontraktes mit <strong>de</strong>m Angeklagten<br />
in das Verhältnis <strong>de</strong>r strengen <strong>Gerechtigkeit</strong> (Verkehrsgerech<br />
tigkeit) . Der Kläger verstößt gegen diese <strong>Gerechtigkeit</strong>, wenn er<br />
<strong>de</strong>n Angeklagten entwe<strong>de</strong>r verleum<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r mit ihm gemein<br />
same Sache macht o<strong>de</strong>r unbegrün<strong>de</strong>terweise vom begonnenen<br />
Prozeß zurücksteht. Vgl. E. Chenon, a. a. 0.711.<br />
[53] Mit <strong>de</strong>m Freispruch <strong>de</strong>s Angeklagten war die richter<br />
liche Aufgabe noch nicht erschöpft. Der Richter hatte ebenfalls<br />
256
zu untersuchen, auf welcher Gesinnung die falsche Anklage<br />
eigentlich beruhte. Vgl. E. Chenon, a.a.O.712.<br />
[54] Das jus talionis, von <strong>de</strong>m hier die Re<strong>de</strong> ist, be<strong>de</strong>utet die<br />
Vergeltung durch Gleiches. Sosehr auch dieses <strong>Recht</strong> sich aus<br />
<strong>de</strong>r Geschichte entwickelt haben mag, so ist es doch in <strong>de</strong>r<br />
Metaphysik von Sün<strong>de</strong> <strong>und</strong> Strafe begrün<strong>de</strong>t, wie im Kommen<br />
tar von 64,2 ausgeführt ist.<br />
[55] Der „Ehrverlust" ist doppelt: entwe<strong>de</strong>r vom Richter<br />
ausgesprochen o<strong>de</strong>r auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r öffentlichen Tat selbst. Von<br />
letzterem spricht Thomas in 67,3 Zu 2.<br />
[56] Die Antworten <strong>de</strong>s Angeklagten hatten nach <strong>de</strong>r stren<br />
gen Form <strong>de</strong>r Frage zu erfolgen. Vgl. E. Chenon, a. a. 0.667f.<br />
[57] Calumnia ist im Prozeßrecht die Schikane, d. h. das<br />
bewußte Vorgehen mit unwahren Behauptungen o<strong>de</strong>r unge<br />
rechtfertigten Anträgen. Als Sch<strong>utz</strong> gegen die Schikane wur<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r hier erwähnte Kalumnieneid auferlegt, d. h. <strong>de</strong>r Schwur, daß<br />
man nicht aus Schikane handle. Vgl. „calumnia" in Heumanns<br />
Handlexikon zu <strong>de</strong>n Quellen <strong>de</strong>s Römischen <strong>Recht</strong>s. 9. Auflage<br />
von E. Seckel, Jena 1914, 52.<br />
[58] Unter „Klugheit" ist hier nicht etwa die „Gerissenheit",<br />
son<strong>de</strong>rn die sittliche Klugheit zu verstehen.<br />
[59] Es han<strong>de</strong>lt sich hier um Befreiung jeglicher Art, z. B. von<br />
väterlicher Gewalt, von einem bisher bestan<strong>de</strong>nen Dienstver<br />
hältnis.<br />
[60] Bezüglich <strong>de</strong>r Unterscheidung <strong>de</strong>r Begriffe vgl. Kom<br />
mentar zu diesem Artikel.<br />
[61] Die Sün<strong>de</strong> be<strong>de</strong>utet eine zweifache Bewegung: eine<br />
Hinwendung auf ein verbotenes Gut <strong>und</strong> eine Abkehr vom<br />
guten Ziel. Im Anschluß an diese doppelte Betrachtungsweise<br />
<strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> haben die Scholastiker lange Traktate über <strong>de</strong>n<br />
Wesensbestandteil <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> geschrieben. Es ging dabei um die<br />
Frage, ob die Sün<strong>de</strong> zunächst <strong>und</strong> zuerst wesentlich in <strong>de</strong>r Hin<br />
wendung auf ein verbotenes Gut o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Abkehr von <strong>de</strong>m<br />
257
guten Ziel bestehe. Das Textmaterial weist bei Thomas nach<br />
bei<strong>de</strong>n Richtungen. Auch <strong>de</strong>r Text hier ist nicht ein<strong>de</strong>utig.<br />
[62] Thomas macht hier <strong>de</strong>n etwas spitzfindig erscheinen<strong>de</strong>n<br />
Unterschied zwischen Verhöhnung <strong>und</strong> Verspottung. Die Ver<br />
höhnung äußert sich in überheblichem Naserümpfen, die Ver<br />
spottung dagegen in Worten <strong>und</strong> tönen<strong>de</strong>m Lachen. In <strong>de</strong>r Tat<br />
aber steckt hierin eine feinsinnige Psychologie. Gera<strong>de</strong> im<br />
Naserümpfen kann ein Mensch wortlos seine Verachtung ge<br />
genüber <strong>de</strong>m Nächsten in sehr empfindlicher Weise zum Aus<br />
druck bringen. Wir sprechen in etwas an<strong>de</strong>rem Zusammenhang<br />
auch von „Hochnäsigkeit".<br />
[63] Man könnte meinen, es scha<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Nächsten weiter<br />
nicht, wenn man ihm persönlich unter vier Augen die Fehler<br />
vorhalte, <strong>de</strong>nn we<strong>de</strong>r guter Ruf noch Ehre stän<strong>de</strong>n im Spiel.<br />
Dagegen bemerkt Thomas — <strong>und</strong> hier verrät er wie<strong>de</strong>r einmal<br />
mehr <strong>de</strong>n feinsinnigen Psychologen —, daß <strong>de</strong>r Nächste in sei<br />
nem seelischen Gleichgewicht <strong>de</strong>nnoch schwerstens getroffen<br />
wer<strong>de</strong>, was schon sein Erröten anzeige. Wieviel seelisches<br />
Unheil hat falscher Ta<strong>de</strong>l schon angerichtet in <strong>de</strong>r Erziehung!<br />
Uberaus treffend setzt Thomas diese durch unangebrachten<br />
Ta<strong>de</strong>l zerstörte Selbstsicherheit <strong>de</strong>s eigenen Gewissens <strong>de</strong>m<br />
Verlust <strong>de</strong>r „gloria conscientiae", d. h. <strong>de</strong>s Ruhmes <strong>de</strong>s Gewis<br />
sens gleich.<br />
[64] Thomas unterschei<strong>de</strong>t mit Aristoteles drei Arten von<br />
Fre<strong>und</strong>schaften (vgl. Kommentar in Eth.VIII, lectio 3, Ed.<br />
Marietti 1563ff.): die vollkommene Fre<strong>und</strong>schaft, die auf Nut<br />
zen beruhen<strong>de</strong> Fre<strong>und</strong>schaft <strong>und</strong> die auf geistigen Gewinn<br />
bedachte Fre<strong>und</strong>schaft. Fre<strong>und</strong>schaft ist immer gegenseitige<br />
Liebe, gemäß Augustinus „amicus amico amicus". In <strong>de</strong>r voll<br />
kommenen Fre<strong>und</strong>schaft nun ist das Gut, das von bei<strong>de</strong>n Seiten<br />
her geliebt wird, die wahre sittliche Größe <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn. In <strong>de</strong>r<br />
auf N<strong>utz</strong>en beruhen<strong>de</strong>n Fre<strong>und</strong>schaft ist das bei<strong>de</strong>rseits<br />
geliebte Gut <strong>de</strong>r Vorteil, <strong>de</strong>n je<strong>de</strong>r vom an<strong>de</strong>rn hat. Diese ist die<br />
kaufmännische o<strong>de</strong>r Geschäftsfre<strong>und</strong>schaft, von <strong>de</strong>r im Text die<br />
Re<strong>de</strong> ist. In <strong>de</strong>r auf geistigen Gewinn bedachten wird das Ver<br />
gnügen <strong>und</strong> die persönliche Freu<strong>de</strong> gesucht, welche die Fre<strong>und</strong>e<br />
einan<strong>de</strong>r bereiten.<br />
258
[65] Vgl. DT, Bd.24, Anm [111] zu 188,5, Einw. 1.<br />
[66] Der Darlehenszins galt als Sün<strong>de</strong>. Um diesen Sachver<br />
halt auszudrücken, übersetzen wir nicht: „Von <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Wuchers", wenngleich usura gleich Wucher ist; <strong>de</strong>nn es ist hier<br />
bei Thomas mit Wucher die For<strong>de</strong>rung eines Darlehenszinses<br />
gemeint. Vgl. Näheres im Kommentar.<br />
[67] Vgl. DT, Bd.24, Anm [97], S. 319.<br />
[68] Hier wird Geld nicht mehr als Tauschmittel betrachtet,<br />
son<strong>de</strong>rn als Schmuck o<strong>de</strong>r Gegenstand <strong>de</strong>r Numismatik. Man<br />
kann also unter diesem zweiten Zweck, von <strong>de</strong>m Thomas hier<br />
spricht, nicht etwa die Investition verstehen, wie C. Spicq es tut<br />
(S.Thomas d' Aquin, Somme Theologique, La Justice III, Paris-<br />
Tournai-Rome 1935, 345).<br />
[69] Thomas spricht hier von <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Formen,<br />
gemäß <strong>de</strong>nen man sich für ein Darlehen einen Mehrwert aus<br />
bitten könnte: als Handleistung (Geld für Geld), Leistung<br />
durch Worte (Lob, Gunst, wir wür<strong>de</strong>n heute sagen: „Bezie<br />
hung"), Dienstleistung (Mithilfe im Haushalt, in <strong>de</strong>r Landbe<br />
stellung, jegliche Arbeitsleistung).<br />
[70] Selbstre<strong>de</strong>nd kann je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r einem an<strong>de</strong>rn einen Gefal<br />
len erweist, von diesem die Gesinnung <strong>de</strong>r Dankbarkeit erwar<br />
ten <strong>und</strong> sogar for<strong>de</strong>rn. Jedoch ist diese For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Dankbar<br />
keit nie rechtlich erzwingbar. Sie bleibt immer eine moralische<br />
For<strong>de</strong>rung. In diesem Sinne sagt Thomas hier, daß <strong>de</strong>rjenige,<br />
<strong>de</strong>r einem an<strong>de</strong>rn in Form eines an sich unentgeltlichen Darle<br />
hens einen Gefallen erweist, von <strong>de</strong>m Darlehensnehmer Dank<br />
barkeit „for<strong>de</strong>rn" (exigere) könne.<br />
[71] Die Antwort könnte vielleicht die Meinung nahelegen,<br />
daß Thomas <strong>de</strong>n eigentlichen Mehrgewinn ausschlösse <strong>und</strong> nur<br />
die Risikoprämie zulasse. Vgl. hierzu <strong>de</strong>n Kommentar.<br />
[72] Für Gelddarlehen mußte <strong>de</strong>r Darlehensempfänger zur<br />
Garantieleistung oft ein Pfand hinterlegen. Wenn dieses Pfand<br />
einen eigenen N<strong>utz</strong>wert bot, <strong>de</strong>r in Geld meßbar war, war <strong>de</strong>r<br />
259
Darlehensgeber verpflichtet, diesen N<strong>utz</strong>preis nachher zu Gun<br />
sten <strong>de</strong>s Darlehensempfängers zu berechnen. Sonst hätte ein<br />
reiner Mehrgewinn durch Darlehen vorgelegen, was Wucher<br />
gleichkam.<br />
[73] Der Gedankengang dieses Artikels ist etwas verwickelt.<br />
Thomas nimmt zunächst <strong>de</strong>n Fall an, daß A <strong>de</strong>m B Konsum<br />
güter (Weizen, Wein usw.) leihe <strong>und</strong> dafür Zins verlange in<br />
Form einer größeren als <strong>de</strong>r geliehenen Menge. Nun ist B an<br />
sich zur Rückgabe dieser Mehrmenge verpflichtet. B arbeitet<br />
aber mit diesem Mehr (z. B. durch Anpflanzen <strong>de</strong>s Weizens,<br />
durch Verkauf <strong>de</strong>s Weines im Kleinhan<strong>de</strong>l), wodurch er einen<br />
weiteren Mehrwert erzielt. Muß nun B dieses durch eigenen<br />
Fleiß dazuerworbene Quantum ebenfalls zurückerstatten?<br />
Thomas antwortet: Er brauche <strong>de</strong>m A nur die Darlehensgröße<br />
plus <strong>de</strong>m gefor<strong>de</strong>rten Mehr zurückzuerstatten, weil es sich um<br />
eine Sache handle, die in sich nicht produktiv sei. Produktiv war<br />
nach seiner Ansicht nur die Arbeit, es sei <strong>de</strong>nn, <strong>de</strong>m Eigentümer<br />
wäre irgendwie ein Scha<strong>de</strong>n entstan<strong>de</strong>n.<br />
Thomas führt nun weiter aus: Gesetzt <strong>de</strong>n Fall, <strong>de</strong>r Darle<br />
hensgeber A verlange als Zins für die <strong>de</strong>m B geliehenen Kon<br />
sumgüter irgendwelche Produktivgüter, wie ein Haus, einen<br />
Acker. Wie verhält es sich dann? Muß A nur das Haus zurücker<br />
statten, das er auf Gr<strong>und</strong> eines „Wuchers" erworben hat, o<strong>de</strong>r<br />
auch <strong>de</strong>n Gewinn, <strong>de</strong>n er daraus gezogen hat? Thomas erklärt:<br />
er muß bei<strong>de</strong>s zurückerstatten, weil die Natur <strong>de</strong>s Hauses <strong>und</strong><br />
die <strong>de</strong>s Ackers produktiv ist.<br />
[74] Gemeint ist eine Tat, die unmittelbar aus sich eine Ver<br />
führung zur Sün<strong>de</strong> be<strong>de</strong>utet, die also ein Ärgernis hervorruft.<br />
An<strong>de</strong>rs bei irgen<strong>de</strong>iner Tat, die unmittelbar keinen Zusammen<br />
hang mit einem Ärgernis hat, die aber doch tatsächlich zum<br />
Ärgernis für an<strong>de</strong>re wird, weil die äußeren Umstän<strong>de</strong> ein sol<br />
ches herbeiführen. Z. B. kann ein Journalist an sich aus Berufs<br />
grün<strong>de</strong>n glaubensfeindliche Zeitungen lesen müssen. Er wür<strong>de</strong><br />
aber Ärgernis geben, wenn er es in <strong>de</strong>r Eisenbahn vor <strong>de</strong>n an<strong>de</strong><br />
ren Fahrgästen tun wür<strong>de</strong>, weil die Mitfahren<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong><br />
nicht kennen. In diesem Fall ist die Tat zwar aus sich nicht auf<br />
Ärgernis eingestellt. Das Ärgernis entsteht erst im an<strong>de</strong>rn, nicht<br />
vom Täter aus.<br />
260
[75] Die Gesetzesgerechtigkeit hat einen allgemeinen Wirk<br />
kreis, da sie alle Tugen<strong>de</strong>n auf das Gemeinwohl ausrichtet.<br />
Darum be<strong>de</strong>utet sie für <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r sie besitzt, also für ihren „Trä<br />
ger", jegliche Tugend. Sowohl von <strong>de</strong>r sittlichen Verpflichtung<br />
<strong>de</strong>s Menschen wie auch vom umfassen<strong>de</strong>n Wirkkreis (Objekt)<br />
<strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit her wird also die Geset<br />
zesgerechtigkeit zur universalen Tugend. Dies ist gemeint,<br />
wenn Thomas hier sagt, die Gesetzesgerechtigkeit sei sowohl<br />
für <strong>de</strong>n Träger wie gleichsam nach außen „je<strong>de</strong> Tugend". Die<br />
Ungerechtigkeit ist nun, wenn auch nicht vom Subjekt, so doch<br />
im äußeren Wirkkreis, d. h. im Objekt, eine allgemein umfas<br />
sen<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong>.<br />
261
KOMMENTAR
ZUR EINFÜHRUNG<br />
Dem mo<strong>de</strong>rnen Denken kommt bereits die Überschrift <strong>de</strong>s<br />
Traktats bei Thomas überraschend, wenn nicht gar befrem<strong>de</strong>nd<br />
vor. Denn „<strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>" meint bei Thomas etwas<br />
an<strong>de</strong>res als in <strong>de</strong>r heutigen <strong>Recht</strong>sphilosophie. Wer heute von<br />
<strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> spricht, versteht darunter das beste<br />
hen<strong>de</strong> <strong>Recht</strong> in seiner Beziehung zur I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> ist dabei das I<strong>de</strong>al, das je<strong>de</strong>m gelten<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong><br />
vorschweben soll, um „richtiges <strong>Recht</strong>" zu sein, ein I<strong>de</strong>al also,<br />
an <strong>de</strong>m alle <strong>Recht</strong>sbildung sich orientieren soll.<br />
Dagegen wird hier bei Thomas „<strong>Gerechtigkeit</strong>" in einem<br />
ganz an<strong>de</strong>ren Sinn verstan<strong>de</strong>n. Der Begriff ist tief verankert im<br />
ethischen Gefüge <strong>de</strong>s Traktats. <strong>Gerechtigkeit</strong> ist eine Tugend,<br />
eine persönliche Vollkommenheit, eine Festigkeit unseres Wil<br />
lens, gerecht han<strong>de</strong>ln zu wollen <strong>und</strong> wirklich, d. h. durch die<br />
Tat, gerecht zu sein, wo immer wir es mit <strong>de</strong>m „<strong>Recht</strong>" als<br />
Gegenstand zu tun haben. Wir wer<strong>de</strong>n also mitten in die Ethik<br />
versetzt, in die Lehre von <strong>de</strong>n Tugen<strong>de</strong>n, von <strong>de</strong>n seelischen<br />
Verhaltensweisen im Hinblick auf das Gute. Das <strong>Recht</strong><br />
erscheint <strong>de</strong>mnach schon bei seinem ersten Auftreten in <strong>de</strong>r<br />
Summa als ein Gegenstand <strong>de</strong>s sittlich guten Willens. Das ist<br />
zwar nicht ganz überraschend, <strong>de</strong>nn auch die mo<strong>de</strong>rne <strong>Recht</strong>s<br />
philosophie hält dafür, daß das <strong>Recht</strong> ein wahres Gut sei, ein<br />
Gut <strong>de</strong>r Ordnung, ein Gut <strong>de</strong>r Gesellschaft. Daß aber <strong>de</strong>r ein<br />
zelne dieses Gut zum Gegenstand eigenen persönlichen sittli<br />
chen Strebens macht, kümmert sie dann weniger o<strong>de</strong>r über<br />
haupt nicht mehr. Der Begriff <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> kann daher, wo<br />
er in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen <strong>Recht</strong>sphilosophie verwandt wird, nicht<br />
diesen „Sprung" ins Persönlich-Verantwortliche <strong>de</strong>s einzelnen<br />
machen. Bei Thomas aber wird er gera<strong>de</strong> dorthin verlegt, <strong>und</strong><br />
dies nicht ohne Absicht, wie sich in <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>s Begriffs <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s erweisen wird. Was die Mo<strong>de</strong>rnen unter <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
begreifen ist bei Thomas nicht ein i<strong>de</strong>alisiertes Gut, das hoch<br />
über <strong>de</strong>m Horizont <strong>de</strong>s Lebens als Leitstern voranleuchtet <strong>und</strong><br />
so vor <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> steht; vielmehr kann er das I<strong>de</strong>al, wonach<br />
<strong>Recht</strong> gebil<strong>de</strong>t wird, nur verstehen als etwas, das in sich selbst<br />
schon <strong>Recht</strong> ist.<br />
Von dieser Gr<strong>und</strong>schau <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> als sittlicher<br />
Tugend her ist erst die Einteilung <strong>de</strong>s Traktats verständlich: die<br />
Betrachtung <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> in sich (Fr. J7—60)<br />
265
<strong>und</strong> in ihren Teilen (Fr. 61—120), entsprechend <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>r<br />
Behandlung, wie sie Thomas sonst bei je<strong>de</strong>r sittlichen Tugend<br />
eingehalten hat. Es sei dabei in Erinnerung gerufen (vgl. DT,<br />
Bd. 11), daß <strong>de</strong>r Ausdruck „Teile <strong>de</strong>r Tugend" nichts zu tun hat<br />
mit einer quantitativen Auffassung, son<strong>de</strong>rn die verschie<strong>de</strong>nen<br />
Verwirklichungsweisen <strong>de</strong>r Tugend, entsprechend <strong>de</strong>r jeweili<br />
gen Lagerung <strong>de</strong>s Objekts, be<strong>de</strong>utet. Das Nähere ergibt sich<br />
aus <strong>de</strong>r Darstellung <strong>de</strong>r einzelnen Teile.<br />
266
ERSTER TEIL<br />
DAS WESEN DER TUGEND<br />
DER GERECHTIGKEIT<br />
(Fr. 57-60)<br />
Erstes Kapitel<br />
DAS RECHT ALS GEGENSTAND<br />
DER TUGEND DER GERECHTIGKEIT<br />
(Fr. 57)<br />
I. Der Begriff <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s<br />
(Art. 1)<br />
Die Schlußfolgerung auf die <strong>de</strong>r erste Artikel in anscheinend 57. l<br />
umständlichen Wendungen hinausläuft, klingt für einen unbe<br />
fangenen, nicht tiefer loten<strong>de</strong>n Leser selbstverständlich, kaum<br />
wert, daß darüber überhaupt ein Wort verloren wird: Gegen<br />
stand <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> ist das <strong>Recht</strong>. Und doch verbirgt sich<br />
hinter diesem einfachen Schlußsatz das Problem, um das sich<br />
die <strong>Recht</strong>sphilosophie aller Jahrh<strong>und</strong>erte bemüht hat: Einheit<br />
o<strong>de</strong>r Mehrheit <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s.<br />
Der Positivismus faßt seine sämtlichen Gewinnchancen im<br />
Kampf mit <strong>de</strong>r Naturrechtslehre zusammen in <strong>de</strong>m monisti<br />
schen Apriori: es gibt nur ein einziges <strong>Recht</strong>. Dieser Satz ergibt<br />
sich notwendig aus <strong>de</strong>r Auffassung <strong>de</strong>r Gesellschaft als einer<br />
rechtlich geordneten Gemeinschaft. Innerhalb einer rechtlichen<br />
Gemeinschaft kann doch nur ein einziges <strong>Recht</strong> gelten, sonst<br />
wür<strong>de</strong> die Einheit <strong>de</strong>r Gemeinschaft zerbrechen. Selbst die<br />
Naturrechtslehre kann auf dieses Apriori nicht verzichten,<br />
wenngleich sie vorstaatliche <strong>Recht</strong>e, also <strong>Recht</strong>e verteidigt, die<br />
vor <strong>de</strong>r faktischen <strong>und</strong> positiv gebil<strong>de</strong>ten <strong>Recht</strong>sgemeinschaft<br />
liegen, insofern sie im Fall einer <strong>Recht</strong>skollision <strong>de</strong>m einen,<br />
nämlich <strong>de</strong>m natürlichen <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>n Vorzug geben muß. Man<br />
mag dabei von einer „Intoleranz", von einer Selbstüberhebung<br />
<strong>de</strong>s Naturrechts re<strong>de</strong>n. Aber sowohl das rein begriffliche als<br />
auch das praktische Denken zwingen zu diesem Schluß auf die<br />
Einheit <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s: das begriffliche Denken, insofern „<strong>Recht</strong>"<br />
als solches nicht zwei gegensätzliche Inhalte in gleicher Weise<br />
qualifizieren kann, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n einen als <strong>Recht</strong>, <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren als<br />
Unrecht bezeichnen muß; das praktische Denken, insofern wir<br />
in <strong>de</strong>r Praxis zu irgen<strong>de</strong>iner Frie<strong>de</strong>nsordnung kommen müssen,<br />
267
57. l wenn zwei Parteien sich streiten. Mit einer Doppelspurigkeit<br />
<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s kämen wir niemals zur Ruhe. In diesem Sinne mag,<br />
allerdings mit <strong>de</strong>r Verwahrung gegen die Anschuldigung <strong>de</strong>r<br />
Intoleranz <strong>de</strong>s Naturrechts, stimmen, was <strong>de</strong>r Positivist<br />
W. R. Beyer 1 sagt: „Es kann begrifflich nur ei« <strong>Recht</strong> geben. Der<br />
Begriff <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s steht über <strong>de</strong>r Erscheinungsform <strong>de</strong>sselben.<br />
Die Unteilbarkeit <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>sbegriffs zwingt das Naturrecht ja,<br />
im Wege einer Intoleranz sich selbst überzuordnen <strong>und</strong> alles<br />
positive <strong>Recht</strong> nur als Ausfluß, als Ausdruck, als Teil seiner<br />
selbst zu betrachten". Allerdings verrät dieser Text klar <strong>de</strong>n<br />
positivistischen, naturrechtlich unhaltbaren Gedanken, daß die<br />
Bestimmung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s an sich überhaupt nichts mit <strong>de</strong>r<br />
Erscheinungsform, d. h. mit <strong>de</strong>r inhaltlichen Bestimmung <strong>de</strong>s<br />
sen, was recht ist, zu tun habe. Wohl kann die Nominal<strong>de</strong>fini<br />
tion <strong>de</strong>s allgemeinen Begriffs „<strong>Recht</strong>" von <strong>de</strong>n Inhalten, die als<br />
recht bezeichnet wer<strong>de</strong>n, absehen, niemals aber die Real<strong>de</strong>fini<br />
tion <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. Das bolschewistische <strong>Recht</strong> erfüllt nur die<br />
Nominal<strong>de</strong>finition, nicht aber die Real<strong>de</strong>finition von <strong>Recht</strong>. Es<br />
wird sogleich noch darauf eingegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Gr<strong>und</strong>anliegen einer konsequent <strong>de</strong>nken<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>swis<br />
senschaft ist also damit erfüllt, daß Thomas klar <strong>und</strong> bestimmt<br />
herausstellt: Gegenstand <strong>de</strong>s gerechten Verhaltens ist einzig<br />
<strong>und</strong> allein das <strong>Recht</strong>. Nicht das <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> eine <strong>Gerechtigkeit</strong>,<br />
d. h. nicht ein gelten<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> eine diesem vorschweben<strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ale <strong>Gerechtigkeit</strong> sind Gegenstand einer gerechten Hand<br />
lung, son<strong>de</strong>rn einzig das <strong>Recht</strong>. Dieses <strong>Recht</strong> ist so ein<strong>de</strong>utig,<br />
wie je<strong>de</strong>s Maß, wonach zwei Dinge zu messen sind, ein<strong>de</strong>utig<br />
sein muß.<br />
Was ist nun das wesentliche Merkmal <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s? O<strong>de</strong>r bes<br />
ser: Wie lautet die Definition <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s? 2 Bereits hier stellt sich<br />
die <strong>Recht</strong>swissenschaft als ein ziemlich <strong>und</strong>urchsichtiges<br />
Gebil<strong>de</strong> dar. Außer in <strong>de</strong>r Soziologie wur<strong>de</strong> wohl in keiner Wis<br />
senschaft so um die Definition <strong>de</strong>s eigentlichen Gegenstands<br />
gestritten. Pascal bemerkt darum nicht ohne Gr<strong>und</strong>: „Eine<br />
Ortsverän<strong>de</strong>rung um drei Breitengra<strong>de</strong> macht die ganze<br />
<strong>Recht</strong>swissenschaft zunichte". Wohl hat er dabei mehr an das,<br />
was man als inhaltliches <strong>Recht</strong> bestimmt, als etwa an das <strong>Recht</strong><br />
1 W.R. Beyer, <strong>Recht</strong>sphilosophische Besinnung. Eine Warnung vor <strong>de</strong>r ewigen<br />
Wie<strong>de</strong>rkehr <strong>de</strong>s Naturrechts. 1947, 69.<br />
2 Vgl. hierzu A.F.Utz, Sozialethik, Teil II: <strong>Recht</strong>sphilosophie, 19—56.<br />
268
selbst gedacht. Die mo<strong>de</strong>rne <strong>Recht</strong>sphilosophie macht ganz 57. l<br />
richtig eine klare Unterscheidung zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>m,<br />
was recht ist. Ebenso bemüht sie sich heute, aus einem bereits<br />
in dieser Anfangsfrage sich vordrängen<strong>de</strong>n Positivismus heraus,<br />
um die Unterscheidung zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s.<br />
Diese letzte Unterscheidung zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s hängt, wie wir sehen wer<strong>de</strong>n, zuinnerst mit <strong>de</strong>r Frage<br />
zusammen, ob das „richtige" <strong>Recht</strong> aus sich schon <strong>Recht</strong> sei.<br />
Zur Abklärung <strong>de</strong>r Definition <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s ist zuvor<strong>de</strong>rst die<br />
Unterscheidung zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong>, d. h. <strong>de</strong>m, was<br />
recht ist, also <strong>de</strong>m Gerechten vonnöten. W.R. Beyer' drückt dies<br />
in <strong>de</strong>r Weise aus, daß er sagt, <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> gehe die<br />
Frage nach <strong>Recht</strong> voraus; es sei erheblich, ob <strong>Recht</strong> o<strong>de</strong>r das<br />
jeweilige <strong>Recht</strong> in Frage gestellt sei. Bereits hier verbirgt sich ein<br />
gefährlicher Positivismus, sofern man es darauf absieht, <strong>Recht</strong><br />
von <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> o<strong>de</strong>r Gerechten nicht nur zu unterschei<strong>de</strong>n,<br />
son<strong>de</strong>rn zu trennen. Das Naturrechts<strong>de</strong>nken kann mit einer<br />
Trennung nicht einverstan<strong>de</strong>n sein. Es kann sich nur für eine<br />
Unterscheidung erklären.<br />
Sehen wir also einmal davon ab, was als <strong>Recht</strong> zu gelten hat<br />
<strong>und</strong> was darum — im Naturrechts<strong>de</strong>nken — überhaupt erst ein<br />
<strong>Recht</strong> sein kann, so müssen wir trotz aller wirklichen Bindung<br />
<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s an einen Inhalt zu einer allgemeinen Begriffsbestim<br />
mung von <strong>Recht</strong> gelangen, in <strong>de</strong>r eben nicht Moral, nicht Reli<br />
gion o<strong>de</strong>r was sonst immer, son<strong>de</strong>rn eben nur <strong>Recht</strong> begriffen<br />
wird. Das heißt, es geht um eine Begriffsabgrenzung von <strong>Recht</strong>,<br />
welche gilt, wo immer von <strong>Recht</strong> die Re<strong>de</strong> ist <strong>und</strong> wie immer<br />
auch <strong>de</strong>r Inhalt <strong>de</strong>ssen, was man als <strong>Recht</strong> bezeichnet, aussehen<br />
mag.<br />
Ganz im Sinne <strong>de</strong>s aristotelisch-thomasischen Denkens ist<br />
hierbei von <strong>de</strong>r Erfahrung auszugehen; <strong>de</strong>nn je<strong>de</strong> Begriffsbe<br />
stimmung beginnt bei <strong>de</strong>r Festlegung <strong>de</strong>s Namens, wie er tat<br />
sächlich im Gebrauch ist. Freilich sind wir damit erst bei <strong>de</strong>r<br />
Nominal<strong>de</strong>finition. Und eben daran kranken die Begriffsbe<br />
stimmungen <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen <strong>Recht</strong>sphilosophen durchweg, daß<br />
sie diese als eine Realbestimmung ausgeben. Sind wir aber in<br />
<strong>de</strong>r Erkenntnis so weit, daß wir die Vorläufigkeit <strong>de</strong>r Definition<br />
von <strong>Recht</strong>, im Unterschied zum <strong>Recht</strong>en, zugeben, dann wird<br />
es wohl kein allzugroßer Schritt mehr sein bis zur Anerkennung<br />
3 W.R.Beyer, <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>s-Ordnung. Meisenheim-Glan 1951.<br />
269
einer Bestimmung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, das vom Inhalt <strong>und</strong> zu guter<br />
Letzt auch von einer <strong>Recht</strong>si<strong>de</strong>e, somit einem <strong>Recht</strong>si<strong>de</strong>al be<br />
griffen wer<strong>de</strong>n muß.<br />
Welches aber ist nun die Nominal<strong>de</strong>finition von <strong>Recht</strong>? Im<br />
mo<strong>de</strong>rnen Denken wird <strong>Recht</strong> stets als mit Zwang durchsetz<br />
bare gesellschaftliche Ordnung verstan<strong>de</strong>n. In diesem Sinne<br />
sagt z. B. H. Lauterpacht:* „<strong>Recht</strong> ist das Werkzeug einer gel<br />
ten<strong>de</strong>n Gesellschaftsordnung". Obwohl <strong>de</strong>r Sinn, <strong>de</strong>r sich hinter<br />
dieser Begriffsbestimmung verbirgt, einen unzwei<strong>de</strong>utigen<br />
Positivismus verrät, können wir diese Definition als reine<br />
Nominal<strong>de</strong>finition ruhig gelten lassen, wobei dann die Frage<br />
offen bleibt, was nun als gelten<strong>de</strong> Gesellschaftsordnung ange<br />
sprochen wer<strong>de</strong>n kann. <strong>Recht</strong> ist immer Frie<strong>de</strong>nsordnung <strong>de</strong>r in<br />
Gemeinschaft zusammenleben<strong>de</strong>n Menschen. Im Gr<strong>und</strong>e<br />
genommen kommt diese Sicht auf das hinaus, was Thomas hier<br />
in unserem Artikel sagt: Das <strong>Recht</strong> ist ein Ausgleich zwischen<br />
verschie<strong>de</strong>nen Personen.<br />
Es fragt sich dann weiter, wie nun die Real<strong>de</strong>finition <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s lautet. Mit dieser Frage verbin<strong>de</strong>t sich notwendig die<br />
Vorstellung eines „<strong>Recht</strong>s an sich", also gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssen, was die<br />
mo<strong>de</strong>rne <strong>Recht</strong>sphilosophie aus <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s aus<br />
schließen möchte. Die mo<strong>de</strong>rne <strong>Recht</strong>sphilosophie, die die Re<br />
alität <strong>de</strong>r Universalien leugnet, muß notwendigerweise beim<br />
rein Nominalen stehen bleiben. Sie erklärt das, was naturrecht<br />
liches Denken notwendigerweise nur als „nominal" bezeichnen<br />
kann, als <strong>de</strong>n „Begriff". Für das thomasische Denken aber gilt es<br />
als eine Selbstverständlichkeit, daß wir aus <strong>de</strong>n Erscheinungen,<br />
die als <strong>Recht</strong> bezeichnet wer<strong>de</strong>n, das Allgemeine herauslösen<br />
können, ja noch mehr, daß wir aus <strong>de</strong>m, was überhaupt als<br />
<strong>Recht</strong> bezeichnet wer<strong>de</strong>n darf, die allgemeine Realbestimmung<br />
<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s gewinnen. In <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r Tätigkeit kann Tho<br />
mas sich nun die Definition nur <strong>de</strong>nken entsprechend einer vor<br />
gegebenen Teleologie; d.h. die Real<strong>de</strong>finition wird nicht etwa<br />
aus <strong>de</strong>m genommen, was man als solches bezeichnet <strong>und</strong> was<br />
vielleicht allen bezeichneten Erscheinungen faktisch zugr<strong>und</strong>e<br />
liegt, son<strong>de</strong>rn aus <strong>de</strong>m, was <strong>de</strong>r Begriff enthalten muß, um die<br />
Bezeichnung <strong>Recht</strong> zu verdienen. Schon hier in <strong>de</strong>r Real<strong>de</strong>fini<br />
tion <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s stoßen wir auf das schwierige Problem von<br />
<strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral. Das <strong>Recht</strong> steht in <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>s Sollens<br />
4 H. Lauterpacht, Recognition in International Law. Cambridge 1947, 154.<br />
270
<strong>und</strong> wird darum real auch nur von einem Sollen, also von einer 57. l<br />
absolut gültigen Norm her bestimmt. Es ist eigenartig, daß<br />
nicht einmal Del Vecchio, <strong>de</strong>r sich selbst mit Eifer für ein Natur<br />
recht einsetzt, dies gespürt hat. Er unterschei<strong>de</strong>t sich daher<br />
trotz aller Bemühungen, über das „richtige <strong>Recht</strong>" von Rudolf<br />
Stammler hinauszukommen, gr<strong>und</strong>sätzlich nicht von ihm.<br />
Gleich diesem bleibt er I<strong>de</strong>alist, bei <strong>de</strong>m die I<strong>de</strong>alvorstellung<br />
von <strong>Recht</strong> stets von <strong>de</strong>m fernbleibt, was zum Wesen <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s<br />
gehört. Kant, <strong>de</strong>ssen Definition <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s zwar insofern posi<br />
tivistisch gefärbt war, als darin das <strong>Recht</strong> an die kontingente,<br />
positive Willensbildung <strong>de</strong>r Gesellschaftsglie<strong>de</strong>r geb<strong>und</strong>en war,<br />
steht trotz allem <strong>de</strong>m Denken <strong>de</strong>s hl. Thomas noch näher als die<br />
neueren <strong>Recht</strong>sphilosophen: „Das <strong>Recht</strong> ist <strong>de</strong>r Inbegriff <strong>de</strong>r<br />
Bedingungen, unter <strong>de</strong>nen die Willkür <strong>de</strong>s einen mit <strong>de</strong>r Willkür<br />
<strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn nach einem allgemeinen Gesetz <strong>de</strong>r Freiheit zusam<br />
men vereinigt wer<strong>de</strong>n kann" (WWIX, 33 fi.).Del Vecchio hat zu<br />
dieser Bestimmung nicht mehr zu sagen als dies: „Diese Be<br />
griffsbestimmung bezieht sich in Wirklichkeit auf das Natur<br />
recht, also das I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, aber sie gibt keineswegs <strong>de</strong>n Be<br />
griff, die Vorstellung von <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> als logischer Kategorie.<br />
Wollte man sie in diesem Sinne verstehen, so könnte sie zu <strong>de</strong>r<br />
Schlußfolgerung veranlassen, daß das <strong>Recht</strong> in Wirklichkeit nie<br />
<strong>und</strong> nirgends vorhan<strong>de</strong>n gewesen ist. Denn die <strong>Recht</strong>ssysteme,<br />
welche wir als solche gelten lassen, sind mehr o<strong>de</strong>r weniger weit<br />
von dieser Höchstform entfernt. Das Ergebnis wäre, daß man<br />
ohne weiteres aus <strong>de</strong>m Begriffsbereiche <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s alle die<br />
Systeme ausschließen müßte, in <strong>de</strong>nen die Gleichheit <strong>de</strong>r Frei<br />
heit nicht die volle Anerkennung gef<strong>und</strong>en hat". 5 Die Kritik Del<br />
Vecchios an <strong>de</strong>r kantischen Definition beweist die Begrenztheit<br />
mo<strong>de</strong>rnen <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nkens, weil sie meint, mit <strong>de</strong>r „logischen"<br />
Begriffsbestimmung schon <strong>de</strong>n wissenschaftlichen Bo<strong>de</strong>n für<br />
eine Diskussion über <strong>Recht</strong> geschaffen zu haben. Denn in <strong>de</strong>r<br />
Tat glaubt diese <strong>Recht</strong>sphilosophie, daß in ihrer logischen<br />
Bestimmung mehr ausgedrückt sei, als was etwa Thomas unter<br />
einer reinen Nominal<strong>de</strong>finition versteht. Sie meint nämlich, daß<br />
überall das, was man als <strong>Recht</strong> erklärt, auch <strong>Recht</strong> sei <strong>und</strong> als<br />
solches darum bezeichnet wer<strong>de</strong>n müsse, während Thomas<br />
diesen „dämonischen" Sprachgebrauch am Inhalt selbst wie<strong>de</strong>r<br />
5 G. Del Veccio, Lehrbuch <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sphilosophie. 2. Aufl., hrsg. von F. Darm-<br />
staedter. Basel 1951, 342.<br />
271
57. l zurechtbiegt. Und dieser Inhalt ist nun einmal in <strong>de</strong>r Ordnung<br />
<strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lns nichts an<strong>de</strong>res als eine real gültige I<strong>de</strong>e von <strong>Recht</strong>.<br />
Es bleibt darum bestehen: eine Real<strong>de</strong>finition von <strong>Recht</strong> ist nur<br />
aufzustellen im Hinblick auf die I<strong>de</strong>e von <strong>Recht</strong>, wobei die I<strong>de</strong>e<br />
keine i<strong>de</strong>alistische Vorstellung ist, son<strong>de</strong>rn eine <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s<br />
Menschen entnommene Norm.<br />
Folgenschwer wird allerdings die Erkenntnis, die sich daraus<br />
ergibt: alles, was nicht ausgerichtet ist nach dieser absolut gülti<br />
gen Norm, ist kein <strong>Recht</strong>. Damit wird die Begriffsbestimmung<br />
von Lauterpacht umgekehrt: eine gelten<strong>de</strong> Gesellschaftsord<br />
nung gibt es überhaupt nicht, wo nicht „i<strong>de</strong>ales" <strong>Recht</strong> verwirk<br />
licht ist.<br />
So verstehen wir, daß Thomas die be<strong>de</strong>utsame Gleichset<br />
zung von <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Gerechtem, d. h. <strong>de</strong>m, was recht ist, voll<br />
ziehen muß. Dies besagt nichts an<strong>de</strong>res, als daß <strong>de</strong>r Inhalt selbst<br />
auf Gr<strong>und</strong> seines inneren Bezuges zur absoluten Norm <strong>Recht</strong><br />
ist. Das auf Gr<strong>und</strong> menschlicher Bestimmung in Rußland gül<br />
tige <strong>Recht</strong> kann darum kein <strong>Recht</strong> sein, son<strong>de</strong>rn ist <strong>und</strong> bleibt<br />
Gewalt. Das ist <strong>de</strong>r erkenntnistheoretische Hintergr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s<br />
ersten Artikels. Die Real<strong>de</strong>finition <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s lautet also nach<br />
Thomas: Das <strong>Recht</strong> ist ein Ausgleich zwischen verschie<strong>de</strong>nen<br />
Personen entsprechend <strong>de</strong>n Normen <strong>de</strong>r Natur. Dabei kann<br />
diese Entsprechung zu <strong>de</strong>n Normen <strong>de</strong>r Natur auch mittelbar<br />
geschehen auf <strong>de</strong>m Wege über das positive Gesetz, sofern die<br />
ses <strong>de</strong>r Natur entspricht.<br />
Thomas bemüht sich nun weiterhin in diesem Artikel um die<br />
Abgrenzung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Gerechten von <strong>de</strong>m, was<br />
Gegenstand <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren sittlichen Tugen<strong>de</strong>n ist. Maß für das<br />
<strong>Recht</strong> ist, so sagt er, nicht eine Gewissensentscheidung, son<br />
<strong>de</strong>rn die Abmessung von Ansprüchen mehrerer Personen. Die<br />
Zuständigkeit <strong>de</strong>s subjektiven Gewissensspruchs als <strong>de</strong>s Maßes<br />
<strong>de</strong>r menschlichen Handlungen wird nur dort anerkannt, wo es<br />
um Handlungen geht, die in ihrer ganzen inneren Bestimmung<br />
vom sittlichen Streben <strong>de</strong>s Menschen abhängig sind. So ent<br />
schei<strong>de</strong>t z.B. das jeweilige sittlich gute Streben, inwieweit wir<br />
uns Opfer <strong>und</strong> Entsagung aufzuerlegen haben. Es gibt da kein<br />
absolut bestimmen<strong>de</strong>s äußeres Maß, wenngleich äußere<br />
Bestimmungsgrün<strong>de</strong> nicht ausgeschlossen sind, insofern auch<br />
sachliche Überlegungen, wie z.B. Alter, Beruf, Geschlecht, in<br />
die sittliche Wertung mithineinbezogen wer<strong>de</strong>n müssen. Ent<br />
schei<strong>de</strong>nd aber ist einzig, wie Thomas mit Aristoteles immer<br />
272
wie<strong>de</strong>r betont, das rechtschaffene, d. h. das sittlich gute Stre- 57. 1<br />
ben, <strong>de</strong>r gute Wille in eben diesem Augenblick, in welchem die<br />
Handlung Vollzogen wer<strong>de</strong>n soll. Die sittliche „Situation" kann<br />
je <strong>und</strong> je verschie<strong>de</strong>n sein. Entsprechend fühlt sich das gute,<br />
zielhaft auf Gott gerichtete Wollen in das konkrete Sollen ein.<br />
Ganz an<strong>de</strong>rs verhält es sich auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r ihm entsprechen<strong>de</strong>n Haltung. Hier ist nicht das konkrete<br />
Wertempfin<strong>de</strong>n, die Werteinfühlung in die sittliche Situation<br />
das Maßgeben<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn die äußerlich geregelte Beziehung<br />
zwischen Mensch <strong>und</strong> Mensch. <strong>Recht</strong> ist also wirklich Frie<strong>de</strong>ns<br />
ordnung zwischen mehreren Personen. Es unterschei<strong>de</strong>t sich<br />
darum gr<strong>und</strong>sätzlich von <strong>de</strong>r sittlichen Zumessung, die <strong>de</strong>r ein<br />
zelne Mensch für seine eigene Person vornimmt. Wir haben also<br />
insofern auch eine gewisse Abgrenzung zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong><br />
Moral vorgenommen, wenngleich sich zeigen wird, daß Tho<br />
mas zur Erkenntnis <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s auch eine sittliche Ausrüstung<br />
verlangt, so vor allem beim Richter. Diese ist aber nicht die<br />
Bedingung <strong>de</strong>s Gegenstands wie bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rn sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n, etwa <strong>de</strong>r Maßhaltung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Tapferkeit, son<strong>de</strong>rn<br />
die Voraussetzung <strong>de</strong>r Erkenntnis eines sachlich vorliegen<strong>de</strong>n<br />
Gegenstands, wobei wir allerdings nicht <strong>de</strong>n ausgefallenen<br />
Gedanken heraufbeschwören wollen, daß es nur ein fertiges<br />
<strong>und</strong> nicht auch ein noch zu setzen<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong> gäbe.<br />
Damit ist noch nichts über das eigentliche Problem von<br />
<strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral gesagt, wie wir es heute verstehen. Im Gr<strong>und</strong>e<br />
ist nur eine Unterscheidung vorgenommen zwischen <strong>de</strong>m<br />
Gegenstand <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n. Wenn wir heute von <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral sprechen,<br />
dann meinen wir die heikle Frage, ob rein sittliche Normen zu<br />
<strong>Recht</strong>snormen erhoben wer<strong>de</strong>n können, d.h., ob <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong><br />
irgendwelche politisch-pädagogische Zielhaftigkeit innewohnt.<br />
Kann das <strong>Recht</strong> irgendwelche sittlichen Zweckbestimmungen<br />
verfolgen, z.B. <strong>de</strong>n sittlichen Stand einer Gesellschaft heben<br />
wollen? Es ist klar, daß je<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong> irgenwie Ausdruck <strong>de</strong>s sitt<br />
lichen Stan<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r Gesellschaft ist. Es fragt sich aber, ob das<br />
<strong>Recht</strong> darüber hinaus auch noch höhere ethische Normen in<br />
sich begreift, so daß es die Zwangsinstitution wäre, um einen<br />
I<strong>de</strong>alstand <strong>de</strong>r Gesellschaft zu schaffen. Die Frage ist folgen<br />
schwer. Es geht dabei z. B. auch darum, ob eine christliche<br />
Autorität gegen das heidnische Schwergewicht <strong>de</strong>r Gesellschaft<br />
auf rechtlichem Wege, also mit <strong>de</strong>n Zwangsmitteln <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s,<br />
273
57. l das sittliche Gepräge <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Lebens bestimmen<br />
könne. Dabei wird noch ganz abgesehen von <strong>de</strong>r Frage, ob ein<br />
solches Unternehmen klug sei o<strong>de</strong>r nicht. Es han<strong>de</strong>lt sich ledig<br />
lich darum, ob ein <strong>Recht</strong> dazu bestehe, d. h., ob eine sittliche<br />
For<strong>de</strong>rung potentiell rechtliche Qualität habe.<br />
Diese Fragen sind von Thomas im ersten Artikel noch nicht<br />
behan<strong>de</strong>lt. Geht es ihm hier doch zunächst nur um die Defini<br />
tion, also um <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. Es ist dabei noch keines<br />
wegs von einem I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s die Re<strong>de</strong>, somit auch nicht<br />
vom eigentlichen Problem „<strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral". Selbstre<strong>de</strong>nd<br />
drängt sich unmittelbar nach <strong>de</strong>r Begriffsbestimmung die Frage<br />
auf: Woher stammt die Begründung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s? Welche Fakto<br />
ren bestimmen es? Irgen<strong>de</strong>ine ethische Norm o<strong>de</strong>r ein fakti<br />
scher Zustand o<strong>de</strong>r vielleicht sogar nur ein faktischer Willensbe-<br />
schluß? Hierüber spricht Thomas in <strong>de</strong>n Artikeln 2—4.<br />
IL Naturrecht <strong>und</strong> positives <strong>Recht</strong><br />
(Art. 2-4)<br />
1. DIE ENTSTEHUNG DES RECHTS AUFGRUND DER NATUR UND DER<br />
POSITIVEN SATZUNG<br />
(Art. 2)<br />
57. 2 Es ist sehr bezeichnend, daß Thomas nicht vom Gedanken<br />
<strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>snorm her <strong>de</strong>n Weg zur Unterscheidung zwischen<br />
Naturrecht <strong>und</strong> positivem <strong>Recht</strong> sucht, son<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>r Frage<br />
aus, auf welche Weise <strong>Recht</strong> entstehe. Gera<strong>de</strong> die mo<strong>de</strong>rne<br />
<strong>Recht</strong>sphilosophie müßte daran ihre Freu<strong>de</strong> haben, da es ihr<br />
doch darum zu tun ist, die <strong>Recht</strong>sentstehung von <strong>de</strong>r Normie<br />
rung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s zu unterschei<strong>de</strong>n. Mit dieser Unterscheidung<br />
glaubt ja die mo<strong>de</strong>rne <strong>Recht</strong>sphilosophie, soweit sie nicht völlig<br />
im Positivismus erstickt ist, son<strong>de</strong>rn noch <strong>de</strong>n i<strong>de</strong>alistischen<br />
Standpunkt <strong>de</strong>r Vorstellung einer I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
bewahrt hat, ihre Unterscheidung zwischen Geltung <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s <strong>und</strong> richtigem o<strong>de</strong>r besserem <strong>Recht</strong> stützen zu können.<br />
Allerdings kommt für das mo<strong>de</strong>rne <strong>Recht</strong><strong>de</strong>nken sogleich die<br />
Ernüchterung, wenn wir dann durch Thomas belehrt wer<strong>de</strong>n,<br />
daß die Natur, die als rechtsetzend bezeichnet wird, eben<br />
gera<strong>de</strong> jenen Himmel <strong>de</strong>r Normen in die Sphäre <strong>de</strong>r Geltung<br />
herunterholt, <strong>de</strong>n die i<strong>de</strong>alistische <strong>Recht</strong>sphilosophie stets als<br />
außerhalb <strong>de</strong>s gelten<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>s befindlich betrachtet. Es wird<br />
274
sich nämlich noch zeigen, daß die Natur, welche <strong>Recht</strong> konsti- 57. 2<br />
tuiert, in sich vielschichtig ist, also real gültige I<strong>de</strong>engehalte<br />
überzeitlicher Gültigkeit in sich beschließt, die darum nicht nur<br />
normierend, son<strong>de</strong>rn zugleich rechtschaffend sind.<br />
Es ist also hier nicht mehr die Re<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Definition <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong>sbegriff, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>m Weg, wie konkre<br />
tes, wirkliches <strong>Recht</strong> entsteht. Thomas sieht hier eine doppelte<br />
Möglichkeit: l.die rein sachliche Bestimmtheit, 2.die freie<br />
Konvention. Auf eine zweifache Weise, so sagt er in Art. 2, kann<br />
zwischen zwei o<strong>de</strong>r mehreren Personen das Gleichgewicht her<br />
gestellt wer<strong>de</strong>n, erstens, in<strong>de</strong>m die Natur, zweitens, in<strong>de</strong>m die<br />
freie willentliche Abmachung <strong>Recht</strong> setzt. Bemerkenswert sind<br />
dabei die Beispiele, die Thomas für die naturhafte Setzung <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s angibt. Er nennt hierbei nicht etwa, wie die mo<strong>de</strong>rne<br />
Naturrechtslehre es erwarten wür<strong>de</strong>, die menschliche Natur im<br />
allgemeinen, son<strong>de</strong>rn einen ganz konkreten Sachverhalt: soviel<br />
wur<strong>de</strong> geleistet, soviel also muß wie<strong>de</strong>rgeleistet o<strong>de</strong>r bezahlt<br />
wer<strong>de</strong>n. Selbst dann also, wenn es sich um ein wirtschaftliches<br />
Geschäft aus freiem Willen han<strong>de</strong>lt, muß man sich fragen: Wie<br />
liegt <strong>de</strong>r natürliche Sachverhalt? Was ist <strong>de</strong>r Gegenstand wert?<br />
Wenngleich Verkauf <strong>und</strong> Kauf einen freien Vertrag be<strong>de</strong>uten, so<br />
kann dieses Geschäft doch nach <strong>de</strong>r vor je<strong>de</strong>r Konvention lie<br />
gen<strong>de</strong>n sachlichen Inhaltlichkeit betrachtet wer<strong>de</strong>n. Diese<br />
Form <strong>de</strong>r Betrachtung ist die naturgerechte Betrachtung.<br />
Darum wird das so statuierte <strong>Recht</strong> Afoter-<strong>Recht</strong> genannt. Es<br />
sei auf diese Sicht <strong>de</strong>s Naturrechts beson<strong>de</strong>rs geachtet. Wir nei<br />
gen heute dazu, Naturrecht nur als jenes <strong>Recht</strong> zu bezeichnen,<br />
das sich aus <strong>de</strong>r Wesenheit <strong>de</strong>s Menschen ergibt. Wir kommen<br />
darum im so gefaßten Naturrecht nicht weiter als zu allgemei<br />
nen Normen, die ihre Anwendung auf Gr<strong>und</strong> eines eigenen<br />
„rechtslogischen" Prozesses suchen. Das so universal gefaßte<br />
Naturrecht verbleibt darum immer noch im i<strong>de</strong>alistischen<br />
Raum, im Bereich <strong>de</strong>r reinen Norm. Für Thomas dagegen ist<br />
Naturrecht ein bis in die konkrete Sachlage hineinreichen<strong>de</strong>s<br />
Soll. Wir könnten seinen Gedanken auch so ausdrücken, daß<br />
wir sagen: Alles das hat als Naturrecht zu gelten, was objektiv<br />
rational, d. h. sachlich analysierbar ist. Ob es nun immer mög<br />
lich sein wird, auf rationalem Wege die an sich rationale,<br />
genauer gesagt, rationable <strong>und</strong> intelligible, weil sachlich vorlie<br />
gen<strong>de</strong>, <strong>Recht</strong>slage zu analysieren, ist eine an<strong>de</strong>re Frage. Thomas<br />
selbst hat (I—II 94,4; DT, Bd. 13) verschie<strong>de</strong>ne Stufen <strong>de</strong>r<br />
275
57. 2 Erkennbarkeit <strong>de</strong>s Naturgesetzes unterschie<strong>de</strong>n: einmal die all<br />
gemeinen Prinzipien, die von allen leicht erkannt wer<strong>de</strong>n kön<br />
nen; dann die vielfältigen, daraus erschlossenen For<strong>de</strong>rungen,<br />
die erfahrungsgemäß vielen verborgen bleiben. Tatsächlich wird<br />
die objektiv an sich erkennbare Inhaltlichkeit <strong>de</strong>r Natursachlage<br />
von unserer Seite oft nur durch eine entsprechend ethisch unter<br />
baute Ratio erschlossen. Wir kommen also <strong>de</strong>m nahe, was die<br />
mo<strong>de</strong>rne Philosophie Werterkenntnis nennt, wenngleich bei<br />
Thomas diese Werterkenntnis eine etwas an<strong>de</strong>re Struktur zeigt,<br />
als es im mo<strong>de</strong>rnen Denken <strong>de</strong>r Fall ist.<br />
Thomas hält also daran fest: Es gibt ein Naturrecht, das kon<br />
kret als solches formuliert wer<strong>de</strong>n kann. Und da <strong>Recht</strong> immer<br />
ein konkreter Bestand ist, ist Natur-<strong>Recht</strong> immer mit konkre<br />
ter Inhaltlichkeit gefüllt. Darin gera<strong>de</strong> liegt einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<br />
<strong>de</strong>n Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Gesetz. Das<br />
Gesetz kann sich in allgemeinen Normen bewegen, während<br />
das <strong>Recht</strong> eben wesentlich eine Situation im Hier <strong>und</strong> Jetzt ent<br />
schei<strong>de</strong>t. Es wäre daher an <strong>de</strong>r Zeit, daß die Naturrechts<strong>de</strong>nker,<br />
die sich auf Thomas berufen, diesen Unterschied zwischen<br />
Naturgesetz <strong>und</strong> Naturrecht voll <strong>und</strong> ganz ernstnehmen<br />
wür<strong>de</strong>n.<br />
Dem mo<strong>de</strong>rnen <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nken kommt diese konkrete Sicht<br />
<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, wie bereits gesagt, sehr entgegen. Nur <strong>de</strong>r Positivis<br />
mus sieht die Gestaltungsursache dieses konkreten <strong>Recht</strong>s<br />
nicht in <strong>de</strong>r Natur, son<strong>de</strong>rn allein in <strong>de</strong>r positiven Setzung. Das<br />
positive Gesetz ist aber noch weit entfernt vom konkreten<br />
<strong>Recht</strong> im Hier <strong>und</strong> Jetzt. Darum hatte die Freirechtsschule die<br />
eigentliche <strong>Recht</strong>sbildung in <strong>de</strong>n richterlichen Spruch verlegt.<br />
Immerhin wur<strong>de</strong> im europäischen Positivismus noch ein Weg<br />
gesucht von irgendwelchen übergeordneten Normen zur kon<br />
kreten <strong>Recht</strong>ssetzung. Auch Kelsen, <strong>de</strong>r konsequenteste Positi<br />
vist, geht von einem Normensystem aus. Um das <strong>Recht</strong> noch<br />
als konkreten Entscheid zu retten, zieht auch er <strong>de</strong>n rechts er<br />
zeugen<strong>de</strong>n Prozeß folgerichtig durch bis in das richterliche<br />
Urteil. Dagegen gibt es gemäß <strong>de</strong>m vom Darwinismus stark<br />
beeinflußten Amerikaner Oliver Wen<strong>de</strong>il Holmes überhaupt<br />
kein geschlossenes <strong>Recht</strong>ssystem mehr. Im gleichen Materialis<br />
mus bewegen sich die Amerikaner J.Frank, Th.W.Arnold,<br />
EdwinN. Garlan. Hier heißt es: <strong>Recht</strong> ist; es wird also eigent<br />
lich nicht; <strong>und</strong> zwar ist es je<strong>de</strong>smal neu im Urteilsspruch <strong>de</strong>s<br />
Richters.<br />
276
Im Hinblick auf die konkrete Formung <strong>de</strong>s Naturrechts 57. 2<br />
kann es dann nicht mehr w<strong>und</strong>ernehmen, wenn Thomas (Art. 2<br />
Zu 1) erklärt: „Die Natur <strong>de</strong>s Menschen ist verän<strong>de</strong>rlich". Die<br />
Sachlage än<strong>de</strong>rt sich nach <strong>de</strong>n konkrten Umstän<strong>de</strong>n. Die allge<br />
meinen Normen gehören zum Gesetz. Sie sind <strong>de</strong>m konkreten<br />
<strong>Recht</strong> einverleibt. Dennoch aber sind sie mit diesem nicht i<strong>de</strong>n<br />
tisch, sonst wür<strong>de</strong>n sie ihre Allgemeinheit <strong>und</strong> Unverän<strong>de</strong>rlich-<br />
keit verlieren.<br />
Damit läßt sich das Naturrecht, also das, was konkret von<br />
Natur recht ist, als ein Sollen erkennen, das in sich vielschichtig<br />
ist. Es sind darin die Normen enthalten, die, mit einem konkre<br />
ten Sachverhalt zusammengebracht, eben das <strong>Recht</strong> ergeben.<br />
Und das alles soll, wie Thomas im zweiten Artikel erklärt, ohne<br />
Dazwischentreten irgen<strong>de</strong>iner positiven Gesetzesgewalt ge<br />
schehen, so daß das Naturrecht seine Existenz einem, wenn<br />
man so sagen darf, „Naturprozeß" verdankt. Damit sind wir<br />
beim Kern <strong>de</strong>r thomasischen Naturrechtslehre angelangt. Um<br />
seinen Inhalt aufzubrechen <strong>und</strong> in seiner Be<strong>de</strong>utung für uns<br />
heute erst richtig zu erkennen, bringen wir die thomasische<br />
Naturrechtslehre mit <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen <strong>Recht</strong>sphilosophie in Ver<br />
gleich.<br />
2. DIE NATURRECHTS LEHRE DES HL. THOMAS UND DIE DER<br />
MODERNEN RECHTSPHILOSOPHIE 6<br />
a) Die Normen <strong>de</strong>s Naturrechts<br />
Thomas anerkennt, wie gesagt, trotz <strong>de</strong>r konkreten Fassung<br />
<strong>de</strong>s Naturrechts allgemeine Naturrechtsprinzipien. So spricht<br />
er in Art. 2 Zu 2 von einem „Wi<strong>de</strong>rspruch an sich", <strong>de</strong>n eine<br />
<strong>Recht</strong>sbehauptung besagt, z. B. ist die Behauptung, <strong>de</strong>r Dieb<br />
stahl sei erlaubt, in sich ein Wi<strong>de</strong>rspruch, weil das Wesen <strong>de</strong>s<br />
Diebstahls immer <strong>und</strong> überall <strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>sprinzipien wi<strong>de</strong>r<br />
spricht (a. a. 0.). Die mo<strong>de</strong>rne Scholastik bezeichnet durchweg<br />
dieses An-sich als „das Naturrecht" <strong>und</strong> sieht in <strong>de</strong>r konkreten<br />
6 Die umfangreiche Literatur zu diesem Thema habe ich besprochen in: Die<br />
Neue Ordnung 5 (1951) 201-219,313-329. Eine erweiterte Besprechung in<br />
Bulletin Thomiste 8 (1947/53) 650—664. Weitere Literaturangaben in<br />
A.F. Utz, Sozialethik,Teil II: <strong>Recht</strong>sphilosophie; ebenso in <strong>de</strong>rs., Bibliographie<br />
<strong>de</strong>r Sozialethik (11 B<strong>de</strong>) unter II. 10.3.<br />
277
57. 2 Formulierung nur mehr eine Anwendung <strong>de</strong>s Naturrechts. So<br />
meint z.B./. Messner (Das Naturrecht. 1950, 345): „Im Natur<br />
recht ist in <strong>de</strong>r Tat nur ein Gr<strong>und</strong>riß von <strong>Recht</strong>sbeziehungen<br />
gegeben, alles übrige ist <strong>de</strong>m Willen <strong>de</strong>r Gesellschaftsmitglie<strong>de</strong>r<br />
überlassen, sobald die Demokratie rechtmäßige Staatsform<br />
gewor<strong>de</strong>n ist". Thomas hätte diese Formulierung nicht<br />
gebracht. Er hätte im entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Teil <strong>de</strong>s zitierten Textes<br />
gesagt: „alles übrige ist <strong>de</strong>r Vernunft überlassen..." In <strong>de</strong>r neue<br />
sten, 7. Auflage (1984, 623) ist dieser Text allerdings geän<strong>de</strong>rt<br />
wor<strong>de</strong>n im Hinblick auf die staatliche Verfassung. Die Vernunft<br />
ist das Maßgeben<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>s Sachbereichs. So weit sie<br />
dringt, ebenso weit dringt das Naturrecht. Wo <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rne<br />
Scholastiker schon eine willentliche, interessenmäßige Anwen<br />
dung <strong>de</strong>s Naturrechts (bei Thomas <strong>de</strong>r Naturrechtsprinzipien)<br />
sehen möchte, da sieht Thomas noch Vernunft. Allerdings aner<br />
kennt er, wie aus <strong>de</strong>m zweiten Artikel ersichtlich ist, auch die<br />
rein willensmäßige Festlegung. Jedoch hat diese bei Thomas<br />
nicht <strong>de</strong>n Raum wie im Denken <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Scholastiker.<br />
Freilich behält Messner im Hinblick auf die mo<strong>de</strong>rne Gesell<br />
schaft, in <strong>de</strong>r eine allgemeingültige Vernunft nicht mehr aner<br />
kannt wird, <strong>de</strong>nnoch <strong>Recht</strong>. In <strong>de</strong>r gr<strong>und</strong>sätzlichen Schau aber<br />
ist Thomas beizupflichten, sofern man <strong>de</strong>m thomasischen<br />
Erkenntnisoptimismus folgt, gemäß <strong>de</strong>m die menschliche Ver<br />
nunft fähig genug ist, eine konkrete Sachanalyse vorzunehmen,<br />
ohne voreilig zu rein willentlicher Festlegung zu greifen. Die<br />
protestantische Naturrechtsauffassung krankt eben daran, daß<br />
sie <strong>de</strong>r menschlichen Vernunft um <strong>de</strong>r Erbsün<strong>de</strong> willen kaum<br />
Vertrauen o<strong>de</strong>r teilweise sogar in je<strong>de</strong>r Hinsicht Mißtrauen ent<br />
gegenbringt <strong>und</strong> so zu einem übernatürlichen Erkenntnisprin<br />
zip, nämlich <strong>de</strong>m Glauben, als <strong>de</strong>m einzigen Maßstab <strong>de</strong>s<br />
Naturrechts greifen muß (vgl. E. Brunner, <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Zürich 1943).<br />
Auch außerhalb <strong>de</strong>r Scholastik läßt sich heute, so vor allem<br />
im Arbeitsrecht 7 , ein starker Ruf nach naturrechtlicher F<strong>und</strong>ie<br />
rung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s erkennen. Die Wandlung, welche die <strong>Recht</strong>s<br />
philosophie durch die Abkehr vom Positivismus <strong>und</strong> die Hin<br />
wendung zum Naturrechts<strong>de</strong>nken durchmacht, darf aber durch<br />
aus nicht in übereiltem Optimismus als eine Rückkehr zur<br />
christlichen Naturrechtslehre ge<strong>de</strong>utet wer<strong>de</strong>n. Zwar wer<strong>de</strong>n<br />
278<br />
Vgl. auch <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Fußnote 6 angegebenen Artikel <strong>de</strong>r Neuen Ordnung.
Normen proklamiert, gemäß <strong>de</strong>nen sich das konkrete <strong>Recht</strong> zu 57. 2<br />
bil<strong>de</strong>n habe. Und diese Normen wer<strong>de</strong>n als Naturrechtsnor<br />
men bezeichnet. Es ist aber sorgsam zu untersuchen, ob es sich<br />
wirklich um Naturrechtsnormen han<strong>de</strong>lt o<strong>de</strong>r schließlich doch<br />
nur um „das richtige <strong>Recht</strong>" Stammlers, „das Kulturrecht" Koh<br />
lers, „die apriorischen Gr<strong>und</strong>lagen" Reinachs, „das autonome<br />
<strong>Recht</strong>" o<strong>de</strong>r „die Autonomie <strong>de</strong>s Gewissens" Laims. W. G. Bek-<br />
ker* glaubt — wenn auch in sehr eigenwilliger Weise — nicht<br />
weniger als sechs Definitionen <strong>de</strong>s Naturrechts zusammen<br />
stellen zu können. Man scheut sich nicht, von Naturrecht zu<br />
sprechen <strong>und</strong> dabei im Neukantianismus steckenzubleiben. Wer<br />
die Geschichte <strong>de</strong>s Naturrechts von <strong>de</strong>r Stoa bis in die Neuzeit<br />
verfolgt, dürfte über die Vielgestalt <strong>de</strong>s Begriffs „Naturrecht"<br />
nicht mehr im Zweifel sein.<br />
Das Entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> für eine naturrechtliche Auffassung <strong>de</strong>r<br />
<strong>Recht</strong>snormen ist, daß diese Normen wirklich als gültige Nor<br />
men konkreten <strong>Recht</strong>s anerkannt wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> nicht nur als<br />
metajuristische Kategorien, die in irgen<strong>de</strong>iner Weise für die<br />
<strong>Recht</strong>sbildung als notwendig bezeichnet wer<strong>de</strong>n. Auch <strong>de</strong>r<br />
Positivismus hat Normen <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sbildung verlangt, abge<br />
sehen vielleicht von <strong>de</strong>m materialistischen Suprarealismus ame<br />
rikanischer <strong>Recht</strong>sphilosophen. Man wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Positivisten<br />
Unrecht tun, wollte man ihm vorwerfen, er leugne <strong>de</strong>n wirkli<br />
chen Einfluß irgendwelcher Naturrechtsi<strong>de</strong>en von seiten <strong>de</strong>r<br />
Menschen, die das <strong>Recht</strong> gestalten. Nach ihm ist es durchaus<br />
möglich, daß eine Gesellschaft, die überwiegend naturrechtlich<br />
<strong>de</strong>nkt, auf Gr<strong>und</strong> dieser soziologischen Struktur <strong>de</strong>n Inhalt <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s im Sinne <strong>de</strong>s Naturrechts gestaltet. Für <strong>de</strong>n Positivisten<br />
sind aber diese Entstehungsgrün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, also alle sittli<br />
chen <strong>und</strong> politischen Absichten, die etwa zur <strong>Recht</strong>schaffung<br />
führen können, außerrechtlich, ohne je<strong>de</strong> rechtliche Bewandt<br />
nis. Sie sind einfach Daten, die zur <strong>Recht</strong>sbildung führen, die<br />
politisch sogar gefor<strong>de</strong>rt sind, mit „<strong>Recht</strong>" aber nichts zu tun<br />
haben, d. h. keine rechtlichen Sollenssätze darstellen. Die tat<br />
sächliche Gültigkeit in einer konkreten Gesellschaft ist im<br />
<strong>Recht</strong> das Entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>. Alles an<strong>de</strong>re gehört in die <strong>Recht</strong>spoli<br />
tik.<br />
1 WG. Becker, Die symptomatische Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Naturrechts im Rahmen<br />
<strong>de</strong>s bürgerlichen <strong>Recht</strong>s. In: Archiv für die zivilistische Praxis 150 (1948) 97—<br />
130. Vgl. ebenso E.Wolf, Das Problem <strong>de</strong>r Naturrechtslehre, Karlsruhe 1964,<br />
bes. 193-201. A.Elitz, Sozialethik, Teil II: <strong>Recht</strong>sphilosophie, 119-124.<br />
279
57. 2 Nicht viel an<strong>de</strong>rs verhält es sich mit <strong>de</strong>n meisten mo<strong>de</strong>rnen<br />
Verteidigern <strong>de</strong>s Naturrechts. Wer die <strong>Recht</strong>snorm zwar als<br />
einen — wenn auch noch so starken — rechtsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Faktor<br />
auffaßt, in ihr aber nur die Bedingung für richtiges <strong>Recht</strong> aner<br />
kennt, kann nicht als Vertreter <strong>de</strong>r Naturrechtslehre angesehen<br />
wer<strong>de</strong>n. Stammler mit seinem „richtigen <strong>Recht</strong>" als einen Ver<br />
fechter <strong>de</strong>s Naturrechts zu bezeichnen, wäre daher höchst irr<br />
tümlich. Becker (a. a. 0.117) hat die Wahrheit getroffen, wenn er<br />
sagt, daß Stammler durchaus Positivist im technischen Sinne sei.<br />
Auf folgen<strong>de</strong>s kommt es an: Eine echte Naturrechtslehre aner<br />
kennt reale, allgemeingültige Normen, die aus sich, ohne Rück<br />
griff auf die bestehen<strong>de</strong> Gesellschaft, konkret rechtliche Aner<br />
kennung for<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> darum in <strong>de</strong>r durch die Vernunft (nicht<br />
<strong>de</strong>n Willen) vorgenommenen Konkretisierung <strong>Recht</strong> sind.<br />
Von <strong>de</strong>n „realen, allgemeingültigen Normen" ist hier zu<br />
nächst die Re<strong>de</strong>. Es han<strong>de</strong>lt sich hierbei um die For<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>r Naturrechtsprinzipien an die lex ferenda, an das erst in <strong>de</strong>r<br />
Bildung begriffene <strong>Recht</strong>. Die Konkretisierung durch die Ver<br />
nunft kommt nachher zur Sprache. Es geht dann dort um <strong>de</strong>n<br />
rechtslogischen Prozeß, mit Hilfe <strong>de</strong>ssen Naturrecht gebil<strong>de</strong>t<br />
wird.<br />
Becker (a. a. 0.121) unterschei<strong>de</strong>t das Naturrecht im direkten<br />
Sinne (sensu proprio) vom Naturrecht im symptomatischen<br />
Sinne (sensu symbolico o<strong>de</strong>r allegorico). Unter <strong>de</strong>m Natur<br />
recht im direkten Sinne versteht er die Naturrechtsnormen, wie<br />
sie von Thomas als rechtliche For<strong>de</strong>rungen an das zu bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
<strong>Recht</strong> aufgefaßt wer<strong>de</strong>n. Er nennt diese Art, das Naturrecht zu<br />
sehen, einen „naiven Naturrechtsbegriff". Nach Becker ist<br />
Naturrecht nur haltbar als ein symbolischer Begriff, <strong>de</strong>r unmit<br />
telbar mit <strong>de</strong>r Natur als solcher nichts zu tun hat. In dieser Fas<br />
sung ist Naturrecht „ein Inbegriff von historisch geschehenen,<br />
positiv registrierbaren, in <strong>Recht</strong>sakten zum Ausdruck gelan<br />
gen<strong>de</strong>n Erkenntnissen von Menschen, welche von <strong>de</strong>m Gedan<br />
ken einer effektiven <strong>Recht</strong>sbesserung motiviert <strong>und</strong> dirigiert<br />
sind, damit von <strong>de</strong>m Bedürfnis, ein nach logischen <strong>und</strong> ethi<br />
schen Maßstäben unbefriedigen<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong> ohne Rücksicht auf<br />
seine staatliche Sanktionierung bei seiner konkreten Anwen<br />
dung durch die dazu berufenen Menschen nur in verbesserter<br />
<strong>und</strong> befriedigen<strong>de</strong>r Gestalt zur Wirkung gelangen zu lassen"<br />
(a. a. 0.). Es han<strong>de</strong>lt sich hierbei nicht um eine <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Vernunft <strong>und</strong> erst recht nicht <strong>de</strong>m menschlichen Werterleben<br />
280
vorgegebene Norm in Sinn <strong>de</strong>r überzeitlichen natura humana, 57. 2<br />
son<strong>de</strong>rn lediglich um die am gesellschaftlichen Leben gemes<br />
sene, aus ihm erst entstehen<strong>de</strong> <strong>Recht</strong>sauffassung. <strong>Recht</strong>sbesse<br />
rung ist also nach Becker, <strong>de</strong>r Stärkstens von Stammler <strong>und</strong> teil<br />
weise von Kierkegaard beeinflußt ist, keine Besserung gemäß<br />
Annäherung an eine objektive, von <strong>de</strong>m menschlichen Wollen<br />
unabhängige Normenordnung, son<strong>de</strong>rn nichts an<strong>de</strong>res als eine<br />
von <strong>de</strong>n konkret leben<strong>de</strong>n Menschen gewertete Lebensord<br />
nung. Die Naturrechtsordnung ist so eine Ordnung <strong>de</strong>r „norma<br />
len" — richtiger wäre es zu sagen: <strong>de</strong>r durchschnittlich leben<strong>de</strong>n<br />
— Menschen in <strong>de</strong>r Gesellschaft, im Gr<strong>und</strong>e: <strong>de</strong>r Mehrheit im<br />
formal<strong>de</strong>mokratischen Sinn.<br />
Der Begriff <strong>de</strong>r Natur wird also aus <strong>de</strong>m „naiven Realismus"<br />
<strong>de</strong>r philosophischen Abstraktion in die konkrete Willensord<br />
nung verlagert. Allerdings ist auch diese Natur in gewissem<br />
Sinn eine vorgegebene Größe, vorgegeben aber nicht als on-<br />
tisch-metaphysische Realität, son<strong>de</strong>rn als soziologischer<br />
Bef<strong>und</strong>. Ähnlich ist auch <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r „conscientia", <strong>de</strong>s<br />
Gewissens, umge<strong>de</strong>utet. Conscientia ist nicht mehr das prak<br />
tische Wissen um die Verwirklichung ewiger Normen, son<strong>de</strong>rn<br />
ein con-scire, ein Wissen mit an<strong>de</strong>ren zusammen um gemein<br />
sam erkannte Gr<strong>und</strong>sollenssätze. Ein solches Naturrecht ent<br />
spricht in etwa <strong>de</strong>r „kommunikativen Kompetenz" bei/. Haber<br />
mas?<br />
Die Verlagerung <strong>de</strong>s Begriffs „Natur" ist bezeichnend für die<br />
gesamte Naturrechtsauffassung unserer Tage. Wer „Natur" nur<br />
im Sinn <strong>de</strong>s realistischen Optimismus <strong>de</strong>r Erkenntnis zu neh<br />
men gewohnt ist, wird durch die stets anwachsen<strong>de</strong> Natur<br />
rechtsliteratur geblen<strong>de</strong>t <strong>und</strong> zur Annahme verleitet, es voll<br />
ziehe sich heute eine allgemeine Rückkehr zur alten Natur<br />
rechtsauffassung <strong>de</strong>s hl. Thomas. Bei Ed. Spranger 10 ist <strong>de</strong>r Cha<br />
rakter <strong>de</strong>s Universalen <strong>de</strong>rart außer Kraft gesetzt, daß das<br />
Naturrecht im Sinn einer ewig gelten<strong>de</strong>n Norm ausdrücklich<br />
als „Utopie" bezeichnet wird, da es für neu auftreten<strong>de</strong> kritische<br />
Situationen keine bestimmten Anwendungen enthalte. Das<br />
Naturrecht, das jeweils in Kraft sein mag, wird nur im Sinn<br />
einer Zukunftsnorm anerkannt, d. h. im zeitlichen Fluß <strong>de</strong>rTra-<br />
9 /. Habermai, Vorbereiten<strong>de</strong> Bemerkungen zu einer Theorie <strong>de</strong>r kommunikativen<br />
Kompetenz, in: J. Habermas/N. Luhmann, Theorie <strong>de</strong>r Gesellschaft<br />
o<strong>de</strong>r Sozialtechnologie — Was leistet die Systemforschung?, 101—141.<br />
1 0 E. Spranger, Zur Frage <strong>de</strong>s Naturrechts, in: Universitas 3 (1948) 405—420.<br />
281
57. 2 dition, <strong>und</strong> zwar hier nur richtunggebend auf das Kommen<strong>de</strong><br />
hin. Wir begegnen hier einer existentiellen <strong>Recht</strong>sphilosophie,<br />
wie sie auch <strong>de</strong>r bereits zitierte Autor Beyer vertritt.<br />
Immerhin wirken in <strong>de</strong>r heutigen Naturrechtsauffassung<br />
noch stark einige Überreste <strong>de</strong>r christlichen Tradition <strong>und</strong> vor<br />
allem auch die auf <strong>de</strong>n jüngsten Bankrott <strong>de</strong>s Positivismus<br />
erfolgte Neubesinnung auf die ursprünglichen <strong>Recht</strong>san<br />
sprüche <strong>de</strong>s Menschen, so daß sich die Ergebnisse dieses heuti<br />
gen „versubjektivierten" Naturrechts oft in auffallen<strong>de</strong>r Ähn<br />
lichkeit mit <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r alten christlichen Naturrechtslehre tref<br />
fen.<br />
Dasjenige, woran eigentlich die mo<strong>de</strong>rnste Naturrechtsauf<br />
fassung, soweit sie sich nicht in <strong>de</strong>n Bahnen <strong>de</strong>r thomistischen<br />
Tradition bewegt, Anstoß nimmt, ist <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r „vorstaatli<br />
chen" <strong>Recht</strong>e. Das <strong>Recht</strong> kann man sich nach mo<strong>de</strong>rner An<br />
schauung nur in <strong>de</strong>r existenten Gesellschaft vorstellen, <strong>und</strong><br />
auch da nur, insofern diese organisiert ist. Die Gesellschaft wird<br />
ihrerseits durch an<strong>de</strong>re Motive als die <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s aufgerufen,<br />
sich <strong>de</strong>r menschlichen Lebenswerte bewußt zu sein <strong>und</strong> ihnen<br />
entsprechend <strong>Recht</strong>spolitik zu betreiben zur Schaffung <strong>de</strong>s<br />
„richtigen" <strong>Recht</strong>s. So kommt man heute durchweg auf die<br />
Werte als Normen von zu bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>m <strong>Recht</strong>. Und zwar sind<br />
diese Werte in ihrer Allgemeingültigkeit <strong>und</strong> Allgemeinver<br />
pflichtung anerkannt. Der Gedanke J.Tammelos 1 , daß die<br />
<strong>Recht</strong>snorm jeweils nur <strong>de</strong>m Forscher intuitiv gegeben sei,<br />
nähert sich stark einem individualistischen Wert<strong>de</strong>nken.<br />
Im weitaus größeren Teil <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Literatur ist Vorfeld<br />
<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s das Feld <strong>de</strong>r Werte im Sinne <strong>de</strong>r materiellen Werte<br />
M. Schelers <strong>und</strong> N. Hartmanns. Ph. Heck hatte in seinem um<br />
strittenen Buch „Begriffs- <strong>und</strong> Interessenjurispru<strong>de</strong>nz" (1932)<br />
die Notwendigkeit einer Wertforschung, also einer Wertlehre,<br />
für die <strong>Recht</strong>swissenschaft verteidigt. Dabei aber verwies er<br />
diese Wertforschung in die <strong>Recht</strong>sphilosophie, die ihm keine<br />
Wissenschaft vom <strong>Recht</strong>, son<strong>de</strong>rn eine „Vorwissenschaft" ist.<br />
Die Literatur <strong>de</strong>r Nachkriegszeit legt Gewicht darauf, diese<br />
Wertforschung, wie sie für die <strong>Recht</strong>sbildung von Be<strong>de</strong>utung<br />
ist, nicht mehr in <strong>de</strong>n Vorhof <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>swissenschaft zu verwei<br />
sen, son<strong>de</strong>rn sie unmittelbar als Gegenstand <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>swissen<br />
schaft anzuerkennen. Ob aber diese Annäherung an altes<br />
11 J.Tammelo, Untersuchungen zum Wesen <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>snorm. 1947.<br />
282
Naturrechts<strong>de</strong>nken wirklich so viel be<strong>de</strong>utet, wie es <strong>de</strong>n 57. 2<br />
Anschein hat?<br />
H. Mitteis 12 hebt als einen zentralen Wert das Ethos <strong>de</strong>r Persönlichkeit<br />
hervor. Im selben Sinne fin<strong>de</strong>n wir bei H. Coing 13<br />
dieses Persönlichkeitsi<strong>de</strong>al als einen Gr<strong>und</strong>ton <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnen<br />
<strong>Recht</strong>sempfin<strong>de</strong>ns. Durchweg hat man sich damit abgef<strong>und</strong>en,<br />
<strong>und</strong> mehr als das, man hat es sogar befürwortet, daß die morali<br />
schen Kategorien zu <strong>de</strong>n rechtsbestimmen<strong>de</strong>n Faktoren gehören.<br />
So auch, nach langer Entwicklung, selbst G. Radbruch.<br />
Und doch sind diese Werte nicht eigentlich aus sich <strong>Recht</strong>s<br />
normen; <strong>de</strong>r Weg von <strong>de</strong>r Moral o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Werten geht nicht<br />
direkt zum Inhalt <strong>de</strong>ssen, was <strong>Recht</strong> sein soll, son<strong>de</strong>rn über das<br />
<strong>Recht</strong>sbewußtsein <strong>de</strong>r Gesellschaft; nicht <strong>de</strong>r objektive Wert als<br />
solcher hat rechtsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>und</strong> rechtserzeugen<strong>de</strong> Kraft, son<br />
<strong>de</strong>rn nur das Bewußtsein von diesen Werten, <strong>und</strong> zwar das<br />
Bewußtsein, sofern es sich in <strong>de</strong>r Gesellschaft ausbreitet. Auch<br />
bei Thomas begegnen wir etwas Ähnlichem, insofern nicht <strong>de</strong>r<br />
Inhalt aus sich die Bewandtnis <strong>de</strong>s Sollens hat, son<strong>de</strong>rn nur,<br />
insofern er ins menschliche Bewußtsein eintritt <strong>und</strong> von diesem<br />
als For<strong>de</strong>rung gestellt wird. Wir wer<strong>de</strong>n darauf noch bei <strong>de</strong>r<br />
Besprechung <strong>de</strong>s rechtslogischen Prozesses zurückkommen.<br />
Aber Thomas erkennt in diesem Bewußtsein noch eine allge<br />
meingültige menschliche Vernunft <strong>und</strong> nicht bloß ein Wertge<br />
fühl. In <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen <strong>Recht</strong>sphilosophie wer<strong>de</strong>n aber die<br />
Werte als <strong>Recht</strong>snormen nivelliert entsprechend <strong>de</strong>m Kultur-<br />
<strong>und</strong> Moralniveau <strong>de</strong>r Gesellschaft. Im Gr<strong>und</strong>e genommen<br />
kommt man also auf die alten Auffassungen vom <strong>Recht</strong>sgefühl<br />
zurück. Die Ethik wird im <strong>Recht</strong>sbereich zu <strong>de</strong>m, was die<br />
Gemeinschaft als solche empfin<strong>de</strong>t, entsprechend <strong>de</strong>r Defini<br />
tion <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, das nichts an<strong>de</strong>res als „eine soziale Frie<strong>de</strong>ns<br />
ordnung" sein soll, <strong>und</strong> zwar eine Frie<strong>de</strong>nsordnung <strong>de</strong>r exi<br />
stenten Gesellschaft, wie sie augenblicklich <strong>de</strong>nkt <strong>und</strong> fühlt.<br />
Diese Nivellierung <strong>de</strong>r Ethik im Bereich <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>snormen<br />
<strong>und</strong> entsprechend die Verbannung <strong>de</strong>r Ethik aus <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong><br />
selbst haben nicht zuletzt ihren Gr<strong>und</strong> in <strong>de</strong>r inhaltlich völlig<br />
entleerten Fassung <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>snorm. Aus <strong>de</strong>m i<strong>de</strong>alistischen Be-<br />
1 2 H. Mitteis, Über das Naturrecht. Deutsche Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften zu<br />
Berlin, Vorträge <strong>und</strong> Schriften, Heft 26, 1948.<br />
13 H. Coing, Die obersten Gr<strong>und</strong>sätze <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. Ein Versuch <strong>de</strong>r Neubegründung<br />
<strong>de</strong>s Naturrechts. Schriften <strong>de</strong>r „Süd<strong>de</strong>utschen Juristenzeitung", Heft 4,<br />
1947.<br />
283
57. 2 griff <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> wer<strong>de</strong>n die Achtung vor <strong>de</strong>r Persönlich<br />
keit sowie die verschie<strong>de</strong>nen <strong>Recht</strong>snormen abgeleitet. Es<br />
bedarf also einer ganz bestimmten <strong>und</strong> vorgefaßten I<strong>de</strong>e <strong>und</strong><br />
Wertempfindung, wenn man aus <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> die verschie<br />
<strong>de</strong>nen Menschenrechte ableiten will. Im Gr<strong>und</strong>e han<strong>de</strong>lt es sich<br />
daher nicht um eine Analyse <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Wesen <strong>de</strong>s Menschen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft entnommenen I<strong>de</strong>e „Gerechtig<br />
keit", son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Wertempfin<strong>de</strong>ns in bezug auf die Gerechtig<br />
keit. Bereits die oberste <strong>Recht</strong>snorm läßt wegen ihrer kategoria-<br />
len Leere eine verschie<strong>de</strong>ne Aus<strong>de</strong>utung im konkreten <strong>Recht</strong>s<br />
empfin<strong>de</strong>n zu, so daß es nur an<strong>de</strong>rer Menschen mit an<strong>de</strong>rer<br />
Erziehung <strong>und</strong> an<strong>de</strong>ren Erfahrungen bedarf, um sogleich einen<br />
Wan<strong>de</strong>l in <strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>snormen <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Folge im <strong>Recht</strong> herbei<br />
zuführen.<br />
Doch sei nicht verschwiegen, daß die Scholastik selbst Anlaß<br />
zu einer solch entleerten Auffassung <strong>de</strong>s obersten Gerechtig<br />
keitsbegriffs gibt. Aus <strong>de</strong>n Erörterungen <strong>de</strong>r Scholastiker über<br />
das Prinzip „Je<strong>de</strong>m das Seine geben" gewinnt man leicht <strong>de</strong>n<br />
Eindruck einer formalen Kategorie. Dieser Eindruck wird noch<br />
dadurch verstärkt, daß die Scholastik nur das allgemeinste Prin<br />
zip „Das Gute ist zu tun, das Böse zu mei<strong>de</strong>n" <strong>und</strong> ähnliche<br />
Formulierungen, wie „<strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn nichts Böses zufügen", als<br />
eigentlich allgemeingültige Normen hinstellte, während die<br />
Ableitungen schon nicht mehr diese Unabän<strong>de</strong>rlichkeit aufwei<br />
sen, so daß man von Naturrechtsprinzipien her sowohl auf die<br />
Monogamie wie auch auf die Polygamie schließen konnte. 14<br />
Thomas hatte zwei Arten von Naturrechtsprinzipien unter<br />
schie<strong>de</strong>n: allgemeinste <strong>und</strong> zweitrangige (I—II 94,5). Die allge<br />
meinen, unter <strong>de</strong>nen sich z. B. auch das Prinzip <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit fin<strong>de</strong>t: „Je<strong>de</strong>m das Seine geben, nieman<strong>de</strong>m das Seinige<br />
nehmen", erinnern sehr stark an <strong>de</strong>n neukantianischen Norm<br />
begriff. Gera<strong>de</strong> dies ist es wahrscheinlich auch, was <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>r<br />
nen <strong>Recht</strong>sphilosophie bei Thomas so gefällt <strong>und</strong> sie anzieht.<br />
Selbst ein Positivist wie <strong>de</strong>r Amerikaner Jerome Frank zollt Tho<br />
mas v. Aquin das unerhört schmeicheln<strong>de</strong> Lob: „Ich verstehe<br />
nicht, wie irgen<strong>de</strong>in vernünftiger <strong>und</strong> gesitteter Mensch heute<br />
es ablehnen kann, die Gr<strong>und</strong>prinzipien <strong>de</strong>s Naturrechts bezüg<br />
lich <strong>de</strong>s menschlichen Verhaltens, wie sie Thomas v. Aquin fest-<br />
14 Vgl. C.R.Billuart, Summa S.Th., T.IV., Tract.<strong>de</strong>leg., Diss.II, Art.IV.<br />
284
gestellt hat, als Gr<strong>und</strong>lage <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Kultur anzuerken- 57. 2<br />
nen". 15<br />
Das Lob steht durchaus zurecht, aber nicht in <strong>de</strong>m Sinne,<br />
wie es etwa die i<strong>de</strong>alistische o<strong>de</strong>r positivistische <strong>Recht</strong>sphiloso<br />
phie meint. Die ungeheure Weite <strong>und</strong> Wan<strong>de</strong>lbarkeit, die Tho<br />
mas <strong>de</strong>n Naturrechtsnormen zuerkennt, ist alles an<strong>de</strong>re als <strong>de</strong>r<br />
Ausdruck einer Naturrechtsauffassung im Sinne <strong>de</strong>r Lehre vom<br />
Wertempfin<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Wertgefühl. Thomas spricht an jener Stelle<br />
vom sittlichen Teil <strong>de</strong>r Naturgesetze <strong>und</strong> meint, daß die sittliche<br />
Verantwortung in <strong>de</strong>m Maße abnimmt, in welchem man die<br />
Normen nicht mehr mit Sicherheit erkennt. Natürlich ist dann<br />
auch die Gesellschaft sittlich nicht gehalten, diese Prinzipien in<br />
ihrer vollgültigen objektiven Werthaftigkeit zu ihren <strong>Recht</strong>snor<br />
men zu erklären. Hier ist darum auch die Stelle, an <strong>de</strong>r von Tho<br />
mas her <strong>de</strong>r Zugang zu <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Lehre vom soziologi<br />
schen Wertgefühl als <strong>de</strong>m rechtsformen<strong>de</strong>n Faktor gef<strong>und</strong>en<br />
wer<strong>de</strong>n kann. 16 Es wäre aber gr<strong>und</strong>falsch, die Naturrechtsprin<br />
zipien ihrer absoluten Normkraft entklei<strong>de</strong>n zu wollen. Diese<br />
absolute Normkraft läßt z.B. nicht zu, daß man mit manchen<br />
Scholastikern erklärt, Gott habe im Alten Testament von <strong>de</strong>r<br />
Monogamie „dispensiert". Wenn die Monogamie wirklich eine<br />
naturrechtliche For<strong>de</strong>rung ist, dann gibt es keine Dispens. Es<br />
mag sein, daß die Erkenntnis einer solchen For<strong>de</strong>rung nicht<br />
einer je<strong>de</strong>n Menschheitsgruppe aufgeht. Darum gibt es eine sitt<br />
liche Entschuldigung für diese Menschen. Nie aber kann es eine<br />
objektive, wertmäßige Wandlung geben; darum auch kann die<br />
göttliche Autorität niemals dispensieren; sie kann einzig <strong>de</strong>n<br />
konkreten, sittlich entschuldbaren mißlichen Umstän<strong>de</strong>n Rech<br />
nung tragen, in<strong>de</strong>m sie <strong>de</strong>n objektiven Abfall nicht anrechnet.<br />
Die Scholastiker hätten klarer unterschei<strong>de</strong>n müssen zwischen<br />
<strong>de</strong>n (objektiv) rechtlichen Normen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Erkenntnis<br />
abhängigen sittlichen Verantwortung gegenüber diesen Nor<br />
men. Allein von <strong>de</strong>r Erkenntnisfähigkeit <strong>und</strong> <strong>de</strong>r dieser entspre<br />
chen<strong>de</strong>n sittlichen Verantwortung her spricht Thomas von <strong>de</strong>r<br />
Unterscheidung zwischen primären (allgemeinsten) <strong>und</strong><br />
15 J.Frank, Einleitung zur 6.Aufl. von „Law and the Mo<strong>de</strong>rn Mind", XVII.<br />
Zitiert nach H. Coing, in: Archivfür<strong>Recht</strong>s-<strong>und</strong> Sozialphilosophie 38 (1949/<br />
50) 554.<br />
1 6 Beispielhaft für die soziologische Sicht von <strong>Recht</strong>snormen: P.Trappe, Soziale<br />
Norm, Normalität <strong>und</strong> Wirklichkeit, in: P.Trappe, Kritischer Realismus in<br />
<strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>ssoziologie, Wiesba<strong>de</strong>n 1983, 67—84.<br />
285
57. 2 sek<strong>und</strong>ären Naturrechtsprinzipien. Für Thomas ist das Natur<br />
recht gr<strong>und</strong>sätzlich ein rational analysierbarer Sachverhalt, in<br />
welchen die unwan<strong>de</strong>lbaren Prinzipien (also die <strong>Recht</strong>snor<br />
men) verwoben sind.<br />
In<strong>de</strong>m die mo<strong>de</strong>rne <strong>Recht</strong>sphilosophie das Wertempfin<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft als die <strong>de</strong>m positiven Gesetz vorgeordnete<br />
<strong>Recht</strong>snorm bezeichnet, entfernt sie sich völlig vom eigentli<br />
chen Naturrechts<strong>de</strong>nken, sosehr sie vielleicht sich als solches<br />
ausgibt. Wenn man schon in das Wertbewußtsein <strong>de</strong>r Gesell<br />
schaft abgleitet, dann wäre es, um das kollektive Gewissen zu<br />
erforschen, schließlich das einzig Folgerichtige, mit Fr. W. Jeru<br />
salem 17 die Soziologie zu befragen, also mit Hilfe <strong>de</strong>r soziologi<br />
schen Metho<strong>de</strong> die Zweckmäßigkeit <strong>de</strong>r sozialen Wirklichkeit<br />
festzustellen <strong>und</strong> damit auch zu festen <strong>Recht</strong>ssprüchen zu<br />
gelangen. So allerdings wird die Soziologie „das Naturrecht<br />
unserer Zeit" 18 . Das Resultat solchen Naturrechts ist in <strong>de</strong>m<br />
Satz nie<strong>de</strong>rgelegt: „Entschei<strong>de</strong>nd ist nicht, daß diese Ergebnisse<br />
wahr sind, son<strong>de</strong>rn daß sie gelten, <strong>und</strong> zwar für die <strong>Recht</strong>sge<br />
meinschaft gelten, d.h. daß sie Bestandteil <strong>de</strong>s Geistes <strong>de</strong>r<br />
<strong>Recht</strong>sgemeinschaft <strong>und</strong> von diesem rezipiert o<strong>de</strong>r je<strong>de</strong>nfalls<br />
anerkannt sind bzw. anerkannt wer<strong>de</strong>n können". 19<br />
Von hier aus ist dann kein weiter Weg mehr zu Savignys<br />
Volksgeist, <strong>de</strong>m auch O. Veit 20 , selbst ein Verteidiger <strong>de</strong>r Natur<br />
rechtslehre, sich verschreibt. Damit aber sind wir beim ewigen<br />
Wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Vergehen <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>snormen (nicht etwa nur <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s, <strong>de</strong>m ja auch Thomas Wan<strong>de</strong>lbarkeit zuerkennt) ange<br />
langt, <strong>und</strong> wir könnten genau so gut mit <strong>de</strong>m Materialisten <strong>und</strong><br />
Marxisten H.J. Laski 21 die natürliche Ordnung, das Vorgege<br />
bene, das im Mittelalter <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r spanischen Tradition so hoch<br />
im Kurs stand, als in die wirtschaftliche Entwicklung verwoben<br />
ansehen <strong>und</strong> so <strong>de</strong>r „unabän<strong>de</strong>rlichen Verän<strong>de</strong>rung" die<br />
unwan<strong>de</strong>lbaren Naturrechtsprinzipien opfern.<br />
Entfernt man sich aber so weit von <strong>de</strong>n natürlichen Normen,<br />
dann wäre es immer noch besser <strong>und</strong> folgerichtiger, mit <strong>de</strong>m<br />
amerikanischen Realisten Justice Holmes erst dort <strong>Recht</strong> zu<br />
17 F.W.Jemsalem, Kritik <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>swissenschaft, 1948.<br />
1 8 A.a.O.XX,5.<br />
1 9 A.a.O.52.<br />
2 0 O.Veit, Die geistesgeschichtliche Situation <strong>de</strong>s Naturrechts, in: Merkur 1<br />
(1947) 390-405.<br />
2 1 H.J. Laski, Grammär of Politics, 1941.<br />
286
erkennen, wo <strong>de</strong>r Richter es ausspricht, <strong>und</strong> je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren 57. 2<br />
<strong>Recht</strong>snorm die Wirklichkeit abzusprechen, weil sie nicht mehr<br />
wirklich sei in <strong>de</strong>m Augenblick, da wir über sie nach<strong>de</strong>nken.<br />
O<strong>de</strong>r wir können ebensogut mit <strong>de</strong>r Freirechtslehre einig<br />
gehen <strong>und</strong> etwa mit Fi. Isay, H. Kantorowicz o<strong>de</strong>r E. Fuchs erklä<br />
ren, daß erst <strong>de</strong>r Richter <strong>Recht</strong> schaffe, da je<strong>de</strong> Norm um ihrer<br />
abstrakten Form willen zu einer solchen Wirkung unfähig sei.<br />
Zu guter Letzt schließt sich wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Kreis: vom Positivis<br />
mus zum scheinbaren Naturrecht <strong>und</strong> von hier wie<strong>de</strong>r zurück<br />
zum Positivismus.<br />
Die Unterscheidung zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral, von <strong>de</strong>r<br />
bereits kurz die Re<strong>de</strong> war, bedarf — im engen Rahmen, <strong>de</strong>r hier<br />
zur Verfügung steht — noch einer Erklärung. Der Unterschied<br />
zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral kann einem hellsichtigen Auge nicht<br />
entgehen, sosehr er von einem Teil <strong>de</strong>r Scholastiker auf Gr<strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r nicht in Abre<strong>de</strong> zu stellen<strong>de</strong>n Wahrheit, daß die Normen<br />
<strong>de</strong>s Naturrechts zugleich auch sittliche Normen sind, überse<br />
hen wur<strong>de</strong>.<br />
Es ist nicht unmittelbar einsichtig, warum die absoluten<br />
Normen <strong>de</strong>r Ethik zugleich auch rechtliche Bewandtnis haben<br />
sollen. Wenn man z. B. sagt, daß je<strong>de</strong>r Mensch, <strong>de</strong>r eine Ehe ein<br />
gehen will, im Gewissen verpflichtet sei, sie nur als Einehe ein<br />
zugehen, dann scheint noch nicht gegeben zu sein, daß <strong>de</strong>r<br />
jenige, <strong>de</strong>r polygam lebt, von <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft<br />
belangt wer<strong>de</strong>n könnte, also auf rechtlichem Wege erfaßbar sei,<br />
es sei <strong>de</strong>nn, die menschliche Gesellschaft habe ihrerseits die<br />
Einehe zu einem Bestandteil <strong>de</strong>s friedlichen Zusammenlebens<br />
erklärt. Ethische Normen sind nicht schon <strong>de</strong>swegen, weil sie<br />
ethisch sind, rechtliche Normen. Darin liegt auch <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>,<br />
warum in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Sozialethik je<strong>de</strong>r Gedanke an ein<br />
rechtliches Zwangsnormensystem ausgeschaltet <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Blick<br />
nur auf das <strong>de</strong>r Gesellschaft vorzustellen<strong>de</strong>, von dieser frei zu<br />
erwählen<strong>de</strong> I<strong>de</strong>al gerichtet wird. Der Unterschied zwischen<br />
ethischer <strong>und</strong> rechtlicher Betrachtung ist also nicht zu leugnen.<br />
Die ethische ist die vertikale Sicht zu <strong>de</strong>n ewigen Gesetzen, die<br />
rechtliche die horizontale zu <strong>de</strong>n Mitmenschen. Die vertikale<br />
weist auf das absolute Sollen, <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r einzelne Mensch in sei<br />
nem Gewissen wie einem ewigen Gericht anheimgegeben ist;<br />
die horizontale dagegen <strong>de</strong>utet auf die Organisation <strong>de</strong>r Men<br />
schen untereinan<strong>de</strong>r, nicht um irgen<strong>de</strong>ines I<strong>de</strong>ales, son<strong>de</strong>rn um<br />
<strong>de</strong>r konkret irgendwie noch möglichen Frie<strong>de</strong>nsordnung wil-<br />
287
57. 2 len, da die konkrete soziale Ordnung notgedrungen <strong>de</strong>r kon<br />
kreten Willensbildung <strong>de</strong>r Gesellschaftsglie<strong>de</strong>r Rechnung tra<br />
gen muß, wenn sie nicht utopisch sein will. Der Unterschied<br />
zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral ist sogar ein realer, sofern man <strong>Recht</strong><br />
<strong>und</strong> Individualmoral einan<strong>de</strong>r gegenüberstellt. Denn es gibt in<br />
Wahrheit sittliche I<strong>de</strong>ale, die nur <strong>de</strong>r Einzelmensch ergreift <strong>und</strong><br />
vor seinem Gewissen als verpflichtend anerkennen muß. Der<br />
einzelne Mensch hat seinen eigenen Gewissensspruch, <strong>de</strong>n er<br />
nicht ohne weiteres <strong>de</strong>r Gemeinschaft aufzwingen kann.<br />
Im Raum <strong>de</strong>r Sozialethik sind <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral nicht mehr in<br />
dieser Wirklichkeit unterschie<strong>de</strong>n. Denn hier ist <strong>de</strong>rselbe Inhalt<br />
mit zwei verschie<strong>de</strong>nen Funktionen ausgerüstet, <strong>de</strong>r sittlichen<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r rechtlichen. Es gibt für Thomas ethische Werte, die<br />
wesentlich Gemeinschaftswerte sind, nämlich alle jene, welche<br />
aus <strong>de</strong>r menschlichen Wesenheit als solcher folgen, eben jener<br />
Wesenheit, in welcher alle Menschen zur menschlichen <strong>Recht</strong>s<br />
gemeinschaft zusammengeschlossen sind. Diese ethischen<br />
Werte sind nicht nur Werte, son<strong>de</strong>rn zugleich <strong>Recht</strong>sansprüche<br />
<strong>de</strong>r Menschen untereinan<strong>de</strong>r. Das ethische Sollen <strong>de</strong>r natura<br />
humana ist ein Kulturauftrag an die gesamte Menschheit <strong>und</strong><br />
von ihr als solcher zu erfüllen. Denn nicht etwa nur das Gewis<br />
sen <strong>de</strong>s einzelnen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r vielen einzelnen Menschen ist zur<br />
Verwirklichung <strong>de</strong>s in <strong>de</strong>r natura humana enthaltenen Sollens<br />
aufgerufen, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Mensch als solcher. Darum ist das<br />
Ethos <strong>de</strong>r natura humana ein rechtliches Organisationsprinzip.<br />
Je<strong>de</strong>r kann <strong>und</strong> muß daher vom an<strong>de</strong>rn erwarten können, daß<br />
er „mitmache" in <strong>de</strong>r tatkräftigen Verwirklichung <strong>de</strong>r unabän<br />
<strong>de</strong>rlichen ethischen Sollensordnung, soweit diese in <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Natur nie<strong>de</strong>rgelegt ist.<br />
Dieser Gedanke ist allerdings nicht völlig durchzu<strong>de</strong>nken,<br />
ohne daß man auf <strong>de</strong>n Gesetzgeber dieser rechtlichen Normen<br />
zurückgreift, nämlich auf Gott. Wenngleich an <strong>de</strong>m Wort von<br />
Hugo Grotius, daß das Naturrecht auch ohne die Existenz Got<br />
tes bestün<strong>de</strong> (si Deus non esset...), insofern etwas Wahres ist,<br />
als die naturrechtlichen Normen nicht im Willen Gottes, son<br />
<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s Menschen begrün<strong>de</strong>t sind, so wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>m<br />
Naturrecht eben doch die gesetzliche Kraft abgehen, wenn man<br />
nicht auf Gott, näherhin die Vernunft Gottes, als die vorgege<br />
bene Autorität, zurückginge. Eine weitere Erklärung dieses<br />
Gedankens können wir uns hier ersparen, da er in <strong>de</strong>n Traktat<br />
über das Gesetz gehört.<br />
288
In <strong>de</strong>r thomasischen <strong>Recht</strong>sphilosophie ist also je<strong>de</strong>r sittliche 57. 2<br />
Verstoß gegen die natura humana ein Skandal für die Mensch<br />
heit, auch wenn diese <strong>de</strong> facto nicht skandalisiert ist. Der Skan<br />
dal wird nicht nach <strong>de</strong>r gesellschaftlich gültigen Wertethik beur<br />
teilt, son<strong>de</strong>rn nach <strong>de</strong>n Aufbauprinzipien, die ins Sein <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Natur verflochten sind. Daß nur äußere Hand<br />
lungen durch das menschliche Gesetz erfaßt wer<strong>de</strong>n können,<br />
tut dieser Auffassung keinen Eintrag.<br />
Wer aber besorgt nun die Bekanntgabe dieser naturrecht<br />
lichen Normen? Diese Frage führt in das folgen<strong>de</strong> Thema hin<br />
über.<br />
b) Der rechtslogische Prozeß<br />
von <strong>de</strong>n Normen zum konkreten <strong>Recht</strong><br />
Thomas steht für <strong>de</strong>n erkenntnistheoretischen Optimismus<br />
ein, <strong>de</strong>r besagt, daß die menschliche Vernunft naturhaft die Ver<br />
anlagung in sich trägt, die absoluten Normen zu erkennen, so<br />
daß es an sich keiner eigenen Instanz zur Bekanntgabe bedarf,<br />
son<strong>de</strong>rn die praktische Vernunft <strong>de</strong>r Menschen genügt. Die<br />
praktische Vernunft aber ist nichts an<strong>de</strong>res als das, was wir<br />
Gewissen nennen. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß das sitt<br />
liche Gewissen <strong>de</strong>s einzelnen sich ohne weiteres zum Richter<br />
über die gesellschaftliche Organisation <strong>und</strong> Frie<strong>de</strong>nsordnung<br />
aufwerfen könne. Denn Thomas <strong>de</strong>nkt an das naturhafte<br />
Gewissen, das diesen rechtslogischen Prozeß vornimmt. Dar<br />
unter versteht er jene subjektive Kraft <strong>de</strong>r Vernunft, die <strong>de</strong>n<br />
objektiven absoluten Normen als naturhaftes Organ entspricht.<br />
Natürlich ist damit nicht ein verobjektivierter Geist gemeint. Es<br />
wird aber die Auffassung vertreten, daß <strong>de</strong>r Mensch an sich,<br />
eben weil er eine natura humana besitzt, Vernunftkraft genug<br />
habe, um die Normen erkennen <strong>und</strong> von diesen aus unter Ein<br />
beziehung <strong>de</strong>r konkreten Sachkenntnis die sachgeb<strong>und</strong>ene Fol<br />
gerung ziehen zu können, was als im Hier <strong>und</strong> Jetzt von <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft rechtmäßig zu verwirklichen ist. Das Resultat die<br />
ses logischen Prozesses ist Naturrecht.<br />
Man könnte nun mit <strong>de</strong>n vielen positivistisch eingestellten<br />
Gegnern <strong>de</strong>s hl. Thomas erklären, daß dieser Denkprozeß eben<br />
mehr ein logischer Prozeß <strong>de</strong>r Deduktion als ein rechtslogischer<br />
Prozeß sei. Um im <strong>Recht</strong>svorgang zu verbleiben, hat z.B. die<br />
Kelsensche Theorie <strong>de</strong>n rechtserzeugen<strong>de</strong>n Prozeß bis zur kon-<br />
289
57. 2 kreten <strong>Recht</strong>sanwendung durchgeführt. Aber gera<strong>de</strong> die tho<br />
masische Auffassung von <strong>de</strong>r Vernunft als <strong>de</strong>r Kraft, die <strong>de</strong>n<br />
Weg von <strong>de</strong>n Normen zum konkreten <strong>Recht</strong> überwin<strong>de</strong>n hel<br />
fen soll, scheint daran zu kranken, daß sie einen metajuristi<br />
schen Faktor einbezieht.<br />
Dem ist nicht so, weil in <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas die prak<br />
tische Vernunft, insofern sie <strong>de</strong>n objektiven Sachverhalt richtig<br />
analysiert, d. h. insofern sie wahr ist, rechtserzeugen<strong>de</strong> Kraft<br />
besitzt; <strong>de</strong>nn entsprechend <strong>de</strong>r scholastischen Lehre von <strong>de</strong>r<br />
Syn<strong>de</strong>resis ist die menschliche Vernunft von Natur aus darauf<br />
angelegt, die objektiv vorliegen<strong>de</strong>n Sachverhalte in ihrem Nor<br />
mengehalt zu erkennen <strong>und</strong> als Normen auszusprechen. Die<br />
Naturrechtslehre <strong>de</strong>s hl. Thomas sieht im naturhaften Spruch<br />
<strong>de</strong>r praktischen Vernunft <strong>de</strong>n nächsten Gesetzgeber <strong>de</strong>r Men<br />
schenrechte, <strong>de</strong>r dann seinerseits höher weist, nämlich auf <strong>de</strong>n<br />
ewigen Gesetzgeber über dieser Welt. Man mag diese Metaphy<br />
sik als verworrene Spekulation ablehnen. Man wird aber mit ihr<br />
in <strong>de</strong>r Praxis doch immer rechnen müssen. Denn in <strong>de</strong>r Tiefe<br />
<strong>de</strong>s Bewußtseins lebt in einem je<strong>de</strong>n Menschen immer die<br />
Überzeugung, daß er irgendwie autorisiert sei, gegen die Verlet<br />
zungen seiner ursprünglichen <strong>Recht</strong>e in revolutionärer Aufleh<br />
nung Front zu machen. Tatsächlich hat keine an<strong>de</strong>re Metaphy<br />
sik als diese die Revolutionäre von 1789 <strong>und</strong> 1848 im Kampf um<br />
das <strong>Recht</strong> auf Arbeit begeistert.<br />
Damit ist das Gewissen in vollständig logischer Form in <strong>de</strong>n<br />
rechtserzeugen<strong>de</strong>n Prozeß eingereiht, nicht allerdings das<br />
Gewissen, sofern es nach persönlicher sittlicher Haltung in per<br />
sönlichen sittlichen Fragen urteilt, son<strong>de</strong>rn insofern es ein Wis<br />
sen um <strong>de</strong>n Sachverhalt ist, <strong>de</strong>r die Frie<strong>de</strong>nsordnung <strong>de</strong>r Men<br />
schen objektiv bestimmen soll, ein Wissen, das in <strong>de</strong>r Folge ent<br />
sprechend seiner naturhaften Anlage diese Frie<strong>de</strong>nsordnung<br />
spontan for<strong>de</strong>rt, <strong>und</strong> zwar mit einer Autorität, die ihre letztgül<br />
tige Sendung vom ewigen Gesetzgeber ableitet.<br />
Daraus ergibt sich eine folgenschwere Einsicht: Je<strong>de</strong>s gewis<br />
senlose Han<strong>de</strong>ln gegen die Menschenwür<strong>de</strong>, sei es nun vonsei<br />
ten <strong>de</strong>r gesetzgeben<strong>de</strong>n Autorität, sei es vonseiten <strong>de</strong>r ausfüh<br />
ren<strong>de</strong>n Organe, ist ein naturrechtliches Verbrechen <strong>und</strong> darum<br />
in sich strafwürdig. Es kann daher in durchaus rechtslogischem<br />
Sinne von einer kommen<strong>de</strong>n Autorität bestraft wer<strong>de</strong>n, auch<br />
wenn die früheren positiven Gesetze, unter <strong>de</strong>nen das Verbre<br />
chen gegen die Menschenwür<strong>de</strong> geschehen ist, dieses als sol-<br />
290
ches nicht geahn<strong>de</strong>t hätten. Mit an<strong>de</strong>ren Worten: das Natur- 57. 2<br />
recht hat wirkliche Geltung, auch wenn das positive <strong>Recht</strong><br />
dagegensteht.<br />
Damit sind wir bei <strong>de</strong>m für einen Positivisten so ungeheuer<br />
lich klingen<strong>de</strong>n Thema von <strong>de</strong>r Mehrheit <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s angelangt,<br />
ein Thema, das das Problem von <strong>de</strong>r Kollision zwischen Natur<br />
recht <strong>und</strong> positivem <strong>Recht</strong> in sich birgt. Für Thomas gibt es kein<br />
positives <strong>Recht</strong>, das im Wi<strong>de</strong>rspruch stän<strong>de</strong> zum Naturrecht;<br />
<strong>de</strong>nn es wäre nicht <strong>Recht</strong>, weil je<strong>de</strong>s positive Gesetz, das <strong>de</strong>m<br />
Naturrecht wi<strong>de</strong>rstreitet, wirkungslos, also unfähig ist, <strong>Recht</strong><br />
zu konstituieren. Damit ist die For<strong>de</strong>rung nach Einheit <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s gewahrt.<br />
Im übrigen ist niemand ein eifrigerer Verteidiger <strong>de</strong>r Einheit<br />
<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s als Thomas selbst. Kein Gedanke beherrscht die<br />
thomasische <strong>Recht</strong>sphilosophie stärker als <strong>de</strong>r Gedanke <strong>de</strong>r<br />
Ordnung <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns. Gera<strong>de</strong> darin sieht Thomas <strong>de</strong>n<br />
Sinn <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, die Frie<strong>de</strong>nsordnung zu garantieren. So kann<br />
es nach ihm nur jeweils ein einziges <strong>Recht</strong> geben, wenngleich es<br />
zwei <strong>Recht</strong>squellen (Naturrecht <strong>und</strong> positives Gesetz) gibt. Um<br />
dieser Gr<strong>und</strong>finalität <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s überhaupt (also <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s) zu entsprechen, wird daher die Gesellschaft nicht je<strong>de</strong>m<br />
Einzelgewissen freien Lauf gewähren können. Die positivrecht<br />
liche Festlegung wird von selbst zur dringlichen Notwendigkeit<br />
<strong>und</strong> damit zum naturrechtlichen Erfor<strong>de</strong>rnis. Bei aller Bevorzu<br />
gung, welche das Naturrecht bei Thomas auf philosophischer<br />
Ebene genießt, ist Thomas Realist genug <strong>und</strong> räumt <strong>de</strong>m positi<br />
ven <strong>Recht</strong> in <strong>de</strong>r Praxis eine weite Aktionsbasis ein. Wie stark er<br />
bei aller gr<strong>und</strong>sätzlichen Naturrechtsauffassung das formale<br />
<strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s Staates betont, beweisen seine Fragen über das Pro-<br />
zeßrecht (Fr. 67—71) <strong>und</strong> vor allem seine gr<strong>und</strong>sätzliche For<strong>de</strong><br />
rung <strong>de</strong>r Unterordnung unter die gegebene staatliche Autorität.<br />
Das Mittelalter dachte um <strong>de</strong>r naturrechtlichen Gr<strong>und</strong>for<strong>de</strong><br />
rung <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>nsordnung willen im Hinblick auf das beste<br />
hen<strong>de</strong> positive <strong>Recht</strong> viel zu konservativ, als daß er z.B. <strong>de</strong>n<br />
Mord an einer auch noch so tyrannischen Obrigkeit befürwor<br />
tet hätte, es sei <strong>de</strong>nn einzig in <strong>de</strong>m Fall, daß diese überhaupt<br />
noch nicht im gefestigten Besitze <strong>de</strong>r Gewalt wäre. 22 Selbst<br />
In diesem Sinne ist die Thomasstelle in 2. Sent. dist. 44, q. 2, a. 2 ad 5 zu verstehen.<br />
291
57. 2 einem ungerechterweise zum To<strong>de</strong> Verurteilten erlaubt Thomas<br />
<strong>de</strong>n aktiven Wi<strong>de</strong>rstand nur, wenn keine öffentliche Unruhe zu<br />
befürchten ist (68,4).<br />
3. DAS JUS GENTIUM"<br />
(Art. 3)<br />
57. 3 Ist die Einteilung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s in Naturrecht <strong>und</strong> positives<br />
<strong>Recht</strong> erschöpfend? Das ist die sich unmittelbar aufdrängen<strong>de</strong><br />
Frage. Dem hl. Thomas wur<strong>de</strong> diese Frage durch verschie<strong>de</strong>ne<br />
an<strong>de</strong>re Einteilungen <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s vorgelegt, von <strong>de</strong>nen in <strong>de</strong>n bei<br />
<strong>de</strong>n Artikeln 3 <strong>und</strong> 4 die Re<strong>de</strong> ist. Als erste be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Schwie<br />
rigkeit (Art. 3) ergab sich für Thomas die Einordnung <strong>de</strong>s „jus<br />
gentium", das nach römischem <strong>Recht</strong> gegen das bürgerliche<br />
<strong>Recht</strong> abgetrennt wur<strong>de</strong>. Dieser dritte Artikel wur<strong>de</strong> durch die<br />
eigenwillige Erklärung, die er bei Franziskus <strong>de</strong> Vitoria erfahren<br />
hat, zum Anlaß einer umwälzen<strong>de</strong>n Entwicklung auf <strong>de</strong>m<br />
Gebiet <strong>de</strong>s Völkerrechts.<br />
In Rom stan<strong>de</strong>n von jeher <strong>de</strong>n feierlichen, mit <strong>Recht</strong>skraft<br />
<strong>de</strong>s bürgerlichen <strong>Recht</strong>s ausgestatteten <strong>Recht</strong>sgeschäften auch<br />
zahllose Verkehrsgeschäfte gegenüber, die ohne jegliche Form<br />
abgewickelt wur<strong>de</strong>n. Die „bona fi<strong>de</strong>s" war hier das Prinzip, jene<br />
bona fi<strong>de</strong>s, die noch nicht zu einer Quelle <strong>de</strong>s römischen <strong>Recht</strong>s<br />
gewor<strong>de</strong>n war. 23<br />
Wie sollten nun solche formlosen Geschäfte rechtliche Gül<br />
tigkeit erlangen? Diese Frage war <strong>de</strong>swegen wichtig, weil sämt<br />
liche Geschäfte mit Auslän<strong>de</strong>rn formlos waren, da <strong>de</strong>r Frem<strong>de</strong><br />
nach römischem <strong>Recht</strong> gr<strong>und</strong>sätzlich als rechtlos galt. Es war<br />
daher im Interesse <strong>de</strong>r Ordnung, daß sowohl die Geschäfte<br />
zwischen Frem<strong>de</strong>n als auch solche zwischen römischen Bür<br />
gern <strong>und</strong> Frem<strong>de</strong>n juristisch geformt wur<strong>de</strong>n.<br />
Bis etwa 250 v.Chr. hatten immerhin die römischen<br />
Gemein<strong>de</strong>n mit an<strong>de</strong>ren Staaten nicht selten Staats- <strong>und</strong> Han<br />
<strong>de</strong>lsverträge geschlossen (z.B. Karthago), wonach gegenseitig<br />
<strong>Recht</strong>ssch<strong>utz</strong> <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>sfähigkeit zugesagt wur<strong>de</strong>n. So. z.B.<br />
2 3 Vgl. zum Geschichtlichen <strong>de</strong>s jus gentium R. Sohm, Institutionen.<br />
Geschichte <strong>und</strong> System <strong>de</strong>s römischen Privatrechtes. München-Leipzig<br />
1919 16 . O. Lottin, Le droit naturel chez S.Thomas d'Aquin et ses pre<strong>de</strong>cesseurs,<br />
1931 2 . R. Linharät, Die Sozialprinzipien <strong>de</strong>s hl. Thomas v. Aquin,<br />
Freiburg i.Br. 1932, 106ff.<br />
292
hatte nach <strong>de</strong>m zweiten Han<strong>de</strong>lsvertrag mit Karthago <strong>de</strong>r 57. 3<br />
Römer in Karthago die privatrechtliche Verkehrsfähigkeit <strong>de</strong>s<br />
karthagischen Bürgers, <strong>de</strong>r Karthager in Rom die privatrecht<br />
liche Verkehrsfähigkeit <strong>de</strong>s römischen Bürgers. Den privilegier<br />
ten Nichtbürgern (Peregrini) war so durch internationalen<br />
Fre<strong>und</strong>schaftsvertrag ein Teil <strong>de</strong>s römischen Bürgerrechts (das<br />
jus commercii) verliehen.<br />
Etwa im dritten Jahrh<strong>und</strong>ert än<strong>de</strong>rt sich die Lage. Rom, das<br />
zur Großmacht wird, braucht solche Fre<strong>und</strong>schafts vertrage<br />
nicht mehr. Zahlreiche Gemeinwesen wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m römischen<br />
Gemeinwesen einverleibt, ohne jedoch das Bürgerrecht <strong>de</strong>r<br />
Römer zu bekommen. Das römische Bürgerrecht ist also ein<br />
Privileg. Dadurch wird die juristische Formlosigkeit <strong>de</strong>r Han<br />
<strong>de</strong>lsgeschäfte zwischen Römern <strong>und</strong> Frem<strong>de</strong>n <strong>und</strong> zwischen<br />
Frem<strong>de</strong>n untereinan<strong>de</strong>r noch stärker unterstrichen. Dabei<br />
gehörten <strong>Recht</strong>sgeschäfte zwischen Römern <strong>und</strong> Frem<strong>de</strong>n<br />
nicht zu <strong>de</strong>n Seltenheiten. Die Notwendigkeit eines <strong>Recht</strong>s, das<br />
außerhalb <strong>de</strong>s römischen Bürgerrechts <strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>sverkehr<br />
unter <strong>de</strong>n Peregrini <strong>und</strong> mit diesen formte, lag auf <strong>de</strong>r Hand. In<br />
Rom wur<strong>de</strong> um 242 v. Chr. ein eigener Prätor für die Frem<strong>de</strong>n<br />
rechtsprechung eingesetzt. Man erkannte also jetzt ein <strong>Recht</strong><br />
für die Frem<strong>de</strong>n an, das sogenannte jus gentium. Quellen dieses<br />
<strong>Recht</strong>s waren die Amtsgewalt <strong>de</strong>s römischen Magistrats, d. h.<br />
<strong>de</strong>s Prätors, <strong>und</strong> die Tradition. Das römische <strong>Recht</strong>, das Volks<br />
gesetz, galt nur für die römische Bürgerschaft. Das Amtsrecht,<br />
das magistratische jus honorarium <strong>und</strong> das Gewohnheitsrecht<br />
brachten das jus gentium hervor, das ohne nationale Schranken<br />
für Frem<strong>de</strong> genau so gut Gültigkeit hatte wie für die Bürger<br />
schaft. Im jus gentium vollzieht sich also eine Anpassung <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nkens an das allgemein menschliche <strong>Recht</strong>bewußt-<br />
sein. Wir haben somit im jus gentium inhaltlich ein Weltrecht<br />
vor uns, ein <strong>Recht</strong> im Sinne eines naturhaften Sachverhalts, in<br />
gewissem Sinne ein „Naturrecht", das nach Treu <strong>und</strong> Glauben,<br />
nicht nach <strong>de</strong>m Buchstaben wirkt. Das jus gentium war also ein<br />
gemeines Menschenrecht, gemeinsam allen Völkern auf Gr<strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Dinge. Es sprach sich darin das allgemein menschliche<br />
Gefühl <strong>de</strong>r Billigkeit aus. Und <strong>de</strong>nnoch war es als <strong>Recht</strong> nicht<br />
das Naturrecht <strong>de</strong>r Philosophie. Es bleibt ein Teil <strong>de</strong>s positiven,<br />
durch die Verkehrsgewohnheiten <strong>und</strong> an<strong>de</strong>re <strong>Recht</strong>squellen<br />
(beson<strong>de</strong>rs das prätorische Edikt) konkret gestalteten römischen<br />
<strong>Recht</strong>s. R. Sohm (a.a.O. 84) bestimmt darum das jus gen-<br />
293
57. 3 tium in folgen<strong>de</strong>r Formulierung: „Das jus gentium war <strong>de</strong>r Teil<br />
<strong>de</strong>s römischen Privatrechts, welcher mit <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> an<strong>de</strong>rer<br />
Völker (insbeson<strong>de</strong>re mit <strong>de</strong>m griechischen <strong>Recht</strong>, das an <strong>de</strong>n<br />
Gesta<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Mittelmeers eine natürliche Vorherrschaft aus<br />
übte) in seinen Gr<strong>und</strong>gedanken übereinstimmte. Mit an<strong>de</strong>ren<br />
Worten, das jus gentium war <strong>de</strong>rjenige Teil <strong>de</strong>s römischen<br />
<strong>Recht</strong>s, welcher schon <strong>de</strong>n Römern als eine Art von ratio<br />
scripta, als gemeingültiges <strong>und</strong> gemeinmenschliches <strong>Recht</strong><br />
erschien."<br />
Da es für Thomas vom Gesichtspunkt <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sentstehung<br />
her nur zwei Formen von <strong>Recht</strong> gibt, das natürliche <strong>und</strong> das<br />
positive, war es ihm zweifellos schwer gewor<strong>de</strong>n, dieses schil<br />
lern<strong>de</strong> jus gentium vorbehaltlos in eine <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Kategorien<br />
einzuordnen. Diese schwere Aufgabe wird noch klarer, wenn<br />
man sich die verschie<strong>de</strong>nen Definitionen <strong>de</strong>s jus gentium, die<br />
Thomas vor sich hatte, vor Augen führt.<br />
Gaius (gegen 160) unterschied zwei Arten von <strong>Recht</strong>: das bürgerliche<br />
<strong>Recht</strong>, das je<strong>de</strong>s Volk aus eigenem Gutdünken gestal<br />
tet, <strong>und</strong> das jus gentium, ein allgemeines Erbteil <strong>de</strong>r gesamten<br />
Menschheit, diktiert von <strong>de</strong>r menschlichen Vernunft. Das jus<br />
gentium scheint dabei <strong>de</strong>m Naturrecht gleichzukommen. Es ist,<br />
wie Gaius (Dig. 1.41,tit. 1,1) sagt, mit <strong>de</strong>m Menschenge<br />
schlecht zugleich entstan<strong>de</strong>n. So gelte z.B. in gleicher Weise,<br />
daß die Dinge, die noch keinen Eigentümer haben, <strong>de</strong>mjenigen<br />
gehören, <strong>de</strong>r sich ihrer zuerst bemächtigt. 24 Ebenso gehören<br />
auch die Gefangenen <strong>de</strong>n Siegern. 25 Auch die Sklavenschaft<br />
wird zum jus gentium gezählt. 26<br />
Ulpian (gest. 228) übernahm die bereits bei Cicero stehen<strong>de</strong><br />
Einteilung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s in Naturrecht, jus gentium <strong>und</strong> bürgerli<br />
ches <strong>Recht</strong>. Neben <strong>de</strong>m bürgerlichen <strong>Recht</strong>, welches wie bei<br />
Gaius das einem je<strong>de</strong>n Volk eigene <strong>Recht</strong> besagt, gehört das jus<br />
gentium wie auch das Naturrecht <strong>de</strong>r ganzen Menschheit. Das<br />
Naturrecht ist nach stoischem Vorbild jene Richtschnur, nach<br />
welcher sowohl Menschen wie Tiere tätig sind: die animalischen<br />
Triebe. Das jus gentium ist im eigentlichen Sinn menschliches<br />
294<br />
Dig. 1.41, tit. 1,1 u.3.<br />
Ebd. tit. 1,5 u.7.<br />
Dig. 1.1, tit. 6,1.
<strong>Recht</strong> <strong>und</strong> dient allen Völkern in gleicher Weise als Norm. 2 7 57. 3<br />
Zum jus gentium gehört auch die Sklaverei. 28<br />
Die Institutionen Justinians (533) übernehmen die Dreitei<br />
lung Ulpians. Zum jus gentium wer<strong>de</strong>n die Sklaverei <strong>und</strong>, von<br />
Hermogenian beeinflußt, die verschie<strong>de</strong>nen Institutionen<br />
bezüglich privater <strong>Recht</strong>sgeschäfte gerechnet. Auffallend ist,<br />
daß die Institutionen Justinians nicht mehr die Definition <strong>de</strong>s<br />
Naturrechts, wie sie sich bei Ulpian fin<strong>de</strong>t, übernehmen, son<br />
<strong>de</strong>rn unter <strong>de</strong>m Naturrecht dasselbe verstehen wie unter <strong>de</strong>m<br />
jus gentium (vgl. O.Lottin, a.a.O.8). Beson<strong>de</strong>re Erwähnung<br />
verdient, daß die Institutionen Justinians, einen Text Marcians<br />
übernehmend, zu diesem natürlichen <strong>Recht</strong>, das bei allen Völ<br />
kern gilt, auch die Ben<strong>utz</strong>ung <strong>de</strong>r Flüsse <strong>und</strong> Meere zählen.<br />
Sosehr das jus gentium durch die Anerkennung vonseiten <strong>de</strong>s<br />
römischen <strong>Recht</strong>s positiven Charakter angenommen hat, so<br />
geht dieser Aufnahme ins positive <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>nnoch die Überle<br />
gung voraus, daß alles, was überall durch die menschliche Ver<br />
nunft diktiert <strong>und</strong> anerkannt wird, Naturfor<strong>de</strong>rung <strong>und</strong> darum<br />
ein Naturrecht sei.<br />
Isidor von Sevilla greift in seiner Einteilung auf Aristoteles<br />
zurück. Aristoteles hatte das bürgerliche <strong>Recht</strong> in das Natur<br />
recht <strong>und</strong> das gesatzte <strong>Recht</strong> eingeteilt. Naturrecht war dabei<br />
alles, was irgendwie in <strong>de</strong>r Natur selbst beschlossen ist, unab<br />
hängig von menschlichen Meinungen, unabhängig vor allem<br />
von je<strong>de</strong>r Gesetzgebung <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>sprechung. Diesen Begriff<br />
<strong>de</strong>s Naturrechts übernimmt Isidor. Er verzichtet also auf die<br />
stoische Unterscheidung zwischen <strong>de</strong>m, was <strong>de</strong>m animalischen<br />
Trieb, <strong>und</strong> <strong>de</strong>m, was <strong>de</strong>r menschlichen Vernunft als solcher ent<br />
spricht. So kann er das Naturrecht schlechthin <strong>de</strong>finieren als<br />
das <strong>Recht</strong>, das allen Nationen gemeinsam ist. Das jus gentium<br />
ist <strong>de</strong>m gegenüber jenes <strong>Recht</strong>, <strong>de</strong>ssen sich fast alle Völker<br />
bedienen. Es ist also bereits von <strong>de</strong>r Natur weg zu irgendwel<br />
chem faktischen Gewohnheitsrecht hinübergenommen. Im<br />
übrigen wird die Unterscheidung nicht klar durchgeführt. Von<br />
beson<strong>de</strong>rem Interesse ist, daß Isidor unter <strong>de</strong>n einzelnen Bei<br />
spielen <strong>de</strong>s jus gentium nicht nur allgemein privatrechtliche<br />
Institutionen, son<strong>de</strong>rn auch völkerrechtliche Gepflogenheiten<br />
Ebd. tit. 1,1.<br />
Ebd. tit. 1,4.<br />
295
57. 3 im heutigen Sinne aufzählt: Unverletzlichkeit <strong>de</strong>r Gesandten,<br />
Frie<strong>de</strong>nsverträge, Waffenstillstand.<br />
Das Dekret Gratians bringt in die Frage nur Verwirrung zwi<br />
schen göttlichem <strong>und</strong> natürlichem Gesetz (vgl. O. Lottin,<br />
a. a. 0.11). Er wie<strong>de</strong>rholt außer<strong>de</strong>m nur die Einteilung von Lsi-<br />
dor.<br />
Was hat nun Thomas unter <strong>de</strong>m jus gentium verstan<strong>de</strong>n? Die<br />
scheinbaren Unstimmigkeiten rühren einzig daher, daß er mit<br />
<strong>de</strong>r aristotelischen Einteilung, wie auch mit <strong>de</strong>r von Ulpian-Isi-<br />
dor <strong>und</strong> <strong>de</strong>r von Gaius sich auseinan<strong>de</strong>rsetzen mußte (vgl. Eth.<br />
V, 12; I—II 95,4, DT, Bd. 13). Aus Art. 2 <strong>und</strong> I—II 95,4 folgt ein<br />
<strong>de</strong>utig, daß Thomas das <strong>Recht</strong> vollgültig teilt in Naturrecht <strong>und</strong><br />
positives <strong>Recht</strong>. Naturrecht ist dabei nicht nur das, was bereits<br />
an sich nach Art eines analytischen Urteils gilt, son<strong>de</strong>rn auch<br />
dasjenige, was unter <strong>de</strong>n gegebenen konkreten Umstän<strong>de</strong>n ver<br />
nunftgemäß sich aus <strong>de</strong>r Sachanalyse ergibt. Die Inhalte, welche<br />
die Tradition durchweg unter <strong>de</strong>m Namen <strong>de</strong>s jus gentium<br />
begriff, waren für Thomas nichts an<strong>de</strong>res als das durch vernünf<br />
tige Sachanalyse gegebene <strong>Recht</strong>, also ebenfalls Naturrecht.<br />
Denn das Naturrecht ist wie das <strong>Recht</strong> überhaupt ein konkreter<br />
Sachverhalt. An<strong>de</strong>rerseits mußte Thomas, durch die Tradition<br />
gezwungen, <strong>de</strong>m jus gentium einen eigenen rechtlichen Gegen<br />
standsbereich zuteilen. Dies geschieht, in<strong>de</strong>m er erklärt, daß<br />
alles unter das jus gentium falle, was mit <strong>de</strong>r menschlichen Ver<br />
nunft aus <strong>de</strong>m naturrechtlichen An-sich erschlossen wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Daraus folgt, daß Thomas im Gr<strong>und</strong>e einen doppelten Begriff<br />
von Naturrecht aufweist, insofern erstens alles, was unmittel<br />
bar <strong>und</strong> an sich bereits als Naturrecht erkannt wird, zweitens<br />
dasjenige darunter gefaßt wird, was durch einen weiteren logi<br />
schen Prozeß im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r konkreten Befindlich<br />
keit <strong>de</strong>r menschlichen Natur, d. h. ihrer existentiellen Um<br />
stän<strong>de</strong>, erschlossen wird. Es besteht aber kein Zweifel, daß<br />
auch die zweite Fassung zum wahren Naturrecht gehört, wie<br />
wir es in <strong>de</strong>r Erklärung von Art. 2 dargestellt haben. Die Unter<br />
scheidung in „an sich naturrechtlich" <strong>und</strong> „erschlossen natur<br />
rechtlich" ist nur eine Unterscheidung <strong>de</strong>s Gegenstandsberei<br />
ches eines <strong>und</strong> <strong>de</strong>sselben sachbegrün<strong>de</strong>ten <strong>und</strong> darum natürli<br />
chen <strong>Recht</strong>s. In I—II 95,4 begreift Thomas z. B. <strong>de</strong>n gerechten<br />
Kauf—Verkauf unter <strong>de</strong>m jus gentium. Im zweiten Artikel unse<br />
rer Frage dagegen teilt er <strong>de</strong>nselben Sachverhalt <strong>de</strong>m „Natur<br />
recht" zu, in<strong>de</strong>m er von <strong>de</strong>r „natürlichen" Entsprechung von<br />
296
Leistung <strong>und</strong> Gegenleistung spricht, womit im Gr<strong>und</strong>e nur eine 57. 3<br />
allgemeinere Formulierung für das gebraucht wird, was in I—II<br />
95,4 Kauf—Verkauf genannt wird.<br />
Daß Thomas die Sklaverei unter das jus gentium <strong>und</strong> damit<br />
auch unter das Naturrecht zählt, darf nicht verw<strong>und</strong>ern; <strong>de</strong>nn<br />
erstens versteht er darunter nicht die Sklaverei im römisch<br />
rechtlichen Sinn, son<strong>de</strong>rn nur das lebenslängliche Dienstver<br />
hältnis eines Menschen im Dienste seines Herrn (im Sinne <strong>de</strong>r<br />
mittelalterlichen Leibeigenschaft); sodann ist damit nur soviel<br />
gesagt, daß unter <strong>de</strong>n für ihn damals gegebenen Umstän<strong>de</strong>n<br />
nicht alle Menschen in <strong>de</strong>r Lage waren, sich selbst als freie Her<br />
ren im Leben zu behaupten, son<strong>de</strong>rn daß sie <strong>de</strong>r Führung durch<br />
einen „Weiseren" bedurften, daß es somit im Hinblick auf die<br />
konkrete gesellschaftliche Situation angemessen, also natürlich<br />
war, <strong>de</strong>n Zustand <strong>de</strong>s Dienstverhältnisses zu befürworten. Die<br />
natürliche Vernunft mußte ein solches gesellschaftliches Gefüge<br />
„diktieren" (vgl. Zu 3). Damit ist nicht gesagt, daß ein solcher<br />
gesellschaftlicher Zustand, <strong>de</strong>r als „naturrechtlich" bezeichnet<br />
wird, unabän<strong>de</strong>rlich wäre. Entsprechend <strong>de</strong>m Wan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r<br />
Umstän<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lt sich auch das vernünftige Urteil, die sach<br />
liche Analyse, <strong>und</strong> damit das konkrete <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Natur (vgl.<br />
Komm, zu Art. 2).<br />
Da nun all das, was das vernünftige Zusammenleben <strong>de</strong>r<br />
Völker untereinan<strong>de</strong>r (also in unserem Sinne das Völkerrecht)<br />
angeht, im Namen <strong>de</strong>s jus gentium mitbegriffen war, wur<strong>de</strong><br />
das, was wir heute Völkerrecht nennen, stark beeinflußt durch<br />
das weitere geschichtliche Schicksal <strong>de</strong>s Begriffs <strong>de</strong>s „jus gen<br />
tium". Für uns ist heute das Völkerrecht in selbstverständlich<br />
ster Weise ein positiver <strong>Recht</strong>sbegriff, sosehr auch vieles inhalt<br />
lich aus <strong>de</strong>m naturrechtlichen Denken <strong>und</strong> aus <strong>de</strong>m Gewohn<br />
heitsrecht stammen mag, formell aber han<strong>de</strong>lt es sich um ein<br />
positives <strong>Recht</strong>. Diese Entwicklung <strong>de</strong>s Begriffs <strong>de</strong>s jus gentium<br />
zum mo<strong>de</strong>rnen positiven Sinn <strong>de</strong>s Völkerrechts ist aber nicht<br />
erst durch <strong>de</strong>n Positivismus eingeleitet wor<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn geht<br />
bereits auf Vitoria zurück. Zwar wird über die Ehre eines Initia<br />
tors <strong>de</strong>s Völkerrechts im mo<strong>de</strong>rnen Sinne viel gestritten — die<br />
Ehre, die lange Zeit Vitoria zugeteilt wor<strong>de</strong>n war, wur<strong>de</strong> ihm<br />
zugunsten von Hugo Grotius genommen —, <strong>und</strong> doch muß man<br />
diese Ehre Vitoria lassen, sofern man bei ihm auf <strong>de</strong>n tieferen<br />
rechtsphilosophischen Gr<strong>und</strong> seiner Jus-gentium-Lehre hin<br />
absteigt. <strong>Recht</strong>sgeschichtlich gesehen ist nämlich die Frage, was<br />
297
57. 3 an einzelnen Bestimmungen zum Völkerrecht gezählt wur<strong>de</strong>,<br />
nicht so entschei<strong>de</strong>nd wie die Frage, welcher Autor als erster<br />
das Völkerrecht als eine positive Abmachung zwischen <strong>de</strong>n Völ<br />
kern begriffen hat. Und hierin ist Vitoria <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren vorange<br />
gangen, in<strong>de</strong>m er erklärte, daß das jus gentium <strong>und</strong> damit auch<br />
<strong>de</strong>r gesamte völkerrechtliche Inhalt mehr zum positiven als<br />
zum natürlichen <strong>Recht</strong> gehöre (Comment. in S.Thom. II—II<br />
57,3). 29 Hierliegt<strong>de</strong>r eigentliche rechtsphilosophische Wan<strong>de</strong>l. Es<br />
war dann verhältnismäßig leicht, die einzelnen Gr<strong>und</strong>sätze auf<br />
zustellen, die in dieses positive Völkerrecht aufzunehmen<br />
waren. Vom Standpunkt <strong>de</strong>s Naturrechts<strong>de</strong>nkens her muß<br />
allerdings gesagt wer<strong>de</strong>n, daß die Wendung, welche Vitoria <strong>de</strong>m<br />
Begriff <strong>de</strong>s jus gentium gegeben hat, überaus zu bedauern ist,<br />
weil so <strong>de</strong>r erste Griff zur Abriegelung <strong>de</strong>s Völkerrechts vom<br />
Naturrecht getan wur<strong>de</strong>.<br />
4. VATERRECHT UND HERRSCHAFTSRECHT<br />
(Art. 4)<br />
57. 4 In <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>m traditionellen Begriff<br />
<strong>de</strong>s jus gentium kam Thomas zu <strong>de</strong>m Resultat, daß die Eintei<br />
lung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s in Naturrecht <strong>und</strong> positives <strong>Recht</strong> keinerlei<br />
Einbuße durch das jus gentium erlei<strong>de</strong>. In an<strong>de</strong>rem Zusammen<br />
hang stellt die geschichtliche Überlieferung noch einige weitere<br />
Einteilungen zur Diskussion, gegen die Thomas seine These<br />
von <strong>de</strong>r vollgültigen Einteilung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s in Naturrecht <strong>und</strong><br />
positives <strong>Recht</strong> verteidigen muß. Es han<strong>de</strong>lt sich dabei um das<br />
<strong>Recht</strong>sverhältnis zwischen Vater <strong>und</strong> Sohn <strong>und</strong> zwischen Herrn<br />
<strong>und</strong> Sklaven, wofür bei <strong>de</strong>n Römern ein eigenes <strong>Recht</strong> bestand.<br />
Das römische <strong>Recht</strong> hatte sowohl Kin<strong>de</strong>r wie Ehefrau in die<br />
väterliche Gewalt gegeben. Was <strong>de</strong>r Sohn erwarb, erwarb er<br />
<strong>de</strong>m Vater. Die väterliche Gewalt wur<strong>de</strong> als eine Gewalt um <strong>de</strong>s<br />
Vaters willen betrachtet, während nach <strong>de</strong>utschem <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>n<br />
ken die väterliche Gewalt eine Gewalt um <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s willen ist.<br />
Darum erlischt nach <strong>de</strong>utschem <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nken die väterliche<br />
Gewalt mit <strong>de</strong>r Mündigkeit <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s, nicht aber im römi<br />
schen <strong>Recht</strong>. Auch konnte im römischen <strong>Recht</strong> im Falle <strong>de</strong>s To<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Vaters die Mutter nicht die Stelle <strong>de</strong>s Vaters überneh-<br />
298<br />
Vgl. hierzu S.Ramirez, El <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> gentes, Madrid 1955.
men. An die Stelle <strong>de</strong>s Vaters trat ein Vorm<strong>und</strong>. Die Frau wur<strong>de</strong> 57. 4<br />
also nicht Herrin <strong>de</strong>s Hauses (vgl. Sohm, a.a.O.).<br />
Obwohl <strong>de</strong>r Sklave im römischen <strong>Recht</strong> als Träger natürli<br />
cher Persönlichkeit anerkannt <strong>und</strong> ihm daher die Befugnis,<br />
gewisse <strong>Recht</strong>sgeschäfte abzuschließen, nicht versagt war, so<br />
war er doch <strong>de</strong>m Herrn gegenüber völlig rechtlos. Erst die kai<br />
serliche <strong>Recht</strong>sprechung schritt gegen die gr<strong>und</strong>lose Tötung<br />
<strong>und</strong> gegen unmenschliche Behandlung <strong>de</strong>r Sklaven <strong>und</strong> Miß-<br />
brauch <strong>de</strong>r Sklavinnen ein.<br />
Das römische <strong>Recht</strong> bietet in diesen Betrachtungen <strong>de</strong>s<br />
Vater- <strong>und</strong> Herrschaftsrechts im Gr<strong>und</strong>e nichts an<strong>de</strong>res als eine<br />
konkrete Formulierung aristotelisch-griechischen Denkens.<br />
Aristoteles hatte in <strong>de</strong>r Hausgemeinschaft folgen<strong>de</strong> vier <strong>Recht</strong>s<br />
beziehungen festgestellt: 1. die Beziehungen zwischen <strong>de</strong>n<br />
Ehegatten; 2. die Beziehungen zwischen <strong>de</strong>m Vater <strong>und</strong> <strong>de</strong>n<br />
Kin<strong>de</strong>rn; 3. die Beziehungen zwischen <strong>de</strong>m Herrn <strong>und</strong> <strong>de</strong>n<br />
Sklaven; 4. die Beziehungen vom Herrn zu <strong>de</strong>n materiellen<br />
Dingen. Die drei ersten kommen bei Thomas hier zur Sprache,<br />
die vierte wird in Fr. 66 behan<strong>de</strong>lt.<br />
Für Aristoteles war das Verhältnis <strong>de</strong>r Ehegatten zueinan<strong>de</strong>r<br />
sowie das zwischen Vater <strong>und</strong> Sohn <strong>und</strong> zwischen <strong>de</strong>m Herrn<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>m Sklaven nicht ohne weiteres ein <strong>Recht</strong>sverhältnis. Es<br />
klingt für unser Ohr gera<strong>de</strong>zu wild-barbarisch, wenn wir <strong>de</strong>n<br />
sonst so gefeierten Philosophen von Stagyra in seiner Politik<br />
mit Hesiod aufzählen hören: Haus, Weib <strong>und</strong> Ochse, wobei<br />
dann noch die Bemerkung beigefügt ist, daß <strong>de</strong>r arbeiten<strong>de</strong><br />
Ochse für <strong>de</strong>n armen Mann die Stelle <strong>de</strong>s Sklaven ersetze<br />
(Pol. 1,1). Aristoteles hält es mit Homer, gemäß welchem <strong>de</strong>r<br />
Hausvater <strong>de</strong>r Gesetzgeber für Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Frauen ist. Nimmt<br />
man nun noch <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong>gedanken <strong>de</strong>r aristotelischen Politik,<br />
daß <strong>de</strong>r Vater in seiner gesellschaftlichen Funktion Bürger ist,<br />
hinzu, dann kann man sich die Folgen für die Erziehungspolitik<br />
von selbst vorstellen. Darum auch behan<strong>de</strong>lt Aristoteles Ehe<br />
<strong>und</strong> Erziehung nicht etwa im Traktat über die Hausgemein<br />
schaft, son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Staatslehre. Den Unterschied zwischen<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> Staat kennt Aristoteles nicht. Die Gesellschaft<br />
wächst bei ihm organisch in die Form <strong>de</strong>s Staates hinein, so daß<br />
<strong>de</strong>r Staat die „vollkommene Gesellschaft" wird. In dieser voll<br />
kommenen Gesellschaft aber verschwin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Organismus,<br />
obwohl Aristoteles noch äußerlich von ihm re<strong>de</strong>t. In diesem<br />
Schein-Organismus wird das Gesetz zur Seele, so also zum<br />
299
57. 4 eigentlichen Formprinzip. Mit an<strong>de</strong>ren Worten: alles ist staat<br />
lich. Nicht zuletzt trägt <strong>de</strong>r aristotelische Gesellschafts- <strong>und</strong><br />
Staatsbegriff die Schuld, daß in <strong>de</strong>r Summa <strong>de</strong>s hl. Thomas kein<br />
sozialethischer Traktat über die Familie o<strong>de</strong>r die Berufsstän<strong>de</strong><br />
zu fin<strong>de</strong>n ist. Der Stän<strong>de</strong>gedanke wur<strong>de</strong> Thomas dort, wo er<br />
ihn bespricht (Kleriker- <strong>und</strong> Or<strong>de</strong>nsstand), nicht etwa durch<br />
<strong>de</strong>n Gesellschaftsbegriff, son<strong>de</strong>rn einzig durch das kirchliche<br />
<strong>Recht</strong> aufgedrängt.<br />
Einen unverkennbaren Rest aristotelischen <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nkens<br />
möchte man bei Thomas hier im vierten Artikel (Antw.; vgl.<br />
auch Zu 3) fin<strong>de</strong>n. Thomas erklärt hier, daß dort, wo zwei Men<br />
schen eine unmittelbare Beziehung zum Staat <strong>und</strong> <strong>de</strong>ssen Für<br />
sten haben, eine Beziehung mit vollgültigem <strong>Recht</strong>scharakter<br />
vorliege. Man gewinnt also <strong>de</strong>n Eindruck, als ob <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>s<br />
charakter nach <strong>de</strong>m Verhältnis abgestuft wür<strong>de</strong>, in welchem <strong>de</strong>r<br />
einzelne zum Staat steht, ob unmittelbar o<strong>de</strong>r mittelbar, ob<br />
direkt als Mensch o<strong>de</strong>r nur über <strong>de</strong>n Gatten, <strong>de</strong>n Vater o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n<br />
Herrn. Nach Aristoteles war <strong>Recht</strong>sträger einzig <strong>de</strong>r Bürger. Hat<br />
sich Thomas dieser Auffassung restlos angeschlossen?<br />
Während Aristoteles noch sehr stark an <strong>de</strong>n griechischen<br />
Stadt-Staat dachte <strong>und</strong> von hier aus seine Philosophie über die<br />
Entstehung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s begann, schreitet Thomas viel weiter in<br />
die Abstraktion, zum Staat an sich. Hier aber gilt uneinge<br />
schränkt, daß <strong>de</strong>r Staat als die letzte <strong>und</strong> höchste Gesellschaft<br />
das oberste rechtliche Bezugssystem darstellt. Thomas ist, wie<br />
bereits gesagt wur<strong>de</strong>, Monist im Sinne <strong>de</strong>r einen naturrechtli<br />
chen Norm, die je<strong>de</strong> Kollision mit <strong>de</strong>m positiven <strong>Recht</strong> aus<br />
schließt, weil dieses, wenn es in Kollision treten wür<strong>de</strong>, bereits<br />
nicht mehr <strong>Recht</strong> wäre. Das hin<strong>de</strong>rt nicht, daß Thomas dieses<br />
gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nken mit <strong>de</strong>m mittelalterlichen Staat in<br />
Verbindung bringt. Der Ausgang seiner Politik ist aber das<br />
bonum humanum, nicht das Wohl eines konkreten Staatsgebil<br />
<strong>de</strong>s. Deutlich wird diese Weite <strong>de</strong>s Gesichtswinkels in Zu 2, wo<br />
Thomas erklärt, daß zwischen Vater <strong>und</strong> Sohn, Herrn <strong>und</strong> Skla<br />
ven nicht nur das Vater-Sohn- <strong>und</strong> Herr-Sklave-Verhältnis<br />
besteht, son<strong>de</strong>rn zugleich die <strong>Recht</strong>sbeziehung zwischen<br />
Mensch <strong>und</strong> Mensch.<br />
Trotz dieser gr<strong>und</strong>sätzlichen <strong>Recht</strong>sgleichheit zwischen<br />
Vater <strong>und</strong> Sohn kann Thomas die Ansicht verteidigen, daß <strong>de</strong>r<br />
Sohn ein Teil <strong>de</strong>s Vaters ist <strong>und</strong> ihm darum rechtlich untersteht,<br />
nicht im Menschsein, aber im Sohnsein, mit all <strong>de</strong>n Folgen die-<br />
300
ses so gearteten Verhältnisses. Es ist sattsam bekannt, welch un- 57.4<br />
geheure Tragweite diese naturrechtliche Lehre hat: das <strong>Recht</strong><br />
<strong>de</strong>r Eltern auf die Erziehung <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> das damit gege<br />
bene Schulrecht. Für Thomas war dies alles noch kein Problem.<br />
Für ihn stand im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong> die in II-II 10,12 (DT, Bd. 15)<br />
aufgeworfene Frage, wie es sich mit <strong>de</strong>r Taufe von ungläubigen<br />
<strong>und</strong> jüdischen Kin<strong>de</strong>rn gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>s Vaters verhalte.<br />
Die völlig gesellschaftlich geformte Staatsauffassung <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas konnte <strong>de</strong>r Frau nicht die bürgerlichen <strong>Recht</strong>e zuspre<br />
chen wie <strong>de</strong>m Mann. Der Staat als vollkommene Gesellschaft<br />
bil<strong>de</strong>t sich aus <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Gesellschaftskörpern, vorab<br />
aus <strong>de</strong>n Familien. In <strong>de</strong>r Familie aber ist die Frau <strong>de</strong>m Mann<br />
untergeordnet, wenngleich nicht in <strong>de</strong>m Maße wie etwa <strong>de</strong>r<br />
Sohn <strong>de</strong>m Vater o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Diener <strong>de</strong>m Herrn (vgl. Antw.). Die<br />
unmittelbare Beziehung zur Hausgemeinschaft geht bei <strong>de</strong>r<br />
Frau vor. Darum ist sie nicht unmittelbarer Träger von bürgerli<br />
chen <strong>Recht</strong>en.<br />
Die wirtschaftliche <strong>und</strong> politische Entwicklung aber hat <strong>de</strong>r<br />
Frau neue Aufgaben zugewiesen, die sie unmittelbar ins poli<br />
tische Leben hineinstellt. Erst recht gilt dies, seit<strong>de</strong>m man die<br />
letzten Folgerungen aus <strong>de</strong>r politischen Emanzipation <strong>de</strong>r Frau<br />
gezogen hat, in<strong>de</strong>m man sie sogar in <strong>de</strong>n Kriegsdienst stellte,<br />
wenigstens in <strong>de</strong>m Maße, als sie ihrer physischen <strong>und</strong> psychi<br />
schen Konstitution nach diesen Dienst zu leisten vermag: Ver<br />
w<strong>und</strong>etendienst, selbst an <strong>de</strong>r Front, Luftsch<strong>utz</strong>organisationen,<br />
Schreibkraft beim Militär usw. Daß die Frau in politischen Din<br />
gen mitzusprechen das <strong>Recht</strong> hat, ergibt sich aus <strong>de</strong>r unwan<strong>de</strong>l<br />
bar gewor<strong>de</strong>nen Stellung, welche sie in <strong>de</strong>m durch Arbeitstei<br />
lung weitverzweigten Wirtschaftsprozeß innehat. Unsere Wirt<br />
schaft ist keine Hauswirtschaft mehr. Eines je<strong>de</strong>n Existenz ist in<br />
die Wirtschaftspolitik mithineinverflochten, <strong>de</strong>ren Hauptpro<br />
blem die — richtig verstan<strong>de</strong>ne — Vollbeschäftigung ist, just also<br />
die Frage, die <strong>de</strong>r Frau äußerst nahegeht, da ein Großteil von<br />
Frauen keine Möglichkeit zur Gründung eines Familienstan<strong>de</strong>s<br />
fin<strong>de</strong>t.<br />
Die Mo<strong>de</strong>rne hat mit <strong>de</strong>r gr<strong>und</strong>sätzlichen Gleichstellung von<br />
Mann <strong>und</strong> Frau, wovon Thomas hier an<strong>de</strong>utungsweise spricht,<br />
in einer neuen gesellschaftlichen Situation Ernst gemacht <strong>und</strong><br />
so — wenigstens in <strong>de</strong>n meisten Staaten — die politische Gleich<br />
heit bei<strong>de</strong>r erklärt. Thomas konnte zu diesem Schluß noch<br />
nicht kommen, nicht etwa nur wegen <strong>de</strong>r starken Abhängigkeit<br />
301
von Aristoteles, son<strong>de</strong>rn auch im Hinblick auf die Struktur <strong>de</strong>r<br />
damaligen Gesellschaft. Die Anwendung eines naturrechtlichen<br />
Prinzips ist eben je <strong>und</strong> je verschie<strong>de</strong>n, entsprechend <strong>de</strong>r kon<br />
kreten Befindlichkeit sowohl <strong>de</strong>s Menschen wie <strong>de</strong>r Gesell<br />
schaft, entsprechend <strong>de</strong>m Satz, <strong>de</strong>n Thomas in Art. 2 Zu 1 aus<br />
gesprochen hat: „Die Natur <strong>de</strong>s Menschen ist verän<strong>de</strong>rlich".<br />
Das will heißen: Die sachgegebenen Umstän<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>nen wir<br />
leben, än<strong>de</strong>rn sich unaufhaltsam, so daß wir entsprechend auch<br />
die Ordnungsformen än<strong>de</strong>rn müssen.<br />
Zweites Kapitel<br />
GERECHTIGKEIT ALS TUGEND<br />
(Fr. 58)<br />
1. DIE ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNG DER GERECHTIGKEIT<br />
UND DEREN SITTLICHE BEWANDTNIS<br />
(An. 1-4)<br />
Die <strong>Gerechtigkeit</strong>, um die es hier geht, ist nicht die allge<br />
meine <strong>Recht</strong>heit im Sinne Anselms (vgl. Art. 1, Einw. 2), auch<br />
nicht die übernatürliche <strong>Recht</strong>fertigung durch <strong>und</strong> vor Gott<br />
(vgl. Art. 2, Einw. 1), son<strong>de</strong>rn die sittliche Stärke, welche das<br />
<strong>Recht</strong> <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn gegenüber verwirklichen soll. Thomas hat<br />
bei <strong>de</strong>r Abfassung <strong>de</strong>s ersten Artikels, wo es um die Definition<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> in diesem eigentlichen Sinne geht, die durch<br />
die Institutionen Justinians übernommene Definition Ulpians<br />
vor Augen: „Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist <strong>de</strong>r anhalten<strong>de</strong> <strong>und</strong> feste<br />
Wille, je<strong>de</strong>m sein <strong>Recht</strong> zu geben". Ulpian fin<strong>de</strong>t dabei <strong>de</strong>n Bei<br />
fall <strong>de</strong>s hl. Thomas mit <strong>de</strong>r einen Verbesserung, daß es bei <strong>de</strong>r<br />
Definition von Tugen<strong>de</strong>n, wie Thomas sagt, eigentlich nicht um<br />
<strong>de</strong>n Willensakt, son<strong>de</strong>rn um eine dauern<strong>de</strong> sittliche Haltung<br />
gehe. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e fin<strong>de</strong>t Thomas die aristotelische<br />
Definition aus <strong>de</strong>m 5. Buch <strong>de</strong>r Ethik besser, wie er am Schluß<br />
<strong>de</strong>s Artikels leicht an<strong>de</strong>utet: „Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist jener Habi<br />
tus, auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>ssen jemand sich für das <strong>Recht</strong> entschei<strong>de</strong>t".<br />
Es möchte vielleicht überflüssig <strong>und</strong> belanglos erscheinen,<br />
wenn dann Thomas, nach<strong>de</strong>m er doch bereits in <strong>de</strong>r vorigen<br />
Frage die innere Bewandtnis <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s als einer Frie<strong>de</strong>nsord<br />
nung zwischen vielen getrennten Personen dargestellt hat, nun<br />
im zweiten Artikel nochmals fragt, ob die <strong>Gerechtigkeit</strong> immer<br />
302
auf einen an<strong>de</strong>rn bezogen sei. Und <strong>de</strong>nnoch be<strong>de</strong>utet gera<strong>de</strong> 58. 1-4<br />
diese Frage <strong>de</strong>n Auftakt zu <strong>de</strong>r Abklärung <strong>de</strong>r Diskussion <strong>de</strong>s<br />
dritten Artikels, ob die <strong>Gerechtigkeit</strong> als Tugend bezeichnet<br />
wer<strong>de</strong>n könne. Es bleibt nämlich immer Eigenheit <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit, <strong>de</strong>n Abstand <strong>de</strong>s Ich vom Du zu behalten <strong>und</strong> keine Ver<br />
mengung <strong>de</strong>r Interessen vorzunehmen. So möchte es eben<br />
scheinen, daß <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s Guten völlig schwin<strong>de</strong>t. Und dies<br />
aus einem doppelten Gr<strong>und</strong>e: l.Es wird scheinbar die Tren<br />
nung vor <strong>de</strong>r Gemeinsamkeit bevorzugt, wo im Verhältnis zwi<br />
schen <strong>de</strong>n Menschen doch gera<strong>de</strong> im Zusammenstehen <strong>und</strong><br />
Vereinigen die Vollendung zu liegen scheint; 2. <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong><br />
scheint sich die Vorstellung <strong>de</strong>s Zwanges notwendig zu verbin<br />
<strong>de</strong>n, so daß die sittliche Größe <strong>de</strong>s gerechten Han<strong>de</strong>lns völlig<br />
verschwin<strong>de</strong>t. Mit dieser zweiten Schwierigkeit beschäftigt sich<br />
Thomas ausdrücklich im dritten Artikel, während die erste im<br />
Gedankengang <strong>de</strong>s zweiten Artikels verborgen liegt.<br />
Was nun die erste Fragestellung betrifft, so betont Thomas<br />
zwar mit Nachdruck (Art. 2) das wesentliche Element in jegli<br />
cher Form von <strong>Gerechtigkeit</strong>: das „Ein-an<strong>de</strong>rer-sein". Er erklärt<br />
aber dabei, daß es bei aller Verschie<strong>de</strong>nheit eben doch auf einen<br />
Ausgleich ankommt, ohne dabei auf eine Verwischung <strong>de</strong>r In<br />
teressen hinzusteuern. Zurückgreifend auf diesen Gedanken,<br />
formuliert Thomas zu Beginn <strong>de</strong>s fünften Artikels das Ergebnis<br />
<strong>de</strong>s zweiten: Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ordnet <strong>de</strong>n Menschen in seinem<br />
Verhältnis zu einem an<strong>de</strong>rn. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> sieht es also<br />
nicht auf das Ich ab in seiner Geschie<strong>de</strong>nheit vom Du, son<strong>de</strong>rn<br />
auf die Ordnung <strong>de</strong>s Ich zum Du. Sie ist Frie<strong>de</strong>nsordnung.<br />
Damit ist ihre sittliche Aufgabe gewahrt.<br />
Auf die zweite Frage eingehend, unterstreicht Thomas<br />
(Art. 3) nochmals die Bewandtnis <strong>de</strong>s Guten im <strong>Recht</strong> gegen<br />
über je<strong>de</strong>m Zwangsnormensystem, von <strong>de</strong>m in <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sphi<br />
losophie Kelsens ausschließlich die Re<strong>de</strong> ist. Der Gedanke <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>szwanges ist erst eine weitere Konsequenz, die sich aus<br />
<strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>sgutes ergibt. Er folgt erst aus <strong>de</strong>m<br />
Guten, das die Bewandtnis <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s hat, insofern <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re,<br />
auf seinen <strong>Recht</strong>sanspruch pochend, zu Gegenmaßnahmen<br />
greift <strong>und</strong> damit zur <strong>Recht</strong>sbefolgung zwingt. Man kann aller<br />
dings <strong>de</strong>n Gedanken <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>szwanges aus <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> selbst<br />
nicht bannen. Er ergibt sich aus <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>s Geschie<strong>de</strong>n<br />
seins <strong>de</strong>rer, zwischen <strong>de</strong>nen die Frie<strong>de</strong>nsordnung hergestellt<br />
wer<strong>de</strong>n soll.<br />
303
58. 1-4 Der Zwang bleibt aber im Wesen <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s nur als Möglich<br />
keit beschlossen <strong>und</strong> verborgen. Es ist für das <strong>Recht</strong> durchaus<br />
nicht wesentlich, sich tatsächlich im Zwang auszuwirken. Tho<br />
mas unterstreicht also <strong>de</strong>n unleugbaren sittlichen Wert <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s. Aus ihm leitet er ab, daß die Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
zum vollkommenen Menschen gehört, daß es darum ein utopi<br />
scher Gedanke ist, sich eine Gemeinschaft vorzustellen, die nur<br />
Liebesverband wäre. Sosehr die Liebe vorherrschen mag, wie<br />
die Theologie sich dies für <strong>de</strong>n paradiesischen Menschen <strong>und</strong><br />
für <strong>de</strong>n Zustand am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Dinge für das Jenseits vorstellt, so<br />
bleibt doch das wahre Gut <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s immer bestehen, insofern<br />
die Menschen unter sich getrennte Wesen mit eigenständiger<br />
Handlungsweise darstellen. Der Zwang liegt freilich bei diesem<br />
I<strong>de</strong>alzustand außerhalb <strong>de</strong>r Betrachtung. Er bleibt aber doch in<br />
<strong>de</strong>r Möglichkeit beschlossen, für <strong>de</strong>n Fall, daß <strong>de</strong>r eine <strong>de</strong>m<br />
an<strong>de</strong>rn nicht freiwillig das Seine gäbe. Die Vorstellung Tolstois<br />
von einer reinen Liebesgemeinschaft mag viel Verlocken<strong>de</strong>s an<br />
sich haben, ähnlich wie die erdachten Ausführungen mancher<br />
Kirchenväter über ein verlängertes Paradiesesdasein.<br />
Allerdings könnte man sich weiterhin die ernste Frage vor<br />
legen, ob die <strong>Gerechtigkeit</strong> nur die freie sittliche Einstellung zu<br />
<strong>de</strong>m Gut <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s sei o<strong>de</strong>r ob sich darin nicht doch auch eine<br />
gewisse Unterwerfung unter ein Gesetz <strong>und</strong> damit unter einen<br />
Gesetzgeber fin<strong>de</strong>. Mit dieser Frage stoßen wir wohl o<strong>de</strong>r übel<br />
doch auf das Problem <strong>de</strong>s Zuammenhangs zwischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong><br />
Autorität. Thomas spricht hiervon an unserer Stelle nicht. Wir<br />
begnügen uns daher damit, die Schwierigkeit nur kurz zu strei<br />
fen.<br />
Man beachte, daß es in <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>r Beziehung <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s zur Autorität keineswegs um die Frage nach <strong>de</strong>m Zwang<br />
geht. Auch hier bleibt die Vorstellung <strong>de</strong>s Zwanges zweitrangig,<br />
insofern man sich eine Autorität vorstellen kann, die nur Ord<br />
nungsprinzip <strong>und</strong> nur <strong>de</strong>r Möglichkeit, nicht unbedingt <strong>de</strong>r Tat<br />
sächlichkeit nach, Vollzieherin <strong>de</strong>s Zwanges ist.<br />
Thomas kann sich, wie sich aus seinem Traktat über das<br />
Gesetz (I—II 90-108; DT, Bd. 13) ergibt, das <strong>Recht</strong> ohne<br />
Gesetz <strong>und</strong> so auch ohne Gesetzgeber nicht vorstellen. Gera<strong>de</strong><br />
hier liegt ja <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>, warum er im <strong>Recht</strong>, mit welchem ein<br />
an<strong>de</strong>rer gegen uns auftritt, nicht nur eine frem<strong>de</strong> Zwangshand<br />
lung sieht, son<strong>de</strong>rn ein wahres sittliches Gut, das Frie<strong>de</strong>n zwi<br />
schen uns stiftet. Die Hobbessche Vorstellung sah im Mitmen-<br />
304
sehen einen Wolf, <strong>de</strong>m gegenüber man sich sichern muß, was 58. 1-4<br />
nur durch gegenseitige Ubereinkunft, durch ein notgedrungen<br />
vereinbartes <strong>Recht</strong>ssystem möglich sei. Für Thomas ist das<br />
<strong>Recht</strong>ssystem kein notgedrungenes Frie<strong>de</strong>nsabkommen, son<br />
<strong>de</strong>rn ein Ordnungsgefüge, das die Partner vorfin<strong>de</strong>n, nicht<br />
eigenmächtig schaffen.<br />
Es liegt nun in <strong>de</strong>r Eigenart <strong>de</strong>s kausalen Denkens, sogleich<br />
nach <strong>de</strong>m Woher dieser Frie<strong>de</strong>nsordnung zu fragen. Gewiß hat<br />
<strong>de</strong>r Positivismus <strong>und</strong> vor allem Kelsen dieses Fragen nach <strong>de</strong>r<br />
Ursache als ein <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nken artfrem<strong>de</strong>s Vorgehen<br />
bezeichnet. Und <strong>de</strong>nnoch bewegt sich Thomas ganz folgerich<br />
tig nur auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s rechtlichen Denkens <strong>und</strong> begibt sich<br />
keineswegs hinüber auf <strong>de</strong>n allgemeinen Bereich kausalen Wir<br />
kens, etwa in <strong>de</strong>n Gedanken <strong>de</strong>r Weltschöpfung durch Gott. Wo<br />
immer ein Mensch uns gegenüber mit einem Anspruch auftritt,<br />
spricht er ein gewisses Machtwort, in <strong>de</strong>r Weise nämlich, als er<br />
sich je<strong>de</strong> Einmischung von an<strong>de</strong>rer Seite verbittet <strong>und</strong> auf seine<br />
Eigenständigkeit pocht. Er muß sich also von selbst als uns<br />
überlegen ausweisen, zwar nicht durch die Kraft seiner Faust,<br />
son<strong>de</strong>rn vielmehr durch die Macht <strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ellen Gehaltes, um<br />
<strong>de</strong>ssentwillen er sich uns gegenüber als unantastbar bezeichnet.<br />
Die Tatsache nun, daß auf unserer Seite <strong>de</strong>m Selbständigkeits<br />
anspruch <strong>de</strong>s Mitmenschen gegenüber eine spontane Aner<br />
kennung dieser seiner Eigenständigkeit entspricht, zeigt <strong>de</strong>ut<br />
lich, daß hier ein Frie<strong>de</strong>nsordnungsprinzip vorliegt, das wir<br />
nicht aus uns haben, das vielmehr zurück- o<strong>de</strong>r hinüberweist<br />
auf eine bei<strong>de</strong>n übergeordnete Gesetzes-Macht, die wir als <strong>de</strong>n<br />
Schöpfer unserer geistigen Eigenständigkeit bezeichnen müs<br />
sen. Verbin<strong>de</strong>n wir diese aus unzwei<strong>de</strong>utig juristischem Denk-<br />
prozeß ermittelte höchste Autorität mit <strong>de</strong>m ontologisch-kau-<br />
salen Denken, dann wer<strong>de</strong>n wir sie nur mit <strong>de</strong>m Namen „ Gott"<br />
anre<strong>de</strong>n können. Wenn Kelsen solches Denken mit <strong>de</strong>m Aber<br />
glauben <strong>de</strong>r Primitiven vergleicht, als ob es sich hier um die un-<br />
bewußten Auswirkungen einer Angst vor <strong>de</strong>m frem<strong>de</strong>n Wesen<br />
handle, das uns Blitz <strong>und</strong> Donner schickt, dann übersieht er die<br />
Gr<strong>und</strong>struktur unseres kausalen Denkens, <strong>de</strong>m auch er nicht<br />
entrinnen kann.<br />
Thomas spricht von all <strong>de</strong>m hier in unserer Frage nicht mehr,<br />
weil es ihm eine Selbstverständlichkeit ist. Er zieht nur die<br />
Schlußfolgerung (Art. 3): Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist eine wahre<br />
Tugend, eine sittliche Einstellung auf das Gut <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s.<br />
305
58. 1-4 Daraus mag man zugleich erkennen, daß es einfach eine<br />
absolute Unmöglichkeit ist, <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Moral zu trennen, d. h.<br />
<strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s von <strong>de</strong>m <strong>de</strong>s Guten loszu<strong>de</strong>nken, um<br />
eine reine <strong>Recht</strong>slehre im Sinne Kelsens auszubauen. Allerdings<br />
ist das Gute <strong>und</strong> das <strong>Recht</strong> nicht schlechthin dasselbe. Aber das<br />
<strong>Recht</strong> ist ein Gut <strong>und</strong> nur als ein Gut vorstellbar. So ist auch die<br />
scholastische Auffassung <strong>de</strong>r Sozialethik gerechtfertigt, welche<br />
in <strong>de</strong>r Sozialetik das rechtlich geordnete Gefüge <strong>de</strong>r Gesell<br />
schaft betrachtet. Es wäre verhängnisvoll, ausgehend vom kan<br />
tischen Standpunkt zu meinen, daß die Ethik nur die Entwick<br />
lung o<strong>de</strong>r Entfaltung <strong>de</strong>s persönlichen kategorischen Impera<br />
tivs zum Gegenstand habe. Damit wäre natürlich je<strong>de</strong> Ethik <strong>de</strong>s<br />
Sozialen außer Kurs gesetzt. An<strong>de</strong>rerseits besagt diese Uber<br />
einstimmung von Gut <strong>und</strong> <strong>Recht</strong> nicht, daß Sozialethik <strong>und</strong><br />
<strong>Recht</strong>, im Sinne von positivem <strong>Recht</strong>, sich <strong>de</strong>cken wür<strong>de</strong>n. In<br />
<strong>de</strong>r Schaffung positiven <strong>Recht</strong>s sind wir Vertragspartner, wenig<br />
stens zu einem großen Teil, so daß wir hier die freie Willensbil<br />
dung aller in Betracht ziehen müssen, also vom „I<strong>de</strong>al" <strong>de</strong>r<br />
natürlichen Sittlichkeit oft genug dadurch abweichen, daß wir<br />
nicht abzuän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> sittliche Deka<strong>de</strong>nz in Kauf nehmen. Hier<br />
erhält die absolute Ethik <strong>de</strong>n Charakter einer „Situations<br />
ethik", d. h. einer Ethik, die sich <strong>de</strong>r gegebenen soziologischen<br />
<strong>und</strong> psychologischen Verfassung <strong>de</strong>r Gesellschaft anpaßt, weil<br />
an<strong>de</strong>rs eine Frie<strong>de</strong>nsordnung nicht möglich wäre. In <strong>de</strong>r positi<br />
ven <strong>Recht</strong>sgestaltung müssen wir oft genug moralische Übel<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft hinnehmen (vgl. Ehescheidungsgesetze), um<br />
wenigstens ein Min<strong>de</strong>stmaß <strong>de</strong>r an sich für alle unbedingt gel<br />
ten<strong>de</strong>n Ethik zu retten.<br />
Dennoch aber bleibt die Schlußfolgerung <strong>de</strong>s hl. Thomas<br />
bestehen: Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist eine wahre Tugend, eine sitt<br />
liche Einstellung auf das Gut <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. Daß das <strong>Recht</strong> seiner<br />
seits wesentlich die Autorität einschließt, kann seinen sittlichen<br />
Wert nicht beeinträchtigen, da die Autorität keine Heteronomie<br />
be<strong>de</strong>utet, wie Kant gemeint hat. Denn die Autorität ist bereits in<br />
das sittliche Apriori unserer Vernunft verwoben. Be<strong>de</strong>utet doch<br />
das Urgewissen, die sogenannte Syn<strong>de</strong>resis, nicht einfachhin<br />
das Hören auf eine außenstehen<strong>de</strong> Macht, son<strong>de</strong>rn eine uns ein<br />
geschaffene Teilhabe <strong>de</strong>r göttlichen Autorität 1 . Unser kategori-<br />
1 Vgl. A.F.Utz, Ethik, Hei<strong>de</strong>lberg 1970, 145.<br />
306
scher Imperativ, um Kants Ausdruckweise zu gebrauchen, ist<br />
eben eine Partizipation göttlichen Imperativs.<br />
Im Anschluß an die Frage nach <strong>de</strong>r sittlichen Bewandtnis <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> konnte Thomas, <strong>de</strong>r in unserem Traktat weitge<br />
hend Aristoteles folgt, die Frage nach <strong>de</strong>m psychologischen Trä<br />
ger <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht übergehen (Art. 4). Ari<br />
stoteles hatte die <strong>Gerechtigkeit</strong> in <strong>de</strong>n sinnlichen Strebeteil ver<br />
legt, Thomas dagegen schreibt sie <strong>de</strong>m Willen zu. Für uns liegt<br />
heute dies Problem am Ran<strong>de</strong>, während es für Thomas aus<br />
geschichtlichen <strong>und</strong> theologischen Grün<strong>de</strong>n nicht zu umgehen<br />
war 2 .<br />
2. DIE ALLGEMEINE GERECHTIGKEIT.<br />
DAS PROBLEM DER SOZIALEN GERECHTIGKEIT<br />
(Art. 5 u. 6).<br />
In <strong>de</strong>n Artikeln 5 ff. beschäftigt sich <strong>de</strong>r hl. Thomas mit einer<br />
alten, von Aristoteles stammen<strong>de</strong>n Einteilung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>,<br />
die beson<strong>de</strong>re Aufmerksamkeit verdient: die Unterscheidung<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> in Gemeinwohl- <strong>und</strong> ScWergerechtigkeit,<br />
wobei letztere wie<strong>de</strong>rum untergeteilt wird in austeilen<strong>de</strong> <strong>und</strong><br />
ausgleichen<strong>de</strong>.<br />
Man wür<strong>de</strong> Thomas falsch verstehen, wollte man diese Teil<br />
gerechtigkeiten nur als verschie<strong>de</strong>ne Gesichtspunkte einer ein<br />
zigen sittlichen Haltung betrachten <strong>und</strong> dabei die Sicht auf die<br />
Verschie<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>s Objekts, d. h. die Unterscheidung von Sei<br />
ten <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s übersehen. Gemäß <strong>de</strong>r aristotelisch-thomisti-<br />
schen Philosophie wird jegliche seelische, erst recht sittliche<br />
Haltung vom Objekt her bestimmt.<br />
Allerdings wäre man wie<strong>de</strong>rum auf falscher Fährte, wollte<br />
man glauben, Thomas fän<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r besagten Glie<strong>de</strong><br />
rung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> in <strong>de</strong>r Wesensfunktion <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, d. h.<br />
im <strong>Recht</strong> als solchem. Das <strong>Recht</strong> ist immer Frie<strong>de</strong>nsordnung<br />
zwischen verschie<strong>de</strong>nen Subjekten. Der Unterschied zwischen<br />
Gemeinwohl- <strong>und</strong> Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit ist darum nicht in einer<br />
Verschie<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>r wesentlichen <strong>Recht</strong>sfunktion zu suchen.<br />
Thomas erklärt dies ausdrücklich, wenn er (Art. 5) sagt, daß<br />
sich in bei<strong>de</strong>n die „eigentliche Bewandtnis" <strong>de</strong>s Gerechtseins<br />
bewahrheite (sec<strong>und</strong>um propriam rationem).<br />
2 Siehe meinen Kommentar in DT, Bd. 11, 545—550.<br />
307
Man erinnert sich bei dieser Gelegenheit <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s Arti<br />
kels 5 in Frage 57, wo das Verhältnis zwischen Vater <strong>und</strong> Kind<br />
nicht als streng rechtliche Beziehung bezeichnet wur<strong>de</strong>. Dort<br />
wäre eine solche Bezeichnung „<strong>Gerechtigkeit</strong>" in ihrer eigentli<br />
chen Bewandtnis für die Vater-Sohn-Beziehung nicht möglich<br />
gewesen. Dagegen heißt es hier, daß auch die Gemeinwohlge<br />
rechtigkeit zur Kategorie <strong>de</strong>s strengen <strong>Recht</strong>s gehöre, wenn<br />
gleich <strong>de</strong>r einzelne Mensch als Teil <strong>de</strong>s Ganzen bezeichnet wird,<br />
wie ähnlich in 57,5 <strong>de</strong>r Sohn als Teil <strong>de</strong>s Vaters. Man mag daraus<br />
die Be<strong>de</strong>utung dieser an sich unscheinbaren <strong>und</strong> im allgemeinen<br />
wenig beachteten, sogar „mißachteten" Bemerkung in unserem<br />
Artikel erkennen. In <strong>de</strong>r Diskussion über die Wie<strong>de</strong>rgutma<br />
chung hätte man darauf das Augenmerk richten sollen (vgl.<br />
Kommentar zu 62,1).<br />
Die Unterscheidung also, um die es hier geht, ist nicht <strong>de</strong>r<br />
Wesensfunktion <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>ssen Sachbereich ent<br />
nommen. Der Sachbereich <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s ist nämlich verschie<strong>de</strong>n,<br />
entsprechend <strong>de</strong>r Verschie<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>s „an<strong>de</strong>rn", <strong>de</strong>m man das<br />
Seine geben soll. Es ist ihm immer das „Seine" zu geben. Wir<br />
verbleiben also im Bereich <strong>de</strong>s strengen <strong>Recht</strong>s. Der „an<strong>de</strong>re"<br />
aber, <strong>de</strong>m das <strong>Recht</strong> gilt, kann eine einzelne Person sein o<strong>de</strong>r die<br />
Gemeinschaft, zu <strong>de</strong>r wir gehören. Im ersten Fall haben wir die<br />
Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit, im zweiten die Gemeinwohlgerechtigkeit.<br />
Um die Gemeinwohlgerechügkek geht es nun zunächst (Art. 5<br />
u. 6).<br />
Der Mensch lebt naturhaft in <strong>de</strong>r Gemeinschaft von Men<br />
schen, er bil<strong>de</strong>t also einen Teil eines Ganzen <strong>und</strong> ist somit <strong>de</strong>m<br />
Ganzen gegenüber verpflichtet. Uberraschend für das mo<strong>de</strong>rne<br />
Denken über die Menschenrechte kommt sodann die völlig ari<br />
stotelische Wendung: „Der Teil aber ist, was er ist, durch das<br />
Ganze". Darum steht <strong>de</strong>r ganze sittliche Mensch in <strong>de</strong>r Spann<br />
weite <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, nämlich <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> erhält dann die Gemeinwohlgerechtigkeit<br />
<strong>de</strong>n Namen „allgemeine <strong>Gerechtigkeit</strong>".<br />
Man <strong>de</strong>nkt unwillkürlich an <strong>de</strong>n Spannschen Universalis<br />
mus: Das Ganze, die Gemeinschaft wird aufgebaut von oben,<br />
vom Universalen <strong>und</strong> Umfassen<strong>de</strong>n her. Die Glie<strong>de</strong>r sind<br />
Funktion <strong>de</strong>s Ganzen. Das Ganze tritt also mit Herrschaftsan<br />
sprüchen an die Glie<strong>de</strong>r heran. Die Anerkennung dieses<br />
Herrschaftsanspruchs vollzieht sich in <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerech<br />
tigkeit. Es möchte fast scheinen, als ob hier <strong>de</strong>r Christ Thomas<br />
308
<strong>de</strong>n Totalitarismus <strong>de</strong>s Hei<strong>de</strong>n Aristoteles kopieren wür<strong>de</strong>. 58. 5/6<br />
Doch können wir <strong>de</strong>m thomasischen Text unmöglich diese<br />
Deutung geben, da Thomas sonst in seinen Werken unzwei<strong>de</strong>u<br />
tig eine personalistische Gesellschaftslehre vorträgt 3 .<br />
Wie aber löst sich <strong>de</strong>r scheinbare Wi<strong>de</strong>rspruch in <strong>de</strong>r Lehre<br />
<strong>de</strong>s hl. Thomas? Man könnte versucht sein, die Antwort darin<br />
zu fin<strong>de</strong>n, daß Thomas eigentlich nur von <strong>de</strong>r Möglichkeit<br />
spricht, die gesamte sittliche Haltung <strong>de</strong>s Individuums auf die<br />
Gemeinschaft auszurichten, wie man etwa von <strong>de</strong>r Liebe sagt,<br />
sie könne sich frei verschenken, ohne dadurch ihren persönli<br />
chen Charakter zu verlieren. Thomas gebraucht ja auch <strong>de</strong>n<br />
Ausdruck „ausrichtbar" <strong>und</strong> nicht „auszurichten". Ebenso:<br />
„Die Akte aller Tugen<strong>de</strong>n können zur <strong>Gerechtigkeit</strong> gehören,<br />
insofern diese <strong>de</strong>n Menschen auf das Gemeinwohl ausrichtet".<br />
An<strong>de</strong>rerseits ist zu be<strong>de</strong>nken, daß wir uns auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r<br />
strengen <strong>Gerechtigkeit</strong> befin<strong>de</strong>n, wo ein unabän<strong>de</strong>rliches Muß<br />
gilt, das vom an<strong>de</strong>rn, nämlich von <strong>de</strong>r Gemeinschaft, eingefor<br />
<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n kann. Zu alle<strong>de</strong>m fährt Thomas fort, die Gemein<br />
wohl- o<strong>de</strong>r allgemeine <strong>Gerechtigkeit</strong> könne auch Gesetzesge<br />
rechtigkeit genannt wer<strong>de</strong>n, insofern <strong>de</strong>r Mensch durch sie sich<br />
<strong>de</strong>m Gesetz unterwirft, welches die Akte aller Tugen<strong>de</strong>n auf das<br />
Gemeinwohl hinordnet.<br />
Die theologische Ordnung bleibt außer acht, da es sich um<br />
ein rein philosophisches Problem han<strong>de</strong>lt. Der Traktat über die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> steht auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Natur, da es darum<br />
geht, was <strong>de</strong>r Mensch <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Naturverbun<br />
<strong>de</strong>nheit schul<strong>de</strong>t. Die übernatürliche Ordnung von Mensch zu<br />
Mensch ist die Ordnung <strong>de</strong>r Liebe, die ihrerseits zwar <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> nicht entraten kann, aber an<strong>de</strong>rerseits eben nicht<br />
selbst <strong>Gerechtigkeit</strong> besagt, son<strong>de</strong>rn weit darüber hinausragt 4 .<br />
Auch <strong>de</strong>m Theologen darf diese philosophische Schauweise<br />
nicht fehlen, da die göttliche Liebe Königin aller Tugen<strong>de</strong>n, auch<br />
3 Vgl. /. Th. Eschmann, Bonum commune etc., Med. St. 5 (1943) 126—165.<br />
A. F. Verpaalen, Der Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls bei Thomas von Aquin, Ein Beitrag<br />
zum Problem <strong>de</strong>s Personalismus. Hei<strong>de</strong>lberg 1954. Die gesamten das<br />
Gemeinwohl betreffen<strong>de</strong>n Thomastexte (von A. F. Verpaalen zusammengestellt)<br />
sind im Teil I meiner Sozialethik abgedruckt.<br />
4 Dabei darf aber nicht übersehen wer<strong>de</strong>n, daß beim Christen jedwe<strong>de</strong> Ungerechtigkeit<br />
zugleich Sün<strong>de</strong> gegen die übernatürliche Gottesliebe ist. Vgl. 59,4<br />
mit Kommentar. Hier wird <strong>de</strong>r unzerreißbare innere Zusammenhang von<br />
natürlicher <strong>und</strong> übernatürlicher Ordnung <strong>de</strong>utlich.<br />
309
58. 5/6 <strong>de</strong>r natürlichen, ist, d. h. <strong>de</strong>n gesamten sittlichen, auch rein<br />
natürlichen Kräftekosmos zur Tätigkeit aufruft. Die innere Er<br />
neuerung <strong>de</strong>r in Gemeinschaft leben<strong>de</strong>n Individuen durch die<br />
Liebe kann noch nicht die ganze gesellschaftliche Erneuerung<br />
be<strong>de</strong>uten, da diese ihre Verwirklichung in einer sogenannten<br />
„Zustän<strong>de</strong>reform", d. h. in rechtlichen Abgrenzungen verlangt.<br />
Es kann also in unserem Artikel keineswegs von einer Hin<br />
ordnung <strong>de</strong>r theologischen o<strong>de</strong>r eingegossenen sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n auf das Gemeinwohl auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gemeinwohlge<br />
rechtigkeit die Re<strong>de</strong> sein. Die Frage bezieht sich einzig auf die<br />
natürlichen Tugen<strong>de</strong>n: „Das Wohl <strong>de</strong>s Bürgers ist nicht das<br />
letzte Ziel <strong>de</strong>r eingegossenen Kardinaltugen<strong>de</strong>n [erst recht<br />
nicht <strong>de</strong>r theologischen Tugen<strong>de</strong>n], son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r erworbenen<br />
Tugen<strong>de</strong>n, von <strong>de</strong>nen bei <strong>de</strong>n Philosophen die Re<strong>de</strong> war" (Virt.<br />
card., 4 Zu 3). Im natürlichen Bereich bewegen sich alle Tugen<br />
<strong>de</strong>n im Raum <strong>de</strong>r sozialen Natur. Zwar anerkennt auch <strong>de</strong>r Phi<br />
losoph ein persönliches Verhältnis eines je<strong>de</strong>n geistigen Wesens<br />
zu Gott. Doch be<strong>de</strong>utet dieses Verhältnis zu Gott in <strong>de</strong>r Natur<br />
keine Tugend, son<strong>de</strong>rn eben Natur. Es liegt in <strong>de</strong>r Teilhabe <strong>de</strong>s<br />
Seins, also im Sein <strong>de</strong>s natürlich Personalen. Das natürliche<br />
Streben nach Gott ist nichts an<strong>de</strong>res als die naturhafte Ausrich<br />
tung <strong>de</strong>s Menschen auf <strong>de</strong>n Schöpfer. Man wird darum in <strong>de</strong>r<br />
Tugendlehre, d. h. unter jenen vom Menschen durch eigenen<br />
sittlichen Fleiß erworbenen sittlichen Kräften, umsonst nach<br />
einer „Tugend" <strong>de</strong>r Gottesliebe suchen. Die Tugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Philo<br />
sophen bewegen sich im Bereich <strong>de</strong>r Mittel zum Endziel, auf<br />
welches wir naturhaft hingeordnet sind. Auf diesem Tätigkeits<br />
feld aber sind wir naturhaft sozial, gesellschaftsverb<strong>und</strong>en.<br />
Unsere naturhafte Gottbezogenheit beweisen wir dadurch, daß<br />
wir uns zu allem „recht" verhalten, was uns umgibt <strong>und</strong> uns un<br />
terstellt ist: <strong>de</strong>m Mitmenschen gegenüber, uns selbst gegenüber<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Welt gegenüber. Dem Mitmenschen gegenüber durch<br />
die <strong>Gerechtigkeit</strong> im eigentlichen Sinn, uns selbst <strong>und</strong> <strong>de</strong>r nicht<br />
geistigen Welt gegenüber durch die Tugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Maßhaltung<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Tapferkeit. Das Objekt <strong>de</strong>r Maßhaltung wie auch jenes<br />
<strong>de</strong>r Tapferkeit steht aber in engem Kontakt mit <strong>de</strong>m Mitmen<br />
schen. Der Genußsüchtige mißbraucht Güter dieser Welt, mit<br />
tels <strong>de</strong>ren er <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Mitmensch sich vervollkommnen sollten.<br />
Die Drogensüchtigen z.B. be<strong>de</strong>uten eine kostenmäßige Bela<br />
stung <strong>de</strong>r Gesellschaft. Der Feige mißachtet Güter, für die er<br />
sich um <strong>de</strong>r Mitmenschen willen einsetzen sollte, weil sie allge-<br />
310
mein menschliche Güter sind. Wenngleich sich ein Großteil <strong>de</strong>r<br />
Maßhaltung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Tapferkeit im geheimen Leben unserer<br />
eigenen Person abspielt, so ist doch das Objekt unserer Lei<strong>de</strong>n<br />
schaften, <strong>de</strong>ren Regelung diesen bei<strong>de</strong>n Tugen<strong>de</strong>n obliegt, aufs<br />
innigste mit <strong>de</strong>r Umwelt verknüpft. Das sittliche Leben kennt<br />
keine säuberliche Abtrennung, son<strong>de</strong>rn ist in sich geeint (vgl.<br />
„Verknüpfung <strong>de</strong>r Tugen<strong>de</strong>n" in I—II 65; DT, Bd. 11). Wir<br />
haben uns nicht nur vor Uberschreitungen zu hüten, die <strong>de</strong>m<br />
Nächsten scha<strong>de</strong>n könnten, son<strong>de</strong>rn müssen darüber hinaus<br />
unsere sittlichen Kräfte positiv einsetzen zur Beteiligung am<br />
Aufbau <strong>de</strong>r Gemeinschaft, am allgemeinen Kulturschaffen, das<br />
nicht nur etwas Personales, son<strong>de</strong>rn zugleich ein soziales Gut<br />
ist. Wür<strong>de</strong>n wir uns <strong>de</strong>m Kulturauftrag, <strong>de</strong>r an die Menschheit<br />
als solche ergangen ist, entziehen, wir wür<strong>de</strong>n nicht nur unsere<br />
persönliche sittliche Vollendung hintansetzen, son<strong>de</strong>rn auch<br />
<strong>de</strong>n Mitmenschen um unseren Beitrag kürzen, <strong>de</strong>n wir ihm auf<br />
gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gemeinsamkeit <strong>de</strong>r menschlichen Natur schul<strong>de</strong>n.<br />
So gilt also in Wahrheit <strong>de</strong>r Satz <strong>de</strong>s hl. Thomas: „Das Gut<br />
einer je<strong>de</strong>n Tugend, ob diese nun <strong>de</strong>n Menschen in sich selbst<br />
o<strong>de</strong>r in Beziehung auf <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rn Einzelmenschen ordnet, ist<br />
auf das Gemeinwohl ausrichtbar", <strong>und</strong> zwar ausrichtbar im<br />
Sinne <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, ist also „auszurichten" auf das<br />
Gemeinwohl, das einen Anspruch auf die sittliche Leistung<br />
eines je<strong>de</strong>n hat.<br />
Der Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls, <strong>de</strong>n Thomas hier zugr<strong>und</strong>e<br />
legt, hat seine eigene Färbung, die wir heute nicht mehr kennen<br />
(vgl. die Exkurse).<br />
Die Gemeinwohlgerechtigkeit wird vom hl. Thomas als eine<br />
eigene Tugend im strengen Sinn aufgefaßt, da sie ein eigenes<br />
Objekt hat, eben das Gemeinwohl (Art. 6). Sie ist aber zugleich<br />
eine Tugend, die die an<strong>de</strong>rn auf sich bezieht, die darum <strong>de</strong>m ge<br />
samten sittlichen Leben eine neue Zielrichtung gibt. In dieser<br />
Hinsicht kann sie als Kommandostelle <strong>de</strong>r natürlichen Tugend<br />
ordnungen bezeichnet wer<strong>de</strong>n. Thomas gibt ihr unter diesem<br />
Betracht <strong>de</strong>n Namen „allgemeine" <strong>Gerechtigkeit</strong>. Nicht, daß<br />
die an<strong>de</strong>ren Tugen<strong>de</strong>n ihre eigene Funktion verlieren. Es soll<br />
nur gesagt sein, daß sie eine neue Werthaftigkeit, eine neue sitt<br />
liche Note, empfangen. Darum ist die Gemeinwohlgerechtig<br />
keit in gewisser Hinsicht in allen Tugen<strong>de</strong>n, wie Thomas (Art. 5<br />
u. 6) sich ausdrückt. Sie wird auch, wie bereits erwähnt, „Geset-<br />
311
zesgerechtigkeit" genannt, weil ihr Objekt durch die Gesetze<br />
bestimmt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Entsprechend <strong>de</strong>m aristotelischen Vorbild unterschei<strong>de</strong>t<br />
Thomas (Art. 6) die Gemeinwohlgerechtigkeit selbst wie<strong>de</strong>rum<br />
je nach <strong>de</strong>m Subjekt, in welchem sie sich fin<strong>de</strong>t, ob im Fürsten<br />
o<strong>de</strong>r im Untertan. Im Fürsten, so meint er, sei sie „hauptsäch<br />
lich" <strong>und</strong> in erster Linie, im Untertan erst zweitlinig <strong>und</strong> aus<br />
führend. Auffallend ist, daß Thomas nicht sagt: eigentlich <strong>und</strong><br />
uneigentlich. Man erinnere sich <strong>de</strong>r Lehre von <strong>de</strong>r politischen<br />
Klugheit in II—II 50,2, wo die gleiche Unterscheidung ange<br />
wandt wird. Hat eigentlich Thomas diese Rangunterschie<strong>de</strong> in<br />
<strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit nicht doch stark im Sinn einer<br />
Wesensunterscheidung gesehen? Aus II—II 50,2 zu schlie<br />
ßen, han<strong>de</strong>lt es sich je<strong>de</strong>nfalls nur um eine gradmäßige Unter<br />
scheidung. Diese Erkenntnis könnte an sich belanglos erschei<br />
nen. Jedoch ergibt sich aus ihr die gr<strong>und</strong>sätzliche politische<br />
Gleichstellung zwischen Regieren<strong>de</strong>m <strong>und</strong> Untertan. In <strong>de</strong>r<br />
mo<strong>de</strong>rnen Demokratie, in welcher ein je<strong>de</strong>r in gleichem Maße<br />
die Verantwortung für das Gemeinwohl übernimmt, ist diese<br />
Erkenntnis eine Selbstverständlichkeit. So wenig die Unter<br />
scheidung zwischen Demokratie <strong>und</strong> Monarchie für die poli<br />
tische Gemeinschaft eine Wesensunterscheidung be<strong>de</strong>utet, son<br />
<strong>de</strong>rn nur <strong>de</strong>ren äußere Form betrifft, ebensowenig berührt die<br />
Unterscheidung <strong>de</strong>r Funktionen, welche <strong>de</strong>m Untertan einer<br />
seits <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Regieren<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rerseits im Staate zufallen, das<br />
Wesen <strong>de</strong>r sittlich-politischen Verantwortung.<br />
3. DIE SONDERGERECHTIGKEIT<br />
(Art. 7-10)<br />
Die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit ist bei Thomas nicht die Gerechtig<br />
keit eines einzelnen Menschen, son<strong>de</strong>rn zu einem einzelnen.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong>e kann Thomas sie unterschei<strong>de</strong>n in ausglei<br />
chen<strong>de</strong> (zwischen zwei einzelnen Menschen) <strong>und</strong> austeilen<strong>de</strong><br />
(vom Gemeinwohl zum einzelnen Menschen). Allerdings sagt<br />
Thomas (61,1) selbst, daß die austeilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> im<br />
Gr<strong>und</strong>e nicht nur <strong>de</strong>n einzelnen, son<strong>de</strong>rn zugleich auch die ge<br />
samte Ordnung im Auge hat, insofern die Güter <strong>de</strong>s Gemein<br />
wohls ordnungsgerecht (sec<strong>und</strong>um proportionalitatem) <strong>de</strong>m<br />
einzelnen zugeteilt wer<strong>de</strong>n. Damit aber nähert sich die austei-<br />
312
len<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>de</strong>s hl. Thomas unserem mo<strong>de</strong>rnen Begriff 58. 7-10<br />
von <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit, die auch als soziale <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
bezeichnet wird. Wir können uns heute, wie im zweiten<br />
Exkurs dargestellt ist, das Gemeinwohl nur noch im Sinn <strong>de</strong>r<br />
ausgeglichenen Proportion <strong>und</strong> Koordination aller vorstellen,<br />
so daß notwendigerweise Gemeinwohlgerechtigkeit <strong>und</strong> aus<br />
teilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> nur verschie<strong>de</strong>ne Funktionen ein <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>rselben <strong>Gerechtigkeit</strong> (<strong>de</strong>r sozialen <strong>Gerechtigkeit</strong>) sind. Für<br />
unser vom Individualismus beeinflußtes <strong>und</strong> <strong>de</strong>r konkreten<br />
<strong>Recht</strong>sverteilung zugewandtes Denken kann das Gemeinwohl,<br />
sofern es Gegenstand <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s ist, nur noch in <strong>de</strong>r Ordnung<br />
<strong>de</strong>r vom Gesetz <strong>de</strong>n vielen einzelnen aufgetragenen Lasten <strong>und</strong><br />
Pflichten bestehen. Allerdings möchte das christliche Denken<br />
sich gegen die Gefangennahme durch <strong>de</strong>n Individualismus<br />
dadurch wehren, daß es eben doch noch eine Zielstrebigkeit <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwesens nach einem I<strong>de</strong>al anerkennt. Damit bleibt <strong>de</strong>m<br />
Gesetz die Vollmacht erhalten, für alle Menschen gelten<strong>de</strong> sitt<br />
liche For<strong>de</strong>rungen rechtskräftig aufzustellen, auch wenn die<br />
faktische Willensbildung, die soziologische Situation, ihnen<br />
wi<strong>de</strong>rstreben wür<strong>de</strong>. Thomas bedurfte dieses Sperriegels gegen<br />
<strong>de</strong>n Individualismus nicht, da die Gemeinwohlgerechtigkeit bei<br />
ihm ein integrales Ja zur Gemeinschaft be<strong>de</strong>utet. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong>e wird <strong>de</strong>r innere Mensch mit seinen Affekten durch die<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit in einer Weise aufgerufen, wie man<br />
es sonst von <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> nicht erwarten wür<strong>de</strong> (Art. 9 Zu<br />
3). Allerdings bleibt es Eigenheit einer je<strong>de</strong>n Art <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit, durch eine äußere Handlung auf die Umwelt zu wirken<br />
(Art. 9 u. 10). In diese äußere Betätigung aber wird bei <strong>de</strong>r<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit das Affektleben <strong>de</strong>s Menschen in<br />
wesentlicher Weise mit hineingezogen (Art. 9 Zu 3).<br />
4. DAS GERECHTE TUN<br />
(Art. 11)<br />
Entsprechend <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>auffassung <strong>de</strong>r Scholastik, daß die 58. 11<br />
Tugend eine dauerhafte sittliche Haltung (Habitus) be<strong>de</strong>ute,<br />
ergibt sich von selbst die Notwendigkeit, <strong>de</strong>n Akt, d. h. die<br />
Äußerung dieser sittlichen Einstellung, zu studieren. Die Ant<br />
wort liegt auf <strong>de</strong>r Hand, da die sittliche Haltung selbst durch<br />
<strong>de</strong>n Akt <strong>und</strong> dieser durch das Objekt bestimmt ist. Das<br />
313
58. Ii Gerechtsein äußert sich im gerechten Tun, das in nichts an<strong>de</strong><br />
rem besteht, als je<strong>de</strong>m das Seine zu geben.<br />
5. DIE WERTHÖHE DER GERECHTIGKEIT<br />
(Art. 12)<br />
58. 12 Der Vergleich <strong>de</strong>r Tugen<strong>de</strong>n nach ihrer Werthöhe ist in <strong>de</strong>r<br />
Ethik <strong>de</strong>s hl. Thomas ein bevorzugtes Thema. Im ersten Teil<br />
seiner Moraltheologie hat er diesem Thema eine eigene Frage<br />
(I—II 66; DT, Bd. 11) gewidmet. In II-II 30,4 (DT, Bd. 16)<br />
erwog er die beson<strong>de</strong>ren Auszeichnungen <strong>de</strong>r Barmherzigkeit.<br />
In II-II 81,7 (DT, Bd. 19) wer<strong>de</strong>n die Vorzüge <strong>de</strong>r Gottesver<br />
ehrung dargestellt. Ahnliche Vergleiche fin<strong>de</strong>n sich an zahlrei<br />
chen an<strong>de</strong>ren Stellen (vgl. II-II 102,3; 104,3; 117,6; 123,12;<br />
136,2; 141,8; 152,5; 155,4; 157,4).<br />
Das Fragen nach <strong>de</strong>r besten Tugend ist keine n<strong>utz</strong>lose Spiele<br />
rei, wenngleich je<strong>de</strong> sittliche Tat ihren eigenen unvergleichlichen<br />
Wert besitzt, so daß ein in <strong>de</strong>r absoluten Wertskala weniger<br />
hoch eingeschätzter Tugendakt auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r konkreten Um<br />
stän<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r persönlichen Intensität usw. Ausdruck höchster sitt<br />
licher Bemühung sein kann. Sofern man aber <strong>de</strong>r Ethik die<br />
Wesenserkenntnis <strong>de</strong>r sittlichen Werte nicht abspricht, muß<br />
man dieser absoluten Wertskala ihre Berechtigung zuerkennen.<br />
Thomas zieht hier keinen Vergleich von <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zu<br />
<strong>de</strong>n theologischen Tugen<strong>de</strong>n, auch nicht zur Klugheit, son<strong>de</strong>rn<br />
lediglich zu <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rn sittlichen Tugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Tapfer<br />
keit <strong>und</strong> Maßhaltung.<br />
Gemäß <strong>de</strong>m Gr<strong>und</strong>satz, daß das Gemeinwohl <strong>de</strong>m Einzel<br />
wohl vorgehe, stellt Thomas ohne Umschweife die Gemein<br />
wohlgerechtigkeit <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n genannten sittlichen Tugen<strong>de</strong>n<br />
voran.<br />
Bezüglich <strong>de</strong>r Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit möchte es schwer schei<br />
nen, das Lob auf die <strong>Gerechtigkeit</strong> aufrechtzuerhalten. Und<br />
<strong>de</strong>nnoch wird Thomas auch dieser Beweis leicht. Die Gerech<br />
tigkeit ist ihm die geistigste unter <strong>de</strong>n sittlichen Tugen<strong>de</strong>n. Dazu<br />
kommt noch, daß sie nicht im Subjekt verbleibt, son<strong>de</strong>rn aus<br />
ihm hinausgeht zum Nächsten. Man vermute hier bei Thomas<br />
nicht die unbesorgte Nachfolge <strong>de</strong>s Philosophen Aristotelesl Es<br />
entspricht durchaus einem gr<strong>und</strong>sätzlich christlichen Gedan<br />
ken, daß eine Tugend, je mehr sie über sich hinaus zum Näch-<br />
314
sten geht, an Vollkommenheit gewinnt. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e<br />
wird die Barmherzigkeit von Thomas (II—II 30,4 Zu 2; DT,<br />
Bd. 16) als die „Summe <strong>de</strong>r christlichen Religion" bezeichnet,<br />
„soweit die äußeren Werke in Frage kommen". Entsprechend<br />
wird hier auf einer Vorstufe <strong>de</strong>r theologischen Tugen<strong>de</strong>n, näm<br />
lich im Bereich <strong>de</strong>r sittlichen Tugen<strong>de</strong>n, die <strong>Gerechtigkeit</strong> als die<br />
vornehmste <strong>de</strong>r Tugen<strong>de</strong>n bezeichnet.<br />
Dies für die mo<strong>de</strong>rne praktische Moral zu notieren, dürfte<br />
beson<strong>de</strong>rs angezeigt sein, nach<strong>de</strong>m durch eine jahrh<strong>und</strong>erte<br />
lange Tradition hindurch <strong>de</strong>r Schwerpunkt <strong>de</strong>r Aufmerksamkeit<br />
auf einer Tugend lag, die in erster Linie das persönlich seelische<br />
Gleichgewicht regelt, nämlich auf <strong>de</strong>r Keuschheit. Ohne die<br />
Werthöhe dieser Tugend, die ihren beson<strong>de</strong>ren christlichen<br />
Glanz durch die Jungfräulichkeit um Christi willen erhält, auch<br />
nur im geringsten herabzusetzen, müssen wir in <strong>de</strong>r absoluten<br />
Wertung <strong>de</strong>nnoch <strong>de</strong>r Tugend, die das Subjekt transzendiert,<br />
<strong>de</strong>n Vorzug geben. In <strong>de</strong>r konkreten Situation allerdings mag<br />
die Keuschheit, vorab die Jungfräulichkeit, eine stärkere sitt<br />
liche Intensität beweisen, weil sie die Uberwindung größerer<br />
subjektiver Schwierigkeiten for<strong>de</strong>rt. Die absolute Werthöhe <strong>de</strong>r<br />
Tugen<strong>de</strong>n wird aber eben nicht nach <strong>de</strong>r Uberwindung <strong>de</strong>r<br />
Hemmungen bestimmt, <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Mensch unterliegt, son<strong>de</strong>rn<br />
gemäß <strong>de</strong>r geistigen Gutheit <strong>de</strong>s Objekts.<br />
Drittes Kapitel<br />
DIE UNGERECHTIGKEIT<br />
(Fr. 59)<br />
Der erste Artikel ist nicht nur durch die biblische Lehre von<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> Ungerechtigkeit (vgl. Einw. 1), son<strong>de</strong>rn<br />
auch durch die Feststellung <strong>de</strong>s praktischen Lebens veranlaßt,<br />
daß nämlich die Ungerechtigkeit selten allein auftritt, son<strong>de</strong>rn<br />
immer mit an<strong>de</strong>rn Verfehlungen zusammen, wie <strong>de</strong>r 2. Ein<br />
wand darstellt.<br />
Wie die Gemeinwohlgerechtigkeit eine eigene Tugend ist, so<br />
be<strong>de</strong>utet <strong>de</strong>r Verstoß gegen sie eine eigene Sün<strong>de</strong> <strong>und</strong>, sofern es<br />
aus verfestigter Haltung geschieht, ein eigenes Laster. Die ego<br />
zentrische Einstellung, welche <strong>de</strong>r Gemeinschaft das Ihrige vor<br />
enthält, ist wirklich Sün<strong>de</strong>, <strong>und</strong> zwar eine eigene Sün<strong>de</strong>, nicht<br />
315
nur unor<strong>de</strong>ntliche Begier<strong>de</strong> nach Reichtum, son<strong>de</strong>rn eine vor<br />
<strong>de</strong>r Gemeinschaft zu verantworten<strong>de</strong> Ungerechtigkeit: asoziale<br />
Haltung <strong>und</strong> Tat. Das Sich-selbst-Abschließen <strong>und</strong> Sich-Sträu-<br />
ben gegenüber <strong>de</strong>r Einglie<strong>de</strong>rung in das allgemeine Kultur<br />
schaffen fügt <strong>de</strong>r Gemeinschaft Scha<strong>de</strong>n zu <strong>und</strong> be<strong>de</strong>utet zu<br />
gleich einen Verstoß gegen die eigene sittliche Vollendung <strong>de</strong>s<br />
Einzelmenschen. Ein erneuter Beweis dafür, wie tief Thomas<br />
die soziale Natur <strong>de</strong>s Menschen als sittliche Aufgabe anerkannt<br />
wissen will.<br />
Wo <strong>de</strong>r Mensch <strong>de</strong>m Mitmenschen das versagt, was ihm<br />
zusteht, liegt, wie Thomas weiter ausführt, eine Ungerechtig<br />
keit gegen die Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit vor.<br />
Allerdings kann man nur dort von Ungerechtigkeit sprechen,<br />
wo ein ungerechtes Wollen im Menschen vorliegt (Art. 2).<br />
Da die <strong>Gerechtigkeit</strong> stets <strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>sanspruch <strong>de</strong>s Mitmen<br />
schen miteinbezieht, so geschieht Ungerechtigkeit niemals,<br />
wenn <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re sich nicht unwillig zeigt, d. h. <strong>de</strong>n ihm zuge<br />
fügten Scha<strong>de</strong>n überhaupt nicht einschätzt (Art. 3). Diese von<br />
Aristoteles stammen<strong>de</strong> Lehre zeitigt verhängnisvolle Folgen,<br />
sobald man <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Naturrechts<strong>de</strong>nkens verläßt, wo es<br />
noch <strong>Recht</strong>e gibt, auf welche <strong>de</strong>r Mitmensch nicht verzichten<br />
kann. Der <strong>Recht</strong>spositivismus, <strong>de</strong>r die Frie<strong>de</strong>nsordnung <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft nicht im Sinne absoluter Normen, son<strong>de</strong>rn als<br />
Ordnung innerhalb verschie<strong>de</strong>ner Willensbildungen auffaßt,<br />
kann folgerichtig z.B. die Homosexualität als strafwürdiges<br />
Verbrechen streichen, sofern die bei<strong>de</strong>n Partner in bei<strong>de</strong>rseiti<br />
ger Einwilligung han<strong>de</strong>ln. Es liegt dann kein Unrecht mehr vor,<br />
zumal wenn die gesamte Gesellschaft an dieser Handlung kei<br />
nen Anstoß mehr nimmt. Im Naturrechts<strong>de</strong>nken jedoch bleibt<br />
die Homosexualität immer ein von <strong>de</strong>r Gesellschaftsmoral<br />
absolut <strong>und</strong> überzeitlich zu verwerfen<strong>de</strong>s Vergehen, so daß sie<br />
immer eine Ungerechtigkeit be<strong>de</strong>utet, nicht nur in <strong>de</strong>m rein reli<br />
giösen Sinn <strong>de</strong>r sündhaften Tat gegen Gott, son<strong>de</strong>rn auch im<br />
zwischenmenschlichen Bereich, weil eben eine Norm verletzt<br />
wird, die <strong>de</strong>r Gesellschaft als Ganzes aufgetragen ist. Auch hier<br />
mag man wie<strong>de</strong>rum die sittliche Spannweite <strong>de</strong>r Gemeinwohl<br />
gerechtigkeit erkennen.<br />
Welches Gewicht die sittliche Verpflichtung zu gerechtem<br />
Han<strong>de</strong>ln besitzt, ergibt sich aus Artikel 4, wo Thomas erklärt,<br />
daß die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit wesentlich eine schwere<br />
Sün<strong>de</strong> sei. Wer <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn das Seine nimmt o<strong>de</strong>r nicht gibt,<br />
316
verfehlt sich sogar gegen das Gr<strong>und</strong>gebot <strong>de</strong>r übernatürlichen<br />
Sittlichkeit, gegen die göttliche Liebe. Nicht, als ob die Gerech<br />
tigkeit im Gr<strong>und</strong>e doch auf die Liebe hinausliefe. Wer aber die<br />
Liebe hat <strong>und</strong> sie bewahren will, muß gerecht sein, muß <strong>de</strong>m<br />
Nächsten das geben, was ihm gehört, sonst kann er in <strong>de</strong>r Liebe<br />
nicht bleiben. Mit an<strong>de</strong>rn Worten: sonst versündigt er sich<br />
schwer, <strong>de</strong>nn in <strong>de</strong>r Theologie ist jene Sün<strong>de</strong> als schwer zu<br />
bezeichnen, die mit <strong>de</strong>r Liebe nicht mehr vereinbar ist.<br />
Dies schließt aber im Bereich <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> die Möglich<br />
keit einer „kleinen", theologisch ausgedrückt, einer läßlichen<br />
Sün<strong>de</strong> nicht aus. In kleinen <strong>und</strong> belanglosen Dingen hat <strong>de</strong>r<br />
Geschädigte keinen sachlichen Gr<strong>und</strong> zum Unwillen. Wer also<br />
in kleineren Dingen Unrecht begeht, kann berechtigterweise<br />
annehmen, daß <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re sich nicht geschädigt fühlt (Art. 4 Zu<br />
2). Damit aber ist <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit die Spitze abgebrochen,<br />
da es, wie Thomas im 3. Artikel ausführte, Unrecht nur gibt, wo<br />
<strong>de</strong>r Mitmensch das Unrecht „erlei<strong>de</strong>t". Man kann daher auf <strong>de</strong>m<br />
Gebiet <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s von schwerwiegen<strong>de</strong>m <strong>und</strong> geringfügigem<br />
Tatbestand re<strong>de</strong>n (materia gravis <strong>und</strong> materia levis, wie die<br />
Theologie sich ausdrückt).<br />
Viertes Kapitel<br />
DIE RECHTSPRECHUNG<br />
(Fr. 60)<br />
Sosehr die Gesetzesbildung für ein ruhiges gesellschaftliches<br />
Leben im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong> stehen muß, so wird sie <strong>de</strong>nnoch end<br />
gültig ihre Wirksamkeit erst in <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sprechung erhalten.<br />
Hier erst wird eigentlich <strong>Recht</strong> im entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Sinn. Es ent<br />
spricht dies ganz <strong>de</strong>m Denken <strong>de</strong>s hl. Thomas, insofern er<br />
selbst als <strong>Recht</strong> das hic et nunc gelten<strong>de</strong> Objekt <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> bezeichnet (vgl. Kommentar zu 57,1). Kelsen hat<br />
daher, wie bereits gesagt, mit feinem Gespür <strong>de</strong>m Richter<br />
rechtserzeugen<strong>de</strong> Kraft zugesprochen. Auch bei Thomas<br />
schreitet <strong>de</strong>r rechtsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Prozeß folgerichtig von <strong>de</strong>n Geset<br />
zen vor bis zum richterlichen Urteil. In Art. 6 Zu 1 sagt er aus<br />
drücklich, daß das richterliche Urteil nicht nur eine Feststellung<br />
<strong>de</strong>s Tatbestan<strong>de</strong>s sei, son<strong>de</strong>rn ein autoritativer Anstoß. Darum<br />
gehört die <strong>Recht</strong>sprechung in jenen Bereich <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, <strong>de</strong>r<br />
317
nicht einzig <strong>Recht</strong> vollführt <strong>und</strong> befolgt, son<strong>de</strong>rn als übergeord<br />
nete Instanz <strong>Recht</strong> festlegt (Art. 1 Zu 4). Zur <strong>Recht</strong>sprechung<br />
ist eine höhere Gewalt vonnöten, welche bei<strong>de</strong> rechtsuchen<strong>de</strong>n<br />
Teile gewissermaßen in <strong>de</strong>r Hand hat (Art. 1 Zu 3). Das richter<br />
liche Urteil wird darum als „auf <strong>de</strong>n Einzelfall zugeschnittenes<br />
Gesetz" bezeichnet (67,1).<br />
Es möchte sogar scheinen, als ob Thomas im Sinn <strong>de</strong>r Frei<br />
rechtsschule <strong>de</strong>m Richter die freie <strong>Recht</strong>sbildung zusprechen<br />
wür<strong>de</strong>. Denn außer <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>r legiti<br />
men Zuständigkeit verlangt er auch noch die <strong>Recht</strong>sklugheit auf<br />
seiten <strong>de</strong>s Richters (Art. 2). Soll diese Klugheit etwa be<strong>de</strong>uten,<br />
daß <strong>de</strong>r Richter selbständig, vielleicht sogar über das Gesetz<br />
hinweg neues <strong>Recht</strong> schaffen kann? Die Lehre von Frage 60<br />
beweist, daß Thomas insoweit <strong>de</strong>n Gedanken <strong>de</strong>r Freirechts<br />
schule vertritt, als er, wie sie, die Lückenhaftigkeit <strong>de</strong>s Gesetzes<br />
unterstreicht. Er unterschei<strong>de</strong>t sich jedoch von ihr, insofern er<br />
nicht einfach eine Berücksichtigung <strong>de</strong>r Verkehrsbedürfnisse<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r For<strong>de</strong>rungen von Treu <strong>und</strong> Glauben, son<strong>de</strong>rn über<br />
diese mehr praktische Sicht hinaus eine Rückbesinnung auf die<br />
absoluten Normen for<strong>de</strong>rt.<br />
Die thomasische Auffassung von <strong>de</strong>r Lückenhaftigkeit <strong>de</strong>s<br />
Gesetzes <strong>und</strong> <strong>de</strong>r damit gegebenen Notwendigkeit einer neuen<br />
<strong>Recht</strong>sbildung durch <strong>de</strong>n Richter spricht sich in <strong>de</strong>m Begriff<br />
jener Klugheit <strong>und</strong> <strong>de</strong>r mit ihr verb<strong>und</strong>enen Tugend <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit aus, die Thomas als wesentliche Ausrüstung <strong>de</strong>s Richters<br />
verlangt.<br />
Diese Klugheit ist zunächst die „rechte Vernunft" zur Auf<br />
<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>s unter das Gesetz fallen<strong>de</strong>n Tatbestan<strong>de</strong>s (vgl.<br />
Art. 1 Zu 1; Art. 2). Damit ist allerdings zunächst mehr <strong>de</strong>m<br />
<strong>Recht</strong>sformalismus als <strong>de</strong>r Freirechtslehre das Wort gespro<br />
chen. Immerhin führt bereits die beson<strong>de</strong>re Art, mit welcher <strong>de</strong>r<br />
Richter bei <strong>de</strong>r Feststellung <strong>de</strong>s Tatbestan<strong>de</strong>s vorzugehen hat,<br />
einen Gedanken ein, <strong>de</strong>r zur freien sittlichen <strong>Recht</strong>sentschei<br />
dung <strong>de</strong>s Richters hinüberführt. Denn es soll <strong>de</strong>m Richter, wie<br />
Thomas (Art. 4 Zu 2) sagt, nicht nur um die Ermittlung einer<br />
materiellen Wahrheit nach Art einer rein juristischen Technik<br />
gehen, son<strong>de</strong>rn er soll selbst mit eigener sittlicher Verantwor<br />
tung für die Wahrheit <strong>de</strong>s Tatbestan<strong>de</strong>s eintreten können. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong>e rät Thomas (Art. 4 Zu 3), immer zum Besten<br />
<strong>de</strong>s Nächsten zu urteilen, <strong>de</strong>nn besser sei es, sich öfters zu täu<br />
schen, als sich <strong>de</strong>r Gefahr auszusetzen, <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn Unrecht zu<br />
318
tun (Art. 4 Zu 1). So wird <strong>de</strong>r Richter zum sittlichen, nicht nur 60. 1-6<br />
zum sachverständigen Interpreten <strong>de</strong>s vorliegen<strong>de</strong>n Falles.<br />
Uber <strong>de</strong>n Tatbestand hinaus reicht nun diese sittliche Hal<br />
tung <strong>de</strong>s Richters bis hinein in das Innere <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sprechung,<br />
<strong>de</strong>s Urteils. Den aristotelischen Begriff <strong>de</strong>r Billigkeit anwen<br />
<strong>de</strong>nd, meint Thomas (Art. 5 Zu 2), <strong>de</strong>r Richter habe zu urteilen,<br />
ob billigerweise das Gesetz in einem konkreten Fall überhaupt<br />
Geltung habe; <strong>de</strong>nn die positiven Gesetze könnten, wenngleich<br />
sie an sich eine <strong>Recht</strong>sordnung im allgemeinen beabsichtigten,<br />
<strong>de</strong>nnoch im Einzelfall die Ordnung stören. Thomas macht also<br />
<strong>de</strong>n Richter nicht nur zum Interpreten <strong>de</strong>s statuierten Gesetzes,<br />
son<strong>de</strong>rn spricht ihm darüber hinaus noch die Fähigkeit zu,<br />
selbst gegen <strong>de</strong>n Wortlaut <strong>de</strong>s Gesetzes zu urteilen, also im<br />
konkreten Fall gesetzgebend, besser: rechtsverbessernd zu wir<br />
ken. Das Prinzip dieser <strong>Recht</strong>serzeugung ist dabei die mit <strong>de</strong>r<br />
Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> gepaarte sittliche Klugheit. Damit<br />
wird ein Orientierungspunkt eingeführt, <strong>de</strong>r nicht in <strong>de</strong>m allge<br />
meinen <strong>Recht</strong>sgeühl <strong>de</strong>r Gesellschaft, wie etwa bei <strong>de</strong>n Vertre<br />
tern <strong>de</strong>r Freirechtsschule, son<strong>de</strong>rn über <strong>de</strong>r gesellschaftlichen<br />
Praxis, erst recht natürlich über <strong>de</strong>r rein juristischen Praxis liegt,<br />
nämlich in <strong>de</strong>n Normen <strong>de</strong>r natürlichen Sittlichkeit, die für alle<br />
gelten, die sich in <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft zusammenge<br />
f<strong>und</strong>en haben. So kann Thomas (Art. 2 Zu 2) <strong>de</strong>n Richter <strong>de</strong>n<br />
„Diener Gottes" nennen, ähnlich wie Ulpian <strong>de</strong>n Juristen als<br />
„Priester <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>" bezeichnet hat. H. Coing 1 scheint<br />
sich dieser Auffassung zu nähern, wenn er in <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sanwen<br />
dung nicht eine rein logische Tätigkeit sieht, ein „Rechnen mit<br />
Begriffen" nach Art <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Pan<strong>de</strong>ktistik <strong>de</strong>s vorigen<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts, eine reine Subsumption <strong>de</strong>s gegebenen Tatbe<br />
stan<strong>de</strong>s unter <strong>de</strong>n Tatbestand <strong>de</strong>s Gesetzes, son<strong>de</strong>rn eine, frei<br />
lich irgendwie geb<strong>und</strong>ene, aber doch freie Entscheidung. Das<br />
sogenannte „Richterrecht" hat sich in Deutschland beson<strong>de</strong>rs<br />
im Arbeitsrecht entwickelt, da hinsichtlich <strong>de</strong>r Arbeitskämpfe<br />
(Kampfparität <strong>de</strong>r Sozialpartner) keine gesetzlichen Normen<br />
bestehen.<br />
Allerdings wirft eine solche Auffassung <strong>de</strong>s richterlichen<br />
Amtes die Frage nach <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>ssicherheit auf, die für Radbruch<br />
das zentrale Thema war. Thomas selbst hat dies gefühlt <strong>und</strong><br />
darum nicht umsonst im 5. Artikel (vgl. auch Art. 6) die Be<strong>de</strong>u-<br />
1 Die obersten Gr<strong>und</strong>sätze <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, 1947, 141.<br />
319
60. 1-6 tung <strong>de</strong>s geschriebenen Gesetzes hervorgehoben. Diese „for<br />
malistische" Seite seines <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nkens kommt namentlich in<br />
67,2 zur Geltung. Dennoch kann er die <strong>Recht</strong>sprechung nicht<br />
einem toten Formalismus ausliefern. Darum verteidigt er die<br />
lebendige Rückorientierung aller konkreten <strong>Recht</strong>sbildung an<br />
<strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong>normen <strong>de</strong>s Naturrechts. Schärfer konnte Thomas<br />
seine Befürwortung <strong>de</strong>s Naturrechts gegen das positive Gesetz<br />
nicht formulieren, als daß er erklärt, daß positive Gesetze, die<br />
gegen das Naturrecht sind, nicht Gesetze, son<strong>de</strong>rn Gesetzes<br />
ver<strong>de</strong>rbnis seien <strong>und</strong> daß darum nach ihnen nicht gerichtet wer<br />
<strong>de</strong>n dürfe (Art. 5 Zu 1). Das Instrument <strong>de</strong>r Rückbesinnung auf<br />
das Naturrecht ist das Gewissen. Wo dieses seine Funktion<br />
nicht mehr leistet, sieht Thomas keine Gr<strong>und</strong>lage mehr für ein<br />
rechtlich geordnetes Zusammenleben. Darum gibt es für ihn<br />
nur ein Mittel zur Wahrung einer Ordnung in <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>spre<br />
chung: neben fachlicher Kenntnis die Erziehung <strong>de</strong>s Richters<br />
zum Diener Gottes. Ganz übereinstimmend mit dieser thoma<br />
sischen Schauweise sieht V.Tomberg 2 die Regeneration <strong>de</strong>r<br />
<strong>Recht</strong>sbildung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sprechung: „Das moralische Den<br />
ken als Denken, das in <strong>de</strong>n Kategorien von Gut <strong>und</strong> Böse<br />
geschieht, ist die Quelle <strong>de</strong>s entstehen<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>s <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Bo<strong>de</strong>n, auf <strong>de</strong>m die Jurispru<strong>de</strong>nz ihr wahres Wesen wie<strong>de</strong>rfin<br />
<strong>de</strong>n kann <strong>und</strong> muß". Eigentlich ist dies nichts an<strong>de</strong>res, als was<br />
bereits Justinian gesagt hat: „Jurispru<strong>de</strong>ntia est divinarum atque<br />
humanarum rerum notitia", die Jurispru<strong>de</strong>nz ist die Kenntnis<br />
<strong>de</strong>r göttlichen <strong>und</strong> menschlichen Wahrheiten.<br />
Thomas hat diese seine Darlegungen über die <strong>Recht</strong>spre<br />
chung im Gr<strong>und</strong>e nicht einmal <strong>de</strong>n römischen Juristen entnom<br />
men, son<strong>de</strong>rn aus einer älteren Quelle geschöpft, aus Aristote<br />
les, <strong>de</strong>r die Billigkeit als das bessere <strong>Recht</strong> bezeichnet<br />
(Eth.V, 14). Die Begründung sieht Aristoteles in <strong>de</strong>m Rückgriff<br />
auf höhere Normen gesellschaftlicher Ordnung: „Das Billige ist<br />
zwar ein <strong>Recht</strong>, aber nicht <strong>de</strong>m Gesetze nach, son<strong>de</strong>rn als eine<br />
Korrektur <strong>de</strong>s gesetzlich Gerechten. Das hat seinen Gr<strong>und</strong><br />
darin, daß je<strong>de</strong>s Gesetz allgemein ist <strong>und</strong> bei manchen Dingen<br />
richtige Bestimmungen durch ein allgemeines Gesetz sich nicht<br />
geben lassen. Wo nun eine allgemeine Bestimmung zu treffen<br />
ist, ohne daß sie ganz richtig sein kann, da berücksichtigt das<br />
2 V.Tomberg, Degeneration <strong>und</strong> Regeneration <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>swissenschaft, 1946,<br />
28.<br />
320
Gesetz die Mehrheit <strong>de</strong>r Fälle, ohne über das diesem Verfahren 60. 1-6<br />
anhaften<strong>de</strong> Gebrechen im unklaren zu sein. Nichts<strong>de</strong>stoweni<br />
ger ist dieses Verfahren richtig. Denn <strong>de</strong>r Fehler liegt nicht an<br />
<strong>de</strong>m Gesetz, noch an <strong>de</strong>m Gesetzgeber, son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Natur<br />
<strong>de</strong>r Sache. Denn im Gebiet <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lns ist die ganze Materie<br />
von vornherein dieser Art" (1137 b 11—19). Wichtig ist, daß<br />
Thomas mit <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r Korrektur Ernst macht <strong>und</strong> nicht<br />
etwa nur Gesetzeslücken, d.h. gesetzlich überhaupt nicht<br />
Geregeltes, durch <strong>de</strong>n Richter ausfüllen, son<strong>de</strong>rn auch Wi<strong>de</strong>r<br />
sinniges in <strong>de</strong>r gesetzlichen Anwendung durch <strong>de</strong>n Richter aus<br />
merzen <strong>und</strong> sinnvoll gestalten läßt. Dieser moralische Optimis<br />
mus dürfte allerdings <strong>de</strong>m mo<strong>de</strong>rnen Verständnis <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s<br />
staates <strong>und</strong> <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>ssicherheit nicht mehr entsprechen. Im<br />
mo<strong>de</strong>rnen <strong>Recht</strong>sstaat kann man we<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Wissen noch <strong>de</strong>r<br />
Moral <strong>de</strong>s Richters soviel Vorschuß an Vertrauen geben.<br />
321
ZWEITER TEIL<br />
DIE TEILTUGENDEN DER GERECHTIGKEIT<br />
(Fr. 61-79)<br />
Erstes Kapitel<br />
DIE AUSGLEICHENDE UND DIE AUSTEILENDE<br />
GERECHTIGKEIT<br />
(Fr. 61 u. 62)<br />
61-62 Mit Frage 61 beginnt Thomas eigentlich einen neuen<br />
Abschnitt im Traktat <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Nach<strong>de</strong>m er in <strong>de</strong>n vor<br />
hergehen<strong>de</strong>n Fragen das Wesen <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit sowie <strong>de</strong>ren Gegenteil, die Ungerechtigkeit, wie auch einen<br />
ausgeprägten <strong>Recht</strong>sakt, nämlich <strong>de</strong>n richterlichen Urteils<br />
spruch, behan<strong>de</strong>lt hat, befaßt er sich nun mit <strong>de</strong>n einzelnen Tei<br />
len; <strong>und</strong> zwar zunächst mit <strong>de</strong>n eigentlichen Arten <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit, einschließlich <strong>de</strong>r ihnen entgegengesetzten Laster<br />
(Fr. 61—78), sodann mit <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen sittlichen Haltun<br />
gen <strong>und</strong> Handlungen, die zur Vollständigkeit <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
gehören (Fr. 79), <strong>und</strong> schließlich mit jenen Tugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
Bereichs <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, die vom strengen Begriff <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> etwas abweichen wie Gottesverehrung, Pietät<br />
usw. (Fr. 80-120; DT, Bd. 19 u. 20).<br />
Auffallend ist, daß Thomas unter <strong>de</strong>n Arten <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit nur die bei<strong>de</strong>n Tugen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit, die aus<br />
gleichen<strong>de</strong> <strong>und</strong> die austeilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>, nicht aber die<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit bespricht, da er dieser doch ebenso<br />
die eigentliche Bewandtnis <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zuerkennt. Die<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit ist ihm die universale gerechte Hal<br />
tung, die nicht nur die einzelnen Arten <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, son<br />
<strong>de</strong>rn überhaupt <strong>de</strong>n ganzen sittlichen Menschen auf das<br />
Gemeinwohl hinordnet, sosehr sie ein eigenes Objekt hat wie<br />
je<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re Tugend. Als „principalis" justitia gehört sie nicht<br />
unter die einzelnen Arten <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Außer<strong>de</strong>m ist Tho<br />
mas an das Schema von Aristoteles geb<strong>und</strong>en, <strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>m<br />
Namen <strong>de</strong>r Kardinaltugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> nur die bei<strong>de</strong>n<br />
Son<strong>de</strong>rgerechtigkeiten begriff. Da die sogenannten Teiltugen<br />
<strong>de</strong>n bei Aristoteles nichts an<strong>de</strong>res als Teile <strong>de</strong>r Kardinaltugen<strong>de</strong>n<br />
sind, konnte Thomas hier im Traktat über die Teile <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit nur von jenen Tugen<strong>de</strong>n sprechen, die im Begriff <strong>de</strong>r<br />
322
Kardinaltugend enthalten sind. Ein mo<strong>de</strong>rner Traktat über die 61-62<br />
Tugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> wür<strong>de</strong> sich wohl dieser historischen<br />
Bindung entledigen müssen. Der aristotelische Begriff <strong>de</strong>r Kar<br />
dinaltugend <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> hat Thomas daran gehin<strong>de</strong>rt,<br />
seine eigene Systematik <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Arten <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit auszubauen. 1<br />
Zum Unterschied von <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> hebt<br />
Thomas als eigentliches Merkmal <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n Gerech<br />
tigkeit die sozusagen mathematische Bestimmbarkeit <strong>de</strong>s<br />
Objekts hervor. Das <strong>Recht</strong>sgeschäft zwischen zwei Individuen<br />
ist leicht zu bestimmen, insofern <strong>de</strong>r eine <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn das zu<br />
erstatten hat, was er von ihm erhalten o<strong>de</strong>r genommen hat.<br />
Dagegen läßt sich das Maß <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> nur<br />
im Vergleich zu allen an<strong>de</strong>rn festlegen, da die Güter <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls entsprechend <strong>de</strong>n Verdiensten am Gemeinwohl<br />
verteilt wer<strong>de</strong>n; wir wür<strong>de</strong>n noch hinzufügen: entsprechend<br />
auch <strong>de</strong>r Unterstützungsbedürftigkeit durch das Gemeinwohl.<br />
Sobald man aber hier <strong>de</strong>m einen mehr gibt, als ihm zukommt,<br />
schmälert man die an<strong>de</strong>rn. Das <strong>Recht</strong>sverhältnis zwischen Ein<br />
zelmensch <strong>und</strong> Gemeinschaft bedarf also immer <strong>de</strong>r Rück-<br />
orientierung an <strong>de</strong>r Umwelt, <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rn Glie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Gemein<br />
schaft. Es ist <strong>de</strong>mnach kein so glattes Geschäft zwischen Ein<br />
zelmensch <strong>und</strong> Gemeinwesen zu tätigen, wie dies zwischen<br />
Mensch <strong>und</strong> Mensch in <strong>de</strong>r ausgleichen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
geschieht, wo wirklich ein voller Ausgleich zwischen zwei Part<br />
nern zustan<strong>de</strong> kommt, weswegen die ausgleichen<strong>de</strong> Gerechtig<br />
keit auch „Verkehrsgerechtigkeit" heißt.<br />
Es ist nun ein Verhängnis <strong>de</strong>r Geschichte, daß dieses Geben<br />
<strong>und</strong> Nehmen, wie es sich in <strong>de</strong>r Verkehrsgerechtigkeit abspielt,<br />
die Vorstellung von <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> überhaupt so sehr<br />
beherrscht hat, daß <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rgutmachung einzig<br />
ihr zugedacht wur<strong>de</strong>. Moraltheologen <strong>de</strong>s Mittelalters <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Neuzeit haben keine Anstrengung gescheut, um diese einmal<br />
festgewurzelte Lehre von <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rgutmachung als <strong>de</strong>m<br />
eigentlichen Akt <strong>de</strong>r Verkehrsgerechtigkeit durchzuretten. Wie<br />
ist eigentlich die Verkehrsgerechtigkeit zu dieser ihrer unver<br />
dienten Son<strong>de</strong>rstellung gekommen?<br />
Das lateinische Wort hat ursprünglich gar nichts mit Wie<strong>de</strong>r<br />
erstattung von zugefügtem Scha<strong>de</strong>n zu tun, son<strong>de</strong>rn will nur<br />
1 Vgl. hierzu A.F.Utz, Sozialethik I, 210ff.<br />
323
61-62 einfach <strong>und</strong> allgemein „erstatten" o<strong>de</strong>r „vergelten" besagen. In<br />
<strong>de</strong>r Verkehrsgerechtigkeit vollzieht sich ein Austausch. Der eine<br />
gibt <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn etwas, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re erstattet ihm <strong>de</strong>n glei<br />
chen Wert zurück. Das ist <strong>de</strong>r einfache Vorgang, weswegen <strong>de</strong>r<br />
Verkehrsgerechtigkeit die Wie<strong>de</strong>rerstattung zuerkannt wer<strong>de</strong>n<br />
muß (62,1). Dieser Vorgang <strong>de</strong>s Empfangens <strong>und</strong> Wie<strong>de</strong>rge<br />
bens fin<strong>de</strong>t allerdings in keiner an<strong>de</strong>rn Form von <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
statt. Jedoch ist darin nicht das typische Merkmal <strong>de</strong>r Gerech<br />
tigkeit an sich zu sehen. Denn <strong>de</strong>r Ausgleich zwischen mehre<br />
ren, <strong>de</strong>r zu je<strong>de</strong>r Art von <strong>Gerechtigkeit</strong> gehört, braucht sich<br />
nicht notwendig in Form von Geben <strong>und</strong> Empfangen zu voll<br />
ziehen. Wo immer vom Gemeinwohl her ein Ausgleich zwi<br />
schen mehreren stattfin<strong>de</strong>n soll, da muß für <strong>de</strong>n Fall, daß <strong>de</strong>r<br />
eine zuviel erhalten hat, dieses Zuviel wie<strong>de</strong>rerstattet wer<strong>de</strong>n,<br />
<strong>und</strong> zwar eben <strong>de</strong>swegen, weil sonst die austeilen<strong>de</strong> Gerechtig<br />
keit verletzt wür<strong>de</strong>. Allerdings vollzieht sich in diesem Akt <strong>de</strong>s<br />
Zurückgebens etwas, was an sich für die Sache, d. h. Leistung<br />
auf Gegenleistung, passen soll. Und dies ist eben wesentlich bei<br />
<strong>de</strong>r Verkehrsgerechtigkeit <strong>de</strong>r Fall. Jedoch folgt daraus nicht,<br />
daß die Verpflichtung zur Wie<strong>de</strong>rgutmachung von <strong>de</strong>r Ver<br />
kehrsgerechtigkeit aus zu begrün<strong>de</strong>n sei. Man kann wohl mit<br />
Thomas (Art. 1 Zu 3) zugeben, daß die Wie<strong>de</strong>rgutmachung zur<br />
Verkehrsgerechtigkeit gehört, sofern man das äußere Gesche<br />
hen, <strong>de</strong>n Vorgang <strong>de</strong>r äußeren Handlung, betrachtet. Thomas<br />
selbst hatte erklärt, daß die <strong>Gerechtigkeit</strong> äußere Handlungen<br />
betreffe. Nach diesen also wird nun das Wesen <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rgut<br />
machung bestimmt. Damit ist aber noch nichts über die Pflicht<br />
zur Wie<strong>de</strong>rgutmachung gesagt! Die Pflicht zur Wie<strong>de</strong>rgutma<br />
chung besteht auch um <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n bzw. <strong>de</strong>r Gemeinwohl<br />
gerechtigkeit willen. Die Verteilung einer sozialen Prämie<br />
geschieht nach einem ganz bestimmten Schlüssel. Wo <strong>de</strong>m<br />
einen zuviel gegeben wur<strong>de</strong>, muß es ihm wie<strong>de</strong>r genommen<br />
wer<strong>de</strong>n. Das praktiziert von selbst je<strong>de</strong> Behör<strong>de</strong>, in<strong>de</strong>m sie bei<br />
<strong>de</strong>r nächsten Zahlung <strong>de</strong>r Rente das abhält, was sie vorher viel<br />
leicht zuviel ausbezahlt hat. Dies verlangt die austeilen<strong>de</strong><br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>. Nur bezüglich <strong>de</strong>s Aktes <strong>de</strong>s Zurückholens<br />
könnte man, wenn man ganz formal <strong>de</strong>nken will, sagen, daß er<br />
die Bewandtnis eines Aktes <strong>de</strong>r Verkehrsgerechtigkeit habe,<br />
weil mathematisch genau zurückverlangt wird, was zuviel<br />
gegeben wor<strong>de</strong>n ist. Es wickelt sich also dabei <strong>de</strong>r äußere Vor<br />
gang <strong>de</strong>r Verkehrsgerechtigkeit ab. Aber die moralische Innen-<br />
324
sehe <strong>de</strong>s Sollens ist doch die austeilen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Gemeinwohlge- 61-62<br />
rechtigkeit. Man fragt sich, wie es möglich war, daß so viel Tinte<br />
verschrieben wur<strong>de</strong> für ein Thema, das durch die Wirklichkeit<br />
schon lange klargestellt ist. Die Ansicht von Faidherbe <strong>und</strong><br />
Welty verdient Anerkennung: „Wer die allgemeine o<strong>de</strong>r gesetz<br />
liche <strong>Gerechtigkeit</strong> verletzt, kann aus diesem Gr<strong>und</strong>e, <strong>und</strong> nicht<br />
nur wegen <strong>de</strong>r beiläufig mitverletzten ausgleichen<strong>de</strong>n Gerech<br />
tigkeit, entschädigungspflichtig sein". 1<br />
Zweites Kapitel<br />
DIE SÜNDEN<br />
GEGEN DIE AUSTEILENDE GERECHTIGKEIT.<br />
DIE FALSCHE RÜCKSICHT AUF PERSONEN<br />
(Fr. 63)<br />
Das in Fr. 63 behan<strong>de</strong>lte Thema wäre auf zu schmale Spur 63. 1-4<br />
gestellt, wollte man nur an <strong>de</strong>n Nepotismus <strong>de</strong>nken, <strong>de</strong>r als<br />
Krebsscha<strong>de</strong>n die mittelalterliche Hierarchie verseuchte. Im<br />
übrigen hätte die Frage in dieser Beschränkung auch für uns<br />
heute noch Be<strong>de</strong>utung genug, wo die „Beziehung" im sozialen<br />
Leben alles <strong>und</strong> die Sachlichkeit oft nichts erreicht. Thomas<br />
aber zeigt im vierten Artikel, daß die falsche Rücksicht auf die<br />
Person nicht nur in <strong>de</strong>r unsachlichen Verteilung von Amtern<br />
vorliegt, son<strong>de</strong>rn überall dort gegeben ist, wo mit behördlicher<br />
Autorität <strong>de</strong>m einen zum Nachteil <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn mehr gegeben<br />
wird, als ihm zusteht, das heißt, wo das Gesetz <strong>de</strong>r gerechten<br />
Verteilung verletzt, also nach mo<strong>de</strong>rnem Denken die soziale<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> gestört wird.<br />
Der Begriff <strong>de</strong>r sozialen <strong>Gerechtigkeit</strong> spannt allerdings <strong>de</strong>n<br />
Aufgabenkreis weiter als <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> bei<br />
Thomas. In <strong>de</strong>r sozialen <strong>Gerechtigkeit</strong> han<strong>de</strong>lt es sich nicht nur<br />
um die von oben her in Angriff zu nehmen<strong>de</strong> Verteilung <strong>und</strong><br />
Zuteilung von Amtern <strong>und</strong> Gütern, son<strong>de</strong>rn auch um die vom<br />
einzelnen Gemeinschaftsglied zu übernehmen<strong>de</strong>n Lasten.<br />
Darum wird überall dort die soziale <strong>Gerechtigkeit</strong> verletzt, wo<br />
ein einzelner <strong>de</strong>m Gemeinwohl etwas entzieht, was diesem<br />
zusteht. Der Begriff <strong>de</strong>r falschen Rücksicht auf Personen paßt<br />
1 E. Welty, Sozialkatechismus, Bd. 1,263, Fußnote.<br />
325
63. 1-4 also nicht mehr recht für die Sün<strong>de</strong> gegen die soziale Gerechtig<br />
keit in ihrem ganzen Umfang. Denn er lenkt <strong>de</strong>n Blick zu sehr<br />
auf die Autorität, welche in Vertretung <strong>de</strong>s Gemeinwohls <strong>de</strong>n<br />
gerechten Ausgleich schaffen soll. Allerdings wird dann in <strong>de</strong>r<br />
Folge auch die beraten<strong>de</strong> <strong>und</strong> Intrige spielen<strong>de</strong> Person <strong>de</strong>rsel<br />
ben Sün<strong>de</strong> schuldig. Von hier ist <strong>de</strong>r Weg dann nicht mehr weit<br />
zur Überlegung, daß <strong>de</strong>r einzelne auch ohne <strong>de</strong>n Weg über die<br />
Behör<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Gemeinwohl Scha<strong>de</strong>n zufügen <strong>und</strong> sich damit<br />
wesentlich <strong>de</strong>rselben Sün<strong>de</strong> schuldig machen kann, die Thomas<br />
als falsche Rücksicht auf Personen bezeichnet, die aber dann<br />
besser mit Sün<strong>de</strong> gegen das Gemeinwohl bezeichnet wür<strong>de</strong>.<br />
Beson<strong>de</strong>rer Erwähnung würdig ist die Lehre <strong>de</strong>s zweiten<br />
Artikels, wonach die Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Person im gesellschaftlichen<br />
Bereich nicht einfach nach <strong>de</strong>r sittlichen Gutheit bemessen wer<br />
<strong>de</strong>n darf, son<strong>de</strong>rn nach <strong>de</strong>r Eignung, das Gemeinwohl sachlich<br />
zu för<strong>de</strong>rn. Man möchte zwar annehmen, daß gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Tugendhafte um seiner Tugend willen <strong>de</strong>r passen<strong>de</strong> Mann sei,<br />
ein gesellschaftliches Ganzes zu leiten, da das Ziel <strong>de</strong>r Gesell<br />
schaft eben im Gr<strong>und</strong>e doch ein ethisches ist. Thomas ist Realist<br />
genug, um diesen Gedanken nicht restlos zu bejahen, da das<br />
Gemeinwohl in <strong>de</strong>r konkreten Situation <strong>de</strong>rart verwickelt ist,<br />
daß die Tugend allein <strong>und</strong> die mit ihr gegebene persönliche sitt<br />
liche Klugheit eben nicht ausreichen, um das Ordnungsganze<br />
zu durchschauen. Um <strong>de</strong>n Weg zur vollkommenen Ordnung<br />
anzubahnen, bedarf es daher <strong>de</strong>r Begabung <strong>und</strong> einer gewissen<br />
Geschäftstüchtigkeit, nicht nur <strong>de</strong>r Tugend, wie ja auch Gott<br />
bisweilen die außergewöhnlichen Gna<strong>de</strong>ngaben, wie zum Bei<br />
spiel W<strong>und</strong>er <strong>und</strong> Weissagungen, <strong>de</strong>n weniger Guten zuteilt<br />
(Art. 2). Wir sind heute mit diesem Gedanken noch mehr ver<br />
traut, als es etwa Thomas zu seiner Zeit sein konnte, da wir mit<br />
einem beinahe unabsehbaren Mechanismus <strong>de</strong>s gesellschaftli<br />
chen Zusammenlebens rechnen müssen, wie wir ihn in <strong>de</strong>r<br />
mo<strong>de</strong>rnen Wirtschaft vor uns haben. Um einen Ausweg aus<br />
<strong>de</strong>m Gewirr von wirtschaftlichen Problemen zu fin<strong>de</strong>n, genügt<br />
die reine Ethik keinesfalls; son<strong>de</strong>rn es ist zugleich, sogar vor<br />
dringlich ein gerütteltes Maß an wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Kenntnissen gefor<strong>de</strong>rt.<br />
326
Drittes Kapitel<br />
DIE SÜNDEN GEGEN<br />
DIE AUSGLEICHENDE GERECHTIGKEIT<br />
(Fr. 64-78)<br />
In diesem Traktat über die Sün<strong>de</strong>n wi<strong>de</strong>r die ausgleichen<strong>de</strong> 64/78<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> wird erst so recht <strong>de</strong>utlich, daß die wörtliche<br />
Übersetzung von „kommutativer" <strong>Gerechtigkeit</strong> mit „Tausch"-<br />
gerechtigkeit eigentlich nur einen Ausschnitt aus <strong>de</strong>m umfas<br />
sen<strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r kommutativen <strong>Gerechtigkeit</strong> begreift. Geht<br />
es doch hier Thomas nicht nur darum, die verschie<strong>de</strong>nen Ver<br />
fehlungen in <strong>de</strong>n Tauschgeschäften o<strong>de</strong>r Verträgen zwischen<br />
Einzelmenschen, son<strong>de</strong>rn überhaupt jedwe<strong>de</strong>n Verstoß eines<br />
Einzelmenschen gegen das <strong>Recht</strong> eines an<strong>de</strong>rn zu behan<strong>de</strong>ln.<br />
Es geht also im Gr<strong>und</strong>e um nichts an<strong>de</strong>res als um die <strong>Recht</strong>s<br />
kürzung eines einzelnen Menschen durch einen an<strong>de</strong>rn einzel<br />
nen Menschen, d.h. um die Verfehlungen im gegenseitigen<br />
rechtlichen Zusammenleben, im Verkehr. Gera<strong>de</strong> darum<br />
erscheint <strong>de</strong>r Ausdruck „Verkehrsgerechtigkeit" als die geeig<br />
netste Übersetzung <strong>de</strong>r „kommutativen" <strong>Gerechtigkeit</strong>. Diese<br />
Übersetzung hat <strong>de</strong>m Namen „ausgleichen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>"<br />
das voraus, daß sie <strong>de</strong>n Inhalt plastischer wie<strong>de</strong>rgibt, wenn<br />
gleich „ausgleichen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong>" mehr ins Wesen dieser<br />
beson<strong>de</strong>ren Art <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> vordringt, insofern darin die<br />
streng arithmetische Bemessung ausgesprochen ist. In <strong>de</strong>r<br />
Übersetzung wird jeweils <strong>de</strong>r passendste Terminus gewählt.<br />
Thomas unterschei<strong>de</strong>t nun zwei praktische Formen <strong>de</strong>r Ver<br />
kehrsgerechtigkeit, die eine, die <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn das Seine nicht<br />
nimmt, ohne mit ihm in einem <strong>Recht</strong>sgeschäft zu stehen; die<br />
an<strong>de</strong>re, die <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn das ihm Gehörige leistet, weil er darauf<br />
einen Anspruch hat aufgr<strong>und</strong> einer Leistung seinerseits. Ent<br />
sprechend sieht nun Thomas zwei Arten von Ungerechtigkei<br />
ten: 1. das <strong>Recht</strong>svergehen gegen <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rn in Fällen, wo man<br />
mit ihm in keinem direkten Austausch stand, <strong>und</strong> zwar durch<br />
die Tat, im Mord, in <strong>de</strong>r Körperverletzung <strong>und</strong> im Diebstahl<br />
o<strong>de</strong>r Raub, <strong>und</strong> durch das Wort, im gerichtlichen Prozeß in<br />
Form von falschem Urteil, falscher Anklage usw. o<strong>de</strong>r im außer<br />
gerichtlichen Leben in Form von Verleumdung. Ehrabschnei<br />
dung usw., <strong>und</strong> 2. das <strong>Recht</strong>svergehen gegen <strong>de</strong>n Nächsten bei<br />
Tauschgeschäften, wie Betrug, Wucher usw.<br />
327
I. Der Mord<br />
(Fr. 64)<br />
1. DIE TODESSTRAFE<br />
(Art. 1-4)<br />
64. 1-4 Es fällt vielleicht auf, daß Thomas vom Mord als von einer<br />
Sün<strong>de</strong> gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> nur in einem Artikel (6) spricht,<br />
während er im übrigen die Frage nach Erlaubtheit <strong>de</strong>r Tötung<br />
von Menschen untersucht. Doch ist zu be<strong>de</strong>nken, daß die<br />
Sün<strong>de</strong> eigentlich nur zufällig zur Ethik <strong>und</strong> Moraltheologie<br />
gehört, wenngleich sie in <strong>de</strong>r Praxis <strong>de</strong>r Menschen einen beacht<br />
lichen Raum behauptet. Gegenstand <strong>de</strong>r Ethik ist das Gute, das<br />
Böse dagegen nur als Abfall vom Guten. So wird auch hier das<br />
Gebiet abgeschritten, innerhalb <strong>de</strong>ssen eine Tötung erlaubt,<br />
also noch gut ist. Jenseits dieses Bereiches beginnt dann die Un<br />
gerechtigkeit gegen das menschliche Leben.<br />
Etwas weit ausholend untersucht Thomas zunächst (Art. 1)<br />
die Frage, ob es überhaupt erlaubt sei, Lebewesen irgendwel<br />
cher Art zu töten. Allerdings dachte er dabei nicht an die von<br />
manchen Exegeten behan<strong>de</strong>lte Frage, ob <strong>de</strong>r Mensch ursprüng<br />
lich sich von Pflanzen o<strong>de</strong>r Tieren ernährte. Der erste Artikel<br />
dient nur als Rahmen, um <strong>de</strong>n Zusammenhang aufzuzeigen, in<br />
welchem die Frage nach <strong>de</strong>r Tötung von Menschen überhaupt<br />
steht: das Ordnungsgefüge <strong>de</strong>s Universums. Denn, wie sich<br />
noch zeigen wird, kann auch die legitime Tötung eines Men<br />
schen nur von einem, wenn auch kleineren, Ordnungsgefüge<br />
aus verteidigt wer<strong>de</strong>n. Schwierig ist die Frage nach <strong>de</strong>r Erlaubt<br />
heit <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe, welche Thomas in Art. 2 behan<strong>de</strong>lt: „Ist es<br />
erlaubt, einen Sün<strong>de</strong>r zu töten?" Die private Tötung eines Ver<br />
brechers wird dabei verneint, höchstens für <strong>de</strong>n Fall anerkannt,<br />
wo <strong>de</strong>r Verbrecher <strong>de</strong>m Nächsten als Angreifer begegnet<br />
(Art. 7).<br />
Im systematischen Zusammenhang ist es bezeichnend, daß<br />
Thomas das Problem <strong>de</strong>r Tötung eines Verbrechers durch eine<br />
Privatperson erst nach Behandlung <strong>de</strong>r Frage bespricht, ob ein<br />
Verbrecher durch die öffentliche Hand hingerichtet wer<strong>de</strong>n<br />
könne. Denn hier stellen sich die wesentlichen Probleme:<br />
Wesen <strong>de</strong>r Strafe überhaupt, Vollzug <strong>de</strong>r Strafe, To<strong>de</strong>sstrafe,<br />
durch eine menschliche Autorität verhängt, Zweck <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>s<br />
strafe.<br />
328
Wohl auf keinem Feld <strong>de</strong>r Ethik wird wie hier das Problem 64. 1-4<br />
nach <strong>de</strong>m Ursprung unserer Werturteile aufgeworfen. Ist es<br />
schon schwierig, auf rationalem Wege <strong>de</strong>n Satz zu begrün<strong>de</strong>n,<br />
daß je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> eine Strafe verdient, so wird es erst recht müh<br />
sam, durch sachliche Analyse zu <strong>de</strong>m Ergebnis zu kommen,<br />
daß eine bestimmte Sün<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r auch irgen<strong>de</strong>ine Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r To<br />
<strong>de</strong>sstrafe würdig sei.<br />
a) Schuld <strong>und</strong> Strafe 1<br />
Woher nehmen wir das Werturteil, daß eine Sün<strong>de</strong> eine ent<br />
sprechen<strong>de</strong> Strafe verdiene? Sofern dieses Werturteil <strong>de</strong>m<br />
Naturgesetz entstammt, müssen wir dazu auf <strong>de</strong>m Wege einer<br />
Analyse <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> kommen. Denn was <strong>de</strong>m Naturgesetz ent<br />
spricht, muß auf rationalem Wege erfaßbar sein.<br />
Wir begegnen bei allen Völkern, angefangen von <strong>de</strong>n primiti<br />
ven, bei <strong>de</strong>nen das jus talionis (das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Vergeltung)<br />
bestand <strong>und</strong> noch besteht, bis zu <strong>de</strong>n höchsten Kulturen, <strong>de</strong>m<br />
Wertempfin<strong>de</strong>n, daß ein Vergehen gesühnt wer<strong>de</strong>n müsse.<br />
Auch verbin<strong>de</strong>t sich mit <strong>de</strong>m Sühnegedanken immer o<strong>de</strong>r mei<br />
stens irgendwie eine religiöse Vorstellung. Es ist z.B. wahr<br />
scheinlich, daß bereits im altgriechischen <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nken die To<br />
<strong>de</strong>sstrafe eine Kulthandlung war, ein Sühnopfer an die belei<br />
digte Gottheit. Ebenso hatten im altgermanischen <strong>Recht</strong> die<br />
öffentlichen To<strong>de</strong>sstrafen sakralen Charakter. Sie waren Kult<br />
handlungen, die von Priestern vollzogen wur<strong>de</strong>n. Die Vor<br />
bereitungen stempelten <strong>de</strong>n Verbrecher zum Opfertier. Das<br />
Christentum hat trotz <strong>de</strong>r es kennzeichnen<strong>de</strong>n Mil<strong>de</strong> die To<br />
<strong>de</strong>sstrafe nicht abgeschafft. Auch hier lebt <strong>de</strong>r Gedanke, daß ein<br />
Verbrechen gegen die Gemeinschaft gesühnt <strong>und</strong> daß diese<br />
Sühne vom Staate im Auftrage Gottes vollzogen wer<strong>de</strong>n<br />
müsse: „Wenn du aber das Böse tust, so fürchte, <strong>de</strong>nn nicht um<br />
sonst trägt sie (die Obrigkeit) das Schwert; ist sie doch Gottes<br />
Dienerin, Rächerin zur Bestrafung für <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r das Böse tut"<br />
(Rom 13,2-4).<br />
Man könnte — wenn wir einmal vom übernatürlichen Offen<br />
barungscharakter <strong>de</strong>r christlichen Lehre absehen — aus dieser<br />
allgemein menschlichen Uberzeugung, daß ein Verbrechen<br />
gesühnt <strong>und</strong> daß ein schweres Verbrechen gegen die Gemein-<br />
1 Ausführlicheres zu diesem Thema s. A.F. Utz, Sozialethik, Teil II: <strong>Recht</strong>sphi<br />
losophie, Hei<strong>de</strong>lberg 1963, 181-208.<br />
329
64. 1-4 schaft mit <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> bestraft wer<strong>de</strong>n soll, <strong>de</strong>n Schluß ziehen<br />
wollen, daß ein naturgegebenes Wertempfin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Menschen<br />
das Prinzip <strong>de</strong>r verdienten Strafe <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r verdien<br />
ten To<strong>de</strong>sstrafe eingibt. Doch genügt ein solcher Beweis, <strong>de</strong>r<br />
nur aus <strong>de</strong>n soziologischen Tatsachen <strong>und</strong> <strong>de</strong>m historisch fest<br />
gestellten Wertempfin<strong>de</strong>n geschlossen wird, nicht zum Aufweis<br />
eines wirklichen Naturgesetzes im Sinne <strong>de</strong>s hl. Thomas. Wenn<br />
Thomas in unserer Frage nicht mehr behaupten wollte, als daß<br />
er das christliche Wertempfin<strong>de</strong>n bezüglich <strong>de</strong>r Strafe <strong>und</strong> im<br />
beson<strong>de</strong>ren bezüglich <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe wie<strong>de</strong>rgibt, dann wäre<br />
dies wohl ein unanfechtbares christliches Lehrstück; es wäre<br />
aber noch kein philosophisches Lehrstück. Denn trotz <strong>de</strong>r<br />
theologischen Umrahmung will <strong>de</strong>r Traktat über <strong>Recht</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> bei Thomas eine philosophische, nämlich natur<br />
rechtliche Begründung aller Lehrstücke bieten. Diese Aufgabe<br />
obliegt ihm auch dann, wenn er diesen Traktat als typisch theo<br />
logischen auffassen wollte. Denn es genügte dann nicht, nur auf<br />
die Schrift <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Geist <strong>de</strong>s Christentums zu verweisen; er<br />
hätte immer noch die Aufgabe, die Beziehung zur natürlichen<br />
Ethik zu suchen. Ohne <strong>de</strong>n Aufweis dieses Bezuges zur natürli<br />
chen Ethik könnte <strong>de</strong>r Theologe nur auf <strong>de</strong>n Willen Gottes ver<br />
weisen, müßte es aber für je<strong>de</strong>n einzelnen Straftatbestand tun<br />
können, sonst müßte er <strong>de</strong>n Straftatbestand mit natürlichem<br />
Werturteil bestimmen. Damit aber verließe er die theologische<br />
Basis für ein konkretes Strafurteil.<br />
Wenn es wirklich keinen an<strong>de</strong>ren Hinweis auf Naturgesetz<br />
lichkeit <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>-Sühne-Verhältnisses gibt als jenen auf <strong>de</strong>n<br />
soziologischen Tatbestand, dann gibt es keine voll-<strong>und</strong> letztgül<br />
tige Entgegnung auf die Behauptung mancher, die <strong>Recht</strong>sfolge<br />
zwischen Sün<strong>de</strong> <strong>und</strong> Sühne <strong>und</strong> erst recht zwischen schwerem<br />
Verbrechen <strong>und</strong> To<strong>de</strong>sstrafe entspränge einem anerzogenen<br />
Wertempfin<strong>de</strong>n.<br />
Wie also läßt sich das Sün<strong>de</strong>-Strafe-Verhältnis rational ermit<br />
teln? Der überragen<strong>de</strong> Mittelbegriff ist hierbei für Thomas <strong>de</strong>r<br />
Begriff <strong>de</strong>r Ordnung. Das Universum — dies besagt übrigens<br />
schon sein Name — ist in Wirklichkeit ein Ordnungsganzes. Die<br />
Vielheit <strong>de</strong>r Dinge be<strong>de</strong>utet nicht ein Nebeneinan<strong>de</strong>r, son<strong>de</strong>rn<br />
ein Unter- <strong>und</strong> Übereinan<strong>de</strong>r zur Erfüllung eines je<strong>de</strong>m Sein<br />
entsprechen<strong>de</strong>n Gemeinzweckes. Darum spricht Thomas vom<br />
Gemeinwohl <strong>de</strong>s Universums. Es ist also im Universum eine<br />
I<strong>de</strong>e verkörpert, die ihrerseits einen Denken<strong>de</strong>n voraussetzt,<br />
330
<strong>de</strong>r kein an<strong>de</strong>rer ist als <strong>de</strong>r Schöpfer. Also ein Deus ex machina ? 64.1-4<br />
Keineswegs, <strong>de</strong>nn wir verbleiben in <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>s Seins <strong>und</strong><br />
seiner inhaltlichen Erklärung. Es wird durchaus nicht ein<br />
Sprung vom Inhaltlichen auf das Bewirken<strong>de</strong> gemacht. Der<br />
Schluß heißt, genau formuliert, nicht: Es gibt eine Ordnung,<br />
weil es einen Gott gibt, son<strong>de</strong>rn: Es gibt eine Ordnung, weil das<br />
Sein, in welchem sich diese Ordnung fin<strong>de</strong>t, einer i<strong>de</strong>ellen Kon<br />
zeption nachgebil<strong>de</strong>t ist <strong>und</strong> diese real zum Ausdruck bringt.<br />
Naturgemäß ist daher auch mitausgesprochen, daß das geord<br />
nete Sein eine Ursache hat. Aber nicht die Wirkursache ist hier<br />
bei das logische Bin<strong>de</strong>glied, son<strong>de</strong>rn die ewige I<strong>de</strong>e <strong>und</strong><br />
Absicht dieser Wirkursache. Aus <strong>de</strong>r Wirkursächlichkeit allein<br />
läßt sich kein Ordnungsbegriff herstellen. Genauso will die<br />
Scholastik auch nicht aus <strong>de</strong>m Schöpfungsbericht als solchem<br />
die göttliche Autorität im Naturgesetz nachweisen, wie Kelsen<br />
fälschlicherweise meinte. Sie gelangt vielmehr zu ihrem Resul<br />
tat in einem im <strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nken verbleiben<strong>de</strong>n logischen Prozeß,<br />
in<strong>de</strong>m sie von einem naturhaft gegebenen <strong>Recht</strong>sanspruch <strong>de</strong>s<br />
Menschen zur Begründung dieses Anspruchs zum ewigen<br />
Befehl <strong>de</strong>s Schöpfers aufsteigt, einem Befehl, <strong>de</strong>r aber nicht<br />
wirkursächlich, son<strong>de</strong>rn final, d. h. aus <strong>de</strong>r Zielordnung heraus<br />
zu verstehen ist. Selbstre<strong>de</strong>nd ist <strong>de</strong>r final ordnen<strong>de</strong> <strong>und</strong><br />
befehlen<strong>de</strong> Gott zugleich auch Wirkursache <strong>de</strong>r Welt <strong>und</strong> ihrer<br />
Ordnung. Die Scholastik vermischt also nicht die Kausal-<br />
(Wirk-) Ordnung mit <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sordnung.<br />
Erfaßt man aber die Ordnung <strong>de</strong>s Universums, vor allem<br />
aber die Ordnung <strong>de</strong>r menschlichen Gemeinschaft als ein einer<br />
ewigen I<strong>de</strong>e nachgebil<strong>de</strong>tes Gefüge, dann erscheint die Sün<strong>de</strong><br />
nicht nur als eine vorübergehen<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn eine in gewissem<br />
Sinne nicht wie<strong>de</strong>r zu beseitigen<strong>de</strong> Störung <strong>de</strong>r Ordnung. Das<br />
Gleichgewicht ist noch nicht wie<strong>de</strong>rhergestellt, wenn <strong>de</strong>r Sün<br />
<strong>de</strong>r seine Sün<strong>de</strong> lediglich bereut <strong>und</strong> sich wie<strong>de</strong>rum zum Guten<br />
wen<strong>de</strong>t. Damit wird erst wie<strong>de</strong>r Ordnung geschaffen für <strong>de</strong>n<br />
kommen<strong>de</strong>n zeitlichen Ablauf <strong>de</strong>r Dinge. Die Ordnung aber<br />
will begriffen wer<strong>de</strong>n als eine <strong>de</strong>r ewigen I<strong>de</strong>e nachgebil<strong>de</strong>te<br />
Sinnfülle. Um nun im zeitlichen Raum das Vergangene, wenig<br />
stens soweit es möglich ist, wie<strong>de</strong>rum aufzuholen, übernimmt<br />
<strong>de</strong>r Mensch eine Sühne. Es ist klar, diese Sühne kann niemals<br />
einen vollen Ersatz für etwas Unwi<strong>de</strong>rrufliches be<strong>de</strong>uten. Aber<br />
sie be<strong>de</strong>utet <strong>de</strong>nnoch die einzige Ausdrucksmöglichkeit <strong>de</strong>s<br />
zum Guten wie<strong>de</strong>r zurückgekehrten Menschen gegenüber <strong>de</strong>r<br />
331
64. 1-4 ewigen Ordnung in Gott. Die Sühne ist darum nichts an<strong>de</strong>res<br />
als die nachdrückliche menschliche Wie<strong>de</strong>rbejahung <strong>de</strong>r ewigen<br />
Ordnung nach einem schuldhaften Verstoß gegen dieselbe.<br />
Ohne diesen metaphysischen Blick in die ewige Ordnung gött<br />
lichen Denkens <strong>und</strong> Befehlens ist es schlechthin unmöglich, das<br />
Verhältnis von Sün<strong>de</strong> <strong>und</strong> Strafe irgendwie zu erklären. Jene in<br />
<strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Völker feststellbare enge Verbindung zwi<br />
schen Sühne <strong>und</strong> Religion hat darum nicht nur soziologische<br />
Bewandtnis, son<strong>de</strong>rn zutiefst metaphysische, seinsmäßige. Der<br />
Ordnungsbegriff, <strong>de</strong>r sich in je<strong>de</strong>m Zusammen<strong>de</strong>nken von<br />
Sün<strong>de</strong> <strong>und</strong> Strafe k<strong>und</strong>tut, wäre unsinnig, wenn er nicht in<br />
einem überzeitlich <strong>de</strong>nken<strong>de</strong>n <strong>und</strong> befehlen<strong>de</strong>n ewigen Geist<br />
verankert wäre.<br />
In diesem Zusammenhang allein ist <strong>de</strong>r Gedanke <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas in 61,4 zu erklären, daß es nicht genüge, das gestoh<br />
lene Gut im gleichen Wert zurückzugeben, son<strong>de</strong>rn daß ein<br />
Mehrfaches zu leisten sei, um auf eigener Seite einen Scha<strong>de</strong>n<br />
zu erlei<strong>de</strong>n, wie er auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rn verursacht wur<strong>de</strong>.<br />
Je<strong>de</strong> Strafe, im menschlichen Raum von menschlicher Macht<br />
verhängt, kann naturgemäß nur einen zeitlichen Ausschnitt <strong>de</strong>s<br />
ewigen Sinnes <strong>de</strong>r Strafe begreifen. Darum tritt <strong>de</strong>r reine Süh<br />
necharakter zurück zugunsten <strong>de</strong>s Zweckgedankens, die Men<br />
schen ins Gleichgewicht <strong>de</strong>r Ordnung zu bringen, <strong>und</strong> zwar<br />
<strong>de</strong>n Verbrecher, o<strong>de</strong>r wer es zu wer<strong>de</strong>n droht, von <strong>de</strong>r Ver<br />
suchung zum Verbrechen abzubringen <strong>und</strong> die Guten in <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft zu beruhigen mit <strong>de</strong>m Gedanken, daß die Obrig<br />
keit stark genug ist, um die Ordnung zu garantieren. Das ist es,<br />
was Thomas in 68,1 meint, wenn er sagt, daß die Verhängung<br />
<strong>de</strong>r Strafe als solche „an sich" (d. h. in ihrem endgültigen Vergel<br />
tungssinn) <strong>de</strong>m Jenseits vorbehalten sei, während hier auf<br />
Er<strong>de</strong>n die medizinale Zweckbestimmung vorherrsche (vgl.<br />
auch 66,6 Zu 2), <strong>und</strong> wenn er dann diese medizinale Zweckbe<br />
stimmung doppelt bestimmt, im Hinblick auf <strong>de</strong>n einzelnen<br />
<strong>und</strong> im Hinblick auf die Ruhe <strong>und</strong> Ordnung in <strong>de</strong>r Gemein<br />
schaft (68,1). Beson<strong>de</strong>rs zu beachten ist dabei, daß Thomas die<br />
medizinale Zweckbestimmung <strong>de</strong>r Strafe im Hinblick auf die<br />
Gemeinschaft zugleich auch als Sühne im menschlichen, zeit<br />
lich beschränkten Sinne auffaßt (vgl. beson<strong>de</strong>rs auch 67,4).<br />
Diese Sühne hat für <strong>de</strong>n Theologen <strong>und</strong> Metaphysiker, <strong>de</strong>r alles<br />
vom Ewigen <strong>und</strong> Unabän<strong>de</strong>rlichen her sieht, eben nur vorläufi<br />
ge <strong>und</strong> darum zweckgerichtete Bewandtnis. Dadurch daßTho-<br />
332
mas im menschlichen Raum die medizinale Seite <strong>de</strong>r Bestrafung<br />
hervorkehrt, wird aber <strong>de</strong>r Sühnecharakter nicht ausgeschlos<br />
sen. Unser rationales Denken trennt, weil es nur <strong>de</strong>n menschli<br />
chen Strafbereich begreift, die Sühne vom Medizinalen <strong>und</strong> ver<br />
weist die theologisch-metaphysische F<strong>und</strong>ierung <strong>de</strong>r Sühne in<br />
das rein ethische Denken.<br />
b) Staatsgewalt <strong>und</strong> To<strong>de</strong>sstrafe<br />
Wer hat nun das <strong>Recht</strong>, zu strafen <strong>und</strong> Sühne zu verhängen?<br />
Die Frage ist eigentlich gleich beantwortet: <strong>de</strong>rjenige, welcher<br />
die Ordnung aufzustellen das <strong>Recht</strong> hat o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m sie zur Obhut<br />
unterstellt ist. Das Problem wird erst heikel, wenn es um die To<br />
<strong>de</strong>sstrafe geht.<br />
Wir brauchen uns hier nicht mehr mit <strong>de</strong>r Frage zu befassen,<br />
ob <strong>de</strong>r Tod überhaupt eine Sühne darstellen könne. Im Raum<br />
<strong>de</strong>s ewigen Denkens ist <strong>de</strong>r Tod zweifellos keine Zerstörung <strong>de</strong>r<br />
Ordnung, weil <strong>de</strong>rjenige, welcher <strong>de</strong>n Tod als Sühne über<br />
nimmt, nicht aufhört zu sein. (Natürlich ist hier die Unsterb<br />
lichkeit <strong>de</strong>r menschlichen Seele vorausgesetzt.) Vielmehr geht<br />
es um die Erklärung, ob außer <strong>de</strong>m ewigen ordnen<strong>de</strong>n Geist<br />
einer an<strong>de</strong>rn, menschlichen, Befehlsgewalt das <strong>Recht</strong> zusteht,<br />
eine solche Sühne zu for<strong>de</strong>rn.<br />
Die Sühne ist inhaltlich begrün<strong>de</strong>t durch die Ordnung,<br />
innerhalb welcher das Vergehen begangen wor<strong>de</strong>n ist. Ausge<br />
sprochen <strong>und</strong> gefor<strong>de</strong>rt wird sie, wie gesagt, von jener Gewalt,<br />
welcher diese Ordnung zur Obhut unterstellt ist. Diese Gedan<br />
kenfolge ist logisch <strong>und</strong> einfach. Das Problem liegt aber tiefer.<br />
Der Kern <strong>de</strong>r Frage besteht nicht darin, ob irgen<strong>de</strong>ine mensch<br />
liche Autorität die Vollmacht zur Verhängung eines To<strong>de</strong>surteils<br />
habe, son<strong>de</strong>rn wie <strong>de</strong>r Mensch in jenem Ordnungsganzen<br />
stehe, das — in unserem Fall — <strong>de</strong>r staatlichen Autorität zur<br />
Sorge übertragen ist. Was immer <strong>de</strong>m Ordnungsganzen unter<br />
stellt ist, gehört notwendigerweise auch zum Machtbereich <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>m Ganzen vorstehen<strong>de</strong>n Gewalt. Wenn also <strong>de</strong>r Mensch mit<br />
seinem Leben innerhalb <strong>de</strong>r menschlichen Gemeinschaft steht<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>m Ganzen sogar untergeordnet ist, dann folgt notwendig<br />
daraus, daß für <strong>de</strong>n Fall, daß er gegen die Gemeinschaft gr<strong>und</strong><br />
sätzlich, also gemeingefährlich, verstößt, die Autorität von ihm<br />
das Opfer <strong>de</strong>s Lebens verlangen kann. Von diesem Gesichts<br />
punkt aus hat Thomas das Problem in Artikel 2 angefaßt. Es er-<br />
333
64. 1-4 übrigt sich also die Schwierigkeit, daß nur <strong>de</strong>rjenige das <strong>Recht</strong><br />
habe, über das Leben eines Menschen zu befin<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r es auch<br />
geschaffen hat. Mit solcher Fragestellung befän<strong>de</strong>n wir uns au<br />
ßerhalb <strong>de</strong>s Gebiets <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s, nämlich nur innerhalb <strong>de</strong>r Kau<br />
salität. Die Kategorie <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s ist aber, wie bereits gesagt,<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Kausalität unterschie<strong>de</strong>n, wenngleich<br />
bei<strong>de</strong> untereinan<strong>de</strong>r Verbindungslinien haben.<br />
Der Artikel 5 in Fr. 58 hat uns bereits einen Einblick in die<br />
beinahe unabschätzbare Einglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Einzelperson in die<br />
Gemeinschaft gegeben. Das organische Gesellschafts- <strong>und</strong><br />
Staats<strong>de</strong>nken drängt zu dieser Sicht. „In staatlicher Hinsicht<br />
wer<strong>de</strong>n alle Menschen, die einer Gemeinschaft angehören, als<br />
ein einziger Körper angesehen <strong>und</strong> die ganze Gemeinschaft als<br />
ein Mensch, wie auch Porphyrius sagt, daß vermöge <strong>de</strong>r Wesens<br />
gemeinschaft mehrere Menschen ein Mensch sind" (I-II 81,1;<br />
DT, Bd. 12). Wie an an<strong>de</strong>rer Stelle ausgeführt wird (vgl. Exkurs<br />
I), gehört dieser Organismus zur moralischen Ordnung, nicht<br />
etwa zur physischen. Manche scholastische Autoren haben sich<br />
viel Mühe gemacht, durch die Unterscheidung von Individuum<br />
<strong>und</strong> Person zu zeigen, daß das Personale über <strong>de</strong>r Gemeinschaft<br />
stehe. Diese ontologische Sicht lag Thomas fern. Für ihn gehört<br />
die Gemeinschaft <strong>de</strong>r dynamisch-sittlichen Ordnung, d. h. <strong>de</strong>m<br />
Bereich <strong>de</strong>s menschlichen Zieles, also jenem Bereich an, zu wel<br />
chem Thomas auch das <strong>Recht</strong> zählt. Das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Gemein<br />
schaft wird bei ihm von <strong>de</strong>m gemeinsamen Ziel, <strong>de</strong>m Gemein<br />
wohl, abgeleitet. Diesem hat <strong>de</strong>r Mensch mit <strong>de</strong>m Einsatz aller<br />
seiner, auch persönlichen Kräfte zu dienen, um sich selbst als<br />
Mensch wie<strong>de</strong>rzufin<strong>de</strong>n. Wie die Sün<strong>de</strong> überhaupt <strong>de</strong>n Men<br />
schen jenes Platzes beraubt, <strong>de</strong>n er in <strong>de</strong>r Gesamtordnung als<br />
geistiges Wesen einnimmt, <strong>und</strong> ihn so sogar unter das Tier stellt<br />
(Art. 2 Zu 3), so schei<strong>de</strong>t die Sün<strong>de</strong> gegen die Gemeinschaft <strong>de</strong>n<br />
Menschen gewissermaßen von selbst aus dieser aus. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong>e auch kann die staatliche Autorität nicht wegen jedwe<br />
<strong>de</strong>n Verbrechens die To<strong>de</strong>sstrafe verhängen, son<strong>de</strong>rn nur wegen<br />
jener, die <strong>de</strong>n Menschen zum „fauligen" Glied, wie sich Thomas<br />
(Art. 2) ausdrückt, stempeln.<br />
Es geht in erstem Betracht nicht darum, daß die Gemein<br />
schaft sich in ihrer Existenz sichere, als ob sie sich durch einen<br />
gemeingefährlichen Verbrecher in einem gewissen Notstand<br />
o<strong>de</strong>r gar in einer Notwehr befän<strong>de</strong>. Dieser Notwendigkeit <strong>de</strong>r<br />
Selbstsicherung wäre mit Einkerkerung bzw. Gewahrsam mit<br />
334
Arbeitszwang Genüge getan. Gewiß kann unter Umstän<strong>de</strong>n<br />
die To<strong>de</strong>sstrafe ein Abschreckmittel sein, um schwerste,<br />
gemeingefährliche Verbrechen zu verhüten. Aber auch dieser<br />
Gesichtspunkt ist nicht vordringlich. Vielmehr geht es darum,<br />
die Ordnung als ein geistiges Gut <strong>de</strong>r Gemeinschaft zu wahren<br />
<strong>und</strong> dort — wie<strong>de</strong>rum menschlich gesprochen — wie<strong>de</strong>rherzu<br />
stellen, wo sie durchbrochen wur<strong>de</strong>, d. h. das Verbrechen zu<br />
sühnen. Es ist zum richtigen Verständnis <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe vorausgesetzt,<br />
daß man sich gr<strong>und</strong>sätzlich in <strong>de</strong>n geistigen <strong>und</strong><br />
sittlichen Sinn <strong>de</strong>r Gemeinschaftsordnung hineinfin<strong>de</strong>t.<br />
Im letzten Gr<strong>und</strong> ruht das Argument für die To<strong>de</strong>sstrafe also<br />
auf <strong>de</strong>r inneren Struktur <strong>de</strong>s Gemeinwohls, das sich mit <strong>de</strong>m<br />
Wohl <strong>de</strong>r Einzelperson nicht auf dieselbe Stufe stellen läßt.<br />
Denn es besteht, wie Thomas in 58,7 Zu 2 sagt, zwischen die<br />
sen bei<strong>de</strong>n ein wesentlicher Unterschied, nicht nur ein quantita<br />
tiver wie zwischen viel <strong>und</strong> wenig. Aus eben diesem Gr<strong>und</strong> hat<br />
niemals eine Privatperson das <strong>Recht</strong> zur Tötung eines Verbre<br />
chers (ausgenommen im Fall <strong>de</strong>r Notwehr, wodurch aber eine<br />
ganz an<strong>de</strong>re Note in die Fragestellung hineinkommt). Ebenso<br />
wenig kann ein Hausherr seinen Sklaven hinrichten. Denn auch<br />
hier hält Thomas an <strong>de</strong>r wesentlichen Eigenart <strong>de</strong>s Gemein<br />
wohls fest: Staatsgemeinschaft <strong>und</strong> Hausgemeinschaft sind<br />
wesentlich verschie<strong>de</strong>n (58,7 Zu 2). Es ist also im Ordnungs<br />
<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>s hl. Thomas durchaus richtig: „Das Gemeinwohl<br />
vieler ist gottentsprechen<strong>de</strong>r als das Wohl <strong>de</strong>s einzelnen" (II-II<br />
31,3 Zu 2; DT, Bd. 16).<br />
Soweit die Zusammenhänge in <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r reinen Phi<br />
losophie, d. h. insofern von <strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>en <strong>de</strong>r Gemeinschaft die<br />
Re<strong>de</strong> ist innerhalb <strong>de</strong>r natura humana. Wie aber verhält es sich,<br />
wenn wir nicht mehr gr<strong>und</strong>sätzlich von <strong>de</strong>m Staat an sich, son<br />
<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>m Staat sprechen, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r konkreten Wirklichkeit<br />
als solcher existiert? Das Gemeinwohl, von <strong>de</strong>m Thomas<br />
spricht, ist nicht dasselbe wie das, was ein konkreter Staat als<br />
solches bezeichnet <strong>und</strong> beabsichtigt. Es ist noch lange nicht<br />
immer Gemeinwohl, was eine staatliche Gemeinschaft als sol<br />
ches ansieht. Wäre <strong>de</strong>m so, dann könnte <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rstand gegen<br />
eine sittlich zerrüttete <strong>und</strong> zu <strong>de</strong>n größten Menschenverbre<br />
chen fähige Gesellschaft bereits als Sün<strong>de</strong> gegen das Gemein<br />
wohl bezeichnet <strong>und</strong> darum naturrechtlich mit <strong>de</strong>m To<strong>de</strong><br />
bestraft wer<strong>de</strong>n. Unvermeidlicherweise wird <strong>de</strong> facto ein Revo<br />
lutionär, auch wenn er an sich nach i<strong>de</strong>alem Denken recht hätte,<br />
335
64. 1-4 Unrecht bekommen, d.h. er wird gemäß positiv gelten<strong>de</strong>m<br />
<strong>Recht</strong> hingerichtet. Der Naturrechts<strong>de</strong>nker wird eine solche<br />
Hinrichtung im Raum <strong>de</strong>r ewigen Ordnung <strong>und</strong> <strong>de</strong>s ewigen<br />
<strong>Recht</strong>s stets als rechtswidrig bezeichnen. Gera<strong>de</strong> diese Aussicht<br />
aber, daß <strong>de</strong>r konkrete Staat, <strong>de</strong>r von einer ganz kontingenten<br />
Willensbildung abhängt <strong>und</strong> regiert wird, die naturrechtliche<br />
Ordnung, also auch die gerechte Handhabung <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe,<br />
nicht garantiert, gibt das schwere Problem auf, ob die „an sich"<br />
zu <strong>Recht</strong> bestehen<strong>de</strong> To<strong>de</strong>sstrafe nicht doch schließlich die<br />
Absichten <strong>de</strong>s Naturrechts zunichtemache. Dazu kommt noch<br />
die Überlegung, daß Irren menschlich ist, daß also selbst bei<br />
bester sittlicher Haltung <strong>de</strong>r Staatsgewalt <strong>und</strong> ihrer Behör<strong>de</strong>n<br />
die Schuldfrage <strong>de</strong>s als Verbrecher Bezeichneten nicht wahr<br />
heitsgetreu gelöst wer<strong>de</strong>n kann. Wäre es dann nicht doch ange<br />
bracht, <strong>de</strong>n Rat <strong>de</strong>s hl. Thomas (60,4 Zu 1 u. Zu 3) zu befol<br />
gen, wonach es besser ist, sich öfters zugunsten <strong>de</strong>s Mitmen<br />
schen zu täuschen, als sich <strong>de</strong>r Gefahr auszusetzen, <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn<br />
auch nur in seltenen Fällen Unrecht zu tun?<br />
Mit dieser Frage sind wir nun nicht mehr auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
überzeitlichen Prinzipien <strong>de</strong>s Naturrechts, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s kon<br />
kreten natürlichen <strong>Recht</strong>s, worein sich in <strong>de</strong>r Praxis ein gerüt<br />
teltes Maß von persönlichem Wertempfin<strong>de</strong>n mischt. Thomas<br />
selbst hatte offenbar keine Schwierigkeit, für <strong>de</strong>n konkreten<br />
Staat die Gültigkeit <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe aufrechtzuerhalten, <strong>und</strong><br />
zwar nicht etwa nur auf Gr<strong>und</strong> soziologischer Beeinflussung<br />
vonseiten <strong>de</strong>s Werturteils seiner Zeit überhaupt, son<strong>de</strong>rn auch,<br />
weil er von sich aus <strong>de</strong>m christlichen Gewissen seiner Zeitge<br />
nossen noch Einsicht <strong>und</strong> auch Verantwortungsbewußtsein<br />
zutraute, sich an <strong>de</strong>n Normen unabän<strong>de</strong>rlicher Gesetze zu<br />
orientieren. Vielleicht hatte er ihm doch zu viel zugetraut?<br />
Natürlich können wir Menschen niemals <strong>de</strong>n Anspruch<br />
erheben, irrtumsfrei zu sein. Wir wer<strong>de</strong>n, wenn wir überhaupt<br />
noch eine allgemeine Ordnung aufrechterhalten wollen, immer<br />
mit <strong>de</strong>m einen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rn „Betriebsunfall" in <strong>de</strong>r Justiz rech<br />
nen müssen. Eine an<strong>de</strong>re Frage allerdings wird die sein, ob wir<br />
von vornherein einen solch schwerwiegen<strong>de</strong>n Betriebsunfall<br />
wie die irrtümliche Hinrichtung eines Unschuldigen in Kauf<br />
nehmen dürfen. Und doch geben auch die Gegner <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>s<br />
strafe zu, daß in beson<strong>de</strong>rs außeror<strong>de</strong>ntlichen Fällen, wie bei<br />
Unruhen, in Kriegszeiten usw., die To<strong>de</strong>sstrafe eine unentbehr<br />
liche Maßnahme zur Aufrechterhaltung <strong>de</strong>r allgemeinen Ord-<br />
336
nung sei. H. Kühle, <strong>de</strong>ssen Buch über „Staat <strong>und</strong> To<strong>de</strong>sstrafe"<br />
(Münster 1934) übrigens die Gedanken <strong>de</strong>s hl. Thomas gut wie<br />
<strong>de</strong>rgibt, weist auf einen sprechen<strong>de</strong>n Beleg, auf die Haltung <strong>de</strong>s<br />
ehemaligen Reichsjustizministers G. Radbruch hin, „<strong>de</strong>r prinzi<br />
piell Gegner <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe war, aber praktisch sie angewandt<br />
wissen wollte. In seinem Entwurf <strong>de</strong>s RSTGB hatte er — seiner<br />
Anschauung gemäß — die Abschaffung <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe vorgese<br />
hen. Als aber nach <strong>de</strong>r Ermordung W. Rathenaus (die Ermor<br />
dung Erzbergers war vorhergegangen) die Gefährdung <strong>de</strong>r Re<br />
gierungsmitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utlich wur<strong>de</strong>, erschien am 29.Juni 1922<br />
die 2. Verordnung zum Sch<strong>utz</strong>e <strong>de</strong>r Republik mit weitgehen<strong>de</strong>r<br />
Androhung <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe. Fast noch weiter geht das Repu<br />
bliksch<strong>utz</strong>gesetz <strong>de</strong>s Ministeriums Radbruch vom 21. Juli <strong>de</strong>s<br />
selben Jahres" (a. a. 0.106). Allerdings hat dann Radbruch spä<br />
ter nach seinem Ausschei<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r Regierung sich wie<strong>de</strong>rum<br />
gegen die To<strong>de</strong>sstrafe gewandt. Das Beispiel zeigt <strong>de</strong>utlich, wie<br />
sehr die praktische Handhabung <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe,<strong>de</strong>ren Erlaubt<br />
heit an sich <strong>und</strong> prinzipiell nicht zu leugnen ist, sehr stark von<br />
<strong>de</strong>r soziologischen Situation abhängt <strong>und</strong> übrigens auch abhän<br />
gen muß. Verkehrt wäre es nur, daraus die gr<strong>und</strong>sätzliche<br />
Erlaubtheit <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe abstreiten zu wollen.<br />
Im 4. Art. kommt Thomas auf ein typisch mittelalterliches<br />
Diskussionsthema zu sprechen. Trotz <strong>de</strong>r naturrechtlichen Un<br />
anfechtbarkeit <strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n Staat zu verhängen<strong>de</strong>n To<strong>de</strong>s<br />
strafe <strong>und</strong> trotz <strong>de</strong>r <strong>und</strong>urchbrochenen kirchlichen Lehre, daß<br />
dieses <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>m Staate zustehe, schickt es sich doch nicht, daß<br />
ein Kleriker das Amt eines Henkers übernimmt. Gemäß <strong>de</strong>m<br />
Gr<strong>und</strong>satz „Ecclesia non sitit sanguinem" sollte <strong>de</strong>r Kleriker,<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Altar geweiht ist, sich von solchen Werken freihalten.<br />
Das frühere kirchliche Gesetzbuch (CJC can. 984 n. 6 u. 7),<br />
das in seinem eigenen Gerichtsverfahren ein „barmherziges<br />
Gericht" durchzuführen wünscht (cum misericordia iudicium,<br />
CJC can. 2214 §2), erklärte diejenigen, die bei To<strong>de</strong>surteilen<br />
mitwirkten, als irregulär. Der unter Johannes Paul IE edierte<br />
Co<strong>de</strong>x enthält hierüber nichts mehr. Eine Zeitlang bestand so<br />
gar das kirchliche Asylrecht. Dem Einwand, daß selbst die gött<br />
liche Vorsehung die To<strong>de</strong>sstrafe legitimiert habe, begegnet Tho<br />
mas in überaus feinsinniger Weise in <strong>de</strong>r Antwort Zu 1: „Gott<br />
wirkt in allem das Gute, im einzelnen jedoch das, was ihm ange<br />
messen ist". Ein je<strong>de</strong>r also hat Gott nachzuahmen in <strong>de</strong>m, was<br />
ihm, seiner Natur, seiner Stellung, seinem Beruf eigentümlich<br />
337
ist. Thomas wen<strong>de</strong>t damit einen Gedanken aus <strong>de</strong>r Seinslehre<br />
auf die Moral an: wie die Dinge <strong>de</strong>r Welt je verschie<strong>de</strong>n sind,<br />
entsprechend <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Abbildbarkeit <strong>de</strong>r einen un<br />
endlichen Seinsfülle Gottes, so hat auch je<strong>de</strong>r Mensch an sei<br />
nem Posten, in seinem Beruf in beson<strong>de</strong>rs bezeichnen<strong>de</strong>rweise<br />
eine <strong>de</strong>r unendlichen Vollkommenheiten Gottes darzustellen.<br />
„Die Unterscheidung <strong>und</strong> die Vielheit <strong>de</strong>r Dinge stammt aus<br />
<strong>de</strong>r Absicht <strong>de</strong>s ersten Wirken<strong>de</strong>n, das ist Gott. Denn Er hat die<br />
Dinge ins Dasein hervorgebracht, um Seine Güte <strong>de</strong>n Geschöp<br />
fen mitzuteilen <strong>und</strong> durch sie darzustellen. Und weil sie durch<br />
ein Geschöpf nicht hinreichend dargestellt wer<strong>de</strong>n kann, hat Er<br />
viele <strong>und</strong> verschie<strong>de</strong>ne Geschöpfe hervorgebracht, so daß das,<br />
was <strong>de</strong>m einen Geschöpf in <strong>de</strong>r Darstellung <strong>de</strong>r göttlichen Güte<br />
fehlt, aus einem an<strong>de</strong>ren ergänzt wird. Denn die Gutheit,<br />
welche in Gott einfach <strong>und</strong> einförmig ist, ist in <strong>de</strong>n Geschöpfen<br />
vielfältig <strong>und</strong> geteilt" (I 47,1; DT, Bd. 4).<br />
2. DER SELBSTMORD<br />
(Art. 5)<br />
Für gewöhnlich wird das Thema <strong>de</strong>s Selbstmords unter das<br />
Kapitel: „Pflichten <strong>de</strong>s Menschen in bezug auf Leben <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heit gestellt". Damit aber fällt <strong>de</strong>r Traktat aus <strong>de</strong>r Kate<br />
gorie <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. Er wird zum rein ethischen Traktat im Sinn<br />
von Bindung <strong>de</strong>s menschlichen Gewissens an Gott. Warum hat<br />
nun Thomas dieses Thema in <strong>de</strong>n Traktat über <strong>Recht</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> eingefügt?<br />
Man könnte berechtigterweise meinen, <strong>de</strong>r fünfte Artikel, in<br />
welchem dieses Thema behan<strong>de</strong>lt wird, sei nur ein Anhängsel<br />
<strong>de</strong>r allgemeinen Frage <strong>de</strong>s Mor<strong>de</strong>s. Jedoch müßte dann dieser<br />
Artikel am Schluß <strong>de</strong>r Frage stehen, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r ganze Fra<br />
genkomplex über die Tötung eines an<strong>de</strong>rn erledigt wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Wie<strong>de</strong>rum könnte man sich sagen, daß ein reiner Zufall die<br />
sen Artikel hierhergebracht habe, eine gedankliche Assoziation<br />
zum vorigen Artikel etwa in <strong>de</strong>m Sinne: wenn es auch einer Pri<br />
vatperson nicht erlaubt ist, einen an<strong>de</strong>rn, selbst wenn er <strong>de</strong>n<br />
Tod verdient, zu töten, so möchte man doch annehmen, daß sie<br />
dann wenigstens sich selbst das Leben nehmen könne.<br />
Es ist jedoch kaum anzunehmen, daß Thomas sich in <strong>de</strong>r<br />
Einreihung von Fragen <strong>und</strong> Artikeln von solch zufälligen Ge-<br />
338
Sichtspunkten o<strong>de</strong>r gar von mehr o<strong>de</strong>r weniger unterbewußten 64. 5<br />
Assoziationen leiten läßt. Dafür ist <strong>de</strong>r Aufbau sowohl <strong>de</strong>r gan<br />
zen Summa wie auch <strong>de</strong>r einzelnen Fragen durchweg viel zu<br />
sorgfältig systematisch durchdacht.<br />
Der Gr<strong>und</strong> liegt darum tiefer. Thomas betrachtet, wie auch<br />
aus <strong>de</strong>m Artikel selbst hervorgeht, <strong>de</strong>n Selbstmord als eine Un<br />
gerechtigkeit, als ein Vergehen gegen das <strong>Recht</strong>. Das zweite<br />
Argument, das er für das Verbot <strong>de</strong>s Selbstmords anführt, hebt<br />
diesen Gesichtspunkt <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit gegen die mensch<br />
liche Gesellschaft hervor <strong>und</strong> scheint auch die systematische<br />
Einordnung dieser Frage bewirkt zu haben. Daß Thomas <strong>de</strong>n<br />
Selbstmord nicht etwa in die Kategorie <strong>de</strong>r allgemeinen Pflich<br />
ten <strong>de</strong>s Menschen gegenüber Gott einreihen wollte, geht schon<br />
aus <strong>de</strong>m Einwand hervor, mit welchem er diese Frage einleitet:<br />
Es scheint, daß <strong>de</strong>r Selbstmord nichts mit <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> zu<br />
tun habe, weil sich ja keiner selbst Unrecht antun könne. Tho<br />
mas antwortet darauf, daß die Bewandtnis <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit<br />
<strong>de</strong>nnoch gewahrt sei, <strong>und</strong> zwar, weil <strong>de</strong>r Selbstmord gegen das<br />
<strong>Recht</strong> Gottes <strong>und</strong> gegen das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Gesellschaft gerichtet<br />
sei. Insofern nun <strong>de</strong>r Selbstmord gegen das <strong>Recht</strong> Gottes ver<br />
stößt, wäre er <strong>de</strong>m Traktat über die Religion einzufügen, wo die<br />
<strong>Recht</strong>spflichten <strong>de</strong>s Menschen gegen Gott behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n.<br />
Thomas folgt aber in <strong>de</strong>r Einglie<strong>de</strong>rung nicht diesem Gedan<br />
ken, son<strong>de</strong>rn gibt offenbar <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>n Vorzug: Der<br />
Selbstmord be<strong>de</strong>utet ein Unrecht gegen die menschliche<br />
Gesellschaft, also ein Unrecht im eigentlichen <strong>und</strong> strengen<br />
Sinn.<br />
Es sei nur beiläufig bemerkt, daß hier nur von <strong>de</strong>r eigenmäch<br />
tigen Zerstörung <strong>de</strong>s eigenen Lebens die Re<strong>de</strong> ist, nicht also von<br />
<strong>de</strong>r Frage, ob ein gerecht zum To<strong>de</strong> Verurteilter auf Geheiß <strong>de</strong>s<br />
Richters das To<strong>de</strong>surteil an sich selbst vollstrecken dürfe, o<strong>de</strong>r<br />
ob er sich dieser Auffor<strong>de</strong>rung wi<strong>de</strong>rsetzen müsse.<br />
Gewiß steht die Verwerfung <strong>de</strong>s Selbstmords als eines<br />
Unrechts gegen die Gesellschaft im Zusammenhang mit <strong>de</strong>n<br />
an<strong>de</strong>ren, rein sittlichen Beweggrün<strong>de</strong>n. Thomas konnte <strong>de</strong>s<br />
halb darüber nicht schweigen, um sich rein formal an die<br />
<strong>Recht</strong>sbegründung zu halten. Außer<strong>de</strong>m leuchtet gera<strong>de</strong> hier<br />
<strong>de</strong>r hauptsächliche Gr<strong>und</strong>gedanke <strong>de</strong>r thomasischen Natur<br />
rechtsauffassung auf, daß nämlich alle naturhaften sittlichen<br />
For<strong>de</strong>rungen, d.h. alle Gebote <strong>de</strong>s Sittengesetzes, soweit sie<br />
aus <strong>de</strong>r natura humana folgen, nicht nur sittlichen, son<strong>de</strong>rn zu-<br />
339
64. 5 gleich rechtlichen Charakter haben. Das will besagen: Das<br />
natürliche Sittengesetz gilt nicht nur in <strong>de</strong>r vertikalen Ordnung<br />
von oben nach unten, vom ewigen Richter zu je<strong>de</strong>m einzelnen<br />
Menschen, son<strong>de</strong>rn zugleich auch horizontal, von Mensch zu<br />
Mensch, als Organisationsprinzip <strong>de</strong>r Menschheit, wobei <strong>de</strong>r<br />
selbe Richter <strong>de</strong>s einzelnen Menschen nun Gesetzgeber <strong>de</strong>r so<br />
zialen Ordnung ist <strong>und</strong> auch einstmals als <strong>de</strong>ren Richter auftre<br />
ten wird. Darum gelten die moralischen Grün<strong>de</strong> gegen <strong>de</strong>n<br />
Selbstmord zugleich auch als gesellschaftliche <strong>Recht</strong>sfor<strong>de</strong>run<br />
gen.<br />
Thomas sieht im Selbstmord ein dreifaches Verbrechen:<br />
gegen <strong>de</strong>n Menschen, <strong>de</strong>r die Tat verübt, gegen die Gesellschaft<br />
<strong>und</strong> gegen Gott.<br />
a) Der Selbstmord als Verbrechen gegen sich selbst<br />
Der natürlichen Veranlagung nach strebt je<strong>de</strong>s Wesen zur<br />
Selbsterhaltung. Es be<strong>de</strong>utet daher ein Verfehlen gegen die<br />
naturhafteste Liebe, nämlich die Selbstliebe, wenn einer an sein<br />
eigenes Leben Hand anlegen wollte. Und da in <strong>de</strong>r übernatürli<br />
chen Ordnung die Selbstliebe durch die theologische Tugend<br />
<strong>de</strong>r Caritas geregelt wird, wird <strong>de</strong>r Selbstmord zum Verbrechen<br />
auch gegen diese.<br />
Der Beweis wird natürlich sehr schwach, wenn man das<br />
Naturgesetz nur in einer naturhaften Hinneigung zu irgen<strong>de</strong>i<br />
nem Ziel, etwa <strong>de</strong>r Selbsterhaltung, verstehen wollte. Thomas<br />
ist weit entfernt, das Naturgesetz in diesem naturalistischen<br />
Sinne zu verstehen. Das Naturgesetz als sittliche <strong>und</strong> rechtliche<br />
Norm ist nicht einfach eine bestimmte Zielordnung unserer<br />
Triebe <strong>und</strong> Neigungen. Die Naturneigung zur Selbsterhaltung<br />
ist wohl ein vorbestimmter Trieb; als Naturgesetz, d. h. als<br />
Norm schließt er zugleich auch die naturhafte Neigung <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Vernunft zur Bejahung dieser Ordnung mit ein.<br />
Das will heißen: die Naturneigung ist zugleich Bewußtseinsnei-<br />
gung, eine naturhafte For<strong>de</strong>rung unserer Vernunft <strong>und</strong> damit<br />
naturhaft in uns vorgegeben, also ein uns vom Schöpfer einge<br />
schriebenes Gesetz. Erst dadurch wird es möglich, in <strong>de</strong>m<br />
Wi<strong>de</strong>rspruch gegen diese Naturordnung <strong>de</strong>s Menschen eine<br />
Sün<strong>de</strong> zu erkennen. In<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Mensch in seinem Bewußtsein<br />
<strong>und</strong> Wollen diese Ordnung verneint, wi<strong>de</strong>rsetzt er sich einer in<br />
seinem Bewußtsein selbst vorgegebenen Ordnung, die ihren<br />
340
letzten Sinn nur in <strong>de</strong>m ewigen Bewußtsein Gottes haben kann. 64. 5<br />
So wird <strong>de</strong>r Selbstmord als ein bewußtes Übergehen unserer<br />
innersten menschlichen Neigung <strong>und</strong> natürlichen Selbsthebe<br />
zum Verbrechen gegen das Naturgesetz.<br />
Gegenüber <strong>de</strong>r Ansicht Senecas, wonach die Überwindung<br />
<strong>de</strong>s naturhaften Selbsterhaltungstriebes, somit die Selbsttö<br />
tung, eine „Hel<strong>de</strong>ntat" sei, erklärt Thomas in <strong>de</strong>r fünften Ant<br />
wort, es handle sich nur <strong>de</strong>m äußeren Anschein nach um eine<br />
Hel<strong>de</strong>ntat.<br />
b) Der Selbstmord als Verbrechen gegen die Gesellschaft<br />
Wie<strong>de</strong>rum begegnen wir <strong>de</strong>m aristotelischen Gr<strong>und</strong>satz, daß<br />
<strong>de</strong>r Mensch zur Gesellschaft gehöre wie <strong>de</strong>r Teil zum Ganzen.<br />
Der Zusammenhang, in welchem hier dieses Prinzip steht, un<br />
terstreicht <strong>de</strong>n darin ausgesprochenen Gedanken noch viel<br />
stärker als etwa die Lehre von 58,5, wo je<strong>de</strong>m Menschen zur<br />
Pflicht gemacht wird, <strong>de</strong>m Gemeinwohl mit allen seinen sittli<br />
chen Kräften zu dienen. Hier nämlich möchte man <strong>de</strong>n Ein<br />
druck gewinnen, als ob die Gemeinschaft Eigentümerin <strong>de</strong>s Le<br />
bens <strong>de</strong>s einzelnen wäre <strong>und</strong> so <strong>de</strong>r Gedanke zugr<strong>und</strong>e läge,<br />
daß nur <strong>de</strong>r über das Leben verfügen könne, <strong>de</strong>m es gehöre,<br />
<strong>und</strong> das sei die Gemeinschaft.<br />
Nun ist wohl richtig, daß <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>m das Leben gehört,<br />
auch darüber verfügen kann. Es gilt aber nicht umgekehrt, daß<br />
<strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r die To<strong>de</strong>sstrafe verhängen kann, dadurch auch<br />
bewiese, daß ihm das Leben gehört. Denn er verfügt nicht über<br />
das Leben, son<strong>de</strong>rn er vollführt nur eine <strong>Recht</strong>shandlung, die<br />
bereits vorgezeichnet ist von Dem, <strong>de</strong>m das Leben im eigentli<br />
chen Sinne gehört, nämlich Gott. Das menschliche Leben<br />
gehört nicht <strong>de</strong>r Gemeinschaft, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>m Gut, das durch die<br />
Gemeinschaft verwirklicht wer<strong>de</strong>n soll. Gera<strong>de</strong> darum aber,<br />
weil <strong>de</strong>r Selbstmord sich an diesem gemeinsamen Gut verfehlt,<br />
be<strong>de</strong>utet er ein Unrecht gegen die menschliche Gesellschaft.<br />
c) Der Selbstmord als Sün<strong>de</strong> gegen Gott<br />
Im Gr<strong>und</strong>e kommt dieser Gedanke auf das erste Argument<br />
zurück, nur wird hier <strong>de</strong>r religiöse Sinn unserer sittlichen Ver<br />
antwortung stärker unterstrichen. Unser ganzes Sein ist ein<br />
Sein durch Teilhabe <strong>und</strong> weist darum stets über sich hinaus auf<br />
341
64. 5 die Absichten <strong>de</strong>ssen, an <strong>de</strong>ssen Sein es teilhat. Es kann darum<br />
niemals einen Gr<strong>und</strong> geben, sich irgendwann <strong>und</strong> aus irgend<br />
welcher Absicht, selbst nicht zur Rettung vor sittlicher Gefahr,<br />
das Leben zu nehmen. Natürlich hin<strong>de</strong>rt dies nicht, daß man im<br />
Kampf für ein sittliches Gut sein Leben einsetze. Denn dann<br />
wird nicht <strong>de</strong>r Tod gesucht, son<strong>de</strong>rn die Unversehrtheit<br />
menschlichen o<strong>de</strong>r gna<strong>de</strong>nhaft-göttlichen Lebens.<br />
3. DIE TÖTUNG UNSCHULDIGEN LEBENS<br />
(Art. 6)<br />
64. 6 Einem Unschuldigen darf das Leben niemals genommen<br />
wer<strong>de</strong>n, erklärt Thomas im sechsten Artikel. Man kann von<br />
ihm <strong>de</strong>n Einsatz für ein gemeinschaftliches, sittlich ausgerichte<br />
tes Gut verlangen. Wenn er diesen Einsatz für das Ganze nicht<br />
leistet, kann man ihn unter Umstän<strong>de</strong>n für to<strong>de</strong>swürdig erach<br />
ten auf Gr<strong>und</strong> dieser Verneinung, die dann als Verbrechen<br />
gegen die Gemeinschaft erklärt wer<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>. Aber <strong>de</strong>r<br />
Schuldlose bleibt, wie Thomas ausdrücklich sagt, immer ein<br />
nützliches <strong>und</strong> das Gemeinwohl för<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>s Glied <strong>de</strong>r mensch<br />
lichen Gesellschaft.<br />
Um allen Ernstes in allen konkreten Fällen zu dieser Lehre<br />
zu stehen, muß man vom wesentlich sittlichen Wert, ja sogar<br />
vom theologischen Sinn <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft über<br />
zeugt sein. Der unheilbar Kranke, <strong>de</strong>r Sieche, <strong>de</strong>r Geistes<br />
schwache <strong>und</strong> sogar Irrsinnige erfüllt noch einen sinnvollen<br />
Zweck in <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft. Erstens hat damit die<br />
Gesellschaft die offensichtliche <strong>und</strong> untrügliche Gelegenheit,<br />
sich noch als sittliche Gemeinschaft zu bewähren, in<strong>de</strong>m sie aus<br />
Achtung vor <strong>de</strong>m Geist, <strong>de</strong>r in je<strong>de</strong>m Menschen, auch noch im<br />
Irren, da ist, die Pflege eines scheinbar lebensunwerten Lebens<br />
übernimmt. Zweitens kann sie, sofern sie christlich ist, Ernst<br />
machen mit <strong>de</strong>n For<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Evangeliums, die gemäß<br />
christlichem Glauben nicht nur For<strong>de</strong>rungen an <strong>de</strong>n einzelnen<br />
Menschen für das private Leben sind, son<strong>de</strong>rn zugleich Sozial<br />
prinzipien, Gr<strong>und</strong>sätze <strong>de</strong>r Gesellschaftsformung be<strong>de</strong>uten.<br />
Gera<strong>de</strong> vom übernatürlichen Glauben her, mit seinen Dogmen<br />
von <strong>de</strong>r Erbsün<strong>de</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Berufung aller zum ewigen Leben,<br />
wird je<strong>de</strong>r naturalistischen Bevölkerungspolitik <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>n ent<br />
zogen.<br />
342
Man könnte versucht sein, in unserem Artikel das Problem 64. 6<br />
<strong>de</strong>s Schwangerschaftsabbruchs ange<strong>de</strong>utet zu fin<strong>de</strong>n. Doch hat<br />
Thomas dieses Thema nicht im Auge gehabt.<br />
4. DIE TÖTUNG EINES LEBENSGEFÄHRLICHEN ANGREIFERS<br />
(Art. 7)<br />
Das römische <strong>Recht</strong> hatte Gewalt mit Gewalt zu vertreiben 64. 7<br />
gestattet. Thomas greift auf diesen Gedanken in <strong>de</strong>r Formulie<br />
rung <strong>de</strong>r Dekretalen (vgl. Decret. Greg. IX., lib.V, tit. 12, De<br />
homicidio, c. 18; Frdbll, 801) zurück, in<strong>de</strong>m er erklärt, daß bei<br />
„moralisch abgewogener Sch<strong>utz</strong>maßnahme" o<strong>de</strong>r, in wörtlicher<br />
Ubersetzung <strong>de</strong>s altjuristischen Begriffs, bei „Maßhaltung<br />
schuldloser Verteidigung" (cum mo<strong>de</strong>ramine inculpatae tutelae,<br />
Notwehrbeschränkung) die eventuelle Tötung <strong>de</strong>s Gegners<br />
verantwortet wer<strong>de</strong>n könnte. In <strong>de</strong>m Begriff „moralisch abge<br />
wogene Verteidigung" (Notwehrbeschränkung) liegt <strong>de</strong>r Kern<br />
<strong>de</strong>s Artikels. Es ist damit gesagt, daß das Gewicht <strong>de</strong>r Absicht<br />
auf <strong>de</strong>r Selbstverteidigung liegt <strong>und</strong> nicht auf <strong>de</strong>r Tötung. Das<br />
will besagen: Der sich Verteidigen<strong>de</strong> soll nur die Absicht haben,<br />
sein Leben zu retten, in keiner Weise aber, <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren zu<br />
töten. Die Tötung <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren wird als reine Folge <strong>de</strong>r Selbst<br />
verteidigung aufgefaßt. Im Zusammenhang ist dies wichtig,<br />
weil nämlich gemäß <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s vorherigen Artikels die pri<br />
vate Tötung eines an<strong>de</strong>ren in sich schlecht ist, also niemals<br />
direkt gewollt sein darf. Sie darf höchstens als physische Folge<br />
einer sittlich guten Handlung auftreten.<br />
Damit allerdings scheint die Erlaubnis <strong>de</strong>r Selbstverteidi<br />
gung ziemlich illusorisch zu wer<strong>de</strong>n. Ist doch <strong>de</strong>r Fall <strong>de</strong>nkbar,<br />
daß man nur mit solcher Selbstwehr zurechtkommt, in <strong>de</strong>r man<br />
die völlige Tilgung <strong>de</strong>s Angreifers von vornherein beabsichtigt.<br />
In <strong>de</strong>n mittelalterlichen Verhältnissen, wo man nur mit Hieb<br />
o<strong>de</strong>r Stichwaffen zu rechnen hatte, hätte man sich vielleicht in<br />
<strong>de</strong>r Selbstverteidigung mit einfachem Umsichschlagen helfen<br />
können. In solchen Umstän<strong>de</strong>n ließe sich die „zufällige", nicht<br />
beabsichtigte Tötung <strong>de</strong>s Angreifers verstehen. Heute aber, da<br />
wohl selten ein Dieb in ein frem<strong>de</strong>s Haus eindringt, ohne mit<br />
einem Revolver bewaffnet zu sein, mit <strong>de</strong>m er aller Wahrschein<br />
lichkeit nach von vornherein <strong>de</strong>n Tod <strong>de</strong>s sich wehren<strong>de</strong>n Besit<br />
zers beabsichtigt, wird <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r sein Leben zu verteidigen<br />
343
64. 7 hat, vor allem, wenn er kein tüchtiger Schütze ist, die lebens<br />
wichtigsten Körperstellen zum Ziel seiner Schußwaffe machen<br />
müssen. So bleibt, wie es scheint, nichts an<strong>de</strong>res übrig, als <strong>de</strong>n<br />
Tod <strong>de</strong>s Angreifers direkt zu wollen.<br />
Die einfachste Lösung hierfür ist natürlich, mit mo<strong>de</strong>rnen<br />
Theologen die Selbstverteidigung als eine Handlung im Sinne<br />
<strong>de</strong>s Dienstes am öffentlichen Wohl, d. h. an <strong>de</strong>r öffentlichen<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung zu betrachten. Dann kann <strong>de</strong>r Vertei<br />
diger ruhig die Tötung <strong>de</strong>s Angreifers direkt wollen, wie dies<br />
auch Thomas hier <strong>de</strong>m Soldaten im Krieg o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Polizei<br />
eigens zugesteht.<br />
Verbleiben wir aber im Gedankengang <strong>de</strong>s Artikels, wonach<br />
<strong>de</strong>r Selbstverteidiger als Privatperson han<strong>de</strong>lt, dann folgt, daß<br />
die Absicht zur Tötung sittlich nicht haltbar ist. Und doch muß<br />
<strong>de</strong>r Verteidiger mit seiner Schußwaffe ein Ziel haben! Und die<br />
ses Ziel kann, wie gesagt, bisweilen nur eine tödliche Stelle sein.<br />
Die Analyse <strong>de</strong>r Handlung kann natürlich nicht einzig nach<br />
ihrer physischen Form geschehen. Denn so wäre sie we<strong>de</strong>r gut<br />
noch schlecht. Ein Geschoß kann aus irgen<strong>de</strong>inem Gr<strong>und</strong><br />
(Explosion) in das Herz <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn dringen, ohne daß sich<br />
damit eine sittliche Handlung von an<strong>de</strong>rer Seite verbin<strong>de</strong>t. Um<br />
zur sittlichen Beurteilung <strong>de</strong>r Abwehr, bei welcher die Schuß<br />
waffe auf eine lebenswichtige Stelle <strong>de</strong>s Angreifers gerichtet<br />
wird, zu kommen, muß man die unmittelbar mit <strong>de</strong>m rein phy<br />
sischen Geschehen verb<strong>und</strong>ene Absicht miteinbeziehen. Diese<br />
aber kann nie die direkte Tötung <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn sein, son<strong>de</strong>rn nur<br />
seine Unschädlichmachung. Daß zwischen <strong>de</strong>r Absicht zur<br />
Tötung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Absicht zur gänzlichen Unschädlichmachung<br />
ein großer Unterschied liegt, beweist die Tatsache, daß <strong>de</strong>r Ver<br />
teidiger das Leben <strong>de</strong>s Angreifers erhalten wür<strong>de</strong>, wenn er es<br />
könnte, ohne sein eigenes Leben zu gefähr<strong>de</strong>n. So scheint es<br />
keine ungebührliche Erweiterung <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s Artikels zu<br />
sein, wenn wir auch auf die mo<strong>de</strong>rne Problematik <strong>de</strong>n Satz <strong>de</strong>s<br />
hl. Thomas anwen<strong>de</strong>n: „Es ist nicht heilsnotwendig, die mora<br />
lisch abgewogene Sch<strong>utz</strong>maßnahme zu unterlassen, um <strong>de</strong>n<br />
Tod <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn zu vermei<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Mensch muß mehr für<br />
das eigene als für ein frem<strong>de</strong>s Leben Sorge tragen".<br />
Der Polizei erlaubt Thomas eigentümlicherweise die direkte<br />
Tötung <strong>de</strong>s Verbrechers. Eigentümlich klingt es auch, wenn<br />
Thomas <strong>de</strong>m Soldaten die völlige Vernichtung <strong>de</strong>s Fein<strong>de</strong>s ohne<br />
weitere Einschränkung zubilligt. Gemäß welchem <strong>Recht</strong> darf<br />
344
<strong>de</strong>r Soldat dies tun? Auch <strong>de</strong>r Feind erachtet sich um seines 64. 7<br />
Gemeinwohles willen ermächtigt, seinen Gegner bis zur Ver<br />
nichtung zu erledigen. Wollte man die Parallele mit <strong>de</strong>r polizeili<br />
chen Gewalt im Sinne <strong>de</strong>s hl. Thomas voll <strong>und</strong> ganz durchfüh<br />
ren, dann wäre man zur Erklärung gezwungen, daß <strong>de</strong>r Soldat<br />
als Diener eines übernationalen Gemeinwohles, also im Auftrag<br />
eines höheren als <strong>de</strong>s nationalen <strong>Recht</strong>s kämpfe. Sonst wäre<br />
nicht einzusehen, warum <strong>de</strong>r Soldat, <strong>de</strong>r für das Gemeinwohl<br />
seines Staatswesens gegen einen nicht zu seinem Gemeinwesen<br />
gehören<strong>de</strong>n Angreifer kämpft, mehr <strong>Recht</strong>e haben soll als <strong>de</strong>r<br />
sich verteidigen<strong>de</strong> Einzelmensch im Kampf mit <strong>de</strong>m Angreifer,<br />
d. h. warum <strong>de</strong>r Soldat seinen Gegner direkt vernichten darf,<br />
während <strong>de</strong>r private Verteidiger Maßhaltung in <strong>de</strong>r Abwehr<br />
üben muß. Unsere Stelle ist völkerrechtsphilosophisch interes<br />
sant, insofern sie beweist, wie wenig Thomas noch eine Vorstel<br />
lung von verschie<strong>de</strong>nen Nationen hatte. Die bestehen<strong>de</strong> Staats<br />
gemeinschaft autorisierte allein auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s zur Exi<br />
stenz <strong>und</strong> Selbstbehauptung ihre Soldaten zur Vernichtung <strong>de</strong>s<br />
Angreifers, da dieser als „Splitter" <strong>und</strong> Sektierer betrachtet<br />
wird, gegen <strong>de</strong>n dasselbe <strong>Recht</strong> als maßgebend betrachtet wird<br />
wie gegen einen Verbrecher innerhalb <strong>de</strong>r Gemeinschaft.<br />
Die Theorie <strong>de</strong>r privaten Selbstverteidigung wird heute auf<br />
einen Fall angewandt, auf <strong>de</strong>n sie unter gar keinen Umstän<strong>de</strong>n<br />
angewandt wer<strong>de</strong>n darf: auf die Kraniotomie o<strong>de</strong>r Perforation<br />
in <strong>de</strong>r Geburtshilfe. Man greift dabei auf die Unterscheidung<br />
zwischen physischer Natur <strong>de</strong>r Handlung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r eigentlichen<br />
Absicht, die <strong>de</strong>r Operateur damit verbin<strong>de</strong>t, zurück, in<strong>de</strong>m<br />
man erklärt, daß <strong>de</strong>r Arzt die Tötung gar nicht beabsichtige,<br />
son<strong>de</strong>rn nur Geburtshilfe leiste, womit natürlich die Tötung<br />
gegeben sei, die aber eben nicht als Tötung, son<strong>de</strong>rn nur als<br />
physische Perforation gewollt sei.<br />
Doch ist auch hier, wie bei je<strong>de</strong>r menschlichen Handlung,<br />
eine sittliche Situation gegeben, die es zu beurteilen gilt. Es<br />
kann sich unmöglich um eine Unschädlichmachung <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s<br />
han<strong>de</strong>ln, da das Kind nicht als Schädling auftritt, son<strong>de</strong>rn als<br />
völlig gleichberechtigter <strong>Recht</strong>sträger wie die Mutter. In <strong>de</strong>r<br />
Abwägung zwischen Mein <strong>und</strong> Dein, zwischen eigenem Leben<br />
<strong>und</strong> Leben <strong>de</strong>r Mutter fällt <strong>de</strong>m Leben <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s nicht weniger<br />
<strong>Recht</strong> zu als <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Mutter. Welche erste <strong>und</strong> unmittelbare<br />
sittliche Qualität soll also die Perforation haben? Keine an<strong>de</strong>re<br />
als Tötung unschuldigen Lebens. Außer<strong>de</strong>m ist hier ein Lieb-<br />
345
64. 7 lingsgedanke <strong>de</strong>s hl. Thomas nicht außer acht zu lassen, wonach<br />
nämlich <strong>de</strong>r einzelne stets im Ordnungsganzen <strong>de</strong>r Gemein<br />
schaft zu betrachten ist. Nicht, als ob damit das Leben <strong>de</strong>s ein<br />
zelnen im Ganzen unterginge. Im Gegenteil, <strong>de</strong>n Eigenwert<br />
erhält <strong>de</strong>r einzelne gera<strong>de</strong> im Raum <strong>de</strong>s Ganzen, das als sittliche<br />
Gemeinschaft aufgefaßt ist. Von hier aus gesehen kann es sich<br />
nicht mehr um das Schicksal <strong>de</strong>r einzelnen Mutter han<strong>de</strong>ln,<br />
son<strong>de</strong>rn es gilt vielmehr einzig die For<strong>de</strong>rung, das sittliche<br />
Organisationsprinzip <strong>de</strong>r Gesellschaft um je<strong>de</strong>n Preis zu wah<br />
ren. Warum sollte die Mutter, die das Jawort zum Wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
Kin<strong>de</strong>s gegeben hat, nicht auch zu diesem Ja treu stehen müs<br />
sen, wenn es bitter schwer fallen sollte? — Im übrigen sei<br />
erwähnt, daß die medizinische „Notwendigkeit" zu einem sol<br />
chen mör<strong>de</strong>rischen Eingriff gera<strong>de</strong> von besten Fachärzten<br />
bestritten wird. Von <strong>de</strong>m bewußt gewollten Schwangerschafts<br />
abbruch, wie er heute als straffrei proklamiert wird, brauchen<br />
wir hier nicht zu sprechen. Das Urteil darüber im Sinn <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas ist unmißverständlich: man darf unter keinen Umstän<br />
<strong>de</strong>n einen Unschuldigen töten.<br />
Als letzten Teil <strong>de</strong>r Tötung behan<strong>de</strong>lt Thomas in Art. 8 die<br />
fahrlässige Tötung. Es wird hier das allgemein gültige Prinzip<br />
angewandt, daß ein Effekt insofern auf das sittliche Konto einer<br />
Handlung fällt, als die Ursächlichkeit zwischen Handlung <strong>und</strong><br />
Effekt erkannt wer<strong>de</strong>n mußte <strong>und</strong> die Handlung um dieses Zu<br />
sammenhangs willen zu unterlassen geboten war.<br />
IL Die an<strong>de</strong>rn Eingriffe in das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Person,<br />
wie Körperverletzung, Züchtigung, Freiheitsberaubung<br />
(Fr. 65)<br />
1. DIE KÖRPERVERSTÜMMELUNG<br />
(Art. 1).<br />
65. l Die strenge Unterordnung <strong>de</strong>s einzelnen unter das Gemein<br />
wohl wird mit <strong>de</strong>mselben Prinzip gekennzeichnet wie in 58,5:<br />
Der Mensch ist Teil <strong>de</strong>r Gemeinschaft. Hier ist die Sprechweise<br />
<strong>de</strong>s hl. Thomas noch <strong>de</strong>utlicher <strong>und</strong> konkreter: Der ganze<br />
Mensch ist auf sein Ziel hingeordnet, auf die Gemeinschaft,<br />
<strong>de</strong>ren Teil er ist <strong>und</strong> <strong>de</strong>r er in je<strong>de</strong>m ihrer Glie<strong>de</strong>r dient. Wie<br />
346
darum vom sittlich <strong>und</strong> geistig verstan<strong>de</strong>nen Gemeinwohl her 65. 1<br />
über einen Verbrecher die To<strong>de</strong>sstrafe verhängt wer<strong>de</strong>n kann, so<br />
kann auch wegen geringerer Vergehen von <strong>de</strong>r öffentlichen Au<br />
torität die Abnahme irgen<strong>de</strong>ines Glie<strong>de</strong>s verordnet wer<strong>de</strong>n. Die<br />
diesbezügliche Praxis <strong>de</strong>s Mittelalters ist reichlich bekannt: Ver<br />
stümmelung <strong>de</strong>r Ohren, <strong>de</strong>r Hän<strong>de</strong>, <strong>de</strong>rTestikel, <strong>de</strong>r Füße war<br />
im 13. Jahrh<strong>und</strong>ert nichts Beson<strong>de</strong>res. 1260 mußte Ludwig <strong>de</strong>r<br />
Heilige die im Bezirk von 7cws herrschen<strong>de</strong> Sitte ta<strong>de</strong>ln,<br />
wonach <strong>de</strong>r Herr <strong>de</strong>m Diener o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Magd ein Glied abschlug<br />
wegen Stehlens eines Brotes o<strong>de</strong>r eines Huhnes.<br />
Die zwangsweise Sterilisation o<strong>de</strong>r Kastration zur Bestra<br />
fung von sexuellen Verbrechen wird also von Thomas aner<br />
kannt. Dabei sind aber die bei<strong>de</strong>n Bedingungen vorausgesetzt:<br />
1. es muß ein Verbrechen vorliegen; 2. nur die staatliche Autori<br />
tät kann eine solche Strafe anordnen. Die Lösung <strong>de</strong>s ersten<br />
Einwan<strong>de</strong>s ist also ganz in diesem Sinne zu verstehen. Wenn<br />
Thomas dort sagt, daß die Körperverstümmelung zwar gegen<br />
die Natur <strong>de</strong>s einzelnen sei, daß sie aber doch <strong>de</strong>r Vernunft ent<br />
spreche, sofern sie auf das Gemeinwohl hingeordnet wer<strong>de</strong>,<br />
dann hat dies nichts mit kollektivistischen Zweckbestimmun<br />
gen zu tun, etwa im Sinn <strong>de</strong>r eugenischen Indikation <strong>de</strong>r Sterili<br />
sation. Der Staat kann nicht tun, was er mag. Er kann nur an<br />
ordnen, was <strong>de</strong>m Gemeinwohl entspricht. Das Gemeinwohl ist<br />
aber bei Thomas, das dürfte bisher klargewor<strong>de</strong>n sein, eine gei<br />
stig-sittliche Wirklichkeit, die von allen angestrebt wer<strong>de</strong>n soll<br />
entsprechend <strong>de</strong>n Normen <strong>de</strong>r menschlichen Natur. So wenig<br />
Thomas um irgen<strong>de</strong>ines Gemeinwohls willen die Tötung soge-<br />
nannten lebensunwerten Lebens zuläßt, ebensowenig konnte<br />
er die Sterilisierung nur zur körperlichen Ges<strong>und</strong>erhaltung <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Gemeinschaft gestatten.<br />
Eine Privatperson kann nur aus therapeutischen Grün<strong>de</strong>n<br />
eine Verstümmelung an ihrem Körper vornehmen lassen. Dies<br />
geht klar aus <strong>de</strong>r Antwort <strong>und</strong> aus <strong>de</strong>r Lösung <strong>de</strong>s zweiten Ein-<br />
wands hervor.<br />
„Geistigen" Übeln, so erklärt Thomas in <strong>de</strong>r Lösung zum<br />
dritten Einwand, darf man nicht mit Körperverstümmelung<br />
entgehen, man muß sie mit geistigen Mitteln, d. h. mit <strong>de</strong>m Wil<br />
len überwin<strong>de</strong>n. Thomas <strong>de</strong>nkt an überstarke Libido. Zur<br />
Bekämpfung <strong>de</strong>r Libido verwirft er die Kastration <strong>und</strong> emp<br />
fiehlt Willensbildung. Wir sind allerdings heute medizinisch<br />
etwas weiter, in<strong>de</strong>m wir in einer überstarken Libido oft genug<br />
347
65. 1 rein somatisch bedingte Ursachen ent<strong>de</strong>cken, über die <strong>de</strong>r<br />
Patient niemals Herr wer<strong>de</strong>n kann (vgl. hierzu/. Mayer, Gesetz<br />
liche Unfruchtbarmachung Geisteskranker, Freiburg i. Br. 1927,<br />
328 f.).<br />
2. DIE PRÜGELSTRAFE<br />
(Art. 2)<br />
65. 2 In <strong>de</strong>m Maße, als einer über einen an<strong>de</strong>rn rechtliche Gewalt<br />
hat, übt er auch die Strafgewalt über ihn aus. Wie darum <strong>de</strong>r<br />
Staat die vollkommene Gemeinschaft ist, auf die <strong>de</strong>r einzelne<br />
alle Akte sämtlicher sittlichen Tugen<strong>de</strong>n ausrichten muß (58,5),<br />
so übt er auch die höchste <strong>und</strong> letztmögliche Strafgewalt im<br />
irdischen Bereich aus: To<strong>de</strong>sstrafe <strong>und</strong> Strafe <strong>de</strong>r Körperver<br />
stümmelung. Entsprechend besitzt das Familienoberhaupt als<br />
Autorität einer kleineren, „unvollkommenen" Gemeinschaft<br />
das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Bestrafung mit geringeren Straf mittein, nämlich<br />
<strong>de</strong>r Körperzüchtigung (Zu 2). Das gleiche gilt auch bezüglich<br />
<strong>de</strong>r Gewalt <strong>de</strong>s Hausherrn über seine Dienerschaft (Antw.)<br />
Man muß sich die mittelalterliche Anschauung vergegenwär<br />
tigen, wonach <strong>de</strong>m Vater die volle Autorität über die Angelegen<br />
heiten zustand, die die Hausgemeinschaft betrafen. Das Mittel<br />
alter folgte hierin <strong>de</strong>m römischen <strong>Recht</strong>, das übrigens vor <strong>de</strong>r<br />
Mil<strong>de</strong>rung im dritten Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>de</strong>m Familienoberhaupt so<br />
gar das <strong>Recht</strong> über Leben <strong>und</strong> Tod eingeräumt hatte. Im Mittel<br />
alter, zur Zeit <strong>de</strong>s hl. Thomas, war jener Familienvater rechtlich<br />
nicht zu fassen, welcher seine Familienangehörigen, sogar seine<br />
eigene Frau, schlug <strong>und</strong> verw<strong>und</strong>ete, sofern er sie nicht tötete.<br />
Thomas (Suppl. 62,4 Zu 4) erklärt, daß <strong>de</strong>r Ehegatte, wenn<br />
gleich er das Haupt <strong>de</strong>r Ehefrau sei, doch nicht zu ihrem Richter<br />
bestellt sei, so daß er zu jenen Züchtigungen kein <strong>Recht</strong> habe,<br />
welche <strong>de</strong>m Zivilgericht vorbehalten sind. Dagegen kann seiner<br />
Ansicht nach <strong>de</strong>r Ehegatte seine ehebrecherische Frau züchti<br />
gen (Suppl. 60,1 Zu 1).<br />
Angesichts dieser Äußerungen drängt sich die Frage auf, wo<br />
man hier noch von Naturrecht sprechen könne. Das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s<br />
Mannes, die Frau wegen irgendwelcher häuslicher Vergehen zu<br />
schlagen, kann doch nicht ein Naturrecht sein im Sinne, wie<br />
man von „unwan<strong>de</strong>lbaren" <strong>Recht</strong>en <strong>de</strong>r Natur spricht. Man<br />
kann aber mit Thomas sagen, daß jeweils jene rechtliche Rege-<br />
348
lung die naturrechtlich gebotene sei, welche die stets sich 65. 2<br />
än<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n konkreten Situationen (hierzu auch Kulturauffas<br />
sungen, soziologische Gegebenheiten) weitmöglichst <strong>de</strong>n un<br />
abän<strong>de</strong>rlichen Normen entsprechend ordnet. Das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s<br />
Vaters, Haupt <strong>de</strong>r Familie <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Hausgemeinschaft zu sein,<br />
kann auch auf an<strong>de</strong>re Weise als mit <strong>de</strong>r Prügelgewalt gewahrt<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Geschichte hat die Menschen belehrt, daß <strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>re Teil <strong>de</strong>s Ehe- <strong>und</strong> Familienrechts, wovon Thomas in 57,4<br />
spricht, beson<strong>de</strong>rer Aufmerksamkeit bedarf: daß sowohl die<br />
Kin<strong>de</strong>r als auch beson<strong>de</strong>rs die Ehefrau als Träger von Men<br />
schenrechten zu gelten haben, über die <strong>de</strong>r Vater <strong>und</strong> Gatte<br />
keine Befugnis hat. Für Thomas ist die naturgemäße For<strong>de</strong>rung,<br />
d. h. das Naturrecht, eine For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s konkreten Augen<br />
blicks, nicht zwar im Sinne einer reinen Situationsethik mit exi-<br />
stentialistischem Gepräge, son<strong>de</strong>rn im Sinne <strong>de</strong>r „verän<strong>de</strong>rli<br />
chen Natur", von <strong>de</strong>r er in 57,2 Zu 1 spricht, d. h. <strong>de</strong>r an sich un<br />
verän<strong>de</strong>rlichen Natur, die aber stets eine eigene, <strong>de</strong>m Hier <strong>und</strong><br />
Jetzt angemessene je <strong>und</strong> je verschie<strong>de</strong>ne konkrete Gestalt <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>s nicht nur verlangt, son<strong>de</strong>rn sogar konstituiert.<br />
3. KERKERHAFT UND GEWAHRSAM<br />
(Art. 3)<br />
Aus gerechten Grün<strong>de</strong>n ist es, wie Thomas ausführt, erlaubt, 65. 3<br />
einen Menschen <strong>de</strong>r Freiheit zu berauben durch Kerker o<strong>de</strong>r<br />
Gewahrsam (Internierung). Als solche gerechte Grün<strong>de</strong> führt<br />
Thomas an: Strafe <strong>und</strong> Vorsichtsmaßregeln. Bezüglich <strong>de</strong>r<br />
Strafe empfin<strong>de</strong>t man weiter keine Schwierigkeit in <strong>de</strong>r Aner<br />
kennung <strong>de</strong>r vorgetragenen Meinung. Was aber ist unter Vor<br />
sichtsmaßregel zu verstehen? Etwa das im römischen „Gesetz<br />
<strong>de</strong>r zwölf Tafeln" <strong>de</strong>m Gläubiger eingeräumte <strong>Recht</strong>, einen<br />
säumigen Schuldner in privatem Kerker einzusperren, eine<br />
Gepflogenheit, die im Mittelalter in Übung war <strong>und</strong> zu üblen<br />
Ausschreitungen führte, so daß Ludwig <strong>de</strong>r Heilige sie auf ganz<br />
bestimmte Fälle unter bestimmten Bedingungen einschränken<br />
mußte? O<strong>de</strong>r sollen wir an ähnliche Vorsichtsmaßregeln <strong>de</strong>n<br />
ken, wie sie ein mo<strong>de</strong>rner Staat durch Internierung von Geistes<br />
schwachen trifft, nur zur Verhütung geistesschwachen Nach<br />
wuchses? Aus <strong>de</strong>r Lösung zum dritten Einwand geht hervor,<br />
daß die Übel, welche durch staatlich verordnete Internierung<br />
349
65. 3 von Personen verhin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n sollen, sittlich verwerfliche<br />
Taten sind, z.B., daß einer, obwohl er könnte, die Schul<strong>de</strong>n<br />
nicht bezahlt. Wenigstens folgt dies aus <strong>de</strong>n letzten Worten:<br />
„durch die Einkerkerung wird er nicht nur daran gehin<strong>de</strong>rt,<br />
Böses, son<strong>de</strong>rn auch Gutes zu tun."<br />
Ob aber Geistesschwache, die an sich keine Gefahr für die<br />
Umwelt sind, einzig um <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Gesellschaft verlangten<br />
Gewähr willen, daß sie keine erblich belastete Nachkommen<br />
schaft zeugen, interniert wer<strong>de</strong>n dürfen, kann nach <strong>de</strong>r hier aus<br />
gesprochenen Doktrin nicht entschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Es läßt sich<br />
hier keine Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas ermitteln.<br />
4. DAS UNRECHT IN SEINER AUSDEHNUNG AUF EINEN WEITEREN<br />
PERSONENKREIS<br />
(Art. 4)<br />
65. 4 Der vierte Artikel behan<strong>de</strong>lt die eigentümliche Frage, ob das<br />
Unrecht, das auf die in <strong>de</strong>n vorhergehen<strong>de</strong>n Artikeln genannten<br />
Arten, beson<strong>de</strong>rs durch Körperverletzung, einer Person zuge<br />
fügt wird, auch auf <strong>de</strong>ren Angehörige o<strong>de</strong>r die irgendwie mit ihr<br />
durch ein gesellschaftliches Band Verb<strong>und</strong>enen übergreife, so<br />
daß die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit noch größer wür<strong>de</strong>, als<br />
wenn sie nur gegen eine einzelne Person gerichtet wäre. An sich<br />
betrifft diese Frage jegliches Unrecht, nicht nur die in <strong>de</strong>n vor<br />
hergehen<strong>de</strong>n Artikeln erwähnten Formen. Thomas hat<br />
zunächst offenbar an <strong>de</strong>n tätlichen Angriff auf Amtspersonen<br />
gedacht <strong>und</strong> darum das Problem hier eingereiht.<br />
Die Antwort ist klar: an sich ist solches Unrecht größer<br />
wegen <strong>de</strong>r Ausweitung <strong>de</strong>s betroffenen Personenkreises. An<strong>de</strong><br />
rerseits kann aber, so meint Thomas, das Unrecht gegen eine<br />
einzelne Person ohne diese Einbeziehung Dritter <strong>de</strong>nnoch<br />
schwerer sein im Hinblick auf die gesellschaftliche Be<strong>de</strong>utung<br />
<strong>de</strong>r betroffenen Person o<strong>de</strong>r auf die Erheblichkeit <strong>de</strong>s zugefüg<br />
ten Scha<strong>de</strong>ns.<br />
Warum aber ist das Unrecht gegen Witwen <strong>und</strong> Waisen, die<br />
allein stehen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Verb<strong>und</strong>enheit entbeh<br />
ren, gemäß christlicher Auffassung eines <strong>de</strong>r schwersten Ver<br />
brechen? Thomas antwortet darauf (Zu 2), daß diese Sün<strong>de</strong> ein-<br />
schlußweise eine höhere Tugend als die <strong>Gerechtigkeit</strong> verletze,<br />
nämlich die Barmherzigkeit, <strong>und</strong> daß außer<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r zugefügte<br />
Scha<strong>de</strong>n durch die Hilflosigkeit <strong>de</strong>r Verletzten noch wachse.<br />
350
III. Diebstahl <strong>und</strong> Raub<br />
(Fr. 66)<br />
A. DAS EIGENTUMSRECHT<br />
(Art. 1 u. 2)<br />
1. DER STREIT UM DIE AUSLEGUNG DER THOMASISCHEN TEXTE<br />
Nur wenige Artikel <strong>de</strong>s hl. Thomas sind von <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong><br />
nen Kommentatoren so erhitzt umkämpft wor<strong>de</strong>n wie die bei<br />
<strong>de</strong>n ersten Artikel unserer Frage. Der erste stellt das Besitz- <strong>und</strong><br />
Eigentumsrecht Gottes <strong>de</strong>m <strong>de</strong>s Menschen gegenüber, wobei<br />
Thomas <strong>de</strong>n Ausdruck „Eigentum" mit „Besitz" o<strong>de</strong>r<br />
„Herrschaft" vertauscht (vgl. Anm. [34]). In <strong>de</strong>r ihm eigenen<br />
ontologischen Sicht betrachtet Thomas zunächst <strong>de</strong>n Sachver<br />
halt <strong>de</strong>s Seins, d. h. die Uber-<strong>und</strong> Unterordnung auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
seinsmäßigen Vollkommenheit <strong>und</strong> Ausrüstung. Gott, <strong>de</strong>r alle<br />
Dinge schaffen <strong>und</strong> in ihrer Substanz verän<strong>de</strong>rn kann, beweist<br />
damit eine absolute Herrschergewalt über jegliches Sein. Er ist<br />
also Eigentümer aller Dinge im vollen<strong>de</strong>tsten Maß. Der Mensch<br />
besitzt solche Machtausrüstung nicht. Man kann daher auch<br />
nicht sagen, daß er die Substanz besäße. Natürlich drängt sich<br />
hier sogleich die Frage auf, ob damit auch gesagt sei, daß <strong>de</strong>r<br />
Mensch die Substanz überhaupt niemals besitze, etwa im Sinne<br />
<strong>de</strong>s Agrarsozialismus, wonach je<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Kultivierung <strong>de</strong>s<br />
Bo<strong>de</strong>ns nur <strong>de</strong>n unmittelbaren Ertrag seiner Arbeit ziehen, nie<br />
mals aber <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n als eigen betrachten kann.<br />
Wenngleich die äußeren Dinge <strong>de</strong>m Menschen nicht in <strong>de</strong>r<br />
Weise unterstellt sind wie Gott, so haben sie ihm doch zu die<br />
nen, <strong>de</strong>nn „das Unvollkommenere ist immer um <strong>de</strong>s Vollkom<br />
meneren willen". Der Mensch überragt die übrige sichtbare<br />
Schöpfung durch seine Vernunft, aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>ren er Ebenbild<br />
Gottes ist. Er kann darum die Naturdinge in seinen Dienst neh<br />
men, soweit er überhaupt an ihnen seine vernunftgemäße<br />
Überlegenheit beweisen kann. Wie aber sieht dieser Dienst <strong>de</strong>r<br />
Dinge aus? Thomas sagt schlicht: Auf Gr<strong>und</strong> seiner Vernunft<br />
<strong>und</strong> seines Willens kann <strong>de</strong>r Mensch die äußeren Dinge „ge<br />
brauchen". Damit also beweist er seine naturgemäße Herr<br />
schaft über sie. In diesem Sinne also ist er ihr Eigentümer.<br />
Soweit <strong>de</strong>r erste Artikel.<br />
351
Horväth drückt sich an einer Stelle seines Buches „Eigentumsrecht<br />
nach <strong>de</strong>m hl. Thomas von Aquin" (Graz 1929,56) so<br />
aus, als sehe er im ersten Artikel nicht mehr als das N<strong>utz</strong>recht.<br />
Vom Eigentum im Sinne <strong>de</strong>s Privateigentums sei dann erst im<br />
zweiten Artikel die Re<strong>de</strong>, wo Thomas frage, ob <strong>de</strong>r Mensch die<br />
äußeren Güter auch als Eigentum besitzen dürfe <strong>und</strong> in welcher<br />
Form, als Kollektiv- o<strong>de</strong>r Privateigentum. An<strong>de</strong>rerseits scheint<br />
dann Horväth <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r N<strong>utz</strong>ung, wie er im ersten Artikel<br />
steht, doch wie<strong>de</strong>r nicht in diesem engen Sinn zu verstehen, als<br />
N<strong>utz</strong>ung, die gegen <strong>de</strong>n Besitz streng abgetrennt ist. Sofern er<br />
wirklich unter N<strong>utz</strong>ung ein In-Dienst-Nehmen, soweit es überhaupt<br />
menschenmöglich ist, verstehen wollte, wür<strong>de</strong> er sich <strong>de</strong>r<br />
dritten, noch zu erwähnen<strong>de</strong>n Meinung nähern. Auf je<strong>de</strong>n Fall<br />
entbehren seine Darlegungen <strong>de</strong>r nötigen Präzision.<br />
Der überwiegen<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>r Erklärer sieht im ersten Artikel<br />
bereits das <strong>Recht</strong> auf Eigentum im Sinne <strong>de</strong>s Naturrechts ausgesprochen,<br />
also im Sinn <strong>de</strong>r Frage: Ist Besitz, nicht nur<br />
Gebrauch, von äußeren Gütern für <strong>de</strong>n Menschen naturgemäß?<br />
Und zwar wäre damit zugleich auch das gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>Recht</strong><br />
auf Privateigentum mitverstan<strong>de</strong>n (nicht nur etwa die von Horväth<br />
erwähnte „Eigentums/ä'^'g&eir", son<strong>de</strong>rn das Eigentumsrecht),<br />
<strong>und</strong> zwar im Sinn <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnen Individualrechts, so<br />
daß im zweiten Artikel nur noch die soziale Angemessenheit im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Gemeinwohls besprochen wür<strong>de</strong>. Es ist dies die<br />
Erklärung, die durchweg von <strong>de</strong>n Autoren gehalten wird,<br />
welche die leoninische Eigentumsauffassung unmittelbar bei<br />
Thomas beheimatet glauben.<br />
Es besteht aber noch die Möglichkeit einer dritten Erklärung,<br />
die besagt, daß Thomas im ersten Artikel überhaupt noch nicht<br />
an <strong>de</strong>n individuellen Menschen <strong>de</strong>nke, son<strong>de</strong>rn an <strong>de</strong>n Menschen<br />
als solchen, an die persona <strong>und</strong> natura humana im allgemeinen,<br />
in welcher <strong>de</strong>r individuelle Mensch nur potentiell ausgesprochen<br />
ist, <strong>und</strong> dann meine, daß in dieser Sicht <strong>de</strong>r Mensch<br />
die Güter ben<strong>utz</strong>en <strong>und</strong> in Dienst nehmen könne, soweit es<br />
überhaupt möglich sei, wobei „Können" zugleich ethisch zu<br />
verstehen ist (nicht rechtlich im Sinn <strong>de</strong>r Abgrenzung von<br />
Mensch zu Mensch). Es kann also nach dieser Erklärung im<br />
Gegensatz zur zweiten, noch keine Re<strong>de</strong> sein von einem<br />
„Naturrecht" auf Privateigentum. Dieses ist zwar gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nicht ausgeschlossen. Um aber dazu zu gelangen, bedarf es<br />
noch eines langen Weges rechtslogischer Überlegungen, inner-<br />
352
halb <strong>de</strong>ren die soziologische Struktur <strong>de</strong>r Menschheit im Ge<br />
samten <strong>und</strong> <strong>de</strong>r jeweiligen Wirtschaft eine entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle<br />
spielt.<br />
Diese dritte Erklärungsweise <strong>de</strong>s ersten Artikels wird sich<br />
aus geschichtlich zwingen<strong>de</strong>n Grün<strong>de</strong>n als die einzig haltbare<br />
erweisen. Wie wenig Thomas die private Aufteilung <strong>de</strong>r äuße<br />
ren Güter als naturrechtlich gegeben betrachtet, beweist die<br />
Antwort auf <strong>de</strong>n ersten Einwand im zweiten Artikel, wo er un<br />
verhohlen sagt, es gebe aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Naturrechts keine Unter<br />
scheidung <strong>de</strong>s Besitzes, son<strong>de</strong>rn mehr aufgr<strong>und</strong> menschlicher<br />
Verfügung, <strong>und</strong> das gehöre in <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>s gesatzten <strong>Recht</strong>s.<br />
Die drei Grün<strong>de</strong>, welche Thomas im zweiten Artikel für die<br />
Notwendigkeit <strong>de</strong>r privaten Eigentumsordnung anführt, stam<br />
men sämtlich nicht aus <strong>de</strong>m Bereich, <strong>de</strong>n man heute allgemein<br />
als naturrechtlich bezeichnet. Er sagt hierbei, daß die Verfügung<br />
<strong>und</strong> die Verwaltung besser <strong>und</strong> n<strong>utz</strong>bringen<strong>de</strong>r in privaten<br />
Hän<strong>de</strong>n sei, weil so 1. <strong>de</strong>r Fleiß <strong>de</strong>r Menschen mehr angefacht<br />
wer<strong>de</strong>, als wenn alles gemeinsam sei; 2. die Güter besser behan<br />
<strong>de</strong>lt wür<strong>de</strong>n, wenn ein je<strong>de</strong>r für sich selbst zu sorgen habe;<br />
3. <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Gesellschaft sicherer gewährleistet sei.<br />
Was ist mit diesen Grün<strong>de</strong>n gemeint? Etwa die in <strong>de</strong>r christ<br />
lichen Tradition übliche Formel, daß das Privateigentum<br />
irgendwie eine Sün<strong>de</strong> sei?<br />
L. <strong>de</strong> Sousberghe 1 bringt eine geistreiche Erklärung, die in<br />
manchen Punkten die Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas trifft, aber doch<br />
nicht ganz auf <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong> stößt. Er meint, daß Thomas sowohl<br />
die Gemeinschaft wie die Aufteilung <strong>de</strong>r Güter naturrechtlich<br />
nenne. Die Aufteilung <strong>de</strong>r Güter sei <strong>de</strong>r unabdingbare Weg, um<br />
die von <strong>de</strong>r Natur als i<strong>de</strong>al angestrebte Gemeinn<strong>utz</strong>ung zu ver<br />
wirklichen. Richtig ist, daß die Aufteilung <strong>de</strong>r Güter nach Tho<br />
mas (vgl. weiter unten) nicht irgen<strong>de</strong>inem egoistischen Inter<br />
esse einzelner Besitzer dienen soll, son<strong>de</strong>rn ein soziales Prinzip<br />
ist, um die Gemeinschaft zu stabilisieren. Eine an<strong>de</strong>re Frage<br />
aber ist, ob es Thomas jemals eingefallen wäre, ohne Unter<br />
scheidung zu erklären, sowohl Gemeinsamkeit als auch Auftei<br />
lung <strong>de</strong>r Güter seien naturrechtlicher Art. Was Sousberghe aus<br />
Thomas herausliest, ist ohne Zweifel eine aus allgemein thoma<br />
sischen Prinzipien richtige Folgerung. Es braucht aber dazu<br />
Propriete „<strong>de</strong> Droit naturel". These neo-scolastique et tradition scolastique.<br />
in: Nouvelle Revue Theologique 72 (1950) 580-607.<br />
353
einer gründlichen Entwicklung <strong>de</strong>r Gedanken. Thomas selbst<br />
hätte sich nicht in dieser Weise ausgedrückt. Seinem Denken<br />
entsprach, wie wir noch sehen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Ansatz beim<br />
Gemeinschaftlichen, nicht beim Privaten. Er mußte also das<br />
Private auf einer an<strong>de</strong>rn Ebene erkennen, d. h. er konnte nicht<br />
im gleichen Sinne <strong>und</strong> auf gleicher Abstraktionsebene das<br />
Gemeinschaftliche <strong>und</strong> das Private als „naturrechtlich" bezeich<br />
nen.<br />
Wir sind heute gewohnt, das Privateigentum als eine natur<br />
rechtliche Institution zu bezeichenen. Dabei sind wir uns aber<br />
nicht ganz im klaren, in welcher Weise wir eigentlich von einem<br />
Naturrecht auf Privateigentum sprechen. Diese schon im<br />
mo<strong>de</strong>rnen Sprachgebrauch unklare Ausdrucksweise übertra<br />
gen wir nun noch auf das Mittelalter <strong>und</strong> glauben, <strong>de</strong>r hl. Tho<br />
mas habe dieselbe Lehre vorgetragen wie wir heute.<br />
Um Thomas <strong>und</strong> auch uns selbst zu verstehen, sind zwei<br />
Dinge vorausgesetzt: 1. daß wir unsere mo<strong>de</strong>rne Terminologie<br />
abklären <strong>und</strong> ihre Assoziationen bewußt begreifen; 2. daß wir<br />
die thomasischen Begriffe <strong>und</strong> Denkweisen im Zusammenhang<br />
mit <strong>de</strong>r gesamten christlichen Tradition studieren, <strong>de</strong>nn allein<br />
von dort aus sind sie zu verstehen. Wir wer<strong>de</strong>n uns bei diesen<br />
geschichtlichen Untersuchungen stets bewußt wer<strong>de</strong>n müssen,<br />
wie verschie<strong>de</strong>n die Schauweise <strong>de</strong>r Alten gegenüber unser ist.<br />
2. DAS EIGENTUM ALS NATURRECHT IN DER MODERNEN SCHAUWEISE<br />
Leo XIII. besteht auf <strong>de</strong>r unzwei<strong>de</strong>utigen Formulierung, daß<br />
<strong>de</strong>r Mensch das <strong>Recht</strong> zum Besitz privaten Eigentums von <strong>de</strong>r<br />
Natur erhalten habe. Die dafür angeführten Grün<strong>de</strong> sind<br />
geschichtlich, wie wir sehen wer<strong>de</strong>n, überaus aufschlußreich.<br />
Der Papst führt zunächst drei Grün<strong>de</strong> an: a) die Vernunftnatur<br />
<strong>de</strong>s Menschen, b) die Freiheit <strong>de</strong>s Menschen, c) die Arbeits<br />
pflicht.<br />
a) Es möchte vielleicht scheinen, daß die bei<strong>de</strong>n ersten Be<br />
gründungen ungefähr auf das hinauskämen, was Thomas im<br />
ersten Artikel darstellt, wenn er sagt, daß <strong>de</strong>r Mensch „mit Ver<br />
nunft <strong>und</strong> freiem Willen" die Dinge dieser Welt gebrauche. Der<br />
Zusammenhang, d. h. die gedankliche Assoziation, ist jedoch<br />
ein an<strong>de</strong>rer. Während Thomas im ersten Artikel <strong>de</strong>n Menschen<br />
überhaupt im Auge hat, wie er im Unterschied zu Gott <strong>de</strong>n<br />
äußeren Dingen gegenübersteht, will Leo XIII. hier aus <strong>de</strong>r<br />
354
Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Menschen, wie sie je<strong>de</strong>m Menschen im einzelnen (!)<br />
zukommt, das <strong>Recht</strong> nachweisen, daß <strong>de</strong>r Mensch, besser<br />
gesagt: je<strong>de</strong>r Einzelmensch, die Dinge nicht nur wie die Tiere<br />
gebraucht, son<strong>de</strong>rn besitzt <strong>und</strong> für sich beansprucht. Wir fin<strong>de</strong>n<br />
hier in einem kirchlichen Dokument bereits einen Nie<strong>de</strong>rschlag<br />
<strong>de</strong>r Menschenrechtsi<strong>de</strong>e, wie sie von <strong>de</strong>n englischen Philoso<br />
phen entwickelt wor<strong>de</strong>n ist, <strong>und</strong> zwar einen Nie<strong>de</strong>rschlag im<br />
guten Sinne, im Sinne <strong>de</strong>r Konkretisierung <strong>de</strong>r abstrakten Frei<br />
heitsrechte <strong>de</strong>s Mittelalters. Ohne das, was später zu behan<strong>de</strong>ln<br />
ist, vorwegzunehmen, sei doch schon gesagt, daß es Thomas<br />
niemals eingefallen wäre, auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Menschenwür<strong>de</strong> ein<br />
Freiheitsrecht für <strong>de</strong>n einzelnen zu behaupten, etwa mit <strong>de</strong>r<br />
Erklärung, zuerst habe ein je<strong>de</strong>r einzelne seine naturrechtliche<br />
Freiheit <strong>und</strong> erst, sofern die Ordnung <strong>de</strong>r Gesellschaft gestört<br />
wer<strong>de</strong>, sei an einen Eingriff vom Kollektiv her zu <strong>de</strong>nken im<br />
Sinne <strong>de</strong>s Subsidiaritätsprinzips. Das Subsidiaritätsprinzip, von<br />
Pius XL im Anschluß an Leo XIII. erarbeitet, wur<strong>de</strong> erst dann<br />
zum notwendigen <strong>und</strong> „naturrechtlichen" Formprinzip <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft, nach<strong>de</strong>m man die abstrakte Philosophie vom<br />
Menschen in <strong>de</strong>n konkreten <strong>und</strong> kontingenten Bereich <strong>de</strong>r exi<br />
stentiellen Ordnung herabgeholt hatte, nach<strong>de</strong>m man gelernt<br />
hatte, mit <strong>de</strong>m, was Thomas eigentlich schon ausgesprochen,<br />
aber in <strong>de</strong>r Gesellschaftslehre noch nicht durchgeführt hatte,<br />
Ernst zu machen, nämlich das Naturrecht als eine For<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r hier <strong>und</strong> jetzt leben<strong>de</strong>n menschlichen Natur—<strong>und</strong> nicht nur<br />
Natur, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s hier <strong>und</strong> jetzt leben<strong>de</strong>n konkreten Men<br />
schen — zu betrachten. Damit kommen wir von selbst in <strong>de</strong>n<br />
Bereich <strong>de</strong>s Individuums, zum Aufbau <strong>de</strong>r gesellschaftlichen<br />
<strong>und</strong> auch wirtschaftlichen Ordnung vom Privaten her. Aller<br />
dings achte man auf die Akzentverschiebung: Dieses Natur<br />
recht bewegt sich nicht mehr auf jener Ebene <strong>de</strong>r Abstraktion<br />
<strong>und</strong> Allgemeinheit, welche <strong>de</strong>r erste Artikel <strong>de</strong>s hl. Thomas ein<br />
hält. Diese Entwicklung, die durchaus sachlich richtig ist, stand<br />
unmerklich unter <strong>de</strong>m Einfluß <strong>de</strong>r Liberalisten, die <strong>de</strong>r ameri<br />
kanischen Verfassung ihren Begriff <strong>de</strong>r Menschenwür<strong>de</strong> gege<br />
ben haben. Die katholische Doktrin hat durch <strong>de</strong>n Einbau <strong>de</strong>r<br />
sozialen For<strong>de</strong>rungen, beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r sozialen Belastung <strong>de</strong>s<br />
Eigentums, die dann Pius XL stärker hervorhob, die Irrtümer<br />
<strong>de</strong>s liberalen Denkens vermie<strong>de</strong>n <strong>und</strong> überw<strong>und</strong>en.<br />
b) Das zweite Argument, das Leo XIII. zugunsten <strong>de</strong>r natur<br />
rechtlichen Begründung <strong>de</strong>s Privateigentums anführt, beweist<br />
355
66. 1/2 noch <strong>de</strong>utlicher, wie sehr sich die Anschauungen über <strong>de</strong>n Men<br />
schen in <strong>de</strong>r Gemeinschaft entwickelt haben. Der Mensch wird<br />
als frei bezeichnet. Dabei ist zu beachten, es han<strong>de</strong>lt sich um<br />
je<strong>de</strong>n Menschen, nicht nur um <strong>de</strong>n Menschen an sich Gott ge<br />
genüber, son<strong>de</strong>rn um <strong>de</strong>n Menschen unter Menschen. In diesem<br />
Sinne versteht Leo XIII. seine Worte: „Da <strong>de</strong>r Mensch mit sei<br />
nem Denken unzählige Gegenstän<strong>de</strong> umfaßt, mit <strong>de</strong>n gegen<br />
wärtigen die zukünftigen verbin<strong>de</strong>t <strong>und</strong> Herr seiner Handlun<br />
gen ist, so bestimmt er unter <strong>de</strong>m ewigen Gesetz <strong>und</strong> unter <strong>de</strong>r<br />
allweisen Vorsehung Gottes sich selbst nach freiem Ermessen.<br />
Es liegt darum in seiner Macht, unter <strong>de</strong>n Dingen die Wahl zu<br />
treffen, die er zu seinem eigenen Wohl nicht allein für die<br />
Gegenwart, son<strong>de</strong>rn auch für die Zukunft als die ersprießlichste<br />
erachtet. Hieraus folgt: es müssen <strong>Recht</strong>e erworben wer<strong>de</strong>n<br />
können, nicht bloß auf Erzeugnisse, son<strong>de</strong>rn auch auf Eigen<br />
tum am Bo<strong>de</strong>n selbst; <strong>de</strong>nn was <strong>de</strong>m Menschen sichere Aus<br />
sicht auf künftigen Fortbestand seines Unterhalts verleiht, das<br />
ist nur <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>n mit seiner Produktionskraft" (Rerum nova<br />
rum, 6).<br />
Die Frage nach <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> auf Bo<strong>de</strong>nerwerb ist für uns au<br />
genblicklich belanglos. Worauf es ankommt, ist zu zeigen, wie<br />
stark das Eigentumsrecht vom kontingenten Individuum her<br />
aufgefaßt wird. Der Mensch hat, so erklärt Leo XIII., erwor<br />
bene <strong>Recht</strong>e auf bestimmte äußere Dinge, <strong>und</strong> diese erworbe<br />
nen <strong>Recht</strong>e wer<strong>de</strong>n im Sinne von Naturrechten verstan<strong>de</strong>n, weil<br />
aus <strong>de</strong>r Freiheit <strong>de</strong>s Menschen folgend. „Der Mensch ist älter als<br />
<strong>de</strong>r Staat, <strong>und</strong> darum besaß er das <strong>Recht</strong> auf Erhaltung seines<br />
körperlichen Daseins, ehe es einen Staat gegeben hat" (Rerum<br />
novarum, a. a. O.). Es wird hier von Eigenrechten <strong>de</strong>s Individu<br />
ums gegenüber „seinem" Staat gesprochen. Das will heißen: es<br />
geht nicht um <strong>de</strong>n Menschen als solchen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Staat als sol<br />
chen, son<strong>de</strong>rn es geht um <strong>de</strong>n Menschen, <strong>de</strong>r in einem<br />
bestimmten Staate lebt. Denn nur in diesem Sinne gilt, daß <strong>de</strong>r<br />
Mensch vorher da war, „ehe es einen Staat gegeben hat". Es ist<br />
überaus bezeichnend für das mo<strong>de</strong>rne Denken, daß nicht mehr<br />
über die politische Gemeinschaft als solche philosophiert wird,<br />
son<strong>de</strong>rn über <strong>de</strong>n Staat, wie er nun einmal besteht, wie er<br />
gewor<strong>de</strong>n ist <strong>und</strong> wie er auch wie<strong>de</strong>r vergehen kann. Vor diesem<br />
Staat war <strong>de</strong>r Mensch! Und zwar <strong>de</strong>r Mensch mit <strong>Recht</strong>en, die<br />
seinem persönlichen, kontingenten, eben seinem frei gewollten<br />
Schaffen zu verdanken sind.<br />
356
Auch Thomas hat zwar von <strong>Recht</strong>en <strong>de</strong>s Einzelmenschen<br />
gesprochen, die <strong>de</strong>r Staat zu beachten hat. So spricht er vom<br />
<strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s Menschen auf Leben, das vom Staat nicht angetastet<br />
wer<strong>de</strong>n darf, vom <strong>Recht</strong> auf Unversehrtheit <strong>de</strong>s Leibes, auf<br />
Freiheit usw. (vgl. Fr. 64 u. 65). Diese <strong>Recht</strong>e sind also auch<br />
„vor"-staatliche <strong>Recht</strong>e, insofern sie nicht durch das positive<br />
<strong>Recht</strong> gesetzt sind. Und doch han<strong>de</strong>lt es sich dabei nicht um<br />
vorstaatliche <strong>Recht</strong>e in <strong>de</strong>m Sinne, wie die mo<strong>de</strong>rne Formulie<br />
rung von vorstaatlichen <strong>Recht</strong>en spricht. Es sind <strong>Recht</strong>san<br />
sprüche <strong>de</strong>s einzelnen Menschen gegenüber <strong>de</strong>m Staat, an <strong>de</strong>s<br />
sen Entstehung <strong>und</strong> Wer<strong>de</strong>n nicht gedacht wird <strong>und</strong> überhaupt<br />
nicht gedacht wer<strong>de</strong>n kann, weil er bereits in <strong>de</strong>r natura humana<br />
mitgegeben ist.<br />
Und wie <strong>de</strong>r Staat verschie<strong>de</strong>n gesehen ist, so auch das Indi<br />
viduum. In <strong>de</strong>r thomasischen Sicht ist hier unter Individuum<br />
je<strong>de</strong>r Mensch in gleicher Weise zu verstehen, weil ein je<strong>de</strong>r<br />
gleichviel Mensch ist. In <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Sicht ist damit je<strong>de</strong>r Ein<br />
zelmensch differenziert gesehen mit seiner individuellen Lei<br />
stung, mit allen kontingenten Ansprüchen, die irgendwie <strong>de</strong>n<br />
Stempel <strong>de</strong>s Persönlichen tragen (Besitz aus Erbschaft,<br />
Geschenk). All diese <strong>Recht</strong>e sind für uns Mo<strong>de</strong>rne nicht nur<br />
<strong>Recht</strong>e gegenüber <strong>de</strong>m Staat, son<strong>de</strong>rn „Naturrechte", die vor<br />
<strong>de</strong>r Bildung <strong>de</strong>s Staates liegen. Man merkt hier <strong>de</strong>utlich die<br />
Nachwirkungen <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sphilosophie <strong>de</strong>s 18. <strong>und</strong> 19. Jahr<br />
h<strong>und</strong>erts, <strong>de</strong>r die Menschenrechte im wahren Sinne Freiheits<br />
rechte waren, Freiheit von Zwang, vom Eingriff durch staatliche<br />
Herrschaft. Wir stehen also — wenigstens im Ansatz <strong>de</strong>s Den<br />
kens — in einem gewissen Liberalismus <strong>und</strong> Individualismus. Es<br />
gibt nun einmal, wie wir noch sehen wer<strong>de</strong>n, von jenem <strong>Recht</strong><br />
her, das auf <strong>de</strong>r abstrakten natura humana aufruht, für je<strong>de</strong> kon<br />
krete <strong>Recht</strong>sordnung nur die Alternative: entwe<strong>de</strong>r beginnt<br />
man beim Kollektiv <strong>und</strong> sucht von hier aus <strong>de</strong>n Weg zur Wah<br />
rung <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>e eines je<strong>de</strong>n, o<strong>de</strong>r man beginnt beim Indivi<br />
duum <strong>und</strong> achtet weitblickend auf eventuelle Gefährdung <strong>de</strong>r<br />
Gemeinschaft. Aber ein Ordnungsprinzip muß man immer<br />
haben. Weltanschaulich, d. h. philosophisch gibt es nur diese<br />
bei<strong>de</strong>n Möglichkeiten: im Ansatz (!), d. h. vom Strukturprinzip<br />
her ist man entwe<strong>de</strong>r Kollektivist o<strong>de</strong>r Individualist. Damit ist<br />
keineswegs gesagt, daß es dabei bleiben müsse o<strong>de</strong>r dürfe. Es<br />
geht nur um <strong>de</strong>n Ansatz <strong>de</strong>s konkreten Gemeinschafts<strong>de</strong>nkens.<br />
Die Fülle <strong>de</strong>r Gemeinschaftsordnung kann niemals im Kollektiv<br />
357
<strong>und</strong> auch nicht im Individualistischen liegen. Wer die Gemein<br />
schaft als <strong>de</strong>n letzten Sinn menschlichen Zusammenlebens<br />
ansieht (<strong>und</strong> nicht vielmehr das „gute Leben" im Sinne <strong>de</strong>r ethi<br />
schen Vollkommenheit aller), <strong>de</strong>r ist Kollektivist im üblen<br />
Sinne, <strong>und</strong> wer die Freiheit <strong>de</strong>s Individuums nicht nur als Struk<br />
turprinzip, son<strong>de</strong>rn auch als das Gesetz <strong>de</strong>r Erfüllung allen Zu<br />
sammenlebens bezeichnen wür<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r wäre Individualist <strong>und</strong><br />
Liberalist im üblen Sinne. Im Individualismus <strong>und</strong> Liberalis<br />
mus liegt aber etwas, was die katholische Sozialdoktrin ruhig<br />
übernehmen konnte, weil es im Gr<strong>und</strong>e nichts an<strong>de</strong>res war als<br />
die Konsequenz aus großen, im mitteralterlichen Denken noch<br />
nicht entwickelten, aber vorhan<strong>de</strong>nen Sozialprinzipien. Aller<br />
dings liegt auch im Kollektivismus etwas zu Erwägen<strong>de</strong>s, nicht<br />
zwar, daß er Strukturprinzip sei, aber daß er Rahmengebil<strong>de</strong> sei<br />
gegen das Überwuchern <strong>de</strong>s Individuums.<br />
Thomas hat, wie wir noch sehen wer<strong>de</strong>n, das Individualprin-<br />
zip als angemessen <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Stand <strong>de</strong>r Dinge entsprechend<br />
bezeichnet (Art. 2). Er hat aber nicht daran gedacht, daraus eine<br />
Naturrechtsfrage zu machen. Dies lag seiner ethisch-finalen<br />
Betrachtung fern, in welcher <strong>de</strong>r aristotelische Gedanke gilt:<br />
„Der Staat ist <strong>de</strong>r Natur nach früher als die Familie <strong>und</strong> als <strong>de</strong>r<br />
einzelne Mensch, weil das Ganze früher sein muß als <strong>de</strong>r Teil"<br />
(Pol. 1,2). Für Thomas lag kein Gr<strong>und</strong> vor, von dieser ethisch<br />
finalen Sicht abzugehen, weil <strong>de</strong>r Aufbau, also das aktuelle<br />
Gestalten von Gesellschaft <strong>und</strong> Staat, nicht zur Debatte stand.<br />
Die Gesellschaft bestand bereits in fester Ordnung, <strong>de</strong>r Staat<br />
war eine Gegebenheit. Die Ordnung, die da war, wur<strong>de</strong> nicht in<br />
Frage gestellt. Wir wer<strong>de</strong>n dies wie<strong>de</strong>rum bei <strong>de</strong>r thomasischen<br />
Auffassung von <strong>de</strong>r Preisbildung sehen. Es ging also <strong>de</strong>r prakti<br />
schen Moral nur darum, die Menschen, die nun einmal in <strong>de</strong>m<br />
bestehen<strong>de</strong>n Staatsgebil<strong>de</strong> lebten, zu unterrichten, damit sie ihr<br />
Benehmen entsprechend <strong>de</strong>r ewigen I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>s Gemeinwohls<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Gemeinschaftslebens in eben dieser ihrer Gemeinschaft<br />
einrichteten. Aber Thomas dachte nicht an eine Umformung<br />
<strong>de</strong>s sozialen <strong>und</strong> politischen Lebens. Die soziale Revolution<br />
fällt in eine spätere Zeit. Und mit ihr war dann auch die recht<br />
liche Frage <strong>de</strong>s Aufbaus gegeben. Mit ihr ergab sich das Indivi-<br />
dualprinzip als ein „vorstaatliches" <strong>Recht</strong>sprinzip, als ein Prin<br />
zip <strong>de</strong>s Naturrechts.<br />
c) Als dritten Gr<strong>und</strong> für das Privateigentum als Naturrecht<br />
führt Leo XIIL. die Arbeit an. Der Papst spricht also nicht nur<br />
358
von einem <strong>Recht</strong> auf irgendwelchen Eigentumserwerb, son<strong>de</strong>rn 66. 1/2<br />
erklärt jene Dinge als naturrechtlich <strong>de</strong>m Einzelmenschen<br />
zugehörig, die dieser sich selbst erarbeitet hat. Damit wird also<br />
irgen<strong>de</strong>ine konkrete Aufteilung als naturrechtlich im Sinn von<br />
vorstaatlich bezeichnet, weil die Arbeit ein Naturrecht auf<br />
Eigentum erzeugt. Kann man ein<strong>de</strong>utiger das Individualprinzip<br />
zum Ausgangspunkt sozialen Aufbaus machen? Leo umgeht<br />
weise, wie bereits gesagt, die Gefahren <strong>de</strong>s Individualismus<br />
durch die Unterstellung dieses „Naturrechts" unter die Belange<br />
<strong>de</strong>s Gemeinwohls. Noch eindringlicher dann Pius XL in „Qua-<br />
dragesimo anno".<br />
L. <strong>de</strong> Sousberghe hat die Ansicht geäußert, daß die Begrün<br />
dung <strong>de</strong>s Eigentumsrechts durch die Arbeit von Locke beein-<br />
flußt sei; weiter, daß diese Formel im thomasischen Denken<br />
überhaupt unvorstellbar gewesen sei: „Der Reichtum wur<strong>de</strong><br />
durch die Mittelalterlichen niemals als Frucht <strong>de</strong>r Arbeit, als<br />
gerechte Vergütung für die Arbeit aufgefaßt. Er war vielmehr<br />
normalerweise das Resultat einer rechtlichen Situation, welche<br />
das Individuum bei seiner Geburt als gegeben vorfand"<br />
(a.a.O. 590).<br />
Dies stimmt nun nicht ganz. Denn Thomas hat <strong>de</strong>r Arbeit<br />
eine ungeheure Be<strong>de</strong>utung im Eigentumserwerb zugesprochen,<br />
wenngleich wohl nicht jene, welche manche Vertreter <strong>de</strong>r<br />
Arbeitswertlehre ihm unterschieben (vgl. die Fragen 77 <strong>und</strong><br />
78). Wohl aber wäre Thomas niemals daraufgekommen, das<br />
durch Arbeit naturrechtlich erworbene Eigentum als „vorstaat<br />
lich" zu bezeichnen, eben aus <strong>de</strong>r allgemeinen Sicht heraus, die<br />
für Thomas maßgebend war. Das eigentlich Neue o<strong>de</strong>r Revolu<br />
tionäre an <strong>de</strong>r Lockeschen Auffassung liegt eben darin, daß die<br />
Arbeit als individuelle Leistung gegen die Eingriffe von seiten<br />
<strong>de</strong>s Staates völlig immun gemacht wird. Darin liegt auch das<br />
eigentlich individualistische Gepräge <strong>de</strong>r Lockeschen Theorie.<br />
Diese hatte, wie P. Larkin (Property in the eigtheenth Century,<br />
1930) ausgeführt hat, ihren Nährbo<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r neuen sozialen<br />
Situation Englands, im Konflikt, welchen die neuen gesell<br />
schaftlichen Schichten unter <strong>de</strong>n Stuarts auszustehen hatten.<br />
Taparelli SJ. hat durch sein Werk „Saggio teoretico di diritto<br />
naturale appogiato sul fatto" (Palermo 1840, <strong>de</strong>utsch in Regens<br />
burg bereits 1845) diese individualistische Anschauung <strong>de</strong>s Pri<br />
vateigentums unter <strong>de</strong>n katholischen Moraltheologen schulge<br />
recht gemacht. Im gleichen Sinne schrieb auch sein Or<strong>de</strong>nsmit-<br />
359
66. 1/2 bru<strong>de</strong>r Liberatore (Ethicae et juris naturae elementa, Napoli<br />
1846). Taparelli, <strong>de</strong>r als Erneuerer <strong>de</strong>r Scholastik gilt, kannte die<br />
Scholastiker kaum, dafür aber um so mehr seine liberalistischen<br />
Zeitgenossen. Doch darf man <strong>de</strong>n Einfluß Taparellis nicht über<br />
schätzen, <strong>de</strong>nn die individualistische I<strong>de</strong>e vom Privateigentum<br />
als einem Naturrecht dieses o<strong>de</strong>r jenes Einzelmenschen gegen<br />
über <strong>de</strong>m Staate entsprach durchweg <strong>de</strong>r allgemeinen Auffas<br />
sung <strong>de</strong>r Menschenrechte als Freiheitsrechte, d. h. als <strong>Recht</strong>e, die<br />
von seiten <strong>de</strong>r Gemeinschaft unantastbar sind. Das Privateigen<br />
tum als vorstaatliches Naturrecht war <strong>de</strong>r Refrain aller, auch<br />
<strong>und</strong> beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r katholischen Liberalisten. Mit welchem<br />
skeptischen Achselzucken wur<strong>de</strong> doch im Jahre 1891 die Lehre<br />
Leos XIII., daß <strong>de</strong>r Staat in die bestehen<strong>de</strong> Eigentumsordnung<br />
eingreifen könne, bei katholischen Unternehmern aufgenom<br />
men! Geschichtlich gesehen, war die geistige Verbindung zu<br />
Thomas von Aquin abgebrochen. Die Verfechter <strong>de</strong>s Privat<br />
eigentums als eines Naturrechts, in diesem verwan<strong>de</strong>lten Sinn<br />
individuellen Freiheitsrechts, hatten selbst keine innere Bezie<br />
hung zu Thomas <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Mittelalter. Dies gilt auch <strong>und</strong> gera<strong>de</strong><br />
von Taparelli.<br />
Und <strong>de</strong>nnoch steht <strong>de</strong>r Liberalismus in einem objektiven<br />
inneren Verhältnis zur Tradition, 2 insofern er eine, allerdings<br />
einseitige Entfaltung von gesellschaftsethischen Gr<strong>und</strong>sätzen<br />
<strong>de</strong>s Mittelalters in einer neuen weltanschaulichen <strong>und</strong> religiösen<br />
Umwelt darstellt. Als die Gesellschaft sich nicht mehr an Rom<br />
orientierte, verschwand die Autorität, welche als gotterwählte<br />
Deuterin <strong>de</strong>s Naturrechts galt. Es mußte notgedrungen jene<br />
Instanz in Kraft treten, welche die „naturgemäße" war, nämlich<br />
die Vernunft. Allerdings war es diesmal nicht mehr die Vernunft<br />
<strong>de</strong>r natura humana als solche, an welche Thomas noch dachte,<br />
son<strong>de</strong>rn die Vernunft eines je<strong>de</strong>n einzelnen, weil keiner von<br />
Natur zum Richter über <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rn bestellt wur<strong>de</strong>. Die Wür<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Menschen konnte nur noch verteidigt wer<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n<br />
Menschen selbst, <strong>de</strong>r sie trug, d. h. durch <strong>de</strong>n einzelnen.<br />
Diese notwendige Folge eines weltanschaulichen Wan<strong>de</strong>ls in<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft fand ihre Formulierung in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen<br />
Erklärungen <strong>de</strong>r Freiheitsrechte, sowohl in Amerika wie in<br />
2 Die Beziehung <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre zum Liberalismus behan<strong>de</strong>lt<br />
A. Rauscher, Katholische Soziallehre <strong>und</strong> liberale Wirtschaftsauffassung, in:<br />
A.Rauscher, Hrg., Selbstinteresse <strong>und</strong> Gemeinwohl, Berlin 1985, 279—318.<br />
360
Europa. Im Gr<strong>und</strong>e war diese Sicht nichts an<strong>de</strong>res als eine kon- 66. 1/2<br />
sequente Anwendung <strong>de</strong>r thomasischen Lehre von <strong>de</strong>r Ver<br />
nunft als <strong>de</strong>r entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Richterin in Naturrechtsfragen<br />
auf eine konkrete gesellschaftliche Situation. Die Liberalisten<br />
hätten nur <strong>de</strong>n naturrechtlichen Gegenpol <strong>de</strong>s Individuums<br />
nicht übersehen dürfen: die Gemeinschaft mit ihrer positiven<br />
Kulturaufgabe. Und ebenso hätten die Verfasser <strong>de</strong>r scholasti<br />
schen Handbücher die Rückorientierung an <strong>de</strong>r thomasischen<br />
Eigentumslehre früher vornehmen müssen, um die soziale<br />
Belastung als noch tiefer im Naturrecht verankert zu erkennen<br />
als das vorstaatliche Individualrecht; dann wäre wohl die<br />
Enzyklika „Rerum novarum" früher vorbereitet wor<strong>de</strong>n.<br />
d) Die drei erwähnten Grün<strong>de</strong> für das Privateigentum als<br />
Naturrecht wer<strong>de</strong>n von Leo XIII. noch durch zwei an<strong>de</strong>re<br />
ergänzt, die nicht auf <strong>de</strong>rselben Linie stehen wie die drei<br />
genannten <strong>und</strong> auch unter sich ansehnliche Verschie<strong>de</strong>nheiten<br />
aufweisen.<br />
Der erste <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n geht auf das Naturrecht eines je<strong>de</strong>n<br />
Menschen zurück, in freier Entscheidung eine Familie grün<strong>de</strong>n<br />
zu können: „Wenn je<strong>de</strong>m Menschen, wie gezeigt wur<strong>de</strong>, als<br />
Einzelwesen die Natur das <strong>Recht</strong>, Eigentum zu besitzen, verlie<br />
hen hat, so muß sich dieses <strong>Recht</strong> auch im Menschen, insofern<br />
er Haupt einer Familie ist, fin<strong>de</strong>n. Ja, das <strong>Recht</strong> besitzt im Fami<br />
lienhaupte noch mehr Energie, weil <strong>de</strong>r Mensch sich im häus<br />
lichen Kreise gleichsam aus<strong>de</strong>hnt" (Rerum novarum, 9). Es<br />
wird hier im Namen einer vorstaatlichen Gesellschaft etwas<br />
proklamiert, das die Unabhängigkeit vom Staate garantieren<br />
soll. Der Familienvater soll frei sein von je<strong>de</strong>r Bevorm<strong>und</strong>ung<br />
durch <strong>de</strong>n Staat, er soll darum die Gemeinschaft, die er gegrün<br />
<strong>de</strong>t hat, auf weite Sicht wirtschaftlich abstützen können. Er soll<br />
nicht nur selbst Eigentum im Namen <strong>de</strong>r Familie als sein eige<br />
nes <strong>Recht</strong> betrachten dürfen, son<strong>de</strong>rn auch über seine Lebens<br />
zeit hinweg die Familie als wirtschaftlich freie Gemeinschaft<br />
sichern dürfen, in<strong>de</strong>m er ihr Eigentum als Erbschaft hinterläßt.<br />
Auffallend ist hier, daß zwischen Individuum <strong>und</strong> Staat nun ein<br />
gesellschaftliches Element auftaucht, welches ebenfalls eine Au<br />
tonomie besitzt. Pius XL wird diesen unpolitischen gesell<br />
schaftlichen Raum noch mehr ausbauen in seiner Lehre von <strong>de</strong>r<br />
berufsständischen Ordnung. All das zeigt, wie weit wir von <strong>de</strong>r<br />
thomasischen Sicht abrücken, abrücken nicht im Sinne von<br />
„wi<strong>de</strong>rsprechen", son<strong>de</strong>rn von entwickeln <strong>und</strong> entfalten. Tho-<br />
361
66. 1/2 mas hatte in seiner finalbetonten, d. h. ethisch-i<strong>de</strong>alen Auffas<br />
sung <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Ordnung noch keinen autonomen<br />
Raum einräumen können. Man kann sich diese neue Sicht <strong>de</strong>s<br />
Staatlichen von <strong>de</strong>m vorstaatlichen <strong>Recht</strong> her nicht genug klar<br />
machen, um davor bewahrt zu wer<strong>de</strong>n, Thomastexte, die sich<br />
irgendwie mit <strong>de</strong>m Problem <strong>de</strong>r Gemeinschaft <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Einzel<br />
menschen befassen, genau so, wie sie lauten, auf mo<strong>de</strong>rne<br />
Fragestellungen zu übertragen. Die ungeheure geistesge<br />
schichtliche Entwicklung spiegelt etwa folgen<strong>de</strong>r Passus aus<br />
„Rerum novarum" (9) wi<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>n wir uns niemals in dieser Fas<br />
sung in <strong>de</strong>r Summa <strong>de</strong>s hl. Thomas vorstellen könnten: „Die<br />
Familie, die häusliche Gesellschaft, ist eine wahre Gesellschaft<br />
mit allen <strong>Recht</strong>en <strong>de</strong>rselben, sie ist älter als jegliches an<strong>de</strong>re<br />
Gemeinwesen, <strong>und</strong> <strong>de</strong>shalb besitzt sie unabhängig vom Staate<br />
ihre innewohnen<strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>e <strong>und</strong> Pflichten."<br />
Das heißt an<strong>de</strong>rerseits nicht, daß er die gesellschaftliche<br />
Ordnung zur politischen erklärt habe. Aristoteles folgend<br />
erkannte er gesellschaftliche Gebil<strong>de</strong> innerhalb <strong>de</strong>s Gemein<br />
wohls <strong>und</strong> die Notwendigkeit von nicht-staatlichen Hand<br />
lungsbereichen. In <strong>de</strong>r Frage, wer für die Bestimmung <strong>de</strong>r Reli<br />
gion <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s zuständig sei, sprach er sich für das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r<br />
Eltern, nicht etwa wie Johannes Duns Skotus für das <strong>de</strong>s Fürsten<br />
aus. 3 Seine Argumente für das Privateigentum weisen ebenfalls<br />
auf die Wertschätzung <strong>de</strong>r persönlichen Verantwortung gegen<br />
über kollektiven Eingriffen hin. All das ist aber gesehen vom<br />
wertgefüllten <strong>und</strong> strukturierten Gemeinwohl aus. Dieses<br />
erklärt er gegen Aristoteles als vorstaatlich, d. h. <strong>de</strong>n Staat bin<br />
<strong>de</strong>nd. 4 Der Ansatz seiner Sozialphilosophie ist das Gemein<br />
wohl, von <strong>de</strong>m aus er zu <strong>de</strong>n subjektiven <strong>Recht</strong>en vorstößt,<br />
nicht umgekehrt wie im mo<strong>de</strong>rnen rechtsstaatlichen Denken<br />
von <strong>de</strong>n subjektiven <strong>Recht</strong>en zum Gemeinwohl, <strong>de</strong>r sogenann-<br />
ten „sozialen Belastung".<br />
e) Der zweite <strong>de</strong>r noch beigefügten Grün<strong>de</strong> für das Privatei<br />
gentum <strong>und</strong> gegen das Kollektivsystem hat eine eigene<br />
Bewandtnis^ Er sieht nämlich vom vorstaatlichen <strong>Recht</strong>, wie es<br />
bisher besprochen wur<strong>de</strong>, ab <strong>und</strong> betrachtet das gesellschaft<br />
liche Ordnungsganze: „Aber sieht man selbst von <strong>de</strong>r Unge<br />
rechtigkeit ab, so ist ebensowenig zu leugnen, daß dieses<br />
3 Vgl. A.F. Utz, Sozialethik, Teil III, 131.<br />
4 Vgl. A.F.Utz, Sozialethik, Teil I, 202.<br />
362
System in allen Schichten <strong>de</strong>r Gesellschaft Verwirrung herbei<br />
führen wür<strong>de</strong>. Eine unerträgliche Beengung aller, eine skla<br />
vische Abhängigkeit wür<strong>de</strong> die Folge <strong>de</strong>s Versuchs seiner<br />
Anwendung sein. Es wür<strong>de</strong> gegenseitiger Mißgunst, Zwietracht<br />
<strong>und</strong> Verfolgung Tür <strong>und</strong> Tor geöffnet. Mit <strong>de</strong>m Wegfall <strong>de</strong>s<br />
Ansporns zu Strebsamkeit <strong>und</strong> Fleiß wür<strong>de</strong>n auch die Quellen<br />
<strong>de</strong>s Wohlstands versiegen. Aus <strong>de</strong>r eingebil<strong>de</strong>ten Gleichheit<br />
aller wür<strong>de</strong> nichts an<strong>de</strong>res als <strong>de</strong>rselbe klägliche Zustand <strong>de</strong>r<br />
Entwürdigung aller" (Rerum novarum, 12). Damit wer<strong>de</strong>n im<br />
wesentlichen die von Thomas in Art. 2 angeführten drei Ange-<br />
messenheits- <strong>und</strong> Notwendigkeitsgrün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r privaten Eigen<br />
tumsordnung genannt, allerdings mit <strong>de</strong>r Beimischung <strong>de</strong>r<br />
bereits dargestellten Lehre <strong>de</strong>r Menschenwür<strong>de</strong> im mo<strong>de</strong>rnen<br />
Sinn <strong>de</strong>r Individualrechte. Die soziale Ordnung verlangt <strong>de</strong>n<br />
Ansatz beim Individuum. Das Individualprinzip ist darum in<br />
Wahrheit ein Sozialprinzip. Dies hat nichts mit <strong>de</strong>m wirtschaft<br />
lichen Automatismus <strong>de</strong>r Liberalisten zu tun, als ob das wirt<br />
schaftliche Gleichgewicht ein Resultat <strong>de</strong>r ungeregelten wirt<br />
schaftlichen Freiheit sei. Im Individualismus <strong>und</strong> Liberalismus<br />
ist das Individualprinzip nicht nur ein Sozialprinzip im Sinn<br />
einer Gr<strong>und</strong>norm, nicht nur Ansatz <strong>und</strong> Ausgangspunkt <strong>de</strong>s<br />
Sozial<strong>de</strong>nkens, Prinzip also im eigentlichen Sinn von princi-<br />
pium = Anfang, son<strong>de</strong>rn auch En<strong>de</strong>, Vollendung <strong>de</strong>r wirtschaft<br />
lichen <strong>und</strong> sozialen Ordnung.<br />
Mit <strong>de</strong>m Augenblick, da <strong>de</strong>r Nachweis erbracht ist, daß das<br />
Individualprinzip um <strong>de</strong>r sozialen Ordnung willen gefor<strong>de</strong>rt<br />
ist, kann man mit <strong>Recht</strong> die Menschenwür<strong>de</strong>, wie sie auf <strong>de</strong>r<br />
Linie <strong>de</strong>r natura humana als solcher für je<strong>de</strong>n Menschen<br />
zunächst in gleicherweise gilt, in die konkrete Situation weiter<br />
<strong>de</strong>nken <strong>und</strong> auf dieser lebensnäheren Basis zum Naturrecht<br />
erklären. Dies hat Leo XIII. getan. Dazu war die Zeit <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas noch nicht reif. Es bedurfte hierzu <strong>de</strong>r sozialen Revolu<br />
tion, wie sie die Industrialisierung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Liberalismus mit<br />
sich brachten. Bei Thomas fin<strong>de</strong>n sich aber alle dazu notwendi<br />
gen Denkelemente.<br />
f) Johannes Paul II. verweist in <strong>de</strong>r Enzyklika Laborem exer<br />
cens (15) auf die Eigentumslehre <strong>de</strong>s hl. Thomas (II—II 66,2,<br />
nicht, wie es in verschie<strong>de</strong>nen Ausgaben heißt, II—II 65,2). Er<br />
gibt ihr aber eine ganz eigene Interpretation. Die logische Folge<br />
seiner Darlegung ist folgen<strong>de</strong>: l.die Produktionsmittel sind<br />
wesentlich bezogen auf die arbeiten<strong>de</strong> Person, 2. die Mißach-<br />
363
tung dieses Bezuges hat wirtschaftliche <strong>und</strong> gesellschaftliche,<br />
überhaupt allgemein menschliche Schä<strong>de</strong>n zur Folge. Für das<br />
zweite Glied dieses Gedankenprozesses wird die Lehre <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas angeführt. Daß die volle Beachtung <strong>de</strong>s personalen<br />
Wertes <strong>de</strong>m Wirtschaftssystem <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Produktionsprozeß<br />
nur zum Vorteil gereiche, sei, so sagt <strong>de</strong>r Papst (Nr. 15), vor<br />
allem <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>, <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>m hl. Thomas von Aquin für das<br />
Privateigentum spreche.<br />
Thomas hat sein Argument zugunsten <strong>de</strong>r privaten Eigen<br />
tumsordnung nicht mit <strong>de</strong>m Bezug Produktionsmittel —Arbeit<br />
begonnen, son<strong>de</strong>rn mit <strong>de</strong>r Relation Produktionsmittel zur<br />
Produktivität <strong>und</strong> <strong>de</strong>m sozialen Frie<strong>de</strong>n. Ihm kam es in erster<br />
Linie auf die objektive Seite <strong>de</strong>r Arbeit, genauer: <strong>de</strong>r Disposi<br />
tionsgewalt über die Produktionsmittel im Hinblick auf die<br />
objektiven Folgen an: Das gottgewollte Ziel, nämlich <strong>de</strong>ren<br />
produktivste Verwendung zum Besten aller, wird sicherer<br />
erreicht, wenn <strong>de</strong>r einzelne Mensch Eigentümer ist <strong>und</strong> damit<br />
hautnah die Konsequenzen unproduktiven Umgangs mit <strong>de</strong>n<br />
Gütern spürt (Risikobindung). Dies heißt natürlich, daß <strong>de</strong>r<br />
personale Bezug <strong>de</strong>r Produktionsmittel zum Menschen her<br />
gestellt wer<strong>de</strong>n muß. Der Bezug zum arbeiten<strong>de</strong>n Menschen ist<br />
hierbei miteingeschlossen. Gemeint ist aber gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>de</strong>r<br />
personale Bezug zum disponieren<strong>de</strong>n, verwalten<strong>de</strong>n Men<br />
schen, <strong>de</strong>r nach Thomas nur als Eigentümer begriffen wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Ein vom Gemeineigentum beherrschtes Wirtschaftssy<br />
stem wäre keine Ordnung, wie sie Thomas vorsieht. Die mög<br />
lichste Annäherung <strong>de</strong>r Produktionsmittel an <strong>de</strong>n Arbeiter im<br />
Sinn <strong>de</strong>r Partizipation an <strong>de</strong>r Leitung gälte gemäß Thomas als<br />
Kompromißfor<strong>de</strong>rung an ein System, das gr<strong>und</strong>sätzlich auf<br />
<strong>de</strong>m Gemeineigentum grün<strong>de</strong>t, damit wenigstens soviel<br />
erreicht wür<strong>de</strong>, daß <strong>de</strong>r Arbeiter das Bewußtsein gewänne, „in<br />
eigener Sache" zu arbeiten.<br />
Warum diese Akzentverschiebung in <strong>de</strong>r Eigentumslehre<br />
Johannes Pauls II. im Vergleich zu Thomas von Aquin <strong>und</strong> auch<br />
zu Leo XIII. ? Während es Thomas von Aquin darum ging, eine<br />
Wirtschaftsordnung in ihren Gr<strong>und</strong>zügen zu entwerfen, <strong>und</strong> es<br />
Leo XIII. darauf ankam, das Wirtschaftssystem <strong>de</strong>s Sozialis<br />
mus zu wi<strong>de</strong>rlegen, will Johannes Paul II. ein für alle aktuellen<br />
Systeme gültiges Kriterium benennen, wonach man ein System,<br />
welches immer es sein mag, als menschenwürdig beurteilen<br />
kann. Das Kriterium heißt „die Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>s arbeiten<strong>de</strong>n Men-<br />
364
sehen". Die Absicht etwa, die mit <strong>de</strong>m Privateigentum über 66. 1/2<br />
Produktionsmittel verb<strong>und</strong>ene Marktwirtschaft als das <strong>de</strong>m<br />
Menschen konforme Wirtschaftssystem nachzuweisen, liegt<br />
nicht im Gedankengang <strong>de</strong>r Enzyklika „Laborem exercens".<br />
Wenn Johannes Paul II. <strong>de</strong>n Kommunismus unter <strong>de</strong>m strengen<br />
Gesichtspunkt <strong>de</strong>s Wirtschaftssystems hätte angreifen wollen,<br />
hätte er wie etwa Thomas von Aquin die ökonomische Seite an<br />
<strong>de</strong>n Anfang stellen müssen. Er hat, wie gesagt, diesen Gesichts<br />
punkt nur indirekt o<strong>de</strong>r mittelbar angesprochen. Sein Gedan<br />
kengang zerstört durchaus nicht die traditionell gesicherten<br />
Aussagen <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre. Es bleibt je<strong>de</strong>m Papst<br />
anheimgestellt, die katholische Soziallehre im Hinblick auf ein<br />
bestimmtes, von ihm als opportun betrachtetes aktuelles Anlie<br />
gen darzutun <strong>und</strong> entsprechend die Akzente zu setzen.<br />
3. DIE LEHRE VOM EIGENTUM IN DER CHRISTLICHEN TRADITION<br />
Um <strong>de</strong>n genuinen Sinn <strong>de</strong>r thomasischen Eigentumslehre zu<br />
ermitteln, muß man <strong>de</strong>r christlichen Tradition nachgehen. Ist<br />
doch <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s „Gebrauchs" <strong>de</strong>r Güter, <strong>de</strong>n Thomas als<br />
allen Menschen gemeinsam erklärt, aus <strong>de</strong>r Tradition genom<br />
men. Es zeugt vom neuen Geist, <strong>de</strong>r das Christentum gera<strong>de</strong> in<br />
<strong>de</strong>r Einschätzung <strong>de</strong>r Güter dieser Welt beseelte, daß sich die<br />
christlichen Autoren nur sehr wenig o<strong>de</strong>r überhaupt nicht auf<br />
das Alte Testament beziehen.<br />
Die Väter hatten sich im Geist <strong>de</strong>s Evangeliums mit <strong>de</strong>r rein<br />
moralischen Sicht <strong>de</strong>s Eigentums begnügt <strong>und</strong> dabei die recht<br />
liche außer Acht gelassen o<strong>de</strong>r doch sehr geringgechätzt; d. h.,<br />
sie gingen vom Gedanken aus, daß vor Gott niemand sich als<br />
Eigentümer bezeichnen könne, son<strong>de</strong>rn stets nur verantwortli<br />
cher Lehensträger bleibe. Damit tritt das rechtliche Verhältnis<br />
von Mensch zu Mensch in <strong>de</strong>n Hintergr<strong>und</strong>. Die Rückerinne-<br />
rung an das Alte Testament hätte aber manche etwas über<br />
spitzte Äußerungen gegen das Privateigentum gemil<strong>de</strong>rt. Denn<br />
das Alte Testament hatte eine sehr kluge Wirtschaftsverfas<br />
sung. 5 Bei <strong>de</strong>r gr<strong>und</strong>sätzlichen Anerkennung <strong>de</strong>s Privat- (o<strong>de</strong>r<br />
wenigstens <strong>de</strong>s Familien-)eigentums enthielt die alttestament-<br />
5 Vgl. die ausgezeichnete Schrift von H. Bückers CSSR, Die biblische Lehre vom<br />
Eigentum, Bonn 1947.<br />
365
66. 1/2 liehe Gesetzgebung eine Reihe von sozialen Vorschriften, durch<br />
die das Eigentum <strong>und</strong> die Existenz <strong>de</strong>r Armen gesichert wer<strong>de</strong>n<br />
sollten. Wenngleich Gott als oberster Herr das Land besitzt <strong>und</strong><br />
in <strong>de</strong>r Hand behält, so hat Er es doch unter die Menschen ver<br />
teilt, damit je<strong>de</strong>r seinen, gera<strong>de</strong> ihm gehören<strong>de</strong>n Anteil habe:<br />
„Verteilt das Land nach euren Stämmen durch das Los! Denen,<br />
die zahlreicher sind, sollt ihr ein ausge<strong>de</strong>hnteres, <strong>und</strong> <strong>de</strong>nen, die<br />
wenige sind, ein kleineres Gebiet geben! Was einem je<strong>de</strong>n<br />
[Stamm] durch das Los zufällt, soll ihm gehören! Nach euren<br />
väterlichen Stämmen sollt ihr es verteilen" (Nm 33,54). Wenn<br />
gleich in diesem Text nicht vom Eigentum eines einzelnen Men<br />
schen, son<strong>de</strong>rn eines einzelnen Stammes die Re<strong>de</strong> ist, so<br />
gebührt ihm doch beson<strong>de</strong>re Aufmerksamkeit. Gott wird zwar<br />
als <strong>de</strong>r Erst- <strong>und</strong> eigentliche Besitzer aller Dinge bezeichnet.<br />
Dennoch gibt Er <strong>de</strong>m einzelnen Stamm <strong>de</strong>n ihm zugehören<strong>de</strong>n<br />
Teil, auf <strong>de</strong>n dieser einen <strong>Recht</strong>stitel gegenüber <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren<br />
haben soll. Das Eigentum ist also in doppelter Hinsicht gese<br />
hen: vertikal <strong>und</strong> horizontal. Vertikal besteht kein <strong>Recht</strong>stitel,<br />
<strong>de</strong>nn Gott ist <strong>de</strong>r einzige Besitzer. Jedoch kann sich in horizon<br />
taler Richtung, d. h. in <strong>de</strong>r Linie von Mensch zu Mensch, <strong>de</strong>r<br />
Stamm als rechtlicher Eigentümer betrachten. Die Kirchenväter<br />
haben, wie bereits erwähnt, die vertikale Sicht eingehalten,<br />
während die horizontale, die eigentlich rechtliche Beziehung<br />
erst im Mittelalter klar gewürdigt wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Warum aber haben die Väter so wenig von <strong>de</strong>r rechtlichen<br />
Eigentumsregelung <strong>de</strong>s Alten B<strong>und</strong>es Notiz genommen? Die<br />
Antwort liegt auf <strong>de</strong>r Hand. Das Alte Testament war <strong>de</strong>m<br />
Reichtum stärker zugewandt als das Neue. Trotz allem Kampf,<br />
<strong>de</strong>n die Propheten mit <strong>de</strong>n Reichen um ihrer Habgier <strong>und</strong> Un<br />
gerechtigkeiten willen führten, läßt sich im Alten B<strong>und</strong>e doch<br />
kein so scharfer Gegensatz gegen <strong>de</strong>n Reichtum feststellen wie<br />
im Neuen. Der Reichtum ist <strong>de</strong>m Israeliten ein Segen Gottes,<br />
für <strong>de</strong>n er dankbar ist. So heißt es im 42. Kapitel <strong>de</strong>s Buches Job,<br />
daß <strong>de</strong>r geduldige Job um seiner standhaften Gesinnung willen<br />
mit äußeren Gütern noch reicher gesegnet wur<strong>de</strong>: „Der Herr<br />
gab Job jetzt noch mehr Glück, als er zuvor besessen. Erbrachte<br />
es auf 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 100Joch Rin<strong>de</strong>r<strong>und</strong> 1.000<br />
Eselinnen" (42,12). Und im „Prediger" (5,18) heißt es: „Ist<br />
doch für je<strong>de</strong>n Menschen, <strong>de</strong>m die Gottheit Reichtum gibt <strong>und</strong><br />
Schätze <strong>und</strong> <strong>de</strong>m sie Fähigkeit verleiht, davon zu essen <strong>und</strong> sich<br />
seinen Teil zu nehmen <strong>und</strong> sich an seiner Mühe zu erfreuen, dies<br />
366
eine Gottesgabe". Im Buch <strong>de</strong>r Sprüche wird <strong>de</strong>r Reichtum eine<br />
feste Stadt genannt, eine hohe Mauer, die <strong>de</strong>n Besitzen<strong>de</strong>n um<br />
ringt (18,11).<br />
Die Armut besaß im Alten Testament eine wenig ehrenvolle<br />
Stellung. Sie war Strafe <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> <strong>und</strong> Gottlosigkeit. „Der Säu<br />
fer <strong>und</strong> <strong>de</strong>r lie<strong>de</strong>rliche Mensch verarmen; die Dirne klei<strong>de</strong>t sich<br />
in Lumpen" (Spr 23,21). Da <strong>de</strong>m Alten Testament <strong>de</strong>r Sinn für<br />
die jenseitige Vergeltung stark fehlt, fehlt das Lob auf die rechte<br />
Armut. An<strong>de</strong>rerseits weiß <strong>de</strong>r alttestamentliche Mahner wohl<br />
zu unterschei<strong>de</strong>n zwischen <strong>de</strong>m Reichtum <strong>de</strong>s Gottlosen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Armut <strong>de</strong>s Gottesfürchtigen: „Besser wenig mit Gottes<br />
furcht als reicher Besitz <strong>und</strong> dabei Unruhe" (Spr 15,16). Im<br />
Hinblick auf die sittlichen Gefahren <strong>de</strong>s Reichtums suchte das<br />
Alte Testament das wirtschaftliche <strong>und</strong> soziale I<strong>de</strong>al im Mittel<br />
stand: „Gib mir nicht Armut <strong>und</strong> Reichtum! Laß mich genießen<br />
mein Stückchen Brot! Sonst könnte ich, wäre ich satt, Dich ver<br />
leugnen <strong>und</strong> fragen: Wer ist <strong>de</strong>r Herr? O<strong>de</strong>r wäre ich arm,<br />
könnte ich zum Dieb wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> mich am Namen meines Got<br />
tes vergreifen" (Spr 30,8 f.).<br />
Auch die christliche Ethik hat, namentlich bei Thomas von<br />
Aquin, <strong>de</strong>n Mittelstand als das <strong>de</strong>m sittlich-religiösen I<strong>de</strong>al för<br />
<strong>de</strong>rlichste Maß von Besitz erkannt. Man könnte diese Einstel<br />
lung in <strong>de</strong>r Vaterunser-Bitte um das „tägliche Brot" wie<strong>de</strong>rfin<br />
<strong>de</strong>n. Und doch tritt in <strong>de</strong>n Evangelien das Heroische stärker in<br />
Erscheinung: die Armut um <strong>de</strong>s Himmelreiches willen.<br />
Bezeichnend dafür ist auch, daß Christus sich gera<strong>de</strong> die Armen<br />
<strong>und</strong> Ärmsten ausgesucht hat, <strong>de</strong>rart, daß Alfred Weber die Berg<br />
predigt Jesu als die Re<strong>de</strong> <strong>de</strong>s größten Sklavenaufstands bezeich<br />
nete.<br />
Die Urkirche in Jerusalem war von diesem I<strong>de</strong>al völlig einge<br />
nommen, so daß sich eine freie, spontane Gütergemeinschaft<br />
bil<strong>de</strong>te. Es bestand zwar kein rechtlicher Kommunismus.<br />
Immerhin aber gehörte es zum guten Ton <strong>de</strong>s Christseins, alles<br />
in die Gemeinschaft zu tragen, so daß <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r sich dieser<br />
Gepflogenheit nicht anschloß, mit einer gewissen Geringschät<br />
zung rechnen mußte.<br />
Die spontane Gütergemeinschaft in Jerusalem machte aber<br />
weiter keine Schule. Der Scharfblick <strong>de</strong>s Völkerapostels<br />
erkannte, daß in <strong>de</strong>n aus Hei<strong>de</strong>nchristen bestehen<strong>de</strong>n Gemein<br />
<strong>de</strong>n kein Raum für solche Bestrebungen war. Im übrigen hat das<br />
Beispiel Jerusalems, das chronischer Armut verfiel (wohl nicht<br />
367
66. 1/2 zuletzt, wenn auch nicht vordringlich wegen <strong>de</strong>r dortigen<br />
Gütergemeinschaft) <strong>und</strong> auf die Hilfe <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Christen<br />
gemein<strong>de</strong>n angewiesen war, von selbst seine Anziehungskraft<br />
verloren.<br />
Die Gütergemeinschaft in <strong>de</strong>r christlichen Gemein<strong>de</strong> von<br />
Jerusalem hatte übrigens ihre Vorbil<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>n Griechen,<br />
wovon <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r griechischen Literatur bewan<strong>de</strong>rte Evangelist<br />
Lukas sehr wahrscheinlich gewußt hat. Es gehörte zum sozial<br />
politischen I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s Hellentums, daß <strong>de</strong>r Reiche seinen Besitz<br />
<strong>de</strong>r gemeinsamen N<strong>utz</strong>ung zur Verfügung stellte. Der grie<br />
chische Stadt-Staat mit seiner räumlichen Beschränkung<br />
ermöglichte die Verwirklichung eines solchen I<strong>de</strong>als. Aristoteles<br />
berichtet im 6. Buch <strong>de</strong>r Politik (c. 5; 1320 b 9), daß die Reichen<br />
von Tarent <strong>de</strong>n Armen <strong>de</strong>n Mitgebrauch ihrer Güter zugestan<br />
<strong>de</strong>n <strong>und</strong> sich auf diese Weise die Zuneigung <strong>de</strong>r Armen erwor<br />
ben haben. Aristoteles selbst tritt für die Privateigentumsord<br />
nung ein aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r üblen Erfahrungen, die man in einer<br />
völlig gemeinschaftlich verwalteten Wirtschaftsgesellschaft<br />
machen kann. Er meint aber doch, daß in einem gewissen Sinn<br />
die Güter gemeinsam verwaltet wer<strong>de</strong>n sollten. Wenn je<strong>de</strong>r für<br />
das Seine sorge, dann wür<strong>de</strong> zwar tüchtiger gesorgt. An<strong>de</strong>rer<br />
seits aber müßte das Gesetz <strong>de</strong>r gegenseitigen Hilfsbereitschaft<br />
gelten, das auch durch staatliche Maßnahmen unterstützt wer<br />
<strong>de</strong>n sollte: „Schon jetzt ist hiermit in <strong>de</strong>r Gesetzgebung einzel<br />
ner Staaten ein Anfang gemacht, so daß man sieht, die Sache ist<br />
nicht unmöglich; <strong>und</strong> zumeist in wohleingerichteten Staaten ist<br />
in diesem Sinn manches teils schon verwirklicht, teils in <strong>de</strong>r<br />
Vorbereitung begriffen. Ein je<strong>de</strong>r hat da seinen Eigenbesitz,<br />
aber manches überläßt er seinen Fre<strong>und</strong>en zur Mitben<strong>utz</strong>ung,<br />
an<strong>de</strong>res ben<strong>utz</strong>t er selbst als Gemeingut mit, wie z. B. in Laze-<br />
dämon <strong>de</strong>r eine sich <strong>de</strong>r Sklaven <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn gleichsam wie sei<br />
ner eigenen bedient, <strong>und</strong> ebenso seine Pfer<strong>de</strong> <strong>und</strong> H<strong>und</strong>e, wie<br />
auch <strong>de</strong>r Früchte, wenn man ihrer auf <strong>de</strong>n Fel<strong>de</strong>rn im Lan<strong>de</strong> als<br />
Wegzehrung bedarf. Man sieht also, es ist besser, daß <strong>de</strong>r Besitz<br />
Privateigentum bleibe, aber durch die Ben<strong>utz</strong>ung gemeinsam<br />
wird. Daß aber die Bürger ihrer Gesinnung nach dahin gebracht<br />
wer<strong>de</strong>n, ist die eigenste Aufgabe <strong>de</strong>s Gesetzgebers" (Pol. 11,5;<br />
1263 a 30-40).<br />
In <strong>de</strong>r christlichen Urgemein<strong>de</strong> waren die Motive solcher<br />
Gütergemeinschaft allerdings an<strong>de</strong>re, weniger wirtschaftspoli<br />
tische, son<strong>de</strong>rn von Gr<strong>und</strong> auf religiöse.<br />
368
Zum Erweis dafür, wie stark die ethische Betrachtung in <strong>de</strong>r 66. 1/2<br />
Eigentumsfrage bei <strong>de</strong>n Vätern unterstrichen wird <strong>und</strong> wie<br />
wenig die eigentlich naturrecbtliche Seite zur Geltung kommt,<br />
machen wir nur einige wenige Angaben, die für die thomasische<br />
Gedankenwelt von beson<strong>de</strong>rem Interesse sind. 6<br />
Irenaus (Adv. Haereses, aus <strong>de</strong>r Zeit 174—189) betont die<br />
Freiheit <strong>de</strong>r christlichen Liebe, im Gegensatz etwa zu <strong>de</strong>n jüdi<br />
schen sozialen Gesetzgebungen wie <strong>de</strong>m Armenzehnten. Er<br />
meint, daß diese Freiheit sich <strong>de</strong>m Gebot Christi füge, nicht nur<br />
<strong>de</strong>n Zehnten, son<strong>de</strong>rn die ganze Habe an die Armen zu vertei<br />
len. Er hält sogar dafür, daß diese Pflicht vom Christen mit inne<br />
rer Freu<strong>de</strong> erfüllt wer<strong>de</strong>. In rhetorischer Übertreibung meint<br />
Irenaus sogar, es könne sich niemand von uns zum Besitzer von<br />
irdischen Gütern aufwerfen. Im Gr<strong>und</strong>e genommen ist dies<br />
aber gar keine Ubertreibung, da es hier nur um die ethische<br />
Sicht geht, d. h. um das Verhältnis <strong>de</strong>s Menschen zu Gott, nicht<br />
um die zwischenmenschlichen rechtlichen Beziehungen.<br />
Irenaus aber <strong>de</strong>hnt seine Lehre vom „ungerechten Mam<br />
mon", <strong>de</strong>n ein je<strong>de</strong>r sein eigen nennen möchte, auch auf die zwi<br />
schenmenschlichen Beziehungen aus. Jedoch ist auch hier nur<br />
<strong>de</strong>r ethische Teil gesehen, nicht die rechtliche Seite, d. h. es wird<br />
Mensch zu Mensch betrachtet in <strong>de</strong>r Verpflichtung um <strong>de</strong>s<br />
Gewissens, also im Gr<strong>und</strong>e um Gottes willen, nicht vom<br />
<strong>Recht</strong>sanspruch <strong>de</strong>s Nächsten her. In diesem Sinn ist die eigen<br />
tümlich erscheinen<strong>de</strong> Stelle zu verstehen, wo Irenaus <strong>de</strong>n Ein<br />
wand, die Ju<strong>de</strong>n hätten auf Befehl Gottes durch Mitnahme <strong>de</strong>r<br />
Gefäße <strong>und</strong> Gewän<strong>de</strong>r die Ägypter bestohlen <strong>und</strong> beraubt, mit<br />
<strong>de</strong>r Begründung zurückweist, daß wir überhaupt alles, was wir<br />
unser eigen nennen, zu Unrecht besäßen: „Wenn nämlich bei<br />
<strong>de</strong>r vorbildlichen Auswan<strong>de</strong>rung Gott dies nicht gestattet hätte,<br />
so könnte jetzt bei unserer wahren Auswan<strong>de</strong>rung, d. h. im<br />
6 Vgl. zum Ganzen: O. Schilling, Reichtum <strong>und</strong> Eigentum in <strong>de</strong>r altkirchlichen<br />
Literatur. Ein Beitrag zur sozialen Frage, Freiburg i.Br. 1908; Ders.: Der<br />
kirchliche Eigentumsbegriff,Freiburgi.Br. 1930. Ebenso: H.Schumacher,The<br />
Social Message of the New Testament, Milwaukee 1937; I.Seipel, Die wirtschaftsethischen<br />
Lehren <strong>de</strong>r Kirchenväter, Wien 1907; John A. Ryan, Alleged<br />
Socialism of the Church Fathers, St. Louis 1913; die Artikel von Patrick<br />
J. Healy, Historie Christianity and the Social Question, in: The Catholic University<br />
Bulletin XVII, 1911. Die Gedanken fin<strong>de</strong>n ihre mo<strong>de</strong>rne Auswertung<br />
bzgl. <strong>de</strong>s Problems „Religion <strong>und</strong> Kapitalismus" bei Tawney, Laski, Fanfani,<br />
O Brien, Troeltsch, M. Weber u. a.<br />
369
66. 1/2 Glauben, in <strong>de</strong>n wir versetzt <strong>und</strong> durch <strong>de</strong>n wir aus <strong>de</strong>r Zahl <strong>de</strong>r<br />
Hei<strong>de</strong>n ausgeschie<strong>de</strong>n sind, niemand gerettet wer<strong>de</strong>n. Uns<br />
allen nämlich folgt — sei es kleiner o<strong>de</strong>r großer—Besitz, <strong>de</strong>n wir<br />
aus <strong>de</strong>m ,Mammon <strong>de</strong>s Unrechts' erworben haben. Denn<br />
woher haben wir die Häuser, worin wir wohnen, die Gewän<strong>de</strong>r,<br />
womit wir uns beklei<strong>de</strong>n, die Gefäße, <strong>de</strong>ren wir uns bedienen,<br />
<strong>und</strong> was sonst uns alles zum fortwähren<strong>de</strong>n Gebrauch dient, als<br />
aus <strong>de</strong>m, was wir noch als Hei<strong>de</strong>n habsüchtig erworben o<strong>de</strong>r<br />
aus <strong>de</strong>m ungerechten Erwerb von heidnischen Eltern, Ver<br />
wandten o<strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong>en bekommen haben? Um davon zu<br />
schweigen, daß wir auch jetzt noch im Stan<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Glaubens<br />
Erwerb suchen. Denn wer verkauft <strong>und</strong> will nicht gewinnen<br />
vom Käufer? Und wer kauft <strong>und</strong> will nicht, daß das Geschäft<br />
mit <strong>de</strong>m Verkäufer zum eigenen N<strong>utz</strong>en ausfalle? Welcher<br />
Händler aber han<strong>de</strong>lt nicht, um sich [vom Gewinn] zu näh<br />
ren?" (Adv. haer. IV, c. XXX; PG 7,1065). Irenaus will <strong>de</strong>n Ein<br />
wand ad absurdum führen mit <strong>de</strong>r Begründung, wenn die Ju<strong>de</strong>n<br />
damals das, was sie mitgenommen haben, aus Diebstahl gehabt<br />
hätten, dann könnte man mit <strong>de</strong>mselben <strong>Recht</strong> auch behaup<br />
ten, wir Christen hätten alles nur aus Raub.<br />
Den Gedanken, daß aller Reichtum <strong>und</strong> Besitz im Gr<strong>und</strong>e<br />
nur ungerechter Mammon sei, fin<strong>de</strong>n wir auch bei Klemens von<br />
Alexandrien, <strong>de</strong>r von etwa 190—202/3 in Alexandrien lehrte.<br />
Auch bei ihm fällt die rein sittliche Betrachtung <strong>de</strong>s Eigentums<br />
problems, wie die Stoa sie hatte, auf. Es ist schon ein echt stoi<br />
scher, nicht erst christlicher Gedanke, daß nicht <strong>de</strong>r Reiche,<br />
son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r gute Mensch <strong>de</strong>r wertvolle Mensch sei. Mit <strong>de</strong>r<br />
Stoa unterstreicht Klemens das „Adiaphoron", die gleichgültige<br />
Gesinnung gegenüber Reichtum <strong>und</strong> Genuß. Der schlecht ver<br />
waltete Reichtum wird als eine „Akropolis <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>" bezeich<br />
net, die Liebe zum Geld als die „Mutterstadt aller Übel" (Dioge<br />
nes aus <strong>de</strong>r kynischen Schule). Ganz stoisch ist die Lehre, daß<br />
<strong>de</strong>r beste Reichtum die Armut an Begier<strong>de</strong>n sei. Es ist klar, daß<br />
Klemens, <strong>de</strong>r in diesen Gedankengängen sich heimisch fühlt,<br />
<strong>de</strong>n Überfluß verwerfen, ja überhaupt die Güter als für die<br />
Gemeinschaft bestimmt bezeichnen muß. Er ist sehr stark be-<br />
einflußt durch das stoische Dogma, daß es von Natur kein Pri<br />
vateigentum gebe, daß Eigentum eigentlich erst durch <strong>de</strong>n<br />
guten Gebrauch zustan<strong>de</strong> komme. Der Stoiker Chrysipp war<br />
z. B. <strong>de</strong>r Meinung, daß <strong>de</strong>m Bösen nichts nützlich sein <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Schlechte keinen wirklichen Gebrauch von <strong>de</strong>n Dingen machen<br />
370
könne, <strong>de</strong>mgemäß besitze <strong>de</strong>r Gute niemals etwas Frem<strong>de</strong>s. 66. 1/2<br />
Klemens übernimmt diese Philosophie <strong>und</strong> verbin<strong>de</strong>t sie mit<br />
<strong>de</strong>m Ausspruch <strong>de</strong>s Evangeliums vom „ungerechten Mammon"<br />
(Lk 16,9) <strong>und</strong> <strong>de</strong>m christlichen Gedanken, daß man, um eine<br />
gute Tat zu setzen, also um guten Gebrauch von <strong>de</strong>n Dingen zu<br />
machen, eigentlich Christ sein müsse. So bleibt im Gr<strong>und</strong>e <strong>de</strong>r<br />
unangefochtene Besitz <strong>de</strong>m Christen vorbehalten. Daß nur die<br />
Christen Güter eigentlich erwerben können, erklärt Klemens<br />
außer<strong>de</strong>m mit einer typisch theologischen Wendung, daß näm<br />
lich Gott <strong>de</strong>n Christen alles auf <strong>de</strong>ren Bitte hin gewähre. Darum<br />
gehöre alles <strong>de</strong>n Gottesfürchtigen. 7 Es wird von dieser Schau<br />
weise noch mehrmals die Re<strong>de</strong> sein. Sie steht in engem Zusam<br />
menhang mit <strong>de</strong>r christlichen Bewertung <strong>de</strong>s sittlichen Lebens<br />
<strong>de</strong>s Hei<strong>de</strong>n. Eine rein theologische Sicht, die alles vom Ewig<br />
keitswert her sieht, kann in <strong>de</strong>r auch noch so guten natürlich<br />
sittlichen Tat keinen Wert erkennen, wenn sie nicht begna<strong>de</strong>t<br />
ist. Das Problem hat vor allem Augustinus beschäftigt <strong>und</strong><br />
wur<strong>de</strong> endgültig dann von Thomas mit klarer Unterscheidung<br />
zwischen philosophischem <strong>und</strong> theologischem Wert gelöst in<br />
I—II 65,2 (vgl. Kommentar in DT, Bd. 11, 618ff.).<br />
Die rein theologische, d. h. die vertikale Sicht tritt bei Orige-<br />
nes, <strong>de</strong>m Schüler von Klemens von Alexandrien, noch <strong>de</strong>utlicher<br />
hervor. Das Mißtrauen gegen <strong>de</strong>n Reichtum steigert sich hier<br />
zur fast völligen Mißachtung. Gegen Celsus, nach <strong>de</strong>ssen<br />
Ansicht alles Irdische zunächst <strong>de</strong>m König verliehen ist, so daß<br />
wir das, was wir besitzen, diesem zu verdanken haben, betont<br />
Origenes, daß wir die Güter unmittelbar von Gott, durch Seine<br />
Vorsehung besitzen. An sich drückt hiermit Origenes eine phi<br />
losophische Lehre aus. Doch macht seine Ansicht <strong>de</strong>n Eindruck<br />
einer Parallele zum theokratischen Staatsgedanken in Israel.<br />
Der Kampf gegen Reichtum <strong>und</strong> Luxus führt bei Tertullian<br />
dazu, daß das I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>r christlichen Gemeinschaft auch auf die<br />
Gemeinsamkeit <strong>de</strong>r Familiengüter ausge<strong>de</strong>hnt wird. Man spürt<br />
hier <strong>de</strong>utlich die Begeisterung für die wirtschaftliche Regelung,<br />
wie sie in <strong>de</strong>r Urgemein<strong>de</strong> von Jerusalem in Übung war. Die<br />
Pflicht zur Liebe erscheint als Gesetz. Der Christ soll nicht nur<br />
nicht Zins verlangen, son<strong>de</strong>rn auch <strong>de</strong>mjenigen gerne leihen,<br />
von <strong>de</strong>m er das Geliehene aller Wahrscheinlichkeit nach nicht<br />
mehr zurückerhalten wird.<br />
7 Vgl. O. Schilling, Der kirchliche Eigentumsbegriff, Freiburg 1930,37,43.<br />
371
66. 1/2 Cyprians Lehre trägt die Züge <strong>de</strong>r Tertullianschen Doktrin.<br />
Die Pflichten <strong>de</strong>m Nächsten gegenüber wer<strong>de</strong>n in schärfsten<br />
Worten eingeprägt. Er meint sogar, daß die Sorge um eine kin<br />
<strong>de</strong>rreiche Familie <strong>de</strong>n Familienvater von <strong>de</strong>r Pflicht <strong>de</strong>s Almo<br />
sens nicht entbin<strong>de</strong>. Im Gegenteil böte sich gera<strong>de</strong> dann Gele<br />
genheit, durch reichlicheres Almosengeben die eigene zahl<br />
reiche Schar Gott anzuempfehlen (De op. et eleemos., c. 16 u.<br />
18; PL 4,637ff.). Uberweise, so rät Cyprian, <strong>de</strong>ine Schätze, die<br />
du für die Erben aufbewahrst, Gott. „Er sei <strong>de</strong>iner Kin<strong>de</strong>r Vor<br />
m<strong>und</strong>... Das Gott anvertraute Vermögen entreißt we<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Staat, noch zieht <strong>de</strong>r Fiskus es ein" (a.a.O. c. 19).<br />
Der Lehre vom gemeinsamen Gebrauch aller Dinge, wie wir<br />
sie in Art. 2 unserer Frage bei Thomas fin<strong>de</strong>n, begegnen wir bei<br />
Cyprian in einer eigenartigen Formulierung: „Quodcumque<br />
Dei est, in nostra usurpatione commune est" (De op. et elee<br />
mos., c. 25). L. Brentano 8 sucht hier kommunistische Gedanken<br />
<strong>und</strong> übersetzt: „Alles, was Gottes ist, ist uns, die wir es usur<br />
piert haben, zu gemeinsamem Gebrauch gegeben". Doch<br />
scheint Cyprian unter „usurpatio" hier nichts an<strong>de</strong>res zu verste<br />
hen als „Ben<strong>utz</strong>ung". Es wäre allerdings nicht ausgeschlossen,<br />
daß wir hier <strong>de</strong>nselben Begriff haben, wie wir ihm bei Ambrosius<br />
begegnen (vgl. unten).<br />
Laktanz, <strong>de</strong>r tüchtige Kenner <strong>de</strong>r klassischen Literatur, erin<br />
nert mit seinem Begriff <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>r damit ver<br />
b<strong>und</strong>enen Auffassung von <strong>de</strong>r Gleichheit aller an seine griechi<br />
schen Vorbil<strong>de</strong>r. Er bewegt sich zwischen Plato einerseits, Ari<br />
stoteles <strong>und</strong> Cicero an<strong>de</strong>rerseits, wobei typisch Christliches, wie<br />
z. B. die Vorstellung von Gott als <strong>de</strong>m Herrn <strong>de</strong>r Welt <strong>und</strong> aller<br />
Dinge, sich einfügt. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> ist bei ihm <strong>de</strong>r Inbegriff<br />
<strong>de</strong>r Tugen<strong>de</strong>n. Innerhalb <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> nehmen Frömmig<br />
keit <strong>und</strong> Gotteserkenntnis sowie die ciceronianische Tugend<br />
<strong>de</strong>r „aequabilitas", d. h. die Bereitschaft, sich mit je<strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn<br />
zu verständigen, die vornehmste Stelle ein. Vor Gott sind alle<br />
Menschen gleich. Es kann sich keiner über <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rn erheben.<br />
Keiner ist von <strong>de</strong>n göttlichen Wohltaten ausgeschlossen. Allen<br />
leuchtet die Sonne, für alle spru<strong>de</strong>ln die Quellen, allen ist Nah<br />
rung gegeben, alle dürfen die Ruhe <strong>de</strong>s Schlafes genießen. Nie-<br />
Die wirtschaftlichen Lehren <strong>de</strong>s christlichen Altertums. Sitzungsbericht <strong>de</strong>r<br />
philosophisch-philologischen Klasse <strong>de</strong>r k. bayr. Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften,<br />
Jhg. 1902, München 1903, 151. Vgl. O.Schilling a. a.O. 59.<br />
372
mand ist vor Gott Sklave, niemand Herr. Die stoische Auffassung<br />
<strong>de</strong>r Menschenrechte wird hier gänzlich ins Theologische<br />
übertragen. Die Darstellung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> bei Laktanz sieht<br />
allerdings entsprechend <strong>de</strong>m platonischen Vorbild sehr nach<br />
Kommunismus aus. Doch ist Laktanz geistiger, weniger wirtschaftlich<br />
zu verstehen. Er besieht die platonische Gütergemeinschaft<br />
mit kritischen Augen, wenngleich er — übrigens mit<br />
<strong>Recht</strong> — meint, daß dieser Kommunismus im Bereich <strong>de</strong>s Gel<strong>de</strong>s<br />
vielleicht noch erträglich wäre im Gegensatz zur Weibergemeinschaft<br />
<strong>de</strong>r platonischen I<strong>de</strong>ologie. Im übrigen ist <strong>de</strong>r Begriff<br />
<strong>de</strong>r Gleichheit bei Laktanz doch mehr aristotelisch als platonisch<br />
gefärbt. Es han<strong>de</strong>lt sich nicht um eine Gleichheit im<br />
materiellen Sinn, son<strong>de</strong>rn um eine Gleichheit <strong>de</strong>r persönlichen<br />
Wür<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s rechtlichen Trägers. Im Anschluß an die Fabel vom<br />
saturnischen Zeitalter kommt Laktanz auf <strong>de</strong>n Urzustand im<br />
Paradies zu sprechen <strong>und</strong> meint, daß damals die einzelnen ihre<br />
Früchte nicht gehortet, son<strong>de</strong>rn mit Freigebigkeit <strong>de</strong>n Armen<br />
mitgeteilt hätten. Er <strong>de</strong>nkt also an einen Kommunismus aus<br />
Liebe, nicht aus Zwang.<br />
Nicht unerwähnt sollen die Rekognitionen bleiben, eine<br />
Schrift aus 10 Büchern, die <strong>de</strong>m hl. Klemens von Rom zugeschrieben<br />
wur<strong>de</strong>, aber ins vierte (o<strong>de</strong>r schon ins dritte) Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
gehört. Dort (c.X) steht ein Satz, <strong>de</strong>m einige Aufmerksamkeit<br />
gebührt, weil er als klementinische Lehre im Dekret<br />
Gratians (p.II, causa XII, q. l,c. 1; Frdbl, 676) erwähnt <strong>und</strong><br />
dann als klementinisches Gedankengut durch das ganze Mittelalter<br />
geschleppt wird: „In Ungerechtigkeit nennt <strong>de</strong>r eine dies,<br />
<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re jenes sein eigen, <strong>und</strong> so ist unter <strong>de</strong>n Menschen die<br />
Teilung eingetreten". Diese Worte wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Rekognitionen<br />
einem Hei<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n M<strong>und</strong> gelegt. Die Sün<strong>de</strong> wird also für die<br />
Aufteilung <strong>de</strong>r Güter in Privateigentum verantwortlich gemacht.<br />
Wir fin<strong>de</strong>n diesen Gedanken mit aller Deutlichkeit ausgesprochen<br />
bei Gregor von Nazianz. Er hat namentlich die<br />
Scholastik beschäftigt in <strong>de</strong>r Frage, ob <strong>de</strong>r Mensch im paradiesischen<br />
Zustand Privateigentum besessen habe. 9 Abgesehen von<br />
Piatons kommunistischer I<strong>de</strong>ologie fin<strong>de</strong>n wir diesen Gedanken<br />
bereits bei <strong>de</strong>n Hei<strong>de</strong>n Cicero, Seneca <strong>und</strong> Posidonius.<br />
9 Vgl. hierzu die ausgezeichnete Arbeit von William J. McDonald, Communism<br />
in E<strong>de</strong>n? in: The New Scholasticism XX (1946) 101-125.<br />
373
66. 1/2 Cicero sagt ausdrücklich: „Alles Private stammt nicht aus <strong>de</strong>r<br />
Natur" (De offic. 1,7; vgl. ebenso 1,16; Seneca, Epist. IV, 10;<br />
XIV, 2).<br />
Cyrill von Jerusalem, <strong>de</strong>r zwar gegen die Manichäer die Gut<br />
heit <strong>de</strong>r materiellen Dinge verteidigt, lehnt sich doch engstens<br />
an die stoische Lehre an, wonach die Güter nur zu edlem<br />
Gebrauch erworben wer<strong>de</strong>n. Man wird an Klemens von Alexan<br />
drien erinnert, wenn Cyrill aus <strong>de</strong>r Septuaginta (Spr 17,6) <strong>de</strong>n<br />
Text zitiert: „Dem Gläubigen gehört die ganze Welt mit ihren<br />
Schätzen, <strong>de</strong>m Ungläubigen auch nicht ein Obolus" (Cat. 5,2;<br />
PG 33,632).<br />
Basilius d. Gr. zeigt dieselbe Gr<strong>und</strong>anschauung. Die Güter<br />
dürfen nicht totes Kapital bleiben. „Wer<strong>de</strong>n Brunnen ausge<br />
schöpft, so geben sie reichlicheres Wasser, wer<strong>de</strong>n sie aber nicht<br />
benützt, so wird das Wasser faul. So ist auch <strong>de</strong>r Reichtum,<br />
wenn er ruhig daliegt, unnütz, wird er aber aufgerüttelt <strong>und</strong><br />
geht er von einem zum an<strong>de</strong>rn, so wird er gemeinnützig <strong>und</strong><br />
fruchtreich" (In Luc. 12,18: 5, PG 31,272; 3,PG 31,265). Der<br />
Mensch ist auch hier nur von Gott bestellter Verwalter, nicht<br />
Besitzer <strong>de</strong>r Güter. Aus <strong>de</strong>r inneren Bestimmung <strong>de</strong>r Güter,<br />
<strong>de</strong>m Menschen zu dienen, folgert Basilius, daß ein je<strong>de</strong>r sich in<br />
<strong>de</strong>n Grenzen <strong>de</strong>s Notwendigen halte. Prächtige Klei<strong>de</strong>r, kost<br />
bare Hauseinrichtungen, Marmor an Häusern, großer Besitz an<br />
Pfer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Dienerschaft wer<strong>de</strong>n verurteilt, wie ähnlich Plato<br />
<strong>de</strong>n Luxus als Fieberzustand <strong>de</strong>r Gesellschaft kritisierte. Den<br />
Naturzustand sieht Basilius wie ähnlich Plato in <strong>de</strong>r Gemein<br />
samkeit <strong>de</strong>r Güter. Den Plan <strong>de</strong>r Natur liest er aus <strong>de</strong>m Tier<br />
reich ab: die Fische befolgen in allem, was sie tun, das in sie<br />
gelegte Gesetz <strong>de</strong>r Natur. Und wir? Wir teilen die Er<strong>de</strong>, fügen<br />
Haus an Haus, Acker an Acker, um <strong>de</strong>n Nächsten zu berauben<br />
(Horn. 7 in Hexaem. 3—4; PG 29,156). Basilius rühmt die sozia<br />
len Einrichtungen <strong>de</strong>r Hellenen, wobei er an die Tischgemein<br />
schaft (Syssitien) <strong>de</strong>r Spartaner<strong>und</strong> Kreter dachte (PG 31,326).<br />
Er feiert das Beispiel <strong>de</strong>r ersten Christengemein<strong>de</strong> in Jerusalem.<br />
All das, um die ursprüngliche Bestimmung <strong>de</strong>r materiellen<br />
Güter (Dienst an <strong>de</strong>r Menschheit) darzustellen. Kennzeichnend<br />
ist folgen<strong>de</strong> Stelle: „Wer einem ein Kleid wegnimmt, wird Dieb<br />
genannt; wer aber <strong>de</strong>n Nackten nicht klei<strong>de</strong>t, obgleich er es<br />
könnte, verdient er eine an<strong>de</strong>re Bezeichnung? Dem Hungern<br />
<strong>de</strong>n gehört das Brot, das du zurückhältst, <strong>de</strong>m Unbeklei<strong>de</strong>ten<br />
das Kleid, das du im Schrank hütest, <strong>de</strong>m Barfüßigen <strong>de</strong>r<br />
374
Schuh, <strong>de</strong>r bei dir vermo<strong>de</strong>rt, <strong>de</strong>m Bedürftigen das Geld, das du 66. 1/2<br />
vergraben hütest. So han<strong>de</strong>lst du an allen diesen unrecht, <strong>de</strong>nen<br />
du helfen könntest" (PG 31,277). In diese Gedankengänge paßt<br />
natürlich nur die Auffassung von <strong>de</strong>r ursprünglichen Gemein<br />
schaft nicht nur in sozialer, son<strong>de</strong>rn auch in wirtschaftlicher<br />
Hinsicht. Beson<strong>de</strong>rer Erwähnung bedarf hier jene berühmt<br />
gewor<strong>de</strong>ne, auch von Thomas (Art. 2, Einw. 2) zitierte Stelle, an<br />
welcher Basilius das bei Cicero (De fin. 3,20) überlieferte Bei<br />
spiel <strong>de</strong>s Stoikers Chrysipp von <strong>de</strong>n Theaterbesuchern anführt:<br />
„Wem, sagt er (<strong>de</strong>r Habsüchtige), tue ich unrecht, wenn ich das<br />
Meinige behalte? Aber sage mir, was ist <strong>de</strong>in? Woher hast du es<br />
genommen <strong>und</strong> in <strong>de</strong>in Leben gebracht? Gera<strong>de</strong> so wie einer,<br />
<strong>de</strong>r im Theater einen Sitz einnähme <strong>und</strong> dann die später Eintre<br />
ten<strong>de</strong>n fernhielte, als sein eigen ansehend, was allen zu gemein<br />
samem Gebrauche bestimmt ist. Solcher Art sind auch die Rei<br />
chen, <strong>de</strong>nn nach<strong>de</strong>m sie das Gemeinsame vorsorglich besetzt,<br />
machen sie es kraft dieser Vorwegnahme zu ihrem Eigentum.<br />
Wenn je<strong>de</strong>r nur das zur Befriedigung seines eigenen Bedarfs<br />
Erfor<strong>de</strong>rliche in Anspruch nähme <strong>und</strong> das Übrige <strong>de</strong>m ließe,<br />
<strong>de</strong>r es seinerseits braucht, dann wäre keiner reich, keiner arm"<br />
(PG 31,275). Chrysipp hatte allerdings das Beispiel im Sinne <strong>de</strong>s<br />
Privateigentums aufgefaßt: „Wie im Theater, das zwar allen<br />
gemeinsam ist, man doch jenen Platz, <strong>de</strong>n ein je<strong>de</strong>r besetzt hat,<br />
als diesem zu eigen betrachten kann, so wi<strong>de</strong>rspricht es in <strong>de</strong>r<br />
gemeinsamen Stadt o<strong>de</strong>r Welt nicht <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong>, daß einem<br />
je<strong>de</strong>n das Seine gehöre". Basilius dagegen gebraucht es im Sinne<br />
<strong>de</strong>r ursprünglichen Gemeinschaftsbestimmung <strong>de</strong>r Güter.<br />
K. Famer 10 <strong>de</strong>utet gemäß seiner kommunistischen Ten<strong>de</strong>nz<br />
diese Stelle im Sinn eines positiven Kommunismus. Und<br />
Th. Sommerlad 11 meint, Basilius sei <strong>de</strong>r erste, <strong>de</strong>r unter Auswer<br />
tung griechischer Sozialbegriffe <strong>de</strong>m Bericht <strong>de</strong>r Apostelge<br />
schichte über die Urgemein<strong>de</strong> von Jerusalem eine kommuni<br />
stische Auslegung gegeben <strong>und</strong> <strong>de</strong>mzufolge eine positiv kom<br />
munistische Wirtschaftsordnung gefor<strong>de</strong>rt habe. Mit solchen<br />
Schlüssen muß man sehr vorsichtig sein. Die Unterscheidung<br />
zwischen positivem <strong>und</strong> negativem Kommunismus ist, nicht<br />
nur <strong>de</strong>m Namen, son<strong>de</strong>rn auch <strong>de</strong>m Inhalt nach, neueren<br />
1 0 Christentum <strong>und</strong> Eigentum bis Thomas von Aquin; Mensch <strong>und</strong> Gesell<br />
schaft, hrg. von K. Farner Bd. XII, Bern 1947.<br />
11 Das Wirtschaftsprogramm <strong>de</strong>r Kirche <strong>de</strong>s Mittelalters, Leipzig 1903, 130.<br />
375
66. 1/2 Datums. Die rein ethische Betrachtung, die bei allen Kirchen<br />
vätern vorherrscht, läßt überhaupt nicht mit Klarheit die I<strong>de</strong>e<br />
eines rechtlichen, d. h. zwangsmäßigen Kommunismus zu.<br />
Wenn Basilius erklärt, alles gehöre allen, dann ist dies gr<strong>und</strong><br />
sätzlich richtig in <strong>de</strong>r theologisch-vertikalen Ordnung. Nie<br />
mand ist vor Gott Eigentümer <strong>de</strong>r Dinge. Und die Dinge sind<br />
von sich aus nieman<strong>de</strong>m zugeeignet. Darin besteht <strong>de</strong>r negative<br />
Kommunismus. Es soll sich je<strong>de</strong>r vor Gott in seinem Gewissen<br />
sagen, daß er <strong>de</strong>m Nächsten gegenüber in dieser göttlichen<br />
Sicht nur Verpflichtungen, keine <strong>Recht</strong>e hat. Steigt man dage<br />
gen in <strong>de</strong>n zwischenmenschlichen Raum hinab <strong>und</strong> betrachtet<br />
man Mensch <strong>und</strong> Mensch, sofern sie gegen sich abgegrenzte<br />
<strong>Recht</strong>sträger sind <strong>und</strong> ein je<strong>de</strong>r als ein „an<strong>de</strong>rer" <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn<br />
gegenüber erscheint, dann befin<strong>de</strong>t man sich im Gebiet <strong>de</strong>s<br />
<strong>Recht</strong>sanspruchs, in welchem rechtliche Verfolgung <strong>und</strong> Zwang<br />
möglich sind. Wer in diesem ausgesprochenen Sinne <strong>de</strong>n Kom<br />
munismus verteidigt, <strong>de</strong>r vertritt einen positiven Kommunis<br />
mus. Basilius konnte in dieser Zuspitzung das Problem noch gar<br />
nicht kennen. Dazu war die Zeit noch nicht reif. Es bedurfte<br />
schon <strong>de</strong>s ausgebauten Aristotelismus, wie wir ihm erst bei<br />
Thomas von Aquin begegnen, um die ethischen <strong>und</strong> rechtlichen<br />
Gesichtspunkte klar auseinan<strong>de</strong>rzuhalten. Basilius kommt als<br />
Prediger <strong>und</strong> Rhetor an die Frage <strong>de</strong>s Eigentums heran, etwa<br />
entsprechend <strong>de</strong>r Lehre von Plato, <strong>de</strong>r meint, <strong>de</strong>r Besitzer au<br />
ßeror<strong>de</strong>ntlichen Reichtums könne kaum ein wahrhaft vollkom<br />
mener Mensch sein; wer ehrenvoll bleibe <strong>und</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Besitze<br />
immanenten Pflicht <strong>de</strong>s Opferbringens für edle <strong>und</strong> gute<br />
Zwecke gerecht wer<strong>de</strong>, bei <strong>de</strong>m wer<strong>de</strong> es kaum zur Anhäufung<br />
übermäßiger Schätze kommen. Die Gr<strong>und</strong>anschauung ist bei<br />
Basilius <strong>und</strong> überhaupt bei <strong>de</strong>n Kirchenvätern beherrscht von<br />
<strong>de</strong>r Finalität <strong>de</strong>r materiellen Güter: <strong>de</strong>n Menschen zu dienen,<br />
nicht diesem o<strong>de</strong>r jenem, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Menschheit insgesamt.<br />
Damit ist noch gar nichts über die private Aufteilung gesagt, wie<br />
dies aus Art. 2 unserer Frage bei Thomas <strong>de</strong>utlich wird. Die<br />
Betrachtung <strong>de</strong>r Finalität ist aber eben die typisch ethische Sicht<br />
eines Problems. Wir müssen daher <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r „gemeinsa<br />
men Güter <strong>de</strong>s Lebens" als „zum gemeinsamen Gebrauch<br />
bestimmte Güter" verstehen in <strong>de</strong>m Text: „Wir müssen <strong>de</strong>njeni<br />
gen, <strong>de</strong>r Überfluß an Reichtum hat... <strong>und</strong> davon guten<br />
Gebrauch macht, lieben <strong>und</strong> achten als einen Mann, <strong>de</strong>r die<br />
gemeinsamen Güter <strong>de</strong>s Lebens besitzt, sie aber auch auf die<br />
376
echte Weise handhabt, in<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>m Dürftigen von seinem<br />
Geld reichlich spen<strong>de</strong>t... <strong>und</strong> seine übrige Habe nicht so sehr<br />
für seine als <strong>de</strong>r Dürftigen Eigentum ansieht" (De invidia 5; PG<br />
31,384).<br />
Während Basilius sich noch hellenistischer Gedankengänge<br />
bedient, ist Gregor von Nazianz völlig theologisch eingestellt.<br />
Der negative Kommunismus wird hier aus <strong>de</strong>m Bericht <strong>de</strong>r<br />
Genesis (1—3) über die Erschaffung <strong>de</strong>r Welt <strong>und</strong> <strong>de</strong>s ersten<br />
Menschenpaars sowie <strong>de</strong>ssen erster Sün<strong>de</strong> geschöpft. „Anfangs<br />
war es nicht so"! Nach Ansicht von Gregor von Nazianz hat<br />
Gott ursprünglich alles unterschiedslos allen zur Verfügung<br />
gestellt <strong>und</strong> nichts <strong>de</strong>r menschlichen Willkür o<strong>de</strong>r menschlicher<br />
Gesetzgebung unterworfen. Reichtum <strong>und</strong> Armut sind eine<br />
Erscheinung <strong>de</strong>r Bosheit <strong>und</strong> Schwäche <strong>de</strong>s Menschen. Gregor<br />
nimmt diesen Zustand <strong>de</strong>r privaten Eigentumsordnung hin. Er<br />
<strong>de</strong>nkt nicht daran, ihn irgendwie auf <strong>de</strong>m Wege sozialer<br />
Zwangsmaßnahmen abzuschaffen, son<strong>de</strong>rn möchte nur durch<br />
die Erinnerung an <strong>de</strong>n ursprünglichen Zustand <strong>de</strong>r Güterge<br />
meinschaft die Reichen ermahnen, freiwillig von ihrem Reich<br />
tum abzugeben. Man wird also auch hier angesichts <strong>de</strong>r rein<br />
ethischen Betrachtung nicht von einem positiven Kommunis<br />
mus sprechen können.<br />
Bei Gregor von Nyssa, <strong>de</strong>m um vieles jüngeren Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s hl.<br />
Basilius, verbin<strong>de</strong>t sich die stoische Auffassung von <strong>de</strong>n glei<br />
chen Menschenrechten aller mit <strong>de</strong>m christlichen Gedanken,<br />
daß wir alle in gleicher Weise Kin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>sselben Vaters seien.<br />
Gott wird als <strong>de</strong>r eigentliche Eigentümer bezeichnet, darum soll<br />
keiner mehr beanspruchen als <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re. Die Lehre vom<br />
Eigentumserwerb durch <strong>de</strong>n rechten Gebrauch wird hier abge<br />
schwächt <strong>und</strong> in die paulinische Ermahnung verwan<strong>de</strong>lt:<br />
„Mache Gebrauch, aber treibe keinen Mißbrauch" (De pauperi-<br />
bus amandis; or. 1: PG 46,465).<br />
Johannes Chrysostomus macht mit <strong>de</strong>r christlichen Lehre, daß<br />
wir vor Gott niemals als eigenmächtige Eigentümer auftreten<br />
können, am konsequentesten Ernst. Der rechtliche Gedanke <strong>de</strong>r<br />
zwischenmenschlichen Beziehung tritt völlig zurück. Mensch<br />
<strong>und</strong> Mensch stehen einan<strong>de</strong>r gegenüber auf Gr<strong>und</strong> ihrer<br />
gemeinsamen Verantwortung vor Gott. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e<br />
wird die stoische Ansicht, daß die gesamte Wertung <strong>de</strong>r Eigen<br />
tumsverhältnisse nur vom richtigen, auf das Gute abzielen<strong>de</strong>n<br />
Gebrauch vorgenommen wer<strong>de</strong>n kann, ohne je<strong>de</strong> Korrektur<br />
377
übernommen: „Sage nicht, ich verzehre das Meinige. Du tust es<br />
von Frem<strong>de</strong>m. Der schwelgerische, egoistische Gebrauch<br />
macht, was <strong>de</strong>in ist, zu frem<strong>de</strong>m Gut, darum nenne ich es frem<br />
<strong>de</strong>s Gut, weil du es hartherzig verzehrst <strong>und</strong> behauptest, es sei<br />
recht, daß du allein von <strong>de</strong>m Deinigen lebest" (In ep. 1 ad Cor.,<br />
hom. 10,3; PG 61,86). Da das gesamte gesellschaftliche Leben<br />
nur von <strong>de</strong>r religiösen Ethik her gesehen wird <strong>und</strong> in dieser<br />
Ethik <strong>de</strong>r einzelne Mensch niemals als Eigentümer erscheint,<br />
son<strong>de</strong>rn nur als von Gott bestellter Verwalter, ist es klar, daß das<br />
I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>r Gütergemeinschaft nicht nur für die ursprüngliche<br />
menschliche Gesellschaft, son<strong>de</strong>rn auch für uns zu gelten hat,<br />
so daß das Privateigentum als Ordnungsprinzip abgelehnt<br />
wird. In diesem Sinn ist folgen<strong>de</strong>r, von mo<strong>de</strong>rnen Autoren<br />
fälschlicherweise rein kommunistisch verstan<strong>de</strong>ner Text aus<br />
zulegen: „Sage mir, woher stammt <strong>de</strong>in Reichtum? Du ver<br />
dankst ihn einem an<strong>de</strong>rn? Und dieser An<strong>de</strong>re, wem verdankt er<br />
ihn? Seinem Großvater, sagt man, <strong>de</strong>m Vater. Wirst du nun, im<br />
Stammbaum weiter zurückgehend, <strong>de</strong>n Beweis liefern können,<br />
daß dieser Besitz auf gerechtem Wege erworben ist? Das kannst<br />
du nicht. Im Gegenteil, <strong>de</strong>r Anfang, die Wurzel <strong>de</strong>sselben liegt<br />
notwendigerweise in einem Unrecht. Warum? Weil Gott von<br />
Anfang nicht <strong>de</strong>n einen reich, <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren arm erschaffen <strong>und</strong><br />
keine Ausnahme gemacht hat, in<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>m einen <strong>de</strong>n Weg zu<br />
Goldschätzen zeigte <strong>und</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren hin<strong>de</strong>rte, solche auf<br />
zuspüren, son<strong>de</strong>rn allen diesselbe Er<strong>de</strong> zum Besitze überlassen<br />
hat. Wenn also diese ein Gemeingut aller ist, woher hast du<br />
dann so<strong>und</strong>soviel Tagwerk davon, <strong>de</strong>in Nachbar aber keine<br />
Scholle Land? Mein Vater hat es mir vererbt, antwortet man.<br />
Von wem hat es dieser geerbt? Von seinem Vorfahren. Man<br />
kommt freilich in je<strong>de</strong>m Falle zu einem Anfang, wenn man zu<br />
rückgeht. Jakob war reich, aber sein Besitz war Arbeitslohn. Der<br />
Reichtum muß gerecht erworben sein, es darf kein Raub daran<br />
kleben. Allerdings, du bist nicht verantwortlich für das, was<br />
<strong>de</strong>in habgieriger Vater zusammengescharrt hat. Du besitzest die<br />
Frucht <strong>de</strong>s Raubes, doch <strong>de</strong>r Räuber warst du nicht. Aber zuge<br />
geben, daß auch <strong>de</strong>in Vater keinen Raub beging, son<strong>de</strong>rn daß<br />
sein Reichtum irgendwo aus <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n quoll, wie steht es<br />
dann? Macht das <strong>de</strong>n Reichtum zu einem Gut? Durchaus nicht.<br />
Aber etwas Schlechtes ist er auch nicht, sagst du. Ist man nicht<br />
habgierig, teilt man <strong>de</strong>n Bedürftigen mit, so ist er nichts<br />
Schlechtes. Ist das nicht <strong>de</strong>r Fall, so ist er schlecht <strong>und</strong> ein<br />
378
gefährlich Ding. Ja, erwi<strong>de</strong>rt man, wenn einer nichts Böses tut, 66.<br />
so ist er nicht böse, auch wenn er nichts Gutes tut. Schön! Heißt<br />
das aber nicht etwas Böses tun, wenn einer für sich allein über<br />
alles Herr sein, wenn er Gemeinsames allein genießen will?<br />
O<strong>de</strong>r ist nicht die Er<strong>de</strong> <strong>und</strong> alles, was darin ist, Eigentum Got<br />
tes? Wenn also all unser Besitz Gott gehört, gehört er auch<br />
unseren Mitbrü<strong>de</strong>rn im Dienste Gottes. Was Gott <strong>de</strong>m Herrn<br />
gehört, ist alles Gemeingut. O<strong>de</strong>r sehen wir nicht, daß es auch<br />
in einem großen Hauswesen so gehalten wird? Zum Beispiel<br />
bekommen alle das gleiche Quantum Brot. Es kommt ja aus<br />
<strong>de</strong>n Vorräten <strong>de</strong>s Herrn. Das Haus <strong>de</strong>s Herrn steht allen offen.<br />
Auch das königliche Eigentum ist Gemeingut, <strong>und</strong> Städte,<br />
Marktplätze, Arka<strong>de</strong>n gehören allen zusammen, alle haben wir<br />
daran teil. Man betrachte einmal <strong>de</strong>n Haushalt Gottes! Er hat<br />
gewisse Dinge zu einem Gemeingut gemacht, womit er das<br />
Menschengeschlecht beschämt: z. B. Luft, Sonne, Wasser, Er<strong>de</strong>,<br />
Himmel, Licht, Sterne — das verteilt er alles gleichmäßig wie un<br />
ter Brü<strong>de</strong>r. Allen schuf er dieselben Augen, <strong>de</strong>nselben Körper,<br />
dieselbe Seele; es ist bei allen dasselbe Gebil<strong>de</strong>. Von <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>,<br />
von einem einzigen Manne ließ er alle abstammen, allen wies er<br />
dasselbe Haus an. Aber all das half nichts bei uns. Gott hat auch<br />
an<strong>de</strong>re Dinge zum Gemeingut gemacht, z. B. Bä<strong>de</strong>r, Städte,<br />
Plätze, Promena<strong>de</strong>n. Und man beachte, wie es bei solchem<br />
Gemeingut keinen Ha<strong>de</strong>r gibt, son<strong>de</strong>rn alles friedlich hergeht.<br />
Sobald aber einer etwas an sich zu ziehen sucht <strong>und</strong> es zu sei<br />
nem Privateigentum macht, dann hebt <strong>de</strong>r Streit an, gleich als<br />
wäre die Natur selbst darüber empört, daß, während Gott uns<br />
durch alle möglichen Mittel friedlich beisammenhalten will, wir<br />
es auf eine Trennung voneinan<strong>de</strong>r absehen, auf Aneignung von<br />
Son<strong>de</strong>rgut, daß wir das ,Mein <strong>und</strong> Dein' aussprechen, dieses<br />
frostige Wort. Von da an beginnt <strong>de</strong>r Kampf, von da an die Nie<br />
<strong>de</strong>rtracht. Wo aber dieses Wort nicht ist, da ensteht kein Kampf<br />
<strong>und</strong> Streit. Also ist die Gütergemeinschaft in höherem Maße die<br />
angemessene Form unseres Lebens als <strong>de</strong>r Privatbesitz, <strong>und</strong> sie<br />
ist naturgemäß. Warum streitet niemand vor Gericht über <strong>de</strong>n<br />
Marktplatz? Darum nicht, weil er Gemeingut aller ist. Uber<br />
Häuser dagegen o<strong>de</strong>r über Geld sehen wir ewige Gerichtspro<br />
zesse. Was wir nötig haben, das liegt alles da zum gemeinsamen<br />
Gebrauch; wir aber beobachten diese Gemeinsamkeit 12 nicht<br />
12 K. Farner (a. a. O. 73) übersetzt hier koinon mit „Kommunismus".<br />
379
einmal in <strong>de</strong>n kleinsten Dingen. Dafür hat Gott uns jene not<br />
wendigen Dinge vorsorglich als Gemeingut gegeben, daß wir<br />
daran lernen, auch die an<strong>de</strong>ren Dinge in gemeinschaftlicher<br />
Weise 13 zu besitzen. Doch lassen wir uns selbst auf diesem<br />
Wege nicht belehren! — Aber um auf das Gesagte zurückzu<br />
kommen: Wie wäre es <strong>de</strong>nkbar, daß <strong>de</strong>r Reiche ein guter<br />
Mensch ist? Das ist unmöglich. Gut kann er nur sein, wenn er<br />
an<strong>de</strong>ren von seinem Reichtum mitteilt. Besitzt er nichts, dann<br />
ist er gut; teilt er an<strong>de</strong>rn mit, dann ist er gut. Solange er bloß<br />
besitzt, kann er wohl kein guter Mensch sein" (In 1 ad Tim 4;<br />
PG 62,563 f.).<br />
Für das Verständnis dieses Textes ist folgen<strong>de</strong>s wichtig:<br />
Cbrysostomus beurteilt das Privateigentum einzig vom ethi<br />
schen Standpunkt aus. Der einzelne soll vor seinem Gewissen<br />
nicht meinen, er habe das Eigentum geschaffen: „Heißt es aber<br />
nicht etwas Böses tun, wenn einer für sich allein über alles Herr<br />
sein, wenn er Gemeinsames allein genießen will?" Auch die<br />
Gemeinschaft wird rein ethisch gefaßt; d. h. Sozialethik ist hier<br />
nichts an<strong>de</strong>res als die Individualethik aller. Cbrysostomus ist <strong>de</strong>r<br />
Uberzeugung, daß, wenn ein je<strong>de</strong>r für sich wirklich ethisch voll<br />
kommen leben wür<strong>de</strong>, wie man dies für <strong>de</strong>n paradiesischen<br />
Menschen auch annahm, dann wäre die Aufteilung in Privatei<br />
gentum unnütz. Die rechtliche Organisation grün<strong>de</strong>t also bei<br />
Cbrysostomus ganz auf <strong>de</strong>r Vorstellung <strong>de</strong>s ethischen I<strong>de</strong>als.<br />
Ethisch i<strong>de</strong>al ist, daß ein je<strong>de</strong>r auf das Gemeinwohl bedacht sei.<br />
Die Aneignung von materiellen Gütern zu rein persönlichen<br />
Zwecken unter Ausschluß <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren be<strong>de</strong>utet darum einen<br />
Abfall von diesem I<strong>de</strong>al <strong>und</strong> — da dieses I<strong>de</strong>al als rechtliche Ord<br />
nung supponiert wird — eine Ungerechtigkeit gegen die an<strong>de</strong>rn.<br />
Eine Ungerechtigkeit gegen das Naturrecht in unserem Sinn<br />
o<strong>de</strong>r im Sinn <strong>de</strong>s hl. Thomas? Keineswegs, weil Cbrysostomus<br />
überhaupt die Vorstellung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s nicht hat. Bei ihm wird<br />
die Ethik, wie sie für das Einzelgewissen an sich, außerhalb<br />
einer aktuellen Gesellschaft, gilt, zum zwischenmenschlichen<br />
Gesetz gemacht, so daß je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r diese moralische For<strong>de</strong>rung<br />
nicht erfüllt, unmittelbar auch ungerecht gegen die Gemein<br />
schaft wird. Cbrysostomus fragt darum gar nicht danach, wie <strong>de</strong>r<br />
Gute, <strong>de</strong>r wirklich alles ins Gemeinwohl trägt <strong>und</strong> durch die<br />
Trägheit <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren benachteiligt ist, zu seinem <strong>Recht</strong> komme.<br />
380<br />
Bei K.Farner (a. a. O.): „In kommunistischer Weise".
Daß <strong>de</strong>r eine o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re das sittliche Gesetz seines Gewissens<br />
nicht erfüllt, kann für Cbrysostomus noch kein Anlaß sein, eine<br />
zwischenmenschliche Regelung zu suchen, welche allen per<br />
sönlichen rechtlichen Ansprüchen am besten gerecht <strong>und</strong> so<br />
eine sozialrechtliche Ordnung verwirklichen wür<strong>de</strong>, die von <strong>de</strong>r<br />
rein sozialethischen unterschie<strong>de</strong>n ist, wenngleich sie dieser<br />
wohl nie entraten kann. Thomas, so wer<strong>de</strong>n wir sehen, hat diese<br />
Lösung gesucht <strong>und</strong> auch in etwa gef<strong>und</strong>en, allerdings noch<br />
nicht so weit durchgeführt, wie die mo<strong>de</strong>rne, etwa leoninische<br />
Auffassung vom Naturrecht auf Privateigentum. Mit an<strong>de</strong>rn<br />
Worten: Cbrysostomus hat die reine Ethik <strong>de</strong>s Gesellschaftli<br />
chen im Auge, <strong>und</strong> das unter Zugr<strong>und</strong>elegung eines irrealen<br />
Menschentyps, nämlich <strong>de</strong>s nicht mehr existieren<strong>de</strong>n paradiesi<br />
schen Menschen. Man kann ihn also nicht im heutigen Sinn <strong>de</strong>s<br />
Worts als einen Kommunisten bezeichnen. Er bleibt durch <strong>und</strong><br />
durch Ethiker, ist nie, auf keiner Seite, eigentlich naturrechtli<br />
cher Sozialpolitiker. Allerdings hat Cbrysostomus sattsam die<br />
Bosheit <strong>de</strong>r Menschen erfahren müssen <strong>und</strong> so aus unmittelba<br />
rer Lebensnähe die tatsächliche Entfernung vom paradiesischen<br />
Menschen festgestellt. Dennoch liegt seinem Ordnungsplan<br />
eben ein hochgespanntes ethisches Soll zugr<strong>und</strong>e, für <strong>de</strong>ssen<br />
Verwirklichung <strong>de</strong>r paradiesische Mensch vonnöten wäre.<br />
Wenngleich Ambrosius die kapitalistischen Äußerungen Cice-<br />
ros gegenüber <strong>de</strong>n Armen rügt <strong>und</strong> mit <strong>de</strong>m Hinweis auf das<br />
Gebot <strong>de</strong>r christlichen Liebe <strong>und</strong> Barmherzigkeit zurückweist,<br />
so bewegt er sich natürlich doch in <strong>de</strong>ssen stoischer Gr<strong>und</strong>an<br />
schauung, daß wir nur das besitzen, wovon wir Gebrauch<br />
machen. Es konnte auch nicht an<strong>de</strong>rs sein, da die stoische Lehre<br />
von <strong>de</strong>r Wertlosigkeit <strong>de</strong>r nicht benützten Güter <strong>de</strong>m christli<br />
chen Gedanken, wonach die materiellen Güter allen Menschen<br />
zum Gebrauch anheimgegeben sind, entsprach. Die Natur, so<br />
meint er, hat das allgemeine <strong>Recht</strong> hervorgebracht, die Usurpa<br />
tion hat die private Teilung geschaffen (De off. 1,28,132; PL<br />
16,67). Die Sün<strong>de</strong> spielt also in <strong>de</strong>r Einführung <strong>de</strong>s Privateigen<br />
tums die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle. Es klingt ganz nach Seneca — üb<br />
rigens paradoxerweise <strong>de</strong>r Millionär unter <strong>de</strong>n Philosophen! —,<br />
wenn Ambrosius die Habsucht für die Verteilung <strong>de</strong>r Besitz<br />
rechte verantwortlicht macht (Expos, in Ps 118,22). Das I<strong>de</strong>al<br />
ist darum <strong>de</strong>r ursprüngliche Kommunismus. O. Schilling (Der<br />
kirchliche Eigentumsbegriff, 49) meint, daß Ambrosius <strong>de</strong>n nun<br />
einmal durch <strong>de</strong>n Sün<strong>de</strong>nfall eingetretenen Zustand als<br />
381
Zustand <strong>de</strong>s sek<strong>und</strong>ären Naturrechts verstan<strong>de</strong>n habe, <strong>de</strong>n<br />
Gott angesichts <strong>de</strong>r Bosheit <strong>de</strong>r Menschen gewissermaßen legi<br />
timiert habe. Doch geht diese Auslegung weit über Ambrosius<br />
hinaus, wenngleich etwas Ahnliches sich bei Augustinus fin<strong>de</strong>t.<br />
Ambrosius war sicherlich nicht Kommunist (wiewohl er vom<br />
Eigentum als einer Usurpation spricht), da er als Nur-Ehtiker<br />
noch weit von <strong>de</strong>r rechtlichen Betrachtung <strong>de</strong>r Gesellschaft ent<br />
fernt ist. Ethisch gesehen gilt immer, daß die sorgsame, recht<br />
liche Aufteilung <strong>de</strong>r Güter in Privateigentum auf einen Abfall<br />
vom ursprünglichen I<strong>de</strong>al hinweist. Allerdings besteht dieser<br />
Abfall nicht in <strong>de</strong>r Aneignung, wie Ambrosius gemeint hat, son<br />
<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Habgier <strong>und</strong> übrigens, was immer von <strong>de</strong>n Vätern<br />
übersehen wird, auch in <strong>de</strong>r Trägheit. Die private Eigentums<br />
ordnung be<strong>de</strong>utet <strong>de</strong>n einzigen Ausweg aus <strong>de</strong>r Unordnung.<br />
Sie wird darum aus Vernunftprinzipien „gefolgert" <strong>und</strong> als<br />
solche, d. h. als durch Vernunft vollzogene Folgerung, von Tho<br />
mas zum „jus gentium" gerechnet. So hat Thomas, wie noch<br />
gezeigt wird, mit klarer Unterscheidung Ordnung in eine bisher<br />
nicht falsche, aber verschwommene Theorie vom Eigentum<br />
gebracht.<br />
Bei Augustinus, <strong>de</strong>r das gesellschaftliche <strong>und</strong> politische<br />
Geschehen unter letztem theologischem Gesichtspunkt<br />
betrachtet, mußte die stoische Lehre vom guten Gebrauch als<br />
<strong>de</strong>m einzigen Titel <strong>de</strong>r Aneignung von Gütern dahin umge<strong>de</strong>u<br />
tet wer<strong>de</strong>n, daß nur <strong>de</strong>r Gläubige Besitz erwerben könne. Augu<br />
stinus beruft sich dabei auf <strong>de</strong>n schon zitierten Text aus <strong>de</strong>r Sep-<br />
tuaginta Spr 17,6: „Dem Gläubigen gehört die ganze Welt von<br />
Schätzen, <strong>de</strong>m Ungläubigen auch nicht ein Obolus." 1 4 Wir sind<br />
diesem Gedanken bereits früher begegnet. Augustinus geht ihm<br />
noch weiter nach <strong>und</strong> erklärt, daß die Schlechten die Güter an<br />
die Guten zurückerstatten müßten, <strong>de</strong>nen sie im eigentlichen<br />
Sinne gehörten. Allerdings wür<strong>de</strong>n es wohl, so meint er, nur<br />
wenige sein, <strong>de</strong>nen eine solche Rückerstattung zuteil wer<strong>de</strong>n<br />
wür<strong>de</strong>, weil es faktisch nur wenige sind, die gut mit <strong>de</strong>n Dingen<br />
umzugehen wüßten. „Unter diesen Umstän<strong>de</strong>n aber dul<strong>de</strong>t<br />
man die Ungerechtigkeit <strong>de</strong>r schlechten Besitzer <strong>und</strong> stellt zwi<br />
schen ihnen gewisse <strong>Recht</strong>e fest, die bürgerliche <strong>Recht</strong>e heißen,<br />
14 Vgl. auch Spr 13,22: „Ein Erbe hinterläßt <strong>de</strong>r Heilige <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>skin<strong>de</strong>rn.<br />
382<br />
Dem Frommen ist <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs Habe vorbehalten."
nicht als ob diese bewirkten, daß sie einen guten Gebrauch<br />
machen, son<strong>de</strong>rn damit jene, die einen schlechten Gebrauch<br />
machen, min<strong>de</strong>r lästig seien. Dieser Zustand dauert so lange, bis<br />
die Gläubigen <strong>und</strong> Frommen — <strong>de</strong>nen von <strong>Recht</strong>s wegen alles<br />
gehört <strong>und</strong> die entwe<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Schar jener hervorgehen o<strong>de</strong>r<br />
unter ihnen eine Zeitlang leben, aber sieb nicht in ihre Übeltaten<br />
verstricken lassen, son<strong>de</strong>rn dadurch erprobt wer<strong>de</strong>n — zu <strong>de</strong>r<br />
Stadt gelangen, wo ihr ewiges Erbteil sich befin<strong>de</strong>t, wo nur <strong>de</strong>r<br />
Gerechte einen Platz hat <strong>und</strong> nur <strong>de</strong>r Weise die Regierung, wo<br />
alle Bewohner in Wahrheit ihr Eigentum besitzen" (Ep.<br />
153,6,26; PL 32,665; vgl. auch Sermo 50,2,4; PL 38,327).<br />
Augustinus scheint sich also mit <strong>de</strong>m Zustand <strong>de</strong>r privaten<br />
Eigentumsordnung abzufin<strong>de</strong>n. Doch bezeichnet er diesen<br />
Zustand nicht als Naturrecht, auch nicht als sek<strong>und</strong>äres Natur<br />
recht, son<strong>de</strong>rn sieht in ihm vielmehr einen durch die Bosheit <strong>de</strong>r<br />
Menschen notwendig gewor<strong>de</strong>nen, aber in sich nicht schlechten<br />
Zustand, weil in ihm immerhin das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Guten einigerma<br />
ßen gerettet wird. Er kommt aber noch nicht so weit, diesen<br />
Zustand, wie später Thomas, als „vernünftig" zu bezeichnen.<br />
Da <strong>de</strong>r gute Gebrauch <strong>de</strong>n Titel <strong>de</strong>s Eigentumserwerbs aus<br />
macht, ergibt sich für Augustinus ohne weiteres, daß <strong>de</strong>r Über-<br />
fluß nie rechtmäßiger Besitz wer<strong>de</strong>n kann: „Frem<strong>de</strong>s besitzt,<br />
werÜberfluß besitzt" (De bono conj. 14,16; PL 40,384). Aber<br />
auch hier ist nicht an ein eigentlich zwischenmenschliches<br />
<strong>Recht</strong>sverhältnis gedacht, son<strong>de</strong>rn an die typisch theologisch<br />
vertikale Sicht, wonach vor <strong>de</strong>m Gewissen nur jener Besitzer<br />
sein kann, <strong>de</strong>r die Dinge gemäß <strong>de</strong>n ewigen Sittengesetzen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>m Willen Gottes benützt. Der Reiche ist daher vor Gott unge<br />
recht, solange er <strong>de</strong>n Überfluß behält. Thomas fin<strong>de</strong>t dafür die<br />
viel diskutierte Formulierung: „ Der Überfluß, <strong>de</strong>n einige<br />
haben, ist auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Naturrechts <strong>de</strong>m Unterhalt <strong>de</strong>r<br />
Armen geschul<strong>de</strong>t" (Art. 7).<br />
An die augustinische Ansicht, daß das Privateigentum eine<br />
Einrichtung <strong>de</strong>s bürgerlichen Lebens, nicht aber <strong>de</strong>s Natur<br />
rechts sei, knüpft das Dekret Gratians an: „Gemäß <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong><br />
<strong>de</strong>r Natur ist alles allen gemeinsam... Durch das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r<br />
Gewohnheit o<strong>de</strong>r das gesatzte <strong>Recht</strong> ist dies mein, jenes einem<br />
an<strong>de</strong>rn" (Init. D. VIII; Frdbl, 12). Gratian weist dabei auf die<br />
Urgemein<strong>de</strong> von Jerusalem hin <strong>und</strong> erinnert an die Philoso<br />
phen, von <strong>de</strong>nen diese Lehre stamme: „Darum wird gemäß<br />
Überlieferung seit Plato jener Staat als am gerechtesten geord-<br />
383
66. 1/2 net bezeichnet, in <strong>de</strong>m niemand persönliche Triebe kennt"<br />
(a.a.O.).<br />
Die starke Befürwortung <strong>de</strong>s ursprünglichen Zustands <strong>de</strong>r<br />
Gütergemeinschaft konnte zur Zeit <strong>de</strong>r Väter nicht scha<strong>de</strong>n, da<br />
es dort darum ging, schwerste Mißstän<strong>de</strong> zu geißeln <strong>und</strong> die<br />
Reichen zum Wohltun anzueifern. Es lag durchaus nicht in <strong>de</strong>r<br />
Absicht <strong>de</strong>r Väter, eine sozialpolitische Aktion zu unterneh<br />
men, son<strong>de</strong>rn Bußprediger zu sein im Sinn <strong>de</strong>r im Neuen B<strong>und</strong><br />
verkün<strong>de</strong>ten Liebe. Ganz an<strong>de</strong>rs verhält es sich in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s<br />
Mittelalters, als die verschie<strong>de</strong>nen spiritualistischen Armutsbe<br />
wegungen, wie z. B. die <strong>de</strong>r Wal<strong>de</strong>nser, aus ihrem zunächst<br />
geschlossenen Raum sozialpolitische Bewegungen zu entfes<br />
seln drohten. Die Gruppe um Girald von Monteforte in <strong>de</strong>r<br />
Gegend von Turin (1130) hatte <strong>de</strong>n typischen Charakter einer<br />
kommunistischen Bewegung. Die Wal<strong>de</strong>nser, obwohl zunächst<br />
nur geistige Erneuerer im Sinn <strong>de</strong>r moralischen Ausstrahlung<br />
eines Or<strong>de</strong>ns, lassen die sozialpolitische Propaganda in ihrem<br />
Programm nicht vermissen. Thomas hat dies alles mit feinem<br />
Gespür gefühlt <strong>und</strong> darum seiner Lehre vom Eigentum eine<br />
ganz an<strong>de</strong>re Färbung gegeben als etwa die Kirchenväter, vorab<br />
Cbrysostomus (vgl. Art. 2 Dagegen)./. D. Kraus kommt auf die<br />
ses zeitgeschichtliche Element <strong>de</strong>r thomasischen Eigentums<br />
lehre zu sprechen: „Zur Zeit <strong>de</strong>s hl. Thomas hatte die Fragestel<br />
lung nach <strong>de</strong>r Erlaubtheit <strong>de</strong>s Privateigentums auch einen prak<br />
tischen Hintergr<strong>und</strong>. In <strong>de</strong>r Provence verurteilten die Wal<strong>de</strong>n<br />
ser, die Saccati, in Oberitalien die schwärmen<strong>de</strong>n Bettelscharen<br />
<strong>de</strong>r Jombardiscben Armen' allen Privatbesitz <strong>und</strong> predigten<br />
Gütergemeinschaft, <strong>und</strong> innerhalb <strong>de</strong>s Franziskaneror<strong>de</strong>ns gab<br />
es unter <strong>de</strong>m Generalat Bonaventuras, <strong>de</strong>s Fre<strong>und</strong>es von Tho<br />
mas, eine schwere Krise im Streite über die Erlaubtheit von<br />
Or<strong>de</strong>nseigentum. Wie stark das Problem nachzitterte, sollte <strong>de</strong>r<br />
bald danach entbrennen<strong>de</strong> Kampf <strong>de</strong>r Spiritualen, <strong>de</strong>r Fraticelli<br />
<strong>und</strong> Begbinen offenbaren, <strong>de</strong>n selbst das Eingreifen <strong>de</strong>s Papstes<br />
Jobann XXII. nicht zum Stillstand brachte" (Scholastik, Purita-<br />
nismus <strong>und</strong> Kapitalismus, München <strong>und</strong> Leipzig 1930, 25).<br />
384
4. DIE LEHRE ÜBER DAS EIGENTUM BEIM HL. THOMAS<br />
a) Der Zweck <strong>de</strong>r Güterwelt. Ihre soziale Bestimmung<br />
Ubersieht man die gesamte Entwicklung <strong>de</strong>r christlichen 66. 1/2<br />
Lehre vom Eigentum bis zu Thomas von Aquin, dann wird man<br />
von selbst zur Überzeugung kommen, daß etwa die Formulie<br />
rung eines Traktats wie „Das <strong>Recht</strong> auf Privateigentum beim hl.<br />
Thomas von Aquin" von vornherein <strong>de</strong>n Gesichtspunkt etwas<br />
verschiebt. Denn diese Formulierung ist schon zu sehr von <strong>de</strong>r<br />
mo<strong>de</strong>rnen Sicht her beeinflußt, in welcher <strong>de</strong>r einzelne Mensch<br />
als individueller Besitzer gegen <strong>de</strong>n Nächsten <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Staat<br />
auftritt. Thomas konnte niemals von diesem Standort her kom<br />
men. Ihm lagen als Traktan<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Diskussion folgen<strong>de</strong> Punkte<br />
vor: l.Die Lehre <strong>de</strong>s negativen Kommunismus, gemäß wel<br />
chem keine Güter von sich aus irgen<strong>de</strong>inem Menschen zugeeig<br />
net, son<strong>de</strong>rn alle gr<strong>und</strong>sätzlich allen zur Verfügung gestellt<br />
sind. 2. Die ethische Wertung, daß an sich <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>alzustand <strong>de</strong>r<br />
Güterordnung die kollektive Bewirtschaftung wäre, wenn die<br />
Menschheit nicht gesündigt hätte. Diese bei<strong>de</strong>n Punkte sind<br />
durchgängige Lehren <strong>de</strong>r christlichen Tradition. 3. Die histo<br />
rische Situation <strong>de</strong>r Zeit, in welcher die Leugnung <strong>de</strong>s privaten<br />
Besitzes durch die Spiritualisten eine gr<strong>und</strong>sätzliche Ümkeh-<br />
rung <strong>de</strong>r sozialen Ordnung gebracht hätte. Es konnte also Tho<br />
mas nicht darum gehen, das Eigentumsrecht <strong>de</strong>s einzelnen<br />
nachzuweisen, son<strong>de</strong>rn unter <strong>de</strong>r Wahrung <strong>de</strong>r Gedanken <strong>de</strong>r<br />
christlichen Tradition die Angemessenheit <strong>und</strong> auch Notwen<br />
digkeit einer sozialen Ordnung zu zeigen, in welcher eine Auf<br />
teilung in Privatbesitz vorgenommen wird. Thomas mußte<br />
vom Sozialen her kommen. Er konnte seinen Ausgangspunkt<br />
nicht im Individualen suchen, wie wir dies heute tun. Die drei<br />
Punkte, mit welchen er im zweiten Artikel die Angemessenheit<br />
<strong>und</strong> Notwendigkeit <strong>de</strong>r privaten Eigentumsordnung aufweist,<br />
sind durchweg sozial, nicht individual bestimmt.<br />
Es ist nach all<strong>de</strong>m einfach unvorstellbar, daß Thomas im<br />
ersten Artikel hätte behaupten wollen, <strong>de</strong>r Einzelmensch habe<br />
ein <strong>Recht</strong> auf Privateigentum. Privateigentum schließt immer<br />
Differenzierung in <strong>de</strong>n Besitzverhältnissen <strong>de</strong>r Menschen ein.<br />
Davon aber hat Thomas hier unmöglich re<strong>de</strong>n können. Der<br />
erste Artikel sagt nichts an<strong>de</strong>res, als was die ganze Tradition<br />
betont hat: Die materiellen Güter sind <strong>de</strong>m Menschen zum<br />
Gebrauch überlassen. Er darf sie benützen. Und er soll sie<br />
385
66. 1/2 benützen, um <strong>de</strong>n Ordnungsgedanken <strong>de</strong>s Kosmos zu erfüllen.<br />
Es tut dieser Behauptung keinen Eintrag, wenn man einwen<strong>de</strong>t,<br />
Thomas re<strong>de</strong> doch vom Besitz, was bei ihm hier gleichlautend<br />
sei mit Eigentum. 15 Natürlich soll <strong>de</strong>r Mensch die Dinge besit<br />
zen, soweit er es überhaupt kann. Aber man achte darauf, wer<br />
als Besitzer bezeichnet wird. Nicht dieser o<strong>de</strong>r jener Mensch,<br />
son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r „Mensch überhaupt", alle Menschen. Es ist also für<br />
eine Vorstellung vom Privateigentum wenig gewonnen. Man<br />
erkennt noch nichts von <strong>de</strong>r Differenziertheit <strong>de</strong>s Individuellen<br />
<strong>und</strong> Privaten. Der Mensch als solcher, wie er zwischen <strong>de</strong>r<br />
materiellen Welt <strong>und</strong> Gott steht, soll sich die Güter dieser Er<strong>de</strong><br />
dienstbar machen, in<strong>de</strong>m er über sie herrscht, sie zu seinen<br />
Diensten benützt. Um zur I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>s Privateigentums vorzusto<br />
ßen, braucht es über diese ethische Betrachtung hinaus <strong>de</strong>n Be<br />
griff <strong>de</strong>r rechtlichen zwischenmenschlichen Beziehung. Davon<br />
aber ist im ersten Artikel nichts zu vernehmen. Dies ist <strong>de</strong>utlich<br />
ausgedrückt in <strong>de</strong>r Antwort auf <strong>de</strong>n ersten Einwand: „Gott, <strong>de</strong>r<br />
die Oberherrschaft über alle Dinge innehat, bestimmte in seiner<br />
Vorsehung einen gewissen Teil für <strong>de</strong>n leiblichen Unterhalt <strong>de</strong>s<br />
Menschen. Daher besitzt <strong>de</strong>r Mensch die natürliche Herrschaft<br />
über diese Dinge im Sinne <strong>de</strong>r seinem N<strong>utz</strong>en dienen<strong>de</strong>n Ver<br />
fügungsmacht."<br />
Dieser f<strong>und</strong>amentale Satz ist im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r ge<br />
samten Naturrechtslehre <strong>de</strong>s hl. Thomas zu sehen. Die Natur<br />
rechtslehre ist bei Thomas zunächst die Interpretation <strong>de</strong>r<br />
Schöpfung. Dem Menschen ist im Rahmen <strong>de</strong>r Schöpfung eine<br />
Macht, d. h. ein physisches Können geschenkt wor<strong>de</strong>n. Er ist<br />
nicht Schöpfer, er hat nur das beschränkte Können, das von<br />
Gott Geschaffene zu verän<strong>de</strong>rn, umzuwan<strong>de</strong>ln <strong>und</strong> in seinen<br />
Dienst zu nehmen. Daraus leitet Thomas nun die moralische<br />
Ordnung ab: die Dinge sind für <strong>de</strong>n Menschen immer nur<br />
Gebrauchsdinge. Da er sie nicht geschaffen hat, kann er sie auch<br />
nicht als Eigentum betrachten <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Folge darf er es auch<br />
nicht. Er bleibt <strong>de</strong>m Schöpfer gegenüber verantwortlich, <strong>de</strong>r die<br />
Welt geschaffen hat <strong>und</strong> auch die Macht besitzt, sie zu zerstö<br />
ren. In ähnlicher Weise geht Thomas im Traktat über die Ehe<br />
vor. Er betrachtet zunächst die physische Gegebenheit: die<br />
geschlechtliche Verschie<strong>de</strong>nheit weist darauf hin, daß <strong>de</strong>ren Ziel<br />
die Zeugung von Nachkommenschaft ist. Also, so schließt Tho-<br />
15 Vgl. hierzu Anm. [34].<br />
386
mas, kann die Verbindung von Mann <strong>und</strong> Frau in <strong>de</strong>r Ehe als 66. 1/2<br />
ersten Zweck nur die Zeugung haben.<br />
Thomas übernimmt also im ersten Artikel <strong>de</strong>n negativen<br />
Kommunismus <strong>de</strong>r Väter, in<strong>de</strong>m er aber dieser Lehre bereits die<br />
bei <strong>de</strong>n Vätern noch bemerkbare innere Neigung zur Polemik<br />
gegen Reichtum <strong>und</strong> Eigentum nimmt <strong>und</strong> betont, <strong>de</strong>r Mensch<br />
dürfe die Dinge wirklich als sein gebrauchen. Wie nun dieser<br />
gute Gebrauch entsprechend <strong>de</strong>r inneren Finalität <strong>de</strong>r Dinge,<br />
entsprechend <strong>de</strong>r Ordnung im Kosmos am besten sich voll<br />
zieht, ob in gemeinsamer o<strong>de</strong>r in privater Verwaltung, darüber<br />
äußert sich Thomas vorerst noch nicht. Dies ist Gegenstand <strong>de</strong>s<br />
zweiten Artikels. Soviel allerdings ist bereits im ersten Artikel<br />
enthalten, daß <strong>de</strong>r Gebrauch <strong>de</strong>r Dinge, d. h. die N<strong>utz</strong>ung <strong>de</strong>r<br />
Dinge, von Natur <strong>de</strong>r Gemeinschaft <strong>de</strong>r Menschen, näherhin<br />
allen Menschen zugänglich sein muß, weil eben <strong>de</strong>m Menschen<br />
überhaupt zugeordnet. Denn am Schluß <strong>de</strong>s zweiten Artikels<br />
kommt Thomas nochmals darauf zurück, in<strong>de</strong>m er erklärt, daß,<br />
wenngleich die Verwaltung privat sein mag, <strong>de</strong>r Gebrauch<br />
immer gemeinsam sein müsse. Wir wollen darüber noch spre<br />
chen. Wichtig ist aber schon hier, daß Thomas von <strong>de</strong>r Natur<br />
<strong>de</strong>r Dinge her ihren Gebrauch als etwas Gemeinsames bezeich<br />
net.<br />
Heißt dies aber, daß die Gebrauchsgüter in gleicherweise auf<br />
alle zu verteilen seien? Was soll <strong>de</strong>nn schließlich an<strong>de</strong>res unter<br />
<strong>de</strong>m gemeinsamen Gebrauch gemeint sein? Wenn dies <strong>de</strong>r Fall<br />
wäre, dann hätten wir bezüglich <strong>de</strong>r Gebrauchs guter bereits<br />
einen positiven Kommunismus. Thomas sagt aber ausdrücklich<br />
in Art. 2 Zu 1, daß die Gemeinsamkeit <strong>de</strong>r Dinge nicht <strong>de</strong>swegen<br />
auf das Naturrecht zurückgehe, weil etwa das Naturrecht<br />
gebieten wür<strong>de</strong>, alles in Gemeinschaft <strong>und</strong> nichts als Eigentum<br />
zu besitzen, son<strong>de</strong>rn weil es aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Naturrechts keine<br />
Unterscheidung <strong>de</strong>s Besitzes gebe. Mit an<strong>de</strong>ren Worten, es han<br />
<strong>de</strong>lt sich um nichts an<strong>de</strong>res als um <strong>de</strong>n negativen Kommunis<br />
mus. Die Einsicht in diesen Zusammenhang ist <strong>de</strong>swegen<br />
be<strong>de</strong>utsam, weil sonst die Bemerkung <strong>de</strong>s hl. Thomas in Art. 7,<br />
<strong>de</strong>r Überfluß sei aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Naturrechts <strong>de</strong>n Armen geschul<br />
<strong>de</strong>t, mißverstan<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>, als ob <strong>de</strong>r Arme von vornherein <strong>de</strong>n<br />
Überfluß <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn als sein <strong>Recht</strong> betrachten könne. Der<br />
Arme hat ein <strong>Recht</strong>, aber aus einem ganz an<strong>de</strong>ren Gr<strong>und</strong>;<br />
nicht, weil es Überfluß ist, son<strong>de</strong>rn weil er nichts hat, während<br />
auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rn Seite nichtgebrauchte Gebrauchsgüter sind. Die<br />
387
66. 1/2 stoische Auffassung vom guten Gebrauch als <strong>de</strong>m einzigen Er<br />
werbstitel, wie sie sich bei so vielen Vätern fand, ist also völlig<br />
umgewan<strong>de</strong>lt. Zwar wird <strong>de</strong>r Gebrauch noch als für die<br />
Gemeinschaft <strong>de</strong>r Menschen bestimmt bezeichnet, so daß die<br />
Güter von hier aus von vornherein sozial belastet sind, <strong>und</strong><br />
zwar von ihrer ersten Bestimmung her. Und doch sagt Thomas<br />
nicht, die unben<strong>utz</strong>ten Güter, wie z.B. <strong>de</strong>r Überfluß, könnten<br />
überhaupt nicht Eigentum <strong>de</strong>s Reichen sein, son<strong>de</strong>rn nur: sie<br />
seien, solange es Arme gibt, diesen geschul<strong>de</strong>t.<br />
Auch die mo<strong>de</strong>rne, etwa leoninische Auffassung sieht in die<br />
ser „Schuld" eine naturrechtliche Pflicht, aber eben eine Pflicht,<br />
die in <strong>de</strong>r zwischenmenschlichen Beziehung <strong>de</strong>n Besitzer noch<br />
nicht entrechtet. In <strong>de</strong>r zwischenmenschlichen <strong>Recht</strong>sordnung,<br />
d. h. in <strong>de</strong>r sozialen Frie<strong>de</strong>nsordnung, bleibt dabei <strong>de</strong>r Besitzer<br />
noch rechtlicher Eigentümer, <strong>und</strong> zwar rechtlicher im Sinn von<br />
individuellem Naturrecht. Es möchte dies als Wi<strong>de</strong>rspruch<br />
erscheinen, von naturrechtlicher Pflicht zur Abgabe <strong>und</strong> im glei<br />
chen Atem von naturrechtlichem Eigentum zu sprechen. Es<br />
wäre ein Wi<strong>de</strong>rspruch, wenn in bei<strong>de</strong>n Fällen <strong>de</strong>r Begriff<br />
„naturrechtlich" auf gleicher Ebene stän<strong>de</strong>. Die naturrechtliche<br />
Pflicht zur Abgabe <strong>de</strong>s Überflusses an die Armen befin<strong>de</strong>t sich<br />
auf <strong>de</strong>r obersten Ebene <strong>de</strong>s Naturrechts, dort, wo man über<br />
haupt über die materiellen Güter <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Menschen nachzu<br />
<strong>de</strong>nken anfängt. Die Güter sind sozial bestimmt, noch bevor<br />
man an das Problem <strong>de</strong>nkt, ob man kommunistische o<strong>de</strong>r pri<br />
vate Aufglie<strong>de</strong>rung vornehmen soll. Mit <strong>de</strong>m Augenblick aber,<br />
wo man aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s sozialen Frie<strong>de</strong>ns <strong>und</strong> <strong>de</strong>r sozialen<br />
Ordnung die Aufteilung <strong>de</strong>r Güter in Privateigentum vor<br />
nimmt, hat dieses praktisch das Vorrecht, bis die soziale Frie<br />
<strong>de</strong>nsordnung durch das Gesetz jene Urbestimmung <strong>de</strong>r mate<br />
riellen Güter, <strong>de</strong>m Gebrauch aller zu dienen, rechtlich neu<br />
regelt. Bis dahin ist jenes „naturrechtliche Geschul<strong>de</strong>tsein"<br />
nichts an<strong>de</strong>rs als eine ethische Verpflichtung, allerdings eine<br />
ethische Verpflichtung, die trotz allem eine rechtliche wer<strong>de</strong>n<br />
kann, weil alle Pflichten <strong>de</strong>r natura humana nicht nur ethische<br />
For<strong>de</strong>rungen, son<strong>de</strong>rn zugleich auch rechtliche Organisations<br />
prinzipien sind.<br />
Doch wir greifen bereits unserem Gedankengang vor. Es<br />
geht vorläufig noch nicht darum, die Aufteilung in privates<br />
Eigentum zu begrün<strong>de</strong>n <strong>und</strong> die damit sich ergeben<strong>de</strong> soziale<br />
Ordnung aufzuzeigen. Es kam bisher vielmehr darauf an, <strong>de</strong>n<br />
388
ersten Artikel mit <strong>de</strong>n in ihm liegen<strong>de</strong>n Folgerungen zu <strong>de</strong>uten. 66. 1/2<br />
Thomas behan<strong>de</strong>lt also darin, wie wir sahen, die ursprüngliche<br />
Hinordnung <strong>de</strong>r Güter auf <strong>de</strong>n Menschen, <strong>de</strong>r (als Mensch, auf<br />
Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r natura humana) sie gebrauchen, in Dienst nehmen<br />
soll. Von hier stammt die soziale Belastung jeglichen Besitzes,<br />
wovon die Väter im Kampf gegen Mißbräuche in so scharfen<br />
Worten gesprochen habe. Unter „Gebrauch" versteht Thomas<br />
das Indienstnehmen eines Gegenstan<strong>de</strong>s zu irgen<strong>de</strong>inem<br />
Zweck <strong>de</strong>s menschlichen Lebens, sei dies nun in Form <strong>de</strong>s Ver<br />
brauchens bezüglich <strong>de</strong>r Konsumgüter o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Verausgabens<br />
beim Geld (11—11117,4; DT, Bd. 20), sei es in Form <strong>de</strong>s einfa<br />
chen Ben<strong>utz</strong>ens, wie dies bei <strong>de</strong>n nichtkonsumtionsfähigen<br />
Gütern <strong>de</strong>r Fall ist, wie etwa beim Bewohnen eines Hauses<br />
(78,1).<br />
b) Kommunismus o<strong>de</strong>r private Eigentumsordnung?<br />
Spricht Thomas im ersten Artikel bereits vom <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s ein<br />
zelnen Menschen, irgend etwas, z. B. das Selbsterarbeitete, pri<br />
vat zu besitzen? Wir können diese Frage nur verneinen. Denn<br />
die Vorstellung, daß ein einzelner Mensch aus sich erklärte, er<br />
habe von Natur das <strong>Recht</strong>, die Dinge, die er erarbeitet, gegen<br />
alle Anfechtungen von seiten <strong>de</strong>r Gemeinschaft zu besitzen,<br />
wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Gedankengang völlig stören. Ohne Zweifel schließt<br />
Thomas im ersten Artikel das <strong>Recht</strong> auf Privateigentum nicht<br />
aus, wie wir bei <strong>de</strong>r Erklärung <strong>de</strong>s zweiten Arikels noch näher-<br />
hin sehen wer<strong>de</strong>n. Aber er meint noch keineswegs jenes private<br />
<strong>Recht</strong> auf Eigentum, das gemeint ist, wenn wir heute vom<br />
Naturrecht <strong>de</strong>s einzelnen Menschen auf sein Erarbeitetes spre<br />
chen. Wir gehen vom einzelnen aus; Thomas spricht aber im<br />
ersten Artikel nur vom Menschen. Dieser kann die Güter besit<br />
zen. Ja, es ist sogar erlaubt, daß er sie privat besitzt. Auch dies<br />
steht im Ganzen <strong>de</strong>s ersten Artikels. Aber beachten wir: warum<br />
erlaubt? Etwa, weil dieser o<strong>de</strong>r jener sich etwas erarbeitet hat<br />
<strong>und</strong> nun gegen die Gemeinschaft darauf pochen kann? Durch<br />
aus nicht, son<strong>de</strong>rn nur, sofern die soziale Ordnung die private<br />
Eigentumsordnung gebietet, so daß erst um <strong>de</strong>s Ordnungsge<br />
dankens willen <strong>de</strong>r einzelne das Seine in die Hand nimmt. Wir<br />
müssen uns einmal gr<strong>und</strong>sätzlich von unserer mo<strong>de</strong>rnen Auf<br />
fassung <strong>de</strong>r Freiheitsrechte lösen, um <strong>de</strong>n Gedankengang <strong>de</strong>s<br />
hl. Thomas zu verstehen. In <strong>de</strong>m: „Es ist erlaubt, Privateigen-<br />
389
66. 1/2 tum zu besitzen", wovon Thomas zu Beginn <strong>de</strong>s zweiten Arti<br />
kels spricht <strong>und</strong> das er bereits im ersten Artikel miteinschließt,<br />
ist nur so viel ausgesprochen, daß die Menschen auch eine pri<br />
vate Eigentumsordnung einführen können. Es heißt aber nicht,<br />
o<strong>de</strong>r sagen wir besser „noch" nicht, daß <strong>de</strong>r Einzelne natur<br />
rechtlich auf sein Eigenerworbenes pochen könne, weil er Ein<br />
zelner, weil er Individuum <strong>und</strong> Person ist. Im heutigen Verständ<br />
nis von Eigentumsrecht ist von vornherein die Verschie<strong>de</strong>nheit<br />
<strong>de</strong>s Besitzes mitgegeben. Je<strong>de</strong>r hat das Seine. In <strong>de</strong>r thomasi<br />
schen Formulierung <strong>de</strong>s ersten Artikels hat je<strong>de</strong>r Mensch glei<br />
ches <strong>Recht</strong> auf Zugang zu Eigentum, weil <strong>de</strong>r Mensch erlaubter<br />
weise die Güter dieser Er<strong>de</strong> in Dienst nehmen darf. Potentiell<br />
liegt darin auch das <strong>Recht</strong> eines je<strong>de</strong>n auf das je verschie<strong>de</strong>ne<br />
Seine. Aber nur potentiell, möglicherweise. Daß dieses <strong>Recht</strong><br />
wirklich eintritt <strong>und</strong> zur Regel gemacht wer<strong>de</strong>n soll, das hängt<br />
von Momenten ab, die nicht vom Individuum, son<strong>de</strong>rn vom<br />
Gemeinschaftsganzen herkommen.<br />
Damit eröffnet sich uns die Fragestellung <strong>de</strong>s zweiten Arti<br />
kels^ geht hier darum, welche soziale Ordnung vorzuziehen<br />
sei, die kollektiv- o<strong>de</strong>r die privatrechtlich bestimmte.<br />
Für <strong>de</strong>n paradiesischen Menschen nahm Thomas das I<strong>de</strong>al<br />
<strong>de</strong>s freien Kommunismus an wie die Väter: „Im Unschuldszu<br />
stan<strong>de</strong> wäre <strong>de</strong>r Wille <strong>de</strong>r Menschen so geordnet gewesen, daß<br />
sie ohne je<strong>de</strong> Gefahr <strong>de</strong>r Zwietracht von allem, was ihrer<br />
Herrschaftsmacht unterstand, Gebrauch gemacht hätten, wie<br />
es ein je<strong>de</strong>r bedurfte. Denn das wird ja auch bei uns von vielen<br />
guten Menschen so gehalten" (I 98,1 Zu 3; DT, Bd. 7). Ohne<br />
Zweifel sah Thomas in <strong>de</strong>r Gütergemeinschaft ein hohes I<strong>de</strong>al,<br />
das er im Mendikantenstreit mit Erfolg verteidigte. In <strong>de</strong>r Ord<br />
nung <strong>de</strong>r Engel konnte er dafür ein Vorbild fin<strong>de</strong>n: „In <strong>de</strong>r<br />
Gemeinschaft <strong>de</strong>r Engel ist aller Besitz gemeinsam" (1108,2 Zu<br />
2; DT, Bd. 8). Thomas <strong>de</strong>nkt natürlich bei diesem i<strong>de</strong>alen<br />
Zustand nicht an einen rechtlichen, son<strong>de</strong>rn nur an einen ethi<br />
schen Kommunismus. Ein je<strong>de</strong>r Mensch wäre gescheit <strong>und</strong><br />
auch hochgemut genug, um alles ins Gemeinwohl zu bringen<br />
<strong>und</strong> von dort das zu nehmen, was er gera<strong>de</strong> braucht. Allerdings<br />
hat sich Thomas genauso wenig wie die Väter darüber Gedan<br />
ken gemacht, wie im einzelnen die soziale Ordnung Zustan<strong>de</strong><br />
kommen soll, da wohl auch ohne Bosheit eine Unordnung sich<br />
hätte ergeben können. Suarez (De Opere Sex Dierum, lib.V,<br />
n. 18) ist diesem Gedanken nachgegangen <strong>und</strong> hat sich dabei<br />
390
überlegt, ob es <strong>de</strong>nn wirklich so weit hergewesen sei mit <strong>de</strong>m<br />
Kommunismus im Paradies: „Zu allererst scheint in jenem<br />
Stand kein Verbot bezüglich <strong>de</strong>r Aufteilung <strong>de</strong>r Güter bestan<br />
<strong>de</strong>n zu haben, <strong>de</strong>nn ein positves Verbot läßt sich nicht ermitteln,<br />
noch wird ein natürliches Verbot aus <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>de</strong>r<br />
rechten Vernunft abgeleitet, <strong>de</strong>nn eine solche Aufteilung wäre<br />
we<strong>de</strong>r gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong> noch gegen eine an<strong>de</strong>re<br />
Tugend... Darum ist weiterhin zu unterschei<strong>de</strong>n zwischen<br />
beweglichen <strong>und</strong> unbeweglichen Gütern. Denn die bewegli<br />
chen Güter sind eher Gegenstand <strong>de</strong>r Aufteilung, weil sie eben<br />
dadurch, daß man sie in Besitz o<strong>de</strong>r an sich nimmt, <strong>de</strong>m gehö<br />
ren, <strong>de</strong>r sie nimmt. Und dieses <strong>Recht</strong> scheint auch im Stand <strong>de</strong>r<br />
Unschuld notwendig gewesen zu sein. Wenn nämlich jemand<br />
zum Essen Früchte eines Baumes sammeln wür<strong>de</strong>, dann wür<strong>de</strong><br />
er unmittelbar dadurch ein beson<strong>de</strong>res <strong>Recht</strong> auf sie erwerben,<br />
um sie frei zu gebrauchen, <strong>und</strong> sie könnten ohne Ungerechtig<br />
keit gegen seinen Willen ihm nicht abgenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Jedoch wäre hinsichtlich <strong>de</strong>r unbeweglichen Güter eine solche<br />
Aufteilung nicht nötig. Und von diesen re<strong>de</strong>n hauptsächlich die<br />
Autoren. Es ist allerdings darüber hinaus zu beachten, daß die<br />
Menschen in jenem Stand die Er<strong>de</strong> bebauen <strong>und</strong> vielleicht einen<br />
Teil davon besäen konnten. Daraus also wäre notwendiger<br />
weise gefolgt, daß <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r einen Teil <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> bebaut hat,<br />
gerechterweise nicht von einem an<strong>de</strong>rn seiner Ben<strong>utz</strong>ung <strong>und</strong><br />
gewissermaßen seines Besitzes beraubt wer<strong>de</strong>n konnte, <strong>de</strong>nn<br />
die natürliche Vernunft selbst <strong>und</strong> die angemessene Ordnung<br />
verlangen dies". Suarez nimmt dieselbe Angemessenheit einer<br />
Aufteilung in Privatbesitz auch für an<strong>de</strong>re unbewegliche Güter,<br />
wie z. B. Häuser, an.<br />
Thomas hätte noch nicht daran gedacht, ausdrücklich vom<br />
<strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s einzelnen im Paradies zu sprechen. Es liegt ihm die<br />
Vorstellung fern, daß <strong>de</strong>r eine o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re im Paradies auf sein<br />
privates <strong>Recht</strong> pochen könnte. Dagegen sagt Suarez, daß auch<br />
im Paradies <strong>de</strong>mjenigen, <strong>de</strong>r sich etwas erarbeitet hatte, das Er<br />
arbeitete gerechterweise nicht genommen wer<strong>de</strong>n durfte, da es<br />
ja ihm gehörte. Hier taucht bereits ein Schimmer <strong>de</strong>s individual<br />
rechtlichen Gesichtspunkts auf. Der einzelne wird erfaßt als<br />
Träger von <strong>Recht</strong>en, die ihm zustehen gegenüber <strong>de</strong>m Näch<br />
sten <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Ganzen. Suarez steht durchaus nicht gegen Tho<br />
mas. Doch bleibt diese rechtliche Sicht bei Thomas noch ver<br />
borgen: Es ist erlaubt, daß <strong>de</strong>r Mensch als solcher, also auch im<br />
391
66. 1/2 paradiesischen Zustand, etwas als sein betrachten kann. Aber<br />
<strong>de</strong>r Einzelmensch tut es nicht, er <strong>de</strong>nkt gar nicht daran, weil sich<br />
alles durch die ethische Vollkommenheit aller von selbst regelt.<br />
Thomas verbleibt noch viel zu sehr in <strong>de</strong>r ethischen Sicht <strong>de</strong>s<br />
Gemeinschaftslebens <strong>de</strong>r paradiesischen Menschen, um über<br />
haupt an eine solche Entwicklung <strong>und</strong> Entfaltung <strong>de</strong>s latenten<br />
privaten <strong>Recht</strong>s zu <strong>de</strong>nken, von <strong>de</strong>m Suarez ausdrücklich<br />
spricht. Das <strong>Recht</strong> ist an sich da, es besteht auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Natur. Aber es ist in keiner Weise ein Gegenstand<br />
<strong>de</strong>r For<strong>de</strong>rung. Es wird nur in seiner ethischen Bewandtnis<br />
gesehen: <strong>de</strong>r einzelne achtet <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rn. Es wird daher keiner<br />
die Veranlassung haben, an „sein" <strong>Recht</strong> zu <strong>de</strong>nken. Es wird<br />
also gera<strong>de</strong> das, was wir in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Auffassung <strong>de</strong>r Frei<br />
heitsrechte beson<strong>de</strong>rs feststellen, das Individuelle <strong>und</strong> Vor<br />
gemeinschaftliche, überhaupt nicht hervorgekehrt.<br />
Entsprechend dieser gr<strong>und</strong>sätzlich ethischen Sicht <strong>de</strong>r<br />
ursprünglichen Gemeinschaft <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gemeinschaft über<br />
haupt, konnte Thomas die Verteidigung <strong>de</strong>s Privateigentums,<br />
d. h. <strong>de</strong>r allgemeinen Aufteilung in privaten Besitz, wobei ein<br />
je<strong>de</strong>r zunächst als Einzelner auftritt, nur vornehmen vom Ge<br />
sichtspunkt <strong>de</strong>s Gemeinschaftlichen, nicht etwa vom Gesichts<br />
punkt <strong>de</strong>s Individuellen aus. Thomas erklärt nun, daß <strong>de</strong>r Kom<br />
munismus aus Freiheit <strong>und</strong> ethischer Vollkommenheit nicht<br />
mehr möglich, daß vielmehr die private Aufteilung eine Not<br />
wendigkeit gewor<strong>de</strong>n sei. Ein Zwangskommunismus wäre<br />
gegen das Naturrecht, <strong>de</strong>nn „das Naturrecht gebietet nicht, alles<br />
gemeinsam zu besitzen" (Art. 2 Zu 1). Das <strong>Recht</strong> auf Eigentum,<br />
<strong>und</strong> zwar das <strong>Recht</strong> eines je<strong>de</strong>n Menschen, weil es ein <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s<br />
Menschen überhaupt ist, wird stillschweigend vorausgesetzt.<br />
Aber dieses <strong>Recht</strong> ist nach Artikel 1 noch universal, nicht diffe<br />
renziert verstan<strong>de</strong>n. Darum fragt Thomas nun im zweiten Arti<br />
kel, ob man die Differenzierung vornehmen soll, so daß <strong>de</strong>r<br />
eine mehr, <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re weniger besitze, ohne daß <strong>de</strong>m allgemei<br />
nen Sinn <strong>de</strong>r Güter (Dienst an <strong>de</strong>r Gesamtheit) irgendwie Ein<br />
trag geschieht.<br />
Man achte wohl auf die Verschie<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>r Zugänge, die<br />
damals Thomas <strong>und</strong> heute uns zum differenzierten, d. h. indivi<br />
duell bestimmten <strong>Recht</strong> auf Eigentum führen. Thomas sieht die<br />
soziale Bestimmung <strong>de</strong>r Güter, <strong>de</strong>n sogenannten negativen<br />
Kommunismus; er erkennt die gr<strong>und</strong>sätzliche Erlaubtheit <strong>de</strong>s<br />
Einzelbesitzes, sofern die soziale Finalität <strong>de</strong>r Güterwelt erfüllt<br />
392
wird (Art. 1). Für die Aktualisierung <strong>de</strong>s allgemeinen Natur- 66. 1/2<br />
rechts auf die Güter in Form von differenzierten Einzelrechten<br />
kommt daher für Thomas nur ein sozialbestimmter Gr<strong>und</strong> in<br />
Frage: <strong>de</strong>r Sinn <strong>de</strong>r Güterwelt, allen zu dienen. Wir dagegen<br />
machen diesen langen logischen Prozeß nicht mehr, son<strong>de</strong>rn<br />
kommen direkt zum differenzierten Privateigentumsrecht,<br />
in<strong>de</strong>m wir von <strong>de</strong>r Menschenwür<strong>de</strong> <strong>de</strong>s einzelnen ausgehen,<br />
von seinem bereits differenzierten Individuum-Sein, näherhin<br />
vom Vorstaatlichen, Vorgemeinschaftlichen.<br />
Welches sind nun die sozialen Grün<strong>de</strong>, welche die Verwirkli<br />
chung <strong>de</strong>r allgemeinen Menschenrechte in Form von differen<br />
zierten, d.h. Individualrechten for<strong>de</strong>rn? Thomas führt <strong>de</strong>ren<br />
drei an: 1. Anspornung zum Fleiß, <strong>de</strong>nn im allgemeinen besorgt<br />
<strong>de</strong>r Mensch das Gemeinwohl schlechter als das Eigenwohl, also<br />
Hebung <strong>de</strong>r Produktivität <strong>de</strong>r Arbeit; 2. bessere Behandlung<br />
<strong>de</strong>r Güter, also Vermeidung von Kapitalvergeudung; 3. Ruhe<br />
<strong>und</strong> Frie<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>n Menschen, weil durch rechtliche Abgren<br />
zung <strong>de</strong>r Streit vermie<strong>de</strong>n wird. 16<br />
Er kehrt also das Argument von Cbrysostomus gera<strong>de</strong> um.<br />
Während Cbrysostomus in <strong>de</strong>r Aufteilung einen Anlaß zum<br />
Unfrie<strong>de</strong>n sah, faßt sie Thomas als Mittel <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns. Der ver<br />
schie<strong>de</strong>ne Gesichtspunkt in diesen bei<strong>de</strong>n Äußerungen ist nicht<br />
außeracht zu lassen. Äußerer Anlaß zur rechtlichen Teilung<br />
mag die menschliche Schwäche <strong>und</strong> Sündhaftigkeit sein. Diese<br />
sieht <strong>de</strong>r Moralprediger Cbrysostomus. Innerer Sinn <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s<br />
aber ist Frie<strong>de</strong>nsordnung. Diese hat Thomas im Auge, er klärt<br />
also hier die Tradition ab. Die durchgängig gefor<strong>de</strong>rte soziale<br />
Zielsetzung <strong>de</strong>r materiellen Güterwelt wird voll <strong>und</strong> ganz<br />
gewahrt. Aus <strong>de</strong>m moralpessimistischen Argument, daß die<br />
Aufteilung auf die Bosheit <strong>de</strong>r Menschen zurückzuführen sei,<br />
wird die optimistische Formulierung: Die Aufteilung, die an<br />
sich gr<strong>und</strong>sätzlich erlaubt ist, wird gefor<strong>de</strong>rt im Hinblick auf<br />
die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Menschheit, nicht um <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn um<br />
<strong>de</strong>m Ziel <strong>de</strong>r Schöpfung, <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Menschheit, zu die<br />
nen: „Verteilung <strong>und</strong> Besitznahme <strong>de</strong>r Dinge — ein Werk <strong>de</strong>s<br />
menschlichen <strong>Recht</strong>s — hin<strong>de</strong>rn nicht, ebendiese Dinge zur Lin<br />
<strong>de</strong>rung menschlicher Not einzusetzen" (Art. 7).<br />
Die drei Grün<strong>de</strong> haben ihr F<strong>und</strong>ament bei Aristoteles. Vgl. Anm. [5], wo das<br />
Verhältnis <strong>de</strong>r aristotelischen Lehre zu <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s hl.Thomas näher dargelegt<br />
wird.<br />
393
c) Das <strong>Recht</strong> auf Eigentum ein Naturrecht?<br />
So entsteht also um <strong>de</strong>r sozialen Ordnung willen die privat-<br />
rechtliche Ordnung. Ist nun dieses Privatrecht bei Thomas ein<br />
Naturrecht o<strong>de</strong>r nicht? Dies ist die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Frage, von<br />
<strong>de</strong>r abhängt, ob die mo<strong>de</strong>rne Schauweise irgen<strong>de</strong>ine innere<br />
Beziehung zur Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas hat o<strong>de</strong>r nicht.<br />
In <strong>de</strong>r Tat spricht Thomas nicht ausdrücklich vom Natur<br />
recht auf Privateigentum. Er konnte es auch gar nicht im Hin<br />
blick auf die naturgemäße Zielbestimmung aller Güter auf das<br />
Gemeinwohl. Die private Eigentumsordnung wird bei ihm<br />
erschlossen aus dieser Zielsetzung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Betrachtung <strong>de</strong>r<br />
konkreten Befindlichkeit <strong>de</strong>r Menschen. Darum sagt Thomas<br />
(Art. 2 Zu 1), daß die Aufteilung in privaten Besitz durch die<br />
menschliche Vernunft „gef<strong>und</strong>en" wor<strong>de</strong>n sei. Sie geht also über<br />
das Naturrecht hinaus, wie er ausdrücklich betont: Sie wird<br />
durch die Vernunft aus <strong>de</strong>m Naturrecht „herausgef<strong>und</strong>en"<br />
(a. a. O.), nicht, als ob damit das Naturrecht umgebogen wäre<br />
(I—II 94,5 Zu 3; DT, Bd. 13), son<strong>de</strong>rn hinzugefügt durch<br />
logische Anwendung <strong>de</strong>r Prinzipien auf konkrete Verhältnisse.<br />
Dabei han<strong>de</strong>lt es sich nicht nur um eine innere logische Entfal<br />
tung von Naturrechtsprinzipien im Sinn <strong>de</strong>r rationalistischen<br />
Naturrechtslehre, son<strong>de</strong>rn um eine Logik, die eine neue, aus<br />
<strong>de</strong>r Erfahrung stammen<strong>de</strong> Erkenntnis in sich aufnimmt, näm<br />
lich die Erfahrung, daß bei Aufteilung <strong>de</strong>r Sinn <strong>de</strong>r Güterwelt<br />
besser gewahrt sei. Daraus ergibt sich als ermittelte, hinzuge<br />
wonnene Erkenntnis: Das latente allgemeine <strong>Recht</strong> auf die<br />
Güter dieser Welt muß als privates Eigentumsrecht aktuiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Nichts an<strong>de</strong>res ist gemeint durch „herausfin<strong>de</strong>n", was<br />
dadurch erwiesen ist, daß Thomas das Privateigentum zum „jus<br />
gentium" rechnet (57,3).<br />
Damit aber sind wir bei <strong>de</strong>r Lösung unserer Frage: Thomas<br />
sieht im privaten Eigentum, das sich einer erworben hat, ein<br />
Naturrecht; <strong>de</strong>nn alles, was in <strong>de</strong>r konkreten Situation <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Natur entspricht, auch wenn es erschlossen, also<br />
auch wenn es zum „jus gentium" gehört, ist ein natürliches<br />
<strong>Recht</strong>. Allerdings beachte man wohl, unter welchen logischen<br />
Voraussetzungen Thomas zu diesem Naturrecht kommt. Der<br />
einzelne kann tatsächlich das von ihm Erworbene nur als „sein"<br />
Naturrecht bezeichnen, insofern vom Gemeinwohl her bereits<br />
die private Eigentumsordnung als naturgemäß erwiesen ist <strong>und</strong><br />
394
insofern das von ihm Erworbene <strong>de</strong>n Ursinn <strong>de</strong>r privaten<br />
Eigentumsordnung nicht vernichtet, nämlich die Güter mög<br />
lichst allen zugänglich zu machen. Es gehen also diesem indivi<br />
duellen „Naturrecht" Bedingungen voraus, die als vordringli<br />
chere Naturprinzipien zuerst erfüllt sein müssen. Die private<br />
Eigentumsordnung als allgemeines Prinzip verteidigt Thomas<br />
in umfassen<strong>de</strong>r Weise für die Menschheit als solche, nach<strong>de</strong>m<br />
sie in die Sün<strong>de</strong> gefallen ist. Damit aber ist das individuell<br />
Erworbene noch nicht ausreichend als „Naturrecht" gerechtfer<br />
tigt. Es muß die nächste Bedingung erfüllt sein, daß nämlich das<br />
jeweils konkret Erworbene <strong>de</strong>m ursprünglichen Sinn <strong>de</strong>r Güter<br />
wirklich gerecht wird. Da die private Eigentumsordnung eine<br />
<strong>Recht</strong>sordnung ist, bleibt als Instanz, welche diese kontingente<br />
<strong>und</strong> wechseln<strong>de</strong> Bedingung stets neu bestimmt, nur eine<br />
menschliche Institution, nämlich die menschliche Überein<br />
kunft, die zum gesatzten <strong>Recht</strong> gehört (Art. 2 Zu 1).<br />
Das gesatzte <strong>Recht</strong> spielt in <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>de</strong>s Privatei<br />
gentums eine große Rolle. Dabei <strong>de</strong>nkt Thomas aber nicht so<br />
sehr an die Willensäußerung <strong>de</strong>r staatlichen Autorität als sol<br />
cher, son<strong>de</strong>rn vielmehr an das Gemeinwohl, das in dieser Wil<br />
lensäußerung bestimmt wer<strong>de</strong>n soll. In diesem Sinn wird nach<br />
Thomas das <strong>Recht</strong> auf Eigentum sogar erst wirklich. So gehört<br />
ein gef<strong>und</strong>ener Gegenstand <strong>de</strong>m Fin<strong>de</strong>r nicht mehr, wenn die<br />
bürgerlichen Gesetze dies bestimmen (Art. 5 Zu 2). Auch sagt<br />
Thomas (Art. 5 Zu 1), daß in <strong>de</strong>m Augenblick, da <strong>de</strong>r Richter<br />
einen Gegenstand irgend jeman<strong>de</strong>m zuspricht, dieser Gegen<br />
stand diesem gehöre, so daß er ihn bei <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r ihn noch zu<br />
rückhalten wollte, heimlich holen könne, ohne Diebstahl zu be<br />
gehen.<br />
Soll dies aber heißen, daß Thomas bezüglich <strong>de</strong>s Privateigen<br />
tums doch einen reinen Positivismus vertrete ? In <strong>de</strong>r Beantwor<br />
tung dieser Frage stoßen wir wohl auf jenen Punkt, von <strong>de</strong>m aus<br />
die alte <strong>und</strong> die neue Sicht in ihrer gegenseitigen Zuordnung<br />
erst verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n können. Unter Voraussetzung <strong>de</strong>s wah<br />
ren Gemeinwohls gilt immer, daß das <strong>Recht</strong> auf Privateigentum<br />
ein Nachfahre <strong>de</strong>s Gemeinwohls ist, niemals aber vorgemein<br />
schaftlich. Auch die mo<strong>de</strong>rne christliche Schauweise anerkennt<br />
keine vorgemeinschaftlichen <strong>Recht</strong>e, son<strong>de</strong>rn sieht alle Men<br />
schenrechte nur innerhalb <strong>de</strong>r Gemeinschaft. Leo XIII. hat nie<br />
mals im Sinn gehabt, das vorstaatliche <strong>Recht</strong> auf Eigentum als<br />
ein vorgemeinschaftliches zu bezeichnen. Thomas sieht nun auf<br />
395
<strong>de</strong>r abstrakten Höhe, auf welcher sich seine Philosophie vom<br />
Privateigentum hält, in <strong>de</strong>m menschlichen Gesetz das Sprach<br />
rohr <strong>de</strong>s Gemeinwohls. Darum kann er ohne Sorge sagen, daß<br />
das Privateigentum eine „Institution" <strong>de</strong>s menschlichen Geset<br />
zes sei. Für <strong>de</strong>n Fall, daß ein Machthaber gegen das wahre<br />
Gemeinwohl, also gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>, das Gut eines Glie<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r Gemeinschaft an sich reißen wür<strong>de</strong>, begeht er Raub, wie<br />
Thomas ausdrücklich erklärt (Art. 8). Diese Sicht muß man<br />
festhalten, um von Thomas aus <strong>de</strong>n Zugang zu <strong>de</strong>n vorstaat<br />
lichen Naturrechten im mo<strong>de</strong>rnen Sinne zu fin<strong>de</strong>n. Den Staat<br />
<strong>de</strong>r Philosophen gibt es nicht. Es existieren viele Staaten, von<br />
<strong>de</strong>nen keiner für sich in Anspruch nehmen kann, er vertrete das<br />
ganze Humanum. Zu<strong>de</strong>m haben wir heute aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
geschichtlichen Kenntnisse allen Gr<strong>und</strong>, gegenüber <strong>de</strong>n Ent<br />
scheidungen <strong>de</strong>r staatlichen Autoritätsträger skeptisch zu sein.<br />
Wir erklären darum mit viel größerem Gewicht als etwa Tho<br />
mas, daß <strong>de</strong>r Staat sich an die von <strong>de</strong>r Natur vorgegebenen<br />
<strong>Recht</strong>e zu halten habe. Diese vorgegebenen <strong>Recht</strong>e sind nie<br />
mals gemeinschaftsfremd, sie sind zwar immer sozialbestimmt,<br />
aber <strong>de</strong>m Willen <strong>de</strong>s Staates übergeordnet. Da nun die vorgege<br />
bene soziale Ordnung die Ordnung <strong>de</strong>r privaten <strong>Recht</strong>sord<br />
nung ist, steht zunächst die Präsumtion für das Individuum. So<br />
kommen wir dazu, zu sagen, <strong>de</strong>r Einzelmensch habe ein natür<br />
liches <strong>Recht</strong> auf sein Eigentum. Philosophisch aber bleibt dieses<br />
„vorstaatliche" <strong>Recht</strong> naturrechtlich ein soziales <strong>und</strong> damit im<br />
Gr<strong>und</strong>e — abstrakt gesehen (!) — auch ein staatliches <strong>Recht</strong>.<br />
Die vorzügliche Stellung, die die private Eigentumsordnung<br />
als — wenngleich abgeleitetes — Naturrecht einnimmt, verpflich<br />
tet die staatliche Autorität, bestehen<strong>de</strong> Eigentumsverhältnisse<br />
zu respektieren. Die Behör<strong>de</strong>n haben darum z.B. in ihrer<br />
Raumplanung darauf zu achten, daß erworbenes Eigentum<br />
nicht einfach unter das Rad <strong>de</strong>r Enteignung gerät, weil diese<br />
gera<strong>de</strong> im Augenblick vom Gemeinwohl erfor<strong>de</strong>rt erscheint.<br />
Die Enteignung (im Normalfall gegen Entschädigung) ist zwar<br />
durch das Gemeinwohl gerechtfertigt. Die Behör<strong>de</strong>n dürften<br />
sich aber ihrer eigenen Erkenntnisgrenzen bewußt sein <strong>und</strong> ihre<br />
Integration <strong>de</strong>s Gemeinwohls nicht als die einzig richtige anse<br />
hen. Die Gefahr <strong>de</strong>r langsamen, unbemerkten Zersetzung <strong>de</strong>r<br />
privaten Eigentumsordnung als eines naturrechtlich gebotenen<br />
sozialen Ordnungsprinzips ist ernst zu nehmen.<br />
396
Es dürfte nicht müßig sein, noch eigens zu betonen, daß auch 66. 1/2<br />
im großen Weltraum die Präsumtion stets für das Private steht,<br />
nach<strong>de</strong>m mit Thomas nachgewiesen ist, daß die Privatordnung<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>de</strong>n sozialen Sinn <strong>de</strong>r Güterwelt besser erfüllt als<br />
eine kommunistische Ordnung. Allerdings ist in diesem Raum<br />
das Private in viel größerem Ausmaß sozial belastet als nur<br />
innerhalb eines einzelnen Staates. Diese Feststellung mag über<br />
raschen, weil wir heute in unserem Staats<strong>de</strong>nken gera<strong>de</strong> umge<br />
kehrte Vorstellungen haben.<br />
d) Die Reichweite <strong>de</strong>s Privaten<br />
Worin sieht Thomas nun eigentlich <strong>de</strong>n privaten Bereich im<br />
Eigentum, da doch <strong>de</strong>r Gebrauch selbst gemeinsam sein soll?<br />
Diese Frage bedarf <strong>de</strong>r Klärung, weil davon die Anwendungs<br />
möglichkeit <strong>de</strong>s thomasischen Eigentumsbegriffs auf mo<strong>de</strong>rne<br />
wirtschaftliche Verhältnisse abhängt.<br />
Thomas meint (Art. 2), daß <strong>de</strong>r Mensch berechtigt sei, etwas<br />
privat zu erwerben <strong>und</strong> zu verwalten. Bei<strong>de</strong>s, Erwerb <strong>und</strong> Ver<br />
waltung, untersteht <strong>de</strong>n Normen <strong>de</strong>r Moral, entschei<strong>de</strong>nd also<br />
<strong>de</strong>m Gewissen.<br />
Der Erwerb darf nicht grenzenlos sein. Von <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Geizes sagt darum Thomas, sie liege nicht nur dann vor, wenn<br />
jemand einen Überfluß zurückhält, son<strong>de</strong>rn auch, wenn er<br />
„mehr, als ihm gebührt, erwirbt" (II—II 118,1 Zu 2; DT,<br />
Bd. 20). Allerdings ist die rechtliche Seite <strong>de</strong>s Erwerbs nach<br />
Thomas privat, so schwer auch die ethischen Lasten zugunsten<br />
<strong>de</strong>s Nächsten sein mögen.<br />
Dasselbe gilt von <strong>de</strong>r Verwaltung. Die Verwaltung versteht<br />
Thomas als „die Zumessung von etwas Gemeinsamem auf die<br />
einzelnen; darum wird auch <strong>de</strong>r Leiter <strong>de</strong>r Familie Verwalter<br />
genannt, insofern er je<strong>de</strong>m Glied <strong>de</strong>r Familie mit Gewicht <strong>und</strong><br />
Maß sowohl Beschäftigung wie auch das zum Leben Notwen<br />
dige zuteilt" (I—II 97,4; DT, Bd. 13). Ähnlich in II-II 88,10<br />
(DT, Bd. 19): „Die Verwaltung bezeichnet offenbar eine gewisse<br />
abgewogene Austeilung o<strong>de</strong>r Zuwendung von etwas Gemein<br />
samem an die Teile, die in ihm beschlossen sind. Auf diese Weise<br />
sagt man, es wür<strong>de</strong> jemand die Speise <strong>de</strong>r Familie verwalten."<br />
Der Gebrauch <strong>de</strong>r Dinge ist sozial bestimmt, allerdings in<br />
<strong>de</strong>r Weise, daß das <strong>Recht</strong> auf <strong>de</strong>n Gebrauch zunächst beim<br />
Eigentümer liegt <strong>und</strong> die Einschränkung erst durch gesetzliche<br />
397
Maßnahmen erfährt, wobei aber bereits vor <strong>de</strong>m gesatzten<br />
<strong>Recht</strong> die ethische Pflicht besteht, die natürliche Zweckbestim<br />
mung <strong>de</strong>r Dinge zu erfüllen <strong>und</strong> sie darum aus freien Stücken<br />
<strong>de</strong>m Nächsten zur Verfügung zu stellen. Diese freie Tat ist<br />
Liebe, zugleich aber zu einem be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Stück soziale<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> (vgl. A. F. Utz, Freiheit <strong>und</strong> Bindung <strong>de</strong>s Eigen<br />
tums, 1949, 72-83).<br />
In <strong>de</strong>r Enzyklika „Rerum novarum" ist jedoch nicht nur vom<br />
<strong>Recht</strong> auf die Verwaltung als einem privaten Moment im Eigen<br />
tum die Re<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn auch vom <strong>Recht</strong> auf die Sache selbst. Es<br />
ist keine Frage, daß Thomas dieses <strong>Recht</strong> miteinschließt in <strong>de</strong>m<br />
Begriff <strong>de</strong>s „Anschaffens" (procurare = besorgen). Somit gehört<br />
nach Thomas auch <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>mjenigen, <strong>de</strong>r ihn durch Arbeit<br />
o<strong>de</strong>r sonst aufgr<strong>und</strong> irgen<strong>de</strong>ines Titels erworben hat. Um die<br />
ses substantiellen Eigentumsrechts willen besitzt <strong>de</strong>r Eigentü<br />
mer das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>und</strong> Verfügung.<br />
e) Der Eigentumsbegriff <strong>de</strong>s hl. Thomas <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>r Wirtschaft<br />
Für <strong>de</strong>n mittelalterlichen Menschen war das Eigentum<br />
unmittelbar <strong>de</strong>m Zweck unterstellt, <strong>de</strong>n in letzter Entscheidung<br />
die irdischen Güter immer haben müssen: Erhaltung <strong>und</strong> Siche<br />
rung <strong>de</strong>s menschlichen Lebens. Darum begegnen wir <strong>de</strong>r sozia<br />
len Bindung <strong>de</strong>s Eigentums sozusagen nur in <strong>de</strong>r Form <strong>de</strong>r<br />
Zuteilung von Konsumgütern an die Armen. Fast endlos sind<br />
die Traktate über <strong>de</strong>n Überfluß <strong>und</strong> seine Abschöpfung durch<br />
das Almosen. Da <strong>de</strong>r Kleinbürger immer noch unterhalb <strong>de</strong>s<br />
Ran<strong>de</strong>s blieb, über welchen <strong>de</strong>r Überfluß abfloß bzw. abfließen<br />
mußte, war er <strong>de</strong>r unbelastete, privilegierte <strong>und</strong> unumstrittene<br />
Träger seiner <strong>Recht</strong>e. So war <strong>und</strong> blieb es durch die ganze Zeit<br />
<strong>de</strong>s Handwerks <strong>und</strong> <strong>de</strong>s bäuerlichen Lebensstils. Es herrschte<br />
also die rein quantitative Sicht <strong>de</strong>s Eigentums vor. Man dachte<br />
nicht an eine qualitative Bindung <strong>de</strong>s Eigentums innerhalb <strong>de</strong>r<br />
Produktion, daß z.B. die Verfügungsgewalt in irgen<strong>de</strong>iner<br />
Weise durch die Vertreter <strong>de</strong>r Arbeit mitbeansprucht wer<strong>de</strong>n<br />
könnte. Heute sind wir gewohnt, in <strong>de</strong>n Großbetrieben die Ver<br />
waltung in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n von vertraglich verpflichteten Direkto<br />
ren zu sehen. Der Manager ist ein neuer Typ im wirtschaftlichen<br />
Leben. Immer noch allerdings ist er sozialer Vertreter <strong>de</strong>s Kapi<br />
talbesitzers. Insofern bleibt die Verbindung zum Eigentümer<br />
398
noch gewahrt, wenngleich sie gera<strong>de</strong> im Hinblick auf das um- 66. 1/2<br />
fangreiche Kreditwesen äußerst locker gewor<strong>de</strong>n ist. Wir sind<br />
heute auch so weit vorgedrungen, daß auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Berufs<br />
stän<strong>de</strong> eine volle Parität zwischen Kapitalbesitzer <strong>und</strong> Arbeit<br />
nehmer besteht. Unsere Vorstellung vom Eigentum <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
damit verb<strong>und</strong>enen privaten Verfügung fin<strong>de</strong>t also in einer<br />
gewissen, wenn auch indirekten (nämlich über <strong>de</strong>n Berufsstand<br />
<strong>und</strong> die Wirtschaftspolitik sich bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n) Verfügungsbe<br />
schränkung nichts Frem<strong>de</strong>s mehr; d.h., wir haben auch eine<br />
qualitative soziale Belastung <strong>de</strong>s Eigentums anerkannt. Neuer<br />
dings geht <strong>de</strong>r Streit sogar so weit, daß die Parität auch auf <strong>de</strong>r<br />
Basis <strong>de</strong>s Betriebs betont wird, so daß das Zentrale <strong>de</strong>s Priva<br />
ten, nämlich die Verfügung, getroffen zu sein scheint. Es ist dies<br />
die bekannte Frage nach <strong>de</strong>m wirtschaftlichen Mitbestim<br />
mungsrecht im Betrieb.<br />
Was hier beson<strong>de</strong>rs interessiert, ist die Frage, in welchem<br />
Sinn die freie Verfügungsgewalt bei Thomas zu verstehen sei.<br />
Die Verfügungsgewalt, die nach Thomas <strong>de</strong>r Mittelpunkt <strong>de</strong>s<br />
Privateigentums ist, besteht nur um <strong>de</strong>s Gemeinwohls willen.<br />
Thomas hat darum diese Verfügungsfreiheit unmöglich im Sinn<br />
einer isolierten Freiheit verstehen können. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
besteht keine Schwierigkeit für das thomasische Denken, eine<br />
Beschränkung <strong>de</strong>r Verfügungsgewalt dort anzuerkennen, wo<br />
das Gemeinwohl sie for<strong>de</strong>rt. Es ist darum bei Thomas mit <strong>de</strong>r<br />
Verteidigung <strong>de</strong>r privaten Eigentumsordnung noch gar nichts<br />
über die Notwendigkeit einer freien o<strong>de</strong>r einer gelenkten Wirt<br />
schaft ausgemacht. Gewiß, die Präsumtion steht für die freie,<br />
aber: im Rahmen <strong>de</strong>s Gemeinwohls, <strong>und</strong> nicht nur das, son<strong>de</strong>rn<br />
sogar nur zur Wahrung <strong>de</strong>s Gemeinwohls. Es ist nun eine Frage<br />
<strong>de</strong>s wirtschaftswissenschaftlichen Wissens <strong>und</strong> <strong>de</strong>r klugen, ver<br />
antwortungsvollen Wirtschaftspolitik, zu entschei<strong>de</strong>n, ob im<br />
einzelnen Fall eine qualitative Beschränkung <strong>de</strong>s Eigentums,<br />
eine Beschränkung <strong>de</strong>r Verfügungsgewalt durch irgendwelche<br />
beteiligte Nicht-Eigentümer um <strong>de</strong>s Gemeinwohls willen<br />
gefor<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n müsse. Doch darf man nicht aus <strong>de</strong>m Auge<br />
verlieren, daß <strong>de</strong>r Eigentümer als Verwalter <strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>r Eigen<br />
tumslehre <strong>de</strong>s hl. Thomas bil<strong>de</strong>t. Um <strong>de</strong>n Eigentümer an seine<br />
Pflicht zu bin<strong>de</strong>n, sich als Verwalter im Sinn <strong>de</strong>s Gemeinwohls<br />
zu betrachten, sind gesetzliche Normen notwendig. Diese soll<br />
ten aber nicht zur Auflösung <strong>de</strong>s Verwaltungsrechts <strong>de</strong>s Eigen<br />
tümers führen.<br />
399
66. 1/2 Die Gr<strong>und</strong>legung <strong>de</strong>r privaten Eigentumsordnung im<br />
Gemeinwohl wirkt sich in bemerkenswerter Weise auf das<br />
mo<strong>de</strong>rne Problem <strong>de</strong>s Kapitalismus aus. Kapitalismus hat dabei<br />
nicht eine rein wirtschaftliche Funktion, be<strong>de</strong>utet hier auch<br />
nicht irgen<strong>de</strong>ine moralische Einstellung auf Gewinn, son<strong>de</strong>rn<br />
umfaßt einen w\nschz{t.srechtlich'en Inhalt, die Beziehung <strong>de</strong>r<br />
wirtschaftlichen Größe „Kapital" zum Eigentümer: Ein an<strong>de</strong>rer<br />
ist es, <strong>de</strong>r die Arbeit leistet, <strong>und</strong> ein an<strong>de</strong>rer, <strong>de</strong>r das Kapital gibt<br />
(Entsprechen<strong>de</strong>s gilt auch vom Zinsproblem, vgl. Fr. 78). Die<br />
kapitalistische Wirtschaftsweise ergibt sich unmittelbar aus <strong>de</strong>r<br />
privaten Eigentumsordnung. So lange im Produktionsprozeß<br />
die Betonung auf <strong>de</strong>m Privaten ruht, so lange ist auch die kapi<br />
talistische Wirtschaftsweise eine logische Notwendigkeit. Es<br />
kommt <strong>de</strong>mnach ganz darauf an, sich über <strong>de</strong>n metaphysisch<br />
ethischen Ort <strong>de</strong>r privaten Eigentumsordnung klar zu sein. Es<br />
wäre — je<strong>de</strong>nfalls in <strong>de</strong>r Denkweise <strong>de</strong>s hl. Thomas — gr<strong>und</strong>weg<br />
falsch, die private Eigentumsordnung als ein Apriori aufzufas<br />
sen im Sinn <strong>de</strong>s unwan<strong>de</strong>lbaren, ewig gleichbleiben<strong>de</strong>n Natur<br />
rechts. Thomas selbst hat sich in seinem Nachweis <strong>de</strong>s Privatei<br />
gentums sehr vorsichtig ausgedrückt, in<strong>de</strong>m er bei allen drei<br />
Grün<strong>de</strong>n die komparativische, nicht die absolute Form<br />
benützt: mehr Fleißaufwendung <strong>de</strong>s arbeiten<strong>de</strong>n Menschen,<br />
bessere Behandlung <strong>de</strong>r Güter, bessere Bewahrung <strong>de</strong>s allgemei<br />
nen Frie<strong>de</strong>ns (Art. 2). Das Apriori in <strong>de</strong>r Eigentumsfrage ist bei<br />
Thomas das Gemeinwohl. Wenn einmal die privatrechtliche<br />
Scheidung von Arbeit <strong>und</strong> Kapital im Produktionsprozeß vom<br />
Gemeinwohl her nicht mehr empfohlen o<strong>de</strong>r angezeigt wäre,<br />
dann wür<strong>de</strong> logischerweise die kapitalistische Wirtschaftsweise<br />
abgeschafft wer<strong>de</strong>n müssen. Doch besteht zu dieser Abschaf<br />
fung noch kein Gr<strong>und</strong>. Im Raum <strong>de</strong>s An-sich wäre sie aber<br />
durchaus <strong>de</strong>nkbar. Man wür<strong>de</strong> die kirchliche Soziallehre völlig<br />
verdrehen, wür<strong>de</strong> man die kapitalistische Wirtschaftsweise wie<br />
ein Dogma betrachten. Der Blick auf die Tradition <strong>de</strong>r kirchli<br />
chen Lehre dürfte hierüber genügend Aufschluß gegeben<br />
haben. Den Schlüssel zum Verständnis <strong>de</strong>r gesamten Zusam<br />
menhänge bietet nur ein gründliches Studium <strong>de</strong>s Wesens <strong>de</strong>s<br />
Naturrechts (vgl. Kommentar zu Fr. 57).<br />
400
B. DIE SITTLICHE BEWERTUNG DES DIEBSTAHLS<br />
UND DES RAUBES<br />
(Art. 3-9)<br />
Thomas bestimmt (Art. 3) mit <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>n Diebstahl<br />
als geheime Wegnahme einer frem<strong>de</strong>n Sache. Drei Momente<br />
sind in dieser Definition enthalten:<br />
1. Frem<strong>de</strong>s; dadurch wird im eigentlichen Sinn die Gerech<br />
tigkeit berührt. 2. Ein Sachgut; dadurch wird <strong>de</strong>r Diebstahl<br />
gegen Körperverletzung unterschie<strong>de</strong>n. 3. Geheim; hierdurch<br />
wird <strong>de</strong>r Unterschied gegen <strong>de</strong>n Raub angegeben.<br />
Es ist nun eigenartig, in welcher Weise Thomas <strong>de</strong>n Raub als<br />
vom Diebstahl wesentlich verschie<strong>de</strong>n nachweist. Wir wür<strong>de</strong>n<br />
heute sagen, daß <strong>de</strong>r Raub eine beson<strong>de</strong>re Erschwerung <strong>de</strong>s<br />
Diebstahls <strong>und</strong> darüber hinaus noch eine Bedrohung <strong>de</strong>r kör<br />
perlichen Unversehrtheit <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn be<strong>de</strong>utet, also von hier aus<br />
die Bewandtnis einer an<strong>de</strong>rn Art <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit annimmt.<br />
Thomas aber lag ein festes Schema vor, gemäß <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Raub<br />
eine einzig auf frem<strong>de</strong>s Sachgut gerichtete Ungerechtigkeit ist,<br />
so daß je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Gesichtspunkt wie <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r möglichen o<strong>de</strong>r<br />
wirklichen Körperverletzung unmittelbar nicht in Betracht<br />
kommt. Wie aber soll man <strong>de</strong>n Raub als eine beson<strong>de</strong>re Art <strong>de</strong>r<br />
Ungerechtigkeit erkennen, die sich auch vom Diebstahl wesent<br />
lich unterschei<strong>de</strong>t? Um nun diese eigene Wesensart <strong>de</strong>r Unge<br />
rechtigkeit zu wahren, erklärt Thomas, daß sowohl <strong>de</strong>r Dieb<br />
stahl wie auch <strong>de</strong>r Raub zwar eine Wegnahme frem<strong>de</strong>n Gutes<br />
gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn be<strong>de</strong>uten, daß aber eben dieser<br />
Unwille <strong>de</strong>s Bestohlenen o<strong>de</strong>r Beraubten bei Diebstahl <strong>und</strong> bei<br />
Raub je verschie<strong>de</strong>n sei. Beim Diebstahl äußert sich <strong>de</strong>r Unwille<br />
im reinen Nichtwollen <strong>de</strong>s Eigentümers, beim Raub im positi<br />
ven Wi<strong>de</strong>rstreben gegen die Gewalt.<br />
Man könnte sich allerdings fragen, ob die Ineinssetzung von<br />
Unwillen <strong>und</strong> reinem Nichtwollen, also <strong>de</strong>m völligen Fehlen<br />
jeglichen Willensaktes, angängig sei, da zur Ungerechtigkeit<br />
notwendigerweise vorausgesetzt wird, daß <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>m ein<br />
Unrecht geschieht, positiv unwillig ist o<strong>de</strong>r wenigstens als sol<br />
cher angenommen wird. Thomas selbst setzt in <strong>de</strong>m Prinzip,<br />
daß niemand mit Willen (wir wür<strong>de</strong>n sagen „mit Vergnügen")<br />
lei<strong>de</strong>t, voraus, daß man als Unwilliger <strong>und</strong> nicht bloß als Willen<br />
loser lei<strong>de</strong>.<br />
401
66. 3-9 Und <strong>de</strong>nnoch offenbart die Art, in welcher Thomas <strong>de</strong>n<br />
Diebstahl <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Raub voneinan<strong>de</strong>r unterschei<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>n mora<br />
lischen Zusammenhang mit <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> bzw. <strong>de</strong>r Unge<br />
rechtigkeit besser als je<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re Erklärung. Von seiten <strong>de</strong>ssen,<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Diebstahl begeht, genügt es, daß er absichtlich das<br />
Nicht-wissen <strong>de</strong>s Besitzers ben<strong>utz</strong>t, um an die Sache zu kom<br />
men. Wenngleich also vonseiten <strong>de</strong>s Besitzers noch keinerlei<br />
Unwille geäußert wor<strong>de</strong>n ist, noch überhaupt möglich war, so<br />
tritt doch das reine Nicht-wissen <strong>de</strong>s Besitzers in die moralische<br />
Bewertung <strong>de</strong>s Diebstahls, weil die Verheimlichung die Ursache<br />
<strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Diebstahls ist, wie Thomas ausdrücklich sagt<br />
(Art. 3 Zu 1). Demgegenüber bringt das Wissen <strong>de</strong>s Besitzers,<br />
das sich mit <strong>de</strong>m positiven Unwillen verbin<strong>de</strong>t, beim Raub eine<br />
ganz neue moralische Note hinein. Der Räuber rechnet das<br />
Wissen <strong>de</strong>s zu Berauben<strong>de</strong>n mit in sein Unternehmen ein, er<br />
überwin<strong>de</strong>t es — nicht wie beim Diebstahl durch Verheimli<br />
chung, da Verheimlichung natürlich ausgeschlossen ist, son<strong>de</strong>rn<br />
— durch Anwendung von Gewalt.<br />
Diebstahl ist immer Sün<strong>de</strong>, erklärt Thomas im 5. Artikel,<br />
<strong>und</strong> zwar schwere Sün<strong>de</strong>, wie es im sechsten Artikel heißt;<br />
<strong>de</strong>nn es wird damit zugleich auch die göttliche Liebe verletzt,<br />
die gebietet, daß man <strong>de</strong>n Nächsten achte, in<strong>de</strong>m man ihm<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> wi<strong>de</strong>rfahren läßt. Eine beson<strong>de</strong>re Note erhält<br />
diese Sün<strong>de</strong>, wenn sie zur Gewohnheit in <strong>de</strong>r Gesellschaft wird,<br />
weil dann die menschliche Gesellschaft in Gefahr ist (Art. 6).<br />
Diese Feststellung <strong>de</strong>s hl. Thomas verdient <strong>de</strong>swegen eigene<br />
Aufmerksamkeit, weil hier <strong>de</strong>r christlichen Liebe die Sorge um<br />
<strong>de</strong>n Bestand <strong>de</strong>r Gesellschaft aufgetragen wird, wenn auch<br />
nicht direkt, son<strong>de</strong>rn über die <strong>Gerechtigkeit</strong>. Selbstre<strong>de</strong>nd läßt<br />
Thomas im Bereich <strong>de</strong>s Diebstahls auch eine geringfügige<br />
Sache <strong>und</strong> damit eine läßliche Sün<strong>de</strong> zu (vgl. 59,4 Zu 1).<br />
Der Raub wird als schwerere Sün<strong>de</strong> erklärt als <strong>de</strong>r Diebstahl,<br />
weil dabei nicht nur das Nicht-wissen eines an<strong>de</strong>rn listig ausge<br />
n<strong>utz</strong>t, son<strong>de</strong>rn direkt gegen das Wissen mit Gewalt vorgegan<br />
gen wird (Art. 9). Ferner — <strong>und</strong> damit berührt Thomas mehr<br />
<strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong>, <strong>de</strong>n wir in <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen Moralbüchern fin<strong>de</strong>n — ist<br />
<strong>de</strong>r Raub nicht nur auf die Sache, son<strong>de</strong>rn auch auf die Person<br />
gerichtet, welche unmittelbar bedroht wird.<br />
Von beson<strong>de</strong>rem, sowohl praktischem wie auch wissen<br />
schaftlichem Interesse sind die bei<strong>de</strong>n Artikel 7 <strong>und</strong> 8, worin<br />
Thomas <strong>de</strong>r Frage nachgeht, ob es Fälle von heimlicher <strong>und</strong><br />
402
gewaltsamer Wegnahme materieller Güter gäbe, in <strong>de</strong>nen von 66. 3-9<br />
Diebstahl o<strong>de</strong>r Raub <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Folge von Sün<strong>de</strong> keine Re<strong>de</strong><br />
mehr sein könne. Theoretisch ist die Frage von Interesse, inso<br />
fern bei <strong>de</strong>r heimlichen Wegnahme das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s Armen <strong>und</strong><br />
Notlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n <strong>und</strong> bei <strong>de</strong>r gewaltsamen Wegnahme, das <strong>Recht</strong><br />
<strong>de</strong>s Staates abgeklärt wird. Praktisch hat diese Frage ihre eigene<br />
Be<strong>de</strong>utung, weil darin be<strong>de</strong>utsame gesellschaftliche Bewegun<br />
gen, wie die Revolution <strong>de</strong>s Proletariats gegen die Besitzen<strong>de</strong>n,<br />
<strong>und</strong> politische Maßnahmen, wie die <strong>de</strong>r Verstaatlichungen, ihre<br />
Beurteilung erhalten.<br />
Verliert aus irgen<strong>de</strong>inem Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Besitzer, <strong>de</strong>r bisher<br />
Eigentümer von Gütern war, sein Eigentumsrecht, ohne daß er<br />
selbst darauf verzichtet? Wenn ja, dann ergibt sich ohne weite<br />
res, daß zumin<strong>de</strong>st eine heimliche Wegnahme ohne Diebstahl<br />
erlaubt ist. Es fragt sich dann nur noch, ob auch mit Gewalt <strong>de</strong>r<br />
Abtransport durch <strong>de</strong>n neuen Eigentümer besorgt wer<strong>de</strong>n<br />
könne. Thomas behan<strong>de</strong>lt diese bei<strong>de</strong>n Teile getrennt, in<strong>de</strong>m er<br />
zunächst (Art. 7) die Frage stellt, ob es in äußerster Not erlaubt<br />
sei, frem<strong>de</strong>s Gut geheim, wie im Diebstahl, wegzunehmen,<br />
dann in Art. 8, ob man ohne Sün<strong>de</strong> frem<strong>de</strong>s Gut mit Gewalt,<br />
wie beim Raub, <strong>de</strong>m Besitzer entreißen dürfe.<br />
Thomas greift <strong>de</strong>n Inhalt <strong>de</strong>s ersten Artikels auf, in<strong>de</strong>m er auf<br />
<strong>de</strong>n negativen Kommunismus, also auf die soziale Belastung<br />
jeglichen Eigentums, vor allem <strong>de</strong>s Überflusses hinweist. Und<br />
zwar nennt er diese soziale Belastung eine naturrechtliche.<br />
Wenn darum ein Notlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r in äußerster Not sich nicht<br />
an<strong>de</strong>rs helfen kann, als in<strong>de</strong>m er frem<strong>de</strong>s Gut heimlich entwen<br />
<strong>de</strong>t, dann verwirklicht er im Gr<strong>und</strong>e nur die in <strong>de</strong>r Natur lie<br />
gen<strong>de</strong> Zielbestimmung <strong>de</strong>r Güter. Denn in diesem Falle verliert<br />
<strong>de</strong>r Besitzer <strong>de</strong>s Überflusses sein <strong>Recht</strong>. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
kann man hier auch nicht mehr von Diebstahl re<strong>de</strong>n. Ja, Tho<br />
mas erweitert <strong>de</strong>n ursprünglich gewollten Rahmen <strong>de</strong>s Arti<br />
kels, in<strong>de</strong>m er hinzufügt, daß man auch nicht von Raub spre<br />
chen könne, nämlich für <strong>de</strong>n Fall, daß <strong>de</strong>r Notlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> sich <strong>de</strong>n<br />
frem<strong>de</strong>n Überfluß mit Gewalt holen wür<strong>de</strong>.<br />
Der Kern <strong>de</strong>s siebten Artikels liegt in <strong>de</strong>m Satz, <strong>de</strong>m wir<br />
bereits begegnet sind: „Deshalb ist das, was einige im Überfluß<br />
besitzen, <strong>de</strong>n Armen zu ihrem Lebensunterhalt geschul<strong>de</strong>t<br />
(<strong>de</strong>bentur)". Durchweg wird dieser Begriff „<strong>de</strong>bentur" als<br />
ethische For<strong>de</strong>rung aufgefaßt <strong>und</strong> darum mit „wird geschul<strong>de</strong>t"<br />
übersetzt. Dies besagt aber nicht, daß es sich einzig um eine<br />
403
66. 3-9 Liebespflicht han<strong>de</strong>lt. Vielmehr liegt dieser ethischen Pflicht<br />
eine naturrechtliche zugr<strong>und</strong>e, wie Thomas ausdrücklich<br />
betont. Und in <strong>de</strong>r Tat wird diese latente <strong>Recht</strong>spflicht auch zu<br />
einem gewaltsam erzwingbaren <strong>Recht</strong>, wenn <strong>de</strong>r Notlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
keinen an<strong>de</strong>rn Weg mehr sieht, um <strong>de</strong>r Gefahr <strong>de</strong>s Verhungerns<br />
zu entgehen. Wenn also einer aus sich von seinem Überfluß<br />
gibt, dann ist in dieser großzügigen Tat nur ein Bruchteil von<br />
Liebe; <strong>de</strong>n größeren Anteil hat die soziale <strong>Gerechtigkeit</strong>. Die<br />
Tat ist Liebe, insofern <strong>de</strong>r Geber frei han<strong>de</strong>lt, d. h. insofern das<br />
Gesetz sie noch nicht gefor<strong>de</strong>rt hat, obwohl es sie bereits hätte<br />
for<strong>de</strong>rn können. Also gewissermaßen nur die Antizipation<br />
einer an sich gesetzlich möglichen Regelung durch freie Ent<br />
scheidung ist ein Werk <strong>de</strong>r Liebe. Der tiefere Gr<strong>und</strong> dieser soge-<br />
nannten „Liebestat" gehört <strong>de</strong>r sozialen <strong>Gerechtigkeit</strong> an.<br />
Ohne Zweifel ist Thomas in diesem Sinn auszulegen. Die<br />
schroffe Formel <strong>de</strong>s hl. Augustinus, daß <strong>de</strong>r Überfluß <strong>de</strong>n<br />
Armen „gehöre", ist gemil<strong>de</strong>rt entsprechend <strong>de</strong>r sozialen Ange<br />
messenheit <strong>und</strong> Notwendigkeit <strong>de</strong>r privaten Eigentumsord<br />
nung. Wollte man allerdings rein philologisch die Texterklärung<br />
vornehmen, dann könnte man versucht sein, das „<strong>de</strong>bentur"<br />
mit „gehört" zu übersetzen, so daß man nichts an<strong>de</strong>res als die<br />
augustinische Formulierung hätte. In Art. 5 Zu 1 gebraucht<br />
nämlich Thomas dasselbe Wort, diesmal aber nicht lediglich zur<br />
Bezeichnung einer ethischen Schuld, son<strong>de</strong>rn eines vollgültigen<br />
<strong>Recht</strong>sverhältnisses. Er spricht dort von <strong>de</strong>r richterlichen Be<br />
fugnis, die Eigentumsverhältnisse zu bestimmen, so daß nach<br />
<strong>de</strong>m richterlichen Urteil die Sache jenem wirklich gehört, <strong>de</strong>m<br />
sie zugesprochen wor<strong>de</strong>n ist. Ein Beweis, wie wenig Thomas<br />
sich an eine durchgängige Terminologie bin<strong>de</strong>t.<br />
Die gewaltsame Enteignung wird <strong>de</strong>r öffentlichen Gewalt<br />
zugestan<strong>de</strong>n, sofern diese die Ordnung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
durchführen will (Art. 8). Thomas <strong>de</strong>nkt hier wohl beson<strong>de</strong>rs<br />
an die gewaltsame Eintreibung <strong>de</strong>r pflichtgemäßen Abgaben<br />
<strong>de</strong>r Untertanen. Daran erinnert beson<strong>de</strong>rs die Antwort auf <strong>de</strong>n<br />
dritten Einwand in Artikel 8.<br />
In diesen Problemkreis gehört auch <strong>de</strong>r augustinische<br />
Gedanke, daß die Ungläubigen zu Unrecht ihren Besitz als ihr<br />
eigen betrachten <strong>und</strong> ihn darum eigentlich <strong>de</strong>n Gläubigen zu<br />
erstatten hätten. Es scheint also, so erklärt <strong>de</strong>r zweite Einwand<br />
in Artikel 8, daß man <strong>de</strong>n Ungläubigen das vermeintliche<br />
Eigentum mit Gewalt abnehmen könne. Thomas gibt hierauf<br />
404
eine salomonische Antwort: Die Ungläubigen besitzen ihr 66. 3-9<br />
Eigentum dann zu Unrecht, wenn sie es auf Befehl <strong>de</strong>r öffentli<br />
chen Gewalt hin abgeben müßten; es kann darum kein Privat<br />
mann, son<strong>de</strong>rn nur die Obrigkeit eine gewaltsame Wegnahme<br />
vornehmen. Auf <strong>de</strong>n augustinischen Gedanken, daß die Un<br />
gläubigen von vornherein kein Anrecht auf Eigentum hätten,<br />
geht Thomas direkt nicht ein. Seine vorsichtige Antwort läßt<br />
aber erkennen, daß er die augustinische These ablehnt, da er<br />
<strong>de</strong>n Entscheid über die Eigentumsverhältnisse <strong>de</strong>r Ungläubigen<br />
— wie überhaupt jegliche rechtliche Regelung <strong>de</strong>s Eigentums —<br />
<strong>de</strong>m Gesetzgeber überläßt, <strong>de</strong>r gemäß <strong>de</strong>n For<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r<br />
natürlichen <strong>Gerechtigkeit</strong> zu urteilen hat.<br />
IV. Die Ungerechtigkeiten im gerichtlichen Prozeß<br />
(Fr. 67-71)<br />
Unter <strong>de</strong>n Schädigungen <strong>de</strong>s Nächsten durch Worte, von<br />
<strong>de</strong>nen Thomas in <strong>de</strong>n Fragen 67—76 spricht, wer<strong>de</strong>n zunächst<br />
jene besprochen, welche im gerichtlichen Prozeß geschehen<br />
(Fr. 67—71). Im großen <strong>und</strong> ganzen sind diese Fragen fast nur<br />
von historischem Interesse. Thomas versucht hier, das damalige<br />
Prozeßverfahren mit naturrechtlichen Argumenten zu stützen,<br />
ohne sich aber auf Einzelheiten einzulassen. 17<br />
l.DIE UNGERECHTIGKEITEN VONSEITEN DES RICHTERS<br />
(Fr. 67)<br />
Der Richter wird von Thomas an die schwere Verantwortung 67<br />
erinnert, die auf ihm lastet, da er nicht nur ausführen<strong>de</strong>s Organ,<br />
son<strong>de</strong>rn auch in Wahrheit selbst <strong>Recht</strong>serzeuger ist. Im 1. Arti<br />
kel steckt Thomas die Grenzen <strong>de</strong>s richterlichen Wirkens ab,<br />
in<strong>de</strong>m er erklärt, daß <strong>de</strong>r Richter nur über jene Befugnis habe,<br />
welche <strong>de</strong>m Gesetz, <strong>de</strong>m er dient, unterworfen sind.<br />
Als Vertreter <strong>de</strong>r öffentlichen Autorität hat <strong>de</strong>r Richter nicht<br />
gemäß privatem Wissen, son<strong>de</strong>rn nach <strong>de</strong>n öffentlich beigezo<br />
genen Zeugen zu richten (Art. 2). Das private Wissen kann ihm<br />
Die zeitgenössischen Parallelen fin<strong>de</strong>t man bei E. Chenon, Histoire generale<br />
du Droit Francais Public et Prive <strong>de</strong>s origines ä 1915, T. 1—2, Paris 1926 <strong>und</strong><br />
1929. Vgl. auch Fr. Olivier-Martin, Histoire du Droit Francais <strong>de</strong>s origines ä<br />
la Revolution, 1948.<br />
405
67 dabei höchstens Anlaß zu genauerer Überprüfung <strong>de</strong>r verschie<br />
<strong>de</strong>nen Zeugenaussagen geben. Das Urteil selbst aber hat nach<br />
<strong>de</strong>n Zeugenaussagen zu erfolgen, <strong>de</strong>nn in <strong>de</strong>m, was zur öffentli<br />
chen Gewalt gehört, muß <strong>de</strong>r Richter sein Gewissen bestim<br />
men nach <strong>de</strong>m, „was in einem öffentlichen Gerichtsverfahren<br />
herauskommen kann" (Art. 2 Zu 4). Wir haben also hier nicht<br />
die freie Beweiswürdigkeit durch <strong>de</strong>n Richter. Heute wür<strong>de</strong> ein<br />
Richter, <strong>de</strong>r aus privatem Wissen einen Prozeßfall aufklären<br />
kann, in <strong>de</strong>n Ausstand treten.<br />
Wo kein Kläger ist, gibt es auch keinen Prozeß, erklärt Tho<br />
mas im 3. Artikel. Die Institution <strong>de</strong>r Staatsanwaltschaft kannte<br />
man noch nicht. Ein öffentliches Verbrechen bedurfte allerdings<br />
keines Klägers (Art. 3 Zu 2).<br />
Thomas macht mit seinen Zeitgenossen einen Unterschied<br />
zwischen Anzeige <strong>und</strong> Anklage. Die Anzeige ist lediglich auf die<br />
Besserung <strong>de</strong>s Delinquenten gerichtet, keineswegs auf die<br />
Bestrafung im Sinn <strong>de</strong>r öffentlichen Sühne (Art. 3 Zu 2). Sie<br />
spielt im Inquisitionsverfahren eine beson<strong>de</strong>re Rolle (vgl. Anm.<br />
[51]). Die Anklage dagegen be<strong>de</strong>utet die formelle For<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r ganzen <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Die Frage, ob <strong>de</strong>r Richter aus eigener Vollmacht eine Strafe<br />
erlassen o<strong>de</strong>r mil<strong>de</strong>rn könne, verneint Thomas (Art. 4) aus<br />
zweifacher Begründung: l.um <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s <strong>de</strong>s Klägers willen,<br />
2. um <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s <strong>de</strong>r Gemeinschaft willen.<br />
2. DIE UNGERECHTIGKEITEN VONSEITEN DES KLÄGERS<br />
(Fr. 68)<br />
68 Die Pflicht zur Anklage besteht nur dort, wo das Gemein<br />
wohl in Frage steht (Art. 1). Um <strong>de</strong>s Gemeinwohls willen hat,<br />
wie Thomas (Art. 1 Zu 3) mit Bestimmtheit erklärt, auch das<br />
Siegel <strong>de</strong>r Verschwiegenheit zu weichen, ausgenommen natür<br />
lich das Beichtsiegel (Fr. 70,1).<br />
Die For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r schriftlichen Abgabe <strong>de</strong>r Anklage befür<br />
wortet Thomas um <strong>de</strong>r Klarheit <strong>und</strong> Sicherheit willen (Art. 2).<br />
Das mittelalterliche <strong>Recht</strong> unterschied drei Arten von Unge<br />
rechtigkeiten vonseiten <strong>de</strong>s Klägers (Art. 3): 1 .Verleumdung,<br />
d. h. falsche Anklage; 2. Begünstigung <strong>de</strong>s Angeklagten, in<strong>de</strong>m<br />
<strong>de</strong>r Kläger mit <strong>de</strong>m Angeklagten aus irgen<strong>de</strong>inem Gr<strong>und</strong><br />
gemeinsame Sache macht; 3. unbegrün<strong>de</strong>tes Zurücktreten vom<br />
Prozeß.<br />
406
Nach kanonischem <strong>Recht</strong> (Decr. Grat., P. II, causa II, 68<br />
q. 3, c. 2; Frdbl, 451), das hierin römischem Brauch folgte, war<br />
ein verleum<strong>de</strong>rischer Ankläger mit eben<strong>de</strong>rselben Strafe zu<br />
ahn<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ren das Verbrechen wert war, das er <strong>de</strong>m Mitmen<br />
schen angedichtet hatte. Thomas (Art. 4) verteidigt dieses<br />
<strong>Recht</strong> mit <strong>de</strong>m Hinweis auf <strong>de</strong>n Sinn <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, gemäß<br />
welcher man Gleiches mit Gleichem vergilt. Das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Wie<br />
<strong>de</strong>rvergeltung (jus talionis) wird so zum Naturrecht erklärt, ein<br />
Gedanke, <strong>de</strong>r bezüglich seines metaphysischen Gehalts bereits<br />
dargestellt wor<strong>de</strong>n ist (vgl. Kommentar zu 64,2).<br />
3.DIE UNGERECHTIGKEITEN VONSEITEN DES ANGEKLAGTEN<br />
(Fr. 69)<br />
Sofern <strong>de</strong>r Richter gemäß <strong>de</strong>n im Prozeßrecht vorgeschrie- 69<br />
benen Normen eine zum Prozeß gehören<strong>de</strong> Frage an <strong>de</strong>n<br />
Angeklagten richtet, ist dieser verpflichtet, von <strong>de</strong>r Wahrheit<br />
Zeugnis zu geben (Art. 1). Eine unwahre Antwort wäre ein<br />
Unrecht gegen <strong>de</strong>n Vorgesetzten, <strong>de</strong>m zu gehorchen je<strong>de</strong>r Un<br />
tergebene die <strong>Gerechtigkeit</strong>spflicht hat (Art. 1 Zu 2). Außer<strong>de</strong>m<br />
be<strong>de</strong>utet eine Lüge vor Gericht eine doppelte Sün<strong>de</strong> gegen die<br />
Liebe: gegen die Liebe zu Gott, <strong>de</strong>m obersten Richter; gegen<br />
die Liebe zum Nächsten, im Hinblick auf <strong>de</strong>n Kläger, <strong>de</strong>r unge<br />
rechterweise als Verleum<strong>de</strong>r bestraft wird (Art. 1 Zu 3).<br />
Natürlich kann <strong>de</strong>r Angeklagte, so erklärt Thomas (Art. 2),<br />
die Antwort verweigern, wo <strong>de</strong>r Richter gemäß <strong>de</strong>m Prozeß<br />
recht nicht fragen darf. Ein zielloses, vom Gegenstand <strong>de</strong>r<br />
Anklage abweichen<strong>de</strong>s Ausfragen verpflichtet nicht zum<br />
Bekenntnis. Schweigen ist also hier erlaubt, nicht jedoch eine<br />
unwahre Aussage. Das Urteil <strong>de</strong>s hl. Thomas mag hart erschei<br />
nen. Es erklärt sich aber aus <strong>de</strong>r betont ethischen Sicht <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Gemeinschaft, die beson<strong>de</strong>rs auch in <strong>de</strong>r Lösung<br />
<strong>de</strong>s l.Einwands <strong>de</strong>utlich wird, wo Thomas erklärt, daß das,<br />
was durch positive Gesetze nicht geahn<strong>de</strong>t wird, noch lange<br />
nicht als gerecht anzusehen sei. Der Co<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s kanonischen<br />
<strong>Recht</strong>s von 1917 enthält dagegen folgen<strong>de</strong> mil<strong>de</strong>re Bestim<br />
mung: „Dem rechtmäßig fragen<strong>de</strong>n Richter müssen sie (die<br />
Parteien) antworten <strong>und</strong> die Wahrheit bekennen, es sei <strong>de</strong>nn, es<br />
handle sich um ein Vergehen, das von ihnen selbst begangen<br />
wor<strong>de</strong>n ist" (can. 1743 § 1. Im Co<strong>de</strong>x von 1983 can. 1548 in glei<br />
chem Sinn, nur kürzer).<br />
407
69 Das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Berufung darf nach Thomas (Art. 3) nur in<br />
Anspruch genommen wer<strong>de</strong>n, wenn die Berufung im Dienst<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> steht, nicht aber etwa zum Zweck <strong>de</strong>r Ver<br />
schleierung o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Strafaufschubs. Die Berufung eines Katho<br />
liken vor ein nichtkatholisches Gericht wird verworfen aus <strong>de</strong>m<br />
altbekannten Mißtrauen gegenüber <strong>de</strong>n Hei<strong>de</strong>n, das hier in die<br />
Worte geklei<strong>de</strong>t wird: „Wo <strong>de</strong>r wahre Glaube fehlt, besteht auch<br />
kein richtiges Verhältnis zu <strong>de</strong>m, was gerecht ist" (Art. 3 Zu 1).<br />
Einem gerechterweise zum Tod Verurteilten ist <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>r<br />
stand nicht erlaubt (Art. 4). Wohl aber darf er, <strong>de</strong>m natürlichen<br />
Drang nach Existenz folgend, aus <strong>de</strong>m Kerker entweichen,<br />
wenn es ihm ohne Wi<strong>de</strong>rstand gelingt (Art. 4 Zu 2), o<strong>de</strong>r sich<br />
auf geheimem Weg Nahrung verschaffen, falls er zum Hunger<br />
tod verurteilt wor<strong>de</strong>n ist. Einem ungerechterweise zum Tod<br />
Verurteilten ist es erlaubt, sich aktiv zu wi<strong>de</strong>rsetzen wie gegen<br />
einen ungerechten Angreifer, jedoch nur dann, wenn aus <strong>de</strong>m<br />
Wi<strong>de</strong>rstand nicht große Verwirrung in <strong>de</strong>r sozialen Ordnung<br />
entsteht (Art. 4 Antw.).<br />
4. DIE UNGERECHTIGKEITEN VONSEITEN DER ZEUGEN<br />
(Fr. 70)<br />
70 Die Pflicht im Zeugenstand zu erscheinen, besteht nach Tho<br />
mas (Art. 1) erstens, wenn die Obrigkeit in rechtlicher Form um<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> willen dies verlangt. Diese <strong>Recht</strong>mäßigkeit<br />
beschränkt sich auf die Fälle, die allgemein bekannt sind o<strong>de</strong>r<br />
wo <strong>de</strong>r Delinquent sich bereits <strong>de</strong>n öffentlichen Ehrverlust<br />
zugezogen hat. Ein gegebenes Versprechen zum Schweigen<br />
entbin<strong>de</strong>t von <strong>de</strong>r Pflicht <strong>de</strong>r Zeugenaussage, es sei <strong>de</strong>nn, das<br />
Gemeinwohl stehe in Gefahr. Gegen das Gemeinwohl gibt es<br />
keine bin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Schweigepflicht, <strong>de</strong>nn nichts kann gegen das<br />
Naturrecht geboten wer<strong>de</strong>n (Art. 1 Zu 1). Zweitens, wenn zur<br />
gerechten Rettung <strong>de</strong>s Angeklagten das Zeugnis irgendwie<br />
etwas beizutragen vermag. Nicht dagegen ist <strong>de</strong>r Wissen<strong>de</strong> zur<br />
unaufgefor<strong>de</strong>rten Zeugenaussage verpflichtet, wenn <strong>de</strong>m ver<br />
leum<strong>de</strong>rischen Kläger aus <strong>de</strong>r Verlegenheit geholfen wer<strong>de</strong>n<br />
sollte. Denn in diesem Falle gilt das jus talionis. Der Kläger ern<br />
tet dann selbst die gerechten Folgen seiner Verleumdung.<br />
Im Anschluß an die Hl. Schrift (vgl. Art. 2 Dagegen) meint<br />
Thomas, daß im allgemeinen drei Zeugen genügen, worunter<br />
auch die Aussage <strong>de</strong>s Klägers begriffen sei (Art. 2). Eine abso-<br />
408
lute Sicherheit könne man ohnehin niemals vom richterlichen 70<br />
Urteil erwarten, son<strong>de</strong>rn nur eine moralische. Allerdings sei<br />
(Art. 2 Zu 3) eine umfangreichere Zeugenaussage nötig, wenn<br />
<strong>de</strong>r Angeklagte ein kirchlicher Oberer sei, erstens, weil man<br />
einem kirchlichen Wür<strong>de</strong>nträger um seiner hohen Moral willen,<br />
aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>ssen er zu diesem Amt erwählt wur<strong>de</strong>, mehr Ver-<br />
läßlichkeit zutrauen könne als mehreren Zeugen; zweitens, weil<br />
Vorgesetzte leicht Gegenstand <strong>de</strong>s Hasses seien; drittens, weil<br />
die [ungenügend begrün<strong>de</strong>te] Verurteilung eines solchen Wür<br />
<strong>de</strong>nträgers <strong>de</strong>m Ansehen <strong>de</strong>r Kirche scha<strong>de</strong>n könnte.<br />
Aus verschie<strong>de</strong>nen Grün<strong>de</strong>n verdient eine Zeugenaussage<br />
von vornherein Mißtrauen (Art. 3), so, wenn es sich um das<br />
Zeugnis eines Ungläubigen o<strong>de</strong>r eines Menschen han<strong>de</strong>lt, <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r öffentlichen Ehre verlustig ist; ferner bei Kin<strong>de</strong>rn, Irren <strong>und</strong><br />
Frauen, bei Zeugnissen von Fein<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Verwandten <strong>de</strong>s<br />
Angeklagten, selbst auch von Armen <strong>und</strong> Dienern, die leicht<br />
durch irgendwelches Einre<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Bestechung zu falschen<br />
Aussagen verleitet wer<strong>de</strong>n können.<br />
Das falsche Zeugnis ist Sün<strong>de</strong> (Art. 4), <strong>und</strong> zwar erstens auf<br />
gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Meinei<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>r immer damit verb<strong>und</strong>en ist. Meineid<br />
ist immer schwere Sün<strong>de</strong>. Zweitens um <strong>de</strong>r Verletzung <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> willen, <strong>und</strong> hier han<strong>de</strong>lt es sich im allgemeinen,<br />
sofern nämlich be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Scha<strong>de</strong>n angerichtet wird, um eine<br />
schwere Sün<strong>de</strong>. Drittens um <strong>de</strong>r Lüge willen, die im falschen<br />
Zeugnis liegt; um dieses Gesichtspunkts willen braucht aller<br />
dings nicht immer eine schwere Sün<strong>de</strong> vorzuliegen.<br />
Wenn ein Zeuge durch falsche Aussage einen Angeklagten<br />
von einem ungerechten Urteil befreien o<strong>de</strong>r bewahren will, be<br />
geht er zwar keine Sün<strong>de</strong> gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>, er versündigt<br />
sich aber doch schwer durch <strong>de</strong>n Meineid, <strong>de</strong>n er dabei leistet<br />
(Art. 4 Zu 2).<br />
5. DIE UNGERECHTIGKEITEN VONSEITEN DES ANWALTS<br />
(Fr. 71)<br />
Einem Armen unentgeltlich <strong>Recht</strong>sbeistand zu leisten, ist ein 71<br />
Werk <strong>de</strong>r Barmherzigkeit, das dann, wenn <strong>de</strong>m Betreffen<strong>de</strong>n<br />
nicht an<strong>de</strong>rs geholfen wür<strong>de</strong>, von je<strong>de</strong>m Anwalt erwartet wer<br />
<strong>de</strong>n muß, an <strong>de</strong>n sich <strong>de</strong>r Arme in seiner Not wen<strong>de</strong>t (Art. 1).<br />
Thomas ist Realist genug, um einzusehen, daß ein <strong>Recht</strong>sanwalt<br />
seine Tätigkeit nicht einzig in <strong>de</strong>n Dienst <strong>de</strong>r Armen stellen<br />
409
71 kann. Bei allem Lob auf die Barmherzigkeit <strong>und</strong> bei aller Aner<br />
kennung <strong>de</strong>r Pflicht gegen Notlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> nimmt Thomas <strong>de</strong>n<br />
Anwalt in Sch<strong>utz</strong> vor Ausn<strong>utz</strong>ung vonseiten <strong>de</strong>rer, die unent<br />
geltlich <strong>Recht</strong>sbeistand suchen.<br />
Daß zum Amt <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>sanwalts beson<strong>de</strong>re physische wie<br />
moralische Bedingungen verlangt sind, versteht sich von selbst.<br />
Thomas bespricht diese im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r damaligen<br />
<strong>Recht</strong>sordnung im 2. Artikel.<br />
Energisch verbietet Thomas, dort <strong>Recht</strong>sbeistand zu leisten,<br />
wo es sich um eine ungerechte Sache han<strong>de</strong>lt (Art. 3).<br />
Der Anwalt, so erklärt er, sündigt schwer, wenn er seine<br />
<strong>Recht</strong>shilfe einem ungerechten Fall zur Verfügung stellt. Außer<br />
<strong>de</strong>m ist er dann verpflichtet, <strong>de</strong>n verursachten Scha<strong>de</strong>n voll <strong>und</strong><br />
ganz wie<strong>de</strong>rg<strong>utz</strong>umachen. Sofern er erst im Verlauf <strong>de</strong>s Prozes<br />
ses auf die Ungerechtigkeit <strong>de</strong>s Klienten stoßen sollte, wird er<br />
natürlich nur mit größter Vorsicht <strong>de</strong>n Fall abgeben, um nicht<br />
seinen Klienten zu verraten <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Gegner zu unterstützen<br />
(Art. 3 Zu 2).<br />
Bis ins 19. Jahrh<strong>und</strong>ert bestand in Frankreich das Honorar<br />
<strong>de</strong>s Anwalts in <strong>de</strong>r freien Gabe <strong>de</strong>s Klienten. Thomas fragt<br />
daher im Artikel auch nicht, ob <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sanwalt für seine Lei<br />
stung etwas verlangen, son<strong>de</strong>rn nur, ob er dafür etwas „neh<br />
men" könne. Natürlich will dies nicht besagen, daß <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>s<br />
anwalt überhaupt nichts erwarten, son<strong>de</strong>rn das Honorar höch<br />
stens als zufällige Gabe entgegennehmen dürfe. Immerhin<br />
bestand zwischen <strong>de</strong>m Anwalt <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Klienten das nicht aus<br />
gesprochene Verhältnis zweier Kontrahenten. In<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Klient<br />
beim <strong>Recht</strong>sanwalt Rat <strong>und</strong> Hilfe suchte, verpflichtete er sich<br />
stillschweigend zur Leistung eines „angemessenen" Honorars;<br />
angemessen: entsprechend seiner persönlichen Stellung, ent<br />
sprechend <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Falles <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Maß <strong>de</strong>r vom<br />
<strong>Recht</strong>sanwalt gefor<strong>de</strong>rten Arbeit, <strong>und</strong> nicht zuletzt entspre<br />
chend <strong>de</strong>n allgemeinen Gewohnheiten (bzgl. <strong>de</strong>r Honorierung<br />
<strong>de</strong>s Richters <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Zeugen vgl. Art. 4 Zu 3).<br />
410
V. Die außergerichtlichen,<br />
durch Worte verursachten Ungerechtigkeiten<br />
(Fr. 72-76)<br />
l.Die Schmähung (Fr. 72). — Sittliche Fehler, wahre o<strong>de</strong>r 72<br />
angedichtete, eines Menschen in <strong>de</strong>ssen Gegenwart vor <strong>de</strong>r<br />
Öffentlichkeit ausbreiten, ist Schmähung, eine Sün<strong>de</strong> gegen die<br />
Ehre <strong>de</strong>s Menschen <strong>und</strong> damit eine Sün<strong>de</strong> gegen die Gerechtig<br />
keit (Art. 1). Thomas unterschei<strong>de</strong>t die Schmähung (contume-<br />
lia) von <strong>de</strong>r Beschimpfung (convicium) <strong>und</strong> von <strong>de</strong>r Vorhaltung<br />
(improperium), insofern die Schmähung eigentlich nur sittliche<br />
Fehler <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn betrifft, während bei <strong>de</strong>r Beschimpfung allge<br />
mein jegliche Mängel, ob nun sittlicher, psychischer o<strong>de</strong>r kör<br />
perlicher Art, vor <strong>de</strong>r Öffentlichkeit ausgebreitet <strong>und</strong> bei <strong>de</strong>r<br />
Vorhaltung <strong>de</strong>m Nächsten die soziale Abhängigkeit, früher<br />
empfangene Wohltaten in peinlicher Weise öffentlich in Erinne<br />
rung gerufen wer<strong>de</strong>n (Art. 1 Zu 3).<br />
In <strong>de</strong>r Beurteilung solcher Ungerechtigkeiten ist Thomas<br />
sehr streng (Art. 2). Er erklärt kategorisch, daß es sich dabei um<br />
eine schwere Sün<strong>de</strong> handle, <strong>und</strong> zwar „nicht weniger als beim<br />
Diebstahl <strong>und</strong> beim Raub". Auch <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r nicht direkt die<br />
Entehrung <strong>de</strong>s Nächsten beabsichtige, sich aber doch seines<br />
bösen Re<strong>de</strong>ns bewußt sei, begehe eine schwere Sün<strong>de</strong> (Art. 2<br />
Antw.). Thomas wür<strong>de</strong> heute wohl nicht mil<strong>de</strong>r sprechen, in<br />
unserem Zeitalter, in <strong>de</strong>m eine vielleicht be<strong>de</strong>utungslos erschei<br />
nen<strong>de</strong> Kritik, in kleinem Kreis gesprochen, rasch durch die Zei<br />
tungen <strong>und</strong> über <strong>de</strong>n Äther <strong>de</strong>n Weg in die breiteste Öffentlich<br />
keit nimmt <strong>und</strong> einen nie mehr wie<strong>de</strong>rg<strong>utz</strong>umachen<strong>de</strong>n Ehren<br />
raub be<strong>de</strong>uten kann.<br />
Dieser Strenge wi<strong>de</strong>rspricht in<strong>de</strong>s nicht das heitere Verständ<br />
nis <strong>de</strong>s Heiligen für <strong>de</strong>n Spaß, in welchem unter Fre<strong>und</strong>en über<br />
die Fehler <strong>de</strong>r einzelnen mit Humor hergezogen wird (Art. 2<br />
Zu 1).<br />
Das gol<strong>de</strong>ne Maß <strong>de</strong>r Mitte, das die Ethik <strong>de</strong>s hl. Thomas<br />
auszeichnet, wird im 3. Artikel <strong>de</strong>utlich sichtbar, wo, im<br />
Anschluß an das christliche Ethos vom schweigen<strong>de</strong>n Ertragen,<br />
die Frage erörtert wird, ob man Schmähungen stumm hinneh<br />
men solle. Für Thomas sind die Gewissensnormen keine Sche<br />
men, die sich unverän<strong>de</strong>rt auf die konkreten Umstän<strong>de</strong> anwen<br />
<strong>de</strong>n lassen. Für ihn, <strong>de</strong>m die Klugheit die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Gewis<br />
sensnorm ist, kann darum die Ermunterung zum Lei<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
411
72 Ertragen nur <strong>de</strong>n geistigen Sinn haben, daß wir in uns eine sitt<br />
liche Haltung schaffen, die <strong>de</strong>m Beispiel <strong>de</strong>s geschmähten Erlö<br />
sers entspricht, wobei aber das Gewissen in je<strong>de</strong>m Augenblick<br />
selbst entschei<strong>de</strong>t, inwieweit diese innere Haltung sich durch<br />
äußeres Schweigen gegenüber Schmähungen auswirken soll.<br />
Im Gewissensentscheid <strong>de</strong>s Christen spricht aber nach <strong>de</strong>r<br />
Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas nicht nur die vernünftige Überlegung,<br />
son<strong>de</strong>rn zugleich <strong>und</strong> an erster Stelle die Eingebung <strong>de</strong>s Heili<br />
gen Geistes durch die Gabe <strong>de</strong>s Rates. Eine beson<strong>de</strong>re Notwen<br />
digkeit, die Schmähung energisch zurückzuweisen, sieht Tho<br />
mas erstens, wenn es darum geht, <strong>de</strong>n Schmähen<strong>de</strong>n zurecht<br />
zuweisen zu <strong>de</strong>ssen eigenstem sittlichen Wohl; zweitens, um zu<br />
verhin<strong>de</strong>rn, daß an<strong>de</strong>re seelisch Scha<strong>de</strong>n nehmen. Thomas bil<br />
ligt darüber hinaus auch private Grün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Gegenwehr, sofern<br />
nicht ungeordnete Begier<strong>de</strong> nach Ehre <strong>de</strong>n Beweggr<strong>und</strong> dazu<br />
abgibt.<br />
So mannigfaltig die psychisch-moralischen Ursachen <strong>de</strong>r<br />
Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Schmähung sein mögen, in beson<strong>de</strong>rem Maße treibt<br />
<strong>de</strong>r ungeordnete Zorn dazu an, wie Thomas im 4. Artikel fest<br />
stellt.<br />
73 2. Die Ehrabschneidung (Fr. 73). —Die Ehrabschneidung voll<br />
zieht das im Geheimen, was die Schmähung in Gegenwart <strong>de</strong>s<br />
Geschmähten tut. Sie nimmt <strong>de</strong>m Nächsten <strong>de</strong>n guten Ruf<br />
(Art. 1). Thomas macht einen Unterschied zwischen gutem Ruf<br />
<strong>und</strong> Ehre. Der Ruf (Leum<strong>und</strong>) be<strong>de</strong>utet die öffentliche Mei<br />
nung über einen Menschen; diese besteht auch <strong>und</strong> gera<strong>de</strong><br />
dann, wenn <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>n es angeht, nicht zugegen ist, wäh<br />
rend die Ehre <strong>de</strong>n Geehrten irgendwie als gegenwärtig, <strong>und</strong><br />
wäre es nur im Bild, voraussetzt.<br />
Der gute Ruf ist eines <strong>de</strong>r vornehmsten zeitlichen Güter, da<br />
er, wie Art. 2 mit etwas an<strong>de</strong>ren Worten ausführt, in gewissem<br />
Sinn die gesellschaftliche Basis zu sozialen guten Werken dar<br />
stellt. Den guten Ruf einem Menschen rauben be<strong>de</strong>utet daher<br />
an sich eine schwere Sün<strong>de</strong>, es sei <strong>de</strong>nn, <strong>de</strong>r üble Schwätzer<br />
habe nicht die Absicht, <strong>de</strong>n Nächsten zu schädigen, <strong>und</strong> es<br />
handle sich nur um geringfügige Aussagen. Wenn aber schwer<br />
wiegen<strong>de</strong> Dinge, namentlich über das sittliche Leben <strong>de</strong>s Näch<br />
sten, ausgesagt wer<strong>de</strong>n, dann kann dies nicht unüberlegt<br />
geschehen; man sündigt daher ebenfalls schwer, wenngleich die<br />
Absicht nicht in erster Linie auf Schädigung <strong>de</strong>s Nächsten aus<br />
ging. Wer sich durch Ehrabschneidung verfehlt, ist zur Wie<strong>de</strong>r-<br />
412
gutmachung <strong>de</strong>s Scha<strong>de</strong>ns verpflichtet. Der <strong>Gerechtigkeit</strong> 73<br />
wegen die Fehler <strong>de</strong>s Mitmenschen bei <strong>de</strong>r Obrigkeit anzuzei<br />
gen, hat natürlich nichts mit Ehrabschneidung zu tun (Art. 2<br />
zu 1).<br />
Wohl bewußt, daß je<strong>de</strong> Sün<strong>de</strong> ihre eigenen Umstän<strong>de</strong> <strong>und</strong><br />
darum in gewisser Hinsicht ihre eigene Unvergleichbarkeit hat,<br />
versucht Thomas aufgr<strong>und</strong> einer objektiven, <strong>de</strong>m Konkreten<br />
entrückten Wertskala die sittliche Schwere <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Ehrabschneidung mit an<strong>de</strong>ren Sün<strong>de</strong>n gegen <strong>de</strong>n Nächsten,<br />
wie <strong>de</strong>m Mord, <strong>de</strong>m Ehebruch <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Diebstahl, zu verglei<br />
chen (Art. 3). Er kommt dabei zum Ergebnis, daß die Ehrab<br />
schneidung eine schwerere Sün<strong>de</strong> be<strong>de</strong>utet als <strong>de</strong>r Diebstahl,<br />
während sie an<strong>de</strong>rerseits <strong>de</strong>m Mord <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Ehebruch an<br />
Schwere nachsteht, weil diese auf <strong>de</strong>m Menschen einverleibte<br />
Güter gerichtet sind, während <strong>de</strong>r gute Ruf zu <strong>de</strong>n äußeren<br />
Gütern gehört. Die Schmähung kann im Vergleich zur Ehrab<br />
schneidung insofern als schwerere Sün<strong>de</strong> bezeichnet wer<strong>de</strong>n,<br />
als in ihr eine größere Verachtung <strong>und</strong> ein stärkerer Haß gegen<br />
<strong>de</strong>n Nächsten sich ausspricht (Art. 3 Zu 2).<br />
Wer ehrabschnei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Re<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m M<strong>und</strong>e an<strong>de</strong>rer<br />
anhört, ohne durch ein offenes Wort zu wi<strong>de</strong>rsprechen, macht<br />
sich <strong>de</strong>rselben Sün<strong>de</strong> schuldig, <strong>und</strong> zwar um so mehr, je mehr er<br />
mit wohlgefälligem Lächeln zuhört (Art. 4). Wi<strong>de</strong>rspricht er aus<br />
Feigheit o<strong>de</strong>r Nachlässigkeit nicht, dann mag er geringere<br />
Schuld auf sich la<strong>de</strong>n. Doch kann auch reines Schweigen<br />
schwere Sün<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n, wenn man aufgr<strong>und</strong> eines Amts o<strong>de</strong>r<br />
sonst eines beson<strong>de</strong>ren Umstands zum Re<strong>de</strong>n verpflichtet<br />
wäre.<br />
3. Die Ohrenbläserei (Fr. 74). — Die Ohrenbläserei unter- 74<br />
schei<strong>de</strong>t sich von <strong>de</strong>r Ehrabschneidung in <strong>de</strong>r Zielsetzung <strong>de</strong>s<br />
Re<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n (Art. 1). In <strong>de</strong>r Ehrabschneidung strebt <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>r<br />
nach <strong>de</strong>r Zerstörung <strong>de</strong>s guten Rufs <strong>de</strong>s Nächsten, in <strong>de</strong>r<br />
Ohrenbläserei dagegen will er Zwietracht säen zwischen <strong>de</strong>m,<br />
<strong>de</strong>m er Böses nachsagt, <strong>und</strong> <strong>de</strong>ssen Fre<strong>und</strong>en. Die Ohrenbläse<br />
rei be<strong>de</strong>utet eine noch schwerere Sün<strong>de</strong> als die Ehrabschnei<br />
dung, da sie das Höchste <strong>de</strong>r äußeren Güter <strong>de</strong>m Mitmenschen<br />
raubt, nämlich <strong>de</strong>n Fre<strong>und</strong>. Der Fre<strong>und</strong> ist, wie Thomas (Art. 2)<br />
ausführt, mehr wert als die Ehre, das Geliebtwer<strong>de</strong>n ist besser<br />
als das Geehrtsein.<br />
4. Die Verspottung (Fr. 75). — Die Verspottung geht unmittel- 75<br />
bar darauf, <strong>de</strong>n Nächsten in Verlegenheit <strong>und</strong> damit zum Errö-<br />
413
75 ten zu bringen (Art. 1). Als Geringschätzung <strong>de</strong>r Personen<br />
wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Mitmenschen be<strong>de</strong>utet sie eine schwere Sün<strong>de</strong><br />
(Art. 2).<br />
76 5. Die Verfluchung (Fr. 76). — Die Verfluchung stellt das<br />
Gegenteil dar zum Glückwunsch, nämlich <strong>de</strong>n Wunsch, es<br />
möchte <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn schlecht ergehen (Art. 1). Das Fluchen<br />
über Tiere <strong>und</strong> an<strong>de</strong>re vernunftlose Geschöpfe, wie dies alltäg<br />
lich Gebrauch aufgeregter Menschen ist, ist sinnlos <strong>und</strong> dumm,<br />
also unerlaubt (Art. 2).<br />
Dem Mitmenschen fluchen ist schwere Sün<strong>de</strong>, weil gegen die<br />
Liebe, es sei <strong>de</strong>nn, das Übel, das man ihm wünscht, wäre nur<br />
geringfügig o<strong>de</strong>r es handle sich um Auslösung eines nur leichten<br />
Affektes o<strong>de</strong>r um ein spielerisches Necken (Art. 3).<br />
Die Verfluchung ist an sich keine so schwere Sün<strong>de</strong> wie die<br />
wirkliche Ehrabschneidung, weil nicht so wirksam. Artikel 1<br />
spricht allerdings auch von einer an<strong>de</strong>ren Art von Verfluchung,<br />
in welcher nämlich nicht nur eine Ver-wünschung ausgespro<br />
chen, son<strong>de</strong>rn ein Befehl zur Ausführung <strong>de</strong>s Bösen erteilt wird.<br />
Diese Art <strong>de</strong>r Verfluchung ist schlimmer als die Ehrabschnei<br />
dung, weil sie <strong>de</strong>m Nächsten ein schwerwiegen<strong>de</strong>res Unrecht<br />
zufügt, als es die Zerstörung <strong>de</strong>s guten Rufes ist (Art. 4).<br />
VI. Die Ungerechtigkeit in <strong>Recht</strong>sgeschäften<br />
(Fr. 77 u. 78)<br />
77/78 Eine neue Art von Ungerechtigkeit sieht Thomas darin, daß<br />
man das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>s Nächsten in vertraglichen Abmachungen<br />
verletzt. An sich mag <strong>de</strong>r moralische Unterschied gegenüber<br />
<strong>de</strong>n bisher genannten Formen von Ungerechtigkeit vielleicht<br />
nur äußerlich erscheinen. Kommt es doch schließlich auf das<br />
gleiche hinaus, ob ich <strong>de</strong>n Nächsten einfach durch hinterlistige<br />
Verleumdungen o<strong>de</strong>r falsche Anklagen schädige, ohne mit ihm<br />
in einem vertraglichen Geschäft zu tun zu haben, o<strong>de</strong>r ob ich<br />
ihn gelegentlich eines Tauschgeschäfts arglistig betrüge.<br />
Und <strong>de</strong>nnoch ist <strong>de</strong>r Unterschied nicht von <strong>de</strong>r Hand zu wei<br />
sen. In <strong>de</strong>r außervertraglichen Ungerechtigkeit geschieht<br />
Unrecht in beleidigen<strong>de</strong>r Angriffshandlung. Im Vertrag dage<br />
gen kann sich <strong>de</strong>r Vertragspartner gegen ein eventuelles<br />
Unrecht von vornherein wappnen, da er damit rechnen kann.<br />
Doch darin besteht nicht einmal das eigentliche unterschei-<br />
414
<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Merkmal <strong>de</strong>s in <strong>de</strong>r vertraglichen Ebene liegen<strong>de</strong>n 77/78<br />
Unrechts gegenüber <strong>de</strong>m außervertraglichen. Daß <strong>de</strong>r Mit<br />
mensch sich innerlich durch beson<strong>de</strong>re Wachsamkeit wappnet,<br />
ist Sache seiner persönlichen Klugheit. Die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Unge<br />
rechtigkeit im Vertrag hat ihre eigene Note durch die vertragli<br />
che Untreue, die zu gespannter Aufmerksamkeit auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong><br />
ren Seite zwingt. Wer immer mit <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rn eine vertragliche<br />
Abmachung trifft, ist um <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> willen zur Sauber<br />
keit im Geschäft gehalten. Im Betrug zerstört er darum gera<strong>de</strong><br />
die rechtliche Gr<strong>und</strong>lage, zu <strong>de</strong>r er sich äußerlich durch <strong>de</strong>n<br />
Vertrag bekennt. Damit aber vergeht er sich in ganz eigener<br />
Weise gegen das <strong>Recht</strong>.<br />
Thomas (vgl. 61,3) unterschei<strong>de</strong>t drei Gesichtspunkte in<br />
einer Sache: l.die Substanz, 2.<strong>de</strong>n Gebrauch dieser Substanz<br />
zu irgendwelchen N<strong>utz</strong>leistungen <strong>und</strong> 3. die Früchte <strong>de</strong>r Sub<br />
stanz. Bei einer Vase ist z. B. die Substanz vom Gebrauch unter<br />
schie<strong>de</strong>n. Man kann eine Vase ausleihen <strong>und</strong> dabei für <strong>de</strong>n<br />
Gebrauch einen Preis for<strong>de</strong>rn, obwohl man die Vase in unver<br />
letztem Zustand zurückerhält. An<strong>de</strong>rs beim Brot. Die Substanz<br />
<strong>de</strong>s Brotes wird in ihrem Gebrauch verzehrt. Man kann <strong>de</strong>n<br />
Gebrauch von <strong>de</strong>r Substanz nicht trennen. Darauf könnte man<br />
heute erwi<strong>de</strong>rn, daß in einer geldrechenhaften Verkehrswirt<br />
schaft das Brot in je<strong>de</strong>s beliebige Erwerbsvermögen umsetzbar<br />
sei, so daß sich von selbst ein N<strong>utz</strong>wert ergibt, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Sub<br />
stanz <strong>de</strong>s Brotes an sich nicht gegeben ist. Für Thomas gibt es<br />
aber diese Betrachtung nicht, wenngleich er (Fr. 78) <strong>de</strong>n Wert<br />
von <strong>de</strong>r Sache zu unterschei<strong>de</strong>n weiß. Die „Frucht" einer Sache<br />
ergibt sich nach Thomas aus <strong>de</strong>r unmittelbaren Eigentätigkeit<br />
<strong>de</strong>r Sache selbst, ohne Rückgriff auf die menschliche Arbeit.<br />
Wir wür<strong>de</strong>n etwa von <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nrente in diesem Sinne spre<br />
chen.<br />
Entsprechend diesen drei Gesichtspunkten sind nun nach<br />
Thomas folgen<strong>de</strong> <strong>Recht</strong>sgeschäfte möglich: 1. Übergabe eines<br />
Gutes gegen Leistung <strong>de</strong>sselben Wertes: Kauf/Verkauf; 2. zeit<br />
lich beschränkte Überlassung einer Sache zu unentgeltlichem<br />
Genuß <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Sache selbst erstehen<strong>de</strong>n Früchte: N<strong>utz</strong>nie<br />
ßung; 3. zeitlich beschränkte Überlassung einer fruchtbringen<br />
<strong>de</strong>n <strong>und</strong> gebrauchswertigen Sache (o<strong>de</strong>r Leistung) gegen Ent<br />
gelt: Vermietung, Pacht, Verdingung (Arbeitsvertrag); 4. zeit<br />
lich beschränkte Übergabe einer Sache zur bloßen Aufbewah<br />
rung.<br />
415
77/78 Thomas erklärt nun (Vorwort zu Fr. 77), daß es nur zwei<br />
Arten von Sün<strong>de</strong>n gegen die Vertragsgerechtigkeit gebe: Betrug<br />
<strong>und</strong> Zinswucher. Alle an<strong>de</strong>ren Formen gehören seiner Ansicht<br />
nach in <strong>de</strong>n bereits besprochenen Bereich <strong>de</strong>r Ungerechtigkeit<br />
im außervertraglichen Zusammenleben. Der Betrug betrifft <strong>de</strong>n<br />
Kauf/Verkauf-Vertrag, <strong>de</strong>r Zinswucher gilt als Verstoß gegen<br />
<strong>de</strong>n im Wesen unentgeltlichen Leihvertrag von verbrauchbaren<br />
Gütern, d.h. von Gütern, <strong>de</strong>ren Gebrauch im Verbrauch<br />
besteht.<br />
A. DER BETRUG - DIE SÜNDE GEGENDEN<br />
GERECHTEN PREIS<br />
(Fr. 77)<br />
1. DER GERECHTE PREIS<br />
77 Die mittelalterliche Preislehre hat durch die instinktive<br />
Rückführung <strong>de</strong>s Kauf/Verkauf-Vertrags auf die ursprüng<br />
lichste Erscheinungsform wirtschaftlichen Zusammenseins,<br />
nämlich <strong>de</strong>n Tauschvertrag, die Gefahr eines reinen Wertnomi<br />
nalismus einerseits, aber auch eines platten Wertrealismus<br />
an<strong>de</strong>rerseits ohne Schwierigkeit umgangen. 18 Beim schlichten<br />
Tausch fällt <strong>de</strong>r Blick von selbst auf das Tausch- Verhältnis. Es<br />
stehen hier zwei verschie<strong>de</strong>nartige Güter einan<strong>de</strong>r gegenüber,<br />
die je einen in sich verschie<strong>de</strong>nen subjektiven N<strong>utz</strong>wert haben.<br />
Dieser kann aber als solcher nicht zum Wertmesser genommen<br />
wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn ich kann im Verkauf, so sagt Thomas im 1. Arti<br />
kel, nicht <strong>de</strong>n N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>rn verkaufen, son<strong>de</strong>rn mir höch<br />
stens <strong>de</strong>n Verlust eines beson<strong>de</strong>ren N<strong>utz</strong>werts vom Käufer ver<br />
güten lassen. So ergibt sich von selbst die Notwendigkeit, einen<br />
objektiven Verhältniswert zu suchen, <strong>de</strong>r eine Gr<strong>und</strong>lage für<br />
<strong>de</strong>n gerechten Ausgleich angibt. Der Preis soll, führt Thomas im<br />
1. Artikel aus, zum gemeinsamen N<strong>utz</strong>en <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Kontra<br />
henten <strong>de</strong>s Kauf/Verkauf-Vertrags dienen. Es ist dabei nicht an<br />
einen N<strong>utz</strong>en im Sinne <strong>de</strong>s Gemeinwohls <strong>de</strong>r ganzen Wirt<br />
schaftsgesellschaft, son<strong>de</strong>rn eben nur an <strong>de</strong>n N<strong>utz</strong>en gedacht,<br />
<strong>de</strong>r einem je<strong>de</strong>n aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Individualgerechtigkeit zugute<br />
kommt. Es ist für die mittelalterliche Moral vom gerechten Preis<br />
18 Vgl. zum Ganzen O.v. Nell-Breuning, Gr<strong>und</strong>züge <strong>de</strong>r Börsenmoral, Freiburg<br />
416<br />
i.Br. 1928, 46-72.
emerkenswert, daß sie keine Preislehre im eigentlichen Sinne 77<br />
ist, d. h. eine Lehre über das Zustan<strong>de</strong>bringen einer gerechten<br />
Preisordnung, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n Preis, <strong>de</strong>r bereits vorhan<strong>de</strong>n ist, als<br />
gegeben voraussetzt <strong>und</strong> vom individualrechtlichen Stand<br />
punkt aus die verschie<strong>de</strong>nen möglichen Umgehungen dieser<br />
vorgezeichneten Preisordnung bespricht. Natürlich wird damit<br />
auch unvermeidlich die Frage, wenigstens von ferne, berührt,<br />
inwieweit <strong>de</strong>r gegebene Preis verpflichtend sei, bzw. was <strong>de</strong>n<br />
Preis in <strong>de</strong>r Wirtschaftsgesellschaft bestimmen soll, so daß wir<br />
aus einzelnen An<strong>de</strong>utungen immerhin manches über die<br />
zugr<strong>und</strong>eliegen<strong>de</strong>n Vorstellungen bezüglich <strong>de</strong>r Preisbildung<br />
erfahren.<br />
Der vorgegebene Preis war für <strong>de</strong>n mittelalterlichen Theolo<br />
gen durchaus nicht vom ontologischen Wert <strong>de</strong>r Sache<br />
bestimmt. Die ganz auf das objektive Sein <strong>de</strong>r Dinge gerichtete<br />
Schauweise <strong>de</strong>s Mittelalters hätte an sich geneigt sein müssen,<br />
<strong>de</strong>n Tauschwert <strong>de</strong>r Waren von einem Ultra-Ontologismus her<br />
zu sehen. Aber es ist <strong>de</strong>m von Thomas in Artikel 2 Zu 3<br />
erwähnten Text aus Augustinus' „Gottesstaat" (lib. 11, c. 16;<br />
CSEL 40,535) zu verdanken, daß die Theologie <strong>de</strong>n Weg zum<br />
N<strong>utz</strong>wert gef<strong>und</strong>en hat. Es heißt in jenem geistreichen Augusti<br />
nustext: „Die Art <strong>de</strong>r Schätzung eines je<strong>de</strong>n Dinges ist je nach<br />
seinem Gebrauch verschie<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>rart, daß wir sinnenlose<br />
Wesen <strong>de</strong>n Sinnenwesen vorziehen, <strong>und</strong> zwar so weitgehend,<br />
daß, wenn wir es könnten, wir sie völlig aus <strong>de</strong>r Naturordnung<br />
beseitigen wür<strong>de</strong>n, sei es aus Unkenntnis ihres Standorts in ihr<br />
[in <strong>de</strong>r Naturordnung], sei es trotz klarer Erkenntnis, weil wir<br />
sie hinter unsere Annehmlichkeiten stellen. Wer hätte zu Hause<br />
nicht lieber Brot als Mäuse o<strong>de</strong>r Silbermünzen anstelle von Flö<br />
hen? Was ist <strong>de</strong>nn Verw<strong>und</strong>erliches daran, wenn bei <strong>de</strong>r Ein<br />
schätzung von Menschen, <strong>de</strong>ren Natur doch wahrhaftig eine so<br />
große Wür<strong>de</strong> besitzt, ein Pferd höher gewertet wird als ein<br />
Sklave, ein Schmuckstück mehr als eine Magd? So weicht die<br />
Schauweise <strong>de</strong>s nur Betrachten<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r freien Urteilsgestal<br />
tung weit ab von <strong>de</strong>r Not <strong>de</strong>s Bedürftigen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Lust <strong>de</strong>s<br />
Begierigen."<br />
Der N<strong>utz</strong>wert, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Preis bestimmt, wird von Thomas im<br />
Hinblick auf die allgemein menschliche Bedarfs<strong>de</strong>ckung gese<br />
hen. Dies zeigt seine Lehre, die er im Anschluß an <strong>de</strong>n zitierten<br />
Augustinustext entwickelt. Thomas erklärt, es sei durchaus<br />
nicht notwendig, daß man ein zu verkaufen<strong>de</strong>s o<strong>de</strong>r zu kaufen-<br />
417
77 <strong>de</strong>s Objekt von innen <strong>und</strong> außen bis ins einzelne kenne, um ja<br />
keinen Defekt zu übersehen, son<strong>de</strong>rn daß es völlig genüge, um<br />
die allgemein menschliche Brauchbarkeit zu wissen. In diesem<br />
Sinn <strong>de</strong>s sozialökonomischen N<strong>utz</strong>werts versteht Thomas<br />
(Art. 1) auch <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Wirtschaftsgesellschaft bereits vorgege<br />
benen Preis. Um nicht <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Wirtschaftsgesellschaft gül<br />
tigen N<strong>utz</strong>wert einer Sache einem ungebührlichen Preisdruck<br />
auszusetzen, so erklärt Thomas (Art. 3), braucht <strong>de</strong>r Verkäufer<br />
einen offenbaren Defekt an einer Sache, wie z. B., daß ein Pferd<br />
einäugig sei, nicht eigens hervorzuheben, sofern er die entspre<br />
chen<strong>de</strong> Wertmin<strong>de</strong>rung von sich aus in <strong>de</strong>n Preis einbezogen<br />
hat.<br />
Der Preis galt Thomas als Regler <strong>de</strong>s Verbrauchs. Denn nichts<br />
an<strong>de</strong>res be<strong>de</strong>utet doch die stete Rückorientierung auf <strong>de</strong>n<br />
gesellschaftlich bestimmten N<strong>utz</strong>wert, als die Ausrichtung <strong>de</strong>s<br />
Preises nach einem sozialökonomisch vorbestimmten Ziel:<br />
Sicherung <strong>de</strong>r Unterhaltsfürsorge. Diesem Zweck dient nach<br />
Thomas (Art. 2 Zu 2) auch die behördliche Festsetzung <strong>de</strong>r<br />
Maße.<br />
Der Preis als Regler <strong>de</strong>r Erzeugung wird bei Thomas nicht<br />
besprochen. Dagegen kommt die dritte Aufgabe <strong>de</strong>s Preises:<br />
die Regelung <strong>de</strong>r Einkommensbildung, <strong>de</strong>utlich zur Sprache. Im<br />
4. Artikel erklärt nämlich Thomas, daß <strong>de</strong>r Kaufmann für seine<br />
Ware ruhig mehr verlangen könne, als er selbst bezahlt habe,<br />
um das seiner Arbeit entsprechen<strong>de</strong> Honorar zu bekommen.<br />
Da immerhin <strong>de</strong>r Stand <strong>de</strong>r Kaufleute nach Thomas (Art. 4)<br />
einen „allgemeinen N<strong>utz</strong>en" hat, fällt ihm auch das <strong>Recht</strong> zu,<br />
seine Einkommensbildung in <strong>de</strong>r Preisbestimmung <strong>de</strong>r Waren<br />
mitberücksichtigt zu sehen.<br />
Man wür<strong>de</strong> aber Thomas unrecht tun, wollte man die Arbeit<br />
zusammen mit <strong>de</strong>n Kosten als die einzigen bestimmen<strong>de</strong>n Fak<br />
toren <strong>de</strong>s Preises einer Sache bezeichnen. Im Ethikkommentar<br />
(5. Buch, Lect. 9) fin<strong>de</strong>t sich zwar eine scheinbar entsprechen<strong>de</strong><br />
Stelle: Beim Tausch von Schuhen gegen ein bestimmtes Quan-<br />
> tum Getrei<strong>de</strong> sollen die Schuhe an Zahl das Getrei<strong>de</strong>quantum<br />
im gleichen Verhältnis überragen, in welchem die Arbeit <strong>und</strong> die<br />
Auslagen <strong>de</strong>s Bauern die <strong>de</strong>s Schusters übersteigen. Doch sagt<br />
Thomas an <strong>de</strong>rselben Stelle, daß verschie<strong>de</strong>ne Waren ihre Ver<br />
gleichsmöglichkeit durch ihren N<strong>utz</strong>wert im Hinblick auf die<br />
Deckung menschlichen Bedarfs erhalten.<br />
418
In welchem Verhältnis freie Preisbildung <strong>und</strong> behördliche 77<br />
Festlegung <strong>de</strong>s Preises stehen, konnte Thomas selbstre<strong>de</strong>nd<br />
noch nicht klarwer<strong>de</strong>n.<br />
Delikat wird die gesamte Preisfrage <strong>de</strong>s Mittelalters von <strong>de</strong>r<br />
Geldseite her. Wir kommen hier von selbst in Kontakt mit <strong>de</strong>r<br />
damaligen Zinstheorie (Fr. 78). Das Geld wird als ein unver<br />
än<strong>de</strong>rlicher Wertmesser <strong>de</strong>r Dinge aufgefaßt, <strong>de</strong>r keinen Wert<br />
schwankungen ausgesetzt ist. Die Geldseite hat also auf die<br />
Preisbildung in dieser Anschauung keinerlei Einfluß.<br />
2. DIE HANDELSMORAL<br />
In <strong>de</strong>r mehr o<strong>de</strong>r weniger kritiklosen Annahme einer in <strong>de</strong>r<br />
Wirtschaftsgesellschaft entstan<strong>de</strong>nen <strong>und</strong> durch behördliche<br />
Autorität festgesetzten Preisordnung behan<strong>de</strong>lt Thomas in<br />
unserer Frage die Moral <strong>de</strong>s Kaufmanns. Das römische <strong>Recht</strong><br />
ließ es bei<strong>de</strong>n Kontrahenten im Kauf/Verkauf frei, welchen<br />
Preis sie unter sich vereinbarten. Der Verkäufer mußte nur die<br />
Mängel <strong>de</strong>r Sache auf<strong>de</strong>cken. Die justinianische Gesetzgebung<br />
enthält eine Vorschrift, gemäß welcher <strong>de</strong>r Verkäufer eine<br />
Sache, die ihm unter <strong>de</strong>r Hälfte <strong>de</strong>s eigentlichen Werts abge<br />
zwungen wor<strong>de</strong>n war, zurückfor<strong>de</strong>rn konnte. Thomas behan<br />
<strong>de</strong>lt nun im 1. Artikel das Thema, inwieweit die bei<strong>de</strong>n Kontra<br />
henten sich an <strong>de</strong>n sozialökonomisch vorgegebenen Preis zu<br />
halten haben. Auf die Gepflogenheit <strong>de</strong>s römischen <strong>Recht</strong>s<br />
kommt er im 1. Einwand zu sprechen. Schon hier — <strong>und</strong> noch<br />
mehr später in Artikel 4 Zu 1 — läßt Thomas ein großes Ver<br />
ständnis für <strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>n Römern schlecht angesehenen Kauf<br />
mannsstand erkennen. Cicero (De offic. 1,42,150) meinte vom<br />
Kaufmann, er könne nur mit reichlich viel Lügen Gewinne<br />
machen. Thomas (Art. 1 Zu 1) erklärt, daß die Elastizität <strong>de</strong>r<br />
Preise einen mäßigen Gewinn <strong>de</strong>s Kaufmanns rechtfertige. Der<br />
Han<strong>de</strong>l wür<strong>de</strong> erst dort eigentlich sündhaft, wo durch Uberfor<br />
<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>m Käufer ein „beträchtlicher" Scha<strong>de</strong>n zugefügt<br />
wür<strong>de</strong>.<br />
Vom Verkäufer verlangt Thomas (Art. 2) nicht nur treue Ein<br />
haltung <strong>de</strong>s vorgegebenen Preises, son<strong>de</strong>rn auch Ehrlichkeit in<br />
<strong>de</strong>n Angaben über die zu verkaufen<strong>de</strong> Ware. In dreifacher<br />
Weise, so sagt Thomas (Art. 2), kann ein Mangel an einer Sache<br />
gegeben sein: 1. insofern die Ware überhaupt nicht das ist, als<br />
was sie angegeben wird; 2. insofern das Quantum nicht<br />
419
77 stimmt; 3. insofern die Qualität herabgesetzt ist (schadhafte<br />
Ware). Thomas betont, daß alle diese Verfehlungen gegen die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> die Pflicht zur Wie<strong>de</strong>rerstattung nach sich ziehen.<br />
Dieselbe sittliche Pflicht zur vertraglichen Sauberkeit auf<br />
erlegt Thomas aber auch <strong>de</strong>m Käufer, insofern er diesem verbie<br />
tet, ein Versehen auf Seiten <strong>de</strong>s Verkäufers zu eigenem Vorteil<br />
hinzunehmen (Art. 2) o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Preis wegen irgen<strong>de</strong>ines Man<br />
gels ungebührlich zu drücken (Art. 3). Gegen letztere Gefahr<br />
kann sich, wie bereits erwähnt, nach Ansicht <strong>de</strong>s hl. Thomas<br />
<strong>de</strong>r Verkäufer schützen, in<strong>de</strong>m er offensichtliche Mängel ver<br />
schweigt. Die Bemerkung <strong>de</strong>s hl. Thomas (Art. 3 Zu 2), daß die<br />
Mängel einer Ware nicht schon beim Ausrufen angezeigt wer<br />
<strong>de</strong>n müssen, um das Interesse <strong>de</strong>r K<strong>und</strong>schaft nicht von vorn<br />
herein zu lahmen, son<strong>de</strong>rn daß es genüge, sich mit <strong>de</strong>m interes<br />
sierten Käufer persönlich auseinan<strong>de</strong>rzusetzen, zeigt das Ver<br />
ständnis <strong>de</strong>s Heiligen für die Schwierigkeiten <strong>de</strong>s Kaufmanns<br />
berufs beim Absatz <strong>de</strong>r Ware.<br />
Angesichts <strong>de</strong>r im Mittelalter weitverbreiteten Alchimie lag<br />
es nahe, daß Thomas auf die Fälschung von E<strong>de</strong>lmetallen zu<br />
sprechen kam (Art. 2 Zu 1). Thomas hebt als eigenen Wert <strong>de</strong>s<br />
wahren Gol<strong>de</strong>s hervor: Anreiz zu echter Kulturfreu<strong>de</strong>, Mittel<br />
im Heilverfahren; er möchte jedoch die Möglichkeit nicht<br />
bestreiten, daß auf künstlichem Weg schließlich doch einmal ein<br />
<strong>de</strong>m Naturgold ebenbürtiges Gold gewonnen wer<strong>de</strong>n könnte.<br />
Preisunterschie<strong>de</strong>, die sich nicht aus <strong>de</strong>r inneren Beschaffen<br />
heit <strong>de</strong>r Ware, son<strong>de</strong>rn aus äußeren Umstän<strong>de</strong>n, wie Marktsi<br />
tuation, ergeben, können vom Verkäufer nach Thomas (Art. 3<br />
Zu 4) ohne Be<strong>de</strong>nken zum eigenen Vorteil ausgen<strong>utz</strong>t wer<strong>de</strong>n.<br />
Daß eine Sache an irgen<strong>de</strong>inem Ort in absehbarer Zeit durch<br />
größeres Angebot billiger wer<strong>de</strong>n wird, braucht <strong>de</strong>n Verkäufer,<br />
<strong>de</strong>r darum weiß, von <strong>de</strong>r For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s dort gera<strong>de</strong> gültigen<br />
Preises nicht abzuhalten. Damit führt Thomas das Problem <strong>de</strong>r<br />
Spekulation ein, <strong>de</strong>m er seine Aufmerksamkeit eingehend im<br />
4. Artikel widmet, wo er die Frage stellt, ob man einen Gewinn<br />
beabsichtigen dürfe, <strong>de</strong>r sich aus <strong>de</strong>r Differenz zwischen Ein<br />
standspreis <strong>und</strong> Verkaufspreis ergibt.<br />
Daß ein Unternehmer zur Sicherung seiner wirtschaftlichen<br />
Handlungen spekuliert im Sinn von Umschauhalten nach <strong>de</strong>r<br />
objektiv richtigen Konjunktur, ist klar. Es gehört dies zum klu<br />
gen Haushalten im Raum einer Volkswirtschaft. Etwas an<strong>de</strong>res<br />
ist die rein händlerische Spekulation, insofern diese nicht nur<br />
420
wirtschaftlich haushält zur Einholung aller gemachten Auslagen 77<br />
<strong>und</strong> Deckung aller geleisteten Arbeit im Vermittlungsdienst <strong>de</strong>r<br />
Güterverteilung, son<strong>de</strong>rn darüber hinaus <strong>und</strong> selbst <strong>de</strong>ssen un<br />
geachtet kauft <strong>und</strong> verkauft nur, um aus <strong>de</strong>n errechneten <strong>und</strong><br />
erwarteten künftigen Preisschwankungen einen Gewinn zu<br />
erzielen. Wie steht es um dieses Problem bei Thomas? Der<br />
4. Artikel bietet diesbezüglich reichlich Stoff zur Diskussion.<br />
Gera<strong>de</strong> hier fällt auf, wie sehr Thomas die Han<strong>de</strong>lsmoral<br />
nicht zunächst als eine Ordnungsmoral ansieht, gemäß welcher<br />
im objektiven sozialwirtschaftlichen Raum eine sozialgerechte<br />
Vre'isordnung herzustellen ist, son<strong>de</strong>rn eigentlich nur die<br />
Gesetze <strong>de</strong>r Individualmoral bespricht, die bei vorliegen<strong>de</strong>n<br />
Preisen zu beobachten sind. Das Ordnungsgefüge selbst wird<br />
nämlich von Thomas verhältnismäßig rasch erledigt durch die<br />
Bemerkung, <strong>de</strong>r händlerische Gewinn besage in sich nichts<br />
Moralisches, we<strong>de</strong>r im guten noch im schlechten Sinne; es<br />
komme also nur darauf an, auf welches Ziel man ihn ausrichte.<br />
Für eine sozialökonomische Betrachtung aber wür<strong>de</strong> sich<br />
zunächst die Frage stellen: ist <strong>de</strong>r Gewinn überhaupt sozial<br />
ethisch haltbar, da <strong>de</strong>r statische Gleichgewichtspreis (Kosten =<br />
Preis) ihn nicht kennt?<br />
Thomas betrachtet das Spekulieren auf Gewinn als sittlich<br />
unanfechtbar, wenn <strong>de</strong>r Gewinn zum Unterhalt <strong>de</strong>r eigenen<br />
Familie o<strong>de</strong>r zur Unterstützung <strong>de</strong>r Armen angestrebt wird.<br />
Erst recht sieht er je<strong>de</strong> Schwierigkeit behoben, wenn <strong>de</strong>r Kauf<br />
mann, seinen Vorteil hintansetzend, <strong>de</strong>n allgemeinen N<strong>utz</strong>en<br />
im Dienst <strong>de</strong>r Güterverteilung erstrebt <strong>und</strong> für diesen geleiste<br />
ten Dienst <strong>de</strong>n Gewinn als Entgelt, also nicht eigentlich als<br />
Gewinn erwartet. Mit <strong>de</strong>m, was man unter Händlergewinn ver<br />
steht, hat <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Antwort Zu 1 erwähnte Arbeitslohn für<br />
Vere<strong>de</strong>lung <strong>de</strong>r zu verkaufen<strong>de</strong>n Ware vollends nichts mehr zu<br />
tun. Es wäre völlig irrig, wollte man <strong>de</strong>n ganzen Artikel im Sinn<br />
dieser Antwort auslegen, als ob Thomas <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsgewinn<br />
nur im Sinne von geleisteter Arbeit bestehen ließe. A. Orel<br />
(Oeconomia perennis, Bd. I 217) <strong>de</strong>utet nämlich <strong>de</strong>n ganzen<br />
4. Artikel in dieser Weise, als ob Thomas <strong>und</strong> mit ihm die mit<br />
telalterliche Scholastik <strong>und</strong> die ganze Kanonistik <strong>de</strong>n „Han<strong>de</strong>ls<br />
gewinn" nur dann gerechtfertigt hätten, wenn er nicht auf<br />
„Mehrwertaneignung" beruhe, son<strong>de</strong>rn auf Entgelt für Arbeit<br />
<strong>und</strong> Kosten (auf gewen<strong>de</strong>te Mühen <strong>und</strong> Arbeiten, um die Waren<br />
von <strong>de</strong>m Ort <strong>de</strong>r Erzeugung, wo sie nicht benötigt wer<strong>de</strong>n, dort-<br />
421
77 hin zu schaffen, wo sie notwendig sind; Kosten <strong>de</strong>s Transports<br />
usw.). Ore/fin<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>r Tatsache, daß Thomas <strong>de</strong>m Han<strong>de</strong>lsge<br />
winn einen eigenen Artikel gewidmet hat, eine Bestätigung für<br />
<strong>de</strong>ssen bedingungslose Ablehnung <strong>de</strong>s arbeitslosen Einkom<br />
mens: „Daß Thomas die Frage <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lsgewinns ausführlich<br />
geson<strong>de</strong>rt zu behan<strong>de</strong>ln für notwendig fin<strong>de</strong>t, zeugt von <strong>de</strong>r<br />
Gründlichkeit <strong>und</strong> Genauigkeit, mit <strong>de</strong>nen gegen je<strong>de</strong>n arbeits<br />
losen Gewinn Stellung genommen wer<strong>de</strong>n sollte. Denn <strong>de</strong>r<br />
Kaufmann jener Zeit war fast durchgängig ein kleiner hand<br />
werksmäßiger Krämer, <strong>de</strong>r mit großem Aufwand an Zeit <strong>und</strong><br />
Arbeit, Mühen <strong>und</strong> Gefahren, sehr oft das Schwert an <strong>de</strong>r Seite,<br />
seine Waren persönlich bei <strong>de</strong>n meistens fernen Produzenten<br />
einkaufte <strong>und</strong> mittels Wagens o<strong>de</strong>r Schubkarrens, wohl auch<br />
auf <strong>de</strong>m eigenen Rücken, als Hausierer von Gehöft zu Gehöft,<br />
durch Dörfer <strong>und</strong> Städte beför<strong>de</strong>rte <strong>und</strong> auf <strong>de</strong>n Märkten unter<br />
<strong>de</strong>n Lauben o<strong>de</strong>r in kleinen Bu<strong>de</strong>n feilbot. Es genügte die Tat<br />
sache, daß er sein Arbeitsmaterial nicht durch eigene Arbeit<br />
umgestaltete, son<strong>de</strong>rn von einem Ort zum an<strong>de</strong>rn brachte, um<br />
die ausdrückliche Hervorhebung als geboten erscheinen zu las<br />
sen, daß auch er nur Arbeit <strong>und</strong> Kosten sich bezahlen lassen,<br />
nicht aber Mehrwertgewinn machen dürfe" (a. a. 0.217f.).<br />
Die Unterstellung, daß Thomas das arbeitslose Einkommen<br />
gr<strong>und</strong>weg verwerfe, stimmt aber in keiner Weise, wie sich noch<br />
zeigen wird. Und es ist auch nicht korrekt, <strong>de</strong>n 4. Artikel als<br />
eine Kampfansage gegen <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsgewinn aufzufassen. Der<br />
mäßige Han<strong>de</strong>lsgewinn ist, wie bereits gesagt, nach <strong>de</strong>r Lehre<br />
<strong>de</strong>r „Antwort" dieses Artikels gerechtfertigt, sofern er für einen<br />
sittlich guten Zweck ben<strong>utz</strong>t wird. Den Aufschlag im Verkaufs<br />
preis gegenüber <strong>de</strong>m Einstandspreis rechtfertigt Thomas in <strong>de</strong>r<br />
zweiten Antwort mit folgen<strong>de</strong>n Grün<strong>de</strong>n: 1.Vere<strong>de</strong>lung <strong>de</strong>r<br />
Ware; 2. Marktkonjunktur (sec. diversitatem loci vel temporis);<br />
3. Risiko <strong>de</strong>s Transports. Thomas unterschei<strong>de</strong>t also klar die<br />
Arbeitsleistung (1 <strong>und</strong> 3) von <strong>de</strong>m arbeitslosen Gewinnzu<br />
wachs (2).<br />
Es fragt sich aber, aus welchen inneren Grün<strong>de</strong>n die reine<br />
Spekulation sozialökonomisch noch tragbar sei, da es doch<br />
nicht genügt, sie irgendwelchen Zielsetzungen, wie Unterhalt<br />
<strong>de</strong>r Familie, Unterstützung <strong>de</strong>r Armen, unterzuordnen. D. h.,<br />
es geht darum, ob <strong>de</strong>r reine Händlergewinn als Lockmittel <strong>de</strong>s<br />
Gewinnstrebens im sozialökonomischen Prozeß eine Aufgabe<br />
erfüllt, so daß <strong>de</strong>r Spekulant um dieser inneren Werthaftigkeit<br />
422
<strong>de</strong>r Spekulation willen objektiv sittlich gut han<strong>de</strong>lt, sofern er 77<br />
diese innere Zweckbestimmung <strong>de</strong>r Spekulation nicht vereitelt,<br />
son<strong>de</strong>rn sie als Rahmen für sein Gewinnstreben anerkennt.<br />
Thomas rührt an <strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>r Sache, wenn er vom öffentlichen<br />
N<strong>utz</strong>en spricht, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Kaufmann eben um seines Gewinn<br />
strebens willen schafft. Allerdings ist die subjektive Willensbil<br />
dung <strong>de</strong>s Kaufmanns zu stark in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong> geschoben,<br />
während es einer sozialökonomischen Betrachtung zuerst auf<br />
die <strong>de</strong>r Spekulation immanente Beziehung zur Sozialethik<br />
ankommt. Diese Sicht fin<strong>de</strong>n wir allerdings bei Thomas nicht.<br />
Man kann, über Thomas hinausgehend, wohl sagen, daß die<br />
rein händlerische Spekulation in einer arbeitsteiligen Verkehrs<br />
wirtschaft eine volkswirtschaftlich nützliche Funktion erfüllt.<br />
Der verantwortungsbewußte Spekulant übernimmt auf sein<br />
privates Konto Risiken, zu <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Unternehmer nicht fähig<br />
wäre. Er wirkt auf die Preisbewegung ausgleichend <strong>und</strong> bereitet<br />
die Begegnung von Angebot <strong>und</strong> Nachfrage. Für seine Arbeit<br />
steckt er also als gerechten „Lohn" <strong>de</strong>n Gewinn ein. Dies alles in<br />
<strong>de</strong>r Voraussetzung einer mehr o<strong>de</strong>r weniger freien Marktwirt<br />
schaft mit Preisen, die von oben nicht festgesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Allerdings bleibt immer noch das bereits berührte Problem<br />
als Gr<strong>und</strong>frage, ob <strong>und</strong> inwieweit eben die freie Marktwirt<br />
schaft das wirtschaftliche Gleichgewicht zu erreichen imstan<strong>de</strong><br />
sei. Mit dieser Frage erhält natürlich die Diskussion um die Spe<br />
kulation eine ganz an<strong>de</strong>re Note. Darüber entschei<strong>de</strong>t nicht die<br />
Sozialethik, son<strong>de</strong>rn die Wirtschaftswissenschaft.<br />
Sosehr Thomas, Aristoteles folgend, das gewinnsüchtige Spe<br />
kulieren verwirft, so hat er sich doch vom Stagyriten in etwa<br />
entfernt, insofern er <strong>de</strong>n händlerischen Gewinn für an sich<br />
moralisch indifferent erklärt <strong>und</strong> damit die Möglichkeit seiner<br />
Einordnung in ein sittlich gutes Han<strong>de</strong>ln eröffnet. Dennoch<br />
sieht er mit <strong>de</strong>r gesamten christlichen Tradition die schweren<br />
sittlichen Gefahren, welche im Spekulieren auf Gewinn gege<br />
ben sind. Aus diesem Gr<strong>und</strong> verteidigt er (Art. 4 Zu 3) das Kir<br />
chenrecht, welches <strong>de</strong>n Klerikern <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l als mit <strong>de</strong>m Kle<br />
rikerstand unvereinbar verbot (<strong>und</strong> übrigens noch verbietet).<br />
423
B. DER ZINS<br />
(Fr. 78)<br />
Die vorliegen<strong>de</strong> Frage behan<strong>de</strong>lt an sich nur das Darlehen<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n dafür verlangten Zins als Wucher. Dennoch kommt<br />
Thomas beiläufig auch auf das zu sprechen, was für uns heute<br />
die Kapitalrendite ist, so daß Anton Orel in seinem Werk<br />
„Oeconomia perennis" (Bd. I—II, Mainz 1930) für seinen<br />
Kampf gegen das arbeitslose Einkommen die vermeintlich gün<br />
stigsten Texte aus <strong>de</strong>r christlichen Tradition dieser Frage ent<br />
nahm (unter Bezugnahme auf einzelne Zitate aus Fr. 77.) Bevor<br />
wir auf die Diskussion eingehen können, seien die bei<strong>de</strong>n<br />
Begriffe „Kapitalzins" <strong>und</strong> „Darlehenszins" klargestellt.<br />
Kapital ist das in einer Geldziffer ausgedrückte Erwerbsver<br />
mögen. 1 9 Das Kapital ist also nicht das (produzierte) Produk<br />
tionsmittel selbst, son<strong>de</strong>rn besagt nur eine Wertziffer, die selbst<br />
re<strong>de</strong>nd ihrerseits in Produktionsmitteln verkörpert sein kann.<br />
In einer geldrechenhaften, marktgängigen Wirtschaft, in wel<br />
cher je<strong>de</strong>r Wertbetrag Erwerbsvermögen sein kann, weil stets in<br />
Produktionsmittel umsetzbar, sind bestimmte Wertbeträge an<br />
Erwerbsvermögen <strong>und</strong> Produktionsmitteln vertauschbare Be<br />
griffe, weswegen man auch mit <strong>Recht</strong> sagt, daß Kapital, verstan<br />
<strong>de</strong>n als Wertziffer, produktiv sei. An<strong>de</strong>rs natürlich in einer<br />
nicht-geldrechenhaften Wirtschaft, in welcher Produktionsmit<br />
tel nicht stets durch Geld in Umlauf kommen können. Hier sind<br />
natürlich Produktionsmittel ebenfalls produktiv. Aber die geld<br />
lich ausgedrückte Wertsumme für Ertragsgüter ist unproduktiv.<br />
In unserer gegenwärtigen, kapitalistischen Wirtschaft ist ein<br />
Kapitalbetrag ohne weiteres produktiv, d.h. Ertragsquelle.<br />
Damit ist aber das Kapital zugleich für <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r es besitzt, Ein<br />
kommensquelle. 20<br />
1 9 O. v. Nell-Breuning <strong>und</strong> H. Sacher, Zur Wirtschaftsordnung, Wörterbuch <strong>de</strong>r<br />
Politik, Heft IV. Freiburg 1949,178. Vgl. auch O.v.Nell-Breuning, Art. Zins<br />
in: Staatslexikon <strong>de</strong>r Görresgesellschaft, 5. Aufl., Bd. 5, 1932.<br />
2 0 Die Wirtschaftswissenschaft spricht allerdings vom Zins zunächst unabhängig<br />
vom Wirtschaftssystem. Der Zins ist eine Erscheinung <strong>de</strong>s Kapitals in<br />
je<strong>de</strong>r Wirtschaftsform. Selbst eine bolschewistische Planwirtschaft kann nur<br />
mit Hilfe <strong>de</strong>s Zinses berechnen, inwieweit ein Kapital noch n<strong>utz</strong>bringend<br />
angelegt ist. Sofern <strong>de</strong>r Zins in dieser allgemeinen wirtschaftlichen Form aufgefaßt<br />
wird, hat er mit <strong>de</strong>r Ethik noch keine Berührungspunkte. Die Zinsfrage<br />
wird für <strong>de</strong>n Ethiker erst dort relevant, wo es um die Aneignung <strong>de</strong>s<br />
Zinses geht. Erst nach<strong>de</strong>m die Frage entschie<strong>de</strong>n ist, welche Eigentumsord-<br />
424
Der Kapitalzins ist nun <strong>de</strong>r Preis für die reine Kapitalnut<br />
zung. In<strong>de</strong>m wir sagen „reine" Kapitaln<strong>utz</strong>ung, soll ange<strong>de</strong>utet<br />
sein, daß sowohl die Kosten für die Arbeit, also <strong>de</strong>r Arbeitslohn,<br />
wie auch <strong>de</strong>r „Lohn" <strong>de</strong>s Managers, <strong>de</strong>ssen Funktion in <strong>de</strong>r<br />
wirtschaftlichen Zusammenstellung von Arbeit <strong>und</strong> Kapital<br />
besteht, wie auch vor allem die Risikoprämie ausgeschie<strong>de</strong>n<br />
sind.<br />
Der Darlehenszins ist jenes Mehr, das <strong>de</strong>r Darlehensnehmer<br />
<strong>de</strong>m Darlehensgeber über <strong>de</strong>n geliehenen Betrag hinaus zu lei<br />
sten hat. 21 Im Darlehen wird eine Sache geliehen, die keinen<br />
eigenen Gebrauchsn<strong>utz</strong>en hat, son<strong>de</strong>rn im Gebrauch ver<br />
braucht wird. In<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Darlehensgeber die Sache leiht, vergibt<br />
er <strong>de</strong>n Verbrauch. Wenn er darüber hinaus noch einen Preis für<br />
imaginäre N<strong>utz</strong>ung verlangen wür<strong>de</strong>, dann wäre dies <strong>de</strong>r Dar<br />
lehenszins. Für gewöhnlich han<strong>de</strong>lt es sich in <strong>de</strong>r Geldwirt<br />
schaft beim Darlehen um ein Gelddarlehen. Es ist dies aber<br />
zum Begriff <strong>de</strong>s Darlehens als solchen nicht absolut notwendig.<br />
Thomas spricht zwar in unserer Frage ebenfalls hauptsächlich<br />
vom Gelddarlehen. Er schließt aber alle an<strong>de</strong>rn im Gebrauch<br />
verbrauchten Güter mit ein: „Wie daher je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r für ein Geld<br />
darlehen o<strong>de</strong>r etwas an<strong>de</strong>res, das im Gebrauch verbraucht<br />
wird..." (Art.2). Das lateinische Wort für <strong>de</strong>n Darlehenszins<br />
heißt foenus o<strong>de</strong>r usura (Wucher). Letzteres gibt bereits eine<br />
sittliche Bewertung an, in<strong>de</strong>m es die Verwerflichkeit <strong>de</strong>s Zinses<br />
ausdrückt. Das lateinische Wort, von welchem unser Wort<br />
„Zins" abgeleitet wird, heißt census <strong>und</strong> bezeichnet etwas ganz<br />
an<strong>de</strong>res als Zins, nämlich Schätzung, d. h. eine für einen steuer<br />
lichen Veranlagungszeitraum vorgenommene Schätzung eines<br />
nung (ob kommunitäre o<strong>de</strong>r private) <strong>und</strong>, in <strong>de</strong>r Folge, welche Wirtschaftsordnung<br />
(ob zentralgeleitete o<strong>de</strong>r freie Verkehrswirtschaft) <strong>de</strong>m Gemeinwohl<br />
die dienlichste ist, kann vom ethischen Standpunkt aus die Frage <strong>de</strong>s<br />
Zinses angefaßt wer<strong>de</strong>n. Es geht also dieser ethischen Frage nach <strong>de</strong>m Zins<br />
eine viel umfangreichere <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>sätzlichere wirtschaftsethische Frage<br />
voraus, nämlich die, welches Wirtschaftssystem <strong>de</strong>r sozialen Ordnung das<br />
dienlichste sei. Unsere Darlegungen gehen von <strong>de</strong>m hier nicht zu erörtern<strong>de</strong>n<br />
Gedanken aus, daß unter <strong>de</strong>n heute gegebenen Umstän<strong>de</strong>n die kapitalistische<br />
Wirtschaftsweise die <strong>de</strong>r sozialen Ordnung entsprechendste ist.<br />
Dabei ist <strong>de</strong>r Begriff „kapitalistische Wirtschaftsweise" nicht rein wirtschaftlich,<br />
son<strong>de</strong>rn wirtschaftsethisch zu verstehen, entsprechend <strong>de</strong>r Eigentumsordnung,<br />
daß es nämlich ein an<strong>de</strong>rer ist, welcher die Produktionsmittel<br />
besitzt, ein an<strong>de</strong>rer, welcher die Arbeit leistet.<br />
21 Vgl. O.v.Nell-Breuning - H.Sacher, a.a.O. 177.<br />
425
78 Einkommens aus einer dauern<strong>de</strong>n Ertragsquelle. Es han<strong>de</strong>lt<br />
sich hier also um eine Rente aus einer Rentenquelle. Ubertragen<br />
in die geldrechenhafte Wertung, be<strong>de</strong>utet dies nichts an<strong>de</strong>res als<br />
Kapital <strong>und</strong> Kapitalrendite.<br />
Zwei Fragen ergeben sich nun für uns im Hinblick auf die<br />
Thomaserklärung: l.Wie bewertet Thomas Rentenquelle <strong>und</strong><br />
Rente, Kapital <strong>und</strong> Kapitalrendite, Kapital <strong>und</strong> Kapitalzins?<br />
2.Warum verwirft er <strong>de</strong>n Darlehenszins?<br />
1. DIE BEURTEILUNG DER RENTE (CENSUS)<br />
Wenngleich je<strong>de</strong>m unvoreingenommenen Thomaskommen<br />
tator Orels Behauptung, Thomas habe das arbeitslose, rein<br />
kapitalistische Einkommen verworfen <strong>und</strong> nur die Arbeit als<br />
eigentliche Einkommensquelle bezeichnet, völlig gr<strong>und</strong>los<br />
erscheinen muß, so wer<strong>de</strong>n wir uns mit Orels Darstellungen<br />
doch etwas eingehen<strong>de</strong>r beschäftigen, um <strong>de</strong>njenigen Vertreter<br />
<strong>de</strong>r Arbeitslehre zu Wort kommen zu lassen, <strong>de</strong>r sich nicht so<br />
verschwommen wie mancher an<strong>de</strong>re auf Thomas beruft, son<br />
<strong>de</strong>rn sich unmittelbar mit <strong>de</strong>n Thomastexten auseinan<strong>de</strong>rsetzt.<br />
Wenn wir uns im folgen<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Nachweis beschäftigen,<br />
daß Thomas das arbeitslose Einkommen nicht verworfen, son<br />
<strong>de</strong>rn verteidigt hat, dann soll das Arbeitsethos, das bei Thomas<br />
eine beson<strong>de</strong>rs sorgsame Beachtung gef<strong>und</strong>en hat, keineswegs<br />
eine Einbuße erfahren. 22<br />
Im Gr<strong>und</strong>e läuft <strong>de</strong>r ganze Streit auf die Frage hinaus, wel<br />
chen Titel Thomas als <strong>de</strong>n ersten für <strong>de</strong>n Eigentums erwerb<br />
erklärt hat: die Besitznahme herrenlosen Gutes o<strong>de</strong>r die Arbeit.<br />
Wenn nämlich die Arbeit ihrem Wesen gemäß wirklich <strong>de</strong>r erste<br />
Titel <strong>de</strong>s Eigentumserwerbs sein sollte, dann kann folglich ein<br />
Einkommen, daß nicht aus Arbeit fließt, keinen Bestand mehr<br />
haben.Umgekehrt aber wür<strong>de</strong> wohl gelten, daß unter <strong>de</strong>r Vor<br />
aussetzung, daß reine Besitznahme herrenlosen Gutes bereits<br />
einen Eigentumstitel auf die Substanz einer Sache begrün<strong>de</strong>t,<br />
die Arbeit das Einkommen aus <strong>de</strong>r bereits erworbenen Sache<br />
erhöht. Wer die Arbeit zum ersten Titel erklärt, kann <strong>de</strong>m Men<br />
schen nur soviel Eigentumsrecht über die Sache zuteilen, als er<br />
Vgl. hierzu die einschlägige Literatur im Literatur-Verzeichnis am Schluß <strong>de</strong>s<br />
Ban<strong>de</strong>s unter <strong>de</strong>n Namen E.Welty, J.Hässle, S.M.Killeen, K.Müller.<br />
426
arbeitend die Sache vere<strong>de</strong>lt hat. Der arbeiten<strong>de</strong> Mensch wird 78<br />
darum eigentlich niemals Herr über die Substanz <strong>de</strong>r Sache<br />
selbst, kann sie darum auch niemals als Rentenquelle ben<strong>utz</strong>en.<br />
A. Horväth, <strong>de</strong>r in seinem Buch „Eigentumsrecht nach <strong>de</strong>m<br />
hl. Thomas von Aquin" die Arbeit zum ersten Titel <strong>de</strong>s Eigen<br />
tumserwerbs gemacht hat, war sich offenbar <strong>de</strong>r Tragweite sei<br />
ner Erklärung nicht bewußt. Orel dagegen hat die letzten Kon<br />
sequenzen daraus gezogen <strong>und</strong> Thomas zum klassischen Ver<br />
treter einer Arbeitswertlehre gemacht. In unserer Frage (78)<br />
sind es hauptsächlich zwei Stellen, die sich mit <strong>de</strong>r Rentenquelle<br />
befassen: Art. 1 Zu 6 <strong>und</strong> Art. 2 Zu 5. Ergänzend wird dann<br />
Art. 3 noch hinzugezogen.<br />
In Art. 1 Zu 6 spricht Thomas davon, daß man Silbergeschirr<br />
vermieten könne, weil <strong>de</strong>r Gebrauch <strong>de</strong>s Geschirrs nicht im<br />
Verbrauch besteht. Im selben Sinn könne man auch die Geld<br />
münzen einem weiteren Zweck als nur <strong>de</strong>m Tausch dienstbar<br />
machen, in<strong>de</strong>m man ihren Gebrauch zur Schaustellung o<strong>de</strong>r zur<br />
Pfandleistung verkauft, die Substanz <strong>de</strong>r Münze selbst aber als<br />
Eigentum sich vorbehält. Orel ist nun <strong>de</strong>r Auffassung, daß es<br />
sich hier trotz allem nicht um eine Rentenquelle han<strong>de</strong>lt, da<br />
nicht die reine Kapitaln<strong>utz</strong>ung verkauft wer<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn wegen<br />
an<strong>de</strong>rer Titel, wie Kosten für Arbeitsaufwand, Risikoprämie<br />
usw., ein Entgelt gefor<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>: „Mit Unrecht beruft man<br />
sich...auf die Stelle bei Thomas von Aquin, S.th. II—II 78,1 ad<br />
6, wo er davon spricht, daß man <strong>de</strong>n Gebrauch von Silberge<br />
schirr ebenso wie <strong>de</strong>n Gebrauch von Silbermünzen zur Schau<br />
stellung o<strong>de</strong>r zur Pfandbestellung verkaufen, d. h. also, daß<br />
man sie vermieten könne, ohne das Eigentum daran aufzuge<br />
ben, <strong>und</strong> für diese Vermietung einen Preis for<strong>de</strong>rn dürfe. Die<br />
Frage ist nämlich gar nicht diese, die <strong>de</strong>r Einwand im Auge hat:<br />
ob man ein Miet-Entgelt verlangen dürfe, was auch wir ohne<br />
weiteres zugeben. Son<strong>de</strong>rn die Frage ist: aus welchen Elemen<br />
ten sich dieser Mietpreis naturrechtlich zusammensetzt. Im<br />
Einklang mit <strong>de</strong>n von Thomas entwickelten <strong>Recht</strong>sgr<strong>und</strong>sätzen<br />
kann die Antwort nur so lauten: Der Vermieter darf nur äquiva<br />
lentes Entgelt für Arbeit <strong>und</strong> Kosten, Wertmin<strong>de</strong>rung u. dgl. (in<br />
unserem hochkapitalistischen Wirtschaftssystem auch die von<br />
Kanon 1543 zugelassene Schadloshaltung) for<strong>de</strong>rn, niemals<br />
aber die Vermietung dazu mißbrauchen, um eine arbeitslose<br />
Bereicherung auf Kosten <strong>de</strong>s Mieters zu erfahren" (a.a.O.,<br />
Bd. 1,233).<br />
427
78 Es ist aber nicht einzusehen, warum Thomas je<strong>de</strong>n soge-<br />
nannten Mehrwert ausschließen soll. Orel ist völlig im Banne<br />
seiner Erklärung von 77,4, wo er, wie bereits dargestellt, <strong>de</strong>r<br />
ganzen mittelalterlichen Scholastik die Ansicht unterschob, daß<br />
die einzigen Faktoren <strong>de</strong>r Preisbildung „Arbeit <strong>und</strong> Kosten"<br />
seien (Bd. 1,217).<br />
Ebenfalls von dieser Sicht her ist auch seine Erklärung von<br />
Art. 2 Zu 5 aufgefaßt. Thomas spricht hiervon einer Kapitalan<br />
lage im Geschäft eines Kaufmanns o<strong>de</strong>r eines Handwerkers<br />
„nach <strong>de</strong>r Weise einer Gesellschaft". Er meint nun, daß <strong>de</strong>r<br />
Geldgeber ruhig einen über <strong>de</strong>n investierten Betrag hinausge<br />
hen<strong>de</strong>n Son<strong>de</strong>ranteil am Geschäftsgewinn verlangen dürfe, weil<br />
er das Geld nicht in Form eines Darlehens <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren über<br />
gebe, son<strong>de</strong>rn vollgültiger Herr <strong>de</strong>s Werts bleibe, also Mitbesit<br />
zer <strong>de</strong>s Realkapitals sei. Der Kaufmann o<strong>de</strong>r Handwerker<br />
arbeitet mit diesem Kapital (wenigstens teilweise) als Manager<br />
<strong>de</strong>s Kapitalgebers. Das Risiko, so sagt Thomas ausdrücklich,<br />
bleibt beim Kapitalgeber. „Und darum", so folgert Thomas,<br />
„kann er erlaubterweise einen Teil <strong>de</strong>s daraus entstehen<strong>de</strong>n<br />
Gewinns for<strong>de</strong>rn, als von seiner eigenen Sache."<br />
Wie ist nun dieses Einkommen <strong>de</strong>s Kapitalgebers zu verste<br />
hen? Ist es eine Risikoprämie? O<strong>de</strong>r ist es <strong>de</strong>r Preis für die reine<br />
Kapitaln<strong>utz</strong>ung, also ein Mehrwert über Arbeit <strong>und</strong> Kosten?<br />
Orel hat sich gera<strong>de</strong> mit diesem Text viel Arbeit gemacht. Er<br />
möchte auch hier <strong>de</strong>n Text in <strong>de</strong>r nach seinem Sinn ausgelegten<br />
Wirtschaftsmoral <strong>de</strong>s hl. Thomas verstan<strong>de</strong>n wissen.<br />
In <strong>de</strong>r Tat gibt <strong>de</strong>r Text <strong>de</strong>r Kommentierung keine leichte<br />
Aufgabe auf. So meint Orel: „Aus <strong>de</strong>m Zusammenhang geris<br />
sen <strong>und</strong> ihrem bloßen Wortlaut nach betrachtet —, wie es bei <strong>de</strong>r<br />
kapitalistischen Deutung üblich ist — bleibt die Stelle dunkel<br />
<strong>und</strong> unklar. Nicht ersichtlich ist, was Thomas darunter versteht,<br />
wenn er das Geld einem Kaufmann o<strong>de</strong>r einem Handwerker<br />
,nach <strong>de</strong>r Weise einer Gesellschaft' anvertrauen läßt. Nicht<br />
ersichtlich ist, wieso Thomas das unserer Erfahrung gemäß in<br />
Wahrheit doch sehr oft gefähr<strong>de</strong>te Darlehen gefahrlos gegen<br />
über <strong>de</strong>r in Wahrheit kaum mehr gefähr<strong>de</strong>ten,Gesellschafts'ein-<br />
lage hinstellt. Nicht ersichtlich ist, wieso Thomas <strong>de</strong>m nicht<br />
arbeiten<strong>de</strong>n ,Gesellschafter' ,Gewinn, gleichsam von seiner<br />
Sache', zusprechen kann, obwohl er sonst <strong>de</strong>n arbeitslosen<br />
Gewinn gr<strong>und</strong>sätzlich verwirft. Endlich scheint sich <strong>de</strong>r gro<br />
teske Selbstwi<strong>de</strong>rspruch <strong>de</strong>s hl. Thomas zu ergeben, daß <strong>de</strong>r<br />
428
Kaufmann, <strong>de</strong>r unter Arbeit, Mühe <strong>und</strong> Gefahr <strong>de</strong>s Verlustes 78<br />
<strong>de</strong>s eigenen Vermögen, ja sogar seines Lebens, Geschäfte<br />
betreibt, nach Thomas keinen Gewinn machen dürfe, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n<br />
Entgelt seiner Arbeit <strong>und</strong> seiner Kosten überstiege, wogegen<br />
<strong>de</strong>r bloß mit einer Vermögenseinlage beteiligte, keine Arbeit,<br />
keine Mühe tragen<strong>de</strong> Gesellschafter' einen (über Arbeit, die für<br />
ihn nicht vorhan<strong>de</strong>n ist, <strong>und</strong> Kosten hinausgehen<strong>de</strong>n) Gewinn<br />
machen dürfe. Der nicht arbeiten<strong>de</strong> Kapitalist wäre somit gün<br />
stiger gestellt als <strong>de</strong>r arbeiten<strong>de</strong> Kaufmann. Eine <strong>de</strong>rartige<br />
Umstülpung seiner Wirtschaftsmoral kann <strong>de</strong>m hl. Thomas<br />
aber unmöglich zugemutet wer<strong>de</strong>n. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>r<br />
unmöglichen, oberflächlichen kapitalistischen Deutung wird<br />
sich bei gründlicher Durchforschung alsbald zeigen, daß diese<br />
auf <strong>de</strong>n ersten Blick so dunkle <strong>und</strong> wi<strong>de</strong>rspruchsvolle Stelle mit<br />
<strong>de</strong>r unzweifelhaften, klaren antikapitalistischen Lehre <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas vollkommen harmoniert" (a.a.O., Bd. 1,219).<br />
Orel sieht zwei Möglichkeiten <strong>de</strong>r Erklärung <strong>de</strong>s Begriffs <strong>de</strong>r<br />
Anvertrauung „nach <strong>de</strong>r Weise einer Gesellschaft": „entwe<strong>de</strong>r<br />
als regelrechte Darlehen zu geschäftlichen Zwecken (Han<strong>de</strong>ls<br />
<strong>und</strong> Gewerbekredit), o<strong>de</strong>r die Kommenda, <strong>de</strong>n ersten frühkapi<br />
talistischen Ansatz zu <strong>de</strong>n späteren Kapitalgesellschaften im<br />
mo<strong>de</strong>rnen Kapitalismus" (a.a.O.).<br />
Während sonstige Darlehen praktisch nur gegen ein sicheres<br />
Faustpfand o<strong>de</strong>r sehr gute Bürgschaft gewährt wur<strong>de</strong>n, kam die<br />
Pfandbestellung beim kleinen Kaufmann o<strong>de</strong>r Handwerker<br />
nicht in Frage, da die aufgenommene Summe ihr Vermögen<br />
überstieg. Bei Pfand- <strong>und</strong> Bürgschaftsdarlehen konnte sich <strong>de</strong>r<br />
Gläubiger an Faustpfand o<strong>de</strong>r Bürgen schadlos halten. Er lief<br />
also keine Gefahr, konnte darum auch keine eigene Risikoprä<br />
mie verlangen. An<strong>de</strong>rs bei Han<strong>de</strong>ls- <strong>und</strong> Gewerbekredit. Hier<br />
trat nach scholastischer Auffassung <strong>de</strong>r Kreditgeber in ein<br />
Gesellschaftsverhältnis mit <strong>de</strong>m Kaufmann o<strong>de</strong>r Handwerker.<br />
Er trug das Risiko für seine Einlage selbst. Orel schließt sodann<br />
daraus, daß <strong>de</strong>r von Thomas erwähnte „Gewinn" darum nichts<br />
an<strong>de</strong>res als eine Versicherung gegen Risiko war.<br />
Dasselbe nimmt Orel auch an für <strong>de</strong>n Fall, daß es sich um<br />
eine kaufmännische Kommenda han<strong>de</strong>lte. Diese war die Hin<br />
gabe einer Summe an einen an<strong>de</strong>rn zum Geschäftsbetrieb, <strong>de</strong>s<br />
sen Gewinn die Parteien später teilten. Orel meint, daß diese<br />
Gewinne im Gr<strong>und</strong>e nichts an<strong>de</strong>res waren als Deckung von frü<br />
her bereits erlittenen <strong>und</strong> später mit ziemlicher Wahrscheinlich-<br />
429
78 keit zu erwarten<strong>de</strong>n Verlusten. „Eine solche Entschädigung war<br />
in sich durchaus gerecht, stellte nur die Äquivalenz zwischen<br />
Leistung <strong>und</strong> Gegenleistung her" (a.a.O.221). Orel weist<br />
darauf hin, daß man in diesen Kommendae <strong>de</strong>s Mittelalters<br />
nicht etwa kapitalistisch aufgezogene, auf mächtige Gewinne<br />
angelegte Gesellschaften sehen dürfe. Han<strong>de</strong>lte es sich doch<br />
beim damaligen Transportwesen um riesige Gefahren für das<br />
Unternehmen <strong>und</strong> die Unternehmer selbst (Sturm, Räuberwe<br />
sen). Aus diesem Gr<strong>und</strong> sei das Zusammenwirken von mehre<br />
ren Kauf leuten <strong>und</strong> vielen Geldgebern zu einer Transportgesell<br />
schaft eine Notwendigkeit gewesen, zumal <strong>de</strong>r einzelne Betei<br />
ligte einen verhältnismäßig nur sehr geringen Einsatz zu leisten<br />
imstan<strong>de</strong> gewesen sei. „Nichts törichter", so meint Sombart<br />
(Der mo<strong>de</strong>rne Kapitalismus, 1, 291 ff., zitiert bei Orel a. a. O.<br />
220) „als das Mittelalter mit kapitalistisch empfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> ökonomisch geschulten Kaufleuten zu bevölkern. Das<br />
handwerksmäßige Wesen <strong>de</strong>s Händlers alten Schlages tritt vor<br />
allem in <strong>de</strong>r Eigenart seiner Zwecksetzung zutage. Auch ihm<br />
liegt im Gr<strong>und</strong>e seines Herzens nichts ferner als ein Gewinn<br />
streben im Sinne mo<strong>de</strong>rnen Unternehmertums; auch er will<br />
nichts an<strong>de</strong>res, nicht weniger, aber auch nicht mehr, als durch<br />
seiner Hän<strong>de</strong> Arbeit sich recht <strong>und</strong> schlecht <strong>de</strong>n stan<strong>de</strong>sgemä<br />
ßen Unterhalt verdienen; auch seine ganze Tätigkeit wird von<br />
<strong>de</strong>r I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r Nahrung beherrscht... Man weiß, welch mühsames<br />
<strong>und</strong> meist gefährliches Werk je<strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lsgeschäft war, das<br />
eine Ortsverän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Ware — <strong>und</strong> darum han<strong>de</strong>lte es sich ja<br />
fast immer — zur Voraussetzung hatte, weiß, daß <strong>de</strong>r Händler<br />
selbst mit <strong>de</strong>m Schwert umgürtet sich auf die Reise begeben,<br />
wochen- <strong>und</strong> monatelang in eigener Person Wagenführer <strong>und</strong><br />
Herbergsvater spielen mußte, um seine paar Colli glücklich an<br />
ihren Bestimmungsort zu bringen". Im Hinblick auf dieses<br />
ungeheure Risiko, <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Kapitalgeber sein Kapital in <strong>de</strong>n<br />
Kommendaeverträgen aussetzte, konnte er eine berechtigte Ver<br />
sicherungsprämie verlangen, welche gemäß <strong>de</strong>r Auslegung von<br />
Orel bei Thomas mit Gewinnanteil bezeichnet wur<strong>de</strong>: „Da bei<br />
Han<strong>de</strong>ls- <strong>und</strong> Gewerbekredit wie bei <strong>de</strong>r Kommenda <strong>de</strong>r Geld<br />
geber wahrhaftig eine Risikolast trug, konnte er auch <strong>de</strong>n dieses<br />
Risiko ausgleichen<strong>de</strong>n ,Gewinn'anteil als ,gleichsam von seiner<br />
Sache' gewonnene Versicherungs- o<strong>de</strong>r Ersatzquote mit <strong>Recht</strong><br />
for<strong>de</strong>rn. Eine solche Versicherungsquote darf selbstverständlich<br />
bei sämtlichen riskanten Geschäften, <strong>und</strong> zwar in solcher Höhe<br />
430
gerechterweise gefor<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, als die Gefahr im Durch- 78<br />
schnitt groß ist, bei beson<strong>de</strong>rs riskanten Unternehmungen ent<br />
sprechend höher. Worauf es ankommt, ist, daß die Gesamt<br />
summe <strong>de</strong>r gefor<strong>de</strong>rten Versicherungsprämien die Gesamt<br />
summe <strong>de</strong>r als präsumtiv eintretend errechneten <strong>und</strong> tatsäch<br />
lich eintreten<strong>de</strong>n Schä<strong>de</strong>n <strong>de</strong>cke, äquivaliere, nicht aber<br />
Gewinn aus frem<strong>de</strong>r Arbeit eintrage" (a. a. O. Bd. 1,221 f). Für<br />
Orel ist je<strong>de</strong>r arbeitslose Mehrwertgewinn offensichtlicher<br />
Wucher. Er kann es sich daher nicht aus<strong>de</strong>nken, daß Thomas,<br />
wenn er von einem „Gewinn"anteil sprach, an etwas an<strong>de</strong>res<br />
gedacht hätte als an die Risiko-Entschädigung. Orel gibt aller<br />
dings zu, daß <strong>de</strong>r zeitbedingte, unvermeidliche Mangel an<br />
volkswirtschaftlichen Erkenntnissen bei <strong>de</strong>n Scholastikern,<br />
auch bei Thomas, zu Unklarheiten, Schwankungen, Unge-<br />
nauigkeiten Anlaß gegeben habe <strong>und</strong> daß infolge<strong>de</strong>ssen in ihren<br />
Schriften „Wi<strong>de</strong>rsprüche gegen die von ihnen prinzipiell hoch<br />
gehaltene Äquivalenz- <strong>und</strong> Wucherlehre" vorkommen könnten.<br />
In <strong>de</strong>r uns hier beschäftigen<strong>de</strong>n Stelle löse sich allerdings <strong>de</strong>r<br />
scheinbare Wi<strong>de</strong>rspruch unschwer in Einklang auf. Thomas<br />
gebrauche <strong>de</strong>n Ausdruck „Gewinn" hier ebenso wie in 77,4, wo<br />
er vom erlaubten „Han<strong>de</strong>lsgewinn" re<strong>de</strong> <strong>und</strong> dabei nichts an<strong>de</strong><br />
res meine als <strong>de</strong>n Arbeitslohn <strong>de</strong>s Kaufmanns <strong>und</strong> Kostener<br />
satz, für <strong>de</strong>n Kostenpunkt; <strong>de</strong>nn darunter sei die Risiko-Ent<br />
schädigung zu rechnen (a.a.O.223). „Es ist somit stringent<br />
bewiesen, daß Thomas unter <strong>de</strong>m ,Gewinnanteil <strong>de</strong>s Geldge<br />
bers nicht einen über Arbeitslohn <strong>und</strong> Kostenersatz hinausge<br />
hen<strong>de</strong>n Mehrwertgewinn o<strong>de</strong>r echten Kapitalzins verstan<strong>de</strong>n<br />
haben kann" (Orel, a.a.O.).<br />
Was ist nun dazu zu sagen? Die Berufung auf 77,4 scheint <strong>de</strong>r<br />
Berechtigung wirklich zu entbehren, <strong>de</strong>nn es spricht alles dafür,<br />
daß Thomas dort <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsgewinn nicht nur als Arbeitslohn<br />
<strong>de</strong>s Kaufmanns verstan<strong>de</strong>n wissen wollte. Ferner ist zu be<strong>de</strong>n<br />
ken, daß Thomas die gesellschaftliche Geschäftsbeteiligung<br />
streng juristisch von <strong>de</strong>m reinen Darlehen unterschei<strong>de</strong>t. Im<br />
reinen Darlehen wird nach Thomas das Eigentum über die<br />
Sache mitvergeben, weil es sich um eine im Gebrauch ver<br />
brauchte Sache han<strong>de</strong>lt, während beim Kredit mit Geschäftsan<br />
teil <strong>de</strong>r Kreditgeber Kapitalbesitzer wird <strong>und</strong> damit am Ertrag<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens Anteil hat. Orel lehnt diese <strong>de</strong>m römischen<br />
<strong>Recht</strong>s<strong>de</strong>nken entnommene Begründung als unthomistisch ab.<br />
Er bezeichnet sie als juristische Fiktion <strong>und</strong> einen Irrweg <strong>de</strong>r<br />
431
78 Formalistik. Wie aber will man an<strong>de</strong>rerseits überhaupt noch mit<br />
unserer Frage 78 zurechtkommen, wenn mann diese streng<br />
juristische Unterscheidung zwischen Darlehen <strong>und</strong> gesell<br />
schaftlicher Geschäftsbeteiligung nicht mehr aufrechterhält <strong>und</strong><br />
als <strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>r ganzen Frage bezeichnet? Das Eigenartige <strong>de</strong>s<br />
Darlehens ist eben, daß das Eigentum an <strong>de</strong>r Sache entäußert<br />
wird, obwohl das Eigentum am Wert nicht aufgegeben wird.<br />
Wir wer<strong>de</strong>n darauf sogleich nochmals zu sprechen kommen<br />
müssen. Es ist gera<strong>de</strong> höchste wissenschaftliche Auszeichnung<br />
für Thomas, daß er alle Dinge von ihrer Wesens<strong>de</strong>finition her<br />
beurteilt. Wie sollte er nun auf einmal von diesem Verfahren<br />
abgehen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>finitionsgemäßen Unterschied zwischen<br />
Darlehen <strong>und</strong> gesellschaftlicher Geschäftsbeteiligung aufgeben<br />
zugunsten irgen<strong>de</strong>iner praktischen Sicht? Es hieße die ganze<br />
Frage 78 auf <strong>de</strong>n Kopf stellen, wenn man behaupten wollte,<br />
Thomas habe <strong>de</strong>n Darlehenszins aus <strong>de</strong>m Gr<strong>und</strong>e verworfen,<br />
weil in <strong>de</strong>r Praxis bereits ein sicheres Pfand o<strong>de</strong>r eine gute Bürg<br />
schaft für das Darlehen gestellt wor<strong>de</strong>n seien, <strong>und</strong> er habe<br />
beim Han<strong>de</strong>ls- <strong>und</strong> Gewerbekredit <strong>de</strong>m Kreditgeber das <strong>Recht</strong><br />
auf eine beson<strong>de</strong>re For<strong>de</strong>rung zuerkannt, weil an<strong>de</strong>rs das<br />
Risiko nicht ge<strong>de</strong>ckt wor<strong>de</strong>n wäre. Die Dinge liegen im Denken<br />
<strong>de</strong>s hl. Thomas wirklich tiefer. Sie sind gesehen vom verschie<br />
<strong>de</strong>nen Wesen <strong>de</strong>r Vertragsform. Hier von einem Irrweg <strong>de</strong>r For<br />
malistik re<strong>de</strong>n wollen, heißt, ethische <strong>und</strong> moraltheologische<br />
Bewertung vom Wesen in Zufälligkeiten verlegen.<br />
Orel sucht in Art. 3 unserer Frage eine Verstärkung für seine<br />
gr<strong>und</strong>sätzliche Unterstellung, daß für Thomas <strong>und</strong> die mittelal<br />
terliche Kirche nur Arbeit <strong>und</strong> Kosten <strong>de</strong>n Preis bestimmen <strong>und</strong><br />
somit je<strong>de</strong>s arbeitslose Einkommen, also auch je<strong>de</strong> Rente, sitt<br />
lich nicht mehr haltbar sei. 23 Thomas stellt sich in Art. 3 die<br />
Frage, wem <strong>de</strong>r Ertrag jener Güter gehöre, die man als Zins,<br />
d.h. in <strong>de</strong>r thomasischen Beurteilung als Wucher erworben<br />
habe. Er antwortet nun, daß bei jenen Dingen, <strong>de</strong>ren Gebrauch<br />
im Verbrauch besteht, wie z. B. Geld, Weizen, Wein, die also<br />
keinen eigenen N<strong>utz</strong>wert außer ihrer Substanz haben, die<br />
Rückgabe <strong>de</strong>r Substanz voll <strong>und</strong> ganz genüge, weil alles an<strong>de</strong>re,<br />
was sich sonst etwa als Ertrag aus solchen Dingen ergeben<br />
432<br />
Wir gehen auf Art. 3 nur insoweit ein, als es sich um das arbeitslose Einkommen<br />
im allgemeinen han<strong>de</strong>lt. Die darin behan<strong>de</strong>lte Frage <strong>de</strong>s Darlehenszinses<br />
wird uns noch eingehen<strong>de</strong>r beschäftigen.
könnte, <strong>de</strong>m menschlichen Fleiß zu verdanken, also Eigentum 78<br />
<strong>de</strong>s arbeiten<strong>de</strong>n Menschen sei. Es ist eigenartig, daß gera<strong>de</strong><br />
diese Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas von Orel dazu ben<strong>utz</strong>t wur<strong>de</strong>, die<br />
Theorie vom vollen Arbeitsertrag zu unterstützen: „Ihm — <strong>de</strong>m<br />
arbeiten<strong>de</strong>n Menschen — allein gehört <strong>de</strong>r Lohn seiner Mühen:<br />
die Arbeitsfrucht, <strong>und</strong> nicht seinen Hilfsmitteln <strong>und</strong> Werkzeu<br />
gen, nicht <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>und</strong> nicht <strong>de</strong>m,Kapital', nicht <strong>de</strong>m Eigen<br />
tümer dieser Wirtschaftsmittel als solchem. Mögen auch Natur<br />
kräfte <strong>und</strong> technische Behelfe noch so großen Anteil am<br />
Zustan<strong>de</strong>kommen <strong>de</strong>r Arbeitsfrucht haben, so sind sie doch<br />
nur als Arbeitsmittel für <strong>de</strong>n Menschen da, <strong>de</strong>r arbeitend ihr<br />
Herr gewor<strong>de</strong>n ist. Seiner industria, seiner Betriebsamkeit, sei<br />
nem Arbeitsfleiß verdankt die Arbeitsfrucht ihr Zustan<strong>de</strong>kom<br />
men; <strong>de</strong>m Arbeiter gebührt darum auch das Produkt selbst<br />
dann, wenn er kein an<strong>de</strong>res instrumentum als Geld verwen<strong>de</strong>te,<br />
während <strong>de</strong>m Geld <strong>und</strong> seinem Eigentümer als bloßem Eigen<br />
tümer o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Darleiher als solchem je<strong>de</strong>r Zins, je<strong>de</strong>r Mehr<br />
wert <strong>und</strong> Gewinn über die ursprüngliche Geldsumme hinaus<br />
versagt war. Das Erzeugnis gehört daher <strong>de</strong>r Arbeit sogar dann,<br />
wenn sie das instrumentum, die Arbeitsmittel, das ,Kapital'<br />
nicht rechtmäßig besaß, son<strong>de</strong>rn z.B. erwuchert (analog:<br />
gestohlen, geraubt) hatte, während in diesem Fall <strong>de</strong>m rechtmä<br />
ßigen Eigentümer <strong>de</strong>s erwucherten Gel<strong>de</strong>s zwar voller Ersatz,<br />
aber kein Anspruch auf einen Anteü an <strong>de</strong>m mittels seines ihm<br />
wi<strong>de</strong>rrechtlich entzogenen Eigentums von <strong>de</strong>r Arbeit erzeugten<br />
Arbeitsprodukt zusteht; <strong>de</strong>nn, sagt Thomas ausdrücklich<br />
(S. th. II—II 78), ,es ist nicht Frucht dieser (frem<strong>de</strong>n) Sache, son<br />
<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r menschlichen Betriebsamkeit'" (a.a.O.,Bd. 1,227).<br />
In Wirklichkeit geht es aber Thomas an dieser Stelle gar nicht<br />
darum, <strong>de</strong>n Arbeitsfleiß als die einzige Erwerbsquelle zu prei<br />
sen, son<strong>de</strong>rn zu zeigen, daß verbrauchbare Güter (d. h. Güter,<br />
die im Gebrauch verbraucht wer<strong>de</strong>n) alles, was sie eventuell<br />
sonst noch einbringen mögen, nicht aus sich haben, son<strong>de</strong>rn<br />
aus <strong>de</strong>m Fleiß <strong>de</strong>r Arbeit. In seiner zweiten Hälfte betont <strong>de</strong>r<br />
Artikel <strong>de</strong>s hl. Thomas die Möglichkeit arbeitslosen Einkom<br />
mens dort, wo Güter einen eigenen N<strong>utz</strong>ungswert haben. Daß<br />
Thomas wirklich einen Gewinn, d. h. ein über Kosten <strong>und</strong><br />
Arbeit hinausgehen<strong>de</strong>s Mehr verteidigt, beweist klar die Stelle<br />
in De malo 13,4 Zu 4. Der Einwand, <strong>de</strong>n sich Thomas macht,<br />
lautet dort folgen<strong>de</strong>rmaßen: „Wie <strong>de</strong>r Mensch Eigentumsrecht<br />
über sein Haus o<strong>de</strong>r Pferd hat, so hat er ebenfalls Eigentums-<br />
433
78 recht über sein Geld. Nun aber kann er sein Haus <strong>und</strong> Pferd für<br />
einen Preis vermieten. Also kann er aus <strong>de</strong>m gleichen Gr<strong>und</strong><br />
auch eine Vergütung für das Geld empfangen, das er als Darle<br />
hen gibt". Die Antwort darauf: „Manche sagen, daß das Haus<br />
<strong>und</strong> das Pferd durch <strong>de</strong>n Gebrauch abgen<strong>utz</strong>t wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>s<br />
wegen als Vergütung etwas empfangen wer<strong>de</strong>n könne, während<br />
das Geld nicht abgen<strong>utz</strong>t wer<strong>de</strong>. Doch ist diese Begründung<br />
nichtig, <strong>de</strong>nn danach könnte man für das vermietete Haus keinen<br />
höheren, die Abn<strong>utz</strong>ung <strong>de</strong>s Hauses übersteigen<strong>de</strong>n Preis nehmen.<br />
Man muß daher sagen, daß die N<strong>utz</strong>ung <strong>de</strong>s Hauses selbst erlaub<br />
terweise verkauft wird, nicht jedoch <strong>de</strong>s Gel<strong>de</strong>s aus <strong>de</strong>m [im<br />
Artikel] erwähnten Gr<strong>und</strong>e".<br />
Kann man nach all<strong>de</strong>m, was wir über die Ansicht <strong>de</strong>s hl. Tho<br />
mas bezüglich <strong>de</strong>s Spekulationsgewinns <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Rente gehört<br />
haben, Thomas zum Verteidiger <strong>de</strong>s arbeitslosen Einkommens<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Spekulationsgewinns erklären im Sinne, wie wir heute<br />
über diese Frage sprechen?<br />
Für uns heute haben diese Fragen eine viel größere Spann<br />
weite. Wir stellen sie zunächst in <strong>de</strong>n Rahmen <strong>de</strong>s Ordnungs<br />
ganzen einer Volkswirtschaft o<strong>de</strong>r gar <strong>de</strong>r Weltwirtschaft. Der<br />
Han<strong>de</strong>lsgewinn wird darum nicht nur unter <strong>de</strong>m Gesichts<br />
punkt betrachtet, inwieweit er unter einfacher Hinnahme einer<br />
bereits bestehen<strong>de</strong>n Preisordnung <strong>de</strong>n Mitmenschen o<strong>de</strong>r das<br />
Gemeinwohl etwa benachteilige, son<strong>de</strong>rn, ob er als reiner<br />
Gewinn zunächst rein theoretisch in einer Sozialwirtschaft mit<br />
Gleichgewichtspreis bestehen könne <strong>und</strong> inwieweit er, gemes<br />
sen an diesem I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s gerechten Preises, in einer Volkswirt<br />
schaft mit privater Eigentumsordnung noch erträglich sei. Das<br />
selbe gilt auch von <strong>de</strong>r Kapitalrendite. Mit <strong>de</strong>m Augenblick, da<br />
man das wirtschaftliche Gemeinwohl nicht mehr von einer vor<br />
gegebenen Ordnungswidrigkeit, son<strong>de</strong>rn von einem sozial-<br />
wirtschaftlichen I<strong>de</strong>alstandpunkt aus betrachtet, begibt man<br />
sich ins Gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>de</strong>r Wirtschaftsordnung <strong>und</strong> hebt damit<br />
die Frage nach <strong>de</strong>r Kapitalrendite in ein <strong>de</strong>m Denken <strong>de</strong>s hl.<br />
Thomas vorgelagertes Feld. Auf diesem Bo<strong>de</strong>n geht es nicht nur<br />
um das Wohlergehen aller in irgen<strong>de</strong>iner Weise <strong>und</strong> von irgend<br />
einem, gera<strong>de</strong> gültigen Standpunkt aus, son<strong>de</strong>rn um das auf<br />
ein gerechtes Wirtschaftssystem bezogene Wohlergehen aller.<br />
Es sei darum das, was bereits bei <strong>de</strong>r Besprechung <strong>de</strong>r thomasi<br />
schen Auffassung vom Eigentum gesagt wur<strong>de</strong>, hier nochmals<br />
unterstrichen: es geht nicht an, wirtschaftsethische Zitate aus<br />
434
Thomas so, wie sie sind, auf die mo<strong>de</strong>rnen Fragestellungen 78<br />
anzuwen<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn man wird stets, ausgehend von <strong>de</strong>n all<br />
gemeinen Sozialprinzipien <strong>de</strong>s hl. Thomas, eine neue, auf das<br />
konkrete Anliegen passen<strong>de</strong> Anwendung suchen müssen.<br />
2. DER DARLEHENSZINS<br />
Das klassische Argument, mit welchem Thomas — übrigens<br />
ganz in Übereinstimmung mit Aristoteles — <strong>de</strong>n Darlehenszins<br />
verwirft, ist sachlich auch heute noch unbestritten. Wir verteidi<br />
gen heute in <strong>de</strong>r kapitalistischen Wirtschaft <strong>de</strong>n Zins nicht <strong>de</strong>s<br />
wegen, weil wir vielleicht in <strong>de</strong>m Argument <strong>de</strong>r Alten einen<br />
Wi<strong>de</strong>rsinn ent<strong>de</strong>cken, son<strong>de</strong>rn weil wir zur volkswirtschaftli<br />
chen Erkenntnis <strong>de</strong>r Trennung von Sache <strong>und</strong> Wert gekommen<br />
sind.<br />
Ausgehend von <strong>de</strong>r juristischen Definition <strong>de</strong>s Darlehens<br />
vertrags als eines Vertrags, bei welchem eine Sache, die in ihrem<br />
Gebrauch verbraucht wird, geliehen wird, erklärt Thomas, daß<br />
je<strong>de</strong> weitere For<strong>de</strong>rung, die über die Rückgabe <strong>de</strong>r geliehenen<br />
Substanz hinausgeht, ungerecht sei. Bei <strong>de</strong>r Abfolge <strong>de</strong>r Gedan<br />
ken darf man nicht zu irgendwelchen in <strong>de</strong>r Wirtschaftsgesell<br />
schaft sich vorfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Phänomenen abschweifen, in<strong>de</strong>m man<br />
etwa an die geldrechenhafte Umwertung eines Quantums Brot<br />
in je<strong>de</strong>s beliebige Produktionsmittel <strong>de</strong>nkt, son<strong>de</strong>rn hat bei <strong>de</strong>r<br />
Äquivalenz zwischen <strong>de</strong>n zwei Individuen zu verbleiben, inner<br />
halb welchen sich <strong>de</strong>r Vertrag vollzieht; d. h., es wird nicht an<br />
einen allgemein wirtschaftlichen Wert, son<strong>de</strong>rn nur an diese<br />
eine verbrauchbare Sache, etwa das Quantum Brot, gedacht.<br />
Dieses wird zur Verfügung gestellt. Damit wird zugleich auch<br />
das Eigentum vergeben, <strong>de</strong>nn in<strong>de</strong>m das Brot vom Darlehens<br />
nehmer gebraucht wird, wird es verbraucht. Und <strong>de</strong>nnoch<br />
behält <strong>de</strong>r Darlehensgeber auch im klassischen Zins<strong>de</strong>nken sei<br />
nen <strong>Recht</strong>stitel auf genau so viel <strong>und</strong> so gutes Brot, wie er aus<br />
geliehen hat. Bekommt er dies zurück, dann besitzt er alles wie<br />
<strong>de</strong>r, worauf er Anspruch erheben durfte. Mehr zu for<strong>de</strong>rn wäre<br />
(stets im Rahmen dieses sachgeb<strong>und</strong>enen Denkens) Wucher.<br />
Der Zins für Darlehen wird daher mit Wucher gleichgesetzt.<br />
Von <strong>de</strong>rselben Eigenart wie die verbrauchbaren Sachen ist<br />
auch das Geld als Tauschmittel. Sein Gebrauch besteht darin,<br />
daß man es „ausgibt". Wenn also jemand einem an<strong>de</strong>rn Geld<br />
435
78 leiht, kann er von ihm kraft <strong>de</strong>s Darlehens nicht mehr zurück<br />
verlangen als eben<strong>de</strong>nselben Betrag, <strong>de</strong>n er als Darlehen aus<br />
gegeben hatte. Der Zins ist also auch hier Wucher <strong>und</strong> wäre im<br />
Falle, daß er gefor<strong>de</strong>rt wor<strong>de</strong>n wäre, zurückzuerstatten (Art. 1).<br />
Natürlich kennt Thomas die Unterscheidung in Geld als<br />
Tauschmittel <strong>und</strong> als Metall. Als letzteres kommt <strong>de</strong>m Geld ein<br />
weiterer Gebrauch zu, <strong>de</strong>r es nicht verzehrt: als Schaustück<br />
o<strong>de</strong>r als Handpfand. „Und diesen Gebrauch <strong>de</strong>s Gel<strong>de</strong>s kann<br />
man erlaubterweise verkaufen" (Art. 1 Zu 6, vgl. Anm. [68]).<br />
Aber im Geld als Tauschmittel sieht Thomas keine Möglichkeit,<br />
eine von <strong>de</strong>m Wesen <strong>de</strong>s Tauschmittels verschie<strong>de</strong>ne N<strong>utz</strong>ung<br />
zu ent<strong>de</strong>cken, welche man mit einem beson<strong>de</strong>ren Preis berech<br />
nen könnte; <strong>de</strong>nn „<strong>de</strong>rjenige, welcher Geld als Darlehen gibt,<br />
überträgt das Eigentum auf <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m er es leiht" (Art. 2 Zu 5).<br />
An<strong>de</strong>rs ist es, wie bereits gesagt, bei <strong>de</strong>r gesellschaftlichen<br />
Geschäftsteilnahme, die durch das Darlehen entsteht (Art. 2<br />
Zu 5).<br />
Wie Thomas beim Weizen nicht an eine Trennung von Sache<br />
<strong>und</strong> Wert dachte, ebensowenig <strong>und</strong> noch weniger konnte er auf<br />
<strong>de</strong>n Gedanken kommen, daß das Geld (als Tauschmittel) kein<br />
unverän<strong>de</strong>rlicher Wertmesser <strong>de</strong>r Dinge sei, son<strong>de</strong>rn selbst<br />
Wertschwankungen unterworfen sein <strong>und</strong> einen Preis haben<br />
könne. Die Scholastik hat nicht an die marktmäßige Preisbil<br />
dung für das Geld <strong>de</strong>nken können, da es eben <strong>de</strong>r Wesenheit <strong>de</strong>s<br />
Gel<strong>de</strong>s überhaupt wi<strong>de</strong>rsprach, Gegenstand von Kauf <strong>und</strong> Ver<br />
kauf zu sein. Nach Bernhardin von Siena (1380—1444) kann<br />
Geld nicht verkauft wer<strong>de</strong>n, da es selbst Mittel im Verkauf sei<br />
(Serm. 34, a.2,c.3).<br />
Thomas hat klar gewußt, daß <strong>de</strong>r Preis für einen Zentner<br />
Weizen im Laufe <strong>de</strong>r Zeit steigen o<strong>de</strong>r fallen kann. Und er hat<br />
sogar <strong>de</strong>m Kaufmann zugestan<strong>de</strong>n, diese Preisschwankungen<br />
zu seinem Vorteil auszun<strong>utz</strong>en, ohne übrigens an irgendwelche<br />
Kosten, etwa die Lagerkosten, o<strong>de</strong>r an aufgewandte Arbeit zu<br />
<strong>de</strong>nken, son<strong>de</strong>rn im Sinne eines reinen Marktgewinns. Er hat<br />
sich aber nicht die Frage gestellt, ob <strong>de</strong>rjenige, welcher heute<br />
einen Zentner Weizen ausleiht <strong>und</strong> ihn nach einem Jahr, nach<br />
<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Weizenpreis um 30 Prozent gesunken ist, wie<strong>de</strong>r<br />
zurückbekommt, diese 30 Prozent in Form von Entschädigun<br />
gen für erlittenen Scha<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r für Gewinnverlust einfor<strong>de</strong>rn<br />
könne. Thomas hat diese Frage nicht gestellt, weil sie für ihn<br />
bereits gelöst war. Ein Zentner Weizen blieb ein Zentner Wei-<br />
436
zen. Über <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>s Weizens wird nicht disputiert, weil nicht 78<br />
<strong>de</strong>r Wert <strong>de</strong>s Weizens ausgeliehen wur<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Weizen.<br />
Darum auch wird die Preisschwankung beim Darlehensvertrag<br />
überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Mit an<strong>de</strong>rn Worten: <strong>de</strong>r<br />
Wert wird von <strong>de</strong>r Sache nicht getrennt. Allerdings haben die<br />
Alten sehr wohl gewußt, daß eine verbrauchbare Sache, in<strong>de</strong>m<br />
man sie borgt, als Sache <strong>de</strong>m Eigentümer entschwin<strong>de</strong>t <strong>und</strong> er<br />
<strong>de</strong>n Anspruch auf <strong>de</strong>n gleichen Wert hat. Aber dieser Wert ist in<br />
<strong>de</strong>m Zentner Weizen sachlich verkörpert <strong>und</strong> gilt in <strong>de</strong>r mit<br />
telalterlichen Scholastik nicht als sozialwirtschaftlicher Wert,<br />
<strong>de</strong>r in einer geldrechenhaften, durchgängigen Verkehrswirt<br />
schaft von <strong>de</strong>r Sache abstrahiert wird. In sich ist darum das Dar<br />
lehen als solches wesentlich ein unentgeltlicher Vertrag. Der<br />
Darlehenszins, die Mehrfor<strong>de</strong>rung für eine verbrauchbare<br />
Sache, ist <strong>und</strong> bleibt ein Unding. Man muß schon von <strong>de</strong>r Sache<br />
weg in <strong>de</strong>n abstrakten Kapitalbegriff steigen, um <strong>de</strong>n „Darle-<br />
henszins" auf <strong>de</strong>m Weg über <strong>de</strong>n Kapitalzins begreifen zu kön<br />
nen.<br />
Die Alten hatten auch ganz richtig gesehen, daß das Geld als<br />
Tauschmittel niemals produktiv sein kann. Es ist es auch heute<br />
noch nicht. Wohl aber ist das Kapital produktiv, welches in Geld<br />
ziffer ausgedrücktes Erwerbsvermögen ist.<br />
Der Kern <strong>de</strong>s Arguments, um <strong>de</strong>ssentwillen Thomas <strong>de</strong>n<br />
Zins für Darlehen verwirft, besteht im Gedanken, daß im Dar<br />
lehen die ganze Sache samt ihrem Gebrauch, <strong>de</strong>r ein Verbrauch<br />
ist, in das Eigentum <strong>de</strong>s Darlehensnehmers übergeht. Wenn<br />
gleich <strong>de</strong>r Darlehensgeber <strong>de</strong>n Anspruch auf gleichen Wert sich<br />
vorbehält, so wird doch dieser Wert im Geltungsbereich <strong>de</strong>r<br />
ausgleichen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong>, d. h. <strong>de</strong>r Äquivalenz, in einer sta<br />
tischen Wirtschaft, gleichsam verkapselt, so daß eine Trennung<br />
<strong>de</strong>s Werts von <strong>de</strong>r Sache unmöglich wird.<br />
Orel verwirft, wie gesagt, die Erklärung, daß das Mittelalter<br />
<strong>de</strong>n Beweis gegen <strong>de</strong>n Zins auf <strong>de</strong>r juristischen Eigenart <strong>de</strong>s<br />
Darlehensvertrags aufgebaut habe. Sein Anliegen geht tiefer. Er<br />
möchte im mittelalterlichen Zinsverbot die gr<strong>und</strong>sätzliche Ver<br />
werfung arbeitslosen Einkommens, also auch <strong>de</strong>r Rente erblik-<br />
ken: „Es ist nicht allzuschwer einzusehen, daß auf das römisch<br />
rechtlich-formaljuristische Argument <strong>de</strong>r Eigentumsübertra<br />
gung beim Darlehen die Unerlaubtheit <strong>de</strong>s Darlehenszinses<br />
nicht gründbar ist" (a.a.O. Bd.2,72). Orel weist sodann auf<br />
eine Stelle bei Bernhardin von Siena hin, an welcher <strong>de</strong>r Unter-<br />
437
78 schied von Sache <strong>und</strong> Wert gründlich unterstrichen <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren<br />
Trennung sogar eingeleitet wird: „Obgleich das Geld hinsicht<br />
lich <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität seiner Substanz in das Eigentum <strong>de</strong>s Schuld<br />
ners übergeht, weil dieser nicht gehalten ist, das gleiche Geld<br />
seiner Substanz nach zurückzugeben, so bleibt <strong>de</strong>nnoch das<br />
besagte (geborgte) Geld im Eigentum <strong>de</strong>s Darlehensgebers hin<br />
sichtlich <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität o<strong>de</strong>r Gleichheit <strong>de</strong>s Wertes"<br />
(Serm.38,a. l,c.2). Orel zieht daraus <strong>de</strong>n Schluß, daß in <strong>de</strong>r<br />
wirtschaftsethischen Betrachtung <strong>de</strong>s Mittelalters <strong>de</strong>r Unter<br />
schied zwischen Darlehen <strong>und</strong> Kapitalgesellschaft nicht etwa in<br />
einer juristisch verschie<strong>de</strong>nen Eigentumsregelung zu suchen<br />
sei, son<strong>de</strong>rn einzig in <strong>de</strong>r praktischen Übung, daß beim Darle<br />
hen das Risiko durch Pfand <strong>und</strong> Bürgen ge<strong>de</strong>ckt war, während<br />
dies bei <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Mitbeteiligung nicht <strong>de</strong>r Fall war,<br />
so daß im Gr<strong>und</strong>e bei<strong>de</strong> Male die gleiche Gr<strong>und</strong>ten<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>s<br />
Mittelalters sichtbar wür<strong>de</strong>: Kampf <strong>de</strong>m arbeitslosen Einkom<br />
men. Mit Bezug auf die aus Bernhardin zitierte Stelle erklärt<br />
Orel: „Mit dieser unbestreitbaren Feststellung Bernhardins<br />
stürzt nicht nur die ganze Theorie vom ,Kapitalgeschäft' (Weiß),<br />
bei <strong>de</strong>m, im Gegensatz zum Darlehen, Zins <strong>de</strong>shalb erlaubt sei,<br />
weil <strong>de</strong>r Eigentümer geblieben sei, son<strong>de</strong>rn es erhellt daraus<br />
auch ganz klar <strong>de</strong>r wahre Sinn <strong>de</strong>s kanonischen Zinsverbotes: daß<br />
je<strong>de</strong>r arbeitslose Mehrwertgewinn, je<strong>de</strong>r echte Kapitalzins an<br />
<strong>und</strong> für sich wucherisch ist, nicht bloß <strong>de</strong>r Darlehenszins, <strong>de</strong>r<br />
nur ein Spezialfall <strong>de</strong>s Allgemeinbegriffes: Kapitalzins ist. Denn<br />
ist es beim Darlehen nicht die formaljuristische Konstruktion<br />
mit <strong>de</strong>r angeblichen Eigentumsübertragung, auf die das Zins<br />
verbot gegrün<strong>de</strong>t ist, son<strong>de</strong>rn die Unerlaubtheit eines arbeitslo<br />
sen Renten- o<strong>de</strong>r Kapitalzinsbezuges, trotz<strong>de</strong>m man Eigentü<br />
mer geblieben ist <strong>und</strong> das Benützungsrecht an seinem eigenen<br />
Vermögen an einen an<strong>de</strong>ren übertrug, dann ist selbstverständ<br />
lich auch in allen an<strong>de</strong>ren Fällen <strong>de</strong>r Gewährung <strong>de</strong>s Benüt-<br />
zungs- o<strong>de</strong>r Gebrauchsrechtes <strong>de</strong>r eigenen Sache an einen an<strong>de</strong><br />
ren ein Mehrwertbezug von diesem unerlaubt. Es gilt eben für<br />
<strong>de</strong>n gesamten entgeltlichen Wirtschaftsverkehr, gleichgültig, ob<br />
es sich um Darlehen, Miete, Kauf, Arbeitslohn o<strong>de</strong>r was immer<br />
sonst handle, das eine <strong>und</strong> selbe Verkehrsgr<strong>und</strong>gesetz <strong>de</strong>r Äquiva<br />
lenz, <strong>de</strong>mzufolge man sich Arbeit <strong>und</strong> Kosten entgelten lassen,<br />
nie aber einen Mehrwertgewinn ohne gleichwertige Gegenlei<br />
stung beanspruchen darf. Umgekehrt wäre es sinnlos, gera<strong>de</strong><br />
nur beim Darlehen <strong>de</strong>n entgeltlosen Mehrwertgewinnbezug zu<br />
438
verbieten, <strong>de</strong>r in allen an<strong>de</strong>rn Fällen von Vermögensverkehr 78<br />
gestattet wäre" (a.a.O., Bd.2,73).<br />
Wir können nur wie<strong>de</strong>rholen, daß die formaljuristische<br />
Betrachtung <strong>de</strong>s Zinsdarlehens bei Thomas vorwiegt <strong>und</strong> die<br />
Risiko<strong>de</strong>ckung erst in zweiter, außerwesentlicher Linie eine<br />
Rolle spielt. Von diesen „äußeren" Zinstiteln, die im Gr<strong>und</strong>e<br />
überhaupt keine „Zins"titel sind, wird sogleich noch die Re<strong>de</strong><br />
sein. Richtig allerdings ist in <strong>de</strong>r Darlegung Orels, daß die for<br />
maljuristische Betrachtung allein nicht genügt, um die Ableh<br />
nung <strong>de</strong>s Zinses im Darlehen bei Thomas verstehen zu können.<br />
Denn ohne Zweifel hat auch Thomas schon begriffen, daß <strong>de</strong>r<br />
Darlehensgeber sich seines Eigentums nicht völlig begibt, sonst<br />
hätte er nicht vom Darlehen, son<strong>de</strong>rn von einer Schenkung<br />
gesprochen. Der Darlehensgeber hat selbstre<strong>de</strong>nd auch in <strong>de</strong>r<br />
Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas einen wirklichen Anspruch auf die Rück<br />
gabe <strong>de</strong>s geliehenen Gutes. Welchen Gutes? Des sachlich nicht<br />
i<strong>de</strong>ntischen, aber wertmäßig gleichen. Auch dies ist Thomas<br />
klar gewesen. Das Eigentümliche nun dieser Wertgleichheit ist,<br />
daß diese nicht im dynamischen sozialwirtschaftlichen Raum<br />
gesehen wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> man darum auch nicht auf <strong>de</strong>n Gedanken<br />
kommen konnte, daß unter diesem Wert sich jedwe<strong>de</strong>s reale<br />
Erwerbsvermögen verbarg. Mit an<strong>de</strong>ren Worten: Mit <strong>de</strong>r<br />
Unterscheidung zwischen Sache <strong>und</strong> Wert wur<strong>de</strong> nicht so weit<br />
Ernst gemacht, daß man <strong>de</strong>n Wert von <strong>de</strong>r Sache trennte. Im<br />
übrigen weist die Stelle aus Bernhardin von Siena sachlich<br />
gera<strong>de</strong> in die gegensätzliche Richtung, als Orel sie interpretiert:<br />
nicht in die Ablehnung <strong>de</strong>s Zinses, son<strong>de</strong>rn in seine Befürwor<br />
tung.<br />
Wir gehen heute bei <strong>de</strong>r ethischen Verteidigung <strong>de</strong>s Darle<br />
henszinses als eines <strong>Recht</strong>sanspruchs <strong>de</strong>s Darlehensgebers vom<br />
Kapitalbegriff in einer geldrechenhaften, durchgängigen Ver<br />
kehrswirtschaft aus. Bleiben wir aber streng logisch bei <strong>de</strong>r mit<br />
telalterlichen Betrachtungsweise <strong>de</strong>s Darlehens als eines Leih<br />
vertrages hinsichtlich einer verbrauchbaren Sache, ohne Rück<br />
sicht auf <strong>de</strong>ren sozialwirtschaftliche Bewandtnis als Kapital,<br />
dann müssen wir zur selben Schlußfolgerung kommen wie das<br />
Mittelalter: Das Darlehen läßt als Darlehen (vi mutui) keine<br />
Mehrfor<strong>de</strong>rung in Form von Zins zu.<br />
Je<strong>de</strong> Mehrfor<strong>de</strong>rung muß ihre Begründung an<strong>de</strong>rswo als im<br />
Darlehen suchen. Es han<strong>de</strong>lt sich um die sogenannten äußeren<br />
Zinstitel, <strong>de</strong>ren die spätere Scholastik verschie<strong>de</strong>ne anerkannt<br />
439
78 hat, die uns aber hier nur insoweit beschäftigen, als Thomas<br />
davon spricht. Die diesbezügliche Stelle ist Art. 2 unserer Frage.<br />
Thomas sieht keinerlei Schwierigkeit in <strong>de</strong>r Mehrfor<strong>de</strong>rung<br />
zum Ersatz eines im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m Darlehen ste<br />
hen<strong>de</strong>n Verlustes (Art. 2 Zu 1). Er gebraucht für diese Schadlos<br />
haltung <strong>de</strong>n Ausdruck „interesse" (3 Qlb 7,2; Mal 13,4 ad 14).<br />
Er <strong>de</strong>nkt dabei z. B. an Entschädigung für Nichteinhaltung <strong>de</strong>s<br />
Termins. Dagegen verbietet Thomas, eine Vergütung für ent<br />
gangenen Gewinn zu verlangen. Die Begründung hierfür: Man<br />
kann nicht verkaufen, was noch nicht vorhan<strong>de</strong>n ist. Die Tho<br />
masinterpreten haben allerdings <strong>de</strong>n entgangenen Gewinn <strong>de</strong>n<br />
noch unter die berechtigten äußeren Zinstitel einreihen können,<br />
da sie die Hoffnung, d. h. die sichere Aussicht auf Gewinn als<br />
genauso gut preismäßig bewertbar erklärten wie das Risiko<br />
eines Kreditgebers „nach <strong>de</strong>r Art eines Gesellschafters", wovon<br />
Thomas in Art. 2 Zu 5 spricht. Obwohl Thomas (Art. 2 Zu 1)<br />
meint, daß <strong>de</strong>r tatsächliche Gewinn „in vielfältiger Weise ver<br />
hin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n" könnte, so halten die späteren Scholastiker<br />
dafür, daß man doch die bestehen<strong>de</strong> Chance abwägen <strong>und</strong><br />
wertmäßig festlegen könne. Eine solche Interpretation kann<br />
man wohl als weitläufige Parallele zu <strong>de</strong>r von Thomas aner<br />
kannten Risikoprämie anerkennen, wenngleich Thomas von<br />
<strong>de</strong>r Risikoprämie beim Darlehen nicht ausdrücklich spricht,<br />
son<strong>de</strong>rn nur beim Han<strong>de</strong>ls- <strong>und</strong> Gewerbekredit.<br />
Der von <strong>de</strong>n späteren Theologen allgemein befürwortete<br />
„gesetzliche" Titel hätte wohl bei Thomas keine Gna<strong>de</strong> gefun<br />
<strong>de</strong>n. Thomas kommt eigens auf eine Gepflogenheit <strong>de</strong>s römi<br />
schen <strong>Recht</strong>s zu sprechen, gemäß welcher neben <strong>und</strong> getrennt<br />
vom Darlehen noch eine eigene Abmachung, die sachlich <strong>de</strong>m<br />
Zins gleichkam, gestattet war (vgl. Art. 1 Zu 3). „Das positive<br />
<strong>Recht</strong> geht hauptsächlich auf das gemeinsame Wohl <strong>de</strong>r vielen.<br />
Es ist aber bisweilen möglich, daß einer Gemeinschaft größter<br />
Scha<strong>de</strong>n daraus erwächst, daß man ein Übel abriegelt. Darum<br />
erlaubt bisweilen das positive <strong>Recht</strong> etwas nach Art einer<br />
Dispens, nicht, weil es [in sich] gerecht wäre, son<strong>de</strong>rn um zu<br />
verhin<strong>de</strong>rn, daß die Gemeinschaft größeren Scha<strong>de</strong>n nehme,<br />
wie auch Gott manches Übel in <strong>de</strong>r Welt geschehen läßt, um das<br />
Gute nicht zu verunmöglichen, das Er aus diesen Übeln heraus<br />
zuholen versteht. Und in dieser Weise hat das positive <strong>Recht</strong><br />
Wucher zugelassen um <strong>de</strong>r vielen Vorteile willen, welche<br />
manche bisweilen aus <strong>de</strong>m Darlehen ziehen, wenngleich unter<br />
440
Wucherdruck" (Mal 13,4 ad 6). Damit ist <strong>de</strong>r gesetzliche Titel in 78<br />
sich abgelehnt. In <strong>de</strong>r Tat ist er erst haltbar, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Darle<br />
henszins auf <strong>de</strong>m Weg über <strong>de</strong>n Kapitalzins seine <strong>Recht</strong>ferti<br />
gung gef<strong>und</strong>en hat.<br />
Nach <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas (Art. 2) kann <strong>de</strong>r Darlehens<br />
geber selbstre<strong>de</strong>nd vom Darlehensnehmer die preismäßig nicht<br />
zu bewerten<strong>de</strong> Gesinnung <strong>de</strong>s Dankes <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Wohlwollens<br />
erwarten, die sich ihrerseits sichtbar erweisen kann in einer frei<br />
erwiesenen Gegengabe (Art. 2 Zu 2; Mal 13,4 ad 5).<br />
Der Darlehenszins ist immer zurückzuerstatten. Dies erfor<br />
<strong>de</strong>rt die <strong>Gerechtigkeit</strong>, erklärt Thomas im 3. Artikel. Der<br />
Gedanke ist im Zusammenhang <strong>de</strong>r mittelalterlichen Zinslehre<br />
klar <strong>und</strong> unbestritten. Gera<strong>de</strong> an dieser Stelle erkennt man<br />
<strong>de</strong>utlich, wie sachgeb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> wie weit entfernt vom sozial<br />
wirtschaftlichen „Wert" die Güter betrachtet wur<strong>de</strong>n. Weizen,<br />
Wein <strong>und</strong> selbst auch das Tauschmittel Geld sind zwar, wie<br />
gesagt, auch im thomasischen Denken „Werte", aber doch keine<br />
sozialwirtschaftlichen Werte, die in die Zukunft hineinweisen,<br />
d. h. die Zukunft mitbezeichnen, so daß ihr gegenwärtiger<br />
Besitz ein Mehr be<strong>de</strong>utet gegenüber ihrem Besitz in <strong>de</strong>r<br />
Zukunft. Diese Werte sind in <strong>de</strong>r mittelalterlichen Sicht viel<br />
mehr nur Gegenwartswerte, d. h. sie haben im Augenblick, da<br />
man sie betrachtet, einen durch die Wirtschaftsgesellschaft<br />
bestimmten Wert, <strong>de</strong>r als einziger Maßstab gilt für ein zwischen<br />
zwei Vertragspartnern abzuschließen<strong>de</strong>s Geschäft. Darum<br />
kann Kreditgewährung nicht zu einem Mehr an For<strong>de</strong>rung<br />
berechtigen (Art. 2 Zu 7), es sei <strong>de</strong>nn, <strong>de</strong>r Kreditgeber trete in<br />
ein Kapitalgeschäft mit <strong>de</strong>m Kreditnehmer (Art. 2 Zu 5); auch<br />
kann Vorauszahlung keinen Anspruch auf eine Preissenkung<br />
erheben (Art. 2 Zu 7).<br />
Wenn nun jemand als Zins nicht nur eine im Gebrauch ver<br />
brauchbare Ware gefor<strong>de</strong>rt hat, son<strong>de</strong>rn vielmehr eine Sache,<br />
die einen eigenen N<strong>utz</strong>wert besaß, dann ist er zur Rückgabe<br />
auch all <strong>de</strong>r gewonnenen N<strong>utz</strong>ungen <strong>und</strong> Früchte verpflichtet,<br />
abgesehen natürlich von jenem Teil, <strong>de</strong>r seiner persönlichen<br />
Arbeit zukommt (Art. 3). Thomas erkennt hier offenbar einen<br />
über Arbeit <strong>und</strong> Kosten hinausgehen<strong>de</strong>n Wert an <strong>de</strong>n N<strong>utz</strong>gü<br />
tern, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Eigentümer als arbeitsloses Einkommen in <strong>de</strong>n<br />
Schoß fällt.<br />
Sosehr Thomas <strong>de</strong>n zinsfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Darlehensgeber ver<br />
urteilt, so gestattet er doch <strong>de</strong>m Darlehensnehmer, <strong>de</strong>n Zins zu<br />
441
78 bezahlen, <strong>de</strong>r von ihm erpreßt wird, da <strong>de</strong>r Darlehensnehmer<br />
sich an <strong>de</strong>m Wucher nicht aktiv beteilige <strong>und</strong> im Gr<strong>und</strong>e nur sei<br />
ner o<strong>de</strong>r eines an<strong>de</strong>rn Notdurft abhelfen wolle (Art. 4). Man<br />
könnte im 4. Artikel eine Bestätigung dafür fin<strong>de</strong>n, daß Darle<br />
henszins aus rein praktischen Grün<strong>de</strong>n verworfen wer<strong>de</strong>, weil<br />
das Darlehen im Mittelalter fast durchweg für <strong>de</strong>n Ankauf von<br />
Konsumgütern verwen<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n sei. Doch ist dieser Schluß<br />
nach all <strong>de</strong>m, was wir bisher über <strong>de</strong>n Darlehenszins bei Tho<br />
mas vernommen haben, nicht haltbar. Etwas an<strong>de</strong>res ist natür<br />
lich, ob ein solcher Darlehenszins nicht doppelt verwerflich ist:<br />
im Hinblick auf die innere Ungerechtigkeit im Darlehensver<br />
trag <strong>und</strong> auf die grobe Ausn<strong>utz</strong>ung <strong>de</strong>r Not <strong>de</strong>s Mitmenschen.<br />
Viertes Kapitel<br />
DIE WESENSELEMENTE<br />
GERECHTEN HANDELNS<br />
(Fr. 79)<br />
79 Unter <strong>de</strong>r Überschrift „Die vervollständigen<strong>de</strong>n (integralen)<br />
Teile <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>" behan<strong>de</strong>lt Thomas das Problem <strong>de</strong>r<br />
sittlichen Aufbauelemente <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> (zum Begriff <strong>de</strong>r<br />
„Teile" in <strong>de</strong>r Tugendlehre vgl. Anmerkung [14]). Mit an<strong>de</strong>ren<br />
Worten, es geht um die Frage: Was gehört zutiefst zum gerechten<br />
Han<strong>de</strong>ln? Nach all <strong>de</strong>m, was auf <strong>de</strong>n bisherigen Seiten erörtert<br />
wor<strong>de</strong>n ist, möchte man annehmen, daß Thomas hier einen<br />
kurzen Überblick gäbe über das Naturrecht, seinen Wirkkreis,<br />
seine Wandlung in <strong>de</strong>r soziologischen Entwicklung <strong>de</strong>r Men<br />
schen. Jedoch lesen wir von <strong>de</strong>m allem nichts. Man ist erstaunt,<br />
daß hier als die aufbauen<strong>de</strong>n Elemente gerechten Han<strong>de</strong>lns<br />
Gr<strong>und</strong>sätze genannt wer<strong>de</strong>n, die /Gzwrischen Kategorien ähn<br />
lich sehen: Das Böse mei<strong>de</strong>n, das Gute tun. Allerdings begreift<br />
hier Thomas unter <strong>de</strong>m Guten nicht nur das allgemein Gute,<br />
wie es je<strong>de</strong>r guten Handlung o<strong>de</strong>r überhaupt <strong>de</strong>m Sein<br />
zukommt, <strong>und</strong> nicht nur das allgemein Böse, das in je<strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong><br />
sich fin<strong>de</strong>t, da er ausdrücklich betont (Art. 1), daß es sich um<br />
das <strong>de</strong>m Nächsten geschul<strong>de</strong>te Gut handle, das zu erstatten<br />
o<strong>de</strong>r ihm zu belassen sei. Damit sind wir zwar bereits im beson<br />
<strong>de</strong>ren sittlichen Bereich <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Jedoch wür<strong>de</strong> dieser<br />
zweigliedrige Gr<strong>und</strong>satz in dieser seiner allgemeinen Form<br />
442
noch nicht ausreichen, um als Aufbauelement einer an <strong>de</strong>r 79<br />
Natur <strong>de</strong>r Dinge sich messen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> zu gelten, wenn<br />
das „<strong>de</strong>m Nächsten Geschul<strong>de</strong>te" nicht in Zusammenhang<br />
gebracht wür<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m gesamten Traktat <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>, in<br />
welchem das Geschul<strong>de</strong>te <strong>de</strong>s näheren betrachtet wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Wollte man die enge Verb<strong>und</strong>enheit, die zwischen diesem<br />
Anhängsel, das die Frage 79 bil<strong>de</strong>t, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r gesamten Erörte<br />
rung über <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> besteht, auflösen, dann<br />
wür<strong>de</strong> alles, was Thomas über die Natur <strong>de</strong>r Sache als Objekt<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> gesagt hat, illusorisch. <strong>Recht</strong> verstan<strong>de</strong>n, will<br />
also <strong>de</strong>r erste Artikel unserer Frage besagen: Gerecht kann nur<br />
sein, wer das Naturgerechte <strong>de</strong>m Nächsten beläßt o<strong>de</strong>r ihm<br />
gibt. Worin nun das Naturgerechte besteht, dies ist im einzel<br />
nen Fall entsprechend <strong>de</strong>m thomasischen Erkenntnisoptimis<br />
mus auffindbar <strong>und</strong> mit Verantwortung zu ermitteln.<br />
Gegen <strong>de</strong>n ersten Teil <strong>de</strong>s Gr<strong>und</strong>gesetzes gerechten Han<br />
<strong>de</strong>lns „das Böse mei<strong>de</strong>n", verfehlt man sich durch Übertretung<br />
(Art. 2). Gegen <strong>de</strong>n zweiten Teil richtet sich die Sün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Unterlassung (Art. 3). Übertretung be<strong>de</strong>utet hier folgerichtig<br />
zum Gesagten nicht nur jener allgemeine Ungehorsam gegen<br />
Gottes Gebot, wie er in je<strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong> enthalten ist, son<strong>de</strong>rn im<br />
beson<strong>de</strong>ren ein ausgesprochenes Unrechttun gegenüber <strong>de</strong>m<br />
Gesetz, ein trotziges Nein gegenüber <strong>de</strong>n vom Gesetz Gottes<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Menschen vorgezeichneten <strong>und</strong> auferlegten Grenzen.<br />
Die Unterlassung be<strong>de</strong>utet in ähnlicher Weise eine eigene Sün<strong>de</strong><br />
gegen die <strong>Gerechtigkeit</strong>, insofern sie die Nichtleistung eines<br />
(aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Verkehrsgerechtigkeit) <strong>de</strong>m Nächsten o<strong>de</strong>r (auf<br />
gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit) <strong>de</strong>r Gemeinschaft <strong>und</strong> selbst<br />
Gott geschul<strong>de</strong>ten Gutes ist. Beson<strong>de</strong>re Beachtung verdient<br />
hierbei <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit, <strong>de</strong>n Thomas<br />
(Art. 3) anwen<strong>de</strong>t. Die Gesetzesgerechtigkeit ist hier nicht nur<br />
jene Tugend, welche Alles gemäß <strong>de</strong>m menschlichen Gesetz auf<br />
das Gemeinwohl ausrichtet, son<strong>de</strong>rn in einem noch viel umfas<br />
sen<strong>de</strong>ren Sinne auch die Unterordnung <strong>de</strong>s persönlichen Seins<br />
unter das Gesetz Gottes. Eine solche Ausweitung <strong>de</strong>s Begriffs<br />
<strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit darf nicht befrem<strong>de</strong>n, da im thomasi<br />
schen Traktat über das Gesetz Gott nicht nur <strong>de</strong>r Herr <strong>de</strong>s ein<br />
zelnen persönlichen Wesens, son<strong>de</strong>rn als Gesetzgeberauch <strong>und</strong><br />
gera<strong>de</strong> Herr <strong>de</strong>r Gemeinschaft ist, also in vollem <strong>und</strong> ungekürz<br />
tem Sinn das Gemeinwohl <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft dar<br />
stellt, so daß Gott nicht nur Objekt irgen<strong>de</strong>iner sittlichen Hand-<br />
443
79 lung ist, son<strong>de</strong>rn in ausgeprägtester Form Objekt einer wahren<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>s-, nämlich Gesellschaftsverpflichtung. Es wäre<br />
darum verkehrt, etwa an <strong>de</strong>n allgemein theologischen Begriff<br />
<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong> im Sinn von <strong>Recht</strong>fertigung vor Gott zu <strong>de</strong>n<br />
ken.<br />
Die Unterlassung besagt nicht nur ein reines Nicht-sein<br />
irgen<strong>de</strong>ines Aktes, son<strong>de</strong>rn das Nicht-sein aus Schuld. Wann<br />
aber tritt diese Schuld wirklich ein, da <strong>de</strong>r Mensch doch eigent<br />
lich nicht han<strong>de</strong>lt? Um diese Frage zu klären, gebraucht Tho<br />
mas (Art. 3 Zu 3) ein humorvolles, kulturgeschichtlich interes<br />
santes Beispiel: Ein Mönch verschläft <strong>de</strong>n Nachtchor, weil er<br />
sich abends betrunken hat. Die Unterlassungssün<strong>de</strong> besteht<br />
nicht in <strong>de</strong>r Betrunkenheit, <strong>de</strong>nn diese war eine Übertretung.<br />
Die Betrunkenheit ist Ursache <strong>de</strong>r Unterlassung, die Unterlas<br />
sung selbst geschieht zu <strong>de</strong>r Zeit, da <strong>de</strong>r betrunkene Mönch die<br />
Metten verschläft. Denn „angenommen, er wür<strong>de</strong> mit Gewalt<br />
aus <strong>de</strong>m Schlaf geweckt <strong>und</strong> ginge in die Metten, so beginge er<br />
keine Unterlassung". Verglichen mit <strong>de</strong>r Übertretung ist die<br />
Unterlassung, abstrakt gesprochen, nicht so schwerwiegend,<br />
wie Thomas in Art. 4 ausführt, womit selbstre<strong>de</strong>nd nicht gesagt<br />
ist, daß sie keine schwere Sün<strong>de</strong> sein könne.<br />
EXKURS I<br />
DIE ANWENDUNG<br />
DES BEGRIFFS DER GANZHEIT<br />
AUF DIE GESELLSCHAFTSLEHRE<br />
Exk. I Die Lehre vom Verhältnis <strong>de</strong>s Einzelmenschen zum Staat ist<br />
bei Thomas weitgehend, wenn nicht gar zum wesentlichen Teil,<br />
von <strong>de</strong>m aristotelischen Prinzip abhängig, daß <strong>de</strong>r Teil alles, was<br />
er ist, vom Ganzen her ist; an<strong>de</strong>rs ausgedrückt: daß das Ganze<br />
vor <strong>de</strong>m Teil ist.<br />
Nun ist allerdings dies Prinzip überaus vielgestaltig, entspre<br />
chend <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r Ganzheit <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Teile, die zu einem<br />
Ganzen gehören sollen (vgl. H. Schickling, Sinn <strong>und</strong> Grenze <strong>de</strong>s<br />
aristotelischen Satzes: „Das Ganze ist vor <strong>de</strong>m Teil", 1936). Für<br />
unsere Frage ist nur <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s „integralen" Ganzen in sei<br />
ner Anwendung auf die Gesellschaftslehre von Be<strong>de</strong>utung. Das<br />
integrale Ganze ist in <strong>de</strong>r quantitativen Ordnung beheimatet.<br />
444
Es besagt das Zusammensein aller jener quantitativen Teile, Exk.I<br />
ohne welche ein Ding in seiner Unversehrtheit (Integrität)<br />
gestört wäre, ja sogar überhaupt nicht mehr bestehen könnte.<br />
Dabei sind auch die Teile das, was sie sind, nur, weil sie im Gan<br />
zen integriert sind. So nennt Thomas mit Aristoteles <strong>de</strong>n Fuß<br />
einen integralen Teil <strong>de</strong>s Menschen, ebenso die Hand, <strong>de</strong>n Kopf<br />
usw. Der Mensch braucht einerseits diese Teile, um alle Funk<br />
tionen zu erfüllen, die ihm naturgemäß aufgetragen sind. An<strong>de</strong><br />
rerseits sind die Teile auf das Ganze angewiesen, um überhaupt<br />
das zu sein, was sie sind. Wenn ein Glied vom Leib getrennt ist,<br />
hört es auf, das zu sein, was es war. Wir müssen daher sagen,<br />
daß solche Teile nur im Ganzen begrün<strong>de</strong>t sind. Und zwar ist<br />
dabei zu beachten, daß sie ihrem ganzen Sein nach, nicht nur<br />
<strong>de</strong>m begrifflichen Inhalt <strong>de</strong>s Teils nach, ohne die Integrierung in<br />
das Ganze eben nicht das wären, was sie sind. Es han<strong>de</strong>lt sich<br />
also in dieser Überlegung nicht nur um eine logische Korrela<br />
tion, insofern wir erklären, <strong>de</strong>r Teil sei als Teil überhaupt nicht<br />
<strong>de</strong>nkbar ohne das Ganze, in welchem er Teil ist; son<strong>de</strong>rn das<br />
Sein <strong>de</strong>s Teils hört auf, das zu sein, was es war, wenn es nicht<br />
mehr Teil ist.<br />
Der menschliche Organismus dient nun Aristoteles als bester<br />
Vergleich für die staatliche Ganzheit: „Der Staat ist <strong>de</strong>r Natur<br />
nach früher als die Familie <strong>und</strong> als <strong>de</strong>r einzelne Mensch, weil das<br />
Ganze früher sein muß als <strong>de</strong>r Teil. Hebt man das ganze<br />
menschliche Kompositum auf, so kann es keinen Fuß <strong>und</strong> keine<br />
Hand mehr geben, außer nur <strong>de</strong>m Namen nach, wie man etwa<br />
auch eine steinerne Hand Hand nennt; <strong>de</strong>nn nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> ist<br />
sie nur mehr eine solche. Ein je<strong>de</strong>s Ding dankt nämlich die<br />
eigentümliche Bestimmtheit seiner Art <strong>de</strong>n beson<strong>de</strong>ren Ver<br />
richtungen <strong>und</strong> Vermögen, die es hat, <strong>und</strong> kann darum, wenn es<br />
nicht mehr die betreffen<strong>de</strong> Beschaffenheit hat, auch nicht mehr<br />
als dasselbe Ding bezeichnet wer<strong>de</strong>n, es sei <strong>de</strong>nn im Sinne blo<br />
ßer Namensgleichheit. Man sieht also, daß <strong>de</strong>r Staat sowohl von<br />
Natur besteht wie auch früher ist als <strong>de</strong>r Einzelne. Denn wenn<br />
sich <strong>de</strong>r Einzelne in seiner Isolierung nicht selber genügt, so<br />
muß er sich zum Staate ebenso verhalten wie an<strong>de</strong>re Teile zu<br />
<strong>de</strong>m Ganzen, <strong>de</strong>m sie angehören" (Pol. 1,2; 1253a 19-27).<br />
Mit <strong>de</strong>r Analogie wird Ernst gemacht, insofern <strong>de</strong>r vom<br />
Staatswesen getrennte Mensch bereits nicht mehr Mensch sein<br />
kann: „Wer aber nicht in Gemeinschaft leben kann o<strong>de</strong>r ihrer,<br />
weil er sich selbst genug ist, gar nicht bedarf, ist kein Glied <strong>de</strong>s<br />
445
Exk. I Staates <strong>und</strong> <strong>de</strong>mnach ein Tier o<strong>de</strong>r ein Gott" (a. a. O. a 27-29).<br />
Natürlich verliert <strong>de</strong>r Mensch, <strong>de</strong>r sich nicht ins staatliche<br />
Ganze einfügt, nicht sein physisches Sein. Dennoch wird er,<br />
was seine moralische Bestimmung <strong>und</strong> damit sein tiefstes<br />
Menschsein in <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r Vollkommenheit angeht, als<br />
Nicht-Mensch bezeichnet: „Hieraus erhellt also, daß <strong>de</strong>r Staat<br />
zu <strong>de</strong>n von Natur bestehen<strong>de</strong>n Dingen gehört <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Mensch<br />
von Natur ein staatliches Wesen ist, <strong>und</strong> daß jemand, <strong>de</strong>r von<br />
Natur <strong>und</strong> nicht bloß zufällig außerhalb <strong>de</strong>s Staates lebt, ent<br />
we<strong>de</strong>r schlechter ist o<strong>de</strong>r besser als ein Mensch, wie auch <strong>de</strong>r<br />
von Homer als Mann ohne Geschlecht <strong>und</strong> Gesetz <strong>und</strong> Herd<br />
gebrandmarkte" (Pol. 1,2; 1253 a 1-5). Der Mensch, <strong>de</strong>r außer<br />
halb <strong>de</strong>s staatlichen Verban<strong>de</strong>s sein Heil sucht, <strong>de</strong>r sich also<br />
nicht mit seinem Vollkommenheitsstreben im Staat integriert,<br />
kann überhaupt niemals vollkommener Mensch sein: „Denn<br />
wie <strong>de</strong>r Mensch in seiner Vollendung das vornehmste Geschöpf<br />
ist, so ist er, <strong>de</strong>s Gesetzes <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>es ledig, das schlechteste<br />
von allen" (a.a.O.a 31-33). Der Gr<strong>und</strong> ist einfach: „Die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> ist <strong>de</strong>r Inbegriff aller Moralität" (Eth.V, 3;<br />
1129 b29), die <strong>Gerechtigkeit</strong> aber ist „ein staatliches Ding" (Pol.<br />
1,2; 1253a37).<br />
Aristoteles sieht die Moralität <strong>de</strong>s Einzelnen in <strong>de</strong>r Gerechtig<br />
keit begriffen, die ihrerseits nur im staatlichen Verband beste<br />
hen kann. Bei Thomas haben wir die Übertragung dieses<br />
Gedankens (vgl. Kommentar zu 58,5 <strong>und</strong> Exkurs II) in <strong>de</strong>r<br />
Erklärung, daß die Gemeinwohlgerechtigkeit die Kommando<br />
stelle für <strong>de</strong>n ganzen Bereich <strong>de</strong>r sittlichen Tugen<strong>de</strong>n ist. Wir<br />
müssen daher zu <strong>de</strong>m Schluß kommen, daß <strong>de</strong>r Einzelmensch<br />
ohne die Integrierung in das staatliche Ganze nicht vollkom<br />
men sein kann, d. h., daß das staatliche Ganze <strong>de</strong>r Natur nach<br />
(formal) früher ist als <strong>de</strong>r einzelne Mensch.<br />
Die Vollkommenheit ist in <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r Absichten<br />
immer vor <strong>de</strong>m rudimentären o<strong>de</strong>r weniger vollkommenen<br />
Stand. Wir wollen nicht die Zwischenstufen, son<strong>de</strong>rn die End<br />
stufe als eigentlich Beabsichtigtes; alles Dazwischenliegen<strong>de</strong> ist<br />
immer nur gewollt um <strong>de</strong>r Erstabsicht, d. h. um <strong>de</strong>r Vollkom<br />
menheit willen. Einzig im tatsächlichen Vollzug unseres Wol<br />
lens, d. h. in <strong>de</strong>r Verwirklichung unserer Urabsicht, bewegen<br />
wir uns von unten nach oben. In <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r Absichten,<br />
also im eigentlich moralischen Bereich, bleibt die oberste<br />
Absicht das <strong>de</strong>r Natur nach Frühere. Diese Erstabsicht braucht<br />
446
nun gar nicht einmal von uns selbst gefaßt zu sein. Sie kann Exk.I<br />
bereits in <strong>de</strong>r Teleologie <strong>de</strong>r Natur liegen, ursprünglich also im<br />
Schöpfer, <strong>de</strong>r die Naturen geschaffen hat. Sehr gut kommt dies<br />
in folgen<strong>de</strong>m Text <strong>de</strong>s hl. Thomas zum Ausdruck: „Es gibt eine<br />
zweifache Ordnung <strong>de</strong>r Natur. Die eine entsprechend <strong>de</strong>m Weg<br />
<strong>de</strong>r Erzeugung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Zeit; diesem Weg gemäß ist das, was un<br />
vollkommen <strong>und</strong> potentiell ist, früher... Die zweite Ordnung ist<br />
die <strong>de</strong>r Vollkommenheit o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Intention <strong>de</strong>r Natur; wie die<br />
Wirklichkeit <strong>de</strong>r Natur nach schlechthin früher ist als die Mög<br />
lichkeit, <strong>und</strong> das Vollkommene früher als das Unvollkommene"<br />
(I 85,3 Zu 1; DT, Bd. 6).<br />
Wenn man also mit Aristoteles hält, daß die Moralität in <strong>de</strong>r<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> besteht o<strong>de</strong>r doch ganz von ihr beherrscht ist,<br />
dann muß man folgerichtig auch die Finalisierung <strong>de</strong>s morali<br />
schen Wer<strong>de</strong>ns auf die <strong>Gerechtigkeit</strong> erkennen. Und da eben die<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> nichts an<strong>de</strong>res als die Integrierung ins staatliche<br />
Ganze be<strong>de</strong>utet, so bleibt nichts an<strong>de</strong>res übrig als anzuerken<br />
nen, daß <strong>de</strong>r menschlichen Moralität die Ausrichtung auf das<br />
staatliche Ganze naturhaft zukommt. Die Integrierung im<br />
staatlichen Ganzen geht also in <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r Vollkommen<br />
heit <strong>de</strong>m bloßen Einzeldasein als solchem voraus. Es gilt <strong>de</strong>m<br />
nach in Wahrheit: Der Staat (als vollkommene Gesellschaft) ist<br />
<strong>de</strong>r Natur, nämlich <strong>de</strong>r naturinneren Teleologie, d. h. Zielrich<br />
tung nach früher als <strong>de</strong>r einzelne Mensch. Verbleibt man in <strong>de</strong>r<br />
intentionalen, finalen Ordnung, dann entgeht man <strong>de</strong>r Gefahr,<br />
die aristotelisch-thomistische Auffassung von <strong>de</strong>r Beziehung<br />
<strong>de</strong>s Teiles zum Ganzen mit Hegels Lehre vom objektiven Geist<br />
in eins zu setzen.<br />
Thomas war nun Theologe genug, um nicht das gesamte sitt<br />
liche Leben in <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit aufgehen zu las<br />
sen. Er spricht ausdrücklich nur von <strong>de</strong>r natürlichen sittlichen<br />
Ordnung. Nur so weit kann er die Gültigkeit <strong>de</strong>s organischen<br />
Eingeglie<strong>de</strong>rtseins <strong>de</strong>s einzelnen Menschen in die Gesellschaft<br />
anerkennen. Auch ist nicht zu vergessen, daß Thomas bereits in<br />
<strong>de</strong>r reinen Philosophie, ganz abgesehen also vom theologischen<br />
Denken, das <strong>Recht</strong> noch voll <strong>und</strong> ganz eingesenkt sieht in die<br />
absolute Ethik, so daß das sittliche I<strong>de</strong>al aller Menschen in eins<br />
zusammenfällt mit <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> für alle Menschen, ein Gedanke,<br />
<strong>de</strong>r im folgen<strong>de</strong>n Exkurs besprochen wer<strong>de</strong>n soll.<br />
447
Exk. II EXKURS II<br />
DER WANDEL IM BEGRIFF<br />
DER GEMEINWOHLGERECHTIGKEIT.<br />
SOZIALE GERECHTIGKEIT - SOZIALE LIEBE<br />
Pius XI. hat in <strong>de</strong>r Enzyklika „Quadragesimo anno" <strong>de</strong>n Be<br />
griff <strong>de</strong>r Gemeinwohl (Gesetzes-)gerechtigkeit durch <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
„sozialen <strong>Gerechtigkeit</strong>" ersetzt. Diese neue Benennung zeigt<br />
einen erheblichen Wan<strong>de</strong>l gegenüber <strong>de</strong>r thomasischen Lehre<br />
von <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit an. Der Wan<strong>de</strong>l o<strong>de</strong>r, wenn<br />
man will, <strong>de</strong>r Fortschritt liegt in <strong>de</strong>r neuen Fassung <strong>de</strong>s Begriffs<br />
<strong>de</strong>s Gemeinwohls. Der überaus vielfältig schillern<strong>de</strong> <strong>und</strong> ana<br />
loge Begriff ist bei Thomas, wenigstens, was seine Anwendung<br />
auf die Gesellschaftslehre angeht, stark vom aristotelischen<br />
Denken beeinflußt. Selbstre<strong>de</strong>nd hat <strong>de</strong>r allgemein christliche<br />
Gedanke <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>s Universums, das ebenfalls als uni<br />
versales Gut, als Gemeingut, bezeichnet wird, eine nicht unbe<br />
<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle gespielt. Die Vorstellung, daß <strong>de</strong>r ganze Mensch<br />
im beinahe unübersehbaren Raum eines Weltganzen steht, in<br />
<strong>de</strong>m er nur eine untergeordnete Rolle spielt <strong>und</strong> das selbst wie<br />
<strong>de</strong>rum einem höheren „Gemeinwohl" unterstellt ist, nämlich<br />
Gott, war wie geschaffen, um die völlige Einbeziehung <strong>de</strong>s ein<br />
zelnen Menschen in das Ganze <strong>de</strong>r Gesellschaft zu erhärten.<br />
Sosehr das Gemeinwohl <strong>de</strong>r Gesellschaft selbst wie<strong>de</strong>rum nur<br />
relativ verstan<strong>de</strong>n wird in Rückorientierung zum Universum<br />
<strong>und</strong> von dort zu Gott, so läßt eben doch dieser Drang zum<br />
Einordnen <strong>und</strong> Unterordnen in ein vielgestuftes Ordnungsgan<br />
zes <strong>de</strong>n Menschen als Person stark zurücktreten.<br />
Wenngleich die aristotelische Ganzheitslehre für Thomas ein<br />
willkommenes Vorbild war, so ist er doch durch das aristote<br />
lische <strong>Gerechtigkeit</strong>sschema in seiner eigenen Systematik<br />
gestört wor<strong>de</strong>n. Die Vorgabe eines Gemeinwohls, in <strong>de</strong>m alle<br />
Glie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n ihnen zukommen<strong>de</strong>n Platz haben, entsprach<br />
christlichem Ordnungs<strong>de</strong>nken. Daraus ergab sich für <strong>de</strong>n ein<br />
zelnen die sittliche Pflicht <strong>de</strong>r Ein-<strong>und</strong> Unterordnung. Diese<br />
Ein- <strong>und</strong> Unterordnung ist Gegenstand <strong>de</strong>r Gemeinwohlge<br />
rechtigkeit. Es wäre aber logisch gewesen, nicht nur von <strong>de</strong>r<br />
Pflicht zur Einordnung, son<strong>de</strong>rn auch vom <strong>Recht</strong> eines je<strong>de</strong>n zu<br />
sprechen, <strong>de</strong>n ihm gehören<strong>de</strong>n Platz zu erhalten. Bei<strong>de</strong>s gehört<br />
zum Gemeinwohl, sofern man es personalistisch versteht. In<br />
448
<strong>de</strong>r Sozialethik <strong>de</strong>s Aristoteles wird nun das Gemeinwohl durch Exk. II<br />
die staatliche Autorität konstituiert, während Thomas gemäß<br />
seiner Konzeption von <strong>de</strong>r menschlichen Person das Gemein<br />
wohl auch <strong>de</strong>r staatlichen Autorität vorgeordnet sieht. 1 Gemäß<br />
<strong>de</strong>r aristotelischen Gemeinwohltheorie wird nur eine Seite <strong>de</strong>r<br />
Pflicht in Betracht gezogen, die <strong>de</strong>r Gesellschaftsglie<strong>de</strong>r, nicht<br />
die <strong>de</strong>r Autoritätsträger, das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Glie<strong>de</strong>r zu respektieren.<br />
Diese zweite Seite wird <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> als eige<br />
ner, von <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit unterschie<strong>de</strong>ner<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> zugeschrieben. Die austeilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
muß aber ein Teil <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit sein, wenn man<br />
<strong>de</strong>r thomasischen Auffassung von <strong>de</strong>m je<strong>de</strong>r Autorität vor<br />
geordneten Gemeinwohl folgt. Das aristotelische Schema hat<br />
Thomas daran gehin<strong>de</strong>rt, die wenigstens teilweise I<strong>de</strong>ntität von<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit <strong>und</strong> austeilen<strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
systematisch durchzuführen.<br />
Thomas erkannte sehr wohl, daß die austeilen<strong>de</strong> Gerechtig<br />
keit nicht einfach ein einziges Individuum im Auge hat, son<strong>de</strong>rn<br />
immer die Rückbeziehung zum Ganzen mitbetrachtet. Man<br />
w<strong>und</strong>ert sich darum, daß er nicht zu <strong>de</strong>r Folgerung durchgesto<br />
ßen ist, daß dieses <strong>Recht</strong>sverhältnis vom Ganzen zu <strong>de</strong>n einzel<br />
nen nicht auch im umgekehrten Sinn gelten soll, von <strong>de</strong>n einzel<br />
nen zum Ganzen. Wir kämen damit zu einer neuen Sicht <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls, die einen ebenso neuen Inhalt <strong>de</strong>r Gemeinwohl<br />
gerechtigkeit bewirken wür<strong>de</strong>. Das aristotelische Vorbild von<br />
<strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit ließ diese Schlußfolgerung nicht<br />
zu. Man darf wohl auch sagen, daß <strong>de</strong>r stark monarchistische<br />
Staatsbegriff leicht zu dieser in gewissem Sinne An-sich-Set-<br />
zung <strong>de</strong>s aristotelisch gefaßten Gemeinwohls führte. Der<br />
Regent verkörpert dabei gleichsam das Gemeinwohl in seiner<br />
Person, während <strong>de</strong>r Untertan es nur dienstweise (administra<br />
tive) zu verwirklichen hat, wenngleich an<strong>de</strong>rerseits die Wesens<br />
übereinstimmung zwischen <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit <strong>de</strong>s<br />
Regenten <strong>und</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Untertanen anerkannt sein mochte.<br />
Der Gr<strong>und</strong> aber, warum Thomas die Gemeinwohlgerechtig<br />
keit nicht im Sinn <strong>de</strong>r austeilen<strong>de</strong>n <strong>Gerechtigkeit</strong> als ein Ord<br />
nungsprinzip <strong>de</strong>r vielen einzelnen Individuen angesehen hat,<br />
liegt tiefer. Er ist in seiner rein philosophischen <strong>und</strong> betont<br />
ethischen Schauweise <strong>de</strong>r Gesellschaft zu suchen. Thomas geht<br />
1 Vgl. A.F. Utz, Sozialethik, Teil I, 202.<br />
449
Exk. II von <strong>de</strong>r natura humana aus, die als absolute Norm je<strong>de</strong>m<br />
menschlichen Han<strong>de</strong>ln, auch <strong>de</strong>r Gesellschaft, ihr Maß ein<br />
prägt. Wenn also Thomas zu <strong>de</strong>m Individualprinzip gelangt,<br />
dann eben nur, weil vom Gemeinwohl, eben <strong>de</strong>m allgemeinen<br />
Gut <strong>de</strong>r menschlichen Natur her, dies verlangt ist, nicht aber,<br />
weil <strong>de</strong>r einzelne von vornherein als individueller, vorstaatlicher<br />
<strong>Recht</strong>sträger betrachtet wür<strong>de</strong>. Ganz klar tritt dies in <strong>de</strong>r Frage<br />
nach <strong>de</strong>m Privateigentum in Erscheinung (vgl. Kommentar zu<br />
66,1 u. 2, wo die geschichtlichen Zusammenhänge dargestellt<br />
sind).<br />
Wenngleich die aristotelische Auffassung vom Gemeinwohl<br />
auf Thomas einen starken Einfluß ausgeübt hat, so wäre es<br />
doch verfehlt, darin die einzige o<strong>de</strong>r auch nur die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Ursache für seine Gesellschaftsauffassung zu sehen. Der letzte<br />
Gr<strong>und</strong> ist vielmehr die betont christliche Sicht <strong>de</strong>s gesellschaft<br />
lichen Gefüges vom Ethischen her, wie sie Thomas bei <strong>de</strong>n Kir<br />
chenvätern in reinster Form kennen <strong>und</strong> schätzen gelernt hat.<br />
Die Spekulation <strong>de</strong>r Väter <strong>und</strong> auch <strong>de</strong>s heiligen Thomas, wie<br />
wohl eine Gesellschaft im Paradies aussehen wür<strong>de</strong>, beweist<br />
dies unwi<strong>de</strong>rleglich. Denn dort wird nur vom vernünftigen <strong>und</strong><br />
guten Menschen her gedacht, also einzig vom Ethischen her.<br />
Das I<strong>de</strong>al einer Gesellschaft kann nur das I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s Menschen<br />
überhaupt sein. Dieses I<strong>de</strong>al aber ist sittlich. Wenn die mo<strong>de</strong>rne<br />
katholische Gesellschaftslehre, wie sogleich dargestellt wer<strong>de</strong>n<br />
soll, heute <strong>de</strong>n individualrechtlichen Ausgleich zum Gr<strong>und</strong><br />
prinzip <strong>de</strong>r Gesellschaftsbildung macht, dann wird sie doch <strong>de</strong>n<br />
altchristlichen Gedanken von <strong>de</strong>r wesentlich sittlichen Gemein<br />
schaft aller Menschen nicht übersehen dürfen.<br />
In <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen, von <strong>de</strong>r neuzeitlichen Auffassung <strong>de</strong>r Men<br />
schenrechte als <strong>Recht</strong>e <strong>de</strong>r einzelnen gegenüber <strong>de</strong>m staatlichen<br />
Autoritätsträger geprägten Gesellschaftsphilosophie vollzog<br />
sich ein gr<strong>und</strong>sätzlicher Wan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r Gemeinwohlkonzeption.<br />
Der Akzent liegt nun auf <strong>de</strong>n subjektiven <strong>Recht</strong>en <strong>de</strong>s Individu<br />
ums, allerdings verb<strong>und</strong>en mit <strong>de</strong>m Verlust <strong>de</strong>r vordringlichen<br />
Betrachtung <strong>de</strong>r Ganzheit. Die mo<strong>de</strong>rne, weltanschaulich zer<br />
rissene Gesellschaft anerkennt keine gemeinschaftliche <strong>und</strong><br />
einheitliche Ethik mehr. Der erkenntnistheoretische Optimis<br />
mus, wonach alle Menschen an sich Vernunft genug haben, um<br />
absolute Normen als gemeinverbindlich zu erkennen, existiert<br />
nicht mehr. Auch gibt es keine Autorität, von <strong>de</strong>r man eine all<br />
gemeingültige Vorlage ethischer I<strong>de</strong>ale entgegennehmen<br />
450
wür<strong>de</strong>, wie dies z. B. im mittelalterlichen Europa <strong>de</strong>r Fall war. Exk.II<br />
So ist die Ethik <strong>de</strong>r Gesellschaft aufgelöst in das Wertempfin<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r vielen Individuen. Als Ordnungsgefüge bleibt dann für die<br />
mo<strong>de</strong>rne Gesellschaft nichts an<strong>de</strong>res als die rechtliche Abtren<br />
nung <strong>de</strong>r Individuen. Dabei ist das Individuelle nicht mehr eine<br />
am gemeinsamen I<strong>de</strong>al gemessene Größe, son<strong>de</strong>rn die<br />
Anfangsgröße <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Systems. Dies heißt aber,<br />
daß das ganz Kontingente, die freie Willensbildung <strong>de</strong>r vielen,<br />
die gesellschaftliche Struktur bestimmt. So ergibt sich: Der<br />
gesellschaftliche Aufbau muß von unten, von <strong>de</strong>r einzelnen<br />
menschlichen Person her vollzogen wer<strong>de</strong>n, also nicht mehr<br />
von <strong>de</strong>r persona humana aus, sofern sie ganz allgemein in <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Natur als solcher beschlossen ist.<br />
Es läßt sich von hier aus leicht begreifen, warum die mo<strong>de</strong>rne<br />
<strong>Recht</strong>sphilosophie die absoluten Normen als rechtsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Faktoren nicht mehr anerkennen will, <strong>de</strong>nn sie sind gemäß <strong>de</strong>m<br />
Individualprinzip erst dann eigentlich rechtsbil<strong>de</strong>nd, wenn sie<br />
in das faktische Denken <strong>und</strong> Wollen <strong>de</strong>r Gesellschaft eingegan<br />
gen sind.<br />
Als Ordnungsprinzip dieser aufgesplitterten Gesellschaft<br />
haben wir dann zunächst nur noch die austeilen<strong>de</strong> Gerechtig<br />
keit <strong>de</strong>s heiligen Thomas, allerdings ganz im Sinn <strong>de</strong>r subjekti<br />
ven <strong>Recht</strong>e. Um die Rückbeziehung zum alten Gemeinwohlbe<br />
griff zu bewahren, wird - so vor allem in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen katholi<br />
schen Soziallehre - von <strong>de</strong>r sozialen Belastung <strong>de</strong>s Einzelnen<br />
<strong>und</strong> Privaten gesprochen. Diese neue I<strong>de</strong>enkombination hat<br />
auch einen neuen Namen <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit not<br />
wendig gemacht: die soziale <strong>Gerechtigkeit</strong>, erstmals genannt<br />
bei L. Taparelli. Diese soziale <strong>Gerechtigkeit</strong> soll die Funktionen<br />
<strong>de</strong>r alten austeilen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit erfül<br />
len.<br />
Das Gemeinwohl wird so lediglich zu einem Ordnungsprin<br />
zip von vielen zusammenleben<strong>de</strong>n Individuen mit kontingen-<br />
tem Wollen, während es bei Thomas ein absolutes Soll darstellt,<br />
das sich an alle richtet zur gemeinsamen Verwirklichung eines<br />
gemeinsamen I<strong>de</strong>als, einer gemeinsamen Kulturaufgabe.<br />
Bei dieser neuen Sicht <strong>de</strong>s Gemeinwohls <strong>und</strong> <strong>de</strong>s gesell<br />
schaftlichen Aufbaus darf aber die Orientierung am Absoluten<br />
nicht verlorengehen. Das soziale Gut, welches durch die soziale<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> verwirklicht wer<strong>de</strong>n soll, ist, wie schon gesagt,<br />
wesentlich ein ethisches Gut <strong>de</strong>r menschlichen Gemeinschaft.<br />
451
Exk. II Es wird darum niemals vollgültig verwirklicht durch eine rein<br />
individual betonte <strong>Recht</strong>sgemeinschaft. Es bleiben also, wenn<br />
man die Gesellschaft im Individualprinzip begrün<strong>de</strong>t, immer<br />
Lücken. Der Ausgleich <strong>de</strong>r so entstehen<strong>de</strong>n Lücken in <strong>de</strong>r Ver<br />
wirklichung <strong>de</strong>s Gemeinwohls, das trotz allem als Naturauftrag<br />
weiterbesteht, wird von einer an<strong>de</strong>ren sittlichen Kraft geleistet,<br />
<strong>de</strong>r sogenannten sozialen Liebe. Die soziale Liebe rettet also<br />
jenen ethischen Teil in <strong>de</strong>r Gemeinschaft, <strong>de</strong>r eigentlich Aufgabe<br />
<strong>de</strong>r sozialen <strong>Gerechtigkeit</strong> sein müßte, wenn wir jene Gemein<br />
schaft hätten, welche <strong>de</strong>n alten ethischen Begriff <strong>de</strong>s Gemein<br />
wohls noch als Gr<strong>und</strong>norm <strong>de</strong>s Zusammenlebens erfüllt. 2<br />
Die mo<strong>de</strong>rne Sicht <strong>de</strong>s Gemeinwohls als <strong>de</strong>r Koordinierung<br />
<strong>de</strong>r vielen in Gemeinschaft leben<strong>de</strong>n Einzelmenschen trägt also<br />
die Spuren <strong>de</strong>r Kontrakttheorie an sich, insofern <strong>de</strong>r Blick auf<br />
die faktische Willensbildung <strong>de</strong>r Glie<strong>de</strong>r fällt <strong>und</strong> von da auch<br />
ausgeht.<br />
Ein Beispiel <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Auffassung vom Gemeinwohl<br />
gibt das alltägliche Thema <strong>de</strong>r Steuerhinterziehung. Um <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls willen — so <strong>de</strong>nken wir heute — ist <strong>de</strong>r einzelne<br />
verpflichtet, auch in Form von Steuern seinen Beitrag an das<br />
Gemeinwesen zu leisten. Diese Verpflichtung aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit schwin<strong>de</strong>t aber in <strong>de</strong>m Maße, als die<br />
an<strong>de</strong>ren Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Staates ihren Teil nicht erfüllen. Man<br />
kann daher <strong>de</strong>n ehrlichen Staatsbürger nicht mehr aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit für verpflichtet halten, <strong>de</strong>n ganzen<br />
ihm aufgetragenen Anteil zu leisten. Soll dieser aber <strong>de</strong>swegen<br />
sorglos <strong>de</strong>r Gefährdung <strong>de</strong>s Gemeinwesens zusehen dürfen? Es<br />
bleibt ihm trotz allem als natürliche sittliche Aufgabe, die ihn im<br />
Gewissen bin<strong>de</strong>t, zu retten, was zu retten ist, um <strong>de</strong>r Menschen<br />
willen, mit <strong>de</strong>nen er verb<strong>und</strong>en ist. Er entspricht dieser sittli<br />
chen Verantwortung durch <strong>de</strong>n Einsatz aus sozialer Liebe. Tho<br />
mas hätte diese soziale Liebe noch als Gemeinwohlgerechtig<br />
keit bezeichnet aufgr<strong>und</strong> seiner ganz an<strong>de</strong>rs gearteten, auf<br />
höherer Ebene liegen<strong>de</strong>n Sicht <strong>de</strong>s Gemeinwohls <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit. Wir aber können dieser sittlichen Tat<br />
diese Bezeichnung nicht mehr geben.<br />
Aus <strong>de</strong>m Gesagten mag auch hervorgehen, daß es n<strong>utz</strong>los<br />
ist, von unserem heutigen Gesellschaftsbegriff aus zu diskutie-<br />
2 Vgl. A.F. Utz, Sozialethik, Teil I, 230-233.<br />
452
en, ob Thomas mehr die Person o<strong>de</strong>r mehr die Gemeinschaft Exk. II<br />
betont habe. Selbstre<strong>de</strong>nd war Thomas in seiner Gesellschafts<br />
ethik Personalist, aber in ganz an<strong>de</strong>rem Sinn, d. h. auf an<strong>de</strong>rer<br />
Ebene, als wir heute vom Personalismus als <strong>de</strong>m Gr<strong>und</strong>prinzip<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft sprechen. Die Quelle <strong>de</strong>r Verantwortung <strong>de</strong>s<br />
einzelnen gegenüber <strong>de</strong>r Gemeinschaft ist bei Thomas ebenfalls<br />
die persona humana. Und die Gemeinschaft besagt bei ihm<br />
nichts an<strong>de</strong>res als die Schaffung von wahren menschlichen<br />
Gütern zum Besten <strong>de</strong>r Personen, die in <strong>de</strong>r Gemeinschaft<br />
vereint sind. Aber es han<strong>de</strong>lt sich dabei um die persona humana<br />
im Raum <strong>de</strong>r abstrakt gedachten menschlichen Natur, noch ab<br />
gehoben von <strong>de</strong>r konkreten Situation, in welcher wir die<br />
menschliche Person in ihrer natürlichen Verhaltensweise vor<br />
fin<strong>de</strong>n.<br />
Pius XI. hat nun im Hinblick auf die sittliche Notwendigkeit,<br />
in solcher Verfassung <strong>und</strong> nicht in <strong>de</strong>r reinen Abstraktion die<br />
Gesellschaft aufbauen zu müssen, die Subsidiarität zum<br />
Gestaltprinzip <strong>de</strong>r menschlichen Gemeinschaft erklärt. Das<br />
Gr<strong>und</strong>gesetz besagt unter an<strong>de</strong>rem, daß <strong>de</strong>r Einzelmensch un<br />
abhängig von gesetzlicher Regelung so lange Herr seiner<br />
gesellschaftlichen Betätigung bleibt, als er selbstmächtig seinen<br />
Beitrag für das Gemeinwohl leisten kann. Dasselbe gilt in ent<br />
sprechen<strong>de</strong>r Weise für die kleineren Gemeinschaften . Das Phi<br />
losophieren über die Gesellschaft beginnt also hier bei <strong>de</strong>n<br />
Menschenrechten <strong>de</strong>s einzelnen, <strong>de</strong>s Individuums. Auf Gr<strong>und</strong><br />
dieser Menschenrechte wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Individuum bestimmte<br />
vorstaatliche <strong>Recht</strong>e zugesprochen, die es in <strong>de</strong>r Folge durch<br />
seine persönliche Tat verwirklichen kann, um so zu „erworbe<br />
nen" Freiheitsrechten <strong>und</strong> Naturrechten zu gelangen. So gilt<br />
z.B. bezüglich <strong>de</strong>r Eigentumsfrage nicht nur, daß <strong>de</strong>r Mensch<br />
an sich <strong>Recht</strong> auf Privateigentum habe, son<strong>de</strong>rn auch, daß dies<br />
o<strong>de</strong>r jenes durch persönliche Arbeit erworbene Eigentum<br />
naturrechtlicher Privatbesitz ist. Hierbei liegt das Schwerge<br />
wicht auf <strong>de</strong>m Individualen <strong>und</strong> Privaten.<br />
Die Hinwendung zu <strong>de</strong>n subjektiven <strong>Recht</strong>en als <strong>de</strong>m Gr<strong>und</strong><br />
anliegen <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Ordnung ist beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>utlich<br />
sichtbar in <strong>de</strong>r Enzyklika „Pacem in terris" Johannes'XXIII.<br />
3 Vgl. K.Thieme, För<strong>de</strong>ralismus <strong>und</strong> Subsidaritätsprinzip. in: Politeia 1 (1948/<br />
49) 11 ff.<br />
453
Exk. II Zur Aufhellung <strong>de</strong>s Gesagten sei folgen<strong>de</strong>s Beispiel ange<br />
führt. Auf die Schwierigkeit, ob ein Verbrecher vor Gericht auf<br />
gerechte Befragung hin verpflichtet sei, seine an sich verborgene<br />
schwere Schuld einzugestehen, antwortet Thomas affirmativ.<br />
Dagegen fin<strong>de</strong>t Alphonsv. Liguori mit an<strong>de</strong>ren Scholastikern<br />
die negative Antwort auch vertretbar. Warum? Thomas richtet<br />
<strong>de</strong>n Blick auf das I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s bonum commune, von woher ein<br />
je<strong>de</strong>r Mensch auf Gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit zum<br />
letzten Einsatz seiner sittlichen Kraft verpflichtet ist, während<br />
Alphonsv. Liguori nicht die vertikale Sicht zum Absoluten, son<br />
<strong>de</strong>rn die horizontale zu <strong>de</strong>n Mitmenschen wählt <strong>und</strong> erklärt,<br />
daß <strong>de</strong>r Richter kein <strong>Recht</strong> habe, eine im Gewissen verborgene<br />
schwere Schuld auszufragen, die die größte Strafe, nämlich <strong>de</strong>n<br />
Tod <strong>de</strong>s Straffälligen, nach sich zöge.<br />
Im Bestreben nach Rückorientierung an <strong>de</strong>m alten ethischen<br />
Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls <strong>de</strong>r Gesellschaft <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Staates<br />
befürwortet die katholische Soziallehre die soziale Liebe.<br />
Dieser Begriff war eine absolute Notwendigkeit, nach<strong>de</strong>m man<br />
<strong>de</strong>n Schritt in die mehr „individualistische" Gesellschaftsauffas<br />
sung gemacht hatte. Pius XL. hat diesen Begriff in seiner Enzy<br />
klika „Quadragesimo anno" neben <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r sozialen Gerechtig<br />
keit gestellt. Und zwar spricht er von <strong>de</strong>r „Caritas" socialis.<br />
Was ist nun diese soziale Liebe? Verbleiben wir im Bereich<br />
<strong>de</strong>s natürlichen sittlichen Lebens, dann be<strong>de</strong>utet sie eine sitt<br />
liche Tugend, die darauf ausgeht, die i<strong>de</strong>ale gesellschaftliche<br />
Ordnung zu verwirklichen, die das Gemeinwohl dort anstrebt,<br />
wo alle Koordination <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Ansprüche <strong>und</strong> Lei<br />
stungen unzureichend bleibt. Sie übernimmt also die Spitzen<br />
leistungen, welche Thomas <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit<br />
zuteilte. Aus dieser engen Verbindung zwischen Gemeinwohl<br />
gerechtigkeit <strong>und</strong> sozialer Liebe mag man es erklären, daß bei<br />
/. Messner (Naturrecht, 1950, 233 ff.) die Aufgabenbereiche <strong>de</strong>r<br />
bei<strong>de</strong>n Tugen<strong>de</strong>n sich überkreuzen (vgl. unsere Besprechung in<br />
Divus Thomas 29 (1951) 507f.).<br />
Gibt es aber eine soziale Liebe auch als übernatürliche<br />
Tugend? Wenn man von <strong>de</strong>r Tugendlehre <strong>de</strong>s hl. Thomas aus<br />
weiter<strong>de</strong>nkt, ist es unmöglich, die übernatürliche Tugend <strong>de</strong>r<br />
sozialen Liebe als übernatürliche sittliche Tugend zu bezeich<br />
nen, die selbst zum Rang einer „theologischen "Tugend „empor<br />
steigt" (so O. v. Nell-Breuning im 3. Heft <strong>de</strong>r „Beiträge zu einem<br />
Wörterbuch <strong>de</strong>r Politik", Freiburg 1949, Sp.36).<br />
454
Die theologischen, „göttlichen" Tugen<strong>de</strong>n, Glaube, Hoff- Exk. II<br />
nung <strong>und</strong> Liebe (Caritas), sind dadurch gekennzeichnet, daß ihr<br />
Objekt (objectum formale quod) <strong>und</strong> vor allem dasjenige,<br />
wodurch sie das Objekt erfassen (objectum formale quo), Gott<br />
selber ist. Im Glauben erkennen wir Gott durch seine eigene<br />
Offenbarung. Die Offenbarung ist im Objekt selbst enthalten.<br />
Um zu einer solchen göttlichen Erkenntnis fähig zu sein, erhal<br />
ten wir die gna<strong>de</strong>nhafte (eingegossene) Tugend <strong>de</strong>s Glaubens.<br />
Der Glaube ist aufgr<strong>und</strong> dieser doppelten Eigenschaft seines<br />
Objekts eine göttliche <strong>und</strong> theologische Tugend. Analoges gilt<br />
von <strong>de</strong>r göttlichen Hoffnung, die je<strong>de</strong> Art menschlicher Hoff<br />
nung übertrifft. Ihr Objekt ist ebenfalls Gott, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong><br />
ihrer absoluten Gewißheit ist die Zusicherung Gottes. In <strong>de</strong>r<br />
göttlichen Liebe lieben wir Gott mit <strong>de</strong>rselben Liebe, mit <strong>de</strong>r<br />
Gott sich <strong>und</strong> uns liebt. Die <strong>Gerechtigkeit</strong> nun, auch die soziale,<br />
hat zum Objekt die zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie<br />
kann also nicht theologische Tugend sein <strong>und</strong> auch nie zu dieser<br />
Wür<strong>de</strong> „aufsteigen". Die soziale Liebe, streng verstan<strong>de</strong>n als<br />
soziale, will die Lücken ausfüllen, die durch die mangelhafte<br />
Verwirklichung <strong>de</strong>r sozialen <strong>Gerechtigkeit</strong> entstehen. Sollte<br />
dies aus Liebe zu Gott, also mit göttlicher Liebe geschehen,<br />
dann kann man eigentlich nicht von sozialer Liebe sprechen,<br />
<strong>de</strong>nn ein solcher Akt ist i<strong>de</strong>ntisch mit <strong>de</strong>r göttlichen Liebe. Im<br />
Hinblick darauf, daß dieser Akt einen bestimmten Ausschnitt<br />
<strong>de</strong>s umfangreichen Tätigkeitsfel<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r göttlichen Liebe be<br />
trifft, kann man diesen Akt als soziale Liebe bezeichnen, bes<br />
ser <strong>und</strong> konkreter mit Pius XI. als Caritas socialis, jedoch nicht<br />
als Tugend, son<strong>de</strong>rn nur als Akt bzw. eine Gruppe von Akten.<br />
Denn die Caritas als Tugend ist nur eine. Sie betätigt sich in viel<br />
fältiger Weise, auch auf sozialem Gebiet. Eine eingegossene<br />
(übernatürliche) sittliche Tugend gibt es nicht. Streng genom<br />
men gibt es auch keine natürlich-sittliche Tugend <strong>de</strong>r sozialen<br />
Liebe (amor socialis), <strong>de</strong>nn die Funktion <strong>de</strong>r sozialen Liebe im<br />
ethischen Sinn wird, wie gesagt, von <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtig<br />
keit ausgeführt. Man kann höchstens die i<strong>de</strong>alen Spitzenlei<br />
stungen <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit mit <strong>de</strong>m ehrenvollen<br />
Namen „soziale Liebe" versehen, muß aber wissen, daß es sich<br />
um Akte <strong>de</strong>r Tugend <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit han<strong>de</strong>lt. In<br />
diesem Sinn ist <strong>de</strong>r oft zu hören<strong>de</strong> Ausspruch zu verstehen:<br />
„Die soziale <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> die soziale Liebe sind die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Lebens".<br />
455
Exk.III EXKURS III<br />
DER GEMEINWOHLBEGRIFF DES HL. THOMAS<br />
UND DIE KATHOLISCHE SOZIALLEHRE<br />
1. DIE FRAGE NACH DER SYSTEMATIK DER SOZIALETHIK BEI<br />
THOMAS VON AQUIN UND IN DER KATHOLISCHEN SOZIALLEHRE<br />
Von Systematik in einer Wissenschaft kann man nur spre<br />
chen, wenn das Prinzip, von <strong>de</strong>m ausgegangen wird, in sichtba<br />
rer Logik durchgehalten wird bis zu <strong>de</strong>n letzten verzweigten<br />
Schlußfolgerungen. Eine materiale Ethik hat mit <strong>de</strong>m obersten,<br />
allgemeinsten Wert, <strong>de</strong>r Objekt <strong>de</strong>r menschlichen Handlung<br />
sein kann, zu beginnen <strong>und</strong> ihn bis in die letzte konkrete Anwen<br />
dung zu verfolgen. Für die Gesellschaftsethik ist dieses oberste<br />
Objekt das Gemeinwohl. Dieses Objekt muß stets sichtbar blei<br />
ben, selbst für <strong>de</strong>n Fall, daß die konkrete Situation mehr am Pri<br />
vatwohl als am Gemeinwohl orientiert wer<strong>de</strong>n sollte. Auch<br />
dann muß <strong>de</strong>utlich wer<strong>de</strong>n, daß <strong>de</strong>r Individualismus als Orga<br />
nisationsweise nur im Sinn <strong>de</strong>s Gemeinwohls Berechtigung hat.<br />
Auf juristischem Gebiet ist H.Kelsens <strong>Recht</strong>sphilosophie,<br />
obwohl positivistisch orientiert, von bezaubern<strong>de</strong>r Systematik.<br />
Auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Sozialethik darf /. Smith' Individualismus<br />
als systematisch bezeichnet wer<strong>de</strong>n. Wie immer seine Schluß<br />
folgerungen von einem an<strong>de</strong>ren Standpunkt aus bewertet wer<br />
<strong>de</strong>n mögen, sie sind von seinem Ausgangspunkt her folgerich-<br />
Hat nun Thomas von Aquin <strong>und</strong> hat die katholische Sozial<br />
lehre eine ähnlich <strong>de</strong>utliche Systematik aufzuweisen?<br />
Bei Thomas von Aquin ist führen<strong>de</strong>s Kriterium in allen Ein<br />
zelfragen das Gemeinwohl. Ob das, was Thomas material als<br />
Gemeinwohl bezeichnet, im einzelnen unserer mo<strong>de</strong>rnen<br />
Bewertung entspricht, hat mit <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>r Systematik<br />
nichts zu tun. Wenn Thomas z. B. um <strong>de</strong>s Gemeinwohls willen<br />
die Monarchie als Staatsform befürwortet, dann könnte man<br />
cher, wie es <strong>de</strong> facto geschieht, aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r geschichtlichen<br />
Erfahrungen erwi<strong>de</strong>rn, die schlechteste Demokratie sei besser<br />
als die beste Monarchie. Die systematische Einordnung <strong>de</strong>s Pri<br />
vateigentums unter das Gemeinwohl ist Thomas in erstaunli<br />
cher Weise gelungen, erstaunlich im Hinblick auf die verworre<br />
ne Diskussion <strong>de</strong>r vorhergegangenen Jahrh<strong>und</strong>erte. Beim Auf<br />
bau <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Arten von <strong>Gerechtigkeit</strong> im Blick <strong>de</strong>s<br />
456
Gemeinwohls ist Thomas allerdings die Systematik wegen <strong>de</strong>r Exk. III<br />
Autorität <strong>de</strong>s Aristoteles nicht gelungen, wie in Exkurs II darge<br />
stellt wur<strong>de</strong>.<br />
Die katholische Soziallehre, 1 soweit man darunter nur die<br />
Äußerungen <strong>de</strong>r Päpste versteht, hat ohne Zweifel ebenfalls das<br />
Gemeinwohl zum Ausgangspunkt. Dessen Definition ist aber<br />
nicht so sichtbar, ihre Formulierung nicht einheitlich. Das rührt<br />
daher, daß das kirchliche Lehramt stets zu <strong>de</strong>n konkreten sozia<br />
len Fragen spricht <strong>und</strong> keine Veranlassung hat, <strong>de</strong>n systemati<br />
schen Zusammenhang darzustellen. Es ist Aufgabe <strong>de</strong>r Kom<br />
mentatoren, diesen für die sozialethische Systematik f<strong>und</strong>a<br />
mentalen Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls in <strong>de</strong>n päpstlichen Verlaut<br />
barungen zu analysieren <strong>und</strong> mit <strong>de</strong>r Tradition, die bei Thomas<br />
ihre systematische Zusammenfassung erhalten hat, zu verglei<br />
chen.<br />
2. DER KONSENS IN DEN GRUNDTHESEN DER KATHOLISCHEN<br />
SOZIALLEHRE<br />
Die katholische Soziallehre enthält einen Katalog von Wer<br />
ten, die im gesellschaftlichen Leben zu berücksichtigen sind. Es<br />
sind die Werte, die sich aus <strong>de</strong>r christlichen Anthropologie erge<br />
ben: die eigene Wür<strong>de</strong> je<strong>de</strong>r menschlichen Person, <strong>de</strong>ren gött<br />
liche Berufung zum ewigen Leben, ihre Freiheit in <strong>de</strong>r Gewis<br />
sensentscheidung, in <strong>de</strong>r Berufswahl, in <strong>de</strong>r Gründung von per<br />
sönlichen Gemeinschschaften wie Ehe <strong>und</strong> Familie, ebenso<br />
auch von Vereinen usw. Erste gesellschaftliche Einheit ist die<br />
Ehe <strong>und</strong> in <strong>de</strong>ren Erweiterung die Familie. In Respektierung <strong>de</strong>r<br />
freien persönlichen Entfaltung soll je<strong>de</strong> gesellschaftliche Auto<br />
rität sich mit Eingriffen zurückhalten, wann immer das Indivi<br />
duum die ihm im sozialen Rahmen zukommen<strong>de</strong>n Verpflich<br />
tungen selbst zu erfüllen vermag. Das gleiche gilt auch bezüg<br />
lich <strong>de</strong>r kleineren, in freier Bestimmung gegrün<strong>de</strong>ten Gemein<br />
schaften (Subsidiaritätsprinzip). Ehe, Familie <strong>und</strong> Staat sind<br />
natürliche Gemeinschaften. Sie for<strong>de</strong>rn ihrer Natur nach eine<br />
Siehe meine Einleitung in: Die katholische Sozialdoktrin in ihrer geschichtlichen<br />
Entfaltung. Eine Sammlung päpstlicher Dokumente vom 1 S.Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
bis in die Gegenwart (Originaltexte mit Übersetzung), hrsg. von Arthur<br />
Utz <strong>und</strong> Brigitta Gräfin von Galen, 4 B<strong>de</strong>, 1976, XIII-XXXII. In <strong>de</strong>r Folge<br />
zitiert: Utz-vonGalen. In diesem Werk befin<strong>de</strong>n sich die Verlautbarungen<br />
Pius'XIInicht mehr, da bereits im dreibändigen Werk Utz-Groner enthalten<br />
(vgl. Fußn.2).<br />
457
Exk. III Autorität. Alle Gesellschaften o<strong>de</strong>r Gemeinschaften haben ihr<br />
eigenes Gemeinwohl zu verwirklichen. Die Individualrechte gel<br />
ten darum immer nur im Rahmen <strong>de</strong>s jeweiligen Gemeinwohls.<br />
Die letzte Entscheidungsgewalt im Sinn <strong>de</strong>s umfassendsten<br />
Gemeinwohls liegt bei <strong>de</strong>r staatlichen Autorität, selbstre<strong>de</strong>nd<br />
unter Wahrung <strong>de</strong>r natürlichen Strukturen (Ehe, Familie) <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>s Subsidiaritätsprinzips. Durchgängig wird in <strong>de</strong>n Sozialen<br />
zykliken seit Rerum novarum das Privateigentum als <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r<br />
Person angesehen. Nach<strong>de</strong>m Leo XIII. (Rerum novarum, 8 <strong>und</strong><br />
12) das Privateigentum als eine Institution <strong>de</strong>s Naturgesetzes<br />
<strong>und</strong> Pius XL (Quadragesimo anno, 35) es als „heiliges" <strong>Recht</strong><br />
bezeichnet hatte, stellte es Pius XII. in seiner Ansprache an das<br />
Diplomatische Korps vom 2. März 1956 auf die gleiche Ebene<br />
wie die Familie in seiner Aufzählung <strong>de</strong>r Lebensgr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>s<br />
Menschen: „Familie, Eigentum, Beruf, Gemeinschaft, Staat". 2<br />
Diese gleichrangige Bewertung von Familie <strong>und</strong> Eigentum als<br />
naturrechtliche Institutionen hat <strong>de</strong>r unmittelbare Mitarbeiter<br />
Pius'XII. <strong>und</strong> Bearbeiter <strong>de</strong>r Ansprache Gustaf G<strong>und</strong>lach SJ'm<br />
seinem Beitrag zum Artikel „Gesellschaft" im Staatslexikon <strong>de</strong>r<br />
Görresgesellschaft 3 „bestätigend" wie<strong>de</strong>rholt. Familie <strong>und</strong><br />
Eigentum wer<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Staat als „naturrechtliche Einrich<br />
tungen" bezeichnet. Diese Zusammenstellung ist nur möglich,<br />
wenn man das <strong>Recht</strong> auf Privateigentum von <strong>de</strong>r Person her be<br />
grün<strong>de</strong>t. In diesem Sinn hat auch Johannes Paul II. (Laborem<br />
exercens, 15) das <strong>Recht</strong> auf Privateigentum begrün<strong>de</strong>t. Er<br />
nimmt hierfür die Autorität <strong>de</strong>s Thomas von Aquin in<br />
Anspruch. Wie weit diese Interpretation stimmt, soll für <strong>de</strong>n<br />
Augenblick nicht diskutiert wer<strong>de</strong>n 4 . Auf was es hier bei <strong>de</strong>r all<br />
gemeinen Charakterisierung <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre<br />
ankommt, ist die zentrale <strong>und</strong> f<strong>und</strong>amentale Stellung <strong>de</strong>r Per<br />
son in allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen <strong>und</strong> politischen<br />
Fragen. Hierüber besteht allgemeiner Konsens bei allen Inter<br />
preten <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre.<br />
Entgegen je<strong>de</strong>r Form von Individualismus <strong>und</strong> Liberalismus<br />
hält die katholische Soziallehre an <strong>de</strong>m von jeher tradierten Be-<br />
2 Vgl. A. F. Utz u.J.F. Groner, Aufbau <strong>und</strong> Entfaltung <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Lebens,<br />
Soziale Summe Pius'XII., 3 B<strong>de</strong>., Freiburg/Schweiz 1954/1961 (in <strong>de</strong>r<br />
Folge zitiert: Utz — Groner), Nr. 6385.<br />
3 6. Aufl., Bd. 3, 1959, 821.<br />
4 Vgl. hierzu meinen Kommentar zu „Laborem exercens" in „Ethische <strong>und</strong> so<br />
458<br />
ziale Existenz", Walberberg 1983, 359.
griff <strong>de</strong>s Gemeinwohls fest. Das heißt, die menschliche Person Exk. III<br />
hat sich als soziales Wesen zu verstehen <strong>und</strong> <strong>de</strong>mentsprechend<br />
mit an<strong>de</strong>ren zu kooperieren, damit alle sich entsprechend ihrer<br />
Natur entfalten können. In <strong>de</strong>r Eigentumsfrage z.B. erklärt das<br />
kirchliche Lehramt mit <strong>de</strong>r gesamten Tradition, daß die Güter,<br />
wenngleich sie in Privatbesitz aufgeteilt sein mögen, nicht auf<br />
hören, <strong>de</strong>m N<strong>utz</strong>en aller zu dienen. Seit Leo XIII. sprechen<br />
daher die Sozialenzykliken von <strong>de</strong>r „sozialen Belastung" <strong>de</strong>s<br />
privaten Eigentums. In einzelnen Enzykliken ist dieser Ge<br />
sichtspunkt so stark unterstrichen wor<strong>de</strong>n, daß es manchen<br />
Vertretern <strong>de</strong>s Unternehmertums übertrieben vorkam. In <strong>de</strong>r<br />
Tat haben die Enzykliken mehr auf die Verteilung als auf die<br />
Produktion geachtet. Mit Bezug auf die Enzyklika „Populorum<br />
progressio" (1967) erklärt z.B. A.Rauscher in seinem Artikel<br />
„Katholische Soziallehre <strong>und</strong> liberale Wirtschaftsauffassung":<br />
„Es wäre hilfreich gewesen, wenn die Enzyklika nicht nur das<br />
Verdikt über <strong>de</strong>n Paläo-Liberalismus wie<strong>de</strong>rholt hätte, son<strong>de</strong>rn<br />
wenn sie etwas über die Voraussetzungen <strong>und</strong> Bedingungen<br />
einer verbesserten Produktion gesagt hätte, also über qualifi<br />
zierte Arbeit, Kapitalbildung, ges<strong>und</strong>en Wettbewerb <strong>und</strong> seinen<br />
Einfluß auf eine gerechtere Preisbildung." 5 An<strong>de</strong>rerseits kann<br />
sich eine an die gesamte Welt gerichtete Enzyklika nicht für ein<br />
bestimmtes Wirtschaftssystem, etwa die Marktwirtschaft, aus<br />
sprechen, da die wirtschaftlichen, sozialen <strong>und</strong> kulturellen<br />
Bedingungen in <strong>de</strong>n einzelnen Völkern sehr verschie<strong>de</strong>n sind.<br />
Die Enzykliken wollten einen überall gelten<strong>de</strong>n Parameter<br />
angeben, gemäß <strong>de</strong>m man die soziale Qualität eines Wirt<br />
schaftssystems o<strong>de</strong>r einer Wirtschaftsordnung in ihrem En<strong>de</strong>r<br />
gebnis beurteilen kann. Und das ist nun einmal die soziale<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>. Unzwei<strong>de</strong>utig kommt dieses Anliegen in „Labo<br />
ren! exercens" zu Wort. Dort wird als Bemessungsgr<strong>und</strong>lage<br />
einer Wirtschaftsordnung die Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Arbeit angegeben.<br />
Man kann allgemein für alle Enzykliken sagen, daß es immer<br />
<strong>und</strong> überall auf die personale Wohlfahrt ankommt, an <strong>de</strong>ren<br />
Verwirklichung eine gesellschaftliche <strong>und</strong> wirtschaftliche Ord<br />
nung gemessen wer<strong>de</strong>n soll.<br />
Unverkennbar spielt bei aller Betonung <strong>de</strong>r Person das<br />
Gemeinwohl als übergeordnete Norm eine entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
In: A. Rauscher (Hrsg.), Selbstinteresse <strong>und</strong> Gemeinwohl, Beiträge zur Ordnung<br />
<strong>de</strong>r Wirtschaftsgesellschaft, Berlin 1985, 304.<br />
459
Exk.III Rolle. Die Absage an <strong>de</strong>n individualistischen Liberalismus ist<br />
ein<strong>de</strong>utig. Das Gemeinwohl kann nicht die Summe aller Indivi-<br />
dualwohle sein. An<strong>de</strong>rerseits ist gemäß <strong>de</strong>r kontinuierlichen<br />
kirchlichen Tradition <strong>und</strong> auch gemäß <strong>de</strong>r Interpretation dieser<br />
Tradition durch die Theologen das Gemeinwohl personal zu<br />
verstehen, ohne daß es damit seine Qualität als übergeordnete<br />
Norm aller Individuen verlöre. Hier ergibt sich für <strong>de</strong>n Inter<br />
preten <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre die gr<strong>und</strong>sätzliche,<br />
erkenntnistheoretische Frage: Wie kann <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s Wohl<br />
ergehens personal <strong>und</strong> zugleich <strong>de</strong>rart universal sein, daß er die<br />
Personen nur als proportional zueinan<strong>de</strong>r bezogene Teile be<br />
greift <strong>und</strong> in dieser Weise <strong>de</strong>n Personen als übergeordnete<br />
Norm zu gelten hat, somit nicht einfach die Summe <strong>de</strong>r indivi-<br />
dualen Wohle ist? Die Stellungnahme zu dieser Frage ist <strong>de</strong>r<br />
Kern <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen philosophisch-theologischen Begrün<br />
dungen <strong>de</strong>r kirchlichen Soziallehre durch die Interpreten. Um<br />
ein soli<strong>de</strong>s F<strong>und</strong>ament für diese Auseinan<strong>de</strong>rsetzung zu haben,<br />
wer<strong>de</strong>n wir die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Texte <strong>de</strong>r päpstlichen Verlautba<br />
rungen analysieren müssen.<br />
Die Stellungnahme <strong>de</strong>r kirchlichen Obrigkeit zu sozialen<br />
Fragen (Armut, Sklavenhan<strong>de</strong>l, Freiheit <strong>de</strong>r Kirche usw.) ist so<br />
alt wie die Kirche selbst. Die eigentliche Inanspruchnahme <strong>de</strong>s<br />
Begriffs <strong>de</strong>s Gemeinwohls beginnt aber erst dort, wo die Kirche<br />
zu Ordnungsfragen in Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft Stellung<br />
bezieht. Und das geschah erstmals unter Leo XIII. Im Gr<strong>und</strong>e<br />
entfaltet die Kirche damit keine neue Doktrin. Es ist <strong>de</strong>r gleiche<br />
Ansatz, von <strong>de</strong>m aus die kirchliche Obrigkeit stets die einzel<br />
nen sozialen Fragen anfaßte, nämlich das durch alle Jahrhun<br />
<strong>de</strong>rte festgehaltene Naturrecht. Darum konnte Pius XII. in sei<br />
ner Ansprache an die Teilnehmer <strong>de</strong>s Internationalen Kongres<br />
ses für humanistische Studien am 25. September 1949 erklären,<br />
das Naturgesetz sei das F<strong>und</strong>ament <strong>de</strong>r Soziallehre <strong>de</strong>r<br />
Kirche. 6<br />
6 Vgl. Utz - Groner 359.<br />
460
3. ANALYSE DES GEMEINWOHLBEGRIFFS DER PÄPSTLICHEN<br />
VERLAUTBARUNGEN<br />
Unterscheidung von Wert- <strong>und</strong> Handlungsordnung<br />
Im folgen<strong>de</strong>n soll <strong>de</strong>r Gemeinwohlbegriff <strong>de</strong>r päpstlichen<br />
Verlautbarungen <strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n. Hierzu eine kurze Vor<br />
bemerkung.<br />
Gemeinwohl ist gemäß <strong>de</strong>r katholischen Moral, für welche<br />
die Glückseligkeit ein echtes Objekt <strong>de</strong>r moralischen Entschei<br />
dung ist, ebenfalls ein ethischer Begriff. Die moralischen For<strong>de</strong><br />
rungen haben ihren eigenen, absoluten Wert. Sie sind darum<br />
nicht modulierbar gemäß <strong>de</strong>m Ermessen <strong>de</strong>s Menschen. Der<br />
Mensch hat aber die Pflicht, zu überlegen, auf welche Weise er<br />
<strong>de</strong>n absoluten Wert am besten verwirklichen kann. Dieser<br />
Modus <strong>de</strong>r Verwirklichung ist im Vergleich zu individualmorali-<br />
schen Entscheidungen von größerer Be<strong>de</strong>utung hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
sozialen Werte. Der aus <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s Menschen gewonnene<br />
Gemeinwohlwert ist unabän<strong>de</strong>rlich. Der Modus <strong>de</strong>r Verwirkli<br />
chung dagegen kann variieren. Bezüglich <strong>de</strong>r Güterverteilung<br />
gilt als oberste soziale Norm das N<strong>utz</strong>ungsrecht aller. In <strong>de</strong>r<br />
Verwirklichung dieses Postulates fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Mensch rationaler<br />
weise die private Verwaltung als <strong>de</strong>n geeignetsten Verwirkli<br />
chungsmodus. Doch ist dieser Modus an bestimmte wirtschaft<br />
liche, soziale <strong>und</strong> kulturelle Bedingungen geb<strong>und</strong>en.<br />
In <strong>de</strong>n päpstlichen Verlautbarungen wird nun nicht so syste<br />
matisch vorgegangen. Man fin<strong>de</strong>t keinen eigenen Traktat über<br />
das Gemeinwohl als ethischen Wert <strong>und</strong> dann einen solchen<br />
über die kausale Ordnung, in <strong>de</strong>r das ethische Postulat verwirk<br />
licht wer<strong>de</strong>n soll. Es liegt also am Interpreten, die Gesichts<br />
punkte aus ihrer Verklammerung zu lösen, um so die päpstli<br />
chen Äußerungen zu systematisieren. Zu beachten ist, daß das<br />
Gemeinwohl fast durchgängig im Sinn <strong>de</strong>s staatlichen Gemein<br />
wohls verstan<strong>de</strong>n wird, weil es an <strong>de</strong>n meisten Stellen in erster<br />
Linie darauf ankommt, die Grenzen <strong>de</strong>r staatlichen Gewalt zu<br />
bestimmen. Wir befin<strong>de</strong>n uns also stets auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Reali<br />
sierung. Der sinngeben<strong>de</strong> ethische Wert, <strong>de</strong>r eigentliche<br />
Gemeinwohlbegriff, muß darum sorgfältig aus <strong>de</strong>m Kontext<br />
herausgeschält wer<strong>de</strong>n.<br />
461
Exk. III. Das Gemeinwohl als ethischer Wert<br />
„Gemeinwohl" darf nicht mit „Gemeinschaft" o<strong>de</strong>r „Gesell<br />
schaft" verwechselt wer<strong>de</strong>n. Die Gemeinschaft ist das Mittel,<br />
um das Wohl aller, d.h. das Gemeinwohl, zu verwirklichen.<br />
Man kann darum nicht sagen, das Gemeinwohl sei um <strong>de</strong>r Per<br />
sonen willen da, wohl aber wird zu beinahe unzähligen Malen<br />
betont, die Gesellschaft sei um <strong>de</strong>s Menschen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Person<br />
willen da. In <strong>de</strong>r Ansprache an die Teilnehmer <strong>de</strong>s Ersten Inter<br />
nationalen Kongresses für Histopathologie <strong>de</strong>s Nervensystems<br />
vom 14. Sept. 1952 erklärt Pius XII.: „Es ist festzuhalten, daß<br />
<strong>de</strong>r Mensch seinem Sein <strong>und</strong> seiner Persönlichkeit nach letztlich<br />
nicht für die Gesellschaft da ist, son<strong>de</strong>rn umgekehrt die<br />
Gemeinschaft für <strong>de</strong>n Menschen". 7 Das Gemeinwohl, wofür<br />
auch manchmal <strong>de</strong>r Begriff „Wohlfahrt" gebraucht wird, ist das<br />
Wohl von Menschen, von Personen, die in <strong>de</strong>r Gemeinschaft<br />
verb<strong>und</strong>en sind: „Das Gemeinwohl ist immer das Wohl <strong>de</strong>r Per<br />
sonen, die in <strong>de</strong>r staatlichen Gemeinschaft leben, um eine Ver<br />
vollkommnung zu erlangen, die ihre individuellen Möglichkei<br />
ten übersteigt". 8 Es han<strong>de</strong>lt sich also um einen N<strong>utz</strong>en, <strong>de</strong>r per<br />
sönlich empf<strong>und</strong>en wird. Dieser N<strong>utz</strong>en muß aber so verteilt<br />
wer<strong>de</strong>n, daß er von allen, wenngleich in verschie<strong>de</strong>ner Weise,<br />
wahrgenommen wird. In diesem Sinn spricht Pius XI. in <strong>de</strong>r<br />
Enzyklika „Quadragesimo anno" von <strong>de</strong>r gerechten Güterver<br />
teilung mit Blick auf <strong>de</strong>n „allgemeinen N<strong>utz</strong>en" o<strong>de</strong>r das „Ge<br />
samtwohl": „Keineswegs je<strong>de</strong> beliebige Güter- <strong>und</strong> Reich<br />
tumsverteilung läßt nämlich <strong>de</strong>n gottgewollten Zweck, sei es<br />
überhaupt, sei es in befriedigen<strong>de</strong>m Maße erreichen. Darum<br />
müssen die Anteile <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Menschen <strong>und</strong> gesell<br />
schaftlichen Klassen an <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Fortschritt <strong>de</strong>s Gesell-<br />
schaftsprozesses <strong>de</strong>r Wirtschaft ständig wachsen<strong>de</strong>n Güterfülle<br />
so bemessen wer<strong>de</strong>n, daß dieser von Leo XIII. hervorgehobene<br />
allgemeine N<strong>utz</strong>en gewahrt bleibt o<strong>de</strong>r, was dasselbe mit an<strong>de</strong><br />
ren Worten ist, <strong>de</strong>m Gesamtwohl <strong>de</strong>r menschlichen Gesell<br />
schaft kein Scha<strong>de</strong>n zugefügt wird". 9<br />
Die pointierte Gegenüberstellung von Einzelinteresse <strong>und</strong><br />
Gesamtinteresse läßt erraten, daß das Gesamtinteresse nicht<br />
7 Utz - Groner 2275.<br />
8 Päpstlicher Brief <strong>de</strong>s Kardinals A. G. Cigognani, Staatssekretär Pauls VI., an<br />
<strong>de</strong>n Bischof R.Moralejo vom 29.5.1964, Utz - von Galen II 247.<br />
9 Utz - von Galen IV 104.<br />
462
einfach die Summe von Einzelinteressen sein kann. Sonst hät<br />
ten die energische Ablehnung von Nur-Eigeninteressen <strong>und</strong> die<br />
Betonung <strong>de</strong>r Unterordnung <strong>de</strong>s Einzelinteresses unter das<br />
Gemeinwohl keinen Sinn mehr. Leo XIII. begrün<strong>de</strong>t in seinem<br />
Brief „Notre consolation" vom 3. Mai 1892 an die Kardinäle<br />
Frankreichs die gehorsame Annahme aller Regierungsformen<br />
mit <strong>de</strong>m Hinweis auf das Gemeinwohl als „höchstem Ziel":<br />
„Der Gr<strong>und</strong> dieser Annahme (gehorsame Annahme aller Re<br />
gierungsformen, A.F. U.) ist, daß das Gemeinwohl <strong>de</strong>r<br />
Gemeinschaft je<strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren Interesse vorgeht; <strong>de</strong>nn es ist das<br />
schöpferische Prinzip, die erhalten<strong>de</strong> Gr<strong>und</strong>kraft <strong>de</strong>r menschli<br />
chen Gemeinschaft. Daraus folgt, daß je<strong>de</strong>r or<strong>de</strong>ntliche Bürger<br />
es um je<strong>de</strong>n Preis wollen <strong>und</strong> erstreben muß. Ja, aus dieser Not<br />
wendigkeit, das Gemeinwohl zu sichern, erfließt als aus ihrer<br />
eigentlichen <strong>und</strong> unmittelbaren Quelle die Notwendigkeit einer<br />
staatlichen Gewalt überhaupt; sie soll auf das Gemeinwohl als<br />
ihr höchstes Ziel sich einstellen <strong>und</strong> so das vielfältige Wollen<br />
ihrer Untertanen in ihrer Hand zu einer Einheit zusammenfas<br />
sen <strong>und</strong> es weise <strong>und</strong> beständig eben darauf hinordnen". 10<br />
Das Gemeinwohl kann natürlich nur als ein subjektiv wahr<br />
nehmbarer N<strong>utz</strong>en verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Wenn das Gemeinwohl<br />
o<strong>de</strong>r Gemeininteresse verwirklicht ist, dann muß sich offenbar<br />
auch je<strong>de</strong>r einzelne subjektiv „wohl" fühlen. Wir befin<strong>de</strong>n uns<br />
also in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Benthamschen Begriffs <strong>de</strong>s Gesamtwohls.<br />
Daß die vielen Einzelnen gemeint sind, beweist auch <strong>de</strong>r stän<br />
dige Hinweis auf die <strong>Recht</strong>e <strong>de</strong>r Person, die, wie Pius XII. in <strong>de</strong>r<br />
erwähnten Ansprache an <strong>de</strong>n Kongreß für humanistische Stu<br />
dien sagte, „zum Kostbarsten im Gemeinwohl gehören". 11 Mit<br />
<strong>de</strong>r gleichen Schärfe erklärt Pius XII. in <strong>de</strong>r Ansprache an die<br />
Teilnehmer <strong>de</strong>s dritten Nationalkongresses <strong>de</strong>r Italienischen<br />
Sektion <strong>de</strong>s Rates <strong>de</strong>r Europäischen Gemein<strong>de</strong>n vom 6. Dezem<br />
ber 1957: „Die öffentliche Gewalt ist zwar im Hinblick auf das<br />
Gemeinwohl errichtet wor<strong>de</strong>n, aber dieses gipfelt im autono<br />
men Leben <strong>de</strong>r Einzelpersonen". 12<br />
Liest man diese <strong>und</strong> viele an<strong>de</strong>re ähnliche Formulierungen<br />
separat, dann kommt man leicht auf <strong>de</strong>n Gedanken, daß das<br />
Gemeinwohl schließlich doch nichts an<strong>de</strong>res ist als das Ergebnis<br />
1 0 Utz - von Galen XXVII 11.<br />
11 Utz - Groner 359.<br />
12 Utz - Groner 6450.<br />
463
Exk. III <strong>de</strong>r vielen vom Staat geschützen, in Autonomie vollzogenen<br />
Handlungen. Wie aber soll man sich dann noch vorstellen kön<br />
nen, daß die autonomen Personen o<strong>de</strong>r Gruppen sich <strong>de</strong>m<br />
Gemeinwohl beugen sollen? So verlangt <strong>de</strong>r Staatssekretär<br />
Pauls VI., Kardinal A. G. Cicognani, in seinem Brief an Kardinal<br />
G. Siri vom 23. Mai 1964 von <strong>de</strong>n autonomen Gruppen loyale<br />
Unterordnung unter das Gemeinwohl: „Sie (die Gruppen,<br />
A. F. U.) besitzen auch eigene Autonomie, wenn es um Ent<br />
scheidungen <strong>und</strong> Maßnahmen im Hinblick auf ihre spezifischen<br />
Ziele geht, vorausgesetzt, daß sie loyal bereit sind, sich <strong>de</strong>n For<br />
<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Gemeinwohls unterzuordnen". 13<br />
Die starke Betonung <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>e <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Autonomie <strong>de</strong>r Per<br />
son erfährt eine beachtenswerte Eingrenzung durch die natur<br />
rechtliche Bestimmung <strong>de</strong>r menschlichen <strong>de</strong>r Person als eines<br />
sozialen Wesens. So sagt Pius XI. in <strong>de</strong>m R<strong>und</strong>schreiben „Mit<br />
brennen<strong>de</strong>r Sorge" vom 14. März 1937: „...das wahre Gemein<br />
wohl wird letztlich bestimmt <strong>und</strong> erkannt aus <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s<br />
Menschen mit ihrem harmonischen Ausgleich zwischen persönli<br />
chem <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> sozialer Bindung, sowie aus <strong>de</strong>m durch die<br />
gleiche Menschennatur bestimmten Zweck <strong>de</strong>r Gemein<br />
schaft". 1 4 Da es in diesem Schreiben um die Grenzen <strong>de</strong>r Staats<br />
gewalt geht, wird betont, daß <strong>de</strong>r Staat sich dieser vorgeordne<br />
ten Gemeinwohlnorm zu beugen habe. „Die Gemeinschaft ist<br />
vom Schöpfer gewollt als Mittel zur vollen Entfaltung <strong>de</strong>r indi<br />
viduellen <strong>und</strong> sozialen Anlagen, die <strong>de</strong>r Einzelmensch, gebend<br />
<strong>und</strong> nehmend, zu seinem <strong>und</strong> aller an<strong>de</strong>ren Wohl auszuwerten<br />
hat. Auch jene umfassen<strong>de</strong>ren <strong>und</strong> höheren Werte, die nicht<br />
vom Einzelnen, son<strong>de</strong>rn nur von <strong>de</strong>r Gemeinschaft verwirk<br />
licht wer<strong>de</strong>n können, sind vom Schöpfer letzten En<strong>de</strong>s um <strong>de</strong>s<br />
Menschen willen gewollt, zu seiner natürlichen <strong>und</strong> übernatür<br />
lichen Entfaltung <strong>und</strong> Vollendung". 15 Es sei nochmals darauf<br />
hingewiesen, daß <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls sich nicht mit<br />
<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Gemeinschaft <strong>de</strong>ckt. Die Gemeinschaft ist eine von<br />
Menschen bewirkte Institution <strong>und</strong> hat zum Ziel das Gemein<br />
wohl, das aus <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s Menschen, <strong>de</strong>r seinerseits individu<br />
elle <strong>Recht</strong>e <strong>und</strong> soziale Pflichten hat, erkannt wird. Zu beachten<br />
ist ferner, daß vom Menschen als solchem die Re<strong>de</strong> ist, womit<br />
1 3 Utz - von Galen XXII 30.<br />
1 4 Utz — von Galen II 201, Hervorhebung von mir.<br />
1 5 A.a.O., Hervorhebung von mir.<br />
464
selbstre<strong>de</strong>nd an alle Menschen gedacht ist. Es han<strong>de</strong>lt sich also<br />
um eine Generalisierung <strong>de</strong>r Person. Die Werte <strong>de</strong>r Person <strong>und</strong><br />
somit aller Personen sollten in Zusammenarbeit verwirklicht<br />
wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r Enzyklika „Divini illius Magistri" (31.12.1929)<br />
sagt Pius XL an einer Stelle, wo er von <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s dies<br />
seitigen Gemeinwohls durch die Staatsgewalt spricht: „Dieser<br />
Zweck, das Gemeinwohl natürlicher Ordnung, besteht in<br />
Frie<strong>de</strong> <strong>und</strong> Sicherheit, wovon dann die Familie <strong>und</strong> <strong>de</strong>r einzelne<br />
Bürger für <strong>de</strong>n Gebrauch ihrer <strong>Recht</strong>e ihren N<strong>utz</strong>en haben, <strong>und</strong><br />
zugleich im Höchstmaß geistigen <strong>und</strong> materiellen Wohles, soweit<br />
es sich durch einträchtige <strong>und</strong> geordnete Zusammenarbeit aller in<br />
diesem Leben verwirklichen läßt". lb Systematisiert man die von<br />
Pius XL ausgedrückten Elemente, dann kann man das Gemein<br />
wohl bestimmen als „die menschliche Vollkommenheit als<br />
gemeinsames, die einzelmenschlichen Vollkommenheiten als<br />
Teile umfassen<strong>de</strong>s Ziel einer Vielheit von Menschen" o<strong>de</strong>r als<br />
„das personale Wohl vieler Einzelmenschen, sofern es nur mit<br />
gemeinsam angewandten Mitteln erstrebt wer<strong>de</strong>n kann". 17 Das<br />
Gemeinwohl ist somit ein kollektiver Wert, an <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r einzelne<br />
teilhat. In diesem Sinn spricht sich Johannes XXIII. in <strong>de</strong>r Enzy<br />
klika „Pacem in terris" (11.4.1963) aus: „Außer<strong>de</strong>m verlangt<br />
dieses Gut kraft seiner Natur, daß alle Glie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Staates an<br />
ihm teilhaben, wenn auch in verschie<strong>de</strong>nem Gra<strong>de</strong> je nach <strong>de</strong>n<br />
Aufgaben, Verdiensten <strong>und</strong> Verhältnissen <strong>de</strong>s einzelnen. Des<br />
halb müssen alle Staatslenker darauf hinarbeiten, das gemein<br />
same Wohl ohne Bevorzugung irgen<strong>de</strong>ines Bürgers o<strong>de</strong>r einer<br />
Bevölkerungsschicht zum N<strong>utz</strong>en aller zu för<strong>de</strong>rn". 18 Damit<br />
distanziert sich die kirchliche Lehre vom Gemeinwohl entschei<br />
<strong>de</strong>nd von <strong>de</strong>r Benthamschen Formulierung. Es ist nicht das sub<br />
jektiv empf<strong>und</strong>ene Wohl <strong>de</strong>r Personen, son<strong>de</strong>rn das an objekti<br />
ven Inhalten orientierte Wohl aller. Die objektive Norm umfaßt<br />
zwei Elemente: die Menschennatur <strong>und</strong> die geschichtliche<br />
Wirklichkeit: „Die Existenzberechtigung aller öffentlichen<br />
Gewalt ruht in <strong>de</strong>r Verwirklichung <strong>de</strong>s Gemeinwohls, die nur<br />
unter Berücksichtigung seines Wesens wie <strong>de</strong>r gegebenen zeitli-<br />
1 6 Utz — von Galen IX 72, Hervorhebung von mir.<br />
17 Vgl. A.F. Utz, Sozialethik, I.Teil, Die Prinzipien <strong>de</strong>r Gesellschaftslehre,<br />
2.,unveränd. Aufl. 1964, 136.<br />
18 Utz- von Galen XXVIII 149.<br />
465
chen Verhältnisse zu erreichen ist". 19 Die Erstbestimmung aus<br />
<strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s Menschen erfor<strong>de</strong>rt die Berücksichtigung <strong>de</strong>s all<br />
gemeinen, das einzelne Volk übergreifen<strong>de</strong>n Wohles <strong>de</strong>r<br />
Menschheit: „Gewiß bestimmt sich das Gemeinwohl auch aus<br />
<strong>de</strong>m, was einem je<strong>de</strong>n Volk eigentümlich ist; doch macht dies<br />
keineswegs das Gemeinwohl in seiner Gesamtheit aus. Denn<br />
weil es wesentlich mit <strong>de</strong>r Menschennatur zusammenhängt,<br />
kann es als Ganzes <strong>und</strong> vollständig stets nur bestimmt wer<strong>de</strong>n,<br />
wenn man es im Hinblick auf seine innerste Natur <strong>und</strong><br />
geschichtliche Wirklichkeit von <strong>de</strong>r menschlichen Person aus<br />
sieht". 20<br />
Zu <strong>de</strong>n personalen Werten, die im Gemeinwohl beschlossen<br />
sind, gehört nicht nur das irdische Wohl, son<strong>de</strong>rn auch jenes,<br />
das <strong>de</strong>r Mensch im Jenseits erwartet. Pius XII. kämpft in seiner<br />
Pfingstbotschaft vom l.Juni 1941 gegen <strong>de</strong>n Irrtum „als ob <strong>de</strong>r<br />
Mensch kein an<strong>de</strong>res Leben zu erwarten hätte außer <strong>de</strong>m, das<br />
hienie<strong>de</strong>n sein En<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>t". 21 In seiner Osterpredigt vom<br />
24. März 1940 stellt Pius XII. die geistige Erneuerung <strong>und</strong> Wie<br />
<strong>de</strong>rherstellung durch Christus unter die For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls: „Diese notwendige Leistung verlangt nämlich<br />
nicht nur das private Leben <strong>de</strong>s einzelnen <strong>und</strong> sein persönliches<br />
Wohlergehen, son<strong>de</strong>rn das Gemeinwohl <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Gemeinschaft insgesamt". 22 Der Geist <strong>de</strong>r Brü<strong>de</strong>rlichkeit soll<br />
gemäß Pius XII. das sittliche Empfin<strong>de</strong>n für die <strong>Recht</strong>schaffen<br />
heit <strong>und</strong> Wahrhaftigkeit im menschlichen Zusammenleben, wie<br />
ebenso „das Bewußtsein <strong>de</strong>r Verantwortung für das Gemein<br />
wohl" för<strong>de</strong>rn. 23<br />
Wenn also von <strong>de</strong>n <strong>Recht</strong>en <strong>und</strong> Pflichten <strong>de</strong>r Person, die <strong>de</strong>r<br />
Staat zu schützen hat, die Re<strong>de</strong> ist, dann ist, wenn man <strong>de</strong>m Be<br />
griff <strong>de</strong>s Gemeinwohls näherkommen will, zu beachten, daß<br />
<strong>de</strong>r einzelne sein gesamtes sittliches Leben auf das Gemeinwohl<br />
hin einstellen soll. Der päpstliche Brief <strong>de</strong>s Subsistuts Pius'XII.,<br />
A.Dell'Aqua, erklärt darum, die Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas von<br />
Aquin von <strong>de</strong>r Gemeinwohlgerechtigkeit als <strong>de</strong>r obersten sittli-<br />
19 Utz - von Galen XXVIII 147.<br />
2 0 Utz - von Galen XXVIII 148.<br />
21 Utz - Groner 508.<br />
2 2 Utz - Groner 619.<br />
2 3 Ansprache an die Männer <strong>de</strong>r Katholischen Aktion Italiens, 7.9.1947, Utz —<br />
466<br />
Groner 317.
chen Tugend aufnehmend: „Diese <strong>Recht</strong>e <strong>und</strong> Pflichten haben Exk.III<br />
letztlich, wie man weiß, ihren Ursprung in <strong>de</strong>r Gemeinwohl<br />
o<strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit, die von <strong>de</strong>n Philosophen <strong>und</strong><br />
Theologen mit gutem Gr<strong>und</strong>e als e<strong>de</strong>lste unter <strong>de</strong>n sittlichen<br />
Tugen<strong>de</strong>n betrachtet wird, <strong>de</strong>nn sie ordnet alle menschliche<br />
Tätigkeit auf das Gemeinwohl hin". 24<br />
Der Bürger ist seinem Mitbürger aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gemeinwohl<br />
for<strong>de</strong>rung verpflichtet. Ein<strong>de</strong>utig kommt die Begründung <strong>de</strong>r<br />
gegenseitigen Hilfeleistung, d. h. <strong>de</strong>s Solidarismus von Mensch<br />
zu Mensen, im Gemeinwohl bei Leo XIII. in <strong>de</strong>r Enzxklika<br />
„Graves <strong>de</strong> communi" (18.1.1901) zum Ausdruck: „Niemand<br />
lebt im Staate nur seinem eigenen Vorteil, son<strong>de</strong>rn auch für das<br />
Gesamtwohl. Wenn die einen ihren Teil zur Verwirklichung <strong>de</strong>r<br />
allgemeinen Wohlfahrt nicht leisten können, dann müssen die<br />
an<strong>de</strong>rn, <strong>de</strong>nen das möglich ist, dies durch reichlichere Leistun<br />
gen ersetzen". 25<br />
Es geht also nicht nur darum, daß die Gesellschaftsglie<strong>de</strong>r<br />
sich untereinan<strong>de</strong>r helfen, son<strong>de</strong>rn daß sie es tun, weil sie <strong>de</strong>m<br />
Gemeinwohl verpflichtet sind. Im Gemeinwohl liegt die eigent<br />
liche Begründung <strong>de</strong>s Solidarismus. Das ist ein an<strong>de</strong>rer Solida<br />
rismus als jener, von <strong>de</strong>m man in <strong>de</strong>r Marktwirtschaft in Bezug<br />
zum Wettbewerb spricht.<br />
Zu <strong>de</strong>n im Gemeinwohl enthaltenen Werten gehört nicht nur<br />
die materielle, son<strong>de</strong>rn auch die geistige Wohlfahrt, <strong>und</strong> zwar<br />
im „Höchstmaß", wie Pius XL in <strong>de</strong>m aus „Divini illius<br />
Magistri" zitierten Text sagt.<br />
Obwohl die Religion selbst nicht Aufgabe <strong>de</strong>r Staatsgewalt<br />
ist, gehört sie doch zur geistigen Wohlfahrt, also zum Gemein<br />
wohl: „Da die Menschen aus Leib <strong>und</strong> unsterblicher Seele<br />
bestehen, können sie in diesem sterblichen Leben we<strong>de</strong>r ihr<br />
Dasein voll ausschöpfen, noch ein vollkommenes Glück errei<br />
chen. Darum muß das Gemeinwohl auf eine Weise verwirklicht<br />
wer<strong>de</strong>n, die <strong>de</strong>m ewigen Heil <strong>de</strong>r Menschen nicht nur nicht ent<br />
gegensteht, son<strong>de</strong>rn ihm vielmehr dient". 26 Die Staatsgewalt<br />
kann darum die Religion nicht ignorieren, schon <strong>de</strong>shalb nicht,<br />
weil aus <strong>de</strong>r Religion die gesellschaftlich stabilisieren<strong>de</strong>n Motive<br />
Päpstlicher Brief an <strong>de</strong>n Vorsitzen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Sozialen Woche Kanadas vom<br />
29. September 1955, Utz - Groner 6245.<br />
Utz — von Galen VI 46, Hervorhebung von mir.<br />
Johannes XXIII., „Pacem in terris", Utz — von Galen XXVIII 152.<br />
467
kommen. Leo XIII. hat bei <strong>de</strong>r Staatsgewalt sogar ein unter<br />
schei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Vermögen vorausgesetzt, um nicht jedwe<strong>de</strong> Reli<br />
gion als zu schützen<strong>de</strong> anzuerkennen. Es geht also nicht um<br />
eine direkte Religionspolitik, immerhin aber um das kluge<br />
Abwägen, welche Religion staatstragend zu sein vermag. In die<br />
sem Sinn ist die von Leo XIII. in <strong>de</strong>r Enzyklika „Immortale Dei"<br />
(1.11.1885) gefor<strong>de</strong>rte Einbeziehung <strong>de</strong>r Religion ins Gemein<br />
wohl zu verstehen: „Die in <strong>de</strong>r Gesellschaft zu einer Einheit<br />
verb<strong>und</strong>enen Menschen verbleiben nicht weniger als einzeln<br />
genommen in <strong>de</strong>r Gewalt Gottes... Es wäre vonseiten <strong>de</strong>r Staa<br />
ten ein Frevel, wollten sie sich <strong>de</strong>rart gebär<strong>de</strong>n, als ob es keinen<br />
Gott gäbe, o<strong>de</strong>r die Religionsangelegenheiten als ein ihnen völ<br />
lig frem<strong>de</strong>s Objekt von sich weisen, o<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen<br />
Religionen eine o<strong>de</strong>r die an<strong>de</strong>re nach Belieben anerkennen...<br />
Darum soll die staatliche Gemeinschaft, die ja keine an<strong>de</strong>re<br />
Aufgabe hat, als das allgemeine Wohl zu för<strong>de</strong>rn, im Bemühen<br />
um das Staatswohl die Bürger so leiten, daß sie in diesem ihrem<br />
innersten Verlangen nach <strong>de</strong>m Besitze <strong>de</strong>s höchsten <strong>und</strong> unver<br />
gänglichen Gutes nicht nur nicht geschädigt, son<strong>de</strong>rn auf alle<br />
mögliche Weise geför<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Letzteres geschieht aber in<br />
erster Linie dadurch, daß die Heiligkeit <strong>und</strong> Unverletzlichkeit<br />
<strong>de</strong>r Religion respektiert wird, <strong>de</strong>ren Funktion es ist, <strong>de</strong>n Men<br />
schen mit Gott zu verbin<strong>de</strong>n". 27 Leos XIII. Auffassung steht<br />
also nicht im Wi<strong>de</strong>rspruch zu <strong>de</strong>r Erklärung <strong>de</strong>s Kardinals<br />
A. G. Cicognani im päpstlichen Brief an Kardinal G. Siri<br />
(23.5.1964), daß die öffentliche Gewalt wesensgemäß nicht ge<br />
eignet sei, „im Bereich <strong>de</strong>r inneren, geistigen Werte die Person<br />
zu ersetzen". 28 Leo XIII. lag natürlich daran, die „wahre" Reli<br />
gion, nämlich die katholische, geschützt <strong>und</strong> geför<strong>de</strong>rt zu<br />
sehen. Dies ist selbstverständlich für einen Theologen römisch<br />
katholischen Bekenntnisses <strong>und</strong> erst recht für <strong>de</strong>n Papst. Daran<br />
hat auch das II. Vaticanum nichts geän<strong>de</strong>rt. Entgegen <strong>de</strong>r Inter<br />
pretation mancher Theologen han<strong>de</strong>lt es sich im II.Vaticanum<br />
nicht um einen Abschied von <strong>de</strong>r Lehre Leos XIII. Das II.Vati<br />
canum hat in seiner Lehre von <strong>de</strong>r Religionsfreiheit lediglich die<br />
öffentlich-rechtliche Norm an<strong>de</strong>rs gesehen im Sinn <strong>de</strong>r positiv<br />
rechtlichen Gleichstellung aller religiösen Uberzeugungen. Im<br />
übrigen wird ein kluger Staatsmann nur jenen Religionen freie<br />
2 7 Utz - von Galen XXI 26.<br />
2 8 Utz - von Galen XXII 28.<br />
468
Entfaltung gewähren, die staatserhaltend wirken, nicht aber<br />
z.B. solchen, die mit Waffengewalt ihre Ausbreitung suchen.<br />
Das Gemeinwohl ist als For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Naturgesetzes wie<br />
dieses göttlicher Institution. Dies weil „Gott...die Menschen<br />
ihrer Natur nach als Gemeinschaftswesen geschaffen" hat. 29 An<br />
diese Norm ist die Staatsgewalt, die ihre Kompetenz von Gott<br />
erhalten hat, geb<strong>und</strong>en. Darum kann die gesetzgeberische<br />
Gewalt an sich alle natürlichen sittlichen Normen sanktionie<br />
ren, wie Leo XIII. in <strong>de</strong>r Enzyklika „Libertas praestantissi-<br />
mum" (20.Juni 1888) erklärt. Die Gesetze <strong>de</strong>s Staates ver<br />
pflichten darum im Gewissen, sofern sie <strong>de</strong>m natürlichen Sit<br />
tengesetz entsprechen. 30 Die Eingrenzung <strong>de</strong>r Staatsgewalt ist<br />
damit nicht ausgeschlossen. 31 Doch ist die Parallelität von<br />
Pflichten <strong>de</strong>r Bürger <strong>und</strong> naturrechtlich begrün<strong>de</strong>ter Kompe<br />
tenz <strong>de</strong>r Staatsgewalt beachtenswert. Im konkreten Staat ist die<br />
Staatsgewalt, zumin<strong>de</strong>st in allen pluralistischen Demokratien,<br />
rechtmäßig <strong>und</strong> völlig im Einklang mit <strong>de</strong>m naturrechtlichen<br />
Denken begrenzt, so daß in diesem Fall die Pflichten <strong>de</strong>r Bürger<br />
gegenüber <strong>de</strong>m Gemeinwohl umfangreicher sind als die Mög<br />
lichkeit <strong>de</strong>s Eingriffs <strong>de</strong>r Staatsgewalt in das Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r Bür<br />
ger.<br />
Das Gemeinwohl in <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Handlungsordnung<br />
Bis dahin haben wir versucht, die Werte zusammenzustellen,<br />
die gemäß <strong>de</strong>n päpstlichen Verlautbarungen im Gemeinwohl<br />
enthalten sind. Diese Analyse war insofern etwas kompliziert,<br />
als die Päpste die kirchliche Auffassung vom staatlichen<br />
Gemeinwohl stets vom Blickwinkel <strong>de</strong>r staatlichen Tätigkeit<br />
aus zum Ausdruck brachten. Dennoch gelang es, die rein<br />
ethische Bestimmung unter Abstraktion <strong>de</strong>r Verwirklichungs<br />
weise zu fin<strong>de</strong>n. Natürlich kann das Gemeinwohl auch in seiner<br />
rein ethischen Gestalt konkret nicht ohne <strong>de</strong>n Blick auf die Ver<br />
wirklichungsmöglichkeiten bestimmt wer<strong>de</strong>n. Darum wird da<br />
<strong>und</strong> dort in <strong>de</strong>n päpstlichen Verlautbarungen auf die gesell<br />
schaftlichen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Bedingungen als Element <strong>de</strong>r<br />
Gemeinwohlbestimmung hingewiesen. Dieser Blick auf die<br />
2 9 Johanna XXIII, „Pacem in terris", Utz — von Galen XXVIII 139.<br />
3 0 „Pacem in terris", Utz - von Galen XXVIII 143.<br />
31 Utz - von Galen XXVIII 145.<br />
469
Exk. III konkreten Verhältnisse betrifft aber nur die inhaltliche Konkre<br />
tisierung <strong>de</strong>s aus <strong>de</strong>r menschlichen Natur entnommenen<br />
Gemeinwohlbegriffs.<br />
In <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Handlungen innerhalb<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft steht die Überlegung am Anfang, wem die<br />
Priorität <strong>de</strong>r einzelnen Entscheidungen im Hinblick auf das<br />
Gemeinwohl zusteht. Hier erhält die Person einen be<strong>de</strong>utungs<br />
vollen Akzent. Ihr <strong>und</strong> mit ihr <strong>de</strong>n von ihr begrün<strong>de</strong>ten<br />
Gemeinschaften steht die Priorität freien Han<strong>de</strong>lns zu. Der<br />
Staat hat dann nur die Bedingungen zu setzen, gemäß <strong>de</strong>nen die<br />
Person ihre Entfaltung <strong>und</strong> Vollendung zu fin<strong>de</strong>n vermag. Im<br />
Zug <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s pluralistischen Staates legen die<br />
päpstlichen Verlautbarungen zunehmend größeren Wert auf<br />
diesen Gesichtspunkt. Natürlich wird nach wie vor <strong>de</strong>m Staat<br />
die oberste Gewalt belassen, jene Aufgaben zu übernehmen,<br />
die durch die Eigeninitiative <strong>de</strong>r Bürger nicht erfüllt wer<strong>de</strong>n<br />
können. Hinsichtlich <strong>de</strong>r Wertfülle <strong>de</strong>s Gemeinwohls än<strong>de</strong>rte<br />
sich in <strong>de</strong>r Soziallehre <strong>de</strong>r Kirche nichts, es wur<strong>de</strong> lediglich in<br />
<strong>de</strong>r Handlungsordnung die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Subsidiaritätsprin-<br />
zips zunehmend unterstrichen.<br />
Im Bereich <strong>de</strong>r Handlungsnormen stehen die Institutionen<br />
o<strong>de</strong>r Maßnahmen, d.h. die Wirkkräfte im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong>, die<br />
notwendig sind, um <strong>de</strong>n Gemeinwohlfor<strong>de</strong>rungen zu genügen.<br />
Die Wirken<strong>de</strong>n aber sind die Personen, nicht das Kollektiv, wie<br />
Pius XI. in seiner Ansprache an die Teilnehmer <strong>de</strong>s Pilgerzuges<br />
<strong>de</strong>s B<strong>und</strong>es christlicher Arbeiter Frankreichs (C. F.T. C.) in <strong>de</strong>r<br />
Audienz zum 18. September 1938 sagte: „Das Kollektiv selbst<br />
kann keine einzige persönliche Tätigkeit ausüben, es sei <strong>de</strong>nn<br />
über die Individuen, aus <strong>de</strong>nen es besteht: das ist eine evi<strong>de</strong>nte<br />
Wahrheit, aber eine Wahrheit, die in vielen Milieus nicht mehr<br />
anerkannt wird". 32 Die öffentliche Gewalt kann darum nichts<br />
besseres tun, als die Bedingungen <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Lebens<br />
zu schaffen, welche die freie Entfaltung <strong>de</strong>r menschlichen Per<br />
son gewährleisten. Deckt sich diese kausale Seite <strong>de</strong>r Gemein<br />
wohlkonzeption völlig mit <strong>de</strong>m Begriff „Gemeinwohl", wie<br />
etwa O. von Nell-Breuning das Gemeinwohl <strong>de</strong>finierte als<br />
3 2 Utz - von Galen III 53.<br />
3 3 Zur christlichen Gesellschaftslehre, hg. von O. v. Nell-Breuning SJ <strong>und</strong><br />
Dr. H. Sacher, Freiburg i. Br. 1947. O. v. Nell-Breuning hat später diese Version<br />
korrigiert o<strong>de</strong>r ver<strong>de</strong>utlicht, vgl. <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> Freiheit, Wien 1980,<br />
35f. (siehe weiter unten S.487).<br />
470
„Inbegriff aller Voraussetzungen (Einrichtungen) allgemeiner<br />
o<strong>de</strong>r öffentlicher Art, <strong>de</strong>ren es bedarf, damit die einzelnen als<br />
Glie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Gesellschaft ihre irdische Bestimmung zu erfüllen<br />
<strong>und</strong> durch Eigentätigkeit ihr irdisches Wohlergehen erfolgreich<br />
selber zu schaffen vermögen" ? Tatsächlich wird in <strong>de</strong>n päpstli<br />
chen Verlautbarungen das Gemeinwohl nicht mit diesen organi<br />
satorischen Bedingungen i<strong>de</strong>ntifiziert, vielmehr wer<strong>de</strong>n diese<br />
Bedingungen mit <strong>de</strong>m Selbstwert Gemeinwohl als notwendige<br />
Realisierungsfaktoren wirbegriffen. So <strong>de</strong>utlich A. G. Cigo-<br />
gnani in <strong>de</strong>m bereits zitierten Brief an Kardinal G. Siri. Nach<br />
<strong>de</strong>m er zuerst hervorgehoben hatte, daß die „exakte Definition"<br />
"<strong>de</strong>s Gemeinwohls „die ständige Bezugnahme auf die mensch<br />
liche Person" erfor<strong>de</strong>re, fährt er fort: „So zeichnet sich die Kom<br />
plexität <strong>de</strong>s Gegenstan<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Gemeinwohls ab als eine Kom<br />
plexität, die vor allem auf die Vielfalt <strong>de</strong>r im Gemeinwohlbegriff<br />
im Hinblick auf die vollkommene Entfaltung <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Persönlichkeit konkret beschlossenen Elemente zurückzufüh<br />
ren ist". 34 Ebenso in <strong>de</strong>r Patoralkonstitution „Gaudium et spes"<br />
<strong>de</strong>s II.Vatikanischen Konzils: „Die einzelnen, die Familien <strong>und</strong><br />
die verschie<strong>de</strong>nen Gruppen, aus <strong>de</strong>nen sich die politische<br />
Gemeinschaft zusammensetzt, wissen, daß sie allein nicht<br />
imstan<strong>de</strong> sind, alles das zu leisten, was zu einem in je<strong>de</strong>r Rich<br />
tung menschlichen Leben gehört. Sie erfassen die Notwendig<br />
keit einer umfassen<strong>de</strong>ren Gesellschaft, in <strong>de</strong>r alle täglich ihre<br />
eigenen Kräfte zusammen zur ständig besseren Verwirklichung<br />
<strong>de</strong>s Gemeinwohls (= Wert, A. F. U.) einsetzen. So begrün<strong>de</strong>n<br />
sie <strong>de</strong>nn die politische Gemeinschaft in ihren verschie<strong>de</strong>nen<br />
Formen. Die politische Gemeinschaft besteht also um dieses<br />
Gemeinwohls (= Wert, A.F. U.) willen; in ihm hat sie ihre<br />
letztgültige <strong>Recht</strong>fertigung <strong>und</strong> ihren Sinn, aus ihm leitet sie ihr<br />
urspriinglich.es Eigenrecht ab. Das Gemeinwohl aber begreift in<br />
sich (complectitur) die Summe aller jener Bedingungen gesell<br />
schaftlichen Lebens, die <strong>de</strong>n Einzelnen, <strong>de</strong>n Familien <strong>und</strong><br />
gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Vervollkommnung vol<br />
ler <strong>und</strong> ungehin<strong>de</strong>rter zu erreichen gestatten". 35 In diesem Sinn<br />
erhält also <strong>de</strong>r Begriff „Gemeinwohl" einen umfassen<strong>de</strong>ren<br />
Sinn: Gemeinwohl als Wert <strong>und</strong> Gemeinwohlinstitutionen. In<br />
<strong>de</strong>m aus „Gaudium et spes" zitierten Text wird auf einen Passus<br />
Utz - von Galen XXII 25.<br />
Utz - von Galen IV 795.<br />
471
in „Mater et Magistra" hingewiesen, <strong>de</strong>r die Komplexität <strong>de</strong>s<br />
gebrauchten Gemeinwohlbegriffes noch <strong>de</strong>utlicher zum Aus<br />
druck bringt: „Dieses (das Gemeinwohl, A. F. U.) begreift in<br />
sich ja <strong>de</strong>n Inbegriff jener gesellschaftlichen Voraussetzungen,<br />
die <strong>de</strong>n Menschen die volle Entfaltung ihrer Werte ermöglichen<br />
o<strong>de</strong>r erleichtern. Außer<strong>de</strong>m halten Wir es für notwendig, daß<br />
die leistungsgemeinschaftlichen Gebil<strong>de</strong> sowie die vielfachen<br />
Unternehmungen, in <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Vergesellschaftungsprozeß sich<br />
vorzugsweise abspielt, sich wirklich kraft eigenen <strong>Recht</strong>es ent<br />
wickeln können <strong>und</strong> daß die Verfolgung ihrer Interessen im<br />
Einklang mit <strong>de</strong>m Gemeinwohl bleibt". Zweimal wird hier<br />
vom Gemeinwohl gesprochen, im Sinn <strong>de</strong>r gesellschaftlichen<br />
Voraussetzungen <strong>und</strong> im Sinn <strong>de</strong>s Gemeinwohls als eines Wer<br />
tes, mit <strong>de</strong>m die Aktivität <strong>de</strong>r einzelnen Gruppen in Einklang<br />
stehen soll. Der Gebrauch <strong>de</strong>s komplexen Begriffes Gemein<br />
wohl (Wert <strong>und</strong> Bedingungen) kann natürlich <strong>de</strong>n Urbegriff<br />
von Gemeinwohl (Wert) nicht austilgen. Dieser behält in <strong>de</strong>n<br />
päpstlichen Texten vielmehr seine Eigenständigkeit, wie die ver<br />
schie<strong>de</strong>nen schon zitierten Texte beweisen. Denn ohne diesen<br />
Wertbegriff gibt es keine echte Integration <strong>de</strong>r Einzelleistungen<br />
in das Gesellschaftsganze, wie aus <strong>de</strong>m Brief „Octogesima<br />
adveniens" Pauls VI. (14.5.1971) hervorgeht: „In diese umfas<br />
sen<strong>de</strong> Gemeinschaft (politische Gemeinschaft, A. F. U.) ist die<br />
Leistung <strong>de</strong>r einzelnen einzuglie<strong>de</strong>rn; eben damit wird sie auf<br />
das Gemeinwohl hingeordnet". 37<br />
Das Gemeinwohl <strong>de</strong>r Kirche<br />
<strong>und</strong> das ihm entsprechen<strong>de</strong> Subsidiaritätsprinzip<br />
Wie weitreichend <strong>und</strong> umfassend <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s Gemein<br />
wohls gemäß <strong>de</strong>r päpstlichen Lehre sein kann, läßt sich nicht<br />
besser darstellen als durch die kirchliche Auffassung vom<br />
Gemeinwohl <strong>de</strong>r Kirche <strong>und</strong> von <strong>de</strong>m diesem Gemeinwohl ent<br />
sprechen<strong>de</strong>n Subsidiaritätsprinzip. Es war bereits davon die<br />
Re<strong>de</strong>, daß selbst das staatliche Gemeinwohl gemäß <strong>de</strong>n päpstli<br />
chen Texten an sich <strong>de</strong>n ganzen Menschen mit seinem materiel<br />
len <strong>und</strong> geistigen Wohl umfaßt. Und es wur<strong>de</strong> auch berichtet,<br />
daß gemäß <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Päpsten gehaltenen naturrechtlichen<br />
472<br />
Utz - von Galen IV 260.<br />
Utz - von Galen IV 917.
Auffassung die obrigkeitliche Gewalt an sich, d. h. gemäß <strong>de</strong>r Exk. III<br />
Staatsi<strong>de</strong>e, kompetent ist, moralische Handlungen gesetzlich<br />
zu sanktionieren, so daß eine Parallelität besteht zwischen <strong>de</strong>n<br />
Pflichten <strong>de</strong>s Bürgers im Hinblick auf das Gemeinwohl <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
gesetzgeberischen Kompetenz <strong>de</strong>r obrigkeitlichen Gewalt. In<br />
<strong>de</strong>r konkreten Wirklichkeit gibt es aber <strong>de</strong>n Staat nicht, <strong>de</strong>r<br />
sämtliche Bedingungen <strong>de</strong>r Staatsi<strong>de</strong>e erfüllte. Es gibt darum<br />
auch nicht die <strong>de</strong>r Staatsi<strong>de</strong>e entsprechen<strong>de</strong> Gewalt. Außer<strong>de</strong>m<br />
besitzt kein Träger <strong>de</strong>r staatlichen Gewalt das einer umfassen<br />
<strong>de</strong>n moralischen Kompetenz entsprechen<strong>de</strong> Wissen. Der recht<br />
liche Vorrang <strong>de</strong>r Eigeninitiative <strong>de</strong>s Individuums in <strong>de</strong>r Hand<br />
lungsordnung (Subsidiarität als rechtliches Prinzip) ist gera<strong>de</strong><br />
durch diese Tatsache begrün<strong>de</strong>t. Die Berufung auf die Freiheit<br />
allein reicht nicht aus. Sonst hätte die staatliche Gewalt über<br />
haupt keine Kompetenz, die Freiheit um <strong>de</strong>s Gemeinwohls wil<br />
len zu beschränken.<br />
Natürlich soll in je<strong>de</strong>r Gesellschaft, wie immer sie sich nen<br />
nen mag, das Subsidiaritätsprinzip seine Geltung haben, d. h. es<br />
soll <strong>de</strong>m einzelnen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r von ihm gegrün<strong>de</strong>ten Gruppe die<br />
freie Initiative gewährt bleiben, jene Aufgaben zu übernehmen,<br />
zu <strong>de</strong>nen er o<strong>de</strong>r die Gruppe im Rahmen <strong>de</strong>s Gemeinwohls<br />
befähigt ist. Doch stellt sich die Frage, wer eigentlich bestimmt,<br />
inwieweit <strong>de</strong>r einzelne o<strong>de</strong>r die Gruppe „befähigt" ist, die vom<br />
Gemeinwohl gefor<strong>de</strong>rte Leistung zu erbringen. In <strong>de</strong>r Familie<br />
ist es gemäß <strong>de</strong>r kirchlichen Lehre <strong>de</strong>r Vater, <strong>de</strong>r um das<br />
Gemeinwohl <strong>de</strong>r Familie wissen muß. Das Subsidiaritätsprin<br />
zip ist <strong>de</strong>mnach in <strong>de</strong>r Familie ein pädagogisches o<strong>de</strong>r morali<br />
sches Prinzip. An<strong>de</strong>rs im Staat, in <strong>de</strong>m es ein subjektives <strong>Recht</strong><br />
zum Ausdruck bringt. Hier hat <strong>de</strong>r einzelne gegen das ver<br />
meintliche Besserwissen <strong>de</strong>s Trägers <strong>de</strong>r Gewalt das Vorrecht,<br />
als Erstursache <strong>de</strong>r Verwirklichung <strong>de</strong>s Gemeinwohls betrach<br />
tet zu wer<strong>de</strong>n. Das von <strong>de</strong>n Päpsten so vielseitig angerufene<br />
Subsidiaritätsprinzip als rechtliche Verteilungsnorm <strong>de</strong>r Hand<br />
lungskompetenz bezieht sich aus diesem Gr<strong>und</strong> stets auf die<br />
Gemeinwohlverwirklichung im Staat.<br />
In <strong>de</strong>r Kirche als <strong>de</strong>m mystischen Leib Christi ist <strong>de</strong>r getaufte<br />
Mensch bis in die letzten Fasern seines Seins <strong>de</strong>r kirchlichen<br />
Gemeinschaft inkorporiert. Die Kirche ist aufgr<strong>und</strong> ihrer göttli<br />
chen Einsetzung die Institution, in welcher <strong>de</strong>r Mensch sein<br />
letztgültiges Heil fin<strong>de</strong>t. Der totalen Inkorporation <strong>de</strong>s einzel<br />
nen in die Gemeinschaft <strong>de</strong>r Kirche entspricht darum auch ein<br />
473
Exk. III totales Regime. Dies hat Pius XI. in seiner Ansprache an die<br />
Teilnehmer <strong>de</strong>s Pilgerzuges <strong>de</strong>s B<strong>und</strong>es christlicher Arbeiter<br />
Frankreichs (18.9.1938) unmißverständlich zum Ausdruck<br />
gebracht: „Wenn es ein totalitäres Regime gibt —<strong>de</strong> facto <strong>und</strong> <strong>de</strong><br />
jure totalitär —, so ist es das Regime <strong>de</strong>r Kirche, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r<br />
Mensch ist ein Geschöpf Gottes, er ist <strong>de</strong>r Preis <strong>de</strong>r göttlichen<br />
Erlösung, er ist <strong>de</strong>r Diener Gottes, dazu bestimmt, für Gott hier<br />
unten <strong>und</strong> mit ihm im Himmel zu leben. Und Repräsentant <strong>de</strong>r<br />
I<strong>de</strong>en, <strong>de</strong>r Gedanken <strong>und</strong> <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>e Gottes ist nur die Kirche.<br />
Daher hat die Kirche wirklich das <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> die Pflicht, eine<br />
totale Macht über die einzelnen zu beanspruchen: <strong>de</strong>r ganze<br />
Mensch, <strong>de</strong>r Mensch voll <strong>und</strong> ganz, gehört <strong>de</strong>r Kirche, weil er<br />
ganz Gott gehört. Es gibt überhaupt keinen Zweifel hierüber<br />
für je<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r nicht alles leugnen, alles ablehnen will". 38<br />
Wie steht es nun bei dieser Sachlage um das Subsidiaritäts<br />
prinzip in <strong>de</strong>r Kirche? In seiner Ansprache an das Heilige Kol<br />
legium aus Anlaß <strong>de</strong>r Inthronisation <strong>de</strong>r neuen Kardinäle<br />
(20.2.1946) kommt Pius XII. auf diese Frage zu sprechen.<br />
Bezugnehmend auf „Quadragesimo anno" erklärt er: „alle so<br />
ziale Tätigkeit (gemeint ist „alle obrigkeitliche Tätigkeit", <strong>de</strong>nn<br />
sonst hätte <strong>de</strong>r Satz keinen Sinn, A. F. U.) ist ihrer Natur gemäß<br />
subsidiär; sie (die obrigkeitliche Tätigkeit, A. F. U.) soll die<br />
Glie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals<br />
zerschlagen o<strong>de</strong>r aufsaugen. Wahrhaft leuchten<strong>de</strong> Worte, die für<br />
das soziale Leben in allen seinen Stufungen gelten, auch für das<br />
Leben <strong>de</strong>r Kirche, ohne Nachteil für <strong>de</strong>ren hierarchische Struk<br />
tur". 39<br />
Das Subsidiaritätsprinzip kann aber in <strong>de</strong>r Kirche nicht das<br />
selbe sein wie im Staat. In einem göttlich eingesetzen „totalitä<br />
ren" Regime wirkt eine göttliche Führung. Der Träger <strong>de</strong>r gött<br />
lichen Autorität entschei<strong>de</strong>t nicht nur im Sinn einer Frie<strong>de</strong>ns<br />
ordnung, er verkün<strong>de</strong>t auch <strong>und</strong> zuallererst die Wahrheit. So<br />
kann das Subsidiaritätsprinzip nur als pädagogische o<strong>de</strong>r mora<br />
lische Anweisung an <strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r die Träger <strong>de</strong>r kirchlichen Autori<br />
tät verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, die mündigen Gläubigen in <strong>de</strong>n Dienst<br />
<strong>de</strong>r Wahrheit miteinzubeziehen. In diesem Sinn ist die Anwei<br />
sung Pius'XII., das Laienapostolat in <strong>de</strong>r kirchlichen Tätigkeit<br />
einzuschalten, zu verstehen: „Auch hier möge die kirchliche<br />
474<br />
Utz — von Galen III 55.<br />
Utz - Groner 4094.
Autorität das allgemein gültige Prinzip <strong>de</strong>r Subsidiarität <strong>und</strong> Exk. III<br />
gegenseitigen Ergänzung anwen<strong>de</strong>n. Man möge <strong>de</strong>n Laien die<br />
Aufgaben anvertrauen, die sie ebensogut o<strong>de</strong>r selbst besser als<br />
<strong>de</strong>r Priester erfüllen können. Sie sollen in <strong>de</strong>n Grenzen ihrer<br />
Funktion <strong>und</strong> <strong>de</strong>njenigen, die das Gemeinwohl <strong>de</strong>r Kirche<br />
ihnen zieht, frei han<strong>de</strong>ln <strong>und</strong> ihre Verantwortung auf sich neh<br />
men können". 40<br />
Zusammenfassung<br />
l.Die kirchlichen Dokumente enthalten keine allgemeine<br />
Lehre über das Gemeinwohl. Die Verlautbarungen beziehen<br />
sich vornehmlich auf <strong>de</strong>n Staat, wie er existiert, die Weltgemein<br />
schaft o<strong>de</strong>r die Kirche.<br />
2. In <strong>de</strong>n meisten Texten stehen die Äußerungen über das<br />
Gemeinwohl im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Kompetenz <strong>de</strong>s Staa<br />
tes (o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Kirche) hinsichtlich <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>r Entschei<br />
dungsrechte (Subsidiaritätsprinzip). Dadurch wird die Gemein<br />
wohllehre komplex, nämlich bezogen auf die Werte, die im<br />
Gemeinwohl enthalten sind, wie auch auf die Ordnung <strong>de</strong>r<br />
Kausalitäten, von <strong>de</strong>nen die Verwirklichung <strong>de</strong>r Gemeinwohl<br />
werte abhängt.<br />
3. Die konkrete Bestimmung <strong>de</strong>s Gemeinwohls kann nur<br />
erfolgen, in<strong>de</strong>m man die konkreten Verhältnisse wirtschaftli<br />
cher, sozialer <strong>und</strong> kultureller Art in Betracht zieht. Diese<br />
Betrachtung schließt naturgemäß die eventuell vorzusehen<strong>de</strong>n<br />
institutionellen Maßnahmen mit ein. Die konkrete Ausformung<br />
<strong>de</strong>s Gemeinwohls ist darum immer komplex. In mehreren Tex<br />
ten wird bei <strong>de</strong>r Definition <strong>de</strong>s Gemeinwohls außer auf die<br />
Natur <strong>de</strong>s Menschen auch auf die gegebenen Verhältnisse<br />
Bezug genommen.<br />
4. Dennoch lassen sich die Gemeinwohlwerte, also das, was<br />
im eigentlichen <strong>und</strong> letzten Sinn entsprechend <strong>de</strong>r menschli<br />
chen Natur Gemeinwohl zu be<strong>de</strong>uten hat, herausschälen. Dies<br />
geschieht durch die Betrachtung <strong>de</strong>r Pflichten, die gemäß <strong>de</strong>n<br />
Texten <strong>de</strong>r einzelne gegenüber <strong>de</strong>m Gemeinwohl zu erfüllen<br />
hat, nicht aber durch die Betrachtung <strong>de</strong>ssen, was <strong>de</strong>m Staat,<br />
beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>m pluralistischen Staat, in <strong>de</strong>r Handlungsordnung<br />
zusteht. Es ist daher nicht korrekt, das Gemeinwohl <strong>de</strong>r katho-<br />
Utz - Groner 5992.<br />
475
Exk. III lischen Soziallehre lediglich in <strong>de</strong>n Bedingungen <strong>und</strong> Vorausset<br />
zungen zu sehen, gemäß welchen <strong>de</strong>r einzelne seine persönliche<br />
Entfaltung <strong>und</strong> Vollendung zu fin<strong>de</strong>n vermag.<br />
5. Da die im Gemeinwohl beschlossenen Pflichten persona<br />
ler Natur sind, hat <strong>de</strong>r Staat sie in seinen Maßnahmen zu<br />
berücksichtigen, in<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Freiheitsraum<br />
garantiert o<strong>de</strong>r unter Umstän<strong>de</strong>n in eigener Tätigkeit jene Auf<br />
gaben übernimmt, die <strong>de</strong>r einzelne nicht zu leisten vermag. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> gehören die institutionellen, organisatorischen<br />
Elemente in <strong>de</strong>n Rahmen <strong>de</strong>r Verwirklichung <strong>de</strong>r Gemeinwohl<br />
werte. Sie sind, obwohl engstens mit <strong>de</strong>n Gemeinwohlwerten<br />
verb<strong>und</strong>en, nicht als das Gemeinwohl zu bezeichnen. Die<br />
päpstlichen Verlautbarungen nennen sie daher stets nur im Zu<br />
sammenhang mit <strong>de</strong>m eigentlichen Gemeinwohl, <strong>de</strong>m sie zu<br />
dienen haben.<br />
6. Die Gesellschaft ist als Institution <strong>de</strong>r Menschen zu<br />
betrachten, so sehr sie durch die Natur <strong>de</strong>s Menschen gefor<strong>de</strong>rt<br />
sein mag. Sie befin<strong>de</strong>t sich im Raum <strong>de</strong>r Kausalitäten <strong>de</strong>r<br />
Gemeinwohlverwirklichung. Deshalb gilt, daß die Gesellschaft<br />
um <strong>de</strong>s Menschen (<strong>de</strong>r Personen) willen da ist, nicht umge<br />
kehrt. Es gilt aber nicht, daß das Gemeinwohl um <strong>de</strong>s Men<br />
schen willen sei, weil im Gemeinwohl die Personen mit allen<br />
ihren <strong>Recht</strong>en <strong>und</strong> Pflichten eingeschlossen sind. Dies erhellt<br />
aus jenen Texten, in <strong>de</strong>nen erklärt wird, daß <strong>de</strong>r Mensch mit sei<br />
nem gesamten Tugendleben <strong>de</strong>m Gemeinwohl zu dienen habe.<br />
7. Das Gemeinwohl wird somit als höchste moralische Norm<br />
<strong>de</strong>r Integration <strong>de</strong>s gesamten Lebens <strong>de</strong>r Personen betrachtet.<br />
Es gibt keinen Lebensraum, <strong>de</strong>r sich dieser Integration entzie<br />
hen dürfte. Das naturgegebene Gemeinwohl ist göttlicher Ein<br />
setzung.<br />
8. Selbst auch die Religion hat ihren Platz im Gemeinwohl.<br />
Auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Verwirklichung hat darum <strong>de</strong>r Staat die<br />
Pflicht, die Freiheit <strong>de</strong>r Religion zu respektieren <strong>und</strong> sie als ein<br />
wichtiges Element <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Lebens zu betrachten,<br />
ohne jedoch ein religiöses Bekenntnis vorschreiben zu können.<br />
9. Da das durch die Natur <strong>de</strong>s Menschen gefor<strong>de</strong>rte Gemein<br />
wohl Gegenstand <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Autorität ist, kann die<br />
staatliche Gewalt, die ihre Autorität von Gott erhält <strong>und</strong> somit<br />
im Gewissen zu verpflichten vermag, an sich alle im Gemein<br />
wohl enthaltenen Werte gesetzlich sanktionieren, soweit diese<br />
in äußerlich erkennbaren Handlungen in Erscheinung treten.<br />
476
Dies besagt jedoch nicht, daß die Staatsgewalt zur Unterschei- Exk. III<br />
dung von gut <strong>und</strong> böse berechtigt wäre, da diese Unterschei<br />
dung bereits im Naturgesetz erfolgt, das durch die Vernunft<br />
erkennbar ist. Die Bürger haben das <strong>Recht</strong>, die Staatsform zu<br />
bestimmen <strong>und</strong> ihre Regierung zu wählen. Sie können somit<br />
<strong>de</strong>n Umfang sowie die Art <strong>und</strong> Weise <strong>de</strong>r Gewaltanwendung<br />
begrenzen.<br />
10. Im Staat hält sich die Regierung im Sinn <strong>de</strong>s Subsidiari<br />
tätsprinzips mit eigener Tätigkeit zurück, um das Handlungs<br />
vorrecht <strong>de</strong>s einzelnen nicht zu beschnei<strong>de</strong>n. Wenngleich die<br />
Regierung immer ein wenigstens allgemein gehaltenes Gesell<br />
schaftskonzept braucht, so ist sie doch darauf angewiesen, mit<br />
<strong>de</strong>r Konkretisierung <strong>de</strong>r Gemeinwohl<strong>de</strong>finition abzuwarten,<br />
bis sie um die Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Leistungswillen <strong>de</strong>r<br />
einzelnen weiß. Sie kann <strong>de</strong>n Konsens mit rechtlichen Mitteln<br />
nicht produzieren, son<strong>de</strong>rn höchstens weitsichtig moralisch sti<br />
mulieren. An<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>r Kirche. Hier ist <strong>de</strong>r Konsens durch das<br />
Lehramt vorbestimmt. Das vom kirchlichen Lehramt <strong>de</strong>finierte<br />
Gemeinwohl verpflichtet die Gläubigen zur Annahme. In <strong>de</strong>r<br />
Handlungsordnung wird das Subsidiaritätsprinzip insofern<br />
angewandt, als das kirchliche Lehramt <strong>de</strong>n Gläubigen die Initia<br />
tive in <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>s kirchlichen Lebens überläßt.<br />
4. DIE PHILOSOPHISCHE UND THEOLOGISCHE INTERPRETATION<br />
DES GEMEINWOHLBEGRIFFS DER KIRCHLICHEN SOZIALLEHRE<br />
Das Objekt <strong>de</strong>r Interpretation<br />
In <strong>de</strong>n päpstlichen Verlautbarungen fin<strong>de</strong>t man, wie öfters<br />
betont, keine Systematik <strong>de</strong>r Gemeinwohllehre. Allerdings<br />
wer<strong>de</strong>n alle dazu gehörigen Elemente aufgeführt. Doch darf<br />
man von <strong>de</strong>n Päpsten keinen systematischen Traktat erwarten,<br />
da alle päpstlichen Schreiben sich stets an einen bestimmten<br />
Kreis wen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> sich zu einem bestimmten Fragekomplex<br />
äußern. Eine eigentliche Gemeinwohltheorie müßte mit einer<br />
begrifflichen Analyse <strong>de</strong>ssen beginnen, was man immer <strong>und</strong><br />
überall mit <strong>de</strong>m Namen „Gemeinwohl" verbin<strong>de</strong>t. Es wür<strong>de</strong><br />
sich hierbei um eine allgemeine Bestimmung <strong>de</strong>s Begriffes<br />
Gemeinwohl han<strong>de</strong>ln, <strong>de</strong>r über <strong>de</strong>n Anwendungen auf Staat,<br />
Gruppe o<strong>de</strong>r Kirche steht. Auf dieser höchsten Ebene <strong>de</strong>r<br />
Abstraktion liegt die Unterscheidung in ein Gemeinwohl, das<br />
477
Exk. III an sich ein Einzelwohl ist, sich aber in mehreren fin<strong>de</strong>t, <strong>und</strong><br />
ein Gemeinwohl, das im wahren Sinn kollektiver Natur ist. Die<br />
kirchlichen Verlautbarungen streifen diese Seite <strong>de</strong>s Problems<br />
bei ihrer Ablehnung <strong>de</strong>r altliberalen Konzeption, gemäß <strong>de</strong>r das<br />
Gemeinwohl lediglich die Summe aller Einzelwohle ist. Die<br />
kirchliche Soziallehre betont stets die allen Einzelmenschen<br />
übergeordnete Stellung <strong>de</strong>s Gemeinwohls. Wie gezeigt wer<strong>de</strong>n<br />
wird, suchen alle Interpreten diese Überordnung zu retten,<br />
allerdings mit verschie<strong>de</strong>ner Begründung <strong>und</strong> verschie<strong>de</strong>nen<br />
erkenntnistheoretischen Voraussetzungen.<br />
Das Problem besteht nun darin, ob diese Überordnung<br />
apriorisch ist, so daß das Einzelwohl überhaupt nicht gedacht<br />
wer<strong>de</strong>n kann ohne Integration ins Gemeinwohl, o<strong>de</strong>r ob das<br />
Gemeinwohl nur aufgr<strong>und</strong> einer physischen Notwendigkeit<br />
gefor<strong>de</strong>rt ist, weil <strong>de</strong>r einzelne sein Wohl an<strong>de</strong>rs nicht fin<strong>de</strong>n<br />
wür<strong>de</strong>. Man könnte diesen Unterschied auch mit <strong>de</strong>r Frage<br />
kennzeichnen: Ist die Individualethik nur verständlich durch<br />
die Einordnung in eine umfassen<strong>de</strong> Sozialethik o<strong>de</strong>r ist die So<br />
zialethik ein Annex bzw. eine Erweiterung <strong>de</strong>r Individualethik<br />
aus <strong>de</strong>r Erkenntnis heraus, daß die volle Entfaltung <strong>de</strong>r indivi<br />
duellen Moral gesellschaftlicher Hilfe bedarf? Man könnte das<br />
Problem auch so formulieren: Ist das Gemeinwohl für je<strong>de</strong>s In<br />
dividuum ein a priori vorgegebener Wert, o<strong>de</strong>r schaffen die<br />
Menschen aufgr<strong>und</strong> ihrer Bedürftigkeit <strong>de</strong>n gemeinsamen<br />
Wert? Im ersten Fall (a priori vorgegebener Wert) wäre die<br />
Erkenntnis <strong>de</strong>r Bedürftigkeit <strong>de</strong>s Individuums nur eine Bestäti<br />
gung dafür, daß <strong>de</strong>r Mensch sich in die übergeordnete Norm<br />
integrieren soll, im zweiten Fall besteht das Gemeinwohl nur<br />
insofern zu <strong>Recht</strong>, als die Bedürftigkeit <strong>de</strong>s Menschen es erfor<br />
<strong>de</strong>rt. Im zweiten Fall müßte man, um zu einer echt universalen<br />
Norm zu kommen, empirisch nachweisen, daß je<strong>de</strong>s Indivi<br />
duum in je<strong>de</strong>r Hinsicht in allen Zeiten <strong>de</strong>r Mithilfe bedürftig ist.<br />
Die übergeordnete Norm bliebe aber in ihrem innersten Wesen<br />
eine individualethische Norm, weil immer entnommen aus<br />
einem individuellen Phänomen.<br />
Die Ansichten <strong>de</strong>r Interpreten gehen hauptsächlich bezüg<br />
lich <strong>de</strong>r Beantwortung <strong>de</strong>r Frage auseinan<strong>de</strong>r, welche menschli<br />
chen Werte in <strong>de</strong>m Gemeinwohlbegriff „kollektiviert" wer<strong>de</strong>n<br />
können. Man könnte meinen, diese Auseinan<strong>de</strong>rsetzung sei<br />
spitzfindig <strong>und</strong> von wenig praktischem Belang für die konkrete<br />
Bestimmung <strong>de</strong>r allgemeinen Wohlfahrt. Dennoch hat, was<br />
478
noch zu beweisen sein wird, diese theoretische Auseinan<strong>de</strong>rset<br />
zung Folgen für die Bewertung <strong>de</strong>r Maßnahmen, Bedingungen<br />
<strong>und</strong> Voraussetzungen <strong>de</strong>r Gemeinwohlverwirklichung in <strong>de</strong>r<br />
Handlungsordnung. Schon aus <strong>de</strong>m, was über die Familie <strong>und</strong><br />
die Kirche gesagt wor<strong>de</strong>n ist, vermag man leicht zu erkennen,<br />
daß es nicht einerlei ist, welche Werte man auf <strong>de</strong>r ersten Etappe<br />
in die Gemeinwohl<strong>de</strong>finition einsetzt.<br />
Bezüglich <strong>de</strong>r Definition <strong>de</strong>s Gemeinwohls gibt es unter <strong>de</strong>n<br />
katholischen Interpreten hauptsächlich drei systematische Be<br />
gründungen. Man kann diese mit <strong>de</strong>m Namen von drei Autoren<br />
benennen: Thomas von Aquin, Gustav G<strong>und</strong>lach S/<strong>und</strong> Johan<br />
nes Messner. Ob bewußt o<strong>de</strong>r unbewußt halten sich alle übrigen<br />
Interpreten an eine dieser drei Richtungen. 41<br />
a) Das Gemeinwohl bei Thomas von Aquin<br />
Thomas von Aquin hat keine systematische Darstellung sei<br />
ner Gemeinwohllehre geboten. Man muß seine verschie<strong>de</strong>nen<br />
Aussagen mit seiner gesamten Vorstellung <strong>de</strong>r Weltordnung, mit<br />
seiner Erklärung <strong>de</strong>s göttlichen Schöpferwillens, mit seiner<br />
Naturrechtslehre, beson<strong>de</strong>rs mit seiner Auffassung vom Verhält<br />
nis zwischen <strong>de</strong>r Wesensnatur <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Individuum, also seiner<br />
Erkenntnislehre in Verbindung bringen. Sonst versteht man ihn<br />
falsch. Der heute öfters unternommene Versuch, die Kantsche<br />
Freiheitsvorstellung in verschie<strong>de</strong>ne, aus <strong>de</strong>m großen Kontext<br />
gerissene Texte hineinzuinterpretieren, ist eine völlige Verken<br />
nung <strong>de</strong>r großen philosophischen <strong>und</strong> theologischen Zusam<br />
menhänge, in die Thomas seine einzelnen Traktate hineinge<br />
stellt hat.<br />
Das Verhältnis von menschlicher Wesensnatur <strong>und</strong> individu<br />
eller Natur fußt auf <strong>de</strong>r thomasischen Abstraktionslehre. Diese<br />
ist nicht, wie oft erklärt wird, einfach eine Übernahme <strong>de</strong>r ari<br />
stotelischen Erkenntnistheorie. Vielmehr grün<strong>de</strong>t sie in <strong>de</strong>r<br />
thomasischen Analyse <strong>de</strong>r Schöpfung. Gott kann in <strong>de</strong>r Schöp<br />
fung nur das Abbild seiner eigenen Vollkommenheit suchen.<br />
In <strong>de</strong>m Artikel „Johannes Messners Konzeption <strong>de</strong>r Sozialphilosophie" in:<br />
„Das Neue Naturrecht, Die Erneuerung <strong>de</strong>r Naturrechtslehre durch Johannes<br />
Messner", hsg. von A. Klose, H. Schambeck <strong>und</strong> R.Weiler, Berlin 1985,<br />
21—62, habe ich die Konzeption Messners im Vergleich zu Thomas von<br />
Aquin <strong>und</strong> G. G<strong>und</strong>lach dargestellt. Hier eine zusammenfassen<strong>de</strong> <strong>und</strong> zugleich<br />
ergänzen<strong>de</strong> Darstellung.<br />
479
Exk. III Um die Vollkommenheit <strong>de</strong>s Schöpfers auch nur an<strong>de</strong>utungs<br />
weise wi<strong>de</strong>rzuspiegeln, brauchte es eine Vielfalt von Wesen.<br />
Alle geschaffenen Wesen sind also durch die Schöpfung in einer<br />
Einheit o<strong>de</strong>r, wie Thomas sagt, in einem Gemeinwohl kollektiv<br />
verb<strong>und</strong>en. Dieses Gemeinwohl ist Gott, <strong>de</strong>ssen Vollkommen<br />
heit alle Wesen darstellen sollen. Gott ist das Ziel aller<br />
Geschöpfe. Diese Finalisierung drückt Thomas dadurch aus,<br />
daß er sagt: „ein einzelnes Wesen liebt sein eigenes Wohl um <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls <strong>de</strong>s gesamten Alls willen, das Gott ist. 42<br />
Man darf sich diese Weltsicht nicht pantheistisch vorstellen.<br />
Gott bleibt <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Welt getrennte Schöpfer. Alle Kreaturen<br />
„streben" als Verursachte zu ihm als ihrer Ursache <strong>und</strong> ihrem<br />
Erhalter. Dieses Streben ist ontologisch, d. h. im Sein zu sehen<br />
im Sinn <strong>de</strong>r immanenten Relation <strong>de</strong>s geschaffenen Seins zum<br />
ungeschaffenen <strong>und</strong> allverursachen<strong>de</strong>n. Unter diesem Ge<br />
sichtspunkt ist Gott das gemeinsame Wohl aller Kreaturen. Er<br />
ist aber weiterhin das <strong>de</strong>r Welt immanente Gemeinwohl, inso<br />
fern er sich im Gesamt <strong>de</strong>r Schöpfung abgebil<strong>de</strong>t hat, so daß<br />
je<strong>de</strong>s Geschöpf einen Teil <strong>de</strong>r göttlich gewollten Ordnung dar<br />
stellt. Das ist keine Mystik. Es han<strong>de</strong>lt sich auch nicht um eine<br />
neue Version <strong>de</strong>r Hierarchie <strong>de</strong>r Kräfte nach <strong>de</strong>r Darstellung<br />
<strong>de</strong>s Pseudo-Dionysius Areopagita, so sehr Thomasdiese gekannt<br />
<strong>und</strong> auch geschätzt hat. Vielmehr analysiert Thomas <strong>de</strong>n Vor<br />
gang <strong>de</strong>s göttlichen Schöpfungsaktes, <strong>de</strong>r nicht einzig in einem<br />
Wollen sich vollzog, son<strong>de</strong>rn von einer I<strong>de</strong>e geleitet sein mußte.<br />
An<strong>de</strong>rs kann man sich das Wirken Gottes als eines persönlichen<br />
Wesens nicht vorstellen. Man muß darum bei <strong>de</strong>r Vielfalt <strong>de</strong>r<br />
Geschöpfe einen einsichtigen Gr<strong>und</strong> dafür fin<strong>de</strong>n, daß alle<br />
Geschöpfe notwendigerweise ihr Ziel in <strong>de</strong>m absoluten Wesen<br />
Gott haben. Diese Überlegungen sind nicht übernatürlicher<br />
Art. Sie gehören zur rationalen Theodizee. Gemäß <strong>de</strong>r kirchli<br />
chen Lehre ist die Vernunft befähigt, Gottes Existenz aus <strong>de</strong>r<br />
Schöpfung zu erkennen. Thomas hat <strong>de</strong>n Ansatz seiner<br />
Gemeinwohl<strong>de</strong>finition in <strong>de</strong>m rational erkennbaren Verhältnis<br />
<strong>de</strong>s Schöpfers zur Schöpfung gef<strong>und</strong>en. Dieser Ansatz ist<br />
be<strong>de</strong>utsam, weil er <strong>de</strong>n Sachverhalt, <strong>de</strong>r zur Existenz <strong>de</strong>s ersten<br />
<strong>und</strong> obersten Gemeinwohls führt, ins Blickfeld rückt.<br />
4 2 S.Theol. I—II 109,3. Die verschie<strong>de</strong>nen Thomastexte zum Gemeinwohl sind<br />
von A. P. Verpaalen gesammelt wor<strong>de</strong>n. Ich habe diese Sammlung als Anhang<br />
II in <strong>de</strong>n ersten Band <strong>de</strong>r Sozialethik aufgenommen. Der hier zitierte Text<br />
befin<strong>de</strong>t sich daselbst unter Nr. 284.<br />
480
Auch die Menschen untereinan<strong>de</strong>r sind durch ein Gemein- Exk. III<br />
wohl verb<strong>und</strong>en. Auch hier wird das Sein <strong>de</strong>s Menschen ins<br />
Auge gefaßt. Thomas fragt sich, warum es nötig war, das Wesen<br />
<strong>de</strong>s Menschen in solcher Vielfalt zu schaffen. Während <strong>de</strong>r reine<br />
Geist, in <strong>de</strong>r Theologie als Engel bezeichnet, für sich eine spezi<br />
fische Einheit darstellt, kann <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>r Materie verb<strong>und</strong>ene<br />
Geist, <strong>de</strong>r einzelne Mensch, nicht als „species", son<strong>de</strong>rn in<br />
gewissem Sinn nur als Träger <strong>de</strong>r spezifischen Natur, genauer<br />
formuliert, als konkretisierter Teilhaber <strong>de</strong>r Species bezeichnet<br />
wer<strong>de</strong>n. Um die Species, d. h. die Wesensnatur <strong>de</strong>s Menschen<br />
zum Ausdruck zu bringen, braucht es eine Vielfalt von Einzel<br />
menschen, die zusammen in gemeinsamer körperlicher <strong>und</strong><br />
geistiger Tätigkeit das zur Entfaltung bringen, was an Potentia-<br />
lität in <strong>de</strong>r Wesensnatur <strong>de</strong>s Menschen gr<strong>und</strong>gelegt ist. Nur auf<br />
diese ontologische Weise ist <strong>de</strong>r Nachweis zu erbringen, daß <strong>de</strong>r<br />
Mensch wesentlich sozial ist, so daß es für alle Zeiten ausge<br />
schlossen ist, daß jemals ein Mensch nicht sozial wäre. Wenn<br />
man einzig von <strong>de</strong>r empirisch feststellbaren Bedürftigkeit <strong>de</strong>s<br />
einzelnen Menschen ausgeht, ist nicht einzusehen, warum <strong>de</strong>r<br />
Mensch sich nicht zum solitären Wesen entwickeln könnte.<br />
Thomas selbst kommt verschie<strong>de</strong>ntlich auf die Hilfsbedürftig<br />
keit <strong>und</strong> auch auf die <strong>de</strong>m Nächsten zugewandte Geselligkeit<br />
zu sprechen, um zu zeigen, daß <strong>de</strong>r Mensch sozial ist. Aber<br />
dieser Beweis verhält sich zu <strong>de</strong>m ontologischen Beweis wie<br />
eine empirische Bestätigung einer metaphysisch gewonnenen<br />
Erkenntnis.<br />
Von diesem Blickpunkt aus wird einsichtig, warum die<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit die e<strong>de</strong>lste aller sittlichen Tugen<strong>de</strong>n<br />
ist, d. h. warum die Sozialethik die Individualethik in sich be<br />
greift <strong>und</strong> nicht umgekehrt. Und auch nur so wird verständlich,<br />
warum das Gemeinwohl die höchste Norm auch für die Betäti<br />
gung <strong>de</strong>r Freiheit ist. Die Autonomie ist ein Stück <strong>de</strong>s Gemein<br />
wohls, sie ist <strong>de</strong>m Gemeinwohl nicht vorgeordnet, son<strong>de</strong>rn in<br />
ihm enthalten. Jedoch ist sie <strong>de</strong>r Gesellschaft vorgeordnet, weil<br />
diese an die Wertfülle <strong>de</strong>s Gemeinwohls geb<strong>und</strong>en ist. Thomas<br />
von Aquin hat das Verdienst, <strong>de</strong>n aristotelischen Begriff <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls präzisiert zu haben als vorgesellschaftliches<br />
Objekt.<br />
Die thomasische Sicht <strong>de</strong>s Gemeinwohlproblems erhärtet<br />
jene Aussagen <strong>de</strong>r Päpste — <strong>und</strong> es han<strong>de</strong>lt sich hierbei um die<br />
ganze Tradition —, daß das Gemeinwohl, soweit es aus <strong>de</strong>r<br />
481
Exk. III menschlischen Natur bestimmt wer<strong>de</strong>n kann, göttlicher Institu<br />
tion ist. Es wird aus ihr auch klar ersichtlich, daß die letztgültige<br />
Verantwortung <strong>de</strong>r staatlichen Autorität ihre legislative Kraft<br />
göttlicher Einsetzung verdankt. Die Logik <strong>de</strong>r thomasischen<br />
Ableitung <strong>de</strong>s Gemeinwohlbegriffes ist klar <strong>und</strong> für <strong>de</strong>njenigen,<br />
<strong>de</strong>r die Lehre von Gott, <strong>de</strong>m Schöpfer, als rationale Erkenntnis<br />
annimmt, unbestreitbar. Allerdings fin<strong>de</strong>t diese Logik bei <strong>de</strong>n<br />
mo<strong>de</strong>rnen Philosophen keinen Anklang mehr. Einen Christen<br />
dürfte dies jedoch weiter nicht stören. Aus lehrpädagogischem<br />
Gr<strong>und</strong> wäre es wünschenswert, eine Ableitung dieser Gemein<br />
wohlkonzeption zu fin<strong>de</strong>n, die auch von nicht katholisch <strong>de</strong>n<br />
ken<strong>de</strong>n Philosophen mit Sympathie aufgenommen wür<strong>de</strong>.<br />
Johannes Messner hat diesen Weg zu gehen versucht, wovon<br />
noch die Re<strong>de</strong> sein wird.<br />
Die mit allen menschlichen Werten befrachtete thomasische<br />
Gemeinwohli<strong>de</strong>e hat zwar ihre Be<strong>de</strong>utung für die Bestimmung<br />
<strong>de</strong>r allgemeinen Wohlfahrt, sie ist aber noch nicht praxisnahe<br />
genug. Damit stehen wir vor <strong>de</strong>r Frage, in welcher Weise diese<br />
I<strong>de</strong>e in <strong>de</strong>r Handlungsordnung verwirklicht wer<strong>de</strong>n soll. Es<br />
genügt nicht, auf die Pflicht eines je<strong>de</strong>n Menschen gegenüber<br />
<strong>de</strong>m Gemeinwohl zu pochen, ohne die gesellschaftlichen Ord<br />
nungsregeln darzustellen, durch welche die moralische Pflicht<br />
aller konkret motiviert <strong>und</strong> damit gesellschaftlich effizient wird.<br />
Auch hierüber hat sich Thomas von Aquin Gedanken gemacht.<br />
Auf politischer Ebene war er zwar <strong>de</strong>r Ansicht, daß eine Auftei<br />
lung <strong>de</strong>r Macht <strong>de</strong>n Einheitscharakter <strong>de</strong>s Gemeinwohls<br />
gefähr<strong>de</strong>n könnte, so daß er hier, in Entsprechung zum einen<br />
Schöpfer auch in <strong>de</strong>r staatlichen Gemeinschaft einen einzigen<br />
Träger <strong>de</strong>r Gewalt sehen wollte. Für die damalige christliche<br />
Welt war dies <strong>de</strong>r nächstliegen<strong>de</strong> Gedanke, zumal die Fürsten<br />
noch an <strong>de</strong>n einen Inhaber <strong>de</strong>r kirchlichen Gewalt moralisch<br />
geb<strong>und</strong>en waren. Der Schluß aus <strong>de</strong>m Monotheismus auf die<br />
Monarchie ist aber für Thomas nicht unausweichlich, wie<br />
mo<strong>de</strong>rne Interpreten <strong>de</strong>r thomasischen Befürwortung <strong>de</strong>r<br />
Monarchie meinen. Thomas geht es einzig um die sichere Wah<br />
rung <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>s Gemeinwohlbegriffes. Diese Einheit ist,<br />
wie wir aus Erfahrung wissen, auch in <strong>de</strong>r Demokratie möglich,<br />
vorausgesetzt allerdings — <strong>und</strong> das ist für uns Mo<strong>de</strong>rne das<br />
Gr<strong>und</strong>problem —, daß noch ein Konsens bezüglich <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong><br />
werte garantiert ist. Auf wirtschaftlichem Gebiet hat aber Tho<br />
mas entgegen seiner Stellungnahme auf politischer Ebene eine<br />
482
ausgesprochen pluralistische Gewaltverteilung als die <strong>de</strong>m<br />
Gemeinwohl einträglichere, effizientere Verwirklichung gese<br />
hen gegenüber einer autoritären Planung. In <strong>de</strong>r gesellschaftli<br />
chen Ordnung <strong>de</strong>nkt Thomas ebenso pluralistisch, wie seine<br />
Äußerungen über Ehe <strong>und</strong> Familie dartun.<br />
Der Pluralismus auf <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Ebene wird von<br />
Thomas durch die Befürwortung <strong>de</strong>r privaten Eigentumsord<br />
nung begrün<strong>de</strong>t. Beachtenswert ist, daß Thomas das <strong>Recht</strong> auf<br />
privates Eigentum nicht unmittelbar mit <strong>de</strong>r Person verbin<strong>de</strong>t,<br />
son<strong>de</strong>rn konsequent aus <strong>de</strong>m von Gott gesetzten letzten Zweck<br />
<strong>de</strong>r materiellen Güter ableitet. Unter Voraussetzung <strong>de</strong>r durch<br />
die gesamte christliche Tradition festgehaltenen Lehre, daß die<br />
materielle Welt allen Menschen nützen soll, fragt er sich, in wel<br />
cher Art <strong>und</strong> Weise diese göttliche Anordnung am effizientesten<br />
erfüllt wer<strong>de</strong>n könne". Im Hinblick auf die empirisch allgemein<br />
gültige <strong>und</strong> durch die Lehre von <strong>de</strong>r Erbsün<strong>de</strong> erhärtete Fest<br />
stellung, daß <strong>de</strong>r Mensch für die sorgfältige, d. h. wirtschaftliche<br />
N<strong>utz</strong>ung leichter aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Selbstinteresses als aufgr<strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>s an sich werthöheren Gemeininteresses motiviert ist, spricht<br />
er sich, die Ansicht <strong>de</strong>s Aristoteles aufnehmend, für die private<br />
Verwaltung <strong>de</strong>r Güter aus. Um <strong>de</strong>r Gemeinwohlfor<strong>de</strong>rung ge<br />
genüber gerecht zu bleiben, wird <strong>de</strong>r private Eigentümer sozial<br />
belastet, d. h. verpflichtet, das, was er nicht braucht, <strong>de</strong>m Näch<br />
sten abzugeben. Thomas sieht in dieser Pflicht eine echte<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>spflicht. Der Gedanke <strong>de</strong>r sozialen Belastung <strong>de</strong>r<br />
Person wird <strong>de</strong>mnach erst auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Handlungsnormen<br />
geweckt. Auf <strong>de</strong>r obersten Ebene, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Werte, kann man<br />
gemäß Thomas noch nicht von „Belastung" sprechen, weil dort<br />
die Person nicht nur sozial „belastet" ist, son<strong>de</strong>rn in ihrer Natur<br />
sozial ist. Da in <strong>de</strong>n päpstlichen Verlautbarungen <strong>de</strong>rBegriff <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls vornehmlich im Bereich <strong>de</strong>r Handlungsordnung<br />
gebraucht wird, sprechen sie immer nur von sozialer Belastung.<br />
Und da auch die Person in <strong>de</strong>n päpstlichen Äußerungen immer<br />
im Kontext <strong>de</strong>r Gesellschaft, also <strong>de</strong>r zur Verwirklichung <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls <strong>und</strong> <strong>de</strong>s darin eingeschlossenen Einzelwohls<br />
notwendigen Institution, gesehen wird, wird sie unmittelbar<br />
mit <strong>de</strong>m <strong>Recht</strong> auf Privateigentum verb<strong>und</strong>en. Diese Ver<br />
mischung <strong>de</strong>r zwei Ordnungen (<strong>de</strong>r Werte <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Verwirkli<br />
chung) führte in „Laborem exercens" sogar dazu, daß Johannes<br />
Paul II. <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Thomastext in <strong>de</strong>r Weise auslegte,<br />
als ob Thomas unvermittelt die Person als <strong>Recht</strong>sträger von<br />
483
Exk. III Eigentum angesehen hätte. 43 Es ist nicht ausgeschlossen, daß<br />
in <strong>de</strong>r wesentlichen Verknüpfung von Person <strong>und</strong> Eigentum <strong>de</strong>r<br />
Einfluß von /. Locke wirksam war. Nachweislich hat das ratio<br />
nalistische Naturrecht über L. Taparelli d'Azeglio SJ Eingang in<br />
die katholische Soziallehre gef<strong>und</strong>en.<br />
Durch <strong>de</strong>n Nachweis <strong>de</strong>r privaten Eigentumsordnugn als <strong>de</strong>r<br />
einzigen <strong>de</strong>m Gemeinwohl gerecht wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Wirtschaftsord<br />
nung erhält gemäß <strong>de</strong>r dargelegten thomasischen Doktrin die<br />
einzelne Person mit ihrer moralischen Verantwortung das<br />
<strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Priorität im wirtschaftlichen Han<strong>de</strong>ln vor aller Inter<br />
vention vonseiten <strong>de</strong>r staatlichen Gewalt. Hier wird die strin-<br />
gent juristische Form <strong>de</strong>s Subsidiaritätsprinzips, wenn auch<br />
nicht ausdrücklich von Thomas so benannt, sichtbar.<br />
Zusammenfassung<br />
Vergleicht man die thomistische Konzeption <strong>de</strong>s Gemein<br />
wohls mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r päpstlichen Verlautbarungen, dann fin<strong>de</strong>t<br />
man leicht die völlige doktrinäre Deckung bei<strong>de</strong>r. Das kann<br />
nicht verw<strong>und</strong>ern, da die ersten groß angelegten Staatsenzykli<br />
ken wie auch die erste Sozialenzyklika (Rerum novarum) von<br />
einem überragen<strong>de</strong>n Kenner <strong>de</strong>r Werke <strong>de</strong>s hl. Thomas von<br />
Aquin verfaßt wur<strong>de</strong>n: Leo XIII. Da LeoXIII. die Gemeinwohl<br />
frage im Hinblick auf <strong>de</strong>n Staat, <strong>und</strong> zwar auf die konkrete<br />
Situation im Auge hatte, steht selbstverständlich die Handlungs<br />
ordnung im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Blickfel<strong>de</strong>s. Dies je<strong>de</strong>nfalls <strong>de</strong>ut<br />
lich in „Rerum novarum" hinsichtlich <strong>de</strong>r Eigentumsfrage.<br />
Dagegen lassen die staatsphilosophischen Enzykliken Leos<br />
XIII. die thomistische Systematik <strong>de</strong>utlicher hervortreten. Die<br />
Wertfülle <strong>de</strong>s Gemeinwohls, in <strong>de</strong>r auch die menschliche Person<br />
mit ihrer Freiheit <strong>und</strong> allen sittlichen Pflichten enthalten sind, ist<br />
in <strong>de</strong>n päpstlichen Texten in gleicher Weise <strong>de</strong>finiert wie bei<br />
Thomas von Aquin. Das gleiche gilt von <strong>de</strong>r Ableitung <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls aus göttlicher Institution.<br />
Die Logik, <strong>de</strong>r Thomas folgt, zeigt <strong>de</strong>utlich die Spuren <strong>de</strong>s in<br />
seiner gesamten Theologie wirksamen Prinzips „gratia suppo-<br />
nit naturam" — die Gna<strong>de</strong> setzt die Natur voraus —. Wenn das<br />
484<br />
Vgl. meinen Kommentar zu „Laborem exercens" in: Ethische <strong>und</strong> soziale<br />
Existenz, Gesammelte Aufsätze aus Ethik <strong>und</strong> Sozialphilosophie, Inst. f.<br />
Gesellschaftswissenschaften Walberberg, Bonn 1983, 358 f.
natürliche Gemeinwohl, wie es sich aus <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Natur ergibt, nicht alle sittlichen Werte in sich begreifen könnte,<br />
dann müßte man auch für das übernatürliche Gemeinwohl,<br />
nämlich das <strong>de</strong>r Kirche, eine merkliche Begrenzung in Betracht<br />
ziehen. Wie Pius XI. gesagt hat, ist die Kirche eine totalitäre<br />
Gesellschaft. Nichts, auch nicht das Personalste steht außerhalb<br />
<strong>de</strong>s Gemeinwohls dieser Gemeinschaft. Dieses Gemeinwohl ist<br />
die oberste <strong>und</strong> umfassendste Integrationsnorm <strong>de</strong>s menschli<br />
chen Daseins. Jedwe<strong>de</strong> göttliche Berufung geht über die Kirche.<br />
Es gibt keine von <strong>de</strong>r Kirche getrennte Berufung. Diese gött<br />
liche Berufung wen<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong> zwar an <strong>de</strong>n einzelnen,<br />
aber stets an <strong>de</strong>n einzelnen, insofern er Glied <strong>de</strong>r Kirche ist, ge<br />
nauso wie die Erlösung durch Christus die Erlösung <strong>de</strong>r<br />
Menschheit sein wollte <strong>und</strong> über diese <strong>de</strong>s einzelnen. Es kann<br />
also keiner erklären, er sei um seiner selbst willen erlöst. Gewiß,<br />
er mag es behaupten, aber nicht ohne zugleich an die an<strong>de</strong>ren<br />
zu <strong>de</strong>nken, die mit ihm „in corpore" erlöst wor<strong>de</strong>n sind. Tho<br />
mas hat dies in <strong>de</strong>r Weise ausgedrückt, daß er erklärte, die Erlö<br />
sung bezöge sich zunächst auf die Natur <strong>de</strong>s Menschen <strong>und</strong><br />
über sie auf das Individuum. Unverkennbar ist hier die Be<strong>de</strong>u<br />
tung <strong>de</strong>s Gemeinwohls in <strong>de</strong>r gesamten Moral, sowohl in <strong>de</strong>r<br />
Natur wie in <strong>de</strong>r Übernatur. Der thomasische Gemeinwohlbe<br />
griff ist somit auf jedwe<strong>de</strong> natürliche wie auch übernatürliche<br />
Gemeinschaft anwendbar. Das ist ein Zeichen seiner überra<br />
gen<strong>de</strong>n systematischen Brauchbarkeit.<br />
Je<strong>de</strong> Gesellschaft hat ihr Gemeinwohl, ihre eigene personen<br />
bezogene kollektive Wertordnung: die Ehe, die Familie, <strong>de</strong>r<br />
Staat <strong>und</strong> die Kirche.<br />
Die Handlungsordnung wird jeweils bestimmt entsprechend<br />
<strong>de</strong>r realen Ausstattung <strong>de</strong>r zum Gemeinwohl gehören<strong>de</strong>n Au<br />
torität, an<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>r Ehe, an<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>r Familie, an<strong>de</strong>rs im Staat<br />
<strong>und</strong> an<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>r Kirche. Die besagte „Ausstattung" wird<br />
bestimmt entsprechend <strong>de</strong>m Wissen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r realen Wirkkraft<br />
<strong>de</strong>s Trägers <strong>de</strong>r Autorität. Und entsprechend erhält auch das<br />
Subsidiaritätsprinzip seine eigene Spezialisierung.<br />
Überschaut man <strong>de</strong>n logischen Verlauf dieser Gemeinwohl<br />
konzeption, dann kann man ihr das Prädikat einer perfekten,<br />
konsistenten Systematik nicht versagen. Darauf kommt es<br />
sowohl philosophisch wie theologisch an. Und danach sind<br />
auch die an<strong>de</strong>ren Konzeptionen zu beurteilen.<br />
485
) Das Gemeinwohl im Solidarismus von G. G<strong>und</strong>lach<br />
Der Thomismus beginnt die Gesellschaftslehre beim<br />
Gemeinwohl, das aus <strong>de</strong>r individual-sozialen Natur <strong>de</strong>s Men<br />
schen folgt. Erst von hier aus wird die kausale, d. h. die Hand<br />
lungsordnung angegangen. Der Solidarismus von G. G<strong>und</strong>lach<br />
beginnt bei <strong>de</strong>r han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Person, <strong>de</strong>ren Intention <strong>und</strong> Zielbe<br />
stimmung. Die Person, die ihre Vollkommenheit erstrebt,<br />
erkennt ihre eigene Beschränktheit, ihre Hilfsbedürftigkeit. Sie<br />
braucht <strong>de</strong>n Mitmenschen, um jene Lücken auszufüllen, die bei<br />
isoliertem Han<strong>de</strong>ln immer bleiben wer<strong>de</strong>n. Von diesem kausa<br />
len Ansatz aus ist alle Gesellschaftlichkeit <strong>und</strong> <strong>de</strong>mentspre<br />
chend auch das Gemeinwohl zu sehen. Die Person ist „Quell<br />
<strong>und</strong> Ziel gesellschaftlichen Lebens". 44 Selbstverständlich ver<br />
steht G. G<strong>und</strong>lach das Wollen <strong>de</strong>s Mensch nicht im Sinn von<br />
Willkür. Das Menschenbild, das er zugr<strong>und</strong>e legt, ist nicht das<br />
<strong>de</strong>s Utilitarismus. Vielmehr sieht er die Person in ihrer meta<br />
physisch-naturhaften Ausrichtung auf das Lebensziel. Aber es<br />
ist immer die Einzelperson, die im Blickfeld steht, eben die Per<br />
son, die han<strong>de</strong>lt. Aus <strong>de</strong>r Erkenntnis <strong>de</strong>r Ergänzungsbedürftig<br />
keit vereinigen sich die Menschen zur Gesellschaft. Die Gesell<br />
schaft kommt nur durch das solidarische Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r Personen<br />
zustan<strong>de</strong>. Das Soziale ist das „eine in <strong>de</strong>n Mehreren", „nicht zu<br />
erst ihre (<strong>de</strong>r Person, A. F. U.) Integration in einem Ganzen, son<br />
<strong>de</strong>rn ihre innerlich begrün<strong>de</strong>te, personale Ko-Existenz, nämlich<br />
das in <strong>de</strong>r endlich-unendlichen Intentionalität menschlicher<br />
Person begrün<strong>de</strong>te Zueinan<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Gegenüber von Mehreren,<br />
das sie auf gegenseitige Mitteilung einstellt innerhalb <strong>de</strong>r durch<br />
das Menschsein (humanitas) <strong>und</strong> seine Wertfülle abgesteckten<br />
Dimension personaler Selbstverwirklichung". 45 Aus <strong>de</strong>r im<br />
Sein aller Menschen begrün<strong>de</strong>ten Ergänzungsbedürftigkeit<br />
ergibt sich somit die personale Koexistenz <strong>und</strong> daraus die Not<br />
wendigkeit einer Organisation <strong>de</strong>r Gesellschaft auf die Person<br />
hin. Der innere Aufbau <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaftlichkeit<br />
von <strong>de</strong>r Person her <strong>und</strong> auf die Person hin, mit an<strong>de</strong>ren Worten:<br />
die gesellschaftlich verwirklichbare Wertwelt <strong>de</strong>r Person, wird<br />
als Gemeingut, die Verwirklichung <strong>de</strong>s Gemeinguts als<br />
Gemeinwohl bezeichnet. 46 Zusammenfassend erklärt<br />
G. G<strong>und</strong>lach, Staatslexikon, 6. Aufl. 3. Bd., Sp.737.<br />
G. G<strong>und</strong>lach, a. a.O., 7. Bd., Sp.342. Hervorhebung von mir.<br />
Vgl. G. G<strong>und</strong>lach, a. a. O., 3. Bd., Sp. 737.<br />
486
G. G<strong>und</strong>lach: „Die seins- <strong>und</strong> wertmäßige Begründung <strong>de</strong>s<br />
Gemeinwohls beruht auf <strong>de</strong>m inneren <strong>und</strong> äußeren Aufbau <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft. Das Gemeinwohl als Zustand ergibt sich also,<br />
wenn die Gesellschaft <strong>de</strong>r innerlich notwendigen For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s<br />
Gemeinguts nach seiner dauern<strong>de</strong>n Verwirklichung im äuße<br />
ren, organisierten <strong>und</strong> organisieren<strong>de</strong>n Aufbau <strong>de</strong>r menschli<br />
chen Gesellschaftlichkeit entspricht. Wenn das Gesamt aller auf<br />
jene For<strong>de</strong>rung <strong>und</strong> ihre Erfüllung unmittelbar zielen<strong>de</strong>n orga<br />
nisieren<strong>de</strong>n Einrichtungen <strong>und</strong> Maßnahmen betrachtet wird,<br />
erfaßt man das Gemeinwohl im Vollzug. Diese unmittelbare<br />
Begründung <strong>de</strong>s Gemeinwohls im inneren <strong>und</strong> äußeren Aufbau<br />
menschlicher Gesellschaftlichkeit hebt es <strong>de</strong>utlich <strong>und</strong> wesent<br />
lich vom Privatwohl ab, ob man dies nun auf einzelne o<strong>de</strong>r auf<br />
Gruppen bezieht". 47<br />
Die Bemerkung, das Soziale sei nicht zuerst die Integration<br />
<strong>de</strong>r Person in einem Ganzen (vgl. zitierten Text), beweist, daß<br />
das „Gemeingut" nicht das Gleiche sein kann wie das „Gemein<br />
wohl" in <strong>de</strong>r thomistischen Gemeinwohlkonzeption. Der<br />
Gedankengang, <strong>de</strong>n G. G<strong>und</strong>lach verfolgt, ist unter seiner Vor<br />
aussetzung logisch. Die Personen erkennen in <strong>de</strong>r gesellschaftli<br />
chen Organisation das Mittel, das allen zur eigenpersönlichen<br />
Vollkommenheit verhilft. Der Zweck <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Ko<br />
operation ist <strong>de</strong>mnach die Vervollkommnung eines je<strong>de</strong>n Ko<br />
operieren<strong>de</strong>n. Dieser Zweck ist <strong>de</strong>r Selbstwert, um <strong>de</strong>ssentwil-<br />
len sich die Glie<strong>de</strong>r verb<strong>und</strong>en haben. Er ist aber nicht wie im<br />
thomistischen Denken die apriorische Norm, in <strong>de</strong>r die einzel<br />
nen Personen Teile eines Ganzen sind. O. v. Nell-Breuning for<br />
muliert diesen Gedankengang, in<strong>de</strong>m er erklärt, das Gemein<br />
wohl sei „genau das, um <strong>de</strong>ssentwillen die einzelnen sich zu<br />
diesem Ganzen verb<strong>und</strong>en haben, mit an<strong>de</strong>ren Worten, <strong>de</strong>r<br />
Zweck o<strong>de</strong>r das Ziel, wozu o<strong>de</strong>r wofür das betreffen<strong>de</strong> gesell<br />
schaftliche Gebil<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Gemeinwesen besteht; das so verstan<br />
<strong>de</strong>ne Gemeinwohl wird um seiner selbst willen erstrebt, ist ein<br />
<strong>de</strong>utig ein Selbstwext. Manche sprechen, um <strong>de</strong>utlich zu<br />
machen, daß sie dies meinen, statt von Gemeinwohl von<br />
Gemeingut". 48 Der Selbstzweck <strong>de</strong>r Gesellschaft entsteht, wie<br />
4 7 A.a.O.,3.Bd., Sp.737. Vgl. auch die von A. Rauscher herausgegebenen zwei<br />
Bän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Schriften G.G<strong>und</strong>lachs: Die Ordnung <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft,<br />
Köln 1964.<br />
4 8 <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> Freiheit, Gr<strong>und</strong>züge katholischer Soziallehre, Wien 1980,<br />
35.<br />
487
Exk. III man <strong>de</strong>utlich sieht, aus <strong>de</strong>m gemeinsamen Wollen, durch das<br />
sich die Gesellschaftsglie<strong>de</strong>r verbin<strong>de</strong>n. Diese kausale Sicht un<br />
terschei<strong>de</strong>t sich gr<strong>und</strong>sätzlich von <strong>de</strong>r ethischen <strong>de</strong>r thomisti-<br />
schen Konzeption. Ethische Normen sind vor <strong>de</strong>m Wollen, sie<br />
bestimmen das Wollen o<strong>de</strong>r sollen es bestimmen. Der Selbst<br />
zweck <strong>de</strong>r Gesellschaft ist aber bei v. Nell-Breuning, wenn man<br />
seine Ausführung logisch versteht, aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>r Personen<br />
ein Dienstwert. In <strong>de</strong>r Tat steht auch gemäß thomistischer Sicht<br />
die Gesellschaft im Dienst <strong>de</strong>r Personen, aber aufgr<strong>und</strong> einer<br />
ganz an<strong>de</strong>ren Logik. Die Gesellschaft hat hierbei ein eigenes<br />
ethisches Objekt (das Gemeinwohl als Wert), das im Hinblick<br />
auf die Personen nicht als Dienstwert bezeichnet wer<strong>de</strong>n kann,<br />
weil dieses Objekt zunächst eine Integrationsnorm <strong>de</strong>r Perso<br />
nen darstellt <strong>und</strong> erst von hier aus auf die individuelle Absicht<br />
<strong>de</strong>r Person trifft. Wie bereits dargestellt, sprechen die kirchli<br />
chen Verlautbarungen meistens im Sinn <strong>de</strong>r Gesellschaft als<br />
Organisation gemeinsamen menschlichen Han<strong>de</strong>lns. In dieser<br />
Hinsicht stimmt es, was O. v. Nell-Breuning<br />
4 9 sagt: „In kirchli<br />
chen Verlautbarungen meint,Gemeinwohl' in <strong>de</strong>r Regel als ter-<br />
minus technicus <strong>de</strong>n Dienstwert <strong>und</strong> wird in diesem Sinn<br />
manchmal sogar eigens <strong>de</strong>finiert als <strong>de</strong>r Inbegriff alles <strong>de</strong>ssen,<br />
was an Vorbedingungen o<strong>de</strong>r Voraussetzungen erfüllt sein<br />
muß, damit <strong>de</strong>r einzelne durch Regen seiner eigenen Kräfte sein<br />
eigenes Wohl verwirklichen kann". Es stimmt aber nicht mehr,<br />
wenn O. v. Nell-Breuning fortfährt: „Den Dienstwert Gemein<br />
wohl' meinen im allgemeinen auch die Autoren, die <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft Jesu angehören, während die Angehörigen <strong>de</strong>s<br />
Dominikaneror<strong>de</strong>ns, wenn sie von ,Gemeinwohl' sprechen,<br />
vorwiegend an das Gemeinwohl als Selbstwert <strong>de</strong>nken". 50 Ich<br />
weiß nicht, welche Dominikaner gemeint sind. Je<strong>de</strong>nfalls ist<br />
diese Interpretation <strong>de</strong>r kirchlichen Lehre nicht die authen<br />
tische. Wenn man sich das über das Gemeinwohl <strong>de</strong>r Kirche<br />
Gesagte vor Augen hält, dann erkennt man unzweifelhaft, daß<br />
das Gemeinwohl ein vorgesellschaftlicher Wert ist, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r<br />
ersten Intention Gottes eine Integrationsnorm <strong>de</strong>r Personen<br />
be<strong>de</strong>utet. Dies gilt nicht nur vom Gemeinwohl <strong>de</strong>r Kirche, son<br />
<strong>de</strong>rn auch für alle in <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s Menschen gr<strong>und</strong>gelegten<br />
<strong>und</strong> aus ihr gefor<strong>de</strong>rten Gemeinschaften (Ehe, Familie, Staat).<br />
488<br />
A.a.O., 35f.<br />
A.a.O.,36.
Das hat mit Kollektivismus nichts zu tun, sofern man die Ana- Exk. III<br />
logie zur Kenntnis nimmt, die im Gemeinwohlbegriff liegt: pro<br />
portionale Einglie<strong>de</strong>rung je<strong>de</strong>r Person in das Gesamt, wobei<br />
selbstverständlich die Personwür<strong>de</strong> eines je<strong>de</strong>n Glie<strong>de</strong>s ihre<br />
volle Achtung erfährt.<br />
Die kausal orientierte Definition <strong>de</strong>s Gemeinwohls als<br />
Gemeingut im angeführten Sinn, hat ihre eigene Be<strong>de</strong>utung, die<br />
bei aller Kritik nicht unterschätzt wer<strong>de</strong>n darf. Die thomistische<br />
Ganzheitssicht könnte leicht im Sinn <strong>de</strong>s objektiven Geistes<br />
Hegels verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Noch schlimmer wäre es, die Paral<br />
lele zum Marxschen Totalitarismus herzustellen. Die thomi<br />
stische Version entstammt <strong>de</strong>m Ordnungs<strong>de</strong>nken, die G<strong>und</strong>-<br />
lachsche dagegen <strong>de</strong>m rationalistischen Naturrecht wie ähnlich<br />
die Menschenrechtserklärung <strong>de</strong>r UNO. Die thomistische<br />
Denkweise muß an einem Punkt, nämlich dort, wo die Gesell<br />
schaft als Leistungsgesellschaft gefaßt wer<strong>de</strong>n muß, in die indi<br />
vidualistische, vom rationalistischen Naturrecht herkommen<strong>de</strong><br />
Konzeption einmün<strong>de</strong>n, aber nur aus praktischen, nicht theore<br />
tischen Grün<strong>de</strong>n. Die Kirche kann für ihre Gemeinschaft nur im<br />
Sinn <strong>de</strong>r Ordnung <strong>de</strong>nken.<br />
Wie gezeigt wur<strong>de</strong>, ist auch in <strong>de</strong>r thomistischen Sicht die<br />
Gesellschaft als Organisation ein Dienstwert. Nur wird dieser<br />
Dienstwert nicht direkt auf das individuelle Wohl <strong>de</strong>s einzelnen<br />
ausgerichtet, son<strong>de</strong>rn zunächst auf die Integration <strong>de</strong>r Glie<strong>de</strong>r<br />
in die Gesamtwohlfahrt. Das Kind soll in <strong>de</strong>r Familie als Glied<br />
<strong>de</strong>r Familie glücklich sein, nicht einfach als Mensch im allgemei<br />
nen. Die solidarische Hilfeleistung <strong>de</strong>r Bürger untereinan<strong>de</strong>r<br />
soll nicht nur aufgr<strong>und</strong> einer bilateralen Beziehung vor sich<br />
gehen, son<strong>de</strong>rn zuerst eine die gesamte Gemeinschaft materiell<br />
<strong>und</strong> geistig aufbauen<strong>de</strong> Tätigkeit sein, also nicht nur ein zwi<br />
schenmenschlicher Solidarismus, son<strong>de</strong>rn ein Gemeinwohlsoli<br />
darismus. Einzig dieser Solidarismus entspricht <strong>de</strong>r ethischen<br />
For<strong>de</strong>rung, von <strong>de</strong>r auch in <strong>de</strong>n kirchlichen Verlautbarungen die<br />
Re<strong>de</strong> ist, daß <strong>de</strong>r einzelne mit seinem gesamten sittlichen Leben<br />
einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten soll.<br />
Nun wird das Gemeinwohl in <strong>de</strong>r Praxis weniger vonseiten<br />
<strong>de</strong>r Pflichten <strong>de</strong>s einzelnen zum Gesamt als vielmehr von seinen<br />
individuellen <strong>Recht</strong>en <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Folge vom Aufgabenbereich<br />
<strong>de</strong>r geseUschaftlichen Autorität aus betrachtet. Im Zentrum ste<br />
hen die gesellschaftlichen Gememwohlmaßnahmen. Auf je<strong>de</strong>n<br />
Fall trifft dies für <strong>de</strong>n Staat zu, <strong>de</strong>r über das innere Leben <strong>de</strong>s<br />
489
Exk. III Menschen keine Kompetenz besitzt, <strong>de</strong>r vielmehr nur die äuße<br />
ren Bedingungen zu schaffen hat, aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>ren <strong>de</strong>r einzelne<br />
seine allseitige Vervollkommnung fin<strong>de</strong>n kann. Auf dieser<br />
Ebene brauchen sich darum die Vertreter verschie<strong>de</strong>ner<br />
Gemeinwohlkonzeptionen nicht darum zu streiten, welche<br />
Gemeinwohl<strong>de</strong>finition korrekter sei. In <strong>de</strong>r Praxis geht es um die<br />
Stimulierung <strong>de</strong>r Wirkkräfte, das sind die Menschen mit ihrem<br />
Verstand <strong>und</strong> freien Willen, jene Wesen, die ihr eigenes Ergän<br />
zungsbedürfnis wahrnehmen <strong>und</strong> die Gesellschaft in dieser In<br />
tention aufbauen. In <strong>de</strong>r Handlungsordnung individualisiert<br />
sich die Sozialethik. Sie erscheint beinahe nur noch wie ein<br />
Annex zur Individualethik. Darum re<strong>de</strong>t man auf dieser Ebene<br />
von <strong>de</strong>r „sozialen Belastung" <strong>de</strong>s Individuums, während es auf<br />
<strong>de</strong>r vor <strong>de</strong>r Handlung liegen<strong>de</strong>n Ebene <strong>de</strong>r natura humana nur<br />
<strong>de</strong>n Menschen gibt, <strong>de</strong>r zugleich sowohl individuelles wie sozia<br />
les Wesen ist, nicht aber als Individuum sozial nur „belastet" ist.<br />
Die ganzheitliche Sicht ist darum aber nicht belanglos gewor<br />
<strong>de</strong>n. Ohne Ordnungs<strong>de</strong>nken zerfällt das Gemeinwohl in die<br />
Summe <strong>de</strong>r Individualwohle. Das Ordnungs<strong>de</strong>nken setzt aber<br />
einen Ganzheitsbegriff voraus, von <strong>de</strong>m aus die Individuen<br />
eben nur Teilfunktion ausüben. Von dieser gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
Systematik aus dürfte man darum <strong>de</strong>r thomistischen These <strong>de</strong>n<br />
Vorzug geben. Inwieweit sich dieser Vorzug in <strong>de</strong>r praktischen<br />
Wohlfahrtsbestimmung auswirkt, soll später erörtert wer<strong>de</strong>n.<br />
Der Wan<strong>de</strong>l im Ansatz sozialethischen Denkens — vom tho<br />
mistischen Ordnungs<strong>de</strong>nken zur individuellen Handlung — hat<br />
seinen geschichtlichen Hintergr<strong>und</strong>. Auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r katho<br />
lischen Soziallehre beginnt er bei Luigi Taparelli d'Azeglio SJ. hl<br />
Taparelli? 2 kannte die Werke von Thomas von Aquin kaum.<br />
Er hatte seine Ausbildung vor <strong>de</strong>m Eintritt in <strong>de</strong>n Jesuitenor<strong>de</strong>n<br />
auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s Eklektizismus <strong>und</strong> Sensismus empfangen. Er<br />
selbst bestätigte, daß er als Anregung nur nichtkatholische<br />
Handbücher in Hän<strong>de</strong>n gehabt habe. Marcel Thomann hat<br />
51 Saggio teoretico di diritto naturale appogiato sul fatto. 2 vol.,Palermo 1840/<br />
41, Prato 2 1883. Deutsche Ausg.: Versuch eines auf Erfahrung begrün<strong>de</strong>ten<br />
Naturrechts. Aus <strong>de</strong>m Italienischen übersetzt von Fridolin Schöttl <strong>und</strong> Carl<br />
Rinecker. 2 B<strong>de</strong>.,Regensburg 1845.<br />
5 2 Zu seinem Lebensbild <strong>und</strong> seinem Einfluß auf Gioachino Pecci, <strong>de</strong>n späteren<br />
Leo XIII., vgl. Helmut Sorgenfrei, Die geistesgeschichtlichen Hintergrün<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Sozialenzyklika „Rerum novarum" Papst Leos XIII. vom 15. Mai 1891.<br />
Sammlung Politeia Bd. XXV, Hei<strong>de</strong>lberg 1970, 116 ff.<br />
490
nachgewiesen, daß Taparelli <strong>de</strong>n Vertreter <strong>de</strong>s rationalistischen Exk. III<br />
<strong>und</strong> individualistischen Naturrechts Christian Wolff reichlich<br />
kopierte. 53 Im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong> steht nicht mehr eine universelle<br />
Ordnung, son<strong>de</strong>rn das Individuum, die unabhängige mensch<br />
liche Person mit ihren <strong>Recht</strong>en <strong>und</strong> Zielen. Der traditionelle Be<br />
griff <strong>de</strong>s Gemeinwohls wird lediglich durch die Erklärung noch<br />
berücksichtigt, daß das Generelle <strong>de</strong>m Beson<strong>de</strong>ren gegenüber<br />
bevorzugt wer<strong>de</strong>n müsse. Die Ableitung <strong>de</strong>s Privateigentums<br />
als Mittel, die von Gott festgesetzte Güterordnung möglichst<br />
effizient zu gestalten, wird ersetzt durch <strong>de</strong>n Lockeschen<br />
Gedanken, daß die Person ihrem Wesen nach Eigentümerin sei.<br />
Mit dieser Zentrierung <strong>de</strong>r Ethik auf das Individuum sind die<br />
Weichen für die weitere Entwicklung <strong>de</strong>r katholischen Sozial<br />
lehre gestellt. V! Cathrein SJ vertrat in seinem im Philosophi<br />
schenjahrbuch 1892 erschienenen Artikel „Sozialethik o<strong>de</strong>rln-<br />
dividualethik" <strong>und</strong> in seinem zweibändigen Werk „Moralphilo<br />
sophie" 54 die Ansicht, die Sozialethik sei nichts an<strong>de</strong>res als ein<br />
Annex <strong>de</strong>r Individualethik. Dies ist eine völlig konsequente<br />
Logik, wenn man vom Individuum als <strong>de</strong>m han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Subjekt<br />
aus nach <strong>de</strong>m Objekt <strong>de</strong>r sittlichen Handlung sucht. Im Vor<strong>de</strong>r<br />
gr<strong>und</strong> steht hier das letzte Ziel, das je<strong>de</strong>r einzelne für sich<br />
erstrebt. Kann er es nicht allein erreichen, dann sucht er einen<br />
helfen<strong>de</strong>n Partner, <strong>de</strong>r sich in <strong>de</strong>r gleichen Situation befin<strong>de</strong>t.<br />
Und tatsächlich befin<strong>de</strong>n sich alle Menschen in <strong>de</strong>r gleichen<br />
Situation <strong>de</strong>r persönlichen Hilflosigkeit trotz ihrer moralischen<br />
Unabhängigkeit. So ergibt sich <strong>de</strong>r bilaterale Solidarismus als<br />
einzige Lösung <strong>de</strong>s Problems sozialer Fragen. Wer die Hilfe <strong>de</strong>s<br />
Mitmenschen in Anspruch nehmen will, muß seinerseits seine<br />
Hilfe <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren anbieten. Das Gemeinwohl kann dann nur<br />
noch in <strong>de</strong>n gemeinsam erstellten Bedingungen bestehen, auf<br />
gr<strong>und</strong> <strong>de</strong>ren je<strong>de</strong>r einzelne durch persönliche Anstrengung sein<br />
Heil fin<strong>de</strong>t. Das alle verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>und</strong> verpflichten<strong>de</strong> Gemein<br />
wohl ist dann jener gemeinsame Wert, um <strong>de</strong>ssentwillen alle im<br />
Streben nach ihrem individuellen Ziel zusammenkommen, die<br />
Vervollkommnung aller, aber immer bezogen auf <strong>de</strong>n Ansatz,<br />
5 3 Marcel Thomann, Une source peu connue <strong>de</strong> l'Encyclopedie: L'influence <strong>de</strong><br />
Christian Wolff, Paris 1970; <strong>de</strong>n., Einführung zu: Christian Wolff, Jus gentium,<br />
Hil<strong>de</strong>sheim 1972; <strong>de</strong>n., Einführung zu Christian Wolff, Jus naturae,<br />
Hil<strong>de</strong>sheim 1972.<br />
5 4 6. Aufl., 1924, 159.<br />
491
Exk. III bei <strong>de</strong>m die Ethik begann, nämlich auf die verschie<strong>de</strong>nen ein<br />
zelnen. Man muß, diesem Gedankengang G. G<strong>und</strong>lachs fol<br />
gend, diesem Wert einen an<strong>de</strong>ren Namen geben als<br />
Gemeinwohl, nämlich Gemeingut, <strong>de</strong>nn „Wohl" ist immer<br />
etwas Subjektives <strong>und</strong> das Subjektive ist eben nicht gemeinsam.<br />
Geht man diesem Räsonnieren näher nach, dann stellt man<br />
dahinter ein nicht bewältigtes erkenntnistheoretisches Problem<br />
fest, nämlich die Frage nach etwas Gemeinsamem, das wohl<br />
gleich, aber zugleich verschie<strong>de</strong>n in allen ist, d. h. das Problem<br />
eines analog Gemeinsamen. Die Analogie <strong>de</strong>s Gemeinsamen<br />
<strong>und</strong> damit auch <strong>de</strong>s Gemeinwohls mußte Taparelli, <strong>de</strong>r entspre<br />
chend seinen Informationsquellen <strong>de</strong>m rationalistisch-indivi<br />
dualistischen Naturrecht verpflichtet war, völlig fremd bleiben.<br />
Immerhin ist <strong>de</strong>r alte Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls immer noch<br />
gerettet im Begriff <strong>de</strong>r „sozialen Belastung". Taparelli <strong>und</strong> seine<br />
Gefolgsmänner wollten <strong>und</strong> konnten nicht eine Synthese <strong>de</strong>r<br />
alten Ordnungsphilosophie mit <strong>de</strong>r notwendig gewor<strong>de</strong>nen,<br />
unmittelbar auf die Praxis ausgerichteten sozialen Handlungs-<br />
lehre bieten. Das kirchliche Lehramt brauchte aber dringend<br />
eine solche praxisnahe Handlungslehre. Zur Zeit, da Taparelli<br />
von seinem Or<strong>de</strong>nsgeneral <strong>de</strong>n Auftrag erhielt, ein sozialphilo<br />
sophisches Handbuch zu schreiben, lag <strong>de</strong>r Thomismus völlig<br />
am Bo<strong>de</strong>n. Erst unter <strong>de</strong>m Pontifikat Leos XIII. fand man <strong>de</strong>n<br />
Weg zu <strong>de</strong>n Werken von Thomas von Aquin zurück. Die päpstli<br />
chen Verlautbarungen blieben zwar beim praxisnahen Ansatz,<br />
öffneten jedoch <strong>de</strong>n Weg für die Hereinholung <strong>de</strong>s thomisti-<br />
schen Ordnungs<strong>de</strong>nkens in ihre Lehre, was wohl <strong>de</strong>utlich<br />
genug durch die Analyse <strong>de</strong>r päpstlichen Verlautbarungen<br />
gezeigt wor<strong>de</strong>n ist. Das Fehlen <strong>de</strong>r Systematik dürfte <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong><br />
dafür sein, daß sich die Akzente in <strong>de</strong>n einzelnen Verlautbarun<br />
gen so stark verschieben. Man braucht nur auf die Mitbestim<br />
mungsfrage hinzuweisen. Wäre man <strong>de</strong>r thomistischen Syste<br />
matik in <strong>de</strong>r Eigentumsfrage gefolgt, dann wäre man von selbst<br />
auf die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Unternehmers als <strong>de</strong>s Verwalters von<br />
privatem Eigentum zugunsten einer ges<strong>und</strong>en Produktionsord<br />
nung gestoßen. Der Kritik, in <strong>de</strong>n päpstlichen Verlautbarungen<br />
fehlte die Behandlung <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>sätze <strong>de</strong>s produktiven Prozes<br />
ses, wäre vorgebeugt wor<strong>de</strong>n.<br />
492
c) Das Gemeinwohl hei Johannes Messner 55<br />
Johannes Messner, <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong> bisher behan<strong>de</strong>lten Gemein<br />
wohlkonzeptionen sehr genau kannte, wollte mit Bedacht einen<br />
eigenen Weg gehen. Mit <strong>de</strong>m thomistischen Ordnungs<strong>de</strong>nken<br />
geht er zwar gr<strong>und</strong>sätzlich einig. Doch erscheint es ihm zu<br />
abstrakt <strong>und</strong> vor allem für das Verständnis <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rnen zu<br />
wenig empirisch. Daraus versteht sich seine Vorliebe für Tapa<br />
relli, <strong>de</strong>r ausdrücklich seine Gemeinwohl<strong>de</strong>finition mit <strong>de</strong>m<br />
empirisch feststellbaren Wollen <strong>de</strong>s Individuums beginnt. Tapa<br />
relli hat seine Darstellung <strong>de</strong>s Naturrechts als „auf <strong>de</strong>r Erfah<br />
rung begrün<strong>de</strong>t" bezeichnet. Und sie war es auch in <strong>de</strong>r Tat.<br />
Messner beginnt ebenfalls mit <strong>de</strong>r Ergänzungsbedürftigkeit <strong>de</strong>s<br />
Menschen <strong>und</strong> leitet daraus <strong>de</strong>ssen soziale Komponente ab.<br />
Das Soziale möchte er aber nicht einfach als eine zusätzliche<br />
Qualität <strong>de</strong>r Person verstehen, wie dies im Gefolge von Tapa<br />
relli geschehen ist. Man könnte nicht sagen, <strong>de</strong>r Mensch sei<br />
„auch" sozial <strong>und</strong> darum sozial belastet. Vielmehr sei <strong>de</strong>r<br />
Mensch ein sowohl individuelles wie soziales Wesen. „Sowohl<br />
das individuelle wie das gesellschaftliche Wesen <strong>de</strong>r Menschen<br />
natur sind metaphysisch <strong>und</strong> ontologisch gleich ursprünglicher<br />
Art". 56 Das Soziale leitet Messner nun nicht wie <strong>de</strong>rThomismus<br />
aus <strong>de</strong>m Verhältnis von wesenhafter Natur <strong>und</strong> Individualität<br />
ab, vielmehr sucht er es auf empirischem Weg. Er fin<strong>de</strong>t dieses<br />
vor <strong>und</strong> über <strong>de</strong>m Individuum sich befin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Soziale in <strong>de</strong>r<br />
Kultur. In seiner phänomenologischen Erklärung <strong>de</strong>s Sozialen<br />
folgt er Max Scheler, nach <strong>de</strong>m „es im Wesen einer endlichen<br />
Person hegt, Glied einer Sozialeinheit überhaupt zu sein" 57 Den<br />
Begriff <strong>de</strong>r Person fin<strong>de</strong>t Messner mit M. Scheler erst im Verb<strong>und</strong><br />
mit <strong>de</strong>r Sozialeinheit. Das Band, das die Sozialeinheit zusam<br />
menhält, ist, wie gesagt, die Kultur, in die je<strong>de</strong>r Mensch hinein<br />
gewachsen ist <strong>und</strong> ohne die er nicht Bestand hätte. Damit<br />
gelingt es Messner auf empirischem Weg, <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r Ganz<br />
heit, wie er bei Thomas von Aquin <strong>und</strong> in an<strong>de</strong>rer Form bei<br />
Hegel obenan steht, zurückzugewinnen. Die Familie, das Volk<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Staat sind, wie Messner ausführt, geprägt durch ein eige-<br />
5 5 Ich kann mich hier kurz fassen unter Hinweis auf meine ausführlichen Darle<br />
gungen in <strong>de</strong>m in Anm. 40 zitierten Artikel.<br />
5 6 Das Naturrecht. Innsbruck 1950, 163.<br />
5 7 Zitiert in „Das Naturrecht" 185.<br />
493
Exk. III nes kulturelles Milieu, das nicht erklärt wird durch die bloßen<br />
gegenseitigen Beziehungen <strong>de</strong>r einzelnen Glie<strong>de</strong>r.<br />
Trotz dieser entschlossenen Zuwendung zum altüberliefer<br />
ten Ganzheits<strong>de</strong>nken fährt Messner in <strong>de</strong>r Sozialethik nicht in<br />
<strong>de</strong>r Betrachtung <strong>de</strong>s Gemeinsamen fort, son<strong>de</strong>rn richtet seinen<br />
Blick ganz auf die Handlung <strong>de</strong>s einzelnen, <strong>de</strong>r wegen seiner<br />
Ergänzungsbedürftigkeit auf die Kooperation mit <strong>de</strong>m Mit<br />
menschen angewiesen ist, um sein Ziel zu erreichen. Das<br />
Gemeinwohl, das durch diese Kooperation erstellt wird, kann<br />
darum nur als Hilfe für <strong>de</strong>n einzelnen gedacht wer<strong>de</strong>n: „Das<br />
Gemeinwohl kann <strong>de</strong>mnach nur Hilfe (kursiv im Original,<br />
A. F. U.) für <strong>de</strong>n erwähnten Zweck sein". 58 Das Gemeinwohl<br />
hat, so sagt Messner 19 , <strong>de</strong>n Individuen, „ihren Interessen <strong>und</strong><br />
Wünschen zu dienen". Der individualistische Charakter <strong>de</strong>s<br />
Messnerschen Gemeinwohlbegriffes ist unleugbar. Messners<br />
Gedankengang mün<strong>de</strong>t somit ganz in die Konzeption G<strong>und</strong><br />
lachs ein, wonach das Gemeinwohl in <strong>de</strong>n Institutionen <strong>und</strong><br />
Bedingungen besteht, mittels <strong>de</strong>ren <strong>de</strong>r einzelne mit eigenem<br />
Tun seine individuelle Vervollkommnung fin<strong>de</strong>t. Man fragt sich<br />
natürlich, warum die markante Rückorientierung Messners am<br />
Ganzheits<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r Tradition keine Spuren in <strong>de</strong>r Gemein<br />
wohlkonzeption hinterlassen hat. Dies scheint mit <strong>de</strong>m Kultur<br />
begriff zusammenzuhängen, <strong>de</strong>nn dieser ist geschichtlicher<br />
Natur. Die Kultur ist gewor<strong>de</strong>n, durch die gesellschaftliche<br />
Tätigkeit aller geschaffen. Der Gedankengang muß darum not<br />
wendigerweise zum Individuum zurückführen. Messner hat<br />
kausal begonnen, nämlich bei <strong>de</strong>r Ergänzungsbedürftigkeit <strong>de</strong>s<br />
Individuums im Hinblick auf die eigen-aktive Verwirklichung<br />
<strong>de</strong>r Vollkommenheit. Er kann dann schließlich das Gemeinwohl<br />
nur von diesem Blickpunkt aus sehen. Im übrigen behan<strong>de</strong>lt<br />
Messner das Gemeinwohl in seiner diesem Objekt ausschließlich<br />
gewidmeten Schrift 60 mit Blick einzig auf <strong>de</strong>n <strong>de</strong>mokratischen<br />
Staat. Hier muß sich naturgemäß die Einstellung auf das Indivi<br />
duum beträchtlich verstärken.<br />
494<br />
Das Naturrecht, 190, vgl. auch 195.<br />
Das Naturrecht, 190.<br />
Das Gemeinwohl, I<strong>de</strong>e, Wirklichkeit, Aufgaben. Osnabrück 1968.
5. DIE ANWENDUNG DES GEMEINWOHLBEGRIFFS DER KATHOLISCHEN<br />
SOZIALLEHRE AUF DIE BESTIMMUNG DER WOHLFAHRT 61<br />
Soweit es sich um das Gemeinwohl im Staat, beson<strong>de</strong>rs im plu<br />
ralistischen Staat han<strong>de</strong>lt, stimmen alle drei dargestellten Ver<br />
sionen mehr o<strong>de</strong>r weniger überein. 62 Im staatlichen Bereich hat<br />
die private Initiative <strong>de</strong>n Vorrang. Der Staat kann das Glück sei<br />
ner Bürger nicht bestimmen. Die staatliche Autorität sollte ein<br />
zig die Grenzen erkennen können, die zur Wahrung <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Wür<strong>de</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>r existentiellen Integration aller in<br />
die Gesellschaft zu beachten sind. Aus dieser Erkenntnis soll sie<br />
die Rahmenbedingungen schaffen, damit je<strong>de</strong>r sein eigenes<br />
Glück schmie<strong>de</strong>n kann. Im weitestmöglichen Umfang ist die<br />
private Initiative zu schützen <strong>und</strong> auch zu stützen. Die Bedin<br />
gungen, unter welchen je<strong>de</strong>r sein Glück fin<strong>de</strong>n soll, müssen ent<br />
sprechend <strong>de</strong>m Gewicht, das <strong>de</strong>r Eigeninitiative zuerkannt<br />
wird, vielfach sein. Sie können nicht einfach als öffentliche Ein<br />
richtungen verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
Es läge bei dieser Sachlage nahe, das Gemeinwohl lediglich<br />
nach <strong>de</strong>n allgemeinen Voraussetzungen (<strong>de</strong>n wirtschafts- <strong>und</strong><br />
sozialpolitischen Einrichtungen) zu bestimmen, in <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r<br />
einzelne sein Wohl, d.h. sein Lebensziel zu verwirklichen<br />
imstan<strong>de</strong> ist. Doch muß beachtet wer<strong>de</strong>n, daß die Institutionen<br />
final bestimmt sind im Hinblick auf das subjektiv je verschie<strong>de</strong><br />
ne Wohl. In letzter Anlayse befin<strong>de</strong>n wir uns vor <strong>de</strong>m subjekti<br />
ven Wohlbefin<strong>de</strong>n. Wir nähern uns daher <strong>de</strong>r individualisti<br />
schen Sicht <strong>de</strong>r Pareto-Regel. Die Paretianer vermeinen aller<br />
dings, das subjektive Glücks empfin<strong>de</strong>n wertfrei annehmen zu<br />
können. Dieser Sensualismus kann aber nicht ohne geheime<br />
Implikation einer Übereinstimmung in einem objektiven Sach<br />
verhalt vom sensualistisch eingestellten Einzelnen bejaht wer<br />
<strong>de</strong>n. Wer seinen Lebensstil in einer von Exzessen freien Lebens-<br />
61 Vgl. hierzu als Ergänzung Alfred Klose, Zur Gemeinwohlproblematik — Perspektiven<br />
einer gemeinwohlorientierten Politik aus <strong>de</strong>r Sicht christlicher Sozialethik,<br />
in: Anton Rauscher (Hrsg.), Selbstinteresse <strong>und</strong> Gemeinwohl, Berlin<br />
1985, 495-543.<br />
6 2 Der Unterschied macht sich dort bemerkbar, wo gesamtheitliche Interessen<br />
in gewissen Kontrast zum individualistisch gefaßten Eigenwohl treten, z.B.<br />
die sich aufopfern<strong>de</strong> vaterländische Gesinnung, Erhaltung <strong>de</strong>r Gesamtnatur,<br />
überhaupt Lebensraum <strong>de</strong>r Menschheit. Diese Probleme wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r<br />
thomistischen <strong>und</strong> in etwa auch von <strong>de</strong>r Messnerschen Sicht aus leichter<br />
angegangen.<br />
495
Exk. III haltung sieht, wür<strong>de</strong> sich für die Regel, je<strong>de</strong>r könne nach seiner<br />
Facon selig wer<strong>de</strong>n, nicht entschei<strong>de</strong>n, wenn seine nähere Um<br />
gebung das Wohlergehen im Drogenrausch sähe. Als gesell<br />
schaftliches Wesen kann <strong>de</strong>r einzelne sich nicht mit jedwe<strong>de</strong>r<br />
Regel gesellschaftlichen Zusammenseins abfin<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>m<br />
Augenblick, da man einen Sachverhalt auch nur methodolo<br />
gisch verallgemeinert, verallgemeinert man etwas Objektives.<br />
Das subjektive Urteil <strong>de</strong>s einzelnen über sein Eigenwohl ist<br />
zwar zunächst nur für <strong>de</strong>n einzelnen ein Werturteil. Wenn man<br />
aber die verschie<strong>de</strong>nen subjektiven Werturteile zur allgemeinen<br />
Regel einer gemeinsamen Ordnung machen will, ist man genö<br />
tigt, Friktionen innerhalb <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Werturteile aus<br />
zuschließen. Dies kann man nur durch Zuhilfenahme eines all<br />
gemeinen objektiven Nenners. An<strong>de</strong>rs wäre die Pareto-Regel<br />
eine n<strong>utz</strong>lose hypothetische Reißbrettübung, die in <strong>de</strong>r Wirk<br />
lichkeit sinnlos wird. Auch ein Sensualist ist <strong>de</strong>r Ansicht, daß er<br />
sein eigenes Glück im Frie<strong>de</strong>n genießen möchte. Je<strong>de</strong> soziale<br />
Methodologie — <strong>und</strong> die Pareto-Regel ist eine solche - stößt in<br />
<strong>de</strong>r Wirklichkeit auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Aus die<br />
sem Gr<strong>und</strong> ist auch die Vorstellung einer nur methodologisch<br />
geordneten „offenen Gesellschaft" eine Utopie, die, wenn sie<br />
sich verwirklichen wür<strong>de</strong>, die Brutstätte von I<strong>de</strong>ologien<br />
wäre. 63 Im paretianischen Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls verbirgt<br />
sich die Verallgemeinerung einer I<strong>de</strong>e von subjektivem Wohl.<br />
Man muß <strong>de</strong>mnach wenigstens in groben Umrissen wissen,<br />
was wesentlich zum menschlichen Wohl gehört, um eine Diver<br />
sifizierung <strong>de</strong>r subjektiven Wohle zu akzeptieren. Die Pareto-<br />
Regel setzt stillschweigend voraus, daß das sensualistisch wahr<br />
genommene Wohl <strong>de</strong>s einzelnen kein Störungsfaktor ist, d. h.<br />
sie rechnet mit <strong>de</strong>m ges<strong>und</strong>en Menschenverstand aller, die ihr<br />
Eigenwohl innerhalb <strong>de</strong>r Gesellschaft anstreben, es sei <strong>de</strong>nn, sie<br />
verstehe die Regel rein mathematisch, also nicht praktikabel.<br />
Um etwas für die soziale Wirklichkeit zu bieten, muß man sich<br />
vom Sensualismus lösen <strong>und</strong> nach objektiven, sogenannten<br />
„ges<strong>und</strong>en" Normen suchen. Was eine ges<strong>und</strong>e <strong>und</strong> was eine<br />
unges<strong>und</strong>e Lebensweise ist, kann <strong>de</strong>r Arzt entsprechend <strong>de</strong>n<br />
natürlichen Dispositionen <strong>de</strong>s menschlichen Körpers bestim-<br />
496<br />
Vgl. P.Trappe, Die elitären Machtgruppen in <strong>de</strong>r Gesellschaft — o<strong>de</strong>r: Über<br />
die Geschlossenheit <strong>de</strong>r offenen Gesellschaft, in: A. F. Utz, Hrsg., Die offene<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> ihre I<strong>de</strong>ologien, Bonn 1986, 271—310.
men. Gleiches gilt auch für die Psyche, die ihrerseits ihre eige- Exk. III<br />
nen Gesetze hat. Der einzelne kann darum in <strong>de</strong>r Bestimmung<br />
„seines" Glückes über die naturhaften Dispositionen nicht hin<br />
wegsehen. Da auch die Umwelt unser Glücksempfin<strong>de</strong>n beein-<br />
flußt, gehört auch sie zu <strong>de</strong>n Gesetzen, die <strong>de</strong>r einzelne in seiner<br />
Glücksbestimmung zu berücksichtigen hat, wenn er wirklich<br />
glücklich sein will. Je<strong>de</strong>r braucht zu seinem Glück auch eine<br />
zufrie<strong>de</strong>ne Gesellschaft. Für alle diese vielfältigen Normen, die<br />
nicht nur normativen, son<strong>de</strong>rn auch, <strong>und</strong> zwar zuerst kausalen<br />
Charakter haben, hat die katholische Soziallehre <strong>de</strong>n Sammel<br />
begriff <strong>de</strong>r allen gemeinsamen natura humana. Über ihren<br />
Inhalt muß die Gesellschaft einen gewissen Konsens besitzen,<br />
damit jene Bedingungen erstellt wer<strong>de</strong>n können, gemäß <strong>de</strong>nen<br />
<strong>de</strong>r einzelne sein individuelles Glück erwirken kann. In <strong>de</strong>r<br />
mo<strong>de</strong>rnen Wohlfahrtsdiskussion wer<strong>de</strong>n die allgemeinen<br />
menschlichen Bedingungen unter <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r „Lebensqua<br />
lität" zusammengefaßt. Die Lebensqualität wird gemäß <strong>de</strong>r<br />
katholischen Soziallehre in erster Linie nach <strong>de</strong>n natürlichen<br />
Dispositionen, in zweiter Linie nach <strong>de</strong>n wirtschaftlichen <strong>und</strong><br />
sozialen Verhältnissen (<strong>de</strong>m allgemeinen Lebensstandard)<br />
bestimmt.<br />
Nun ist die pluralistische Demokratie mit ihrer Marktwirt<br />
schaft nicht durch natürliche Normen, son<strong>de</strong>rn im wirtschaftli<br />
chen Sektor durch die freie Konsumwahl, im sozialen <strong>und</strong> im<br />
politischen Sektor durch die freie Entscheidung <strong>de</strong>r Individuen<br />
bestimmt. Was hier Wohl aller ist, zerfällt darum in das Einzel<br />
wohl <strong>de</strong>r vielen. Die <strong>de</strong>n Gesetzen <strong>de</strong>r menschlichen Natur fol<br />
gen<strong>de</strong> normative Ordnung muß sich darum zunächst im Glücks<br />
empfin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r einzelnen verwurzeln, ehe sie gesellschaftlich<br />
wirksam wer<strong>de</strong>n kann. Wir befin<strong>de</strong>n uns damit genau bei <strong>de</strong>r<br />
Pareto-Regel, doch nicht in <strong>de</strong>m wertfreien Sinn, als ob <strong>de</strong>r Pro<br />
zeß <strong>de</strong>r Wohlfahrtsbestimmung mit <strong>de</strong>r Addition individueller<br />
Wohlbefin<strong>de</strong>n ohne Zuhilfenahme eines universellen Sachver<br />
haltes erledigt wäre. Daß <strong>de</strong>m nicht so ist, hat uns die Erfahrung<br />
mit <strong>de</strong>r Umwelt vor Augen geführt. Lange haben wir geglaubt,<br />
die Luft sei ein freies Gut, das keinen Preis hat. Wir haben sie im<br />
Sinn unseres subjektiven Wohlempfin<strong>de</strong>ns so lange ausgebeu<br />
tet, bis wir im Smog lan<strong>de</strong>ten, <strong>de</strong>r unsere Lungen belästigt. Das<br />
Naturgesetz ist normativ, weil es das Gesetz <strong>de</strong>r realen Natur,<br />
einschließlich <strong>de</strong>r menschlichen Natur, ist. Die Dichotomie von<br />
Norm <strong>und</strong> Sein, die im Anschluß an Kant Max Weberfür die So-<br />
497
Exk. III zialwissenschaft proklamierte <strong>und</strong> die auch in <strong>de</strong>r Wertfreiheit<br />
<strong>de</strong>r Pareto-Regel steckt, hat nur hypothetisch-theoretische<br />
Be<strong>de</strong>utung. Die wertfreie Pareto-Kegel erfaßt nur einen Teil <strong>de</strong>r<br />
Wohlfahrtsökonomik, nämlich in pointieren<strong>de</strong>r Abstraktion<br />
<strong>de</strong>n Gesichtspunkt <strong>de</strong>r subjektiven Bestimmung <strong>de</strong>s Wohlbe<br />
fin<strong>de</strong>ns. Das rein sensualistische Urteil über das eigene Glück<br />
ist aber sehr irrtumsträchtig. Es bedarf, wie gesagt, um zum sta<br />
bilen Glücksempfin<strong>de</strong>n zu führen, <strong>de</strong>r objektiven Orientierung<br />
an <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r natura humana liegen<strong>de</strong>n Gesetzmäßigkeiten. Die<br />
pluralistische Demokratie kann allerdings die Naturgesetze<br />
nicht in ihre Verfassung aufnehmen. Sie ist darum gera<strong>de</strong>zu ein<br />
Repräsentant <strong>de</strong>s Sensualismus im Sinn <strong>de</strong>r Pareto-Regel. Die<br />
Demokraten müssen es daher in Kauf nehmen, für die von<br />
ihnen begangenen Irrtümer in <strong>de</strong>r Wohlfahrtsbestimmung zu<br />
büßen. Momentan tun wir dies in beträchtlichem Maß für die<br />
falsche Wohlfahrtspolitik unserer Vorfahren.<br />
498
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS<br />
1. Biblische Bücher<br />
Altes Testament<br />
Gn = Genesis Prd = Prediger<br />
Ex = Exodus (Ecclesiastes)<br />
Lv = Leviticus Hl = Hoheslied<br />
Nm = Numeri Weish = Weisheit<br />
Dt = Deuteronomium Sir = Sirach<br />
Jos = Josue (Ecclesiasticus^<br />
Ri = Richter Is = Isaias<br />
Rt = Ruth Jr = Jeremias<br />
1 Sam = 1. Samuel Klgl = Klagelie<strong>de</strong>r<br />
2 Sam = 2. Samuel Bar = Baruch<br />
lKg = 1. Könige Ez Ezechiel<br />
2 Kg = 2. Könige Dn = Daniel<br />
1 Chr = 1. Chronik Os Osee<br />
(Paralipomenon) Joel = Joel<br />
2 Chr = 2. Chronik Am Arnos<br />
Esr = Esdras Abd = Abdias<br />
Neh = Nehemias Jon = Jonas<br />
Tob = Tobias Mich Michäas<br />
Jdt = Judith Nah = Nahum<br />
Est = Esther Hab = Habakuk<br />
1 Makk = 1. Makkabäer Soph = Sophonias<br />
2Makk = 2. Makkabäer Agg = Aggäus<br />
Job = Job Zach = Zacharias<br />
Ps (Pss) = Psalm(en) Mal = Malachias<br />
Spr = Sprüche<br />
Neues Testament<br />
Mt = Matthäus-Evangelium 2 Tim = 2. Timotheusbrief<br />
Mk = Markus-Evangelium Tit = Titusbrief<br />
Lk = Lukas-Evangelium Phm = Philemonbrief<br />
Jo = Johannes-Evangelium Hebr = Hebräerbrief<br />
Apg = Apostelgeschichte Jak = Jakobusbrief<br />
Rom = Römerbrief 1 Petr = 1. Petrusbrief<br />
1 Kor = 1. Korintherbrief 2Petr = 2. Petrusbrief<br />
499
2 Kor = 2. Korintherbrief 1 Jo<br />
Gal = Galaterbrief 2Jo<br />
Eph = Epheserbrief 3 Jo<br />
Phil = Philipperbrief Jud<br />
Kol = Kolosserbrief Apk<br />
1 Thess = 1. Thessalonicherbrief<br />
2 Thess = 2. Thessalonicherbrief<br />
1 Tim = 1. Timotheusbrief<br />
= 1 .Johannesbrief<br />
= 2.Johannesbrief<br />
= 3. Johannesbrief<br />
= Judasbrief<br />
= Apokalypse <strong>de</strong>s<br />
2. Werke <strong>de</strong>s hl. Thomas v. Aquin<br />
Johannes (Geheime<br />
Offenbarung)<br />
(außer Summa theologica <strong>und</strong> Sentenzenkommentar)<br />
An = Quaestio disputata <strong>de</strong> anima<br />
In An = Expositio in libros Aristotelis <strong>de</strong> anima<br />
CG = Summa contra gentes<br />
CI = Contra impugnantes Dei cultum et religionem<br />
Col = Expositio in S. Pauli Apostoli epistolam ad Colossenses<br />
Cor = Expositio in S. Pauli Apostoli epistolam ad Corinthios<br />
CR = Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a<br />
religionis ingressu<br />
CTh = Compendium theologiae<br />
Decleg = De duobus praeceptis caritatis et <strong>de</strong>cem legis praeceptis<br />
Eph = Expositio in S. Pauli Apostoli epistolam ad Ephesios<br />
Eth = Expositio in <strong>de</strong>cem libros ethicorum Aristotelis ad Nicomachum<br />
Gal = Expositio in S. Pauli Apostoli epistolam ad Galatas<br />
Hb = Expositio in S. Pauli Apostoli epistolam ad Hebraeos<br />
Jo = Expositio in evangelium S.Joannis<br />
Job = Expositio in Job<br />
Mal = Quaestiones disputatae <strong>de</strong> malo<br />
Met = Commentaria in metaphysicam Aristotelis<br />
Mt = Expositio in evangelium S. Matthaei<br />
OrDom = Expositio <strong>de</strong>votissima orationis Dominicae<br />
Periherm = Expositio in libros Perihermeneias Aristotelis<br />
Phil = Expositio in S.Pauli Apostoli epistolam ad Philippenses<br />
Pol = Expositio in octo libros politicorum Aristotelis<br />
Pot = Quaestiones disputatae <strong>de</strong> potentia<br />
Ps = Expositio in psalmos Davidis<br />
PVS = De perfectione vitae spiritualis<br />
Qlb = Quodlibetum (Quaestiones quodlibetales)<br />
Resp <strong>de</strong> = Responsio <strong>de</strong> articulis<br />
RJ = De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae<br />
Rom = Expositio in S.Pauli Apostoli epistolam ad Romanos<br />
Subst sep = De substantiis separatis<br />
Thess = Expositio in S.Pauli Apostoli epistolam ad Thessalonicenses<br />
500
Unit int = De unitate intellectus contra Averroistas<br />
Ver = Quaestiones disputatae <strong>de</strong> veritate<br />
Virt = Quaestio disputata <strong>de</strong> virtutibus in communi<br />
Virt card = Quaestio disputata <strong>de</strong> virtutibus cardinalibus<br />
3. Öfters zitierte Werke <strong>und</strong> Zeitschriften<br />
Ang = Angelicum, Rom<br />
ARSP = Archiv für <strong>Recht</strong>s- <strong>und</strong> Sozialphilosophie, Berlin<br />
BT = Bulletin thomiste, Kain<br />
CJC = Co<strong>de</strong>x Juris Canonici<br />
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, ed.<br />
curis et impensis Aca<strong>de</strong>miae Litterarum Vindobonensis<br />
1866 sqq.<br />
CT = La ciencia tomista, Madrid<br />
DT = Deutsche Thomasausgabe<br />
DTF = Divus Thomas, Freiburg (Schw.)<br />
DTP = Divus Thomas, Piacenza<br />
DTW = Divus Thomas, Wien (II. Serie von JPST)<br />
ETL = Ephemeri<strong>de</strong>s Theologiae Lovanienses. Louvain 1923 sq.<br />
Frdb = Friedberg, Emil Albert: Corpus Juris Canonici. 2 B<strong>de</strong>.<br />
Leipzig 1879/1881<br />
Greg = Gregorianum, Rom<br />
JPST = Jahrbuch für Philosophie <strong>und</strong> spekulative Theologie,<br />
Pa<strong>de</strong>rborn<br />
KR = Paul(us) Krüger: Corpus Juris Civilis, II. Berlin 1888<br />
LThK = Lexikon für Theologie <strong>und</strong> Kirche. 2. Aufl. Hrsg. Doktor<br />
Michael Buchberger. Freiburg 1930 ff.<br />
Mansi = Mansi, Joannes Dominicus: Sacrorum Conciliorum<br />
Collectio, 53 B<strong>de</strong>. Paris 1893 ff.<br />
Med St = Mediaeval Studies. Hrsg. Pontifical Institute of Mediaeval<br />
Studies. Toronto (Canada) 1939ff.<br />
MG s. PG<br />
ML s. PL<br />
NO = Die Neue Ordnung, Hei<strong>de</strong>lberg bzw. Köln<br />
NS = The New Scholasticism, Washington<br />
PG = Migne, Patrologiae cursus completus, series Graeca<br />
PJ = Philosophisches Jahrbuch <strong>de</strong>r Görresgesellschaft, Fulda<br />
PL = Migne, Patrologiae cursus completus, series Latina<br />
RFN = Rivista di filosofia neoscolastica, Mailand<br />
RNP = Revue neoscolastique <strong>de</strong> philosophie, Louvain<br />
RP = Revue <strong>de</strong> philosophie, Paris<br />
RPL = Revue <strong>de</strong> philosophie <strong>de</strong> Louvain<br />
RSPT = Revue <strong>de</strong>s sciences philosophiques et theologiques, Kain<br />
RT = Revue thomiste, Paris<br />
501
RUO = Revue <strong>de</strong> l'Universite d'Ottawa (Canada)<br />
Sch = Scholastik, Freiburg<br />
Sol = Dionysiaca, Editio Solesmensis (1937)<br />
4. Sonstige Abkürzungen<br />
c = capitulum<br />
can = Canon<br />
Dig = Digest<br />
V = Vers (Bibelvers), gewöhnlich wer<strong>de</strong>n auch die Kapitelnummern<br />
angegeben, z.B. 3,4 = 3.Kap., 4.Vers<br />
502
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Außer <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Anmerkungen <strong>und</strong> im Kommentar zitierten Literatur<br />
wer<strong>de</strong>n nur die unmittelbar diesen Band betreffen<strong>de</strong>n Veröffentlichungen<br />
aufgeführt. Eine sehr gute thomistische Literaturschau bietet<br />
P. Wyser, Bibliographische Einführungen in das Studium <strong>de</strong>r Philosophie<br />
(hg. von I. M. Bochenski), H. 13/14 <strong>und</strong> 15/16. Bern 1950 <strong>und</strong><br />
1951. Vgl. auch A.F.Utz, Bibliographie <strong>de</strong>r Sozialethik.<br />
Alluntis F., Private Property and Natural Law. In: Studies in Philosophy<br />
and the History of Phiiosophy 2 (1963) 189-210.<br />
Alonso V. M., Explicacion <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa segun Santo Tomas<br />
<strong>de</strong> Aquino. Sociologia y filosofia social. Buenos Aires 1938,213-246.<br />
Alphons von Liguori, Theologia Moralis. Editio Leon. Gau<strong>de</strong>.<br />
Antonia<strong>de</strong>s B., Entstehung <strong>und</strong> Verfassung <strong>de</strong>s Staates nach T. v. A.<br />
Tübingen 1889.<br />
D'Antonio F., II tirannicidio nel pensiero <strong>de</strong>ll'Aquinate. In: Annali di<br />
scienze politiche 12 (1939) 83-103.<br />
Arias G., La filosofia tomistica e l'economia politica. Milano 1934.<br />
Ashley M. A., Englische Wirtschaftsgeschichte. I. Das Mittelalter.<br />
Lpz. 1896.<br />
Baltermi A., II concetto di giustizia sociale negli scrittori cattolici<br />
mo<strong>de</strong>rni. (Diss.) Lugano 1939.<br />
Basler X., T. v. A. <strong>und</strong> die Begründung <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe. In: DTF 9<br />
(1931) 69-90, 173-202.<br />
Baumann J. J., Die Staatslehre <strong>de</strong>s hl. T. v. A. Lpz. 1873.<br />
— Die Staatslehre <strong>de</strong>s T. v. A. Ein Nachtrag. Lpz. 1909.<br />
Baumel J., Les lecons <strong>de</strong> Francisco <strong>de</strong> Vitoria sur les problemes <strong>de</strong> la<br />
colonisation et <strong>de</strong> la guerre. Edition critique avec traduction. Montpellier<br />
1936.<br />
Baxter I. F. G., Pour la justice. In: La Theologie chretienne et le droit.<br />
Archives <strong>de</strong> philosophie du droit 5 (1960) 133-155.<br />
Becker W. G., Die symptomatische Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Naturrechts im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s bürgerlichen <strong>Recht</strong>s. In: Archiv f. d. zivilistische Praxis<br />
150 (1948) 97-130.<br />
Belloc H., <strong>Recht</strong> auf Eigentum. 2. Aufl. Ölten 1958.<br />
Below G. v., Der Staat <strong>de</strong>s Mittelalters. Lpz. 1914.<br />
— Probleme <strong>de</strong>r Wirtschaftsgeschichte. Lpz. 1920.<br />
Ben<strong>de</strong>r L., OP, Philosophia iuris. Romae 1947.<br />
Benkert G. F., The thomistic conception of an international society.<br />
(Diss.) Washington 1942.<br />
503
Berg L., Der Mensch, Herr seiner <strong>Recht</strong>e. Die Metaphysik <strong>de</strong>r Gottebenbildlichkeit<br />
im Personsein <strong>de</strong>s Menschen hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
<strong>Recht</strong>sherrschaft nach T. v. A. (Diss.) Bensheim 1940.<br />
Bernheim E., Politische Begriffe <strong>de</strong>s Mittelalters im Lichte <strong>de</strong>r<br />
Anschauungen Augustins. In: Deutsche Zeitschr. f. Gesch.-Wissensch.<br />
N.F., I. Frbg. u. Lpz. 1897 1 ff.<br />
Besia<strong>de</strong> Th., La justice generale d'apres S. T. d'A. In: Melanges Thomistes<br />
(Biblioth. Thom. III), Kain 1923, 327-340.<br />
— L'ordre social. In: RSPT 13 (1924) 1-19.<br />
Betancur C, La i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> justicia y la teoria imperativista <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho.<br />
In: Anuario <strong>de</strong> Filosofia <strong>de</strong>l Derecho 4 (1956) 93-124.<br />
Betschart I., Das Wesen <strong>de</strong>r Strafe. Untersuchungen über Sein <strong>und</strong><br />
Wert <strong>de</strong>r Strafe in phänomenologischer <strong>und</strong> aristotelisch-thomistischer<br />
Schau. (Diss.) Einsie<strong>de</strong>ln 1939.<br />
Beutter F., Die Eigentumsbegründung in <strong>de</strong>r Moraltheologie <strong>de</strong>s<br />
19.Jahrh<strong>und</strong>erts. Pa<strong>de</strong>rborn 1971.<br />
Beyer W. R., <strong>Recht</strong>sphilosophische Besinnung. Karlsruhe 1947.<br />
— <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>s-Ordnung. Eine Grenzziehung. Meisenheim/<br />
Glan 1951.<br />
Bie<strong>de</strong>rlack J., SJ, Zur Gesellschafts- <strong>und</strong> Wirtschaftslehre <strong>de</strong>s hl. T. In:<br />
Z. f. kathol. Theol. 20 (1896) 574-584.<br />
Bihlmeyer K. - Tüchle H., Kirchengeschichte, 2.Teil: Das Mittelalter.<br />
12. Aufl. 1948.<br />
Billuart C. R., OP, Summa S. Thomae hodiernis Aca<strong>de</strong>miarum moribus<br />
accomodata sive Cursus Theologiae iuxta mentem Divi<br />
Thomae. Lugduni 1864.<br />
Bo G., Ii pensiero di S. T. d'A. sull'origine <strong>de</strong>lla sovranitä. Roma 1931.<br />
Bouvier L., Le precepte <strong>de</strong> l'aumöne chez S. T. d'A. Montreal 1935.<br />
Brachthäuser W., OP, Gemeingut- o<strong>de</strong>r Gesetzesgerechtigkeit. Eine<br />
geschichtlich-systematische Untersuchung zur <strong>Gerechtigkeit</strong>slehre<br />
<strong>de</strong>s hl. T. v. A. (Diss.) Köln 1941.<br />
Bran<strong>de</strong>s B., Die Lehre von <strong>de</strong>r Strafe bei T. v. A. Düsseldorf 1908.<br />
Brants V., L'economie politique au moyen-äge. Louvain 1895.<br />
Brentano L., Zur Genealogie <strong>de</strong>r Angriffe auf das Eigentum. In:<br />
Archiv f. Sozialw. u. Sozialpolitik 19 (1904) 251-271.<br />
— Der wirtschaften<strong>de</strong> Mensch in <strong>de</strong>r Geschichte. Lpz. 1923.<br />
— Die wirtschaftlichen Lehren <strong>de</strong>s christlichen Altertums. Sitzungsbericht<br />
<strong>de</strong>r philos.-philol. Klasse <strong>de</strong>r k. bayr. Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften.<br />
Jhg. 1902. München 1903.<br />
Brey H., Hochscholastik <strong>und</strong> „Geist <strong>de</strong>s Kapitalismus". Lpz. 1927.<br />
Briere Y. <strong>de</strong> la, SJ, Un probleme <strong>de</strong> philosophie du droit: le principe<br />
<strong>de</strong>s nationales. In: RP 25 (1925) 113-129, 306-318.<br />
— Le droit <strong>de</strong> juste guerre. Tradition theologique, adaptations contemporaines.<br />
Paris 1938.<br />
Brodnitz G., Englische Wirtschaftsgeschichte. I. Jena 1918.<br />
Broglie G. <strong>de</strong>, Justice sociale" et „Bien commun". In: Doctor Communis<br />
25 (1972) 257-292.<br />
504
Bruck E. F., Kirchenväter <strong>und</strong> soziales Erbrecht. Wan<strong>de</strong>rungen religiöser<br />
I<strong>de</strong>en durch die <strong>Recht</strong>e <strong>de</strong>r östlichen <strong>und</strong> westlichen Welt.<br />
Berlin 1956.<br />
Brugger M., Schuld <strong>und</strong> Strafe. Ein philosophisch-theologischer Beitrag<br />
zum Strafproblem. (Diss.) Pa<strong>de</strong>rborn 1933.<br />
Brunner E., <strong>Gerechtigkeit</strong>. Zürich 1943.<br />
Bückers FL, Die biblische Lehre vom Eigentum. Bonn 1947.<br />
Bullon y Fernan<strong>de</strong>z E., El concepto <strong>de</strong> la soberania en la escuela<br />
juridica espanola <strong>de</strong>l siglo XVI. Madrid 1935.<br />
Calippe Ch., La <strong>de</strong>stination et l'usage <strong>de</strong>s biens naturels d'apres S. T.<br />
d'A. In: Annales <strong>de</strong> philos. chretienne 155 (1907) 151-187.<br />
— La fonetion sociale <strong>de</strong>s Pouvoirs publics d'apres S. T. d'A. Lyon<br />
1911.<br />
Calliess R.-P., Eigentum als Institution. Eine Untersuchung zur theologisch-anthropologischen<br />
Begründung <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. München 1962.<br />
— Eigentum <strong>und</strong> Staat als Institution. In: Zeitschrift für evangelische<br />
Ethik 8 (1964) 365-368.<br />
Calvez J.TY., La propriete est-elle reactionnaire? In: Revue <strong>de</strong><br />
l'Action populaire 189 (1965) 661-673.<br />
Cappellazzi A., S. Tommaso et la schiavitü. Cremona 1900.<br />
Cardona C, La metafisica <strong>de</strong>l bien comün. Madrid 1966.<br />
Carlyle A. J., Le bien commun, la justice et la securite juridique dans la<br />
coneeption medievale du droit. In: Annuaire <strong>de</strong> l'Institut international<br />
<strong>de</strong> philosophie du droit et <strong>de</strong> sociologie juridique 3 (1938) 17-<br />
28.<br />
Carlyle R. W. <strong>und</strong> A. J., A History of Mediaeval Political Theory<br />
in the West. I-IV. London 1903/15.<br />
Carro V. D., La teologia y los teölogos-juristas espanoles ante la conquista<br />
<strong>de</strong> America. 2 B<strong>de</strong>. Madrid 1944. 2. A. Salamanca 1951.<br />
— Domingo <strong>de</strong> Soto y el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> gentes. Madrid 1930.115-189: El<br />
concepto <strong>de</strong> ley segun S. Tomas y las mo<strong>de</strong>rnas dictaturas y <strong>de</strong>mocracias.<br />
Cathrein V., SJ, Das jus gentium im römischen <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> beim hl. T.<br />
v. A. In: PJ 2 (1889) 373-388.<br />
— Sozialethik o<strong>de</strong>r Individualethik. In: Philosophisches Jahrbuch<br />
(1892).<br />
— <strong>Recht</strong>, Naturrecht <strong>und</strong> positives <strong>Recht</strong>. 2. A. Frbg. 1909.<br />
— Die Gr<strong>und</strong>lage <strong>de</strong>s Völkerrechts. Frbg. 1918.<br />
— Moralphilosophie. 2 B<strong>de</strong>. 6. A. Lpz. 1924.<br />
Challaye F., Histoire <strong>de</strong> la propriete. 5. Aufl. Paris 1958.<br />
Charles J., Les i<strong>de</strong>es d'Aristote sur l'esclavage d'apres S. T. In: RP 32<br />
(1932) 251-265.<br />
Chenon E., Histoire generale du Droit francais public et prive <strong>de</strong>s origines<br />
ä 1815. 2 B<strong>de</strong>. Paris 1926 u. 1929.<br />
Chenu M.-D., Sufficiens. In: RSPT 22 (1933) 251-259.<br />
Chicca G., Ius: ars boni et aequi. In: RIFD 38 (1961) 457-473.<br />
505
Clemens R., Personnalite morale et personnalite juridique. Paris 1935.<br />
Clement L., Le „jus gentium". In: RUO 9/10 (1940) 100-124, 177-<br />
195.<br />
Clementinus a Vlissingen, De evolutione <strong>de</strong>finitionis iuris gentium.<br />
Studium historico-iuridicum <strong>de</strong> doctrina iuris gentium apud auctores<br />
classicos saec. XIV-XVIII. (Diss.) Rbmae 1940.<br />
Coing H., Die obersten Gr<strong>und</strong>sätze <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. Hei<strong>de</strong>lberg 1947.<br />
— Neue Strömungen in <strong>de</strong>r nordamerikanischen <strong>Recht</strong>sphilosophie.<br />
In: ARSP 38 (1949/50) 536-576.<br />
Contzen H., Zur Würdigung <strong>de</strong>s Mittelalters mit beson<strong>de</strong>rer Berücksichtigung<br />
<strong>de</strong>r Staatslehre <strong>de</strong>s hl. T. v. A. Kassel 1870.<br />
— T. v. A. als volkswirtschaftlicher Schriftsteller. Lpz. 1861.<br />
— Geschichte <strong>de</strong>r volkswirtschaftlichen Literatur im Mittelalter. Lpz.<br />
1869.<br />
Costa-Rossetti J., SJ, Allgemeine Gr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>r Nationalökonomie<br />
im Geiste <strong>de</strong>r Scholastik. Frbg. 1888.<br />
Couvreur G., Les pauvres ont-ils <strong>de</strong>s droits? Recherches sur le vol en<br />
cas d'extreme necessite <strong>de</strong>puis la Concordia <strong>de</strong> Gratien (1140)<br />
jusqu'ä Guillaume d'Auxerre (f 1231). Roma 1961.<br />
Cox J. F., A thomistic analysis of the social or<strong>de</strong>r. (Diss.) Washington<br />
1943.<br />
Crahai, La politique <strong>de</strong> S. T. d'A. Louvain 1896.<br />
Crane P. R., The Range of Social Justice. In: Review of Social Economy<br />
16 (1958) 89-108.<br />
Crofts R. A., The Common Good in the Political Theory of Thomas<br />
Aquinas. In: The Thomist 37 (1973) 155-173.<br />
Daniels D., Die Gemeinschaft bei Max Scheler <strong>und</strong> T. v. A. (Diss.)<br />
München 1926.<br />
Darbellay J., La regle juridique. Son fon<strong>de</strong>ment moral et social. (Diss.)<br />
St. Maurice 1945.<br />
— Le droit naturel et le droit positif <strong>de</strong> la societe politique. In: RT 46<br />
(1946) 540-571.<br />
Däubler W. - Sieling-Wen<strong>de</strong>ling U. - Welkoborsky H., Eigentum<br />
<strong>und</strong> <strong>Recht</strong>. Darmstadt 1976.<br />
Defourny M., Aristote. Theorie economique et politique social.<br />
Annales <strong>de</strong> l'Inst. Sup. <strong>de</strong> Philos. III (1914) 1-135.<br />
— Les theories monetaires <strong>de</strong> S. Thomas. Annales <strong>de</strong> droit et <strong>de</strong> sciences<br />
politiques (Louvain) 6 (1937-1938) 5-32.<br />
— Aristote. L'evolution sociale. Annales <strong>de</strong> l'Inst. Sup. <strong>de</strong> Philos. V<br />
(1924) 531-696.<br />
Defroidmont J., La science du droit positif. Paris 1933.<br />
Delos J. T., OP, Les buts du droit: bien commun, securite, justice. In:<br />
Annuaire <strong>de</strong> l'Institut international <strong>de</strong> philosophie du droit et <strong>de</strong><br />
sociologie juridique 3 (1938) 29-47.<br />
— Un <strong>de</strong>bat sur la personnalite morale <strong>de</strong>s societes. In: La vie intellectuelle<br />
9/53 (1937) 55-65.<br />
506
— Societe et personnalite morale. Chronique Sociale <strong>de</strong> France. Lyon<br />
1938.<br />
— Bien commun. Dictionnaire <strong>de</strong> Sociologie III. Paris 1936. 831-855.<br />
— S. T. d'A. Somme Theologique II-II 57-62. Traduction francaise<br />
par M. S. Gillet OP. Notes et appendices par J. Th. Delos OP. Paris<br />
1932.<br />
— Le probleme <strong>de</strong> civilisation. La nation. 2 B<strong>de</strong>. Montreal 1944.<br />
— La sociologie <strong>de</strong> S. T. et le fon<strong>de</strong>ment du droit international. In:<br />
Ang 22 (1945) 3-16.<br />
— Le probleme <strong>de</strong>s rapports du droit et <strong>de</strong> la morale. In: Archives <strong>de</strong><br />
Philosophie du droit 3 (1933) 84-111.<br />
— La notion juridique <strong>de</strong> la guerre. In: Em<strong>de</strong>s et Recherches (1945)<br />
143-160.<br />
— La societe internationale et les principes du droit public. 2. A. Paris<br />
1950.<br />
Del Vecchio G., Lehrbuch <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sphilosophie. 2. A. Basel 1951.<br />
Demongeot M., La theorie du regime mixte chez S. T. d'A. (Diss.)<br />
Paris (1927).<br />
— Le meilleur regime politique <strong>de</strong> S. T. d'A. Paris 1928.<br />
Dempf A., Sacrum Imperium. Geschichts- <strong>und</strong> Staatsphilosophie <strong>de</strong>s<br />
M.-A. <strong>und</strong> <strong>de</strong>r politischen Renaissance. München 1929.<br />
— Christliche Staatsphilosophie in Spanien. Salzburg 1937.<br />
Demsey B., The Range of Social Justice. In: Social Or<strong>de</strong>r 7 (1957)<br />
20-25.<br />
Deploige S., Le conflit <strong>de</strong> la Morale et <strong>de</strong> la Sociologie. 3. A. Paris<br />
1927.<br />
— La Theorie thomiste <strong>de</strong> la propriete. In: RNP II (1895) 61-82, 163-<br />
175, 286-301.<br />
— S. T. et la famille. In: Annales <strong>de</strong> l'Inst. Sup. <strong>de</strong> Philos. V (1924)<br />
699-738.<br />
DiCarlo E., La filosofia giuridica e politica di S. T. d'A. Palermo 1945.<br />
Didiot J., S.Thomas, est-il socialiste? Paris 1900.<br />
Dietze G., In Defense of Property. Chicago 1963.<br />
Dognin P.-D., Das Eigentum <strong>und</strong> die mo<strong>de</strong>rnen Wirtschaftsstrukturen<br />
nach <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s hl. Thomas von Aquin. In: NO 15 (1961)<br />
321-327, 422-430.<br />
— Economie, jugement distributif et usage commun <strong>de</strong>s biens. In:<br />
RSPT 46 (1962) 217-241.<br />
Doherty R. T., The Relation of the Individual to Society in the Light<br />
of Christian Principles as Expo<strong>und</strong>ed by the Angelic Doctor.<br />
Romae 1957.<br />
Dotres F. X., Santo Tomas y las leyes. Madrid 1932.<br />
Dougherty G. V., The moral basis of social or<strong>de</strong>r according to S. T.<br />
(Diss.) Washington 1941.<br />
Dutoit E., Liberte et bien commun. Lyon 1938.<br />
Dyckmans W., Das mittelalterliche Gemeinschafts<strong>de</strong>nken unter <strong>de</strong>m<br />
Gesichtspunkt <strong>de</strong>r Totalität. Pa<strong>de</strong>rborn 1937.<br />
507
Eigentumsordnung <strong>und</strong> katholische Soziallehre. Hrsg. v. Katholisch-Sozialen<br />
Institut <strong>de</strong>r Erzdiözese Köln. Köln 1970.<br />
En<strong>de</strong>mann W., Studien in <strong>de</strong>r romanisch-kanonistischen Wirtschafts<strong>und</strong><br />
<strong>Recht</strong>slehre. I-II. Berlin 1874-1883.<br />
— Die nationalökonomischen Gr<strong>und</strong>sätze <strong>de</strong>r kanonischen Lehre.<br />
Jena 1863.<br />
En<strong>de</strong>rs J. A., Thomas v. Aquin. In: Staatslexikon <strong>de</strong>r Görresges. Bd. V<br />
704 ff. Frbg. 1897.<br />
— Thomas v. Aquin. Mainz 1910.<br />
Eschmann I. Tn., OP, Der Begriff <strong>de</strong>r „Civitas" bei T. v. A. In:<br />
Catholica 3 (1934) 83-103.<br />
— A thomistic glossary on the principle of the preeminence of a common<br />
good. In: Med St 5 (1943) 126-165.<br />
— Bonum commune melius est quam bonum unius. Eine Studie über<br />
<strong>de</strong>n Wertvorrang <strong>de</strong>s Personalen bei T.v.A. In: Med St 6 (1944)<br />
62-120.<br />
— Studies on the notion of society in S. T. A. In: Med St 8 (1946) 1 -42,<br />
9 (1947) 19-55.<br />
— De societate in genere, quaestio philosophica scholastica. In: Ang<br />
11 (1934) 56-77, 214-227.<br />
— In Defense of Jacques Maritain. In: The Mo<strong>de</strong>rn Schoolman 22<br />
(1945) 193-208.<br />
Faidherbe A. J., OP, La justice distributive. Paris 1934.<br />
Farner K., Christentum <strong>und</strong> Eigentum bis T.v.A. Bern 1947.<br />
Farrell P. M., Sources of St.Thomas' Concept of Natural Law. In:<br />
The Thomist 20 (1957) 237-294.<br />
Farreil W., The natural moral law according to S.T. and Suarez.<br />
(Diss.) Boston 1930.<br />
Adler M. J., The theory of <strong>de</strong>mocracy. In: Thomist 3 (1941)<br />
397-449, 588-652; 4 (1942) 121-181, 286-354, 446-522; 6 (1943)<br />
49-118, 251-277, 367-407; 7 (1944) 80-131.<br />
Ferree W., The Act of Social Justice in the Philosophy of S. T. A. and in<br />
the Encyclicals of Pope Pius XI. (Diss.) Washington 1942. Neudruck:<br />
The Act of Social Justice. Washington 1951.<br />
Feugueray H. R., Essai sur les doctrines politiques <strong>de</strong> S.T. d'A. Paris<br />
1857.<br />
Frank J., Law and the Mo<strong>de</strong>rn Mind. 6. Aufl. London 1949.<br />
Friedmann W., An introduction to world politics. London 1951.<br />
Friel G. Q., Punishment in the philosophy of S.T.A. and among<br />
some primitive peoples. (Diss.) Washington 1939.<br />
Funk F. X., Über die ökonomischen Anschauungen <strong>de</strong>r mittelalterlichen<br />
Theologen. In: Z. f. Ges.-St. 25 (1869) 125ff.<br />
— Geschichte <strong>de</strong>s kirchlichen Zinsverbotes. Tübingen 1876.<br />
— Zins <strong>und</strong> Wucher. Tübingen 1878.<br />
Galan Gutierrez E., La filosofia politica <strong>de</strong> Santo Tomas <strong>de</strong> Aquino.<br />
Madrid 1945.<br />
508
Garnier H., De l'i<strong>de</strong>e du juste prix chez les theologiens et canonistes<br />
du moyen-äge. Paris 1900.<br />
Gayraud, L'antisemitisme <strong>de</strong> S.T.d'A. Paris 1896.<br />
Geiger W., <strong>Gerechtigkeit</strong>. In: Staatslexikon <strong>de</strong>r Görresgesellschaft,<br />
6. A. Bd. 3, 1959, 780-786.<br />
Gemmel J., SJ, Die Justitia in <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s hl. T. In: Sch 12 (1937)<br />
204-228.<br />
Giers J., Zum Begriff <strong>de</strong>r justitia socialis. In: Münchener Theologische<br />
Zeitschrift 7 (1956) 61-74.<br />
— Die <strong>Gerechtigkeit</strong>slehre <strong>de</strong>s jungen Suarez. Edition <strong>und</strong> Untersuchung<br />
seiner römischen Vorlesungen De Iustitia et Iure. Freiburg<br />
i.Br. 1958.<br />
Gillet M. S., OP, Le Moral et le Social d'apres S. T. In: Melanges Thomistes<br />
(Biblioth. Thom. III), Kain 1923, 311-326.<br />
Gilson E., Mediaeval universalism and its present value. New York,<br />
London 1937.<br />
Girard E., Histoire <strong>de</strong> l'economie sociale jusqu'ä la fin du XVI me<br />
siecle. Paris 1900.<br />
Gmür H., T.v.A. <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Krieg. Lpz. 1933.<br />
Goe<strong>de</strong>ckemeyer A., Die Staatslehre <strong>de</strong>s hl. T.v.A. In: Preuß. Jahrbücher<br />
1913 (1903) 348-419.<br />
Grabmann M., Die Kulturphilosophie <strong>de</strong>s hl. T. v. A. Augsburg 1925.<br />
— Das Naturrecht <strong>de</strong>r Scholastik von Gratian bis T.v.A. Mittelalterl.<br />
Geistesleben. 2 B<strong>de</strong>. München 1926/1936.<br />
Graf Th., De subjecto psychico gratiae et virtutum sec. doctrinam<br />
scholasticorum usque ad medium saeculum XIV. Pars prima, De<br />
subjecto virtutum cardinalium. Roma 1935.<br />
Graneris G., Contributi tomistici alla filosofia <strong>de</strong>l diritto. Torino<br />
1945.<br />
Groner F., Der aristotelische Einfluß auf die Privateigentumslehre <strong>de</strong>s<br />
hl. Thomas von Aquin in <strong>de</strong>r Summa Theologica. In: Festschr. für<br />
W. Schöllgen. Düsseldorf 1964. 206-215.<br />
G<strong>und</strong>lach G., SJ, Solidarismus, Einzelmensch, Gemeinschaft. In:<br />
Greg 17 (1936) 269-295.<br />
— Gemeinwohl. In: Staatslexikon <strong>de</strong>r Görresgesellschaft, 6.A. Bd. 3,<br />
1959, 737-740.<br />
— Gesellschaft. In: Staatslexikon <strong>de</strong>r Görresgesellschaft, 6.A. Bd. 3,<br />
1959, 817-822, 842-844.<br />
— Sozialphilosophie. In: Staatslexikon <strong>de</strong>r Görresgesellschaft, 6.A.<br />
Bd. 7, 1962, 337-346.<br />
— Die Ordnung <strong>de</strong>r menschlichen Gesellschaft. 2 B<strong>de</strong>. Köln 1964.<br />
Habermas J. - Luhmann N., Theorie <strong>de</strong>r Gesellschaft o<strong>de</strong>r Sozialtechnologie.<br />
Frankfurt a.M. 1971.<br />
Hagenauer S., Das iustum pretium bei T.v.A. Ein Beitrag zur<br />
Geschichte <strong>de</strong>r objektiven Werttheorie. Sttgt. 1931.<br />
Haring J. B., Der <strong>Recht</strong>s- <strong>und</strong> Gesetzesbegriff in <strong>de</strong>r katholischen<br />
Ethik <strong>und</strong> mo<strong>de</strong>rnen Jurispru<strong>de</strong>nz. Graz 1899.<br />
509
Hässle J., Das Arbeitsethos <strong>de</strong>r Kirche nach T. v. A. <strong>und</strong> Leo XIII.<br />
Frbg. 1923.<br />
Hauschild W.-D., Christentum <strong>und</strong> Eigentum. In: Zeitschrift für<br />
evangelische Ethik 16 (1972) 34-49.<br />
Healy P. J., Historie Christianity and the Social Question. In: The<br />
Catholic University Bulletin 17 (1911).<br />
Hearnshaw F. J. C, The social and political i<strong>de</strong>as of some great<br />
mediaeval thinkers. London 1924.<br />
Heck Ph., Begriffsbildung <strong>und</strong> Interessenjurispru<strong>de</strong>nz. Tübingen<br />
1932.<br />
Heinen W., Die justitia socialis. Düsseldorf 1935.<br />
Hering H., OP, De genuina notione justitiae generalis seu legalis juxta<br />
S.T. In: Ang 14 (1937) 464-487.<br />
— De iustitia legali. Frbg. (Schw.) 1944.<br />
Hertling G. v., Kleine Schriften zur Zeitgeschichte <strong>und</strong> Politik. Frbg.<br />
1987. 127-192.<br />
— Historische Beiträge zur Philosophie. München 1914. 70-96:<br />
T.v.A. <strong>und</strong> die Probleme <strong>de</strong>s Naturrechts.<br />
Heumanns Handlexikon zu <strong>de</strong>n Quellen <strong>de</strong>s römischen <strong>Recht</strong>s.<br />
9. Aufl. von E. Seckel, Jena 1914.<br />
Hey<strong>de</strong> P., Gedanken zur Eigentumsfrage. In: J. Doehring, Hrsg.,<br />
Gesellschaftspol. Realitäten. Gütersloh 1964. 47-70.<br />
Hieronimi G., Der Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls in <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s Solidarismus.<br />
In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie <strong>und</strong> Theologie 12<br />
(1965) 413-425.<br />
Hilgenreiner K., Die Erwerbsarbeit in <strong>de</strong>n Werken <strong>de</strong>s hl. T.v.A.<br />
In: Katholik 1 (1901) 62ff.<br />
Hoban J. H., The thomistic Concept of Person. (Diss.) Washington<br />
1939.<br />
Höffner J., Soziale <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> soziale Liebe. Saarbrücken<br />
1935.<br />
— Wirtschaftsethik <strong>und</strong> Monopole im 15. <strong>und</strong> 16. Jahrh<strong>und</strong>ert. Jena<br />
1941.<br />
— Christentum <strong>und</strong> Menschenwür<strong>de</strong>. Das Anliegen <strong>de</strong>r spanischen<br />
Kolonialethik im gol<strong>de</strong>nen Zeitalter. Trier 1947.<br />
— Die Funktion <strong>de</strong>s Privateigentums in <strong>de</strong>r freien Welt. In: Wirtschaftsfragen<br />
<strong>de</strong>r freien Welt, Festschrift für Ludwig Erhard. Frankfurt<br />
1957.<br />
— Ein Bruch in <strong>de</strong>r christlichen Eigentumslehre? Vom jus gentium<br />
zum jus naturae. In: Spanische Forschungen <strong>de</strong>r Görresgesellschaft,<br />
1.Reihe: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens 19.<br />
Münster 1962. 281-290.<br />
Hohoff W., Die Wertlehre <strong>de</strong>s hl. T.v.A. In: Monatsschr. f. christliche<br />
Sozialreform XV (1893) H. 9 u. 10.<br />
Hoorth F., Bemerkungen zur „Staatslehre Leos XIII.". In: Sch 2<br />
(1927) 563-580.<br />
510
— Totalitätsfor<strong>de</strong>rung <strong>und</strong> Totalitätsgesetz. In: Seh 10 (1935) 321<br />
bis 339.<br />
Horväth A., OP, Eigentumsrecht nach <strong>de</strong>m hl.T.v.A. Graz 1929.<br />
Hugueny E., L'Etat et l'individu. In: Melanges Thomistes (Biblioth.<br />
Thom. III), Kain 1923, 341-360.<br />
Hutchins R., S.T. and the World State. Milwaukee 1949.<br />
Janet P., Histoire <strong>de</strong> la science politique dans ses rapports avec la<br />
morale. 3.A. Paris 1887.<br />
Jansen G., Money is sterile. S. T's principles applied to mo<strong>de</strong>rn economies.<br />
Oxford (o.J.).<br />
Janssen A., Doctrina S. Thomae <strong>de</strong> obligatione laborandi. In: ETL 1<br />
(1924) 355-368.<br />
Janssens E., La coutume, source formelle <strong>de</strong> droit d'apres S.T. et<br />
d'apres Suarez. In: RT 36 (1931) 681-726.<br />
Janssens L., Personne et societe. Gembloux 1939.<br />
Jarlot G., Propriete, droit naturel et bien commun: les pauvres ont-ils<br />
<strong>de</strong>s droits? In: Nouvelle Revue Theologique 85 (1963) 618-630.<br />
Jerusalem F. W., Kritik <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>swissenschaft. Frkf. 1948.<br />
La justice. In: Revue internationale <strong>de</strong> philosophie 11, 41 (1957).<br />
Kaczynski E., II „naturale dominium" <strong>de</strong>lla IIa Ilae, 66, 1, e le sue<br />
interpretazioni mo<strong>de</strong>rne. In: Ang 53 (1976) 453-477.<br />
Kaibach R., OFMCap, Das Gemeinwohl <strong>und</strong> seine ethische Be<strong>de</strong>utung.<br />
Düsseldorf 1928.<br />
Keesen, La mission <strong>de</strong> l'Etat d'apres la doctrine et la metho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
S.T.d'A. Bruxelles 1890.<br />
Kelsen H., Reine <strong>Recht</strong>slehre. 2.A. Wien 1960.<br />
Killeen S. M., The Philosophy of labour in S.T. (Diss.) Washington<br />
1939.<br />
Kinkel J., Die sozialökonomischen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>r Staats- <strong>und</strong> Wirtschaftslehren<br />
von Aristoteles. Lpz. 1911.<br />
Kleckow M., Die <strong>Recht</strong>fertigung <strong>de</strong>s Eigentums <strong>und</strong> <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sbegriff<br />
nach christlich-mittelalterlicher Auffassung unter beson<strong>de</strong>rer<br />
Berücksichtigung <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>s- <strong>und</strong> Soziallehre <strong>de</strong>s hl.T.v.A.<br />
Breslau 1939.<br />
Kleinhappl J., SJ, Die Lehre <strong>de</strong>s hl. T. v. A. über <strong>de</strong>n „valor commutativus"<br />
in <strong>de</strong>r Lectio IX seines Kommentars zur Nikomachischen<br />
Ethik. In: Zeitschr. f. kath. Theologie 62 (1935) 443-456.<br />
Klose A., Zur Gemeinwohlproblematik - Perspektiven einer gemeinwohlorientierten<br />
Politik aus <strong>de</strong>r Sicht christlicher Sozialethik. In:<br />
A.Rauscher, Hrsg., Selbstinteresse <strong>und</strong> Gemeinwohl, Berlin 1985,<br />
495-543.<br />
Klose A., Schambeck H., Weiler R., Hrsg., Das Neue Naturrecht.<br />
Die Erneuerung <strong>de</strong>r Naturrechtslehre durch Johannes Messner.<br />
Berlin 1985.<br />
Klüber F., Der Ort <strong>de</strong>s Privateigentums im System <strong>de</strong>s Naturrechts.<br />
In: NO 13 (1959) 81-97.<br />
511
— Eigentumstheorie <strong>und</strong> Eigentumspolitik. Begründung <strong>und</strong> Gestaltung<br />
<strong>de</strong>s Privateigentums nach katholischer Gesellschaftslehre.<br />
Osnabrück 1963.<br />
De Köninck Ch., In Defence of S.T. A Reply to Father Eschmann's<br />
Attack on the Primacy of the Common Good. In: Laval theologique<br />
et philosophique. 1, II (1945) 9-109.<br />
— De la Primaute du bien commun contre les personnalistes. Quebec,<br />
Montreal 1943.<br />
Kopp R., Vaterland <strong>und</strong> Vaterlandsliebe nach <strong>de</strong>r christlichen Moral<br />
mit beson<strong>de</strong>rer Berücksichtigung <strong>de</strong>s hl.T. v. A. (Diss.) Luzern<br />
1915.<br />
Korvin-Krasinski C. v., Gr<strong>und</strong>unterscheidungen im Naturrecht auf<br />
Eigentum. In: NO 17 (1963) 91-103.<br />
— Die Problematik <strong>de</strong>s Gemeinwohls auf Weltebene. In: NO 21<br />
(1967) 419-431.<br />
Kötzschke R., Allgemeine Wirtschaftsgeschichte <strong>de</strong>s Mittelalters. Jena<br />
1924.<br />
Kraus J. B., SJ, Scholastik, Puritanismus <strong>und</strong> Kapitalismus. München,<br />
Lpz. 1930.<br />
Kühle H., Staat <strong>und</strong> To<strong>de</strong>sstrafe. Münster 1934.<br />
Kuhlmann B. C, OP, Der Gesetzesbegriff beim hl. T. v. A. im Lichte<br />
<strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>sstudiums seiner Zeit. Bonn 1912.<br />
Kuhn F., Die Probleme <strong>de</strong>s Naturrechts bei T.v.A. Erlangen 1909.<br />
Kulischer J., Allgemeine Wirtschaftsgeschichte I (Das M.-A.). München<br />
1928.<br />
Küng E., Eigentum <strong>und</strong> Eigentumspolitik. Tübingen 1964.<br />
Kurz E., OFM, Individuum <strong>und</strong> Gemeinschaft beim hl. T. v. A. München<br />
1932.<br />
Lachance L., OP, L'humanisme politique <strong>de</strong> S.T. Individu et Etat.<br />
2 B<strong>de</strong>. Paris, Ottawa 1939.<br />
— La nation. In: Activites philosophiques (Montreal) (1945/1946) 81-<br />
104.<br />
— Le sujet du droit international. Madrid 1947.<br />
— Le concept <strong>de</strong> Droit selon Aristote et S.T. 2. A. Ottawa, Montreal<br />
1948.<br />
Lallement D., La doctrine politique <strong>de</strong> S.T.d'A. In: RP 27 (1927)<br />
353-379, 465-488; 29 (1929) 71-86.<br />
Lantz G., Eigentumsrecht - ein <strong>Recht</strong> o<strong>de</strong>r ein Unrecht? Uppsala<br />
1977.<br />
Larkin P., Property in the eighteenth Century. 1930.<br />
Lasars W., Die klassisch-utilitaristische Begründung <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Berlin 1982.<br />
Laski H. J., Grammar of Politics. 1941.<br />
Lauterpacht H., Recognition in International Law. Cambridge 1947.<br />
Lavaud B., OP, La philosophie du Bolchevisme. In: RT 37 (1932)<br />
599-633.<br />
512
— Le mariage en droit naturel selon T.d'A. In: Studia Gnesnensia 12<br />
(1935) 353-383.<br />
Laversin M. J., Droit naturel et droit positif d'apres S.T. In: RT 38<br />
(1933) 3-49, 177-216.<br />
Leclercq J., Lecons <strong>de</strong> droit naturel. I-IV. Louvain 1946-1950.<br />
Lefebvre Ch., La notion d'equite chez Pierre Lombard. In: Miscellanea<br />
Lombardiana. Novara 1957. 223-229.<br />
Le Foyer J., Expose du droit penal normand au XIIF siecle. Paris<br />
1931.<br />
Leisching P., Der Begriff <strong>de</strong>s bonum commune bei Thomas von<br />
Aquino. In: Oesterreichische Zeitschrift für öffentliches <strong>Recht</strong> 11<br />
(1960/61) 15-26.<br />
Lemmonyer A., Tonneau J. et Tron<strong>de</strong> R., Precis <strong>de</strong> sociologie. Marseille<br />
1934.<br />
Lener S., Ii „Diritto naturale appogiato sul fatto" <strong>de</strong>l P. Taparelli e<br />
l'antigiusnaturalismo contemporaneo. In: La Civiltä Cattolica<br />
114,4 (1963) 346-359, 594-607.<br />
Lenz J., Die Personwür<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Menschen bei T.v.A. In: PJ 49 (1936)<br />
138-166.<br />
Leon P., Doctrines sociales et politiques au Moyen-Age. In: Archives<br />
<strong>de</strong> philosophie du droit et <strong>de</strong> sociologie juridique (1932).<br />
Lessei K., Die Entwicklungsgeschichte <strong>de</strong>r kan.-schol. Wucherlehre<br />
im 13.Jh. Luxembg. 1905.<br />
Liberatore M., SJ, Ethicae et iuris naturae elementa. Napoli 1846.<br />
Linhardt R., Die Sozialprinzipien <strong>de</strong>s hl.T.v.A. Frbg. 1932.<br />
Lio E., II testo di S. Agostino „Justitia (est) in subveniendo miseris" in<br />
Pier Lombardo e nei suoi glossatori fino a S.Tommaso d'Aquino.<br />
In: Miscellanea Lombardiana. Novara 1957. 175-222.<br />
— De jure ut obiecto justitiae apud S.Thomam, II-II, q. 57, a. 1. In:<br />
Apollinaris 32 (1959) 16-71.<br />
Lipinski B., Divi Thomae <strong>de</strong> usu divitiarum doctrina. Frbg. (Schw.)<br />
1910.<br />
Lottin O., OSB, Le droit naturel chez S. T. d'A. et ses pre<strong>de</strong>cesseurs.<br />
2.A. Bruges 1931.<br />
— Psychologie et morale au XIF et XIIF siecles. II-III. Problemes <strong>de</strong><br />
morale. Louvain-Gembloux 1948/1949.<br />
Lumia G., La giustizia. Consi<strong>de</strong>razioni storico-critiche. In: RIFD 38<br />
(1961) 255-280.<br />
MacPherson C. B., ed., Property. Toronto 1978.<br />
Majdanski C, Le röle <strong>de</strong>s biens exterieurs dans la vie morale d'apres<br />
S.T.d'A. (Diss.) Vanves (Seine) 1951.<br />
Malagola A., Le teorie politiche di S. Tommaso d'Aquino. Bologna<br />
1912.<br />
Mandonnet P., OP, S.T. d'A. et les sciences sociales.In: RT 20 (1912)<br />
654-665.<br />
Manser G., OP, Die Frauenfrage nach T.v.A. Ölten 1919.<br />
— Der Staat. In: DTF 24 (1946) 45-79.<br />
513
— Die Individualnatur <strong>de</strong>s Menschen <strong>und</strong> ihre Sozialanlage. In: DTF<br />
18 (1940) 130-141.<br />
— Das Naturrecht in thomistischer Beleuchtung. Frbg. (Schw.) 1944.<br />
— Angewandtes Naturrecht. Frbg. (Schw.) 1947.<br />
Maritain J., Du regime temporel et <strong>de</strong> la liberte. Paris 1933.<br />
— La personne et le bien commun. Paris 1947.<br />
— Les droits <strong>de</strong> l'homme et la loi naturelle. 2. A. Paris 1945.<br />
— Christianisme et <strong>de</strong>mocratie. 2. A. Paris 1945. Übersetzung von F.<br />
Schmal: Christentum <strong>und</strong> Demokratie. Abendländische Reihe 11.<br />
Augsburg 1949.<br />
— Principes d'une politique humaniste. 2. A. Paris 1945.<br />
— The Person and the Common Good. Notre Dame/Ind. 1966.<br />
Martinez M. L., Distributive Justice according to S.T. In: The<br />
Mo<strong>de</strong>rn Schoolman 24 (1946/1947) 208-223.<br />
Martyniak C, Le fon<strong>de</strong>ment objectif du droit d'apres S. T. d'A. Paris<br />
1931.<br />
Mathis B., <strong>Recht</strong>spositivismus <strong>und</strong> Naturrecht. Pa<strong>de</strong>rborn 1933.<br />
Maurenbrecher M., Thomas v. Aquinos Stellung zum Wirtschaftsleben<br />
seiner Zeit. l.H. Lpz. 1898 (vgl. v. Hertlings Besprechung<br />
dieser Schrift in PJ, 1898, 456ff.).<br />
Mausbach J., Naturrecht <strong>und</strong> Völkerrecht. Frbg. 1918.<br />
Mayer E., Italienische Wirtschaftsgeschichte. 2 B<strong>de</strong>. Lpz. 1909. Frbg.<br />
1927.<br />
Mayer J., Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker. Frbg.<br />
1927.<br />
— Gemeinn<strong>utz</strong> vor Eigenn<strong>utz</strong>. In: Jb. <strong>de</strong>r Caritas-Wissenschaft (1935)<br />
185-197.<br />
McDonald W. J., Communism in E<strong>de</strong>n? In: NS 20 (1946) 101-125.<br />
— The social value of property according to S.T. A. (Diss.) Washington<br />
1939.<br />
McLaren D., Private property and the natural law. Oxford 1949.<br />
Menen<strong>de</strong>z-Reigada I., La teoria penalista <strong>de</strong> San Tomas. In: CT 64<br />
(1943) 273-292.<br />
Messner J., Sozialökonomik <strong>und</strong> Sozialethik. Pa<strong>de</strong>rborn 1927.<br />
— Das Naturrecht. Handbuch <strong>de</strong>r Gesellschaftsethik, Staatsethik <strong>und</strong><br />
Wirtschaftsethik. Innsbruck - Wien 1950. 5.A. 1966, 7.A. Berlin<br />
1984.<br />
— Das Gemeinwohl. Osnabrück 1968.<br />
Meyer Th., SJ, Institutiones juris naturalis seu philosophiae moralis<br />
universae sec<strong>und</strong>um principia S. Thomae Aquinatis. Pars I. Jus<br />
naturae generale. Frbg. 1885. Pars II. Jus naturae speciale. Frbg.<br />
1900.<br />
Michel S., La notion thomiste du bien commun. Quelques-unes <strong>de</strong> ses<br />
applications juridiques. Paris 1932.<br />
Miscellanea Taparelli. Analecta Gregoriana 133. Roma 1964.<br />
Mitteis H., Über das Naturrecht. Berlin 1948.<br />
514
Mod<strong>de</strong> A., Le bien commun dans la philosophie <strong>de</strong> S.T. In: RPL 47<br />
(1949) 221-247.<br />
Mongillo D., La struttura <strong>de</strong>l „De iustitia". Summa Theologiae II-II<br />
qq 57-122. In: Ang 48 (1971) 355-377.<br />
Monieon J. <strong>de</strong>, Petites notes autour <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong> la cite. In: Laval<br />
theologique et philosophique 3 (1947) 262-289.<br />
Mörsdorf K., Aequitas. In: Staatslexikon <strong>de</strong>r Görresgesellschaft,<br />
6.Aufl., Bd.I, 1957, 54-60.<br />
Mounier E., De la propriete capitaliste ä la propriete humaine. Paris<br />
1936. Deutsche Übersetzung: Vom kapitalistischen Eigentumsbegriff<br />
zum Eigentum <strong>de</strong>s Menschen. Luzern 1936.<br />
Muhfer E., Die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>s gerechten Lohnes. München 1924.<br />
Müller A., SJ, La Morale et les Affaires. Tournai, Paris 1951.<br />
Müller K., Die Arbeit nach <strong>de</strong>n moralisch-philos. Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>de</strong>s hl.<br />
T.v.A. Frbg. (Schw.) 1912.<br />
— Der Staat in seinen Beziehungen zur sittlichen Ordnung bei T. v. A.<br />
Eine staatsphilosophische Untersuchung. Münster 1916.<br />
Muriel R., Trascen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la persona en el bien comün <strong>de</strong>l universo.<br />
In: Estudios Filosoficos 6 (1957) 231-243.<br />
Nawroth E., Ganzheitliches Gesellschaftsordnungs<strong>de</strong>nken. In: NO<br />
20 (1966) 401-416; 21 (1967) 16-31.<br />
Negro Fr., Das Eigentum. Geschichte <strong>und</strong> Zukunft. Berlin 1963.<br />
Nefl-Breuning O. v., SJ, Gr<strong>und</strong>züge <strong>de</strong>r Börsenmoral. Freiburg 1928.<br />
— Zins. In: Staatslexikon <strong>de</strong>r Görresgesellschaft, 5. Aufl., Bd. V, 1932,<br />
1600-1624.<br />
— Die Eigentumsfrage in neueren kirchenlehramtlichen Verlautbarungen.<br />
In: Trierer Theologische Zeitschrift 60 (1951) 31 ff.<br />
— Die Eigentumsfrage in <strong>de</strong>n Dokumenten <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre.<br />
In: Stimmen <strong>de</strong>r Zeit 197 (1979) 347-349.<br />
— <strong>Gerechtigkeit</strong> <strong>und</strong> Freiheit. Wien 1980.<br />
— <strong>und</strong> Sacher H., Beiträge zu einem Wörterbuch <strong>de</strong>r Politik. H. 1-6.<br />
Frbg. 1947 ff.<br />
Nußbaumer A., Der hl. T. <strong>und</strong> die rechtliche Stellung <strong>de</strong>r Frau. In:<br />
DTF 11 (1933) 63-75, 138-156.<br />
O'Connor D. J., Aquinas and natural law. London 1967.<br />
Olgiati F.,Ii concetto di giuridicitä e S.T. d'A. 2. A. Milano 1944. 3. A.<br />
1951 (Neudruck).<br />
— Indagini e discussioni intorno al concetto di giuridicitä. Milano<br />
1944.<br />
Olivier-Martin Fr., Histoire du Droit Francais <strong>de</strong>s origines ä la Revolution.<br />
Montchrestien 1948.<br />
Orabona L., Cristianesimo e proprietä. Saggio sulle fonti antiche.<br />
Roma 1964.<br />
O'Rahilly A., S.T. on Credit. In: Irish Eccles. Record 64 (1928) 159-<br />
186.<br />
Orel A., Oeconomia perennis. 2 B<strong>de</strong>. Mainz 1930.<br />
Orlich A., L'uso <strong>de</strong>i beni nella morale di S.T. (Diss.) Monza 1913.<br />
515
Ostiguy R., De la nature du droit selon S.T. In: RUO 17 (1947) 69*-<br />
112*.<br />
Palacio J. M., Enchiridion sobre la propiedad. Concepto cristiano <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>recho <strong>de</strong> propiedad y <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> las riquezas. Madrid 1935.<br />
Parel A. - Flanagan Th., ed., Theories of property. Waterloo/Ont.<br />
1979.<br />
Passerin d'Entreves A., S.T.d'A. Scritti politici. Bologna 1946.<br />
Patrono A., II pensiero politico di S.T.d'A. Genova 1940.<br />
Paulus N., Die Wertung <strong>de</strong>r weltlichen Berufe im Mittelalter. In:<br />
Historisches Jahrbuch 32 (1911) 725 ff.<br />
Pegues T., La theorie du pouvoir d'apres S.T. In: RT 19 (1911) 591-<br />
616.<br />
Peläez A. G., Doctrina tomista sobre la tirania politica. In: CT 30<br />
(1924) 313-331.<br />
— Teoria <strong>de</strong> honor en la moral tomista. In: CT 31 (1925) 5-25.<br />
Perez B. A., En pos <strong>de</strong> la paz. Normas etico-juridicas que, segtin<br />
S. Tomas <strong>de</strong> Aquino y sus principales commentadores, <strong>de</strong>ben regulär<br />
la duraciön, ejercicio y terminaciön <strong>de</strong> la guerra. Lima 1928.<br />
Perez Garcia J., De principiis functionis socialis proprietatis privatae<br />
apud divum Thomam Aquinatem. (Diss. Frib.) Abulae 1924.<br />
Perticone G., In tema di diritto e giustizia. Milano 1961.<br />
Pesch H., SJ, Das Privateigentum als soziale Institution. 2. A. Frbg.<br />
1900.<br />
Petit Cl., Les enseignements juridiques et sociaux <strong>de</strong> S.T. In: Chron.<br />
soc. <strong>de</strong> France 33 (1924) 339ff., 426ff.<br />
La Pira G., Indirizzo e conquiste <strong>de</strong>lla filosofia neo-scolastica italiana.<br />
In: RFN 26 (1934) Suppl. 193-205.<br />
— Ii valore <strong>de</strong>üa persona. Milano 1947.<br />
Pöhlmann R., Geschichte <strong>de</strong>r sozialen Frage <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Sozialismus in<br />
<strong>de</strong>r antiken Welt. 3.A. München 1925.<br />
II problema <strong>de</strong>lla giustizia. In: RIFD 39 (1962) 47-221.<br />
Prümmer D., Manuale Theologiae Moralis. 9. Aufl. Freiburg 1940.<br />
Quillet H. R., Doctrina socialis et politica divi Thomae Aquinatis.In:<br />
Rev. <strong>de</strong>s sciences eccles. 9 (1894) 340-355.<br />
Ramirez S., El <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> gentes. Madrid 1955.<br />
— Pueblo y gobierno al servicio <strong>de</strong>l bien comün. Madrid 1956.<br />
Ratzinger G., Die Volkswirtschaft in ihren sittlichen Gr<strong>und</strong>lagen.<br />
2.A. Frbg. 1895.<br />
Rauscher A., Privater <strong>und</strong> sozialer Wohlstand. In: F. Groner, Hrsg.,<br />
Kirche im Wan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r Zeit, Köln 1971, 479-494.<br />
— (Hrsg.), Selbstinteresse <strong>und</strong> Gemeinwohl. Berlin 1985.<br />
Rawls J., Eine Theorie <strong>de</strong>r <strong>Gerechtigkeit</strong>. Frankfurt 1978.<br />
Renard R. G., OP, L'entreprise et sa finance. In: RSPT 25 (1936) 645-<br />
657.<br />
— La philosophie <strong>de</strong> l'institution. Essai d'ontologie juridique. I. Partie<br />
juridique. Paris 1939.<br />
— Droit romain et pensee chretienne. In: RSPT 27 (1938) 53-62.<br />
516
— et Trotabas L., La fonction sociale <strong>de</strong> la propriete privee. Paris<br />
1930.<br />
Renaudiere <strong>de</strong> Paulis D., La naturaleza <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> gentes y la ley<br />
natural. In: Sapientia 13, 49 (1958) 219-223.<br />
Renz O., Die Synteresis nach <strong>de</strong>m hl. T. v. A. Beiträge X 1/2. Münster<br />
1911.<br />
— Die Lösung <strong>de</strong>r Arbeiterfrage durch die Macht <strong>de</strong>s <strong>Recht</strong>s. Luzern<br />
1927.<br />
— Das Dienstverhältnis. Ein Beitrag zum Familienrecht <strong>und</strong> zur<br />
Arbeiterfrage. In: Xenia thomistica I 475-506.<br />
Riedl C, The social theory of S.T.A. Phila<strong>de</strong>lphia 1934.<br />
Robert M., Hierarchie necessaire <strong>de</strong>s fonctions economiques d'apres<br />
S.T.d'A. In: RT 21 (1913) 419-431.<br />
— La doctrine sociale <strong>de</strong> S.T. et sa realisation dans les faits. In: RT 20<br />
(1912) 49-65.<br />
Robillard J. A., Sur la Condition (status) en S.T. In: RSPT 25 (1926)<br />
104-107.<br />
Rocha M., Les origines <strong>de</strong> „Quadragesimo anno". Travail et salaire ä<br />
travers la scolastique. Paris 1933.<br />
Rohner A., OP, Naturrecht <strong>und</strong> positives <strong>Recht</strong>. In: DTF 12 (1934)<br />
59-83.<br />
Rolland-Gosselin B., La doctrine politique <strong>de</strong> S.T. Paris 1928.<br />
Rommen H., Der Staat in <strong>de</strong>r katholischen Gedankenwelt. Pa<strong>de</strong>rborn<br />
1935.<br />
— Die ewige Wie<strong>de</strong>rkehr <strong>de</strong>s Naturrechts. 2.A. München 1947.<br />
DeRooy P., OP, La nature <strong>de</strong> la Societe selon S.T. In: Ang 6 (1929)<br />
483-496.<br />
— Philosophia socialis. Rom 1937.<br />
Ryan J. A., Alleged Socialism of the Church Fathers. St. Louis 1913.<br />
Salleron L., Six etu<strong>de</strong>s sur la propriete collective. Paris 1964.<br />
Sandoz A., La notion <strong>de</strong> juste prix. In: RT 45 (1939) 285-305.<br />
Sauer W., Die <strong>Gerechtigkeit</strong>. Berlin 1959.<br />
Sauter J., Thomistische Gesellschaftslehre. In: Hdb. d. Staatswissenschaften.<br />
4.A. 1928. Bd. 8, 244ff.<br />
Schaller L., OP, Der <strong>Recht</strong>sformalismus Kelsens <strong>und</strong> die thomistische<br />
<strong>Recht</strong>sphilosophie. (Diss.) Frbg. (Schw.) 1949.<br />
Schaub F., Die Eigentumslehre nach T.v.A. <strong>und</strong> <strong>de</strong>m mo<strong>de</strong>rnen<br />
Sozialismus. Frbg. 1898.<br />
— Der Kampf gegen <strong>de</strong>n Zinswucher <strong>und</strong> unlauteren Han<strong>de</strong>l im M.-A.<br />
von Karl d. Gr. bis Papst Alexan<strong>de</strong>r III. Frbg. 1905.<br />
— Studien zur Geschichte <strong>de</strong>r Sklaverei im Frühmittelalter. Berlin-<br />
Lpz. 1913.<br />
Schaube A., Han<strong>de</strong>lsgeschichte <strong>de</strong>r romanischen Völker. München<br />
1906.<br />
Schäzler C. v., Divus Thomas contra Liberalismum. Rom 1874.<br />
Schickling H., Sinn <strong>und</strong> Grenze <strong>de</strong>s aristotelischen Satzes „Das<br />
Ganze ist vor <strong>de</strong>m Teil". München 1936.<br />
517
Schilling O., Reichtum <strong>und</strong> Eigentum in <strong>de</strong>r altkirchlichen Literatur.<br />
Frbg. 1908.<br />
— Das Völkerrecht nach T.v.A. Frbg. 1919.<br />
— Katholische Sozialethik. München 1929.<br />
— Die christliche Soziallehre. München (1926).<br />
— Der kirchliche Eigentumsbegriff. 2.A. Frbg. 1930.<br />
— Die Staats- <strong>und</strong> Soziallehre <strong>de</strong>s hl.T.v.A. 2.A. München 1930.<br />
— Christliche Gesellschaftslehre. Frbg. 1926.<br />
— Christliche Staatslehre <strong>und</strong> Politik. M.-Gladbach (1927).<br />
— Katholische Wirtschaftsethik. München 1933.<br />
— Christliche Gesellschaftslehre. Sozialistische o<strong>de</strong>r christliche Kultur?<br />
München 1949.<br />
— Christliche Sozial- <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>sphilosophie. 2.A. München 1950.<br />
Schmölz F.-M., Der gesellschaftliche Mensch <strong>und</strong> die menschliche<br />
Gesellschaft bei Thomas von Aquin. In: NO 16 (1962) 328-335.<br />
Schneid M., Die Philosophie <strong>de</strong>s hl.T.v.A. <strong>und</strong> ihre Be<strong>de</strong>utung für<br />
die Gegenwart. Würzburg 1881.<br />
— Die Staatslehre <strong>de</strong>s hl.T.v.A. Hist.-Politische Blätter 77 (1876).<br />
Schnei<strong>de</strong>r C. M., Die sozialistische Staatsi<strong>de</strong>e, beleuchtet durch<br />
T.v.A. Pa<strong>de</strong>rborn 1894.<br />
Schnei<strong>de</strong>r F., Das kirchliche Zinsverbot <strong>und</strong> die kuriale Praxis im<br />
13.jh. In: Festgabe f. H. Finke. Münster 1904. 129ff.<br />
Schnürer G., Inquisition. In: LThK V, 1933, 419ff.<br />
Schreiber E., Die volkswirtschaftlichen Anschauungen <strong>de</strong>r Scholastik<br />
seit T.v.A. Jena 1913.<br />
Schreyvogel F., Ausgewählte Schriften zur Staats- <strong>und</strong> Wirtschaftslehre<br />
<strong>de</strong>s T.v.A. Jena 1923.<br />
Schulte K., Gemeinschaft <strong>und</strong> Wirtschaft im Denken <strong>de</strong>s T.v.A.<br />
Pa<strong>de</strong>rborn 1925.<br />
— Staat <strong>und</strong> Gesellschaft im Denken <strong>de</strong>s T.v.A. Pa<strong>de</strong>rborn 1927.<br />
Schumacher H., The social message of the New Testament. Milwaukee<br />
1937.<br />
Schuster J. B., SJ, Die Soziallehre nach Leo XIII. <strong>und</strong> Pius XI. Frbg.<br />
1935.<br />
Schwa<strong>de</strong>rlapp W., Eigentum <strong>und</strong> Arbeit bei Oswald von Nell-Breuning.<br />
Düsseldorf 1980.<br />
Schwalm B., OP, La societe et l'etat. Paris 1937.<br />
— Individualisme et solidarite. In: RT 6 (1898) 65-99.<br />
— La propriete d'apres la philosophie <strong>de</strong> S.T. d'A. In: RT 3 (1895)<br />
281-307, 634-660.<br />
Schwer W., Katholische Gesellschaftslehre. Pa<strong>de</strong>rborn 1928.<br />
Seipel I., Die wirtschaftsethischen Lehren <strong>de</strong>r Kirchenväter. Wien<br />
1907.<br />
Sertillanges A. D., OP, La philosophie morale <strong>de</strong> S.T.d'A. Paris<br />
1922.<br />
Simon Y., Trois lecons sur le travail. Paris 1938.<br />
— Nature and function of authority. Milwaukee/Wisc. 1940.<br />
518
Simone L. <strong>de</strong>, La giustizia secondo S.T. Saggio sulla 58* questione<br />
<strong>de</strong>lla Somma Teologica II-II". Napoli 1941.<br />
Sohm R., Institutionen. Geschichte <strong>und</strong> System <strong>de</strong>s römischen Privatrechtes.<br />
München, Lpz. 1919 16 .<br />
Sombart W., Der mo<strong>de</strong>rne Kapitalismus. 2 B<strong>de</strong>. 6. A. München 1924.<br />
Sommerlad Th., Das Wirtschaftsprogramm <strong>de</strong>r Kirche <strong>de</strong>s Mittelalters.<br />
Lpz. 1903.<br />
Sorgenfrei H., Die geistesgeschichtlichen Hintergrün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sozialenzyklika<br />
„Rerum novarum" Papst Leos XIII. vom 15. Mai 1891.<br />
Hei<strong>de</strong>lberg 1970.<br />
Sousberghe L. <strong>de</strong>, SJ, Propriete „<strong>de</strong> droit naturel". These neo-scolastique<br />
et tradition scolastique. In: Nouvelle Revue Theologique 72<br />
(1950) 580-607.<br />
Spicq C, OP, L'aumone: Obligation <strong>de</strong> justice ou <strong>de</strong> charite? S.T.,<br />
Summa Theol. II-II q. 32 a. 5. In: Melanges Mandonnet 1,245-264.<br />
— Notes <strong>de</strong> lexicographie philosophique medievale: „Dominium,<br />
possessio, proprietas" chez S.T. et chez les juristes romains. In:<br />
RSPT 18 (1929) 269-281.<br />
— La notion analogique <strong>de</strong> „Dominium" et le droit <strong>de</strong> propriete. In:<br />
RSPT 20 (1931) 53-76.<br />
— Note <strong>de</strong> lexicographie philosophique medievale: „Potestas procurandi<br />
et dispensandi" (II-II q. 66 a. 2). In: RSPT 23 (1934) 82-93.<br />
Vgl. auch: Notes et Communications du BT 1 (1931-1933) 62*-<br />
68*.<br />
Spranger E., Zur Frage <strong>de</strong>s Naturrechts. In: Universitas 3 (1948) 405-<br />
420.<br />
Stammler R., Die Lehre vom richtigen <strong>Recht</strong>. 2.A. Lpz. 1922.<br />
— Lehrbuch <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>sphilosophie. 3.A. Berlin 1928.<br />
Stein E., Individuum <strong>und</strong> Gemeinschaft. In: Jb. f. Philos. <strong>und</strong> phaen.<br />
Forschung 5 (1922) 116-267.<br />
Stepa J., Le caractere total <strong>de</strong> l'Etat d'apres S.T. d'A. In: Studia Gnesnensia<br />
12 (1935) 439-442.<br />
Steuer G., Studien über die theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>r Zinslehre<br />
bei T.v.A. Stuttgart 1936.<br />
Stockums W., Die Unverän<strong>de</strong>rlichkeit <strong>de</strong>s natürlichen Sittengesetzes<br />
in <strong>de</strong>r scholastischen Ethik. Münster 1911.<br />
Sutherland A. E., The Law and One Man among Many. Madison<br />
1956.<br />
Sylvestre P. A., Le tout physique et le tout social. In: RUO 6 (1937)<br />
93-112.<br />
Tammelo J., Untersuchungen zum Wesen <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>snorm. Willsbach<br />
u. Hei<strong>de</strong>lbg. 1947.<br />
Taparelli A., SJ, Saggio teoretico di diritto naturale appogiato sul<br />
fatto. 2 vol. Palermo 1840/41. Deutsche Ausgabe: Versuch eines auf<br />
Erfahrung begrün<strong>de</strong>ten Naturrechts. 2 B<strong>de</strong>. Regensburg 1845.<br />
— Essai sur les principes philosophiques <strong>de</strong> l'economie politique. Paris<br />
1943.<br />
519
Thieme, K., Fö<strong>de</strong>ralismus <strong>und</strong> Subsidiaritätsprinzip. In: Politeia 1<br />
(1948/49) 11-18.<br />
Thomann M., Une source peu connue <strong>de</strong> l'Encyclopedie: L'influence<br />
<strong>de</strong> Christian Wolff. Paris 1970.<br />
— Einführung zu: Christian Wolff, Jus gentium, Hil<strong>de</strong>sheim 1972.<br />
— Einführung zu: Christian Wolff, Jus naturae, Hil<strong>de</strong>sheim 1972.<br />
Tischle<strong>de</strong>r P., Die Staatslehre Leos XILI. M.-Gladbach 1925.<br />
— Staatsgewalt <strong>und</strong> katholisches Gewissen. 1927.<br />
— Ursprung <strong>und</strong> Träger <strong>de</strong>r Staatsgewalt. M.-Gladbach 1923.<br />
— Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Franziskus von Vittoria für die Wissenschaft <strong>de</strong>s<br />
Völkerrechts. In: Aus Ethik <strong>und</strong> Leben. Festgabe f. J. Mausbach.<br />
Hrsg. v. M. Meinerts <strong>und</strong> A. Don<strong>de</strong>rs. Münster 1931. 90-106.<br />
Tomberg V., Degeneration <strong>und</strong> Regeneration <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>swissenschaft.<br />
Bonn 1946.<br />
Tonneau J., OP, Propriete. In: Dict. Theol. Cath. XIII (1936) 757-<br />
846.<br />
Trappe P., Soziale Norm, Normalität <strong>und</strong> Wirklichkeit. In: P.<br />
Trappe, Kritischer Realismus in <strong>de</strong>r <strong>Recht</strong>ssoziologie. Wiesba<strong>de</strong>n<br />
1983, 67-84.<br />
— Die elitären Macht! <strong>de</strong>r Gesellschaft - o<strong>de</strong>r: Über die<br />
Geschlossenheit <strong>de</strong>r offenen Gesellschaft. In: A.F.Utz, Hrsg., Die<br />
offene Gesellschaft <strong>und</strong> ihre I<strong>de</strong>ologien, Bonn 1986, 271-310.<br />
Tremblay J. J., Le patriotisme. In: RUO 8 (1939) 73*-93*, 205*-<br />
229*.<br />
Truyol Serra A., Los principios <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho püblico en Francisco <strong>de</strong><br />
Vitoria. Selecciön <strong>de</strong> textos, con introducciön y notas. Madrid<br />
1946. Deutsche Übersetzung von C. J. Keller-Senn: Truyol Serra<br />
A., Die Gr<strong>und</strong>sätze <strong>de</strong>s Staats- <strong>und</strong> Völkerrechts bei Francisco <strong>de</strong><br />
Vitoria. Auswahl <strong>de</strong>r Texte, Einführungen <strong>und</strong> Anmerkungen.<br />
Zürich 1947.<br />
U<strong>de</strong> J., Soziologie. Leitfa<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r natürlich-vernünftigen Gesellschafts<strong>und</strong><br />
Wirtschaftslehre im Sinne <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s hl.T.v.A. Schaan<br />
1931.<br />
Utz A. F., OP, Freiheit <strong>und</strong> Bindung <strong>de</strong>s Eigentums. Hei<strong>de</strong>lberg 1949.<br />
— Die Krise im mo<strong>de</strong>rnen Naturrechts<strong>de</strong>nken. In: NO 5 (1951) 201-<br />
219.<br />
— Naturrecht im Wi<strong>de</strong>rstreit zum positiven Gesetz. In: NO 5 (1951)<br />
313-329.<br />
— Das Ordnungsgesetz in Wirtschaft <strong>und</strong> Staat. In: NO 3 (1949) 385-<br />
400.<br />
— Das <strong>Recht</strong> auf Arbeit. In: ARSP 38 (1950) 350-363.<br />
— Metaphysik <strong>de</strong>r Wirtschaft. In: Schweiz. R<strong>und</strong>schau 50 (1950) 449-<br />
456.<br />
- Der Beitrag <strong>de</strong>r kath. Soziallehre zur Gestaltung <strong>de</strong>r Gesellschaft.<br />
In: Civitas 6 (1951) 466-474.<br />
- Sozialethik, 3 B<strong>de</strong>. Hei<strong>de</strong>lberg 1958 ff.<br />
- Hrsg., Bibliographie <strong>de</strong>r Sozialethik. 11 B<strong>de</strong>. 1960-1980.<br />
520
— Ethik. Hei<strong>de</strong>lberg 1970.<br />
— Ethik <strong>und</strong> Politik. Gesammelte Aufsätze. Stuttgart 1970.<br />
— Ethische <strong>und</strong> soziale Existenz. Gesammelte Aufsätze aus Ethik <strong>und</strong><br />
Sozialphilosophie 1970-1983. Walberberg 1983.<br />
— Johannes Messners Konzeption <strong>de</strong>r Sozialphilosophie. In: A. Klose,<br />
H. Schambeck, R. Weiler, Hrsg., Das Neue Naturrecht, Berlin<br />
1985, 21-62.<br />
Galen B. Gr. v. - Hrsg., Die katholische Sozialdoktrin in ihrer<br />
geschichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung päpstlicher Dokumente<br />
vom 15.Jahrh<strong>und</strong>ert bis in die Gegenwart. 4 B<strong>de</strong>. Aachen 1976.<br />
Groner J. F., Aufbau <strong>und</strong> Entfaltung <strong>de</strong>s gesellschaftlichen<br />
Lebens, Soziale Summe Pius' XII., 3 B<strong>de</strong>., Freiburg/Schweiz 1954/<br />
1961.<br />
Veit O., Die geistesgeschichtliche Situation <strong>de</strong>s Naturrechts. In:<br />
Merkur 1 (1947) 390-405.<br />
Verpaalen A. P., Der Begriff <strong>de</strong>s Gemeinwohls bei Thomas von<br />
Aquin. Hei<strong>de</strong>lberg 1954.<br />
Vialatoux J., Morale et politique. Paris 1931.<br />
— Philosophie economique. Paris 1944.<br />
Viance G., Preface ä une reforme <strong>de</strong> l'etat. Paris 1934.<br />
Vilmain J., Staatslehre <strong>de</strong>s T.v.A. im Lichte mo<strong>de</strong>rn-juristischer<br />
Staatsauffassung. Lpz. 1910.<br />
Francisco <strong>de</strong> Vitoria, OP, De Indis recenter inventis et <strong>de</strong> iure belli<br />
Hispanorum in Barbaros relectiones. Vorlesungen über die kürzlich<br />
ent<strong>de</strong>ckten In<strong>de</strong>r <strong>und</strong> das <strong>Recht</strong> <strong>de</strong>r Spanier zum Kriege gegen die<br />
Barbaren. Lateinischer Text nebst <strong>de</strong>utscher Übersetzung. Hrsg. v.<br />
W. Schätzel. Einleitung von P. Hadrossek. Tübingen 1952.<br />
— Relecciones teolögicas. Edicion critica por L. G. A. Getino. 3 B<strong>de</strong>.<br />
Madrid 1933-1936.<br />
— Comentarios a la Sec<strong>und</strong>a Sec<strong>und</strong>ae <strong>de</strong> S.T. Hrsg. v. V. Beiträn <strong>de</strong><br />
Heredia. 5 B<strong>de</strong>. Salamanca 1932-1935.<br />
Vives J., dEs la propiedad un robo? In: Estudios Eclesiästicos 52<br />
(1977) 591-626.<br />
Vonlanthen A., I<strong>de</strong>e <strong>und</strong> Entwicklung <strong>de</strong>r sozialen <strong>Gerechtigkeit</strong>.<br />
Freiburg 1973.<br />
Vykopal A., La dottrina <strong>de</strong>l „superfluo" in S.T. Brescia 1945.<br />
Wagner F., Das natürliche Sittengesetz nach <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s hl. T. v. A.<br />
Frbg. 1911.<br />
Walter F., Das Eigentum nach <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>s hl. T. v. A. <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Sozialismus.<br />
Frbg. 1895.<br />
— Thomas v. Aquino. In: Handwörterbuch <strong>de</strong>r Staatswissenschaften.<br />
4.A. Bd. 8. Jena 1928. 231-242.<br />
— Sozialpolitik <strong>und</strong> Moral. Frbg. 1899.<br />
Weber H. <strong>und</strong> Tischle<strong>de</strong>r P., Handbuch <strong>de</strong>r Sozialethik. I. Wirtschaftsethik.<br />
Essen 1931.<br />
Welty E., OP, Gemeinschaft <strong>und</strong> Einzelmensch. Eine sozialmetaphy-<br />
521
sische Untersuchung, bearbeitet nach <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>de</strong>s hl.<br />
T.v.A. Salzburg 1935.<br />
— Die Leitungsnorm <strong>de</strong>r Gemeinschaft: das Gesetz. Ein Beitrag zur<br />
Frage: Gemeinschaft <strong>und</strong> Person. In: DTF21 (1943) 257-286, 386-<br />
411.<br />
— Die Entscheidung in die Zukunft. Gr<strong>und</strong>sätze <strong>und</strong> Hinweise zur<br />
Neuordnung im <strong>de</strong>utschen Lebensraum. Köln 1946.<br />
— Vom Sinn <strong>und</strong> Wert <strong>de</strong>r menschlichen Arbeit. Aus <strong>de</strong>r Gedankenwelt<br />
<strong>de</strong>s hl. T.v.A. Hei<strong>de</strong>lbg. 1946.<br />
— Wie <strong>de</strong>nkt die katholische Soziallehre über die Gr<strong>und</strong>rechte <strong>de</strong>s<br />
Menschen? In: NO 2 (1948) 5-26.<br />
— Her<strong>de</strong>rs Sozialkatechismus. 3 B<strong>de</strong>. Freiburg 1951/1953/1958.<br />
— <strong>Recht</strong> <strong>und</strong> Ordnung im Eigentum. Pa<strong>de</strong>rborn 1947.<br />
— Freiheit o<strong>de</strong>r Bindung <strong>de</strong>s wirtschaftlichen Tuns. In: NO 1 (1946/<br />
47) 321 ff.<br />
Wiegand H., Die Staatslehre <strong>de</strong>s hl.T.v.A. <strong>und</strong> ihre Be<strong>de</strong>utung für<br />
die Gegenwart. Berlin 1930.<br />
Winter E. K., Die Sozialmetaphysik <strong>de</strong>r Scholastik. Lpz. 1929.<br />
Witte F.-W., Die Staats- <strong>und</strong> <strong>Recht</strong>sphilosophie <strong>de</strong>s Hugo von<br />
St. Viktor. In: ARSP 43 (1957) 555-574.<br />
Wittmann M., Der Begriff <strong>de</strong>s Naturgesetzes bei T.v.A. In: Aus<br />
Ethik <strong>und</strong> Leben. Festschrift f. J. Mausbach. Münster 1931. 66-80.<br />
Wolf E., Das Problem <strong>de</strong>r Naturrechtslehre. Karlsruhe 1964.<br />
Wolfe M. J., The Problem of Solidarism in S. T. Washington 1938.<br />
Woroniecki H., Quaestio disputata <strong>de</strong> natione et statu civili. In: DTP<br />
3 (1926) 25-54.<br />
Wulf M. <strong>de</strong>, Les theories politiques du moyen-äge. In: RNP 26 (1924)<br />
249-266.<br />
— L'individu et le groupe dans la Scolastique du XILT siecle. In: RNP<br />
22 (1920) 341-357.<br />
Zeiller J., L'i<strong>de</strong>e <strong>de</strong> l'Etat dans S.T.d'A. Paris 1910.<br />
Zitarosa G., II diritto naturale da padre Taparelli d'Azeglio ad oggi.<br />
Napoli 1965.<br />
Zizak G., La giustizia e la legge. In: RIFD 33 (1956) 450-487.<br />
522
Adiaphoron 370<br />
aequabilitas 372<br />
Agrarsozialismus 351<br />
Alchimie 420<br />
Almosen 372<br />
ALPHABETISCHES SACHVERZEICHNIS<br />
— als Abschöpfung d Überflusses<br />
398<br />
Amor socialis 455<br />
Anathem 195<br />
Angeklagter<br />
— Aussagepflicht d - 454<br />
-u Kläger 132 133<br />
— Leugnung d Wahrheit 142-144<br />
— Lügen zulasten d Klägers 143<br />
— <strong>Recht</strong> auf Gegenüberstellung<br />
131<br />
— Sün<strong>de</strong>n gg d <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
142-149<br />
— Ungerechtigkeiten d - 407-408<br />
— Unrechte Mittel z Verteidigung<br />
144-146<br />
— Verpflichtung z Wahrheit 143<br />
— Wi<strong>de</strong>rstand d - 149 408<br />
Anklage 135<br />
-falsche 139-140<br />
— u Gemeinwohl 138<br />
-Pflicht zur - 134-136 407<br />
— schriftl Abfassung 136-137<br />
— unbedachte 137-139<br />
— ungerechte 134-141<br />
— Unterschied z Anzeige 407<br />
— gg Vorgesetze 135<br />
Ansehen d Person 79-86 325-326<br />
— u austeilen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong> 80<br />
— u Ehrerweisung 84-85<br />
— u Gericht 85-86<br />
— als Sün<strong>de</strong> 79-81<br />
— u Verleihung geistl Güter 81-<br />
83<br />
Anwalt<br />
— Ausschluß v Amt d - 161-163<br />
— Geld f <strong>Recht</strong>sbeistand 165-166<br />
— Pflicht d <strong>Recht</strong>sbeistands f<br />
Arme 159-161<br />
— f e ungerechte Sache 163-164<br />
— Ungerechtigkeiten d - 159-166<br />
409-410<br />
Anzeige 135 137 406<br />
Apostoliker, Apostelbrü<strong>de</strong>r 253<br />
Arbeit<br />
— u Eigentum 358 359<br />
— als Einkommensquelle 426<br />
— u Gewinn 422<br />
— als individuelle Leistung 359<br />
— u Kapital 400<br />
— u Preis 432<br />
— u Produktionsmittel 364<br />
— Wür<strong>de</strong> d - 459<br />
Arbeitsrecht 278<br />
Arbeitswertlehre 359<br />
Ärgernis 260<br />
Argwohn 46<br />
Arme<br />
— <strong>Recht</strong> auf Überfluss 387 388<br />
— <strong>Recht</strong>shilfe für - als Akt d<br />
Barmherzigkeit 160<br />
Armut<br />
— i AT 367<br />
Asylrecht, kirchl 337<br />
Aussage<br />
— indikative, imperative, Optative<br />
194<br />
Autonomie<br />
— u Gemeinwohl 481<br />
523
— d gesellschafd Ordnung 361<br />
362<br />
— d Person 463<br />
Autorität 306 458<br />
— u Gemeinwohl 449 476<br />
— u Gewissen 476<br />
— göttl - u Urgewissen 306<br />
— u Menschenrechte 450<br />
— u <strong>Recht</strong> 304 306<br />
— u <strong>Recht</strong>sprechung 44 51 52<br />
— staatl 291 449 476<br />
— d Vaters 348 349<br />
Barmherzigkeit 160 161 162 166<br />
315 350<br />
Beghinen 384<br />
Beichtgeheimnis 152 407<br />
Beruf 458<br />
Berufsständische Ordnung 361<br />
Berufswahlfreiheit 457<br />
Berufung 408<br />
— gerichtl 146-148<br />
Beschimpfung 66 168 169-171<br />
411<br />
Besitz 111-112 251-252 351<br />
— u natura humana 352<br />
— d Ungläubigen 404 405<br />
— s a Eigentum<br />
Güter<br />
Bestechung 145<br />
Betrug 58 200-222 416-423<br />
Beute 124<br />
Beweise v Gericht 129 135 137<br />
Billigkeit 50 293 319 320<br />
Bischof<br />
— als weltl Fürst 249-250<br />
Bo<strong>de</strong>n, Eigentumsrecht an - 398<br />
bona fi<strong>de</strong>s 292<br />
Das Böse mei<strong>de</strong>n 284 442 443<br />
— Gegensatz z Übertretung 228<br />
— als Teiltugend d <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
223-225<br />
Brü<strong>de</strong>rlichkeit 466<br />
Bürger 467 469 473 477<br />
524<br />
Caritas socialis 454 455<br />
Darlehen 424-442<br />
— u ausgleichen<strong>de</strong> <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
437<br />
— Definition 425<br />
— Gewinn aus - 214<br />
— u Kapitalgesellschaft 438<br />
-u Kredit 431<br />
-u Leistung 214 215-219<br />
— u <strong>Recht</strong> auf Rückgabe 439<br />
— u Schenkung 439<br />
— u Zins 220-222 439<br />
Darlehenszins 435-442<br />
— Definition 425<br />
— u Kapitalzins 441<br />
— Rückgabepflicht 441<br />
— als Sün<strong>de</strong> 259<br />
Darwinismus 276<br />
Demokratie<br />
— u Konsens 482<br />
— u Monarchie 312<br />
— u Naturrecht 278<br />
— pluralistische 469 497 498<br />
Dieb<br />
— <strong>Recht</strong> auf gestohlene Sache 254<br />
255<br />
Diebstahl 59 73 111-122<br />
-Definition 115-116 401<br />
— Entführung d Gattin kein - 254<br />
— Kin<strong>de</strong>sentführung ist - 254<br />
— aus Not 121-122 403<br />
— u Raub, Unterschied 116-117<br />
— als schwere Sün<strong>de</strong> 120-121<br />
— sittl Bewertung 401-405<br />
-als Sün<strong>de</strong> 118-119<br />
— Wie<strong>de</strong>rgutmachung bei - 248<br />
dominium (Herrschaft) 252<br />
Ehe 10 243 386-387 453 457 458<br />
483<br />
— s a Monogamie<br />
Polygamie<br />
Ehebruch 109 180 251
Ehescheidungsgesetze 306<br />
Eheschliessung, Dispens 83<br />
Ehrabschneidung 175-184 194<br />
198-199 412-413<br />
Ehre 85 168 169 170 258<br />
Ehrverlust 141 257<br />
Eid 221<br />
Eigentum<br />
— i AT 366<br />
— u Besitz 252<br />
— an Bo<strong>de</strong>n 356<br />
— u Familie 361<br />
— u Gemeinwohl 399<br />
— b d Kirchenvätern 241 242 369<br />
370 376 377<br />
— als Kollektiv- o<strong>de</strong>r Privat- 352<br />
— u natura humana 352<br />
— als Naturrecht 252 352 354-365<br />
394-397<br />
— <strong>Recht</strong> auf - 390 392 393 394-<br />
397 453<br />
— sittl-guter Gebrauch d - 255<br />
— soziale Bindung d - 355 398 399<br />
459<br />
— b Thomas 385-400<br />
— d Ungläubigen 124 255<br />
— u Verfügungsgewalt 399<br />
— u Wirtschaft 398-400<br />
— u Ziel d Güter 364<br />
— Zweck d - 398<br />
— s a Besitz<br />
Güter<br />
Eigentumserwerb<br />
— aus Arbeit 359 426<br />
— durch Besitznahme 426<br />
— durch Erbschaft 378<br />
— Grenzen d - 397<br />
— durch rechten Gebrauch 377<br />
388<br />
Eigentumslehre<br />
-d Aristoteles 239-241 242<br />
— aristotelisch-thomasische 242<br />
— d chrisd Tradition 365-385<br />
Eigentumsordnung<br />
— private 394 483<br />
— private - u Kapitalrendite 434<br />
— u Zins 424 425<br />
Eigentumsrecht 351-400<br />
Einkerkerung 107-108<br />
Einkommen<br />
-arbeitsloses 422 424 426 432<br />
433 434 437 438<br />
Einkommensbildung<br />
— Preis d Waren als Regler d - 418<br />
Einzelgerechtigkeit 224<br />
Einzelmensch, Einzelner<br />
— u Gemeinschaft 464<br />
— <strong>Recht</strong> d - i Paradies 391<br />
— soziale Belastung 451<br />
— u Staat 358 446<br />
— s a Individuum<br />
Einzelwohl 497<br />
Eltern<br />
— Menschenrecht d Kin<strong>de</strong>s gg d -<br />
243<br />
— <strong>Recht</strong> d Kin<strong>de</strong>s auf Erziehung<br />
244<br />
Elternrecht<br />
— u Religion d Kin<strong>de</strong>s 362<br />
Enteignung<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 404<br />
Entführung 254<br />
Erbschaft 378<br />
Erbsün<strong>de</strong> 241<br />
Erkenntnisfähigkeit<br />
— u sittl Verantwortung 285<br />
Erziehung 243 244 301<br />
Ethik<br />
— materiale 456<br />
— u <strong>Recht</strong> 283<br />
Existenz, leibliche 59<br />
Fahrlässigkeit 248 346<br />
Familie 24 25 372 457 458 483<br />
— ältestes Gemeinwesen 361 362<br />
— u Eigentum 361<br />
— Gemeinwohl d - 473<br />
— u Staat 358<br />
525
Familiengüter 3 71<br />
Fraticelli 384<br />
Frau<br />
— rechtl Stellung d - 301<br />
— Träger v Menschenrechten 349<br />
Freigebigkeit 28 31 32 33 81 241<br />
373<br />
Freiheit<br />
— Begrenzung d - 245<br />
— u Gemeinwohl 473<br />
— d Gewissensentscheidung 457<br />
— u Menschenwür<strong>de</strong> 355<br />
— u <strong>Recht</strong> 271 357<br />
— u Staatsgewalt 473<br />
Freiheitsrechte 357 360 453<br />
Freirechtslehre 276 287 318 319<br />
Fre<strong>und</strong>schaft<br />
— drei Arten 258<br />
-u Ohrenbläserei 186 187 188<br />
Frie<strong>de</strong><br />
— durch Bestrafung d Sün<strong>de</strong>r 135<br />
— sozialer - u Privateigentum 364<br />
Frie<strong>de</strong>nsordnung 206 235 267<br />
273 290 291 303 304 306 388<br />
393<br />
Frie<strong>de</strong>nsverträge 296<br />
Furcht 255<br />
Fürst 29 30 43 57 61 85 91 109<br />
123 124 132 133 139 140 147<br />
149 249 250 312 362 482<br />
Ganzes<br />
— integrales 444 445<br />
— Verhältnis z d Teilen 445<br />
Gastfre<strong>und</strong>schaft 241<br />
Geben, unerlaubtes 71<br />
Gebot<br />
— negatives 226<br />
— positives 228<br />
Gebote<br />
— for<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r affirmative - u<br />
Verbote 249<br />
Gebrauch<br />
— Begriff b Thomas 389<br />
526<br />
-d Gel<strong>de</strong>s 214-215<br />
— gemeinsamer - d Güter 387<br />
-u Verbrauch 212-213<br />
Geburtshilfe 345<br />
Geheimnisse 152<br />
Geld<br />
— als Metall 436<br />
-als Tauschmittel 209 213 435<br />
436 437<br />
-Zweck d - 201 213 259<br />
— zweifacher Gebrauch d - 214-<br />
215<br />
Gelddarlehen 425<br />
Gemeingut<br />
— unterschie<strong>de</strong>n v Gemeinwohl<br />
486 487 488 489 492<br />
Gemeinsamkeit d Dinge<br />
— u Naturrecht 114<br />
Gemeinschaft 458<br />
— u Gemeinwohl 464<br />
— Mensch als Teil d - 341 346<br />
— als Mittel z Wohl aller 464<br />
— u Person 334<br />
— nur ein einziges <strong>Recht</strong> 267<br />
Gemeinschaften, natürl 457<br />
Gemeinschaftsleben<br />
— eth Sicht i Paradies 390 392<br />
Gemeinschaftswerte 288<br />
Gemeinwohl 34 35 82 132 135<br />
136 138 241 247 311 335 362<br />
448 456-498<br />
— Analogie d - 489 492<br />
— u Autorität 476<br />
— Definition 465 471<br />
— u Eigentum 399<br />
— u Gemeinschaft 464<br />
— als Gemeinwohlinstitutionen<br />
471 472<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 20 23 24 33<br />
— u Gesetz 20 21<br />
— u Gesetzesgerechtigkeit 55 261<br />
467<br />
— Gott als - d Universums 480<br />
— als göttl Institution 469 482
— u Gruppen, freie Initiative d -<br />
473 474<br />
— b G<strong>und</strong>lach 486-492<br />
— u Individualprinzip 450<br />
— u Individualrechte 458<br />
— u Individuum 473<br />
— als Institution 470 471 472<br />
— d Kirche 472-475 488<br />
— i d Kirche 485<br />
— b Messner 493-494<br />
— u Naturrecht 460<br />
— i d päpstl Verlautbarungen<br />
461-477<br />
— u Person 28 448 449 459 460<br />
462 466 470 476 486<br />
— Pflichten im - 476<br />
— i pluralist Staat 495<br />
— u Privateigentum 362 395 396<br />
400<br />
— u <strong>Recht</strong> 334<br />
— u Religion 476<br />
— u Staat 335 449 461 463 495<br />
— b Thomas 479-484<br />
— u To<strong>de</strong>sstrafe 249 335<br />
— u Tugend 311<br />
— u Ungerechtigkeit 34 35<br />
— u Verteilungsgerechtigkeit 55<br />
— als Wert 471 472<br />
— u Wohl d Menschheit 466<br />
— u Wohlfahrt 495-498<br />
Gemeinwohlgerechtigkeit 244-<br />
245 307 316 322 447 467 481<br />
— u Ungerechtigkeit 315-316<br />
— Wan<strong>de</strong>l i Begriff d - 448-455<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong> 4 12-33 16 45 244<br />
247 265 302-307 313-314 316<br />
— allgemein i e doppelten Sinn<br />
244-245<br />
— allgemeine 23-25 224 307-312<br />
— als allgemeine Tugend 20-21<br />
21-23<br />
— ausgleichen<strong>de</strong> 54 246-247 323<br />
— ausgleichen<strong>de</strong> u austeilen<strong>de</strong><br />
322-325<br />
— ausgleichen<strong>de</strong>, Begriff 327<br />
— ausgleichen<strong>de</strong>, Sün<strong>de</strong>n gg d - -<br />
327-442<br />
— austeilen<strong>de</strong> 54 55 56 80 322-<br />
325 449 451<br />
— austeilen<strong>de</strong> u ausgleichen<strong>de</strong> 53-<br />
55 55-57 57-60 62<br />
— austeilen<strong>de</strong>, „Mitte" d - 56 57<br />
— austeilen<strong>de</strong>, Sün<strong>de</strong>n gg d - -<br />
325-326<br />
— beson<strong>de</strong>re 23-25<br />
— als Frie<strong>de</strong>nsordnung 303 304<br />
— u Gemeinwohl 22 23 24 33<br />
— u Gesetz 304<br />
— u Gesetzgeber 304<br />
— Gottes 16<br />
— als Habitus 302<br />
— als Kardinaltugend 31<br />
-u Liebe 3 317<br />
— Materie d - 57-60<br />
— u Menschenrechte 284<br />
— u Moralität 446 447<br />
— als Ordnungsprinzip 15<br />
— u Persönlichkeit 45 284<br />
— u <strong>Recht</strong> 3-5 265 267-302 317<br />
— u <strong>Recht</strong>sprechung 41-43 44<br />
— u Richter 14 42 49 50 126-133<br />
— als sittl Haltung 302<br />
— u sittl Tugen<strong>de</strong>n 26<br />
— Sitz im Willen 18-21<br />
-soziale 247 307-312 313 325<br />
398 404 448-455<br />
— u Staat 446 447<br />
— u Tapferkeit 33<br />
— Teiltugen<strong>de</strong>n d - 53-62 223-231<br />
246 442-444<br />
— als Tugend 13 17-18 20-21 21-<br />
23 32-33 244 265 302-315<br />
— Tugendmitte d - 30 245-246<br />
— Unterschied v Gemeinwohl- u<br />
Son<strong>de</strong>r- 307<br />
— als Vergeltung 60-62<br />
— u Vollkommenheit 304<br />
-Werthöhe d - 314-315<br />
527
— Wesen d - 267-321<br />
— u Wille 13 14 18-21 26 27 244<br />
302<br />
— u Zeugenaussage 157<br />
— s a Gemeinwohlgerechtigkeit<br />
Gesetzesgerechtigkeit<br />
Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>sschema<br />
— aristotelisches 448 449<br />
Gerichtsprozess<br />
— Ungerechtigkeiten i - 405-410<br />
Gesamtinteresse 463<br />
Gesamtwohl, Benthamscher<br />
Begriff 463 465<br />
Gesandte<br />
— Unverletzlichkeit 296<br />
Geschäftsbeteiligung<br />
— gesellschaftl 431 432<br />
Geschäftsfre<strong>und</strong>schaft 258<br />
Geschäftstüchtigkeit 326<br />
Gesellschaft<br />
— Aufbau v unten 451<br />
— als Institution 476<br />
— mo<strong>de</strong>rne 451<br />
— offene 496<br />
— u Person 462<br />
— u Privateigentum 241<br />
— u Religion 467 468<br />
— u Staat 300 301<br />
— u Subsidiaritätsprinzip 355<br />
Gesellschafts<strong>de</strong>nken<br />
— organisches 334<br />
Gesellschaftlehre<br />
— u Begriff d Ganzheit 444-447<br />
Gesellschaftstheorie 281<br />
Gesetz 4 5 235<br />
— u faktische Willenbildung 313<br />
— u Gemeinwohl 20 21<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 304<br />
— u Gesetzgeber 304<br />
— u Gewissen 469<br />
— Lückenhaftigkeit d - 318 321<br />
— menschl u göttl 145<br />
— u Normen 276 277<br />
528<br />
— positives - u Naturnormen 272<br />
— positives - u Naturrecht 320<br />
— u <strong>Recht</strong> 4 5 49-50 235 276 304<br />
— u Richter 49 50 51 127 133 321<br />
-u Sittlichkeit 145 202 214<br />
— u soziolog Situation 313<br />
— u Tugend 202<br />
— Übertretung d - 226<br />
— ungerechtes 50<br />
Gesetzesbildung<br />
— u <strong>Recht</strong>sprechung 317<br />
Gesetzesgerechtigkeit 21 309<br />
— als allgem Tugend 22 23<br />
— u Gemeinwohl 55 261 467<br />
— u Gesetz Gottes 443<br />
— u Lei<strong>de</strong>nschaften 27-29<br />
— u Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit 24 245<br />
— als universale Tugend 261<br />
Gesetzgeber<br />
— ewiger 290<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 304<br />
— Gott als - 238 288<br />
— u <strong>Recht</strong> 304<br />
Gesetzgebung 5<br />
— u menschl Natur 235<br />
— u natürl sittl Normen 469<br />
— u praktische Vernunft 235<br />
Gewahrsam 349-350<br />
Gewalt 58 123 124 125<br />
— öffentl 465<br />
— väterl 298<br />
— staatl 461<br />
Gewaltverteilung<br />
— pluralist - i d Wirtschaft 482-<br />
483<br />
Gewinn<br />
— aus Arbeit 422<br />
— Erlaubtheit 209-210<br />
— händlerischer 421 422 423 431<br />
434<br />
— aus Wucherzinsen 219-220<br />
— Ziel d - 209 210<br />
Gewissen 306<br />
— u Gesetz 469
— kollektives 286<br />
— i d <strong>Recht</strong>sbildung 320<br />
— u rechtserzeugen<strong>de</strong>r Prozess<br />
290<br />
— u <strong>Recht</strong>sprechung 320<br />
— sittl u naturhaftes 289<br />
— u staatl Autorität 476<br />
— u Vernunft 289<br />
Gewissensentscheidung<br />
— Freiheit d - 457<br />
Gewohnheitsrecht<br />
— als Völkerrecht 239<br />
Gleichstellung v Mann u Frau 301<br />
Gloria conscientiae 258<br />
Glück 461 467 495 496 497 498<br />
Gold<br />
— Wert d - 420<br />
Gotteslästerung 196 199<br />
Gruppen<br />
— eigene Autonomie 464<br />
— freie Initiative 473<br />
— u Gemeinwohl 464<br />
Gute<br />
— d schlechthin - 30<br />
Das Gute tun 284 442 443<br />
— u allgemeine <strong>Gerechtigkeit</strong> 224<br />
— u Einzelgerechtigkeit 224<br />
— als Gegensatz zur Unterlassung<br />
228<br />
— als Teil d <strong>Gerechtigkeit</strong> 223-<br />
225<br />
Güter<br />
— Aufteilung d - 242 388 393 459<br />
462<br />
— Niessbrauch 219-220 415<br />
— N<strong>utz</strong>ung d - 242 243 252 461<br />
— Sinn d - 242 292 293 395 397<br />
— soziale Bestimmung d - 385-<br />
389<br />
— Verwaltung d - 397 461 483<br />
— Zweck d - 385-389<br />
— s a Besitz<br />
Eigentum<br />
Gütergemeinschaft<br />
— b d Griechen 240 368<br />
— d Urkirche 367 368 371 375<br />
Habitus<br />
— durch d Akt <strong>de</strong>finiert 13<br />
— d <strong>Gerechtigkeit</strong> 302<br />
-u Wille 14<br />
— Tugend als - d Willens 29<br />
Han<strong>de</strong>l<br />
-Ehrlichkeit i - 419 420<br />
— Verbot f Kleriker 423<br />
Han<strong>de</strong>ln<br />
— gerechtes 316 442-444<br />
Han<strong>de</strong>lsgeschäft 209 210 423<br />
Han<strong>de</strong>lskredit 429<br />
Han<strong>de</strong>lsmoral 419-423<br />
Händler<br />
— Aufgabe d - 209<br />
Handlungsordnung 443 461 490<br />
Hausgemeinschaft 299 335 348<br />
349<br />
Herrschaft 252 351<br />
Herrschaftsrecht 9-11 298-302<br />
Hinterhalt 164<br />
Hinterlegtes 6 119<br />
Homosexualität 316<br />
Individualismus 313 357 358 359<br />
360 361 363 456<br />
Individualmoral<br />
— u <strong>Recht</strong> 288<br />
Individualprinzip<br />
— u Gemeinwohl 450<br />
— u natura humana 450<br />
— als Sozialprinzip 363<br />
Individualrechte<br />
— u Gemeinwohl 458<br />
— Menschenrechte als - 393 450<br />
— Menschenwür<strong>de</strong> als - 363<br />
Individuum<br />
— u Gemeinwohl 473<br />
— u Kollektiv 357<br />
— u Person 334<br />
— soziale Belastung d - 490<br />
— s a Einzelmensch<br />
529
Inquisition 256<br />
Institution 396 476<br />
Institutionen<br />
— u Gemeinwohlfor<strong>de</strong>rungen<br />
470 471 472 476<br />
Irregularitäten 251<br />
Jungfräulichkeit 315<br />
jus gentium 243 292-298<br />
— Privateigentum als - 394<br />
— u stoischer Naturrechtsbegriff<br />
243<br />
— u Völkerrecht 239<br />
jus talionis 257 329 407<br />
justitia commutativa<br />
s <strong>Gerechtigkeit</strong>, ausgleichen<strong>de</strong><br />
Kalumnieneid 257<br />
Kapital<br />
— Anlage nach d Art e Gesellschaft<br />
428 429 440<br />
— u Arbeit 400<br />
— u Darlehen 438<br />
— Definition 424<br />
— produktiv o<strong>de</strong>r unproduktiv<br />
424<br />
Kapitalgesellschaft 438<br />
Kapitalismus 400 425<br />
Kapitalrendite 434<br />
Kapitalzins 424<br />
Kardinaltugen<strong>de</strong>n 17 18 25 26 31<br />
244 322 323<br />
Katharer 250<br />
Kauf u Verkauf 201 202 203 415<br />
419<br />
Käufer<br />
— Pflichten d - 420<br />
Kaufleute 209 419 423<br />
Kerkerhaft 349-350<br />
Keuschheit 315<br />
Kind<br />
— Entführung 254<br />
— Menschenrechte gg d Eltern<br />
243<br />
— <strong>Recht</strong> auf Erziehung 243<br />
530<br />
— rechtl Beziehung z Vater 298<br />
308<br />
— als <strong>Recht</strong>sträger 345 349<br />
— Religion d - 362<br />
Kirchenväter<br />
— Eigentumslehre d - 241 242<br />
— u ethischer Kommunismus 253<br />
— u Liebesgemeinschaft i Paradies<br />
304<br />
Kläger<br />
— vor Gericht 131<br />
— i Prozessverfahren 256<br />
— u <strong>Recht</strong> auf Bestrafung d Angeklagten<br />
132 133<br />
— Unbesonnenheit d - 138<br />
— Ungerechtigkeit d - im Prozess<br />
134-141 256 406-407<br />
Kleriker<br />
— u Han<strong>de</strong>lsgeschäfte 210 423<br />
— kirchl u weltl <strong>Recht</strong>sausrüstung<br />
249 250<br />
— u Krieg 250<br />
— u To<strong>de</strong>sstrafe 249 250<br />
Klugheit 17 257 319<br />
— vor Gericht 145 146<br />
— i d <strong>Recht</strong>sfindung 319<br />
— i d <strong>Recht</strong>sprechung 42 44 318<br />
— s a Kardinaltugen<strong>de</strong>n<br />
Kollektiv<br />
— u abstrakte natura humana 252<br />
— u Individuum 357<br />
Kollektivismus 358<br />
Kommenda 429 430<br />
Kommunismus 289-393<br />
— b Aristoteles 240<br />
— ethischer 253 390<br />
— freier 242<br />
— b Plato 240<br />
— negativer 242 252-253 255 392<br />
403<br />
-i Paradies 390 391<br />
— positiver 253<br />
— positiver u negativer 375 376<br />
377 387
— recht] - = Zwangs- 253<br />
Konsens<br />
— i d Demokratie 482<br />
— verschie<strong>de</strong>n i Staat u Kirche<br />
477<br />
Kontrakttheorie 452<br />
Kredit<br />
— u Darlehen 431<br />
— Han<strong>de</strong>ls- u Gewerbe- 429<br />
Krieg 164 250 344 345<br />
Kultur 311 493 494<br />
Laienapostolat 474<br />
Lebensqualität 497<br />
Leibeigenschaft 297<br />
— als naturrechtl Zustand 236<br />
237<br />
Lei<strong>de</strong>nschaften<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 27-29<br />
Leihgeschäfte 211-222<br />
Leum<strong>und</strong> 66 131 178 412<br />
— u Ehrabschneidung 176 177<br />
183<br />
Liberalismus 355 357 358 360 363<br />
460<br />
Liebe<br />
— egoistische 241<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 3 317<br />
— Selbst- 241 242<br />
— soziale 448 454-455<br />
Lohn 4<br />
— f Werke d Barmherzigkeit 166<br />
Mammon, ungerechter 369 370<br />
371<br />
Manager 398 425<br />
Markt 420 421 422<br />
Marktwirtschaft 365 423 467 497<br />
Maßhaltung 17 21 273 310 311<br />
314<br />
Materialismus 276<br />
Meineid 157 158<br />
Menschenrechte 308<br />
— u Autoritätsträger 450<br />
— als Freiheitsrechte 357 360<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 284<br />
— als Individualrechte 393 450<br />
— d Kin<strong>de</strong>s 243<br />
— u vorstaatl <strong>Recht</strong>e 453<br />
Menschenrechtserklärung d<br />
UNO 489<br />
Menschenwür<strong>de</strong><br />
— u Eigentum 355<br />
— u Freiheit 355<br />
— als Individualrecht 363<br />
— als Naturrecht 363<br />
— u Privateigentum 393<br />
— Verbrechen gg d 290-291<br />
Miete<br />
— Entgelt f - 434<br />
Mitbestimmung 399 492<br />
Mittelstand 367<br />
Monarchie 312<br />
Monogamie 284 285 287<br />
Moral<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 446 447<br />
— Han<strong>de</strong>ls- 419-423<br />
— Individual- 288<br />
— u <strong>Recht</strong> 270 273 287 288 306<br />
— u <strong>Recht</strong>snormen 283<br />
— u Richter 273<br />
Mord 87-102 180 328-346<br />
Natur<br />
— zweifache Ordnung d - 447<br />
Natur d Menschen<br />
— u Gesetzgebung 325<br />
— individuelle - u menschl<br />
Wesensnatur 429<br />
— u Naturrecht 235-236<br />
— u Privateigentum 242 253<br />
— verän<strong>de</strong>rlich 6 235 277<br />
— s a natura humana<br />
natura humana 497<br />
— als absolute Norm 450<br />
— u Besitz 352<br />
— u Individualprinzip 450<br />
— u Kollektiv 252<br />
531
— Pflichten d - 388<br />
— u <strong>Recht</strong> 252 253<br />
— als rechtl Ordnungsprinzip 288<br />
— u Staat 357<br />
— Verstoss gg d - 289<br />
— s a Natur d M<br />
Naturgesetz<br />
— Erkennbarkeit 276<br />
— F<strong>und</strong>ament d kirchl Soziallehre<br />
460<br />
— normativ 497<br />
Naturrecht 5-7 8 49 268 275 277<br />
291<br />
— u Gemeinsamkeit d Dinge 114<br />
— u Gemeinwohl 460<br />
— u geschriebenes <strong>Recht</strong> 49<br />
— u göttl <strong>Recht</strong> 238<br />
— Intoleranz d - 267 268<br />
— konkretes 236 237 275 296<br />
— Menschenwür<strong>de</strong> als - 363<br />
— u Natur d Menschen 235-236<br />
— u Natur d Sache 49<br />
— u Naturgesetz 276<br />
— Normen d - 277-289<br />
— u Normen 236<br />
— u positives <strong>Recht</strong> 5-7 268 274-<br />
302 320<br />
— u Privateigentum 252 254 353<br />
360 396<br />
— rationalistisches 489<br />
— rationalist u individualist 491<br />
492<br />
— <strong>Recht</strong> auf Eigentum als - 252<br />
352 354-365 394-397<br />
— u <strong>Recht</strong>sbildung 320<br />
— u Schöpferwille Gottes 238<br />
— u Selbsterkennen Gottes 238<br />
— symptomatische Be<strong>de</strong>utung<br />
279 280<br />
— u To<strong>de</strong>sstrafe 336<br />
— u Vernunft 243 278<br />
— u Völkerrecht 7-8<br />
— vorstaadich 396<br />
— u Weltrecht 293<br />
532<br />
Naturrechtsaauffassung<br />
— protestantische 278<br />
Naturrechtsbegriff<br />
— stoischer 243<br />
Naturrechts<strong>de</strong>nken<br />
— u Positivismus 269<br />
Naturrechtslehre<br />
— u mod <strong>Recht</strong>sphilosophie 277-<br />
292<br />
— u Positivismus 235 236 267<br />
— thomasische 277-292<br />
Naturrechtsprinzipien 277<br />
— absolute Normkraft d - 285<br />
— 2 Arten d - 284<br />
— u lex ferenda 280<br />
— primäre u sek<strong>und</strong>äre 285 286<br />
Nepotismus 325<br />
Neukantianismus 279<br />
Norm<br />
— u Naturgesetz 497<br />
— u Sein, Dichotomie 497 498<br />
— soziale 461<br />
Normen<br />
— absolute - u <strong>Recht</strong>sprechung<br />
318<br />
— absolute - u subjektive <strong>Recht</strong>e<br />
362<br />
— allgemeine - u Gesetz 276 277<br />
— allgemeine -, Unverän<strong>de</strong>rlichkeit<br />
d - 277<br />
— ethische u rechtl, Unterschied<br />
287<br />
— u Gesetz 277<br />
— u Gesetzgebung 469<br />
— u konkretes <strong>Recht</strong> 277 289-292<br />
— d Natur u positives Gesetz 272<br />
— u Naturrecht 236<br />
— d Naturrechts 277-289<br />
— u <strong>Recht</strong> 236 271 274 276<br />
— d <strong>Recht</strong>s, allgemeingültige 280<br />
— d <strong>Recht</strong>s u Gott als Gesetzgeber<br />
288<br />
— d <strong>Recht</strong>sbildung 279 282<br />
— u <strong>Recht</strong>sprechung 318
— u Vernunft 289<br />
Notwehr 99-101<br />
Notwendigkeit, zweifache 18<br />
N<strong>utz</strong>ung d Güter 242 243<br />
N<strong>utz</strong>wert e Sache 417 418<br />
Ohrenbläserei 185-188 413<br />
Ordnung<br />
— berufsständische 361<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 15<br />
— gesellschaftl, Autonomie d -<br />
361 362<br />
— gesellschaftl - u Privateigentum<br />
241<br />
— soziale u privatrechtl 394<br />
— d Universums 330 331 448<br />
Paradiesesmensch<br />
— ethischer Kommunismus d -<br />
242<br />
— u Gütergemeinschaft 253<br />
Pareto-Regel 495 496 497 498<br />
Peregrini 293<br />
Person<br />
— Autonomie d - 463<br />
— als Eigentümerin 491<br />
— Einglie<strong>de</strong>rung i d Gemeinschaft<br />
334<br />
— freie Entfaltung d - 470 471<br />
— u Gemeinwohl 28 448 449 459<br />
460 462 466 470 476 486<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 45 284<br />
— u Gesellschaft 462<br />
— u Individuum 334<br />
— Priorität d - 470<br />
— u Privateigentum 458 483 491<br />
— u Produktionsprozess 364<br />
— <strong>Recht</strong>e d - 463<br />
— u Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit 28 54<br />
— als soziales Wesen 459 464<br />
-Unrecht ggd- 87-102 103-110<br />
251<br />
— Werte d - 465<br />
— u Wirtschaft 364<br />
— u Wohlfahrt 459<br />
— Wür<strong>de</strong> d - 59 326 491<br />
Personalismus 453<br />
Persönlichkeitsi<strong>de</strong>al<br />
— u <strong>Recht</strong>sempfin<strong>de</strong>n 283<br />
Pfand 259 429<br />
Pfrün<strong>de</strong> 66 67<br />
Planwirtschaft<br />
— u Zins 424<br />
Polygamie 284<br />
Positivismus<br />
— u Naturrechtslehre 235 236<br />
267 269<br />
— u Normen d <strong>Recht</strong>sbildung<br />
279<br />
— i <strong>Recht</strong> 268 269 270 276 305<br />
316<br />
possessio (Besitz) 252<br />
Preis 419<br />
— u Arbeit 432<br />
— gerechter 202 416-419 434<br />
— u Kosten 432<br />
— u N<strong>utz</strong>en 202<br />
— u N<strong>utz</strong>wert 417 418<br />
— u ontischer Wert 417<br />
— als Regler d Einkommensbildung<br />
418<br />
— als Regler d Verbrauchs 418<br />
-u Wert 201 418<br />
Preisunterschie<strong>de</strong><br />
— i d Marktsituation 420 421<br />
Prinzipien<br />
— allgemeine 276 284<br />
— s a Naturrechts-<br />
Privateigentum<br />
-Erlaubtheit 113-115<br />
— u Gemeinwohl 362 395 396<br />
— u gesatztes <strong>Recht</strong> 353 395<br />
— individualistisches - u kath<br />
Moral 359 360 361<br />
— als Institution 396<br />
— als jus gentium 394<br />
— u Kapitalismus 400<br />
— u Menschenwür<strong>de</strong> 393<br />
533
— u Natur d Menschen 242 253<br />
— u Naturrecht 252 254 353 396<br />
— Notwendigkeit d - 392<br />
— als Ordnungsprinzip d<br />
Gesellsch 241<br />
-u Person 458 483 491<br />
— u positives <strong>Recht</strong> 114 353 395<br />
— an Produktionsmitteln 364<br />
— <strong>Recht</strong> auf - 453<br />
— soziale Belastung d - 483<br />
— u Staat 396<br />
— als vorstaatl Naturrecht 360<br />
Privateigentumsordnung 389-<br />
393<br />
— Gr<strong>und</strong>legung i Gemeinwohl<br />
400<br />
— metaphysisch-ethischer Ort d<br />
- 400<br />
Privates<br />
— Reichweite d - 397-398<br />
Produktion 459<br />
Produktionsgüter<br />
— u positiver Kommunismus 253<br />
Produktionsmittel<br />
— u Arbeit 364<br />
— u arbeiten<strong>de</strong> Person 363<br />
Produktionsprozess<br />
— u Person 364<br />
— u Privateigentumsordnung 400<br />
Produktivität 260<br />
proprietas (Eigentum) 252<br />
Prügelstrafe 105-107 348-349<br />
Rache 173<br />
ratio scripta 294<br />
Raub 59 123-125 401-405<br />
— i äusserster Not 403<br />
— u Diebstahl, Unterscheidung<br />
116-117<br />
— Menschen- 121<br />
— sittl Bewertung 401-405<br />
Raumplanung<br />
— u Privateigentum 396<br />
<strong>Recht</strong> 3-11 235 268 269 271 272<br />
534<br />
273 276 277 331<br />
— u absolut gültige Norm 272<br />
— allgemein gültige Normen d -<br />
280<br />
— als Ausgleich 6 270<br />
— u Autorität 304 306<br />
— Begriff d - 267-274<br />
— zw Eheleuten 10<br />
— auf Eigentum 390 392 393 394-<br />
397 453<br />
— eingeteilt i Naturrecht u positives<br />
<strong>Recht</strong> 5-7<br />
— Einheit d - 291<br />
— Einheit o<strong>de</strong>r Mehrheit 267<br />
— d Einzelnen i Paradies 391<br />
— Entstehung d - 274-277<br />
— u Ethik 283 288<br />
— u Freiheit 271<br />
— auf Freiheit 357<br />
— als Frie<strong>de</strong>nsordnung 273<br />
— u Gemeinschaft 267<br />
— u Gemeinwohl 334<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 3-5 265 267-<br />
302 317<br />
— geschriebenes - u Naturrecht<br />
49<br />
— u Gesetz 4 5 49-50 235 276 304<br />
— u Gesetzgeber 304<br />
— u Gewissen 290 320<br />
— „göttliches" 7<br />
— herrschaftl 9-11 298-302<br />
— I<strong>de</strong>al d - 269<br />
— u Individualmoral 288<br />
-u Klugheit 319<br />
— konkretes - u Normen 277<br />
289-292<br />
— auf Leben 357<br />
— u materielle Werte 282<br />
— u Moral 270 273 387 288 306<br />
— natura humana als Ordnungsprinzip<br />
d - 288<br />
— Nominal<strong>de</strong>finition 269 270<br />
— Nominal- u Real<strong>de</strong>finition d -<br />
268
- u Norm 236 271 274 276 283<br />
- u Normen d Natur 272<br />
- positives 49-50<br />
- positives u Naturrecht 5-7 268<br />
274-302 320<br />
- u Privateigentum 114 353 395<br />
453<br />
- Real<strong>de</strong>finition 270 272<br />
- „richtiges" 265 269<br />
- u sittl Deka<strong>de</strong>nz 306<br />
- sitd Wert d - 304<br />
- u Situation 276<br />
- u Staat 291 300<br />
- u universale natura humana<br />
252 253<br />
-d Vaters 9-11 298-302 308<br />
-u Vernunft 235 236 278 280<br />
283<br />
- Welt- 293<br />
- u Wertbewusstsein 286<br />
- u Wertgefühl 284<br />
- u Wille 265 278<br />
- u Zwang 270 303<br />
<strong>Recht</strong>e<br />
- d Person 463<br />
- subjektive 362 450 451 453<br />
- vorstaatl 267 282 356 357 358<br />
396 453<br />
<strong>Recht</strong>fertigung 16<br />
<strong>Recht</strong>sanspruch 316 331<br />
<strong>Recht</strong>sbesserung 280 281<br />
<strong>Recht</strong>sbeziehungen<br />
- freiwillige u unfreiwillige 58-60<br />
<strong>Recht</strong>sbildung<br />
- u Naturrecht 320 .<br />
- Normen d - 279<br />
- u <strong>Recht</strong>sbewusstsein 283<br />
- durch richterl Spruch 276 287<br />
317 318<br />
- u „richtiges" <strong>Recht</strong> 265<br />
- u Vernunft 283<br />
- Werte als Normen d - 282<br />
- u Wertforschung 282<br />
<strong>Recht</strong>sfindung 319<br />
<strong>Recht</strong>sgefühl 319<br />
<strong>Recht</strong>sgeschäfte<br />
— Ungerechtigkeiten i - 414-442<br />
<strong>Recht</strong>shilfe f Arme 160<br />
<strong>Recht</strong>sphilosophie<br />
— mo<strong>de</strong>rne 265 269 270 271 274<br />
276 277-292<br />
<strong>Recht</strong>slehre, reine 306<br />
<strong>Recht</strong>snormen<br />
— u Ethik 283<br />
— naturrechtl 279<br />
— u Werte 282<br />
<strong>Recht</strong>spositivismus<br />
— u Naturrechtslehre 235 236<br />
267<br />
<strong>Recht</strong>sprechung 41-52 317-321<br />
— u absolute Normen 318<br />
— als Akt d <strong>Gerechtigkeit</strong> 41-43<br />
44<br />
— als Akt d Richters 42<br />
— als Akt d Vernunft 42<br />
— angemasste 44 50-52<br />
— u Autorität d Obrigkeit 44<br />
— u Billigkeit 50<br />
— Erlaubtheit d - 43-45<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 41-43 44<br />
— u geschriebenes Gesetz 49-50<br />
-u Klugheit 42 44 318<br />
— u Obrigkeit 44<br />
<strong>Recht</strong>ssicherheit 319 321<br />
<strong>Recht</strong>sstaat 321<br />
<strong>Recht</strong>ssystem 305<br />
Regierung 477<br />
Reichtum i AT 366 367<br />
Religion<br />
— u Gemeinwohl 476<br />
— gesellschaftl Be<strong>de</strong>utung 467<br />
468<br />
— u soziale Verpflichtung 242<br />
— u Staat 476<br />
— u Staatsgewalt 467 468 469<br />
Religionsfreiheit 468 476<br />
Rente (census) 426-435<br />
Rentenquelle 427<br />
535
Restitution 77-78 219-220<br />
— s a Rückerstattung<br />
Wie<strong>de</strong>rgutmachung<br />
Revolution 403<br />
Richter 42 51 127 129 132 143<br />
255 318<br />
— u Barmherzigkeit 133<br />
— als Diener Gottes 44<br />
— freie sittl <strong>Recht</strong>sentscheidung d<br />
- 318<br />
-u <strong>Gerechtigkeit</strong> 14 42 49 50<br />
126-133<br />
— u Gesetz 49 50 51 127 133 321<br />
— u Moral 273<br />
-u <strong>Recht</strong>sbildung 276 287 317<br />
318<br />
— u <strong>Recht</strong>sverbesserung 319<br />
— sittl Verantwortung d - 318 319<br />
-u Staat 132 133<br />
-u Strafe 68 132<br />
-u Straferlass 132-133<br />
— ungerechtes Urteil d - 147<br />
— Ungerechtigkeiten d - 126-133<br />
405-406<br />
-Zuständigkeit d - 126-128<br />
Richterrecht 319 321<br />
Risiko 259 422 440<br />
Rückerstattung 63-78<br />
— bei Wucherzinsen 219-220 248<br />
— s a Restitution<br />
Wie<strong>de</strong>rgutmachung<br />
Rücksicht auf Personen<br />
— s Ansehen d Person<br />
Ruf s Leum<strong>und</strong><br />
Saccati 384<br />
Sachanalyse<br />
— objektive - u Naturrecht 243<br />
Sache<br />
— Substanz, Gebrauch u Früchte<br />
d - 415<br />
— Überlassung gg Entgelt 415<br />
— Wert d - 415<br />
— u Wert 435-439<br />
536<br />
Sachen, gef<strong>und</strong>ene 119<br />
Sachscha<strong>de</strong>n 111-125<br />
Sachverhalt<br />
— objektiver - u <strong>Recht</strong> 236 237<br />
Sachverhalte<br />
— naturgegebene - u menschl<br />
Vernunft 243<br />
— i Völkerrecht 289<br />
Scha<strong>de</strong>n 69<br />
Schiedsrichter<br />
— u Erzwingungsgewalt 127<br />
Schmähung (contumelia)<br />
167-174 411-412<br />
— Verhältnis z Ehrabschneidung<br />
181<br />
Scholastik 277 284<br />
Schuld 180<br />
— u Strafe 329-333<br />
Schulrecht 301<br />
Schwangerschaftsabbruch 346<br />
Das Seine 308<br />
— geben 284<br />
— je<strong>de</strong>m - geben 12-14 30-32<br />
Selbsterhaltung<br />
— als Naturgesetz 340<br />
Selbstinteresse<br />
— soziale Belastung d - 483<br />
Selbstliebe 241 242<br />
Selbstmord 94-97 149 338-342<br />
Selbstverteidigung 100 149 251<br />
343 344<br />
Sensualismus 496 498<br />
Simonie 249<br />
Sittengesetz 340<br />
Situationsethik 206<br />
Sklaverei 7 8 10 236 294 295 297<br />
Soldaten 100<br />
Solidarismus 467 486-492<br />
Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit 24 25-26 28<br />
32 35 54 245 307 312<br />
das Soziale 493<br />
soziale Belastung 492<br />
— d Eigentums 459 483<br />
— d Einzelnen u Privaten 451
— d Individuums 490<br />
— d Privateigentums 483<br />
— d Selbstinteresses 483<br />
— d subjektiven <strong>Recht</strong>e 362<br />
soziale Frage 491<br />
sozialer Frie<strong>de</strong> 135 364<br />
soziale <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
— s <strong>Gerechtigkeit</strong>, soziale<br />
soziale Liebe<br />
— s Liebe, soziale<br />
soziale Methodologie 496<br />
soziale Natur d M 464 481<br />
soziale Norm 461<br />
soziale Verpflichtung 242<br />
soziale Werte 461<br />
soziales Wesen<br />
— Person als - 459 464<br />
Sozialethik 288 306<br />
— u Handlungsordnung 490<br />
-u Individualethik 478 481 490<br />
491<br />
— Systematik d - 456-457<br />
Sozialismus 364<br />
Soziallehre, kath 456-498<br />
Sozialtechnologie 281<br />
Spassmacher 170 191 192<br />
Spekulation, wirtschaftl 420 421<br />
422 423<br />
Spekulationsgewinn 434<br />
Spiritualen 384<br />
Staat 457 458<br />
— u Einzelmensch 358<br />
— u Familie 358<br />
— formales <strong>Recht</strong> d - 291<br />
— u Freiheit d Religion 476<br />
— u Gemeinwohl 335-449 461<br />
495<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 446 447<br />
— als Gesellschaft 300 301<br />
— u Mensch 356 446<br />
— u natura humana 357<br />
— u Naturrechte 396<br />
— als oberstes <strong>Recht</strong>ssystem 300<br />
— als Organismus 334 445<br />
— pluralistischer 470 495<br />
— u Privateigentum 360 396<br />
— <strong>Recht</strong>s- 321<br />
-u Richter 132 133<br />
— Subsidiaritätsprinzip i - 458<br />
477<br />
Staatsgemeinschaft<br />
— u Hausgemeinschaft, wesentl<br />
Unterschied 335<br />
Staatsgewalt 127 463 495<br />
— u Freiheit 473<br />
— u Gewissen 476<br />
— Grenzen d - 461 464 469<br />
— Kompetenz v Gott 469<br />
— u Pflichten d Bürger 469 473<br />
— u Religion 467 468 469<br />
— u To<strong>de</strong>sstrafe 333-338<br />
— Träger d - 482<br />
— u Wirtschaft 484<br />
Sterilisation 347<br />
Steuerhinterziehung 452<br />
Stoa 243 279 370<br />
Strafe 68 132<br />
— u Schuld 329-333<br />
Strebevermögen<br />
— doppeltes 19<br />
— sinnl 21 27 244<br />
Subsidiarität 453<br />
Subsidiaritätsprinzip 355 457 458<br />
470 473 477 484<br />
— i d Kirche 472 474<br />
— i Ehe, Familie, Staat, Kirche<br />
458<br />
Sühne 332<br />
Sün<strong>de</strong> 257 261 331<br />
Syn<strong>de</strong>resis 290 306<br />
Synesis 42<br />
Tapferkeit 17 21 33 273 310 311<br />
314<br />
Tatsün<strong>de</strong>n 87-125<br />
Tausch 209<br />
Tauschgerechtigkeit 246-247<br />
— Begriff 327<br />
537
— u Kauf u Verkauf 203<br />
Tauschgeschäfte 213<br />
Tauschhandlungen<br />
— freiwillige 200-222<br />
— unfreiwillige 176<br />
Tauschverkehr 56<br />
Tauschvertrag 416<br />
Tiere 87-89 92<br />
To<strong>de</strong>sstrafe 249 328-338<br />
To<strong>de</strong>surteil<br />
— gerechtes 251<br />
-Wi<strong>de</strong>rstand gg - 148 149<br />
Tötung<br />
— Erlaubtheit 328<br />
— fahrlässige 346<br />
— i d Geburtshilfe 345<br />
— i Krieg 344 345<br />
— v Lebewesen 87-89<br />
— e Menschen 251<br />
— i Notwehr 99-101 250 251 343-<br />
346<br />
— e Sün<strong>de</strong>rs 89-94 152<br />
— unfreiwillige 251<br />
— e Unschuldigen 97-99<br />
— unschuldigen Lebens 342-343<br />
— e Verbrechers 335<br />
— z Wohl d Gemeinschaft 249<br />
— zufällige 101-102<br />
Tugend<br />
— u Gemeinwohl 311<br />
— <strong>Gerechtigkeit</strong> als höchste - 32-<br />
33<br />
— u Gesetz 202<br />
— als Habitus d Willens 29<br />
— Materie d sittl - 26<br />
— sittl - u Lust u Trauer 27 28<br />
— u Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit 32<br />
Tugendakt 13<br />
Tugen<strong>de</strong>n<br />
— theologische 455<br />
— s a Kardinaltugen<strong>de</strong>n<br />
Tugendmitte 245-246<br />
— d <strong>Gerechtigkeit</strong> 30 55-57<br />
— als Sachmitte 29-30<br />
538<br />
— u Vernunft 29<br />
Tyrannenmord 237 291<br />
Überfluss<br />
— <strong>de</strong>n Armen „geschul<strong>de</strong>t" 122<br />
242 403 404<br />
— „gehört" d Armen 404<br />
Übertretung 225-226<br />
— u Böses mei<strong>de</strong>n 228 443<br />
— u negatives Gebot 226 228<br />
— u Unterlassung 229-231<br />
— als Verachtung d Gesetzes 226<br />
Ungerechtigkeit 34-40 315-317<br />
— als allgemeine Sün<strong>de</strong> 261<br />
— u Gemeinwohl 34 35<br />
— gg d Gemeinwohlgerechtigkeit<br />
315-316<br />
— e beson<strong>de</strong>res Laster 34-35<br />
— u Son<strong>de</strong>rgerechtigkeit 35<br />
— u Unrechttun 35-37<br />
— Verdacht als - 47<br />
— u Wille 35<br />
Ungerechtigkeiten<br />
— d Ankägers 139-140<br />
— i Gerichtsprozess 405-410<br />
— i <strong>Recht</strong>sgeschäften 414-442<br />
— d Richters 405-406<br />
-b Vertrag 414-416<br />
— d Zeugen 408-409<br />
— s a Unrecht<br />
Universalismus 308<br />
Universum 330 331<br />
Unrecht<br />
— erlei<strong>de</strong>n 37-39 117 176<br />
-gg d Person 87-102 103-110<br />
251<br />
— durch Sachscha<strong>de</strong>n 111-125<br />
— tun 35-37 37-39 39-40 143<br />
— durch Worte 167-199 411-414<br />
— durch Worte i Gerichtsprozess<br />
126-166<br />
— gg Witwen u Waisen 350<br />
— s a Ungerechtigkeit<br />
Unterlassung 227-229
— u Gutes tun 228 443<br />
— u positives Gebot 228<br />
— u Übertretung 229-231<br />
Unternehmer 492<br />
Unwissenheit als Entschuldigung<br />
39<br />
Urteil 44 48<br />
— gern Aussagen d Zeugen 129<br />
— gg besseres Wissen 128-130<br />
— auf blossen Verdacht 45-47<br />
— u öffentl Autorität 51 52<br />
— u Richter 147<br />
Vater<br />
— Autorität d - 348 349<br />
-<strong>Recht</strong> d - 9-11 298-302 308<br />
Verdacht 45 46 47<br />
Vereine 457<br />
Verfluchung 193-199 414<br />
Vergeltung 60 61 62 140<br />
Verheimlichung (praevaricatio)<br />
137 138<br />
Verhöhnung 258<br />
— u Verspottung 258<br />
Verkauf 200-203 203-205<br />
— s a Kauf u Verkauf<br />
Verkäufer<br />
— Pflichten d - 419 420<br />
Verkaufspreis 208-210<br />
Verkehrsgerechtigkeit s <strong>Gerechtigkeit</strong>,<br />
ausgleichen<strong>de</strong><br />
Verleumdung 137 138141 406 407<br />
Vermögen, begehren<strong>de</strong>s 19 21<br />
Vermögen, überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s 19 21<br />
Vernunft<br />
— u naturgegebene Sachverhalte<br />
243<br />
— u Naturrecht 243 278<br />
— u Normen 289<br />
— praktische - als Gewissen 289<br />
— praktische - u Wahrheit 290<br />
— u <strong>Recht</strong> 278 280<br />
— u <strong>Recht</strong>sbildung 283<br />
— u Tugendmitte 29<br />
-u Wille 19<br />
Verschwiegenheit 152 408<br />
Verspottung 189-192 413-414<br />
— u Verhöhnung 258<br />
Verstümmelung 103-105 346-348<br />
Verteidigung 145<br />
-vor Gericht 131 146 147<br />
-dz Tod Verurteilten 148-149<br />
— m ungerechten Mitteln 144-146<br />
— s a Selbstverteidigung<br />
Verteilungsgerechtigkeit s<br />
<strong>Gerechtigkeit</strong>, austeilen<strong>de</strong><br />
Verstaatlichung 403<br />
Verwaltung 397 398 461 483<br />
Volk 466<br />
Völkerrecht 7-8 239 297 298<br />
Volksgeist 286<br />
Vorhaltung 168 169 411<br />
Waffenstillstand 296<br />
Wal<strong>de</strong>nser 384<br />
Ware 200-203 204 205<br />
Warenfehler 203 204 205 206-208<br />
419 420<br />
Warentausch<br />
— doppelte Art v 209<br />
Wegnahme frem<strong>de</strong>n Eigentums<br />
— auf dreifache Weise 73<br />
Weltrecht 293<br />
Wert<br />
-d <strong>Gerechtigkeit</strong> 314-315<br />
— u Preis 201 417<br />
— sittl - d <strong>Recht</strong>s 304<br />
— Trennung v Sache u - 435-439<br />
Wertbewusstsein 286<br />
Werte<br />
— ethische - u <strong>Recht</strong> 288<br />
— materielle - u <strong>Recht</strong> 282<br />
— Modus d Verwirklichung 461<br />
— d Person 465<br />
— u <strong>Recht</strong>snormen 282<br />
— soziale 461<br />
Wertekatalog<br />
— d kath Soziallehre 457<br />
539
Werterkenntnis 276<br />
Wertgefühl<br />
— soziologisches u <strong>Recht</strong> 284<br />
Wertordnung<br />
— u Handlungsordnung 461<br />
Wertskala, absolute 314 315<br />
Wettbewerb 467<br />
Wi<strong>de</strong>rruf (tergiversatio) 137 138<br />
Wi<strong>de</strong>rspruch 277<br />
Wie<strong>de</strong>rgutmachung 248 249 323<br />
324<br />
— s a Restitution<br />
Rückerstattung<br />
Wille<br />
— u <strong>Gerechtigkeit</strong> 13 14 18-21 26<br />
27 244 302<br />
— u <strong>Recht</strong> 265 278<br />
— u Tugend 29<br />
— u Ungerechtigkeit 35<br />
— Unwan<strong>de</strong>lbarkeit d - 14<br />
— als Vernunftstreben 19<br />
Willensbildung<br />
— u soziale Ordnung 288<br />
Wirtschaft<br />
— freie o<strong>de</strong>r gelenkte 399<br />
— Gewaltverteilung i d - 482-483<br />
— u Staatsgewalt 484<br />
— Wan<strong>de</strong>l d - u Eigentum 398-400<br />
Wirtschaftsform<br />
— u Zins 424<br />
Wirtschaftspolitik 399<br />
Wirtschaftssystem 364<br />
Wirtschaftsverfassung i AT 365<br />
366<br />
Witwen u Waisen 109 350<br />
Wohl<br />
— aller u Einzelwohl 497<br />
— d Menschheit 466<br />
— subjektives u allgemeines 496<br />
Wohlfahrt 462 482<br />
— geistige 467<br />
— u Gemeinwohl 495-498<br />
— personale 459<br />
Wohlfahrtsbestimmung<br />
540<br />
— Prozess d - 497<br />
Wohlfahrtsökonomik 498<br />
Wortsün<strong>de</strong>n 126-199<br />
— i Gerichtsverfahren 126-166<br />
— ausserh d Gerichtsverfahrens<br />
167-199<br />
Wucher 219-220 259 260 424 425<br />
431 435 436 440<br />
Wür<strong>de</strong><br />
— d Menschen s Menschenwür<strong>de</strong><br />
— d Person 59 326 457<br />
Zeuge<br />
— Verstösse gg d <strong>Gerechtigkeit</strong><br />
150-158<br />
— Ungerechtigkeiten d - 408-409<br />
— Zurückweisung e - 155-157<br />
Zeugen<br />
-Anzahl d - 152-155<br />
Zeugenaussage<br />
-falsche 157-158 409<br />
-Pflicht zur - 150-152 408<br />
— u Schweigepflicht 408<br />
— Unstimmigkeiten i d - 154 155<br />
Zeugeneid 158<br />
Zins 211-222 371 424-442<br />
— Kapital- 424<br />
-Wucher- 2 19-22<br />
— s a Darlehenszins<br />
Zinstitel<br />
— äussere 439 440<br />
Zorn 173<br />
— u Beschimpfung 171<br />
— u Ehrabschneidung 181<br />
— u Schmähung 173-174<br />
— u Torheit 174<br />
Zwang 123 124 270 303<br />
Zwangsgewalt<br />
— d Richterspruches 127<br />
— d Schiedsrichters 127<br />
— i Staat 127<br />
Zweifel<br />
— nach d günstigeren Seite zu<br />
lösen 47-49
NAMENVERZEICHNIS<br />
Die im alphabetischen Literaturverzeichnis aufgeführten Autoren sind<br />
hier nicht nochmals erwähnt.<br />
Alexan<strong>de</strong>r III. Papa 517<br />
Alphons v. Liguori 248 454 503<br />
Ambrosius 9 17 30 52 111 113<br />
114 115 122 123 129 130 133<br />
204 206 225 226 372 381 382<br />
Anselm 12 19 302<br />
Aristoteles XXIII3467891012<br />
13 16171819202122 23 25 26<br />
27 28 29 30 31'32 33 35 36 37 38<br />
39 40 41 42 45 46 48 49 54 56 57<br />
58 60 65 66 69 84 88 89 91 95 96<br />
97102103 105106112117121<br />
127 130 140 153 169 174 181<br />
187 189 192 201 203 209 213<br />
214 216 221 229 230 236 239<br />
240 241 242 244 246 249 252<br />
272 295 299 300 302 307 309<br />
314 316 320 322 362 368 372<br />
393 423 435 444 445 446 447<br />
449 450 457 483 505 506<br />
Arnold T.W. 276<br />
Augustinus 3 13 14 15 25 26 30 34<br />
44 45 47 49 52 65 82 84 88 89 90<br />
91 92 94 96 97 99 101 102 113<br />
119 121 122 123 124 133 136<br />
150 151 154 160 165 168 171<br />
172 177 179 197 200 202 205<br />
209 221 224 225 226 253 258<br />
371 382 383 404 417 513<br />
Basilius 111 113 114 374 375 376<br />
377<br />
Becker W.G. 279 280 281<br />
Beiträn <strong>de</strong> Heredia V. 521<br />
Bernhard v. Clairvaud 183<br />
Bernhardin v. Siena 436 437 438<br />
439<br />
Beyer W.R. 268 269 282<br />
Bihlmeyer K. 250 254<br />
Billuart CR. 284<br />
Bochenski I.M. 503<br />
Bonaventura 384<br />
Brentano L. 372<br />
Brunner E. 278<br />
Bückers H. 365<br />
Cajetan 250 255<br />
Cassiodor 208<br />
Cathrein V. 491<br />
Celsus 3 371<br />
Chenon E. 256 257 405<br />
Chenu M.-D. 256<br />
Chrysipp 253 370 375<br />
(Johannes] Chrysostomus 24 44<br />
45 105 142 155 171 198 208<br />
210 230 377 380 381 384 393<br />
Cicero 15 17 30 32 45 53 164 201<br />
206 253 294 372 373 374 375<br />
381 409<br />
Cicognani A.G. 462 464 468 471<br />
Coing H. 283 285 319<br />
Cyprian 372<br />
Cyrill v. Jerusalem 374<br />
Darmstaedter F. 271<br />
Dekrete 99 101 113 115 122 134<br />
135 136 137 139 144 146 147<br />
153 156 162 163 219<br />
DelPAqua A. 466<br />
Delos J.Th. 507<br />
Del Vecchio G. 271<br />
541
Diogenes 370<br />
Dionysius (Areopagita) 92 229<br />
DoehringJ. 510<br />
Don<strong>de</strong>rs A. 520<br />
Duns Skotus J. 362<br />
Erzberger M. 337<br />
Eschmann I.Th. 309 512<br />
Faidherbe A.J. 325<br />
Fanfani L. 369<br />
Farner K. 375 379 380<br />
Ferdinand I. XXI<br />
Flanagan Th. 516<br />
Frank J. 276 284 285<br />
Friedmann W. XXI<br />
Fuchs E. 287<br />
Gaius 8 294 296<br />
Galen B.Gr. v. 457 462 463 464<br />
465 466 467 468 469 470 471<br />
472 474 521<br />
Garlan E.N. 276<br />
Gelasius (Callistus I.) 139 141<br />
Gerard Segarelli v. Parma 253<br />
Getino L.G.A. 521<br />
Gillet M.S. 507<br />
Girald v. Monteforte 384<br />
Glosse 46 47 80 84 101 144 147<br />
151 168 177 179 185 186 190<br />
193 198 215 223<br />
Graf Th. 244<br />
Gratian 141 296 373 383 407 506<br />
509<br />
Gregor 17 127 144 159 172 173<br />
179 182 191 192 196<br />
Gregor IX. 156 343<br />
Gregor v. Nazianz 373 377<br />
Gregor v. Nyssa 377<br />
Groner F. 516<br />
Groner J.F. XXV 457 458 460<br />
462 463 466 467 474 475 521<br />
Grotius H. 238 288 297<br />
Guillaume d'Auxerre 506<br />
G<strong>und</strong>lach G. 458 479 486 487 492<br />
494<br />
Habermas J. 281<br />
542<br />
Hadrian 139<br />
Hadrossek P. XXII 521<br />
Hartmann N. 282<br />
Hässle J. 426<br />
Healy P.J. 369<br />
Heck Ph. 282<br />
Hegel 447 489 493<br />
Hermogenian 295<br />
Hertling G. v. 514<br />
Hesiod 299<br />
Heumann 257<br />
Hieronymus 182 209<br />
Hilarius 44<br />
Hobbes Th. 304<br />
Holmes O.W. 276 286<br />
Homer 299 446<br />
Honorius IV. 253<br />
Horväth A. 352 427<br />
Hugo v. St. Viktor 522<br />
Irenaus 254 369 370<br />
Isay H. 287<br />
Isidor 34 5 7 13 115 116 168 185<br />
191 295 296<br />
Jacobus <strong>de</strong> Voragine 96<br />
Jerusalem F.W. 286<br />
Johannes XXII. 384<br />
Johannes XXIII. 453 465 467 469<br />
Johannes v. Damaskus 103 190<br />
Johannes Paul II. 337 363 364 365<br />
458 483<br />
Justinian 254 295 302 320 419<br />
Kant I. 271 306 307 442 497<br />
Kantorowicz H. 287<br />
Karl d Grosse 517<br />
Keller-Senn C.J. 520<br />
Kelsen H. 235 238 276 289 303<br />
305 306 317 456 517<br />
Kierkegaard S. 281<br />
Killeen S.M. 426<br />
Klemens v. Alexandrien 370 371<br />
374<br />
Klemens v. Rom 181 373<br />
Klose A. 479 495 521<br />
Kohler J. 279
Kraus J.D. 384<br />
Kühle H. 337<br />
Laktanz 372 373<br />
Larkin P. 359<br />
Laski HJ. 286 369<br />
Laun R. 279<br />
Lauterpacht H. 270 272<br />
Le Foyer J. 251<br />
Leo IV. 127<br />
Leo XIII. 245 354 355 356 358<br />
360 361 363 364 395 458 459<br />
460 462 463 467 468 469 484<br />
490 492 510 518 519 520<br />
Liberatore M. 360<br />
Linhardt R. 292<br />
Locke J. 359 484<br />
Lombard P. 513<br />
Lottin O. 292 295 296<br />
Ludwig d. Heilige 347 349<br />
Luhmann N. 281<br />
Luzia, hl. 96<br />
Macedonius 165<br />
Marcian 295<br />
Maritain J. 508<br />
Marx K. 489<br />
Mausbach J. 522<br />
Mayer J. 348<br />
McDonald W.J. 373<br />
Meinerts M. 520<br />
Messner J. 278 454 479 482 493<br />
494 511 521<br />
Mitteis H. 283<br />
Moralejo R. 462<br />
Müller K. 426<br />
Nell-Breuning O. v. 416 424 425<br />
454 470 487 488 518<br />
Nikolaus I. 99<br />
Nikolaus IV. 253<br />
O'Brien 369<br />
Oliver Martin Fr. 405<br />
Orel A. 421 422 424 426 427 428<br />
429 430 431 432 433 437 438<br />
439<br />
Origenes 371<br />
Pascal J. 268<br />
Pareto V. 495 496 497 498<br />
Parmenianus 90<br />
Paul VI. 462 464 472<br />
Pius I. 182<br />
Pius XI. 245 355 359 361 448 453<br />
454 455 458 462 464 465 467<br />
470 474 485 508 518<br />
Pius XII. XXIV XXV 457 458<br />
460 462 463 466 474 521<br />
Plato 240 372 373 374 376 383<br />
Porphyrius 334<br />
Posidonius 373<br />
Prümmer D. 249<br />
Publicola 99 102 221<br />
Radbruch G. 283 319 337<br />
Ramirez S. 298<br />
Rathenau W. 337<br />
Rauscher A. 360 459 487 495 511<br />
Reinach A. 279<br />
Rinecker C. 490<br />
RyanJ.A. 369<br />
Sacher H. 424 425 470 515<br />
Savigny F.K. v. 286<br />
Schambeck H. 479 511 521<br />
Schätzel W. 521<br />
Scheler M. 282 493 506<br />
Schickling H. 444<br />
Schilling O. 369 371 372 381<br />
Schmal F. 514<br />
Schnürer G. 256<br />
Schöttl F. 490<br />
Schumacher H. 369<br />
Seckel E. 257 510<br />
Seipel I. 369<br />
Seneca 341 373 374<br />
Sieling-Wen<strong>de</strong>ling U. 506<br />
Siri G. 464 468 471<br />
Smith J. 456<br />
Sohm R. 292 293 299<br />
Sombart W. 430<br />
Sommerlad Th. 375<br />
Sorgenfrei H. 490<br />
Soto D. <strong>de</strong> 505<br />
543
Sousberghe L. <strong>de</strong> 353 359<br />
Spann O. 308<br />
Spicq C. 252 259<br />
Spranger E. 281<br />
Stammler R. 271 279 281<br />
Suarez 390 391 392 508 509<br />
Tammelo J. 282<br />
Taparelli L. 359 360 451 484 490<br />
491 492 493 513 522<br />
Tawney R.H. 369<br />
Tertullian 371 372<br />
Thieme K. 453<br />
Thomann M. 490 491<br />
Tischle<strong>de</strong>r P. 521<br />
Tolstoi L. 304<br />
Tomberg V. 320<br />
Tonneau J. 513<br />
Trappe P. 285 496 520<br />
Troeltsch E. 369<br />
Tron<strong>de</strong> R. 513<br />
Truyol Serra A. 520<br />
544<br />
Tüchle H. 250 254 504<br />
Ulpian 294 295 296 302 319<br />
Utz A.F. XXV 244 268 277 279<br />
306 323 329 362 398 449 452<br />
457 458 460 462 463 464 465<br />
466 467 468 469 470 471 472<br />
474 475 496 503 520<br />
Veit O. 286<br />
Verpaalen A.P. 309 480<br />
Vincentius 123<br />
Vitoria F. <strong>de</strong> XXII 292 297 298<br />
503 520<br />
Weber A. 367<br />
Weber M. 369 497<br />
Weiler R. 479 511 521<br />
Welkoborsky H. 506<br />
Welty E. 325 426<br />
Wolf E. 279<br />
Wolff Chr. 491 520<br />
Wyser P. 503
Demnächst erscheint<br />
THOMAS VON AQUIN<br />
DIE HOFFNUNG<br />
(Theologische Summe II-II 17-22)<br />
Ubersetzung<br />
von<br />
Prof. Dr. Josef F. Groner<br />
Anmerkungen <strong>und</strong> Kommentar<br />
von<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. Arthur F. Utz<br />
Die Hoffnung gehört zu <strong>de</strong>n f<strong>und</strong>amentalen Themen <strong>de</strong>s Lebens. Die<br />
Klassiker <strong>de</strong>r griechisch-römischen Zeit konnten nur von <strong>de</strong>r Vergeblich<br />
keit o<strong>de</strong>r Selbsttäuschung re<strong>de</strong>n, die in <strong>de</strong>r menschlichen Hoffnung liege.<br />
Piaton sprach zwar von einer Hoffnung auf Gott, ob jedoch <strong>de</strong>r Ruf <strong>de</strong>s<br />
Hoffen<strong>de</strong>n überhaupt zu ihm gelange <strong>und</strong> sich die Hoffnung erfülle, ver<br />
mag er nicht zu sagen. In <strong>de</strong>r Philosophie <strong>de</strong>r Neuzeit hat man darauf ver<br />
zichtet, von <strong>de</strong>r Hoffnung eines einzelnen Menschen im Hinblick auf sein<br />
ewiges Glück zu diskutieren. So wich man aus auf die Hoffnung als Erwar<br />
tung <strong>de</strong>r Menschheit im Sinn einer optimistischen Entwicklung <strong>de</strong>s Dies<br />
seits. Der einzelne sollte sein Heil nur in einer Gottwerdung im Rahmen<br />
eines marxistisch konzipierten Geschichtsprozesses erwarten (E. Bloch).<br />
Thomas von Aquin vermittelt in diesem trostreichen Traktat die Ein<br />
sicht, daß <strong>de</strong>r Mensch, <strong>und</strong> zwar je<strong>de</strong>r einzelne, durch die Gna<strong>de</strong> Christi<br />
die sichere Zuversicht haben kann <strong>und</strong> nach Gottes Willen auch haben soll,<br />
an ein glückliches En<strong>de</strong> zu kommen. Aus dieser Hoffnung soll <strong>de</strong>r Christ<br />
auch das unerschütterliche Vertrauen schöpfen, daß ihm in allen sonstigen<br />
kleinen o<strong>de</strong>r großen Sorgen <strong>de</strong>s täglichen Lebens die allmächtige Hilfe<br />
Gottes zur Verfügung steht. Diese personalistisch geprägte Hoffnung<br />
bewahrt <strong>de</strong>n Theologen vor einer allzu großen Anlehnung an die neuzeit<br />
lichen kollektivistischen Vorstellungen von einer nur-eschatologischen<br />
Hoffnung <strong>de</strong>r gesamten Menschheit.<br />
IfG-Verlagsgesellschaft mbH, Bonn, Simrockstr. 19