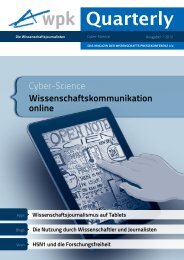PDF zum Download: WPK-Quarterly II 2010
PDF zum Download: WPK-Quarterly II 2010
PDF zum Download: WPK-Quarterly II 2010
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>II</strong> / <strong>2010</strong> <strong>WPK</strong>-<strong>Quarterly</strong><br />
Vernetzt denken zwischen allen Stühlen<br />
Die Welt der Umweltthemen wird unübersichtlicher. Längst müssen Journalisten<br />
dabei nicht mehr nur in Biologie und Chemie Bescheid wissen, sondern oft auch in<br />
Ökonomie und Medizin. Gerüstet sind die Redaktionen dafür selten. Es sei denn,<br />
man bündelt Kompetenzen<br />
Von Nicole Heißmann<br />
Die Fotos wurden zu Ikonen der<br />
Umweltbewegung: Baumgerippe und<br />
Stümpfe an den Hängen von Fichtelgebirge<br />
und Bayerischem Wald. Ein<br />
Begriff dazu ging um die Welt: „the<br />
German Waldsterben“ nannten es die<br />
Amerikaner, Franzosen sprachen von<br />
„le Waldsterben“. Ende der siebziger<br />
und Anfang der achtziger Jahre lösten<br />
Bilder von Umweltzerstörung und Naturplünderung<br />
öffentliche Empörung<br />
und tiefe Ängste aus. Immerhin waren<br />
sie für die meisten Zeitungsleser oder<br />
Fernsehzuschauer hierzulande neu.<br />
Kaum jemand hatte vor Mitte der 70er<br />
Jahre gesehen, wie in Kanada Robbenbabys<br />
erschlagen oder auf hoher See<br />
Wale geschossen wurden, bevor Prominente<br />
wie Brigitte Bardot oder Umweltorganisationen<br />
wie Greenpeace<br />
Bilder von dort mitbrachten und Journalisten<br />
sie um die Welt verbreiteten.<br />
Als Mahner und Aufklärer verstanden<br />
sich prominente Publizisten der<br />
damaligen Zeit: „So bleibt zwischen<br />
Hoffnung und Resignation letztlich die<br />
Befürchtung, dass man auch hierzulande<br />
erst ein Seveso benötigt, um die<br />
tödlichen Risiken der Chemie zu erkennen“,<br />
schrieben im Jahr 1978 Egmont<br />
R. Koch, heute Dokumentarfilmer, und<br />
Fritz Vahrenholt, inzwischen Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung von RWE<br />
Innogy, in ihrem Buch „Seveso ist überall“.<br />
Horst Stern gründete 1980 die Zeitschrift<br />
„natur“ und ließ darin etwa über<br />
den Rückgang der Artenvielfalt, die<br />
Zubetonierung der Landschaft und die<br />
Verschmutzung von Flüssen und Seen<br />
schreiben – sowie über Initiativen, die<br />
sich all dem entgegenstellten. Stern<br />
selbst hatte Anfang der Siebziger die<br />
„Gruppe Ökologie“ mitgegründet, die es<br />
sich auch zur Aufgabe gemacht hatte,<br />
der Industriegesellschaft zu mehr ökologischem<br />
Bewusstsein zu verhelfen.<br />
Absolute Aussagen und Katastrophenszenarien<br />
belebten die Schlagzeilen<br />
der Umweltberichterstattung: „Die<br />
ersten großen Wälder werden schon<br />
in den nächsten fünf Jahren sterben.<br />
Sie sind nicht mehr zu retten“, wurde<br />
der Göttinger Bodenkundler Bernhard<br />
Ulrich 1981 im Spiegel zitiert. Im Jahrzehnt<br />
von Seveso (1976), Harrisburg<br />
(1979), Bhopal (1984), Ozonlochentdeckung<br />
(1985), Tschernobyl und Sandoz<br />
(beide 1986) schien es vielen auch<br />
nicht völlig abwegig, dass die Menschheit<br />
den Planeten irgendwann wahlweise<br />
vergiften, in die Luft sprengen<br />
und anderswie unbewohnbar machen<br />
würde. Zudem befand man sich mitten<br />
im Kalten Krieg, und seit 1983 wurde<br />
atomar nachgerüstet.<br />
Ohne Frage verdanken wir der damaligen<br />
Umweltbewegung eine Menge,<br />
ebenso dem Umweltjournalismus,<br />
der ihre Themen in die Öffentlichkeit<br />
und damit in die Politik brachte: Das<br />
Protokoll von Montreal <strong>zum</strong> Beispiel,<br />
das seit 1987 den Einsatz von FCKW<br />
beschränkt und inzwischen weitgehend<br />
verbietet, oder die Rauchgasentschwefelung,<br />
die seit 1983 für alle<br />
Kohlekraftwerke Pflicht ist.<br />
Dennoch würde der engagierte und<br />
in Teilen plakative Umweltjournalismus<br />
der damaligen Zeit den Themen von<br />
heute wohl kaum noch gerecht. Dass<br />
Umweltprobleme heute nicht mehr so<br />
sichtbar sind, weil hierzulande nur noch<br />
selten Fische kieloben in Flüssen treiben<br />
und man <strong>zum</strong> Beispiel Gentechnik<br />
im Mais nicht wirklich gut fotografieren<br />
kann, ist dabei noch die geringste Herausforderung.<br />
In mindestens drei weiteren Punkten<br />
muss Umweltjournalismus heutige die<br />
Themen komplexer behandeln als vor<br />
drei Jahrzehnten:<br />
Gut und Böse −<br />
ein Auslaufmodell<br />
Früher waren die Schuldigen schnell<br />
benannt: Schwefeldioxid trieb das Wald-<br />
4<br />
sterben voran, Blei im Benzin hemmte<br />
Kinder in ihrer geistigen Entwicklung<br />
und Müllberge begruben Natur unter<br />
sich. Ihre Urheber: Die Kraftwerke, die<br />
Industrie, vorzugsweise die chemische<br />
oder petrochemische, die Autofahrer,<br />
die Konsumenten. Auswege schienen<br />
klar vorgezeichnet: Erneuerbare Energien,<br />
Vermeidung von Emissionen,<br />
autofreie Verkehrskonzepte, Recycling<br />
von Rohstoffen.<br />
Im Grundsatz mag sich daran nichts<br />
geändert haben, in den Details aber<br />
sehr wohl. Auch bei vermeintlich grünen<br />
Alternativen gehört es heute zur guten<br />
journalistischen Praxis, sie auf den Prüfstand<br />
zu stellen: Die Diskussion darüber,<br />
wie man dem Klimawandel mit nachwachsenden<br />
Energieträgern entgegen<br />
treten kann, hat durch Palmölplantagen<br />
auf Kosten von indonesischem Regenwald<br />
und die härter werdende Konkurrenz<br />
um Anbauflächen für Nahrungsmittel<br />
neue Facetten bekommen.<br />
Mehr Wissen,<br />
mehr Verwirrung<br />
Ohne Frage ist durch das Internet,<br />
wissenschaftliche Datenbanken und<br />
die Erfindung des pdf-Formats der<br />
Zugriff auf wissenschaftliche Erkenntnis<br />
einfacher geworden. Gleichzeitig<br />
vervielfältigt sich der Output der Wissenschaft<br />
ständig. Beides zusammen<br />
kann Wissenschafts- wie Umweltjournalisten<br />
zwischen Begeisterung und<br />
Verzweiflung schwanken lassen.<br />
„Manche Zusammenhänge haben<br />
sich im Nachhinein als nicht so eindeutig<br />
herausgestellt wie gedacht. Je mehr<br />
Studien zu einem Thema erscheinen,<br />
desto eher sind Journalisten auch mit<br />
widersprüchlichen Ergebnisse konfrontiert“,<br />
sagt Beatrice Dernbach, Professorin<br />
für Journalistik an der Hochschule<br />
Bremen.