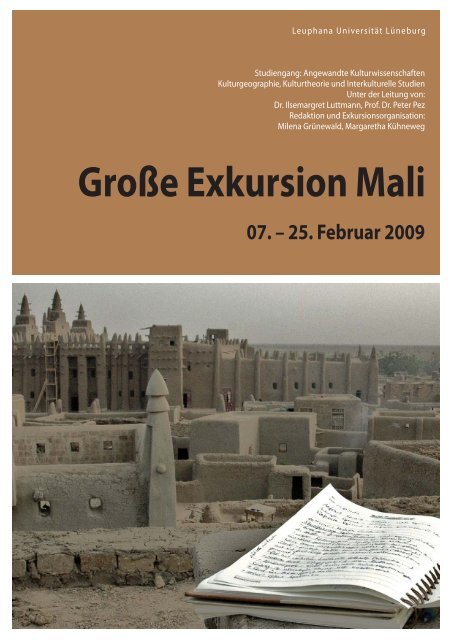Große Exkursion Mali
Große Exkursion Mali
Große Exkursion Mali
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Leuphana Universität Lüneburg<br />
Studiengang: Angewandte Kulturwissenschaften<br />
Kulturgeographie, Kulturtheorie und Interkulturelle Studien<br />
Unter der Leitung von:<br />
Dr. Ilsemargret Luttmann, Prof. Dr. Peter Pez<br />
Redaktion und <strong>Exkursion</strong>sorganisation:<br />
Milena Grünewald, Margaretha Kühneweg<br />
<strong>Große</strong> <strong>Exkursion</strong> <strong>Mali</strong><br />
07. – 25. Februar 2009
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Vorwort<br />
Dr. Ilsemargret Luttmann, Prof. Dr. Peter Pez 6<br />
TEIL I: SEMINARREFERATE<br />
Kima und zu beobachtende Klimazonenverschiebung<br />
Susann Aland 11<br />
Geologisch-tektonischer Aufbau und geomorphologische Einheiten <strong>Mali</strong>s/ Westafrikas<br />
Mirja Greßmann 25<br />
Bevölkerungsstruktur, -entwicklung und –verteilung, ethnische Zusammensetzung,<br />
Siedlungsstruktur und Urbanisierung in <strong>Mali</strong><br />
Robert Oschatz 37<br />
Agrarwirtschaftliche Strukturen und Lebensbedingungen<br />
Melanie Kühl 55<br />
Politische Entwicklung und politisches System des jungen Staates<br />
Sally Ollech 73<br />
Touristische Strukturen in <strong>Mali</strong><br />
Mirjam Krüger 87<br />
Alles für die Katz? Lehren aus der Entwicklungspolitik<br />
Mathias Becker 101<br />
TEIL II: KURZREFERATE<br />
Reiseinformationen: was bei Reisen nach <strong>Mali</strong>, in einen „fremden“ Kulturraum, von<br />
Bedeutung ist<br />
Julia Zimmermann 119<br />
Timbuktu – Entwicklung einer nicht nur historischen Metropole<br />
Friederike Brumhard 127<br />
Stadtentwicklung: Bamako, Djenné, Mopti<br />
Ute Tschirner 139<br />
3
Traditionelle Architektur in Stadt und Land: Der Sudanstil<br />
Susann Aland 149<br />
Kulturelle Konstruktion von Landschaft – die Wissenschaftsreisen von Heinrich Barth<br />
Lisa Trager 163<br />
Die Frau im islamisch geprägten <strong>Mali</strong><br />
Elena Konrad 169<br />
Umweltsituation in <strong>Mali</strong><br />
Theresa Lauw 175<br />
TEIL III: REISEPROTOKOLLE<br />
Samstag, 07. Februar 2009<br />
Anreise, Bamako 182<br />
Sonntag, 08. Februar 2009<br />
Bamako: Stadtrundfahrt, Nationalmuseum 184<br />
Montag, 09. Februar 2009<br />
Bamako: Deutsche Botschaft, DED 188<br />
Dienstag, 10. Februar 2009<br />
Kati: Staudamm 190<br />
Mittwoch, 11. Februar 2009<br />
Ségou:: CPEL 192<br />
Donnerstag, 12. Februar 2009<br />
Niono: ALPHALOG 193<br />
Freitag, 13. Februar 2009<br />
Termitenhügel 195<br />
Samstag, 14. Februar 2009<br />
Sevaré: Bioklima, Perlenmuseum<br />
Mopti: Pirogenfahrt, Bozo-Fischerdorf 196<br />
Sonntag, 15. Februar 2009<br />
Djenné: Stadtrundgang 199<br />
Montag, 16. Februar 2009<br />
Djenné djeno: Ausgrabungsstätte<br />
Djenné: Markt 201<br />
4
Bandiagara<br />
Dienstag, 17. Februar 2009<br />
Bandiagara: Mission Culturelle, Zentrum für traditionelle Medizin 208<br />
Mittwoch, 18. Februar 2009<br />
Bandiagara: Schule, GAAS <strong>Mali</strong> (Arbeit zu Aids, Beschneidung) 210<br />
Donnerstag 19. Februar 2009<br />
Wanderung durch Falaise; Nombori: Rundgang/Übernachtung im Dogondorf, Tanz 214<br />
Freitag, 20. Februar 2009<br />
Schule, Wanderung durch Sanddünen 216<br />
Timbuktu<br />
Dienstag, 17. Februar 2009<br />
Hinfahrt 220<br />
Mittwoch, 18. Februar 2009<br />
Timbuktu:: Stadtführung, Dromedarritt, Übernachtung in Campement in der Wüste 221<br />
Donnerstag 19. Februar 2009<br />
Tin Telut: <strong>Mali</strong> Nord, Einladung zu Mohammeds Familie 226<br />
Freitag, 20. Februar 2009<br />
Rückfahrt 231<br />
Samstag, 21. Februar 2009<br />
Sevaré: Plastikmüllrecycling, Lateritabbau 232<br />
Sonntag, 22. Februar 2009<br />
Segou: Bogolanzentrum 236<br />
Montag, 23. Februar 2009<br />
Bamako: FES 239<br />
Dienstag, 24. Februar 2009<br />
Bamako: Point Sud 241<br />
Mittwoch, 25. Februar 2009<br />
Bamako: GTZ, Rückflug 243<br />
5
Vorwort<br />
Die <strong>Große</strong> Geographische <strong>Exkursion</strong> ist so etwas wie die „Krönung“ des Studiums im<br />
Fach Geographie. Nachdem – ganz besonders im Grundstudium – umfangreiche<br />
theoretische Grundlagen vermittelt und (hoffentlich) verinnerlicht wurden, geht es<br />
während der <strong>Exkursion</strong> um die Anwendung des Gelernten. Dies erfolgt in der gesamten<br />
Breite von Natur- und Kulturgeographie, je nachdem, was der besuchte Raum zu bieten<br />
hat. Die <strong>Exkursion</strong> nach <strong>Mali</strong> ging aber über diese „übliche“ Zielsetzung der Geographie-<br />
<strong>Exkursion</strong>en weit hinaus, denn Dank der Zusammenarbeit mit der Lehrbeauftragten Frau<br />
Ilsemargret Luttmann wurde der inhaltliche Bogen weiter gespannt zum Studiengebiet<br />
„Kulturtheorie und interkulturelle Studien“. Dies wiederum galt nicht nur für die<br />
<strong>Exkursion</strong> und ihr eigenes Vor- und Nachbereitungsseminar, sondern durch die<br />
Koppelung mit weiteren Veranstaltungen gelang die Organisation eines interdisziplinären<br />
„Studienprojektes <strong>Mali</strong>“. Zu diesen ergänzenden weiteren Angeboten gehörten<br />
- das Seminar „Unterentwicklungstheorien und Entwicklungsstrategien für den<br />
Bereich der ‚Dritten Welt’“, Bereich Kulturgeographie (Pez)<br />
- das Seminar „Darstellung afrikanischer Kulturen in den Medien: das Beispiel <strong>Mali</strong>“,<br />
Bereich Kulturtheorie (Luttmann)<br />
- das Seminar „Französisch/FSZ: Préparation à l'excursion au <strong>Mali</strong>“, Bereich<br />
Fremdsprachen (Gola / Luttmann)<br />
und im Sommersemester 2009 zwei weiterführende Seminare<br />
- „Tourismus und Entwicklung am Beispiel Afrikas“, Bereich Kulturtheore (Luttmann)<br />
- „Französisch/FSZ: Les femmes au <strong>Mali</strong>: environnement socio-économique et<br />
approches de la coopération technique européenne“, Bereich Fremdsprachen<br />
(Gola / Luttmann)<br />
Ein solch umfassendes Angebot gab es bislang in Lüneburg nicht und könnte beispielgebend<br />
wirken für die zukünftige Ausbildung, wenn die Ziele der Internationalisierung und<br />
Interdisziplinarität weiterverfolgt werden.<br />
Bedingt durch den besuchten Raum spielte das Thema Entwicklungszusammenarbeit eine<br />
herausragende Rolle. Dies hat uns immer wieder gefesselt, aber auch innerlich mitunter<br />
„zerrissen“. Wir haben eine Reihe hochinteressanter und erfolgreicher lokaler Projekte<br />
gesehen, mussten aber ebenso die hohe Krisenanfälligkeit des Naturraumes und die<br />
unzureichenden Möglichkeiten zur nationalen und internationalen Krisenbewältigung<br />
registrieren. Wir waren überwältigt von der Gastfreundschaft derer, die uns aufgenommen<br />
haben bzw. zur Verfügung standen, konnten aber als Studierendengruppe dem Eindruck, zur<br />
Gruppe der reichen Europäer zu gehören, angesichts von Armut und Aufforderungen von<br />
Kindern wie „Donnez-moi un cadeau“ aus der Perspektive der einheimischen Bevölkerung<br />
(und ggf. eigenen Ansprüchen, von uns etwas zu[rückzu-] geben) sicher nicht gerecht<br />
werden. Wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet – Moskitodome,<br />
Impfungen, Sonnencreme, Kopfbedeckungen, Medikamente u. v. m. –, und mussten doch<br />
unsere unzulänglichen Resistenzen gegen Krankheiten und klimatische Belastungen am Leibe<br />
erfahren. Aber vielleicht gerade deshalb war die <strong>Mali</strong>-<strong>Exkursion</strong> auf einzigartige Weise<br />
eindrücklich. Wir haben pausenlos durch unmittelbare Erfahrungen gelernt und dies mit<br />
7
allen Sinnen sowie viel, viel mehr als jemals in Seminarräumen vermittelt werden kann.<br />
In dieser Hinsicht möchten wir uns bei den Teilnehmenden für ihr ungeheuer großes<br />
Engagement, abschnittweise gepaart mit Leidensfähigkeit, weit mehr aber verbunden mit<br />
Begeisterungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen herzlich bedanken. Es war eine <strong>Exkursion</strong>,<br />
die wir alle – Leitung und Teilnehmende gleichermaßen – sicherlich niemals vergessen<br />
werden.<br />
Peter Pez, Ilsemargret Luttmann<br />
8
TEIL I: SEMINARREFERATE<br />
9
Klima<br />
und zu beobachtende<br />
Klimazonenverschiebung<br />
Susann Aland<br />
11
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Lagebeschreibung und Gradnetzeinordnung.......................................................................... 13<br />
2. Klima- und Vegetationszonen.................................................................................................... 13<br />
3. Klimatische Entwicklungen in der Sahelzone ......................................................................... 14<br />
4. Beobachtungen während des Aufenthaltes in <strong>Mali</strong> im Februar 2009................................ 18<br />
5. Schlussfolgerungen ....................................................................................................................... 21<br />
12
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den klimatischen Entwicklungen in <strong>Mali</strong>. Es werden<br />
zunächst jüngere Tendenzen in der Vegetation des Sahels betrachtet, um diese dann<br />
langfristigen Messwerten gegenüberzustellen. Anhand der Ergebnisse und zusätzlicher<br />
Beobachtungen, die vor Ort im Februar 2009 gesammelt wurden, werden die<br />
zunehmende Trockenheit und die wachsende Gefährdung der Sahelzone durch<br />
Dürreperioden betont und auf die Notwendigkeit für eine Notfallplanung aufmerksam<br />
gemacht.<br />
1. Lagebeschreibung und Gradnetzeinordnung<br />
<strong>Mali</strong> liegt in Westafrika und grenzt im Nordosten an Algerien, im Osten an Niger und<br />
Burkina Faso, im Süden an Côte d’Ivoire und Guinea, im Westen an den Senegal und im<br />
Nordwesten an Mauretanien. Mit einer Fläche von 1.240.192 km² (Fischer Weltalmanach<br />
2002, 181) erstreckt sich das Land zwischen ca. 10° und 25° nördlicher Breite sowie<br />
zwischen ca. 12° westlicher und 4° östlicher Länge.<br />
2. Klima- und Vegetationszonen<br />
Der klimatischen Betrachtung <strong>Mali</strong>s wird im Folgenden die Klimaklassifikation nach<br />
Troll/Paffen zugrunde gelegt. Bei dieser Klassifikation sind allgemein Jahreszeiten,<br />
Wechsel von Trocken- und Regenzeiten, die Temperatur sowie die Vegetation von<br />
Bedeutung. Die Erde ist in fünf Großklimazonen, die nach Temperaturwerten abgegrenzt<br />
werden, eingeteilt: polare und subpolare Zonen (I), kaltgemäßigte Zonen (II),<br />
kühlgemäßigte Zonen (III), warmgemäßigte Subtropenzonen (IV) und Tropenzonen (V).<br />
Bei der Untergliederung der Hauptzonen werden auch Trocken- und Regenzeiten bzw.<br />
aride und humide Monate und besonders die jeweils vorherrschende Vegetation<br />
berücksichtigt.<br />
Aufgrund der beschriebenen Lage und Größe <strong>Mali</strong>s sind von Süd nach Nord insgesamt<br />
vier verschiedene Klima- und Vegetationszonen zu finden. Diese sind in der Abb. 1 stark<br />
vereinfacht dargestellt nachzuvollziehen.<br />
Abb. 1: Klima- und Vegetationszonen Afrikas (stark<br />
vereinfacht)<br />
(Quelle: www.zum.de)<br />
13
Der südliche Teil <strong>Mali</strong>s befindet sich bis etwa 13° nördlicher Breite in der<br />
Trockensavanne der wechselfeuchten Tropenklimate (V 3). Die aride Zeit in den<br />
Wintermonaten hält durchschnittlich 5 bis 7,5 Monate an. Zwar herrschen zwischen<br />
Trocken- und Regenzeit sehr unterschiedliche Bedingungen mit entsprechend<br />
ausgeprägter jahreszeitlicher Vegetation, doch sind die durchschnittliche Niederschlagsmenge,<br />
-dauer und -verlässlichkeit des Monsuns ausreichend für Landwirtschaft. Die<br />
Trockensavanne zeichnet sich durch mannshohes Gras und einen sehr aufgelockerten<br />
Baumbestand aus. Zwischen ca. 13° und 18° nördlicher Breite folgt die Dornsavanne der<br />
tropischen Trockenklimate, welche in Nordafrika auch als Sahelzone bezeichnet wird (V<br />
4). Der saisonale Niederschlag in der Sahelzone ist monsunal bedingt. Mit 7,5 bis 10<br />
Monaten überwiegt die winterliche aride Zeit des Jahres. Die kurze, vor allem sehr<br />
variable humide Zeit und die stete Gefahr von Dürrejahren lassen Ackerbau in diesem<br />
Raum ohne regelmäßige Bewässerung nicht zu. An diesen Lebensraum mit schütterer<br />
Vegetation, kniehohem Gras, Dornsträuchern und vereinzelnd auftretenden Sukkulenten<br />
(z. B. der Affenbrotbaum) haben sich nomadisch lebende Völker angepasst. Richtung<br />
Norden schließt sich bis ungefähr 20° nördlicher Breite das Klima der tropischen<br />
Halbwüsten- und Wüsten an (V 5). Typisch für diesen Raum sind Sukkulenten wie bspw.<br />
Kakteen. Im äußersten Norden herrscht ab ca. 20° nördlicher Breite Halbwüsten- und<br />
Wüstenklima der warmgemäßigten Subtropenzone (IV 5) und tritt mit Kurzgras- und<br />
Waldsteppe in Erscheinung.<br />
3. Klimatische Entwicklungen in der Sahelzone<br />
Erst kürzlich, im April 2009, berichtete das Wochenmagazin ‚Der Spiegel’ über das zu<br />
beobachtende Ergrünen der Sahelzone. Der Geograph Chris Reij von der Freien<br />
Universität Amsterdam macht darauf aufmerksam, dass seit etwa 20 Jahren der<br />
Baumbestand in Niger jährlich um ca. ¼ Mio. Hektar anwächst und dass Vergleichbares<br />
ebenso in Burkina Faso und <strong>Mali</strong> festzustellen ist. Diese Entwicklungen führt Reij auf<br />
zufällige Ereignisse zurück, die er während seiner regelmäßigen Aufenthalte im Sahel seit<br />
30 Jahren beobachtet hat. In Zeiten der Dürre, wie zwischen 1968 und 1973 sowie<br />
Anfang der 1980er Jahre, versucht sich die lokale Bevölkerung auf verschiedene Weise<br />
aus der Not zu helfen. Sie schlagen Brennholz, um es auf dem Markt zu verkaufen und<br />
etwas Geld für Nahrungsmittel zu verdienen. Mit steigendem Holzeinschlag sinkt der<br />
Erosionsschutz der Böden und die Gefahr der Abtragung von fruchtbarem Boden samt<br />
Saat steigt. Einen weiteren Ausweg suchen junge Männer, indem sie in Nachbarländern<br />
ihre Arbeitskraft anbieten. In der Dürreperiode Anfang der 1980er Jahre wurde durch<br />
die (Arbeits-)Migration das Roden mancherorts in Niger vernachlässigt, was sich nach<br />
Einsetzen des Niederschlags im Juni als Glücksfall erwies: Dort wuchs die Hirse auffallend<br />
besser heran als auf den Feldern, in deren Nähe der Baumbestand reduziert wurde. Die<br />
heimischen Akazien, die in der Trockenzeit Blätter tragen, spendeten nicht nur Schatten<br />
und Futter für das Vieh, sondern boten in der Nähe der Felder vor allem Windschutz für<br />
die Saat. Das Vieh wiederum war Düngerlieferant für den Boden. Diese Zusammenhänge<br />
von schützender Vegetation und den Erfolgsaussichten der Ernte verbreiteten sich<br />
zunehmend über Mundpropaganda, so dass andere Dörfer gezielt Akazien anpflanzten<br />
(Schmid 2009, 136 ff.).<br />
Bei dem Erfolg der Pflanzaktionen ist zu berücksichtigen, dass sie in der Folgezeit ab etwa<br />
14
Mitte der 1980er Jahre und besonders seit etwa 2000 durch natürlich feuchtere Jahre<br />
begünstigt wurden. Das Ergrünen des Sahels ist maßgeblich auf diese erhöhte<br />
Feuchtigkeit zurück zuführen. Es darf nicht vergessen werden, dass in dieser Klimazone<br />
die Niederschlagsvariabilität sehr hoch ist und stets das Risiko von erneuten<br />
Dürrephasen besteht. Dabei ist zu bedenken, dass die Niederschlagsmengen nicht nur<br />
von Jahr zu Jahr enorm schwanken können, sondern auch die räumliche Verteilung<br />
innerhalb einer Regenzeit (vgl. Krings 2006, 21).<br />
Betrachtet man langjährige Mittelwerte von Temperatur und Niederschlag, ist eine<br />
klimatische Entwicklung in Richtung Trockenheit festzustellen. Um diese langfristige<br />
Tendenz zu verdeutlichen, werden im Anschluss Klimadaten aus den Zeiträumen 1930<br />
bis 1960 und 1961 bis 1990 ausgewählter Klimastationen <strong>Mali</strong>s miteinander verglichen.<br />
Die Klimastation Mopti ist anhand der Temperaturwerte und der Anzahl der humiden<br />
Monate in die Dornsavanne der Tropenzone (V 4), sprich in die Sahelzone, einzuordnen.<br />
Die Temperatur des kältesten Monats liegt über 13 °C und im Klimadiagramm sind drei<br />
humide Monate abzulesen. Werden die Mittelwerte der Temperatur aus der Periode<br />
1930-60 mit denen der Periode 1961-90 verglichen (Abb. 2), ist ein durchschnittlicher<br />
Temperaturanstieg von ca. 0,48 °C abzulesen. Bei den Niederschlagswerten hingegen ist<br />
ein erkennbarer Rückgang zu verzeichnen. Wie die Tabelle zeigt, sind die Mittelwerte<br />
besonders in den Hauptmonaten der Regenzeit gesunken: im Juli von 147 mm auf 128<br />
mm, im August von 198 mm auf 143 mm und im September von 94 mm auf 82 mm.<br />
Monat J F M A M J J A S O N D<br />
Mittl. Temp. in °C<br />
(1930-60)<br />
22,6 25,2 29 31,6 32,8 31,2 28,6 27,3 28,3 28,8 26,8 23,1<br />
Mittl. Temp. in °C<br />
(1961-1990)<br />
23,2 26,2 29,4 32,3 33,4 31,7 29,1 27,7 28,3 29,3 26,9 23,5<br />
mittl. Nied. in mm<br />
(1930-60)<br />
100<br />
T in °C<br />
90<br />
16<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Mopti (14° 30'N / 4° 12'W)<br />
J F M A M J J A S O N D<br />
200 N in mm<br />
Abb. 3: Vergleichendes Klimadiagramm der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Mopti<br />
(eigener Entwurf nach Daten von Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
mittl. Niederschlag<br />
in mm (1930-60)<br />
mittl. Niederschlag<br />
in mm (1961-90)<br />
mittl. Temp. in °C<br />
(1930-60)<br />
mittl. Temp. in °C<br />
(1961-90)<br />
Zusätzlich soll das Auftreten von Dürrephasen, die eingangs als Merkmal der Sahelzone<br />
beschrieben wurden, in die Betrachtung mit einbezogen werden. Zwar treten Dürren in<br />
dieser Klimazone immer mal wieder auf, jedoch ist zu beachten, dass sich der Abstand<br />
und die Intensität der Trockenphasen seit Ende der 1960er Jahre zunehmend verkürzt<br />
hat. Verglichen mit dem langjährigen Niederschlagsmittel 497 mm (Bezugszeitraum 1931-<br />
2000) treten Niederschlagsdefizite ab etwa 1970 häufiger auf, wie Abb. 4 zeigt (vgl.<br />
Krings 2006, 23).<br />
Abb. 4: Abweichung der mittleren Niederschläge vom langjährigen Mittel 497 mm (1931-2000)<br />
(Quelle: Atlas du <strong>Mali</strong> 2001, 19 nach Krings 2006, 23)<br />
Ein weiteres Beispiel soll diesen langjährigen Trend belegen. Die Stadt Gao liegt<br />
nordöstlich von Mopti und, laut Klimakarte, ebenfalls in der Sahelzone, allerdings mit
deutlich niedrigeren durchschnittlichen Niederschlagswerten am Übergang zur<br />
tropischen Halbwüste.<br />
Zwischen den Vergleichszeiträumen ist die Temperatur im Durchschnitt um ca. 0,42 °C<br />
angestiegen. Auch hier sind sinkende Niederschläge zu verzeichnen. Besonders auffällig<br />
ist der Rückgang im August von 127 mm auf 75 mm (vgl. Abb. 5).<br />
Monat J F M A M J J A S O N D<br />
Mittl. Temp. in °C<br />
(1930-60)<br />
22 25 28,8 32,4 34,6 34,5 32,3 29,8 31,8 31,9 28,4 23,3<br />
Mittl. Temp. in °C<br />
(1961-1990)<br />
22,6 25,4 29,4 32,8 35,6 35,1 32,6 31,1 32,1 32,1 27,5 23,5<br />
mittl. Nied. in mm<br />
(1930-60)<br />
Abb. 7: Verschiebung der Niederschlagsmittel im Senegal zwischen den Perioden 1960-69 und 1990-94<br />
(Quelle: Service de la Météorologie National, Sénégal 1998 nach Krings 2006, 24)<br />
Während im Zeitraum 1960-69 im Norden Senegals noch durchschnittlich zwischen 200<br />
mm und 400 mm Niederschlag fielen, wurden in den Jahren 1990-94 nur noch Werte<br />
unter 200 mm gemessen. In der Hauptstadt Dakar sind die Messungen sogar von 500<br />
mm bis 700 mm auf 200 mm bis 400 mm gesunken (Krings 2006, 24). Wie an der Grafik<br />
gut zu erkennen ist, verlaufen die Linien gleicher Niederschlagsmengen (Isohyeten)<br />
ungefähr breitengradparallel. Das bedeutet, dass sich diese Entwicklungen auch auf den<br />
Süden <strong>Mali</strong>s übertragen lassen.<br />
Die beschriebene klimatische Verschiebung in <strong>Mali</strong> konnte während der universitären<br />
<strong>Exkursion</strong> im Februar 2009 anhand der Vegetation bestätigt werden.<br />
4. Beobachtungen während des Aufenthaltes in <strong>Mali</strong> im Februar 2009<br />
In der Beschreibung der Reiseroute des einleitenden Kapitels wurde Timbuktu als ein<br />
Etappenziel der Studienreise im Februar 2009 erwähnt. Mit den Koordinaten 16°46’N /<br />
3°1’W müsste Timbuktu nach der Klassifikation von Troll/Paffen in der Sahelzone (V 4)<br />
liegen und die Vegetation der Dornsavanne vorherrschen. Die Beobachtungen vor Ort<br />
zeigten jedoch ein anderes Bild: Schon über die Dächer Timbuktus hinaus waren<br />
Sanddünen dicht am Rand der Stadt zu sehen (Abb. 8).<br />
Abb. 8: Blick über den nördlichen Stadtrand von Timbuktu<br />
(Aufnahme Sally Ollech)<br />
<strong>Große</strong> Flächen des Gebietes, das sich im Norden an Timbuktu anschließt, sind gar nicht<br />
18
von Vegetation bedeckt und unterliegen der Winderosion (Abb. 9).<br />
Abb. 9: Sanddünen am nördlichen Stadtrand von Timbuktu<br />
(Aufnahme Mirja Greßmann)<br />
Abb. 10: Sandverwehungen auf der Straße in Timbuktu<br />
(Aufnahme Mirja Greßmann)<br />
Der feine Sand der nahen Dünen wird häufig<br />
von den Luftmassenströmungen des<br />
Harmattan in die Stadt getragen, in der er sich<br />
überall ablagert. In der Abb. 10 sind bspw.<br />
Sandverwehungen auf der Teerstraße in<br />
Timbuktu zu sehen. Im Extremfall können<br />
Sandstürme zur Versandung der<br />
Verkehrswege führen und sie unpassierbar<br />
machen.<br />
Diese Beobachtung kann durch die Temperatur- und Niederschlagswerte von Timbuktu<br />
aus dem Bezugszeitraum 1961-90 unterstützt werden. Aus dem Klimadiagramm in Abb.<br />
11 ergibt sich nur ein Monat, in dem der Niederschlag die Verdunstung übersteigt. Das<br />
spricht folglich für das Klima der tropischen Halbwüste, denn nach Troll/Paffen sind 2 bis<br />
4,5 humide Monate Bedingung für die Sahelzone.<br />
19
50<br />
T in °C<br />
20<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Timbuktu (16° 46'N / 3° 1'W)<br />
J F M A M J J A S O N D<br />
Abb. 11: Klimadiagramm der Station Timbuktu (Bezugszeitraum 1961-90)<br />
(eigener Entwurf nach Daten von www.klimadiagramme.de)<br />
100 N in mm<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Niederschlag in<br />
mm (1961-90)<br />
Temperatur in<br />
°C (1961-90)<br />
Zwar gibt es keine wissenschaftliche Messgröße für die Ausbreitung der Wüste am Rand<br />
der Sahelzone oder genaue quantitative Erfassungsmethoden der Folgeerscheinungen, die<br />
in konkreten Zeiträumen auftreten (Krings 2996, 69), doch kann die Tatsache der<br />
fortschreitenden Desertifikation, die mit der Klimazonenverschiebung einhergeht, nicht<br />
ignoriert werden. Die Langzeittendenzen müssen Beachtung finden und in Überlegungen<br />
der Entwicklungszusammenarbeit mit einbezogen werden.
5. Schlussfolgerungen<br />
Die jüngste klimatische Entwicklung im Sahel darf nicht über den langfristigen Trend in<br />
Richtung Trockenheit hinwegtäuschen. Die zu beobachtende Klimazonenverschiebung<br />
bringt ernstzunehmende Folgen und Handlungsbedarf bzw. die Notwendigkeit zu einem<br />
Umdenken mit sich. In Gesprächen mit der lokalen Bevölkerung wurde immer wieder<br />
die Feuchtigkeit der letzten Jahre, die die Landwirtschaft in vielen Teilen <strong>Mali</strong>s begünstigt,<br />
betont. In dieser, für die Sahelzone eher ungewöhnlich feuchten Phase ruht besonders<br />
für die ländliche Bevölkerung, die auf erfolgreiche Ernten angewiesen ist, sehr viel<br />
Hoffnung. Die weit verbreitete Hoffnung, dass sich dieser Trend fortsetzt, lässt das stete<br />
Risiko einer Dürre zu sehr in den Hintergrund rücken. Auch nach Auskunft der<br />
Deutschen Botschaft in Bamako gibt es derzeit keinen akuten Notstand oder „Grund zur<br />
Sorge“ in <strong>Mali</strong>.<br />
Trotz der gegenwärtigen erfreulichen Situation des ergrünenden Sahels macht die<br />
geographische Lage <strong>Mali</strong>s mit den instabilen klimatischen Verhältnissen über längere<br />
Zeiträume das Denken an und vor allem die Planung für Notzeiten unabdingbar. Nicht<br />
nur die agronomische Inwertsetzbarkeit des Raumes ist stark von der Verlässlichkeit des<br />
Niederschlages abhängig, sondern auch die Versorgung der nördlichen Gebiete auf dem<br />
Flussweg. Bei verstärkter Aridifizierung nimmt die Verdunstung des Niger, der durch<br />
große Teile des Landes als Fremdlingsfluss fließt, zu, was sich negativ auf die Niger-<br />
Binnenschifffahrt auswirkt. In den Monaten zwischen Februar und Juli ist der Fluss in dem<br />
Raum zwischen Mopti und Timbuktu nur von kleinen motorisierten Pinassen und<br />
Segelbooten befahrbar. Langfristig gesehen ist die regelmäßige Lebensmittelversorgung<br />
der nördlichen Sahelzone auf dem Wasserweg in Gefahr (vgl. Krings 2006, 25).<br />
21
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1:<br />
Klima- und Vegetationszonen Afrikas (stark vereinfacht)<br />
(Quelle: www.zum.de)<br />
Abb. 2:<br />
Vergleichende Klimatabelle der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Mopti<br />
(Quellen: Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />
Abb. 3:<br />
Vergleichendes Klimadiagramm der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Mopti<br />
(eigener Entwurf nach Daten von Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />
Abb. 4:<br />
Abweichung der mittleren Niederschläge vom langjährigen Mittel 497 mm (1931-2000)<br />
(Quelle: Atlas du <strong>Mali</strong> 2001, 19 nach Krings 2006, 23)<br />
Abb. 5:<br />
Vergleichende Klimatabelle der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Gao<br />
(Quellen: Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />
Abb. 6:<br />
Vergleichendes Klimadiagramm der Perioden 1930-60 und 1961-90 für die Station Gao<br />
(eigener Entwurf nach Daten von Richter 1996, 321; www.klimadiagramme.de)<br />
Abb. 7:<br />
Verschiebung der Niederschlagsmittel im Senegal zwischen den Perioden 1960-69 und<br />
1990-94<br />
(Quelle: Service de la Météorologie National, Sénégal 1998 nach Krings 2006, 24)<br />
Abb. 8:<br />
Blick über den nördlichen Stadtrand von Timbuktu (Aufnahme Sally Ollech)<br />
Abb. 9:<br />
Sanddünen am nördlichen Stadtrand von Timbuktu (Aufnahme Mirja Greßmann)<br />
Abb. 10:<br />
Sandverwehungen auf der Straße in Timbuktu (Aufnahme Mirja Greßmann)<br />
Abb. 11:<br />
Klimadiagramm der Station Timbuktu (Bezugszeitraum 1961-90)<br />
(eigener Entwurf nach Daten von www.klimadiagramme.de)<br />
22
Literaturverzeichnis<br />
KRINGS, Thomas 2006: Sahelländer. Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik.<br />
Darmstadt.<br />
FISCHER VERLAG 2001: Fischer Weltalmanach 2002. 1. Auflage, Frankfurt am Main.<br />
RICHTER, Gerold (Hrsg.) 1996: Handbuch ausgewählter Klimastationen der Erde. 5.<br />
Auflage, Trier.<br />
SERVICE DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONAL 1998: Dakar.<br />
SCHMID, Hilmar 2009: „Ground Zero“ ergrünt. In: Der Spiegel Nr. 17/2009, S. 136 ff.<br />
http://www.klimadiagramme.de/Afrika/gao.html, Stand, 06.05.2009.<br />
http://www.klimadiagramme.de/Afrika/mopti.html, Stand 06.05.2009.<br />
http://www.klimadiagramme.de/Afrika/timbuktu.html, Stand 06. 05.2009.<br />
http://www.zum.de/Faecher/Ek/BAY/mek/mek/klima/afrika/troll_paffen.html, Stand<br />
31.05.2009.<br />
23
Geologisch-tektonischer Aufbau und<br />
geomorphologische Einheiten<br />
<strong>Mali</strong>s / Westafrikas<br />
Mirja Greßmann<br />
25
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Definition ....................................................................................................................................... 27<br />
2. Geologische Gegebenheiten ...................................................................................................... 27<br />
2.1. Grundwasservorkommen................................................................................................... 28<br />
3. Geomorphologische Einheiten .................................................................................................. 28<br />
3.1. Die Bandiagara-Schichtstufe ............................................................................................... 30<br />
3.2. Weitflächige Lateritplateaus............................................................................................... 31<br />
3.3. Das Nigerbinnendelta.......................................................................................................... 31<br />
3.4. Dünengebiete ........................................................................................................................ 32<br />
4. Böden.............................................................................................................................................. 33<br />
4.1. Zonale Böden ........................................................................................................................ 33<br />
4.2. Azonale Böden ...................................................................................................................... 34<br />
5. Zusammenfassung ........................................................................................................................ 35<br />
26
Dieser Beitrag befasst sich mit den geologischen Gegebenheiten und geomorphologischen<br />
Einheiten in <strong>Mali</strong>, wobei der Fokus auf den bereisten Gebieten des<br />
Nigerbinnendeltas und der Bandiagara-Schichtstufenlandschaft liegt.<br />
1. Definition<br />
„Geologie ist die Wissenschaft von der Zusammensetzung, vom Bau und von der<br />
Geschichte der Erdkruste und von den Kräften, unter deren Wirkung sich die<br />
Entwicklung der Erdkruste vollzieht.“(Neef 1974, 619).<br />
„Geomorphologie ist die Lehre von den Formen der Erdoberfläche und den Kräften und<br />
Vorgängen, die sie geschaffen haben, sowie den Prozessen, die heute daran wirken.“<br />
(Wilhelmy 1994, 11).<br />
2. Geologische Gegebenheiten<br />
Westafrika besteht wie der gesamte afrikanische Kontinent aus einer geologisch alten<br />
Plattform (Gondwana). Diese Plattform wird von einem Grundgebirge bestehend aus<br />
präkambrischen Gesteinen gebildet, das meist mit Sedimentgesteinen unterschiedlichen<br />
Alters bedeckt ist. Die charakteristische Grundstruktur Westafrikas wird wesentlich<br />
durch die weitflächigen Becken (Synklinalen) bestimmt, welche durch flache Schwellen<br />
(Antiklinalen) voneinander abgegrenzt werden (vgl. Barth 1970, 15). Die Becken<br />
entsprechen Sedimentationsräumen mit mehreren tausend Metern mächtigen<br />
kontinentalen und teilweise maritimen Ablagerungen.<br />
Solche Becken, wobei das Toudenni-Becken und das Niger-Becken für <strong>Mali</strong> von<br />
Bedeutung sind, werden im Nordwesten von der Karet-Yetti-Eglab-Antiklinale und<br />
südlich von der Guinea-Schwelle abgegrenzt (vgl. Barth 1970, 16). Deren Randschwellen<br />
sind über die breite Mossi-Antiklinale mit der Erhebung des Adrar des Iforas im Norden<br />
verbunden. Die Oberfläche dieser Schwellen besteht weitgehend aus dem abgetragenen<br />
und über Millionen von Jahren stark umgewandelten Grundgebirge. Dieses ist<br />
hauptsächlich aus kristallinen Schiefer, Gneisen und Quarziten aufgebaut (vgl. Barth 1970,<br />
18).<br />
Den Hauptanteil der Beckensedimente bilden die nahezu horizontal abgelagerten<br />
Sandgesteine unterschiedlichen Alters. Am Rande der Becken erschaffen die älteren<br />
Sedimente Sandsteintafeln, welche als Schichtstufen gegen die Antiklinale abbrechen und<br />
im inneren des Beckens unter jüngere Sedimentschichten abtauchen. Diese jüngeren<br />
Sedimente bestehen aus Ablagerungen des sog. „Continental intercalaire“ (Sandstein,<br />
sandige Tongesteine und Mergel) sowie aus marinen Ablagerungen (z. B. Kalk) der<br />
letzten Überschwemmungsphase. Im Nigerbinnendelta wie auch in allen anderen Becken<br />
lassen sich außerdem Sande und Tone als Sedimente des „continental terminal“ finden<br />
(vgl. Barth 1970, 19).<br />
27
2.1. Grundwasservorkommen<br />
Neben den klimatischen Gegebenheiten sind auch die Beschaffenheit und Zusammensetzung<br />
der Sedimentschichten für die Oberflächengestaltung und im Zusammenspiel für<br />
die Existenz von Grundwasser in einer Region von großer Bedeutung (vgl. Barth 1986,<br />
165). „Grundwasser ist das Wasser, welches die Hohlräume der Erdrinde zusammenhält<br />
und dem hydrostatischen Druck unterliegt.“ (Barth 1986, 165).<br />
Geologische Formationen, die in Hohlräumen Wasser führen können, sog. Aquifere,<br />
werden ausschließlich in den Beckenregionen <strong>Mali</strong>s von den Ablagerungen des<br />
„continental intercalaire“ und des „continental terminal“ gebildet (vgl. Barth 1986, 165).<br />
Diese Ablagerungen treten als Grundwasserträgergesteine auf und schaffen mit den<br />
aufliegenden Schwemmböden und vom Wind angelieferten Sanden und Tonmineralien<br />
günstige Bedingungen für das Vorkommen von Grundwasser sowie für dessen Ergänzung<br />
und Bewegung. Das Nigerbinnengebiet ist aufgrund des Potentials und der Mächtigkeit<br />
dieser Grundwasserträger das grundwasserreichste Gebiet <strong>Mali</strong>s (vgl. Barth 1986, 167).<br />
In Gebieten, in denen das Grundgebirge dominiert (zentrale Aufwölbung des Adrar des<br />
Iforas sowie nördliche Teile der Guinea-Schwelle), bildet sich das Grundwasser aufgrund<br />
des wasserundurchlässigen Untergrundes (Granite, Gneise, kristalline Schiefer) nur in<br />
Spalten und Klüftungen des Gesteins. Da es sich hier um niederschlagsreiche Gebiete<br />
handelt, ist die dörfliche Wasserversorgung dennoch gedeckt (vgl. Barth 1986, 165).<br />
Die porenarmen Sandsteine, welche die Sandsteinplateaus am Rande der Beckengebiete<br />
bilden, ermöglichen nur eine Grundwasseranreicherung in den bestehenden Klüftungen<br />
(vgl. Barth 1986, 167).<br />
Nach Barth zeigen die nutzbaren Grundwasserressourcen keine Möglichkeiten der<br />
Entwicklung auf, da abgesehen von dem ohnehin durch das Oberflächenwasser<br />
begünstigten Nigerbeckengebiet, die hydrogeologischen Bedingungen in den übrigen<br />
Regionen nur geringes Grundwasserpotential zulassen (vgl. Barth 1986, 167).<br />
3. Geomorphologische Einheiten<br />
Westafrika ist ein Teil von Niederafrika (vgl. Krings 2006, 16). Bis auf einige Ausnahmen,<br />
wie z.B. die Zeugenberge der Bandiagara-Schichtstufe (Hombori-Berge), welche eine<br />
Höhe von ca. 1000 m ü. NN erreichen, werden Höhenwerte von 300 m ü. NN selten<br />
überschritten (vgl. Barth 1986, 123). Fastebenen, sog. Rumpfflächen, dominieren das<br />
Landschaftsbild in Westafrika (vgl. Krings 2006, 16). Sie sind das Ergebnis aus vorangegangenen<br />
Verwitterunsprozessen und nachfolgenden meist flächenhaften Abtragungsvorgängen,<br />
die während einer langen Periode der tektonischen Ruhe erfolgten und zu<br />
einer weitgehenden Einrumpfung der Gebirgsaufwölbungen führten. Die rezente<br />
Gliederung der Becken und Schwellenstruktur ist hauptsächlich die Folge von schwachen,<br />
weiträumigen Verbiegungen (vgl. Barth 1970, 20).<br />
28
Die Monotonie der Ebenen wird durch die für Westafrika typischen Schichtstufen belebt.<br />
„Schichtstufen sind Geländeformen mit einer steilen Frontseite und einer flachen<br />
Rückseite. Sie sind aufgebaut aus einer flachlagernden, hängenden „harten“ und einer<br />
liegenden „weichen“ Schicht, wobei die weiche Schicht rascher abgetragen wird als die<br />
harte.“ (Fischer 1998, 5). Im morphologischen Sinne ist unter dem Begriff der Härte die<br />
Widerständigkeit eines Gesteins gegenüber Verwitterung und Erosion zu verstehen. Die<br />
morphologische Härte eines Gesteins ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, wie<br />
z.B. dem physikalischen Härtegrad des Gesteins und der Härte des Bindemittels. Ein aus<br />
Quarzkörnern und kieselsäurehaltigem Zement zusammengehaltener Sandstein (Quarzit)<br />
ist beispielsweise härter, als ein Sandstein mit einem tonigen oder kalkigen Bindemittel.<br />
Von Bedeutung sind auch das Verhalten eines Gesteins unter Druck und seine<br />
Anfälligkeit für chemische Verwitterungen (vgl. Fischer 1998, 5).<br />
Tone oder Mergel sind zum Beispiel wenig widerständig gegenüber dem Druck<br />
überlagernder Gesteinsschichten und geben nach, indem sie seitlich ausweichen. Auch<br />
die Porosität eines Gesteins und folglich dessen Wasserdurchlässigkeit spielen bei der<br />
Bestimmung der geomorphologischen Härte eine Rolle (vgl. Fischer 1998, 5).<br />
Durchfeuchtete Gesteine sind beispielsweise anfälliger gegenüber Abspülungsprozessen<br />
als wasserdurchlässige Gesteine, bei denen das Wasser in darunter liegende Schichten<br />
geleitet wird. Tone und Mergel beispielsweise können Wasser gut aufnehmen und<br />
speichern. Voll gesogen mit Wasser werden sie leicht beweglich, wodurch es zu<br />
Hangrutschungen kommen kann. Aufgrund ihrer Wasserundurchlässigkeit können sie<br />
aber auch innerhalb von Sedimentschichten Wasser tragende Horizonte bilden (vgl.<br />
ebda.).<br />
Folglich ist die Voraussetzung für die Entstehung von Schichtstufen die Aufschichtung von<br />
Gesteinsschichten unterschiedlicher Härte, wobei harte Schichten als Stufenbildner und<br />
weiche Stufen als Sockelbildner bezeichnet werden (vgl. Fischer 1998, 6).<br />
In Westafrika haben sich über Millionen von Jahren unterschiedliche Sedimentationsschichten<br />
abgelagert und das Grundgebirge bedeckt. Über den Schwellen bildeten die<br />
schräg gestellten Gesteinschichten einen Sattel, der durch tektonische Verbiegungen<br />
noch weiter angehoben wurde. Der höchste Punkt dieser Aufwölbung bot eine<br />
Angriffsfläche für Erosionsprozesse, sodass der Gipfel und die obere kalkhaltige<br />
Gesteinsschicht über einen langen Zeitraum hinweg abgetragen wurden. Auf den<br />
freigelegten Sandsteinschichten setzte eine verstärkte Verwitterung ein. In Verbindung<br />
mit Abtragungsprozessen führte diese zu einer Einschneidung der Sandsteinschichten<br />
mittig der ehemaligen Aufwölbung. Die darunter liegende weichere Schicht (tonhaltiger<br />
Sandstein) gab nach. In den Bereichen der Einschneidung wurde die tonhaltige<br />
Sandsteinschicht aufgrund ihrer geringeren Resistenz schneller abgetragen als die<br />
aufliegenden härteren Sandsteinschichten. Folglich brachen nach und nach die oberen<br />
härteren Sedimentschichten in den Bereichen der Einkerbung steil ab. Das zerkleinerte<br />
Material wurde von Wind und je nach klimatischen Verhältnissen auch von Wasser in die<br />
tiefer gelegenen Ebenen abtransportiert. Verstärkt wurde und wird die Stufenbildung<br />
durch die erodierenden Kräfte eines Flusses. Diese Prozesse, die auch heute noch<br />
stattfinden, führten über Millionen von Jahren zu einer Muldenbildung und somit zu einer<br />
Reliefumkehr. Die Abbruchstellen der härteren witterungsresistenteren Sandsteinschicht<br />
bilden, basierend auf dem weicheren Sockel, die heutigen Schichtstufen.<br />
29
Während Sedimentschichten mit einer Neigung von 1-5° eine Stufe bilden (vgl. Zepp<br />
2002, 247), sind bei einer Schichtneigung mit einem Winkel von 7-10° auch mehrere<br />
Stufenbildungen möglich. Formationen mit einer Stufe werden Schichtstufen und jene mit<br />
mehreren Stufenbildungen Schichtkämme genannt (vgl. Zepp 2002, 251).<br />
3.1. Die Bandiagara-Schichtstufe<br />
Im Südosten <strong>Mali</strong>s gelegen verläuft die Bandiagara-Schichtstufe in südwest-nordöstlicher<br />
Richtung. Sie steigt kontinuierlich von 400 m ü. NN im Süden auf 700 m ü. NN nach<br />
Nordosten hin an (vgl. Barth 1970, 49). Mit der Stufenfront zur Mossi-Schwelle gerichtet,<br />
der vorgelagerten Gondoebene und den in das Nigerbinnendelta abflachenden<br />
Sandsteintafeln bildet die Bandiagara-Schichtstufe den „Prototyp einer klassischen<br />
Schichtstufenlandschaft“ (Barth 1986, 123). Die steil abfallende Front der Bandiagarastufe<br />
wird auch „Falaise de Bandiagara“ genannt (vgl. Barth 1970, 64). Während es sich bei<br />
dem Stufenbildner der Bandiagarastufe um resistente quarzitische Sandsteine handelt,<br />
wird der Sockel von tonhaltigen Sandsteinen gebildet (vgl. Barth 1986, 124).<br />
Das durch Erosionsprozesse entstandene Schuttmaterial bedeckt die unteren Hänge der<br />
Stufe mit Blockschutt und weiter abwärts mit feineren Schuttsedimenten. Die<br />
Mächtigkeit dieser feineren Schuttsedimente stellt in den Vorlandbereichen der Stufen<br />
einen ökologischen Gunststandort dar (vgl. Barth 1986, 124). Dieser bietet gute<br />
Voraussetzungen für eine Siedlungsbildung.<br />
Die Sedimentablagerungen deuten auch auf ein Zurückschreiten der Schichtstufen<br />
aufgrund von erodierenden Kräften hin (vgl. Barth 1970, 98). Befinden sich innerhalb<br />
einer Schichtstufe härtere Gesteinspakete, bilden sich beim Zurückschreiten der<br />
Schichtstufe sog. Zeugenberge heraus. Die Hombori-Berge sind ein Beispiel dieser durch<br />
Abtragung der weicheren umliegenden Schichten heraus präparierten Zeugenberge.<br />
Früher verbunden mit der Bandiagara-Schichtstufe bilden die Hombori- Berge heute<br />
isoliert von der Front die höchsten Erhebungen innerhalb <strong>Mali</strong>s (vgl. Barth 1970, 49).<br />
Die teilweise starken Zerklüftungen der Schichtstufenlandschaft sind auf die erodierenden<br />
Kräfte von (periodischen) Flüssen zurückzuführen. Aufgrund des Nordost-<br />
Südwest-Gefälles des Bandiagara-Plateaus wird dieses hauptsächlich nach Südwesten auf<br />
das Nigerbinnendelta zu entwässert (vgl. Barth 1970, 49). Das zwar kurze aber heftige<br />
Eintreten von Regenfällen auf den größtenteils wasserundurchlässigen vegetationslosen<br />
Gesteinsschichten bedingt einen schnellen Oberflächenabfluss (vgl. Barth 1970, 77).<br />
Während sich der Abfluss auf Ebenen flächenhaft vollzieht, wirkt der Oberflächenabfluss<br />
an Hängen und Flächen ab einem Neigungswinkel zwischen 2° und 3° linienhaft. In dem<br />
Bandiagara-Plateau schneidet der schnelle Oberflächenabfluss Rinnen und Kerben in den<br />
Untergrund ein und lässt periodisch Wasser führende Flüsse entstehen (vgl. Barth 1970,<br />
77).<br />
Die Tiefen- und Seitenerosionen der periodisch Wasser führenden Flüsse führen zu<br />
regelrechten Talbildungen (Canyons) innerhalb des Plateaus (vgl. Barth 1970, 78).<br />
30
Die periodischen Flüsse fließen meist nicht mit dem Gefälle des Plateaus. Vielmehr<br />
orientiert sich ihr Verlauf an den bei der tektonischen Verbiegung innerhalb der<br />
Sandsteinschichten entstandenen süd-südwestlich bzw. nord-nordöstlich verlaufenden<br />
kleinräumigen Falten, die eine Kluftenbildung begünstigten (vgl. Barth 1970 , 57).<br />
Die Hauptsammelader für den Oberflächenabfluss bildet der Yame de Bandiagara. Als<br />
ständig Wasser führender Fluss tritt er auf der Höhe von Goundaka aus dem Plateau aus<br />
und mündet schließlich im Niger (vgl. Barth 1970, 49). Im Gegensatz zu den periodischen<br />
Flüssen verläuft der Yame de Bandiagara mit dem Gefälle des Plateaus.<br />
3.2. Weitflächige Lateritplateaus<br />
Ein für Westafrika ebenso charakteristisches Landschaftsbild wird geprägt durch die<br />
weitflächigen Lateritplateaus, auf denen nur anspruchslose Vegetation wachsen kann. Die<br />
stark verkrusteten Hochflächen bestehen aus einer bis zu mehreren Metern dicken<br />
Eisenschicht lateritischer Genese (siehe zonale Bodenbildung). Diese fällt mit deutlichen<br />
Abstufungen zur niedriger gelegenen Rumpffläche ab (vgl. Krings 2006, 17). Das<br />
Mandingo-Plateau ist ein Beispiel einer solch mächtigen lateritischen Verkrustung.<br />
Aufgrund der hohen Widerständigkeit gegenüber Erosionsprozessen tragen die<br />
Lateritkrusten beachtlich zur Flächenerhaltung bei (vgl. Barth 1970, 20).<br />
3.3. Das Nigerbinnendelta<br />
Im westlichen Beckenraum dominieren großflächige Verkrustungen die Oberfläche. Im<br />
Deltabereich kennzeichnen periodisch überschwemmte Sedimentationsgebiete die<br />
Landschaft (vgl. Barth 1986, 128). Das Überflutungsgebiet umfasst eine Fläche von 20.000<br />
km², in der mehrere Niger- und Bani-Arme eine Flusslandschaft entstehen lassen (vgl.<br />
Barth 1986, 83). Bis vor ca. 8000 Jahren war das Becken zwischen der Mossi- und der<br />
Assaba-Schwelle ein abflussloser Sedimentationsraum mit einem bis weit in die Sahara<br />
hineinreichenden schätzungsweise 300.000 km² großen See (vgl. Barth 1986, 84).<br />
Mit der Anzapfung des Binnensees durch den heutigen Unterlauf des Nigers wurde das<br />
Becken entwässert, und der Lauf des Nigers nahm seine heutige Form an. Reste des<br />
ehemaligen Binnensees bilden die heutigen großen Seengebiete (vgl. Barth 1986, 84).<br />
Der Niger entsteht aus dem Zusammenfluss verschiedener kleinerer Flüsse. Deren<br />
Quellgebiete befinden sich in den nördlichen Randgebieten der niederschlagsreichen<br />
Guinea-Schwelle. Oberhalb von Bamako vereinigen sich die wichtigsten Zuflüsse zum<br />
Niger. Von dort aus fließt er in nordöstliche Richtung in die Sahelzone ein (vgl. Barth<br />
1986, 83). Mit dem aus Süd-Südwest fließenden Fluss Bani, der bei Mopti in den Niger<br />
mündet, entsteht ein großes Überschwemmungsgebiet, das Nigerbinnendelta, in dem sich<br />
Fließ- und Spülsedimente ablagern (vgl. Barth 1986, 85).<br />
Die Intensität der Überschwemmung dieser Gebiete ist weniger von den lokalen<br />
31
Niederschlägen während der Regenzeit abhängig, sondern eher von den<br />
Niederschlagsmengen in den Gebieten der Quellflüsse.<br />
Die in den Bereichen der Guinea-Schwelle hauptsächlich im Sommer fallenden intensiven<br />
Niederschläge lösen eine Hochwasserwelle aus, die im September bei Bamako angelangt<br />
ist (vgl. Barth 1986, 85). Erreicht die Flutwelle das Nigerbinnendelta kommt es zu einer<br />
Phasenverschiebung der Hochwasserwelle. Zuerst werden Flussarme, Mare und Kanäle<br />
geflutet, darauf folgt die Überflutung der Überschwemmungsgebiete (vgl. Barth 1986, 86).<br />
Die sich im Becken befindenden Sedimente verfügen über eine sehr gute<br />
Wasserspeicherkapazität (vgl. Barth 1986, 85), so dass ein großer Teil des Hochwassers<br />
vom Boden aufgenommen wird. Bedingt durch die Auffüllung des Gewässernetzes sowie<br />
der Überflutung der Schwemmgebiete bewegt sich die gemäßigte Hochwasserwelle erst<br />
mit einer zeitlichen Verzögerung von vier bis fünf Monaten weiter den Niger entlang.<br />
Mopti beispielsweise erreicht die Hochwasserwelle erst im November (vgl. Barth 1986,<br />
86). Folglich durchfließt die Hochwasserwelle das Nigerbinnengebiet inmitten der ariden<br />
Jahreszeit zwischen Oktober und Januar (vgl. ebda.).<br />
Auch die Pegelstände der Seen sind größtenteils abhängig von der Hochwasserwelle des<br />
Nigers und nicht vom lokalen Klimageschehen. Die häufig über schmale<br />
Überlaufschwellen verbundenen Seen werden von dem Hochwasser konsequent (vgl.<br />
ebda.), aber ohne jegliche Heftigkeit und Strömungsdynamik (vgl. Barth 1986, 88),<br />
hintereinander aufgefüllt. Innerhalb der Seenbecken kommt es zu keiner Sedimentation,<br />
so dass ihr Wasser relativ klar ist. Beim Rückgang des Pegelstandes des Nigers<br />
verhindern die Schwellen den Rückfluss des Wassers aus den Seen (vgl. ebda.). Die<br />
Pegelstände der Seen sinken hauptsächlich aufgrund von Verdunstung, trocknen aber<br />
dank der nigrischen Wasserversorgung auch während der ariden Jahreszeit nicht aus (vgl.<br />
Barth 1986, 86). „Nicht die Aridität des Lokalklimas, sondern die azonale Hydromorphie<br />
ist die gestaltende Dominante dieses Raumes. (Barth 1986, 90)“<br />
3.4. Dünengebiete<br />
Sandgebiete mit fossilen Dünen sind vor allem im nördlichen Teil <strong>Mali</strong>s weit verbreitet.<br />
Sie reichen teilweise bis ins Innere des Nigerbinnendeltas und westlich darüber hinaus bis<br />
nach Gourma. Bei der Bodenbildung erfolgt in den Oberhorizonten eine Anreicherung<br />
mit Eisenoxiden, wodurch eine bräunliche bis rote Färbung entsteht. Die zwischen 10<br />
und 30 m hohen Dünen verlaufen größtenteils parallel mit einem Abstand von 1 bis 10<br />
km in Norost-Südwest-Richtung (vgl. Barth 1986, 129). Entstanden sind diese sog.<br />
Lingualdünen vor ca. 21000 – 15000 Jahren. Neben den fossilen Dünengebieten sind<br />
rezente Dünen in Form von Transversalen und Sicheldünen vor allem in den nördlichen<br />
Landesteilen vertreten (vgl. Barth 1986, 130).<br />
32
4. Böden<br />
Nach Krings lassen sich die Böden im westlichen Sahel in zonale Böden und azonale<br />
Böden unterscheiden (vgl. Krings 2006, 20).<br />
4.1. Zonale Böden<br />
Die Bodenbildungsprozesse der zonalen Böden sind hauptsächlich abhängig von den<br />
klimazonalen Verhältnissen (diese und folgende Angaben zu den zonalen Böden stammen,<br />
wenn nicht anders vermerkt, aus Krings 2006, 20). In den niederschlagsreicheren<br />
Savannengebieten dominiert die relativ sterile und humusarme tropische Roterde, die<br />
sog. Ferrallite. Während der humiden Jahreszeit werden Restmineralien aus dem<br />
Untergrund ausgewaschen. Die mit Eisen, Mangan und Aluminiumoxid angereicherte<br />
Bodenlösung sickert in die tieferen Bodenhorizonte. Im Gegensatz zu den in der<br />
Regenzeit herrschenden abwärtsgerichteten Auswaschungsvorgängen dominiert in der<br />
Trockenzeit eine senkrecht nach oben gerichtete Bewegung. Bedingt durch die hohe<br />
Bodensonneneinstrahlung dringt die Bodenlösung Richtung Oberfläche in die oberen<br />
Bodenhorizonte.<br />
Treten die Anreicherungshorizonte an die Oberfläche, z.B. durch flächenhafte Abtragung,<br />
trocknen diese vollkommen aus und verhärten sich zu teilweise mächtigen<br />
Lateritkrusten. Der Prozess dieser Krustenbildung vollzieht sich über mehrere Millionen<br />
von Jahren. Aufgrund der Widerständigkeit dieser Krustenformationen gegenüber<br />
Erosionsprozessen sind mächtige Lateritkrusten im Sahel und in den Savannengebieten<br />
<strong>Mali</strong>s vorzufinden. Auf diesen Eisenkrusten gedeiht wenn überhaupt nur spärliche<br />
Vegetation.<br />
Ebenfalls der Gruppe der tropischen Böden zugehörig sind die sog. Fersiallite. Sie<br />
entstanden im Vergleich zu der fossilen Bodenbildung der Ferrallite aus rezenten<br />
Bodenbildungsprozessen. Aufgrund der weniger stark ausgeprägten chemischen<br />
Verwitterung beinhalten die Fersiallite noch verwitterbare Restmineralien. Ihr Oberboden<br />
besteht größtenteils aus einer 20 – 30 cm dicken Humusschicht (vgl. Barth 1986,<br />
134). Dieser Bodentyp kann Düngemittel relativ gut aufnehmen, so dass ein Anbau von<br />
Nutzpflanzen (Hirse, Baumwolle) möglich ist. Wird die Bodenstruktur durch beispielsweise<br />
Brandrodungen beschädigt und dann abgetragen, tritt die darunter liegende harte<br />
und unfruchtbare Schicht an die Oberfläche. Die schwach rötlichen Böden sind vor der<br />
Bandiagara-Stufe und auf fossilen Dünen verbreitet, wo sie die Grundlage einer dichten<br />
Baumsavanne bilden (vgl. Barth 1986, 134).<br />
Nach Barth wird subaride Braunerde häufig als Steppenboden bezeichnet, „da sie meist<br />
eine Steppen-Vegetation mit vereinzelten Gehölzen zwischen weiten Grasformationen<br />
tragen.“ (Barth 1986, 137). Diese Böden weisen eine sandig- tonige Matrix auf und bilden<br />
durch Nährstoffzufuhr, z.B. in Form von Tierdung, einen Gunststandort besonders für<br />
die nomadische Bevölkerung. Diese nutzt die mit Gras bewachsenen Flächen als<br />
Trockenzeitweiden für ihre Viehherden. Wenn die Vegetationsdecke beschädigt wird,<br />
z.B. durch Überweidung, sind diese Böden besonders anfällig für die Erosion durch Wind<br />
33
und Wasser.<br />
In den Gebieten der Halb- und Vollwüsten sind sandige und steinige Wüstenböden stark<br />
verbreitet. Je nach Ausgangsgestein bilden sich aufgrund der dominierenden<br />
physikalischen Verwitterung weitflächige Sand-, Kies- und Geröllwüsten. Vom Wind<br />
angewehte und abgelagerte Sandmassen lassen Sandwüsten mit verschiedenen Formen<br />
von Dünen entstehen. Je nach Windverhältnissen bilden sich Sterndünenfelder,<br />
Längsdünen oder Sicheldünen. Solche Sanddünenböden verfügen nur über eine geringe<br />
Wasserspeicherkapazität, sind nährstoffarm und somit wenig ertragsreich. Verfügt die<br />
Vegetation jedoch über ein tiefes Wurzelwerk, kann sie sich dank des gut zu<br />
durchdringenden Bodens direkt oder indirekt mit Grundwasser versorgen. Fehlt die<br />
Vegetation, sind diese Böden sehr erosionsanfällig.<br />
4.2. Azonale Böden<br />
Die Bildung azonaler Böden ist weniger abhängig von den klimazonalen Gegebenheiten,<br />
sondern vom Relief, sowie dem Vorkommen von Stau-, Überflutungs- und Grundwasser<br />
(diese und folgende Angaben zu den zonalen Böden stammen, wenn nicht anders<br />
vermerkt, aus Krings 2006, 21).<br />
Nach Krings zählen zu den azonalen Böden verschiedene Typen der hydromorphen<br />
Böden. Diese schweren tonigen Böden treten entlang von periodisch überschwemmenden<br />
Flusstälern, in großräumigen Überschwemmungsgebieten und an<br />
Spülmulden und Maren auf. Je nach Wasserversorgung lassen sie sich in Pseudogleye und<br />
Gleye unterscheiden.<br />
Gleye werden vom oberflächennahen Grundwasser mit Feuchtigkeit und Nährstoffen<br />
versorgt. Pseudogleye befinden sich in saisonalen Überflutungsgebieten. Ihre Nährstoffzufuhr<br />
erfolgt über die Ablagerung angeschwemmter nährstoffreicher Sedimente. Diese<br />
Böden sind fruchtbarer, als die zonalen Böden. Sie verfügen über eine hohe<br />
Wasserspeicherkapazität, lassen sich aber schwer bewirtschaften. Dennoch sind Gleye<br />
für den Anbau von Sorghum, Reis und Gemüse geeignet. Es besteht allerdings die Gefahr<br />
der Bodenversalzung.<br />
Die Vertisole können ebenfalls den azonalen Böden zugeordnet werden. Bei guter<br />
Durchfeuchtung sind diese lehmartigen Böden u.a. wegen ihres hohen Anteils an<br />
mineralischen Nährstoffen sehr produktiv. Trocknen sie allerdings während der ariden<br />
Jahreszeit aus, kommt es zu Schrumpfungserscheinungen in Form von bis zu einen Meter<br />
tiefen Rissen. Verbreitet sind die Vertisole beispielsweise im Gebiet des Bewässerungsprojektes<br />
„Office du Niger“.<br />
34
5. Zusammenfassung<br />
Als Teil einer uralten Plattform ist die Landschaft Westafrikas von einer Becken- und<br />
Schwellenstruktur geprägt. Über dem stark eingerumpften Grundgebirge haben sich über<br />
Millionen von Jahren mehrere tausend Meter dicke Sedimentschichten unterschiedlichen<br />
Alters abgelagert. Aufgrund von lang anhaltenden Abtragungs- und Sedimentationsprozessen<br />
dominieren leicht gewellte Ebenen das Landschaftsbild. An den Beckenrändern<br />
wird das Landschaftsbild von den steilen z. T. mehrere hundert Meter hohen<br />
Schichtstufen belebt. Als ein Beispiel solch mächtiger Schichtstufen ist die Bandiagara-<br />
Schichtstufe zu nennen, deren Zeugenberge eine Höhe von ca. 1000 m ü. NN erreichen.<br />
In dem Nigerbinnendelta findet heute noch eine Akkumulation von fruchtbaren<br />
Sedimenten statt. Mit der Besonderheit, dass dieses Gebiet auch während der ariden<br />
Jahreszeit überschwemmt wird, bildet das Nigerbinnendelta einen Gunststandort für<br />
Bauern, Viehwirte und Fischer.<br />
35
Literaturverzeichnis<br />
BARTH, Hans Karl 1970: Probleme der Schichtstufenlandschaften West-Afrikas am<br />
Beispiel der Bandiagara-, Gambaga- und Mampong-Stufenländer. Tübinger Geographische<br />
Studien 38, Tübingen.<br />
BARTH, Hans Karl 1986: <strong>Mali</strong>: eine geographische Landeskunde. Wissenschaftliche<br />
Länderkunden Bd. 25. Darmstadt.<br />
FISCHER, Friedrich 1998: Die Schichtstufenlandschaft als strukturbedingter und<br />
klimabeeinflußter Formenkomplex. Blieskastel.<br />
KRINGS, Thomas 2006: Sahelländer: Mauretanien, Senegal, Gambia, <strong>Mali</strong>, Burkina Faso,<br />
Niger. Wissenschaftliche Länderkunde. Darmstadt.<br />
NEEF, Ernst 1974: Das Gesicht der Erde. Taschenbuch der Physischen Geographie.<br />
3.Aufl., Zürich.<br />
ZEPP, Harald 2002: Geomorphologie: eine Einführung, München, Wien, Zürich.<br />
WILHELMY, Herbert 1994: Endogene Kräfte, Vorgänge und Formen. Geomorphologie in<br />
Stichworten, Kiel.<br />
36
Bevölkerungsstruktur, -entwicklung und -verteilung,<br />
ethnische Zusammensetzung, Siedlungsstruktur und<br />
Urbanisierung in <strong>Mali</strong><br />
Robert Oschatz<br />
37
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung........................................................................................................................................ 39<br />
2. Bevölkerungsentwicklung in <strong>Mali</strong> .............................................................................................. 39<br />
2.1. Das Modell des demographischen Übergangs................................................................ 40<br />
2.2. Die natürliche Bevölkerungsbilanz in <strong>Mali</strong>....................................................................... 41<br />
2.2.1. Die Geburten- und Fertilitätsrate............................................................................. 42<br />
2.2.2. Die Sterberate und Säuglingssterblichkeit............................................................... 43<br />
2.3. <strong>Mali</strong> im Modell des demographischen Übergangs.......................................................... 45<br />
2.4. Bevölkerungsprognosen für <strong>Mali</strong>....................................................................................... 45<br />
2.5. Ethnische und religiöse Zusammensetzung .................................................................... 46<br />
3. Bevölkerungsverteilung in <strong>Mali</strong>.................................................................................................. 46<br />
4. Urbanisierung <strong>Mali</strong>s...................................................................................................................... 47<br />
4.1. Die afrikanischen Stadttypen.............................................................................................. 48<br />
4.2. Grad der Urbanisierung in <strong>Mali</strong>......................................................................................... 49<br />
4.3. Ursachen des Städtewachstums ........................................................................................ 51<br />
4.4. Folge: Marginalsiedlung........................................................................................................ 52<br />
4.5. Folge: Primatstadt Bamako ................................................................................................. 52<br />
4.6. Abschließende Anmerkungen zum Grad der Urbanisierung <strong>Mali</strong>s............................ 52<br />
38
1. Einleitung<br />
In folgendem Kapitel wird auf die Bevölkerungsstruktur von <strong>Mali</strong> eingegangen. Der erste<br />
Abschnitt behandelt im Einzelnen die Gesamtbevölkerung, die Geburten- und Sterberate<br />
sowie die Bevölkerungsentwicklung und zukünftige Bevölkerungsprognosen für <strong>Mali</strong>,<br />
sowie im Weiteren die ethnische und religiöse Zusammensetzung der malischen<br />
Gesellschaft. Im zweiten Teil wird die betrachtete Bevölkerungsstruktur um die<br />
räumliche Komponente ergänzt, mit einer Betrachtung der Siedlungsstruktur des Landes,<br />
also der räumlichen Gliederung mit ihren Ballungsgebieten und Städten. An dieser Stelle<br />
kann schon auf den hohen Grad der Verstädterung in <strong>Mali</strong> hingewiesen werden, woraus<br />
der Fokus des letzten Bereiches erwächst. Hier stehen die Urbanisierung sowie die<br />
unterschiedlichen Stadttypen, die für eine Betrachtung der Prozesse von Bedeutung sind,<br />
im Mittelpunkt. Sie dienen als Grundlage um Ursachen und Folgen des rasant<br />
voranschreitenden Städtewachstums <strong>Mali</strong>s mit seinen Problemen, wie beispielsweise der<br />
Entstehung von Marginalsiedlungen, zu untersuchen.<br />
2. Bevölkerungsentwicklung in <strong>Mali</strong><br />
<strong>Mali</strong>s Gesamtbevölkerung umfasst laut World Population Data Sheet 2008 (World<br />
Population Bureau 2008, 7& 10.) eine Größe von 12,7 Mio. Einwohnern und liegt damit<br />
hinsichtlich der Bevölkerungsgröße im Mittelfeld westafrikanischer Länder. Um Daten,<br />
wie die Bevölkerungszahl <strong>Mali</strong>s besser einordnen zu können, werden die Daten des<br />
Landes im Weiteren jeweils mit Daten vom gesamten Kontinent Afrika sowie mit den<br />
Zahlen Deutschlands verglichen. In Deutschland beträgt die Gesamtbevölkerung 82,2<br />
Mio. Einwohner (Ebda.), in ganz Afrika leben 967 Mio. (Ebda.) Menschen. Bei der<br />
Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung der letzten 60 Jahre ergibt sich ein deutlicher<br />
Unterschied in der Entwicklung zwischen Deutschland, <strong>Mali</strong> und Afrika. Nach Angaben<br />
der Vereinten Nationen (United Nations – Department of Economic and Social Affairs<br />
Population Division 2008.) betrug die Bevölkerungsgröße <strong>Mali</strong>s im Zeitraum von 1950-55<br />
3,3 Mio. Einw. (Ebda.), im Vergleich dazu lag die Zahl in Afrika bei insgesamt 224,2 Mio.<br />
Einw. (Ebda.) und in Deutschland waren es 68,4 Mio Einw. (Ebda.). Bereits 25 Jahre<br />
später in Zeitabschnitt 1975-80 lag die Bevölkerungszahl im <strong>Mali</strong> bei 5,4 Mio. Einw.<br />
(Ebda.), in Afrika bei 416,4 Mio. (ebda.) und in Deutschland bei 78,7 Mio (Ebda.). Bei<br />
einem Vergleich der drei Zeitabschnitte 1950-55, 1970-75 und 2008 zeigt sich eine<br />
unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung. Während sich die Bevölkerung in <strong>Mali</strong><br />
zwischen den ersten beiden Zeitabschnitten nahezu verdoppelt hat und in der<br />
Gesamtbetrachtung von 1950 bis 2008 vervierfacht hat, ist in Deutschland eine ganz<br />
andere Entwicklung zu beobachten. Deutschland hatte noch zwischen 1950-55 und 1975-<br />
80 einen deutlichen Zuwachs an Bevölkerung von 10,3 Mio. Einw., im zweiten Zeitsprung<br />
bis 2008 ist dann die Bevölkerung lediglich minimal um 3,5 Mio. Einw., in Relation zur<br />
Bevölkerungszahl gewachsen. Für Afrika ist eine ähnliche Bevölkerungsentwicklung wie<br />
für <strong>Mali</strong> festzustellen. In Abb. 1 ist noch einmal die Entwicklung der beiden<br />
Vergleichsländer <strong>Mali</strong> und Deutschland aufgezeigt. Beide Länder haben verschiedene<br />
Bevölkerungsentwicklung vollzogen.<br />
39
40<br />
90000<br />
80000<br />
70000<br />
60000<br />
50000<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
10000<br />
0<br />
1950<br />
68376 70326<br />
72815<br />
Bevölkerungsentwicklung 1950-2005<br />
75964 78169 78674 78289 77685 79433 81661 82309 82652<br />
3329 3657 4015 4408 4866 5447 6069 6794 7669 8736<br />
1955<br />
1960<br />
1965<br />
1970<br />
1975<br />
Jahr<br />
1980<br />
1985<br />
1990<br />
1995<br />
2000<br />
10004 11611<br />
2005<br />
<strong>Mali</strong><br />
Deutschland<br />
Abb. 1: Eigener Entwurf nach United Nations – Department of Economic and Social Affairs Population Division<br />
2008.<br />
2.1. Das Modell des demographischen Übergangs<br />
Eine unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung ist natürlich nicht nur zwischen <strong>Mali</strong> und<br />
Deutschland festzustellen, sondern generell weisen Länder einen unterschiedlichen<br />
Verlauf in ihrem Bevölkerungswachstum auf. Viele Faktoren beeinflussen das<br />
Bevölkerungswachstum eines Landes und auch die Beeinflussungsfaktoren variieren von<br />
Region zu Region. Sie sind bedingt durch unterschiedliche räumliche, geschichtliche,<br />
wirtschaftliche oder auch gesellschaftlich Hintergründe. Trotz der unterschiedlichen<br />
Entwicklungen des Bevölkerungswachstums, ist es dennoch möglich ähnliche Entwicklungsmuster<br />
innerhalb der Entwicklung von Ländern wieder zuerkennen.<br />
Das Modell des demographischen Übergangs dient nun dazu Länder in dem Verlauf ihrer<br />
raumzeitlichen Bevölkerungsentwicklung einordnen zu können. Es wird von einem<br />
idealtypischen Transformationsprozess ausgegangen, der auf der Basis von Beobachtungen<br />
europäischer sowie später nordamerikanischer Bevölkerungsentwicklungen<br />
festgelegt wurde. Jedes Land durchläuft fünf Phasen der Entwicklung: (1) prätransformative<br />
Phase bzw. Phase der Vorbereitung, (2) frühtransformative Phase bzw. Phase<br />
der Einleitung, (3) mitteltransformative Phase bzw. Phase des Umschwungs, (4)<br />
spättransformative Phase bzw. Phase des Einlenkens, (5) posttransformative Phase bzw.<br />
Phase des Ausklingens. Die entscheidenden Faktoren, die den Prozess des demographischen<br />
Wandels bedingen, sind die Kennziffern der natürlichen Bevölkerungsbilanz,<br />
die Geburten- und Sterberate.
Abb. 2: Bähr 2004, 220.<br />
Die Abb. 2 zeigt den idealtypischen Verlauf des demographischen Übergangs. In der<br />
Grafik werden die verschieden Phasen erkennbar. Die (1) prätransformative Phase ist<br />
durch eine hohe Geburten- sowie eine hohe Sterberate gekennzeichnet. Dabei liegen die<br />
beiden Raten relativ dicht beieinander, so dass es zu einer ziemlich konstanten<br />
Zuwachsrate kommt. In der (2) frühtransformativen Phase folgt ein Abfallen der<br />
Sterberate bei gleich bleibender Geburtenrate mit der Folge einer steigenden<br />
Zuwachsrate. Innerhalb der (3) mitteltransformativen Phase sinkt die Sterberate dann<br />
weiter, jedoch beginnt nun auch die Geburtenrate zu sinken, so dass die Zuwachsrate<br />
aufhört zu steigen und konstant weiter verläuft. Mit dem Übergang zur (4)<br />
spättransformativen Phase stoppt die Sterberate zu sinken und bleibt auf einem konstant<br />
niedrigen Niveau, die Geburtenrate sinkt jedoch weiter und folglich geht die<br />
Zuwachsrate zurück. Erreicht ein Land die (5) posttransformative Phase, ist es von einer<br />
hohen Sterbe- und Geburtenrate zu einer niedrigen Ausprägung der beiden Raten<br />
übergangen, die konstant auf dem niedrigen Level weiter laufen. Die Zuwachsrate bleibt<br />
ebenso auf einem gleich bleibenden Niveau. (Vgl. Bähr 2004, 219f..)<br />
2.2. Die natürliche Bevölkerungsbilanz in <strong>Mali</strong><br />
Für eine Einordnung <strong>Mali</strong>s und Deutschlands innerhalb des Modells des demographischen<br />
Übergangs ist zuerst einmal eine Betrachtung der Geburten- und Sterberate erforderlich.<br />
Die Gesamtbevölkerung eines Landes ist das Ergebnis der natürlichen Bevölkerungsbilanz<br />
und der Wanderungsbilanz eines Landes. Die natürliche Bevölkerungsbilanz setzt sich aus<br />
einerseits der Geburten- und Fertilitätsrate und andererseits der Sterberate zusammen.<br />
Die Geburten- und Fertilitätsrate sind für die Reproduktion der Bevölkerung eines<br />
Landes die entscheidenden Kennzahlen. Die natürliche Bevölkerungsbilanz erlaubt<br />
zusätzlich einen Rückschluss auf den sozioökonomischen Entwicklungsstand eines Landes.<br />
Die Sterberate, im Besonderen die Säuglingssterblichkeit, kann als Indikatoren, für<br />
beispielsweise die Gesundheitsversorgung in einem Land dienen. Die Kennzahlen <strong>Mali</strong>s<br />
werden wieder in Relation zu Afrika und Deutschland betrachtet, und auch in ihrem<br />
historischen Verlauf präsentiert.<br />
41
2.2.1. Die Geburten- und Fertilitätsrate<br />
Die rohe Geburtenrate <strong>Mali</strong>s ist mit 48 Kinder / 1.000 Einw. im Jahre 2008 (World<br />
Population Bureau 2008, 7 & 10.) vergleichsweise zu restlichen Welt sehr hoch und<br />
damit liegt die Zahl auch deutlich über der rohen Geburtenrate Afrikas 2008 mit 37<br />
Kinder / 1.000 Einw. (Ebda.). Außerdem ist sie fünfmal so hoch wie die rohe<br />
Geburtenrate von Deutschland mit 8 Kinder / 1.000 Einw. (Ebda.). Interessant ist die<br />
Betrachtung, der Entwicklung der Geburtenraten der drei Vergleichsregionen <strong>Mali</strong>, Afrika<br />
und Deutschland. In Tab. 1 sind die Veränderungen anhand von drei Zeitpunkten: 1950-<br />
55, 1975-80 und 2008 zu erkennen.<br />
Tab. 1: Rohe Geburtenrate<br />
Die Geburtenrate <strong>Mali</strong>s ist seit 1950 nahezu konstant geblieben, während die<br />
Geburtenrate Afrikas um ein Viertel zurückgegangen ist und die Deutschlands sich<br />
offensichtlich halbiert hat. Diese Entwicklung zeigt einen deutlichen Unterschied<br />
zwischen den auf der einen Seite stehenden, weiterentwickelten Ländern wie<br />
Deutschland eines ist, und den auf der anderen Seite stehenden weniger entwickelten<br />
Ländern, von denen viele auf dem afrikanischen Kontinent liegen. Laut HDI (Human<br />
Development Indices) Rangliste, die 171 Länder umfasst, liegt Deutschland auf dem 23.<br />
Platz, gehört somit zur Gruppe der weiterentwickelten Länder, und <strong>Mali</strong> liegt auf dem<br />
168. Platz, gehört somit zur Kategorie der weniger entwickelten Länder (Vgl. United<br />
Nation Development Programm 2008, 29 & 31.).<br />
Tab. 2: Zusammengefasste Fertilitäsrate<br />
42<br />
1950-55 1<br />
1950-55 2<br />
1975-80 2<br />
1975-80 2<br />
2008 2<br />
<strong>Mali</strong> 51,8* 52* 48*<br />
Afrika 48,9* 45,8* 37*<br />
Deutschland 16* 10,3* 8*<br />
*Einw. / 1.000 Einw. | 1 World Population Bureau 2008, 7 & 10. | 2 United Nations – Department of Econonic<br />
and Social Affairs Population Division 2008.<br />
2005 2<br />
<strong>Mali</strong> 7,11* 7,56* 6,52*<br />
Afrika 6,75* 6,61* 4,67*<br />
Deutschland 2,16* 1,52* 1,36*<br />
*Kinder / gebärfähiger Frau | 2 United Nations – Department of Economic and Social Affairs Population Division<br />
2008.<br />
Für die Reproduktion einer Gesellschaft ist jedoch nicht nur die rohe Geburtenrate von<br />
Bedeutung, sondern viel mehr die Fertilitätsrate. Sie gibt an wie viele Kinder eine Frau im<br />
Durchschnitt bekommt. Dabei zählen die Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 15 und<br />
49 Jahren (Vgl. Bähr 2004, 159.). Die Tab. 2 zeigt die Entwicklung <strong>Mali</strong>s, Afrikas und<br />
Deutschlands anhand von drei Zeitpunkten: 1950-55, 1975-80 und 2005.
Auch hier ist immer noch ein deutlicher Unterschied zwischen Deutschland und <strong>Mali</strong><br />
bzw. Afrika festzustellen. Bereits im Zeitraum 1950-55 ist ein gravierender Unterschied<br />
zu erkennen. Während sich die Fertilitätsrate von Afrika zum Zeitpunkt 2005 im<br />
Vergleich zu 1950-55 um zwei Kinder pro Frau verringert hat, ist in <strong>Mali</strong> die Rate von<br />
6,52 Kinder / gebärfähiger Frau verhältnismäßig hoch.<br />
2.2.2. Die Sterberate und Säuglingssterblichkeit<br />
Die Sterberate dient als zweite Größe, die maßgeblich für die natürliche<br />
Bevölkerungsbilanz ist. Und im Weiteren wird sie bei der Einordnung <strong>Mali</strong>s und<br />
Deutschlands innerhalb des Modells des demographischen Wandels von entscheidender<br />
Bedeutung sein. Ein Blick auf die Tab. 3 zeigt, bei <strong>Mali</strong> und auch für den ganzen<br />
afrikanischen Kontinent eine erkennbare Veränderung der rohen Sterberate im<br />
bekannten Betrachtungszeitraum: 1950-55, 1975-80 und 2008.<br />
Tab. 3: Rohe Sterberate<br />
1950-55 2<br />
1975-80 2<br />
2008 1<br />
<strong>Mali</strong> 31* 24,3* 15*<br />
Afrika 26,2* 17,2* 14*<br />
Deutschland 11,1* 12,2* 10*<br />
*Einw. / 1.000 Einw. | 1 World Population Bureau 2008, 7 & 10. | 2 United Nations – Department of Econonic<br />
and Social Affairs Population Division 2008.<br />
Während sich die Sterberate <strong>Mali</strong>s von 1950-55 halbiert hat, ist in Deutschland nur eine<br />
minimale Veränderung im gleichen Zeitabschnitt festzustellen. Die Sterberate kann als ein<br />
Indikator für die Gesundheitsversorgung in einem Land dienen. Mit einer verbesserten<br />
Gesundheitsversorgung wird auch der historische Rückgang der Sterberate in Europa<br />
erklärt. Für den Rückgang der Sterblichkeit in Europa werden drei Hauptkategorien<br />
genannt: (1) Ökologische Determinanten, (2) Sozio-ökonomische, politische und<br />
kulturelle Determinanten und (3) Medizinische Determinanten (Ebda., 174.). Somit lässt<br />
sich im Umkehrschluss, anhand der Sterblichkeit eines Landes auch Rückschlüsse auf<br />
seinen Entwicklungsstand ziehen.<br />
Ein wichtiger Zusammenhang zwischen der Demographie und der sozioökonomischen<br />
Entwicklung eines Lands zeigt ein Blick auf die Säuglingssterblichkeit mit seiner<br />
Korrelation zum Pro-Kopf-Einkommen eines Landes. Die Abb. 3 nach einem Entwurf von<br />
Dünckmann mit der Datengrundlage des World Population Data Sheets 1988 zeigt den<br />
deutlichen Zusammenhang der beiden Größen.<br />
43
Abb. 3: Dünckmann 2008.<br />
Die Grafik veranschaulicht den Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen<br />
eines Landes und der Säuglingssterblichkeit. Länder, die eine hohe Säuglingssterblichkeit<br />
aufweisen, verfügen meist über ein geringes Pro-Kopf-Einkommen. Unter diesem<br />
Gesichtspunkt soll nun auch die Säuglingssterblichkeit in <strong>Mali</strong> betrachtet werden. In Tab.<br />
4 ist sie in Vergleich zu Afrika und Deutschland gestellt. Es ist im Verlauf von 1950-55,<br />
ähnlich wie bei der Entwicklung der Sterberate, eine Abnahme der Säuglingssterblichkeit<br />
in <strong>Mali</strong>, wie auch in ganz Afrika festzustellen. Gleichzeitig ist der immense Unterschied<br />
zur Vergleichsgröße Deutschland auffallend. Die Diskrepanz zwischen <strong>Mali</strong> und<br />
Deutschland durchzieht den gesamten Betrachtungszeitraum. Mit der Grafik nach<br />
Dückmann als Hintergrundinformation wird deutlich, dass die wirtschaftliche Situation<br />
<strong>Mali</strong>s entscheidend für die Verbesserung der Lebensbedingungen, z. B. gemessen an der<br />
Säuglingssterblichkeit ist.<br />
Tab. 4: Säuglingssterblichkeit<br />
44<br />
1950-55 2<br />
1975-80 2<br />
2008 1<br />
<strong>Mali</strong> 237,4* 182,5* 96*<br />
Afrika 180,6* 122,4* 82*<br />
Deutschland 50,6* 14,9* 3,9*<br />
*Säuglinge / 1.000 lebend geborenen Säuglingen. | 1 World Population Bureau 2008, 7 & 10. | 2 United Nations –<br />
Department of Econonic and Social Affairs Population Division 2008.
2.3. <strong>Mali</strong> im Modell des demographischen Übergangs<br />
Mit den Grundlagen aus den vorherigen Abschnitten zu den Bevölkerungszahlen, der<br />
Sterberate und der Geburtenrate <strong>Mali</strong>s ist es nun möglich, das Land innerhalb des<br />
Modells des demographischen Wandels in die entsprechende Phase einzuordnen. Für die<br />
Einordnung ist die Sterberate mit 15 Einw. pro 1.000 Einw. (World Population Bureau<br />
2008, 10.) und die Geburtenrate mit 48 Einw. pro 1.000 Einw. (Ebda.) relevant. Daraus<br />
ergibt sich für <strong>Mali</strong> eine Positionierung in der (2) frühtransformativen Phase, in der die<br />
Sterberate bereits sinkt bzw. gesunken ist und die Geburtenrate immer noch konstant<br />
hoch ist, mit der Folge eines starken Bevölkerungszuwachses.<br />
Die Entwicklung eines Landes in Bezug auf das Durchlaufen der verschieden Phasen<br />
innerhalb des Modells des demographischen Überganges ist nicht absehbar. Bereits bei<br />
der empirischen Überprüfung des Modells haben die unterschiedlichen europäischen<br />
Länder verschieden lange für den Durchlauf des Prozesses benötigt (Vgl. Bähr 2004, 222).<br />
Mit dem Modell lässt sich <strong>Mali</strong> in eine demographische Entwicklung einordnen, allerdings<br />
ist es schwierig Bevölkerungsprognosen abzuleiten, da es sich um den idealtypisch Verlauf<br />
westlicher Industrienationen handelt (Ebda., 221.). Dennoch kann das Modell bei<br />
Untersuchung der sozioökonomischen Entwicklung <strong>Mali</strong>s für die Forschung nach<br />
Ursachen herangezogen werden und dabei hilfreich sein (Ebda.).<br />
2.4. Bevölkerungsprognosen für <strong>Mali</strong><br />
Im diesem Teil geht es abschließend zur Bevölkerungsentwicklung um einen zukünftigen<br />
Verlauf der Bevölkerungsentwicklung <strong>Mali</strong>s. Obwohl es sich schwierig gestaltet<br />
Prognosen über zukünftige Bevölkerungsentwicklungen abzugeben, soll hier auf der<br />
Datenbasis der Vereinten Nationen eine mögliche Entwicklung skizziert werden. Die<br />
Abb. 4 zeigt in Abgrenzung zu Deutschland eine eventuelle Entwicklung der Bevölkerung<br />
im Subsahara-Land.<br />
In der Grafik ist erkennbar dass sich die Bevölkerung in <strong>Mali</strong> bis 2050 verdreifachen wird.<br />
Hingegen dieser Entwicklung wird die Bevölkerung in Deutschland um etwa 10% zum<br />
heutigen Stand sinken. Eine Verdreifachung der Bevölkerung stellt jedes Land und im<br />
besonderen <strong>Mali</strong>, als ein bisher weniger entwickeltes Land, vor enorme<br />
Herausforderungen in der Zukunft.<br />
45
46<br />
90000<br />
80000<br />
70000<br />
60000<br />
50000<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
10000<br />
0<br />
2005<br />
2010<br />
2015<br />
Bevölkerungsentwicklung 2005-2050<br />
2020<br />
2025<br />
Jahr<br />
2030<br />
2035<br />
2040<br />
2045<br />
2050<br />
<strong>Mali</strong><br />
Deutschland<br />
Abb. 4: Eigener Entwurf nach United Nations – Department of Economic and Social Affairs Population Division<br />
2008.<br />
2.5. Ethnische und religiöse Zusammensetzung<br />
In <strong>Mali</strong> gibt es eine große Anzahl verschiedener ethnischer Gruppen. Die politisch und<br />
ethnisch interessanteste Gruppe sind die Bambara, die rund 32 % (Fischer Weltalmanach<br />
2002, 525.) der gesamten Bevölkerung ausmachen. Bambara ist auch neben der<br />
Amtssprache Französisch die meist gesprochene Sprache in <strong>Mali</strong> und gilt zusammen mit<br />
Arabisch als eine der offiziellen Verkehrssprachen (Leisinger / Schmitt 1992, 125.).<br />
Weitere ethnische Gruppen sind die Fulbe (Peul) mit 14 %, die Senufo mit 12 %, die<br />
Soninké mit 9 %, die Tuareg mit 7 %, die Songhai mit 7 %, die <strong>Mali</strong>nké mit 6 % und die<br />
Dogon mit 2,5 % (Fischer Weltalmanch 2002, 525.).<br />
Bei der Betrachtung der Religionszugehörigkeit fällt eine Zuwendung zum Islam deutlich<br />
auf. Über 90 % der Bevölkerung sind muslimischen Glaubens, die restlichen 9 % sind<br />
einer animistischen Religion zu zuordnen und 1 % sind Anhänger des christlichen<br />
Glaubens. (CIA 2009; Leisinger / Schmitt 1992, 125.)<br />
3. Bevölkerungsverteilung in <strong>Mali</strong><br />
In diesem Kapitel wird der räumliche Bezug zu der vorangegangen Bevölkerungsentwicklung<br />
geschaffen. Besonders in einem klimatisch zerteilten Land wie <strong>Mali</strong> ist eine<br />
Untersuchung der räumlichen Verteilung von Bevölkerung und ihren Ballungsgebieten<br />
äußerst interessant. <strong>Mali</strong> umfasst mit einer Fläche von 1.240.192 km² (Fischer<br />
Weltalmanach 2002, 181.) fast die vierfache Fläche von Deutschland, das eine Größe von
357.020 km² (Ebda., 525.) besitzt. Es ist jedoch anzumerken, dass der Norden <strong>Mali</strong>s mit<br />
einer Fläche von 280.000 km² (22,6 % des Staatsgebietes) Teil des Wüstengebiets der<br />
Sahara ist und eine Fläche von 320.000 km² (25,8 % des Staatsgebietes) der Sahelzone<br />
angehören (vgl. Barth 1986, 6.). Demzufolge ist fast die Hälfte des Staatsgebietes sehr<br />
trockener Lebensraum, der eine Besiedlung erschwert. Für <strong>Mali</strong> ergibt sich somit eine<br />
Bevölkerungsdichte von 10 Einw. / km² Fläche (World Population Bureau 2008, 11.). Im<br />
Vergleich dazu leben in Deutschland auf derselben Fläche 230 Einw. (Ebda., 14) und in<br />
Afrika sind es 32 Einw. / km² (Ebda., 11). Bei dieser Diskrepanz machen die<br />
naturräumlichen Gegebenheiten <strong>Mali</strong>s höchstens im Vergleich zum Kontinent Afrika<br />
einen Unterschied. Auf der Abb. 5 ist die räumliche Verteilung der Bevölkerung in Form<br />
von Ballungsgebieten mit der Größe von 10.000 Einw. – entsprechend eines Punktes – zu<br />
erkennen.<br />
Abb. 5: Barth 1986, 191. Abb. 6: Diercke Weltatlas 2005, 139.<br />
Es ist erkennbar, dass sich die Ballungspunkte entlang des Niger Fluss und vornehmlich<br />
im Süden des Landes befinden. Diese räumliche Position entspricht wiederum den<br />
naturräumlichen Gegebenheiten, wie in der Abb. 6 zu erkennen ist. Im Norden liegt das<br />
Wüstengebiet der Sahara und südlich daran angrenzend die Sahelzone mit ihrer<br />
Trockensavanne.<br />
4. Urbanisierung <strong>Mali</strong>s<br />
Bei der räumlichen Betrachtung durch Bevölkerungsverteilung und -dichte im<br />
Staatsgebiet spielt der Prozess der Urbaniserung eine wesentliche Rolle. Weltweit leben<br />
bereits nach dem 'World Population Data Sheet 2008' 49 % der Menschen in Städten<br />
(World Population Bureau 2008, 11.). In den weiter entwickelten Ländern liegt der Grad<br />
der Urbanisierung sogar bei 74 % (Ebda.). Damit ergibt sich auch die Relevanz einer<br />
genaueren Betrachtung der Rolle der Stadt oder des städtischen Ballungsgebietes für<br />
<strong>Mali</strong>. Im Folgenden werden die, für den westafrikanischen Raum, wichtigen Stadttypen<br />
vorgestellt, der Grad der Verstädterung <strong>Mali</strong>s sowie seine Entwicklung präsentiert und<br />
47
zuletzt werden die Ursachen und Folgen der Verstädterung im Allgemeinen und im<br />
Speziellen für <strong>Mali</strong> dargestellt.<br />
4.1. Die afrikanischen Stadttypen<br />
Im west-afrikanischen, subsahara Raum sind zwei Stadttypen wieder zu finden, die<br />
nordafrikanisch-orientalische Stadt und die Kolonialstadt. Die nordafrikanischorientalische<br />
Stadt ist um die Jahrtausendwende entstanden und somit keine autochthone<br />
Stadt. Sie ging einher mit der islamisch-arabischen Eroberung weiter Teile der südlichen<br />
Sahararegion (Vgl. Bähr / Jürgens 2005, 283.). Es bildeten sich Städte die als Handelsknotenpunkte<br />
für den Trans-Sahara-Handel wichtig waren, wie beispielsweise Timbuktu.<br />
Ihr Stadtbild entspricht heute noch in vielen Bereichen dem islamisch-orientalischen<br />
Stadtbild und kennzeichnet sich somit ebenso durch einen zentralen Bazar oder Suq,<br />
durch ihren Sackgassen-Grundriss und die Innenhofstruktur, die beide dem Wahren der<br />
Privatsphäre dienen, und durch die Abtrennung in verschiedene Wohnquartiere<br />
entstehen (Vgl. Bähr 2006, 288f.). Als Beispiel für den Grundriss einer malischen Stadt,<br />
die dem Modell der nordafrikanisch-orientalischen Stadt entspricht, ist Timbuktu zu<br />
nennen. Die Abb. 7 und Abb. 8 zeigen die Stadt Timbuktu, zum einen in ihrem Grundriss<br />
und zum anderen aus der Satellitenperspektive.<br />
Abb. 7: Därr 2008, 411. Abb. 8: Google Earth 2008.<br />
Die Kolonialstadt als zweite entscheidende westafrikanisch Stadt ist im malischen<br />
Staatsgebiet weniger wieder zu finden, da ihre Gründung häufig an die Lage am Meer<br />
gebunden war. Die Entstehung von Kolonialstädten ist in die Phase der Kolonialzeit<br />
einzuordnen. Es handelt sich dabei um Verkehrsknotenpunkte, die für die Ausbeutung<br />
der Bodenschätze des Landes helfen sollte. Dabei kam es häufig zur Neugründung von<br />
Städten in der Nähe bereits bestehender autochthoner Städte und mit Lage am Wasser,<br />
die dann wiederum zum Bau einer Hafenanlage führte. Bei der weiteren Entwicklung kam<br />
48
es zur Überformung des autochthonen Stadtgebietes, mit der Folge eines dualen<br />
Stadtbildes, der so genannten Hybridstadt. Dieser Prozess ist deutlich in der Abb. 9 zu<br />
erkennen. Die Hybridstadt hat eine ethnische Segregation zur Folge, die aus der<br />
Überlagerung zweier Stadttypen entsteht (Vgl. Bähr / Jürgens 2005, 282.).<br />
Abb. 9: Bähr / Jürgens 2005, 291.<br />
Durch seine Binnenlage des Landes spielt der koloniale Stadttyp für <strong>Mali</strong> eine eher<br />
geringere Bedeutung. Die religiöse Zusammensetzung der malischen Bevölkerung deutet<br />
bereits auf einen starken islamischen Einfluss hin. Dieser findet sich auch im Stadtbild<br />
wieder und führt somit zu einer vornehmlichen Zuordnung zur nordafrikanischenorientalischen<br />
Stadt, wie auch die Satellitenaufnahme Timbuktu in Abb. 8 zeigt.<br />
4.2. Grad der Urbanisierung in <strong>Mali</strong><br />
Nach der Zuordnung der malischen Stadt zu einem vorrangigen islamisch-orientalisch<br />
geprägten Stadtbild, wird nun der Grad der Verstädterung betrachtet. In <strong>Mali</strong> hat sich der<br />
Grad des städtischen Lebens im bekannten Zeitraum von 1950 bis 2008 nahezu<br />
vervierfacht. In Tab. 5 wird die Entwicklung ersichtlich und auch der Unterschied<br />
zwischen Deutschland und <strong>Mali</strong> anhand der letzten sechzig Jahre deutlich. In Deutschland<br />
ist der Zuwachs der Städte im Verlauf der Tabelle eher gering, wobei in Afrika und <strong>Mali</strong><br />
ein massiver Verstädterungsgrad zu verzeichnen ist.<br />
49
Tab. 5: Grad der Urbanisierung<br />
Für diese Entwicklung ist es notwendig eine Verbindung zum allgemeinen Bevölkerungszuwachses<br />
in Afrika und in <strong>Mali</strong> zuziehen. So ist die Bevölkerung, ebenso wie der Grad<br />
der Verstädterung, sind innerhalb der letzten ca. 60 Jahre um das Vierfach gestiegen.<br />
Dennoch spielen für das Städtewachstum auch die regionalen Wanderungsbewegungen,<br />
wie z. B. die Land-Stadt-Wanderung eine wichtige Rolle.<br />
50<br />
1950-55 2<br />
Stadt-/Landverteilung<br />
282 354 444 556 697 885 1122 1428 1789 2229 2787 3537<br />
3047 3302 3571 3852 4169 4562 4947 5366 5880 6507 7217 8074<br />
4503<br />
9003<br />
5716<br />
7207<br />
8987 11022 13294 15788 18482 21333<br />
9939 10827 11603 12228 12672 12931 13006 12898<br />
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050<br />
Jahre<br />
Landbevölkerung Stadtbevölkerung<br />
1975-80 2<br />
2008 1<br />
<strong>Mali</strong> 8,5 % 16, 2 % 31 %<br />
Afrika 14,5 % 25,2 % 38 %<br />
Deutschland 68,1 % 72,6 % 73 %<br />
1 World Population Bureau 2008, 7 & 10. | 2 United Nations – Department of Econonic and Social Affairs<br />
Population Division 2008.<br />
Abb. 10: Eigener Entwurf nach United Nations - Department of Economic and Social Population Division 2008.<br />
Die Abb. 10 zeigt die bisherige Entwicklung sowie eine Prognose für den zukünftigen<br />
Grad der Stadt- und Landbevölkerung in <strong>Mali</strong>. Aus der Grafik ist erkennbar, dass ein<br />
großer Teil des Bevölkerungswachstums in den Städten <strong>Mali</strong>s wieder zu finden sein wird.<br />
Wodurch die Städte vor zukünftige, aber bereits aktuelle Problematiken gestellt werden,<br />
die es zu lösen gilt.
4.3. Ursachen des Städtewachstums<br />
Als Ursache für das städtische Wachstum spielen zum einen Anziehungskriterien – Pull-<br />
Faktoren – der Städte ein Rolle, zum anderen führen schlechte Lebensbedingungen auf<br />
dem Land – Push-Faktoren – zur Wanderung in die Stadt. Die Ursachen werden<br />
allgemein als Push- / Pull-Fakoren bezeichnet. Für Push- / Pull-Faktoren kommen fünf<br />
Wirkungsbereiche zum Tragen: demografische, ökologische, wirtschaftliche, infrastrukturelle<br />
und sozial-gesellschaftliche Faktoren. (Vgl. Heineberg 2006, 33 & 326.)<br />
Unterschiedliche Push-Faktoren spielen dabei auch für <strong>Mali</strong> eine Rolle und verursachen<br />
eine Abwanderung aus dem ländlichen Raum. Hierfür steht auf der demografischen<br />
Ebene das stark zunehmende Bevölkerungswachstum, auf der ökologischen Ebene spielen<br />
die naturräumlichen Gegebenheiten und die daraus resultierende Probleme, wie die<br />
Dürreperioden – in <strong>Mali</strong> Anfang der 80er Jahre – eine entscheidende Rolle (Vgl. Bähr /<br />
Jürgens 2005, 282.). Ein weiterer Push-Faktor kann aus der wirtschaftlichen Situation<br />
durch mangelnde Arbeitsplätze im ländlichen Raum ausgelöst werden oder auch<br />
infrastrukturell bedingte mangelnde Versorgung mit Bildung, Krankenhäusern oder auf<br />
sehr essentieller Ebene – allerdings sehr relevant für <strong>Mali</strong> – mit Trinkwasser. Die<br />
genannten Push-Faktoren, waren während der <strong>Exkursion</strong> in <strong>Mali</strong> wieder zu finden.<br />
Gleichzeitig locken jedoch bestimmte Pull-Faktoren die Bevölkerung in die Städte. Dabei<br />
kehren sich viele Push-Faktoren um, so dass in der Stadt z. B. auf bessere oder höhere<br />
Anzahl von Arbeitsplätzen gehofft wird. Bessere Versorgungsmöglichkeiten locken in die<br />
Städte, dabei gibt es für <strong>Mali</strong>er, die studieren möchten, nur in Bamako die Möglichkeit<br />
dazu. Außerdem existiert häufig ein positives Bild vom Stadtleben, das auf der sozialgesellschaftlichen<br />
Ebene Anreize zur Wanderung in die Stadt bietet. Dieses Bild wird<br />
häufig durch 'falsche Anreize' – bessere Versorgungsversorgungssetzungen für Städter,<br />
durch Preisbindung – auf politischer Ebene zusätzlich noch gestärkt (Ebda.).<br />
Unterschiedliche Gründe führen zu einer Zunahme der städtischen Bevölkerung. Es gibt<br />
Push- und Pull-Faktoren durch die es zur Wanderung in die Stadt kommt. Am Beispiel<br />
Moptis hat Beate Lohnert verschiedene Wanderungsbewegungen, die mit der<br />
Urbanisierung zusammenhängen in ihrem Buch ‚Überleben am Rande der Stadt’<br />
aufgezeigt. Für die Stadt Mopti, die nahe dem Niger-Binnendelta gelegen ist, stellt Beate<br />
Lohnert vier Wanderungsströme fest: die Land-Stadt Migration, Inter-urbane Migration,<br />
Saisonale Arbeitsmigration (zirkulär) und Stadt-Stadt Migration (Vgl. Lohnert 1995, 10.).<br />
Diese Einteilung macht deutlich, dass für den Zuwachs der Städte die Push- und Pull-<br />
Faktoren, die vor allem für die Land-Stadt Migration gelten eine Rolle spielen, jedoch gibt<br />
es noch weitere Migrationströme, innerhalb der Stadt sowie zwischen Städten oder auch<br />
saisonale bedingte Wanderungen, die zirkulär funktionieren, d. h. es kommt auch zu<br />
Rückwanderungen in den ländlichen Raum (Vgl. Bähr / Jürgens 2005, 281.). Dennoch<br />
ergibt sich insgesamt ein Bevölkerungszuwachs, der die Städte und auch das Land vor<br />
weitere Herausforderung stellt.<br />
51
4.4. Folge: Marginalsiedlung<br />
Als Folge von überproportionalem Städtewachstums können sich Probleme in der<br />
Versorgung aber auch für die städtischen Strukturen ergeben. Ein häufiges, auch<br />
strukturelles Problem starken Städtewachstums in weniger entwickelten Ländern ist die<br />
Bildung von Marginalsiedlungen. Der Begriff 'Marginal' bezieht sich dabei auf die<br />
Bausubstanz, die minderwertige städtische Lage der Siedlungen sowie die soziökonomische<br />
Situation der Bewohner. Des Weiteren sind sich Marginalsiedlungen durch<br />
eine hohe Bevölkerungsdichte gekennzeichnet, und darin spiegelt sich erneut das<br />
Problem der Überbevölkerung. Es sind oft unkontrolliert, am Stadtrand wachsende<br />
Viertel, die eine schlechte Versorgung sowie eine hohe Kriminalität aufweisen. (Vgl.<br />
Heineberg 2006, 50.)<br />
In westafrikanischen Städten ist wenig Boden in öffentlichem Besitz, wodurch eine<br />
größere Kontrolle über den Boden herrscht, da die privaten Besitzer ihre eigenen<br />
Interessen verfolgen. Daraus ergibt sich weniger verfügbare Fläche im städtischen Raum<br />
und somit eine höhere Verdichtung mit der Folge, dass es schneller zur Bildung von<br />
Marginalsiedlungen kommt. (Vgl. Bähr / Jürgens 2005, 287.)<br />
4.5. Folge: Primatstadt Bamako<br />
Ein interessantes Phänomen, das gehäuft in weniger entwickelten Ländern vorkommt, ist<br />
die Herausbildung einer Primatstadt. Die Primatstadt ist eine Stadt, die im Zuge einer<br />
Überverstädterung, eine führende Rolle einnimmt, dabei handelt es sich häufig um eine<br />
Groß- oder Hauptstadt. Die Primatstadt bekommt neben ihrer demographischen Primacy<br />
– der Begriff kommt aus dem englischen von der so genannten 'Primate City' – auch noch<br />
eine funktionale Primacy, also eine funktionale Überkonzentration von politischadministrativen,<br />
wirtschaftlichen, sozialen und kulturell-wissenschaftlichen Funktionen.<br />
(Vgl. Heineberg 2006, 38.)<br />
In <strong>Mali</strong> ist das Phänomen der Primatstadt in der Hauptstadt Bamako wieder zuerkennen.<br />
Ein Großteil der Bevölkerung, vor allem der städtischen Bevölkerung lebt in der<br />
Hauptstadt. Insgesamt leben 1.494.000 Einw. in Bamako, das sind somit 12 % der<br />
gesamten malischen Bevölkerung und 39 % der städtischen Bevölkerung. (Vgl. United<br />
Nations – Department of Economic and Social Population Division 2008.) Auch ist ein<br />
funktionaler Bedeutungsüberschuss für die Hauptstadt vorhanden: Bamako ist der<br />
Verkehrsknotenpunkt, Universitätsstandort und politisches Zentrum <strong>Mali</strong>s.<br />
4.6. Abschließende Anmerkungen zum Grad der Urbanisierung <strong>Mali</strong>s<br />
Während der <strong>Exkursion</strong> ist die ländliche Prägung des städtischen Raumes aufgefallen,<br />
woraus sich die Frage ergibt, ob der Grad der Verstädterung in <strong>Mali</strong> bzw. in weniger<br />
entwickelten Ländern mit dem der weiter entwickelten Länder gleichgesetzt werden<br />
52
kann. Und ob nicht über einen Prozess vielleicht unter dem Begriff der 'Ruralisierung'<br />
von Städten nachgedacht werden könnte. Beim spazieren durch Bamako, war es kein<br />
unübliches Bild, Hühner oder auch eine Ochsen mitten in der Stadt zu treffen. Oder für<br />
einen galoppierenden Reiter ohne Sattel Platz zu machen. Diese Erfahrungen ließen das<br />
Gefühl entstehen, dass es nicht nur möglich ist, dass sich städtische Lebensweise<br />
verbreitet, sondern auch ländliche Lebensweise auf den Stadtraum übergeht. Dabei wird<br />
jedoch gleichzeitig wieder einmal deutlich, dass der Stadtbegriff ein aus dem europäischen<br />
Stadtverständnis entwickeltes Konzept ist und damit ein Begriff darstellt, der mit seinen<br />
Strukturen und Merkmalen nicht unbedingt für jeden anderen Lebensraum anwendbar<br />
ist.<br />
53
Literaturverzeichnis<br />
BÄHR, Jürgen 2004: Bevölkerungsgeographie. 4. Auflage, Stuttgart.<br />
BÄHR, Jürgen; JÜRGENS, Ulrich 2005: Stadtgeographie II - Regionale Stadtgeographie.<br />
Braunschweig.<br />
BARTH, Hans Karl 1986: <strong>Mali</strong> - Eine geographische Landeskunde. Darmstadt.<br />
DÄRR, Erika (Hrsg.); BAUR, Thomas; GÖTTLER, Gerhard 2008: Sahel-Länder Westafrikas.<br />
8. Auflage, Bielefeld.<br />
FISCHER VERLAG 2001: Fischer Weltalmanach 2002. Frankfurt a. Main.<br />
HEINEBERG, Heinz 2006: Stadtgeographie. 3. Auflage, Paderborn.<br />
LEISINGER, Klaus M.; SCHMITT, Karin 1992: Überleben im Sahel - Eine ökologische und<br />
entwicklungspolitische Herausforderung. Basel/ Bosten/ Berlin.<br />
LOHNERT, Beate 1995: Überleben am Rande der Stadt - Ernährungspolitik,<br />
Getreidehandel und verwundbare Gruppen in <strong>Mali</strong> - Das Beispiel Mopti. Saarbrücken.<br />
MÜLLER, Franz-Volker 1990: Flexibal aus Tradition - Strategien wirtschaftlichen und<br />
sozialen Handelns im mittleren Nigertal (<strong>Mali</strong>). München.<br />
Westermann 2005: Diercke Weltatlas. 4. Auflage, Braunschweig.<br />
CIA 2009: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/ml.html<br />
Stand 29.04.2009.<br />
United Nations Development Programme 2008: Human Development Indices 2008.<br />
http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf Stand 26.04.2009.<br />
United Nations - Department of Economic and Social Affairs - Population Division<br />
2008: World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database.<br />
http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=1 Stand 10.11.2008.<br />
World Population Bureau 2008: 2008 World Population Data Sheet.<br />
http://www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf Stand 10.11.2008.<br />
54
Agrarwirtschaftliche Strukturen<br />
und Lebensbedingungen<br />
Melanie Kühl<br />
55
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Rahmenbedingungen.................................................................................................................... 57<br />
1.1. Ausgewählte Standortfaktoren .......................................................................................... 57<br />
2. Ökologische Bedingungen .......................................................................................................... 58<br />
2.1. Dürre und Desertifikation.................................................................................................. 58<br />
2.2. Veränderungen der Nigerflutbewegung........................................................................... 58<br />
2.3. Savanne ................................................................................................................................... 59<br />
3. Regenfeldanbau ............................................................................................................................. 59<br />
3.1. Sorghum.................................................................................................................................. 59<br />
3.2. Hirse........................................................................................................................................ 60<br />
3.3. Mais.......................................................................................................................................... 60<br />
3.4. Reis .......................................................................................................................................... 60<br />
3.5. Erdnüsse ................................................................................................................................. 60<br />
3.6. Baumwolle.............................................................................................................................. 61<br />
3.6.1. Baumwollproduktion für den Weltmarkt: verzerrter Wettbewerb und die<br />
Folgen für <strong>Mali</strong>............................................................................................................... 61<br />
3.7. Spezialkulturen ...................................................................................................................... 63<br />
4. Probleme der Landwirtschaft in der Savanne ........................................................................ 63<br />
4.1. Die sahelischen Regionen ................................................................................................... 64<br />
5. Bewässerungswirtschaft.............................................................................................................. 64<br />
5.1. Gebiete der Bewässerungswirtschaft............................................................................... 65<br />
5.2. Oberflächengewässer .......................................................................................................... 65<br />
6. Weidewirtschaft und Tierhaltung............................................................................................. 66<br />
7. Sammelwirtschaft und Schilfgrasnutzung................................................................................. 68<br />
8. Fischfang ......................................................................................................................................... 68<br />
9. Desertifikation .............................................................................................................................. 68<br />
9.1. Nachhaltige Desertifikationsbekämpfung ........................................................................ 70<br />
56
1. Rahmenbedingungen<br />
Die Binnenlage <strong>Mali</strong>s ist einer der Hauptgründe für die Ausprägung allgemeiner negativer<br />
Rahmenbedingungen. <strong>Große</strong> Teile des Landes leiden an der schlechten inneren und<br />
äußeren Verkehrsanbindung, die zusammen mit der wirtschaftlichen und medizinischen<br />
Unterversorgung zur infrastrukturellen Benachteiligung führt (Vgl. Barth 1986, 59).<br />
1.1. Ausgewählte Standortfaktoren<br />
Die Hydrologie ist besonders durch das mäandernde Flusssystem des Nigers bestimmt,<br />
der mit seinen jahreszeitlich bedingten Flutbewegungen das Leben der Menschen<br />
bestimmt (Vgl. Barth 1986, 60).<br />
Niederschläge sind, bezogen auf die Landwirtschaft, in direkte und indirekte Wirkung zu<br />
unterteilen:<br />
Direkte Niederschlagswirkungen beeinflussen besonders den traditionellen Überflutungsreisanbau,<br />
da durch die gleichmäßige Verteilung der ersten Regenfälle der Erfolg der<br />
Direktansaat des traditionellen Flutreises bestimmt wird.<br />
Die indirekte Niederschlagswirkung ergibt sich aus der Flutveränderung des Nigers. Da<br />
ein Großteil der vom Regen abhängigen Anbaugebiete außerhalb der agronomischen<br />
Regenfeldbau Grenzen liegt, ist das sichere Eintreten der alljährlichen Flutbewegung von<br />
großer Bedeutung (ebda.).<br />
Klima: Der Süden des Landes befindet sich in der sahelischen Klimazone. Das bedeutet<br />
eine durch die innertropische Konvektionsgrenze ausgelöste Abfolge von Trocken- und<br />
Regenzeit, die klimabestimmend wirkt. Landwirtschaftlich bedeutend ist daher die<br />
ungleichmäßige Niederschlagsverteilung. Häufige Starkregenfälle, vor allem zu Beginn der<br />
Vegetationszeit sorgen dafür, dass das Wasser größtenteils oberflächlich abfließt und<br />
damit nur zu einem geringen Teil für die Pflanzen verfügbar ist (Vgl. Barth 1986, 61).<br />
Die hydrologische Negativbilanz wird noch durch die hohe Evapotranspirationsrate, von<br />
über 2000 mm/Jahr, verschärft, die sich bei herrschenden Temperatur-Mittelwerten um<br />
36°C einstellt (ebda.).<br />
Die Höhe der Niederschlagswerte und deren erhebliche Schwankungsbreite<br />
unterstreichen die Bedeutung des Nigerwassers für eine Bewässerungslandwirtschaft als<br />
Lebensgrundlage der Bevölkerung. Die negativen Niederschlagsverhältnisse bewirkten<br />
jedoch in der Regel auch einen unmittelbaren Rückgang des Nigerwasserstandes.<br />
Wind: Ist ein bedeutender Klimafaktor, da er trockenheitsverstärkend und erosiv wirkt.<br />
Sandstürme können die landwirtschaftlichen Kulturen sehr gefährden (Vgl. Barth 1986,<br />
63). Dieser Gefährdung sollen Windschutzanpflanzungen entgegenwirken.<br />
Der Boden besteht vorwiegend aus subarider Braunerde, entstanden auf Sandsteinformationen.<br />
Im Überschwemmungsgebiet des Nigers entstehen hydromorphe Böden,<br />
die vorwiegend durch Flutwasser oder oberflächennahes Grundwasser beeinflusst<br />
werden. Dieser Bereich konzentriert sich vorwiegend auf den einen schmalen Bereich<br />
von 10 – 20 km entlang des Nigerverlaufs und setzt den Möglichkeiten der acker-<br />
57
aulichen Nutzung deutliche Grenzen. Dieser Bereich wird der agropastoralen Zone<br />
zugeordnet. Sie ist von der Überflutungstätigkeit des Nigers abhängig. Die hier<br />
entstehenden Böden mit hohem Ton- und Feinschluffanteil, eignen sich aufgrund der<br />
Wasserrückhaltefähigkeit gut für den Naßreisanbau, sind jedoch nur schwer bearbeitbar<br />
(Vgl. Barth 1986, 63-64).<br />
Die sandigen Böden der Baum/Strauch- bzw. Dornbuschsavanne gehören in der Regel zu<br />
den subariden Braunerden, die nur sehr geringe organische Substanz aufweisen. Dieses<br />
wirkt ertragsbegrenzend (Vgl. Barth 1986, 65).<br />
2. Ökologische Bedingungen<br />
2.1. Dürre und Desertifikation<br />
Dürre: Zeiträume anhaltender Wasserknappheit (Niederschlagsmangel) über mehrere<br />
Jahre, „sind im Sahel wiederkehrende Ereignisse, die daher im Leben der Sahelbevölkerung<br />
eine zentrale Rolle spielen“. (Barth 1986, 65). Die soziokulturellen<br />
Lebensformen sind dieser Situation angepasst. Die Auswirkungen der großen Dürren der<br />
70er und 80er Jahre waren Langezeit in der gesamten Sahelregion sichtbar. „Die Ursache<br />
hier ist die Empfindlichkeit des sahelischen Ökosystems, dessen klimatisch bedingte<br />
Regenerationsfähigkeit durch die Dürreauswirkungen erheblich geschwächt wurde“<br />
(Barth 1986, 67).<br />
Desertifikation: „… die Ausbreitung wüstenähnlicher Verhältnisse im Gebiete hinein, in denen<br />
sie zonal-klimatisch eigentlich nicht existieren sollten.“ (Barth 1986, 65 zitiert nach Mensching<br />
1990,4).<br />
Dürrekatastrophen und Desertifikation sind fast immer miteinander verbunden. Hierbei<br />
trägt der Mensch durch die Landnutzung indirekte Verantwortung für die Desertifikation<br />
als Ursache zunehmender Dürren.<br />
2.2. Veränderungen der Nigerflutbewegung<br />
Der Niger durchfließt auf einer Länge von 1745 km das Staatsgebiet und wirkt in seinem<br />
Durchzugsgebiet bestimmend auf die landwirtschaftliche Produktivität. In den letzten<br />
Jahrzehnten kam es zu einer Verringerung der Nigerfluthöhe. Dazu kommt, dass die<br />
flächenhafte Überschwemmung zu einer Abschwächung der Nigerflutfälle führt. <strong>Große</strong><br />
Flächen, die mittlerweile nicht mehr von der Nigerflut erreicht werden, müssen seitdem<br />
mit Motorpumpen bewässert werden um die Reisproduktion soweit wie möglich<br />
sicherzustellen. Der Haupteinfluss auf die Abschwächung der Nigerfluthöhe hat klimatische<br />
und anthropogene Ursachen: insbesondere der extreme Rückgang des<br />
Wasserführung des Bani-Flusssystems. Dieser Hauptzufluss oberhalb des Binnendeltas<br />
wurde stark durch den Niederschlagsrückgang und Abholzung im Quellgebiet verringert.<br />
Er lieferte 1986 bereits 60 % weniger Wasser als 1966. Die Durchflussmenge des Nigers<br />
58
verringerte sich von 1970 bin 1986 von ca. 1.000 m³/s auf 500 m³/s im jährlichen Mittel<br />
(Vgl. Barth 1986, 70-71).<br />
2.3. Savanne<br />
Die agrarökologischen Voraussetzungen der Savannengebiete im südlichen Landesteil<br />
<strong>Mali</strong>s leiten sich im Wesentlichen ab von der klimatischen Ausstattung, wobei<br />
Niederschlagsmenge, Niederschlagsgang im Jahresverlauf, Strahlungspotential und<br />
Temperatur sowie Wasserhaushalt im Vordergrund stehen. Raumdifferenzierende, das<br />
jeweilige Nutzungspotential innerhalb der Savannengebiete bestimmende Naturhaushaltskomponenten<br />
sind das Relief und die Böden (Vgl. Barth 1977, 147).<br />
Im südlichen und mittleren Landesteil <strong>Mali</strong>s herrscht Feucht- und Trockensavanne vor.<br />
Die Niederschlagsmenge beträgt zwischen 1000 und 1500 mm/Jahr. Dies sind günstige<br />
Bedingungen für Regenfeldanbau. In allen Teilen gibt es eine ausreichend lange Regenzeit<br />
mit 9 bis 3 humiden Monaten. Dies gewährleistet eine Wachstumsperiode, die den<br />
Anbau einer vieler Kulturpflanzen ermöglicht (ebda.).<br />
3. Regenfeldanbau<br />
Der Regenfeldanbau ist durch Dürreereignisse zunehmend unsicher. Der häufige<br />
Saatgutmangel ist ein weiteres Risiko. Daher besteht ein deutliches Anbaugefälle Richtung<br />
Norden, so dass hier kaum noch Getreideproduktion im Regenfeldbau betrieben wird. Er<br />
hat somit eine geringere Bedeutung gegenüber der traditionellen Bewässerungswirtschaft.<br />
3.1. Sorghum<br />
Der Anbau von Sorghum gehört zu den ältesten ackerbaulichen Aktivitäten Afrikas. Er<br />
besitzt je nach Ortslage und Bodenverhältnissen unterschiedliche Bedeutung. Heute ist<br />
er in den Savannengebieten Afrikas die am weitesten verbreitete Kulturpflanze und<br />
mittlerweile wichtiger als Hirse, da er auf den schweren Böden im Nigerflutbereich<br />
bevorteilt ist und eine hohe ökologische Anpassungsfähigkeit besitzt: Dürreeinwirkungen<br />
machen ihr ebenso wenig aus wie Wasserandrang in der Zeit der Niederschlagsmaxima.<br />
An die Dauer der Niederschlagsperiode angepasste Vegetations- und Reifephase<br />
zwischen 90 und 140 Tagen erlaubt den Anbau sowohl in den südlichen Feuchtsavannen<br />
als auch im Bereich der agronomischen Trockengrenze (Vgl. Barth 1977, 147). Unterschieden<br />
wird in Nachflutanbau, welcher auf den restfeuchten Niger-Überschwemmungsflächen<br />
oder tonhaltigen Senken mit anstehendem Grundwasser gesät wird und<br />
Direktsaat, welche mit Einsetzen der Regenzeit auf tonhaltigen Sanden und Senken<br />
geschieht.<br />
59
3.2. Hirse<br />
Die Anbaufähigkeit von Hirse reicht von den Feuchtsavannen im Süden bis in die<br />
sahelischen Regionen. Diese über mehrere Klimazonen hinweg reichende Anbaufähigkeit<br />
ist in den Merkmalen der Hirse begründet: Unterschiedliche Wachstums- und<br />
Reifeperioden (je nach Sorte), gute Anpassung an hohe Strahlungs- und Temperaturwerte<br />
und relativ geringe Ansprüche an die Bodengüte (Vgl. Barth 1977, 148) Im<br />
Unterschied zu Sorghum ist Hirse allerdings empfindlicher gegenüber Staunässe und<br />
Überflutung (ebda.).<br />
Der Anbau ist auch auf sandigen Böden möglich. Etwas schwerere tonig-schluffige Sande<br />
werden allerdings bevorzugt, so dass optimale Ertragsbedingungen in der Region der<br />
Trockensavanne herrschen. Der Anbau ermöglicht gleichzeitig Weidewirtschaft. Die<br />
Erträge liegen wegen der geringen Niederschläge meinst unter 300 kg/ha.<br />
3.3. Mais<br />
Mais hat eine wesentlich geringere Bedeutung gegenüber Sorghum und Hirse. Der Anbau<br />
wird vor allem in den Feuchtsavannen im Südosten betrieben. Im Unterschied zu<br />
Sorghum und Hirse reagiert Mais empfindlich auf Feuchtemangel und mindere<br />
Bodengüte. Sichere Erträge sind nur in Niederschlagsgebieten bis zu 800 mm/Jahr<br />
möglich (Vgl. Barth 1977,149). Nährstoffarme Böden sind ausgeschlossen. Für eine<br />
zukünftige Ausweitung des Anbaus spricht allerdings, dass Mais in seiner Reifeperiode<br />
gegen Verluste durch Schlagregen, Insektenbefall und Vogelfraß geschützt ist (ebda.).<br />
3.4. Reis<br />
Man unterscheidet Nass- und Trockenreis. In <strong>Mali</strong> vorwiegend in Überflutungsniederungen<br />
entlang der Flüsse im Gebiet der Feuchtsavannen aber auch in den<br />
Trockensavanne und Sahel angebaut. Einige Sorten haben ihr Hauptanbaugebiet des<br />
Niger-Binnendeltas mit seinen riesigen Überschwemmungsebenen (Vgl. Barth 1977, 150).<br />
Reis hat sehr spezifische Ansprüche an den Wasserhaushalt und die Böden. „Die<br />
Verfügbarkeit von Wasser in ausreichender Menge und zum richtigen Zeitpunkt ist eine<br />
der wichtigsten Voraussetzungen, die über Erfolg oder Misserfolg der Nassreiskultur<br />
entscheiden“ (ebda.).<br />
3.5. Erdnüsse<br />
Der Anbau von Erdnüssen findet schwerpunktmäßig in den südwestlichen Landesteilen<br />
zwischen Bamako und Kayes statt. Neben Baumwolle das wichtigste Agrarprodukt, das<br />
als „cash crop“ exportiert oder im Land verarbeitet wird. Feuchtsavanne und südliche<br />
Trockensavanne bieten günstige Bedingungen hinsichtlich der Anforderungen der<br />
Erdnusspflanze. Relative Sicherheit im Niederschlagsgang, richtige Terminierung von Saat<br />
60
und Ernte in Abhängigkeit vom Niederschlag und ausgeglichene Wasserversorgung in der<br />
Wachstumsphase sind daher ertragswirksame Voraussetzungen: fallen in der Reifezeit<br />
noch Niederschläge, so bedeutet eine „feuchte“ Ernte erhebliche Einbußen. Leichte,<br />
sandige Lehmsubstratböden ohne Wasserstaueigenschaften und gute Dränierung sind<br />
Voraussetzung, ebenso wie ein gutes Nährstoffangebot (Vgl. Barth 1977, 151).<br />
3.6. Baumwolle<br />
Die Baumwolle ist, wie die Erdnuss, ebenfalls als „cash crop“ zu bezeichnen. Die<br />
Hauptanbaumöglichkeit ist auf den Süden des Landes beschränkt. Das Feuchteangebot<br />
nach Dauer und Verteilung ist ein wesentliches Kriterium, die den Zeitpunkt der Ernte<br />
bestimmen und über den Ertrag entscheidet. Hinzu kommt die Voraussetzung gut<br />
dränierter und durchlüfteter Böden mit guten Speichereigenschaften (Vgl. Barth, 1977,<br />
151-152).<br />
3.6.1. Baumwollproduktion für den Weltmarkt: verzerrter Wettbewerb und<br />
die Folgen für <strong>Mali</strong><br />
Laut FAO Production Yearbook belegt China weltweit Platz 1 der Rangliste der<br />
Produzenten von Baumwollfaser. Dies verweist auf die enorme wirtschaftsstrategische<br />
Rolle der Baumwolle in den Schwellenländer Asien. Auch die enorme, vom Staat<br />
subventionierte US-amerikanische Baumwollproduktion ist die Grundlage für eine auf<br />
weltweiten Absatz ausgerichtete Textilherstellung (Vgl. Krings 2004, 28).<br />
Auf dem Hintergrund der Machtstellung der großen amerikanischen und asiatischen<br />
Baumwollproduzenten ist es sehr erstaunlich, dass sich auch in den am wenigsten<br />
entwickelten Ländern Afrikas die Baumwollproduktion äußerst dynamisch entwickelt hat.<br />
Auf der Ministerkonferenz der WTO 2003 in Cancún waren die Agrarsubventionen der<br />
EU und der USA eines der Hauptgesprächsthemen. Die Schwellenländer und<br />
afrikanischen Baumwollerzeugerländer forderten eine konkrete Zusage zum Abbau der<br />
Exportsubventionen.<br />
Die afrikanischen Erzeugerländer, von denen die meisten der Gruppe der LDC (least<br />
developed countries) gehören, können Baumwolle häufig um 50 % billiger als die USA<br />
produzieren, sind aber wegen der hohen Subventionen nicht wettbewerbsfähig. Die<br />
Subventionen gepaart mit einem hohem $-Kurs führten 2000/1 zu den niedrigsten<br />
Weltmarktpreisen seit 30 Jahren, was für die afrikanischen Länder rund 30 % der<br />
Exporteinnahmen, mehr als 60 % der agrarischen Exporterlöse und bis zu 10 % der BIP<br />
ausmachten. Dies hatte große Folgen für Kleinbauern. Mehrere Entwicklungsländer<br />
reagierten auf die Forderungen ihrer Kleinbauern nach einer besseren Vertretung ihrer<br />
Interessen in der WTO (ebda.).<br />
Baumwolle wurde in <strong>Mali</strong> in den vergangenen Jahren nach Gold zum wichtigsten<br />
Exportprodukt. Etwa 60 % des malischen Exporterlöses kommt aus der Baumwollproduktion.<br />
Die in den westafrikanischen Ländern produzierte Baumwolle ist von sehr guter Qualität,<br />
da sie von Hand gepflückt wird und somit nicht so stark verunreinigt ist wie die<br />
61
mechanisch geerntete Baumwolle (Vgl. Krings 2004, 30). Der Baumwollanbau findet in<br />
kleinen und mittleren Familienbetrieben statt. Die Baumwollanbaugebiete gehören zu den<br />
ländlichen Gebieten mit dem höchsten Entwicklungsstand des Landes. Infolge der<br />
überdurchschnittlichen hohen Einkommen, verfügen viele Haushalte über einen oder<br />
mehrere Pflüge oder Ochsen. Die Baumwolle bildet darüber hinaus die Grundlage der<br />
Agroindustrie in <strong>Mali</strong>: Baumwollentkörnungsfabriken, Baumwoll-Ölmühlen.<br />
Abb. 1: Geographische Rundschau 11/2004, 32.<br />
Die beachtlichen Produktionssteigerungen im Baumwollanbau sind weniger das Ergebnis<br />
der Erhöhung der Flächenproduktivität als vielmehr durch die jahrzehntelange<br />
Ausdehnung der Ackerflächen bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Brachlandanteils<br />
erreicht. Hinzu kommt, dass seit einigen Jahren der Mineraldünger in <strong>Mali</strong> nicht mehr<br />
staatlich subventioniert wird, und so die Bodenfruchtbarkeit auf sehr vielen Ackerflächen<br />
abnimmt.<br />
Des Weiteren besteht die Gefahr, dass bei anhaltend hohem natürlichem Bevölkerungswachstum<br />
von 2,5 – 3 % pro Jahr eine notwendige weitere Steigerung der Nahrungsmittelproduktion<br />
im Regenfeldbau in den kommenden Jahrzehnten zumindest sehr<br />
wahrscheinlich wird (Vgl. Krings 2004, 31).<br />
Die rasante Entwicklung des Baumwollanbaus führt in <strong>Mali</strong> und anderen westafrikanischen<br />
Baumwoll-Erzeugerländern nicht nur zu ökologischen, sondern auch zu<br />
einer Reihe sozioökonomischer, Probleme:<br />
1. Notwendigkeit von Bargeld durch den Baumwollanbau zu erwirtschaften<br />
begünstigt die größeren Betriebseinheiten. Am schlechtesten gestellt sind die<br />
Zwergbetriebe ohne nennenswerte Mechanisierung<br />
2. In <strong>Mali</strong> ergeben sich neue Konflikte aufgrund einer erfolgreichen Alphabetisierung<br />
der Kleinbauern. Autorität der Alten wird untermindert<br />
3. Der Sturz des malischen Staatschef Moussa Traoré 1991 führte zu einer<br />
politischen Liberalisierung (Baumwollstreik 1998: Produktionseinbrüche)<br />
62
4. Bodenspekulationen im Umkreis der schnellwachsenden städtischen Zentren<br />
Sikasso und Koutiala. Nur diejenigen Akteure, die über einen legalen<br />
Eigentumstitel an Grund und Boden verfügen, können die höchsten Bodenrenten<br />
durch Verpachtung, Verkauf von Bauland oder durch den Baumwollanbau<br />
realisieren. (ebda.).<br />
Fazit: In den Trocken- und Feuchtsavannen hat die Baumwolle eine zentrale ökonomische<br />
Bedeutung zu Erwirtschaftung benötigter Devisen. Für viele Menschen im<br />
ländlichen Raum bildet der Verkauf von Rohbaumwolle die wichtigste Einkommensquelle.<br />
Vorteile: Baumwollgebiete haben einen allgemeinen Entwicklungsstand hinsichtlich<br />
Nahrungssicherheit, Bildung und Gesundheit, der wesentlich höher liegt als in Gebieten<br />
ohne Baumwollanbau.<br />
Die Nachteile sind Bodenerschöpfungen, Bodendegradation, flächenhafte Rodung und der<br />
Verlust von Brachflächen.<br />
Maßnahmen:<br />
1. Einführung von Boden konservierenden Maßnahmen<br />
2. Erhöhtes Verantwortungsbewusstsein der „großen“ Erzeugerländer hinsichtlich<br />
der Gewährung von fairen Zugangschancen zum Weltmarkt (ebda.).<br />
3.7. Spezialkulturen<br />
Die Feucht- und Trockensavanne eröffnen eine Vielzahl von Anbaumöglichkeiten für eine<br />
Vielzahl von Kulturarten. Der Gemüseanbau ist für viele Anbauer mittlerweile<br />
Haupterwerbszweig. An erster Stelle stehen Tomaten und Zwiebeln, es folgt Gombo. In<br />
städtischen Bereichen werden außerdem Karotten, Kohl, Rote Beete sowie lokale Tee-<br />
und Gewürzpflanzen angebaut. Des Weiteren die Stärkefrucht Batate und die<br />
Eiweißpflanze Augen- oder Niébé-Bohne. Auch Obstkulturen, wie Mango-Bäume,<br />
Limonen und Orangen, vereinzelt Bananen und Datteln aus den Oasen des Nordens, sind<br />
anzufinden (Vgl. Barth 1986, 133).<br />
4. Probleme der Landwirtschaft in der Savanne<br />
Das ökologische Potenzial der Savannengebiete bleibt durch das spezifische Klimageschehen,<br />
durch die Hemmnisse mangelnder Bodenfruchtbarkeit, durch die<br />
Empfindsamkeit in der Reaktion des Naturhaushalts gegenüber menschlichen Eingriffen<br />
beschränkt. Eine großräumige intensivierte Agroindustrie nach europäischen oder USamerikanischen<br />
Muster ist, selbst bei Vorhandensein entsprechender Investitionsmitteln<br />
sowie Bereitschaft und Know-how unter der landwirtschaftlichen Bevölkerung, nicht<br />
möglich. Eine Verbesserung agrarwirtschaftlicher Produktion erscheint nur dann möglich,<br />
wenn entsprechende Maßnahmen und Veränderungen schrittweise und in vorsichtiger<br />
Anpassung an die jeweiligen kleinräumigen Besonderheiten im Naturhaushalt erfolgen<br />
(Vgl. Barth 1986, 152).<br />
63
4.1. Die sahelischen Regionen<br />
Der Sahel ist der „Übergangsraum“ von den Wüsten und Halbwüsten zu den trockenen<br />
und wechselfeuchten Savannen. Die Vegetationszone des Sahel wird vereinfachend mit<br />
der Bezeichnung Dorn- oder Dornbuschsavanne umschrieben. (Vgl. Barth 1986, 67). Die<br />
wird je nach klimatischer Situation und damit verbundener Pflanzendichte in einen Nord-<br />
und Süd-Sahel unterteilt:<br />
Die Nördliche Region ist bereits saharisch geprägt. Niederschläge erreichen hier nur<br />
noch 100 – 200 mm auf 1 – 2 Monate verteilt. Es gibt große vegetationsfreie Flächen mit<br />
fließendem Übergang in den Wüstenbereich. Es überwiegt die Dornbuschsteppe, in der<br />
Bäume zurücktreten und nur noch in Wadiflächen vorkommen. (Vgl. Barth 1986, 68).<br />
Ausgedehnte Grasflächen kommen im Nordbereich kaum noch vor und werden<br />
hauptsächlich von einjährigen Gräsern bestimmt (Vgl. Barth 1977, 154-155).<br />
In der südlichen Region, die heute zwischen 200 – 400 mm Niederschlag erhält, nimmt<br />
wegen der besseren Niederschlagsverteilung über 2 – 3 Monate der natürliche<br />
Baumbewuchs zu. weiter enthält diese Zone größere, zusammenhängende Weideflächen<br />
mit saheltypischen Gräsern. (Vgl. Barth 1986, 68). Es wird hier von einer Dorn- oder<br />
Trockensavanne gesprochen oder einer Baum-Busch-Steppe. Die biogeografische<br />
Zonierung kann allerdings nicht klar abgegrenzt werden (ebda.).<br />
5. Bewässerungswirtschaft<br />
Hauptkultur entlang des Nigers ist, auf den Überflutungsflächen, der Nassreisanbau. Die<br />
Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen sind eng mit dem Rhythmus des<br />
Wasserstandes verbunden. „Hydrologische Bestimmungsgrößen sind das Einsetzen, die<br />
Dauer und Höhe der Überschwemmung, sowie die Intensität und Verteilung der ersten<br />
Regenfälle“ (Barth 1986, 121). Je nach Vegetationszeit und Wassertiefe der Überflutungszone<br />
werden verschiedene Reissorten mit unterschiedlichen Methoden angebaut. Die<br />
tonreichen Überschwemmungsböden werden, da sie nur schwer zu bearbeiten sind,<br />
vielfach erst nach Einsetzen der ersten Starkregenfälle oder aber kurz nach Ablaufen des<br />
Wassers und entsprechendem Restfeuchtegehalt, schon früher umgebrochen (Vgl. Barth<br />
1986, 124). Gegen eine zeitige Bearbeitung spricht jedoch, die Nutzung der abgeernteten<br />
Reisflächen und der angrenzenden Schilf- und Wildbewuchsbereiche als Viehweide in der<br />
Trockenzeit (ebda.).<br />
Die Sortenwahl richtet sich in erster Linie nach den vorherrschenden Niger-<br />
Flutverhältnissen. Aus Gründen der Ertragssicherheit überwiegt der Anteil von<br />
Spätsorten. Allerdings sind die Flächen der Frühsorten sehr begehrt, da auf diese Weise<br />
die mangelnder Getreideversorgung abkürzt werden kann.<br />
Neben der Unterscheidung nach der Vegetationszeit können die Sorten auch nach ihrer<br />
Strohlänge unterschieden werden. Die anfallenden Strohmengen werden als zusätzliche<br />
Viehfutterquelle genutzt (Vgl. Barth 1986, 125).<br />
64
5.1. Gebiete der Bewässerungswirtschaft<br />
Bewässerung wird betrieben, um die für die semiariden Trockensavannen und die Sahel-<br />
Gebiete Unsicherheiten im Klimageschehen auszugleichen sowie den einen Anbau<br />
ausschließenden Niederschlagsmangel des nördlichen Sahel und der Wüstenrandgebiete<br />
zu ersetzen.<br />
Das Potenzial an Oberflächengewässern ist überraschend groß. Dennoch steht deren<br />
Nutzung noch in den Anfängen. Bislang werden weder Grund- noch Oberflächenwässer<br />
in ihrem Potential ausgeschöpft, da dies mit entsprechenden Anforderungen an<br />
Infrastruktureinrichtungen, Agrar- und Bewässerungstechnik hohen Kapitalaufwand<br />
voraussetzt, den zu erbringen weder Regierung noch die bäuerliche Bevölkerung in der<br />
Lage ist (Vgl. Barth 1977, 159).<br />
5.2. Oberflächengewässer<br />
Der Gesamtraum <strong>Mali</strong>s ist durch Niger und Senegal beherrscht. Da diese erheblichen<br />
Wasserstandsschwankungen unterliegen, gestaltet sich eine Nutzbarmachung schwierig.<br />
Hohe Wasserstands- und Schüttungsunterschiede im jahreszeitlichen Ablauf müssten, um<br />
das Abflusswasser einer Nutzung in Bewässerungskulturen zuzuführen, durch<br />
Stromverbauungen aufgefangen werden. Dies ist allerdings durch geomorphologische und<br />
topografische Gegebenheiten äußerst schwierig und mit hohem Kostenaufwand<br />
verbunden (Vgl. Barth 1977, 159-160). Im Planungsstadium befinden sich im Sahel-Gebiet<br />
gelegen zwei Stauwerke, die auf die Bewässerungskultur des Nigers abzielen. Diese<br />
beiden Vorhaben sollen auf lange Sicht die sozioökonomische und infrastrukturelle<br />
prekäre Situation der Nordregion <strong>Mali</strong>s verbessern. So soll das Nigertal unterhalb<br />
Timbuktus vor allem für Weizen- und Reisanbau erschlossen werden.<br />
Probleme:<br />
1. erhebliche Teile des Überschwemmungsgebietes im Binnendelta werden nicht<br />
mehr erreicht.<br />
2. Traditioneller Fischfang und Reisanbau zahlloser Dorfgemeinschaften im Delta<br />
bedroht<br />
3. Auf frühere Hochwasserspiegel eingestellte Schleusen und Kanäle außer Funktion<br />
gesetzt (Vgl. Barth 1977, 162-163).<br />
Unter diesem Aspekt gewinnen Alternativen zu solchen großen Projekten an Bedeutung.<br />
Eine Vielzahl kleiner weniger spektakulärer, dafür aber effektiver, finanziell überschaubarer<br />
und vor allem geoökologisch kontrollierbarer Vorhaben, wurden bereits mehrfach<br />
in verschiedenen Teilen des Landes erfolgreich realisiert.<br />
Beispiel: In Kamankolé unterhalb Kayes wurden auf einer oberen Uferterrasse am<br />
Senegal mit geringem finanziellen Auswand eine Bewässerungsfläche von 5 ha erschlossen<br />
und unter 20 Bauern verteilt.<br />
Demnach haben sowohl Trockensavanne als auch der Sahel gleichermaßen ein<br />
hervorragendes Potential in der Nutzung von Oberflächenwässern für Bewässerungszwecke<br />
• Nutzeffekt kleinerer Vorhaben<br />
• Minimale Kapitalintensität<br />
65
• Praktikabel und überschaubar<br />
• Anwendbarkeit traditioneller Methoden<br />
• Anpassung der Agrarproduktion an die herkömmlichen Sozialstrukturen der<br />
Dorfgemeinschaften (ebda.).<br />
Hinzu kommt, dass die geoökologische Gefährdung des Naturpotentials und Vorgänge<br />
der Desertifikation im Rahmen kleinräumiger Eingriffe in den Naturhaushalt weit geringer<br />
und kontrollierbarer sind als dies bei großflächigem Vorhaben der Fall ist und somit<br />
Klein- und Kleinstprojekten Vorzug zu geben ist.<br />
6. Weidewirtschaft und Tierhaltung<br />
Abnehmende Niederschläge und zunehmende Niederschlagsvariabilität im Übergangsgebiet<br />
der nördlichen Trockensavanne zur südlichen sahelischen Zone machen<br />
Regenfeldbau nur noch beschränkt möglich und somit gewinnt die Tierhaltung an<br />
Bedeutung. Außerdem hat hier die Tsetsefliege keinen Einfluss mehr. Besonders in den<br />
nördlichen Sahel- und Wüstenrandgebieten stellt die Weidewirtschaft die einzige<br />
Lebensgrundlage der Bevölkerung dar (Vgl. Barth 1977, 154).<br />
Neben der weitverbreiteten Rinderzucht sind insbesondere die Haltung von Schafen und<br />
Ziegen von Bedeutung. Insgesamt handelt es sich hierbei um sehr extensive Formen der<br />
Viehwirtschaft, die vor allem von (Halb-)Nomaden praktiziert wird (ebda.).<br />
Bedingt durch den klimatischen Rhythmus zwischen langanhaltender Trocken- und<br />
kurzer Feuchtperiode unterliegt das Futterangebot der natürlichen Weiden außerordentlichen<br />
Schwankungen<br />
Während im nördlichen Sahel weniger als 30 % der Oberfläche von Vegetation bedeckt<br />
sind, ist eine geschlossene Rasengesellschaft vor allem für die südlichen Sahel-Gebiete<br />
während der Regenzeit kennzeichnend. Aus diesem Grunde sind große Wanderbewegungen<br />
der Weidetiere notwendig. (ebda.).<br />
Je nach Vegetationsentwicklung und –dichte variieren Futterwert und Weidequalität. Das<br />
Problem: bei der Unsicherheit des Vegetationsangebotes und dem schwankenden<br />
weidewirtschaftlichen Nutzungspotentials kann es sich bei dem sahelischen Weidewirtschaftssystem<br />
nicht um eine optimale, regelmäßige und das Naturpotential<br />
aufrechterhaltende bzw. fördernde Viehwirtschaft handeln. Vielmehr erfordert das<br />
während der Trockenzeit geringe Futterangebot einen Weidegang unter extremen<br />
Temperaturbedingungen und verursacht eine unregelmäßige Produktivität (Gewicht und<br />
Zahl der Weidetiere stark schwankend). In der Hoffnung auf günstigere Weidebedingungen<br />
im darauffolgenden Jahr wird der Viehbestand, der nach wie vor als soziales<br />
Statuskriterium gilt, unter allen Umständen aufrechterhalten. (Vgl. Sturm 1999, 270).<br />
66
Abb. 2: Geographische Rundschau 05/1999, 271.<br />
Während der 60er Jahre kam es zu einer Ausstockung der Viehbestände vor allem der<br />
Rinder und Schafe. Die Gründe hierfür liegen nicht nur bei den relativ günstigen<br />
Niederschlagsverhältnisse dieser Zeitperiode, sondern auch bei den von der Regierung<br />
verfolgten Entwicklungsintensionen, da die Viehzucht einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor<br />
darstellt. Zum Beispiel wurden die veterinärmedizinische Betreuung und der<br />
Ausbau von Brunnen gefördert. Dazu kam Zunahme der Bevölkerung die mit der<br />
Vergrößerung der Herden konform ging.<br />
Die absolute Zahl der Weidetiere täuscht eine außerordentlich geringe Herdenwanderung<br />
vor, da auf traditionell festgelegten Wanderwegen getrieben wird<br />
(Weiseachsen statt Weideräume) (Vgl. Sturm 1999, 271).<br />
Tierhaltung hat eine besondere Bedeutung vor allem für die Ethnie der Songhay.<br />
Rund 30 % der Familien haben Rindvieh – 1-3 Tiere pro Familie<br />
Knapp 70 % besitzen Ziegen und Schafe – 3-5 Tiere sind die Regel<br />
Geweidet wird in Gemeinschaftsherden auf den abgeernteten Reisflächen (Vgl. Barth<br />
1986, 133).<br />
Neben der Landwirtschaft spielt auch die Forstwirtschaft, der Fischfang, Bergbau und die<br />
Sammelwirtschaft eine Rolle, die allerdings eher untergeordnet ist.<br />
67
7. Sammelwirtschaft und Schilfgrasnutzung<br />
Die Sammelwirtschaft und die Schilfgrasnutzung spielen bei der ländlichen Bevölkerung<br />
eine erhebliche Rolle als Ergänzungsernte zur Anhebung der Selbstversorgung. An erster<br />
Stelle stehen Wildgrassamen. Die Bereitschaft zur Sammelwirtschaft richtet sich nach der<br />
jeweiligen Ertragssituation der Hauptkultur. Ein Beispiel für Sammelwirtschaft stellt die<br />
Palmblatternte zur Mattenherstellung dar (Vgl. Barth 1986, 128). Weitere wichtige<br />
Sammelprodukte: Baumfrüchte, wie Jujube oder Tamarinden. Diese Sammelfrüchte<br />
stellen für die Bevölkerung als Nahrung und Marktfrucht eine große Bedeutung dar. Dies<br />
gilt insbesondere auch für die nomadischen Volksgruppen (ebda.).<br />
8. Fischfang<br />
Das ca. 20000 km² große Überflutungsarenal, das aus zahllosen Niger- und Bani-<br />
Flußarmen zusammengesetzte Flußlandschaft der Deltaregion stellt ein hervorragendes<br />
Potential für den Fischfang dar (Vgl. Barth 1977, 173).<br />
Der Fischfang konzentriert sich auf die Songhay-Fraktion der „Sorko“ und die Ethnie der<br />
„Bozo“, die im Fischfang ihren Haupterwerb sehen (Vgl. Barth 1986, 135). Der<br />
periodisch wiederkehrende Wechsel von Hochwasser, Hochwasserrückgang und<br />
Niedrigwasser im Jahresverlauf beherrscht den Lebensrhythmus der Fischer.<br />
Vor dem Hintergrund des generellen Eiweißmangels in der Ernährung großer Teile der<br />
Bevölkerung sowie bei der tragenden Bedeutung des Fisches im Außenhandel des Landes,<br />
vor allem aber auch im Hinblick auf die ca. 200000 Menschen, deren einzige<br />
Lebensgrundlage im Fischfang und –handel besteht, ist die rückläufige Tendenz der<br />
Fangzahlen bedrohlich. Der Grund dafür ist in der extremen Überfischung der Delta-<br />
Gewässer und starke Ausweitung der Reiskultur zu sehen. Hinzu kommt eine verstärkte<br />
Hinwendung anderer Bevölkerungsgruppen zum Fischfang die eine zunehmende<br />
Liberalisierung der Fangpraxis zu Folge hat. Dies wirkt sich nachteilig sowohl auf die<br />
Fangzeiten als auch Fanggeräte und Fanggebiete aus (ebda.).<br />
Um die Potentiale auch in Zukunft nutzen zu können, müssen bestimmte Maßnahmen<br />
ergriffen werden, um besonders in der Trockenzeit und als wichtige Quelle für das<br />
notwenige Einkommen zu sorgen:<br />
- Einhaltung von Schon- und Fangzeiten<br />
- Benutzung von Netzen genormter Maschenweite<br />
- Einschränkung der Zahl vergebener Lizenzen (Vgl. Barth 1977, 177).<br />
9. Desertifikation<br />
Desertifikation ist eines der größten Probleme im Sahel. In <strong>Mali</strong> betraf sie bereits 1986<br />
knapp 60 % der Landesfläche, wobei 50 % von dauerhafter Wüstenbildung bedroht ist.<br />
Allein von 1976 – 1986 betrug die Wüstenausdehnung im Norden des Landes ca. 50 –<br />
100 km in Richtung Süden. Die führt zu erschwerten Bedingungen, sinkender Erträge und<br />
mangelnder Wasser- und Nahrungsversorgung. Es kommt zu:<br />
Flächenausdehnung und Aufhebung der Brache sowie zu einer Übernutzung von<br />
68
Weidearealen und Sammelflächen für Wildgräser. Dies führt zu einer Konkurrenz unter<br />
den dortigen Nomaden-Gruppen.<br />
Im nigernahen Bereich sind die Auswirkungen der Desertifikation zum Teil besonders<br />
deutlich. Hier kommt es verstärkt zur Bildung von wandernden Dünen. Die damit<br />
verbundenen Verwehungen führen zu einem erheblichen Abtrag des fruchtbaren<br />
Oberbodens und der wenig inkorporierten Humusanteile.<br />
Ein großes Problem ist außerdem die (landesweite) Feuerholzknappheit und die damit<br />
verbundene Abholzung. In <strong>Mali</strong> sind 80 % der Bevölkerung auf Feuerholz als<br />
Energiequelle angewiesen. Die Ursachen für diese Unterversorgung der Bevölkerung<br />
können ist der Regel in den dem Naturpotential nicht angepassten Nutzungsformen<br />
gesehen werden. In deren Verlauf treten mit Vegetationsvernichtung, Bodenerosion,<br />
Veränderungen im Wasserhaushalt sowie Meso- und Mikroklima Selbstverstärkungseffekte<br />
ein, die den Lebensraum insgesamt gefährden.<br />
Gründe für die Ausbreitung der Desertifikation im Sahel:<br />
Geofaktoren:<br />
• Niederschlagsvariabilität<br />
• Sinkender Grundwasserspiegel<br />
• Nährstoffarme Böden<br />
• Hohe Evapotranspiration<br />
• Lose bzw. abnehmende Vegetationsdecke<br />
Interne Faktoren:<br />
• Aufgabe traditioneller, langfristig orientierter Landnutzungssysteme und lokaler<br />
Weidewirtschaftssysteme<br />
• Land- und Bodenverknappung<br />
• Holz als hauptsächliche Energiequelle<br />
• Unangepasste Bewässerungsmethoden im Bewässerungsfeldbau<br />
• Bevölkerungswachstum<br />
Externe Faktoren:<br />
• Weltmarktorientierung und Weltmarktpreisschwankungen<br />
• Zunehmende technologische Schere zwischen Afrika und Westen<br />
• Exportproduktion<br />
• Welthandelsbedingungen (Vgl. Hammer 2000, 5).<br />
69
70<br />
Nordafrika Sahel Südafrika Andere<br />
Gebiete<br />
gesamt<br />
Überweidung 27,7 118,8 44 3,9 194,4<br />
Landwirtschaft 8,6 34,8 12,8 4,2 60,4<br />
Übernutzung 0,2 54,2 1,1 0 55,5<br />
Entwaldung 4,3 16,3 0,7 0,7 22<br />
gesamt 40,8 224,1 58,6 8,8 332,3<br />
Abb. 3: Geographische Rundschau 11/2000, 5 nach UNEP 1997, 71.<br />
Erste konkrete Anläufe zur Bekämpfung der Desertifikation wurden mit der 1992 in Rio<br />
geführten „United Nations Conference on Environment und Development“ begonnen.<br />
Primär auf Druck Afrikas wurde in Kapitel 12 der Agenda 21 die Forderung verankert,<br />
eine internationale, völkerrechtlich verbindliche Konvention vorzubereiten (Vgl. Hammer<br />
2000, 4).<br />
Seit Anfang der 90er ist das Ziel eine kohärente Entwicklungspolitik gegenüber dem<br />
ländlichen Raum und eine Verbesserung struktureller Bedingungen auf den<br />
unterschiedlichen räumlichen Maßstabsebenen zu erwirken. Für Afrika verlangte die<br />
Konvention die Ausarbeitung regionaler Aktionsprogramme, wobei ein Prozess von<br />
unten nach oben vorgesehen ist:<br />
Die ökologischen Veränderungen, verbunden mit den ökonomischen infrastrukturellen<br />
Rahmenbedingungen, führen in <strong>Mali</strong> zu wechselseitigen, desertifikationsauslösenden oder<br />
–beschleunigenden Entwicklungen:<br />
1. <strong>Mali</strong> ist einseitig von einer traditionell extensiven Landwirtschaft abhänging<br />
2. Keine gute Verbindung zu produktiven Regionen<br />
3. Abnahme der durchschnittlichen Niederschlagemenge<br />
4. Abnahme der Nigerfluthöhe und –flutdauer zur Reduzierung der Überflutungs-<br />
Reisflächen der Weidezonen<br />
5. Gebietsweise Zunahme der Bevölkerung<br />
6. Übernutzung der Weiseflächen und Sammelgebiete<br />
7. Zunahme der Sandstürme (ebda.).<br />
9.1. Nachhaltige Desertifikationsbekämpfung<br />
Seit den 80ern gibt es verschiedene Projekte zur Desertifikationsbekämpfung. Ziel ist<br />
eine nachhaltige Wirkung der Ressourcenschutzmaßnahmen, durch Erhöhung der<br />
Eigenverantwortung auf Dorfebene, zu erreichen sowie eine Absicherung der<br />
Landnutzungsrechte. Entscheidend ist die Beteiligung der Dorfbevölkerung an
Entscheidungen, Planung und Ausführung (Vgl. Krings 1994, 546).<br />
Eine Möglichkeit ist in der Erstellung von Bankettenfeldern zu sehen. Das Problem:<br />
aufgrund fehlender Eigentumstitel gibt es nur geringes Interesse an längerfristig<br />
konservierenden Maßnahmen.<br />
In Bla wurde keine der Maßnahmen, wie z. B. der Bau von Steinwällen, von den Bauern<br />
selbst aufgegriffen. Dies führte zu mangelnder Akzeptanz. Gründe:<br />
• Die Projekte führen erst nach mehreren Jahren zum Erfolg<br />
• Der Verbesserungseffekt steht in einem ungünstigen Verhältnis zum notwendigen<br />
Arbeitsaufwand<br />
• Es herrscht im Gebiet von Bla keine Landknappheit, so dass bei Erosionsschäden<br />
Ausweichflächen vorhanden sind. (Vgl. Krings 1994, 549).<br />
71
Literaturverzeichnis<br />
ANHUF, Dieter 1990: Niederschlagsschwankungen und Anbauunsicherheit in der<br />
Sahelzone. Geographische Rundschau 42 (3), S. 152-158.<br />
BARTH, Hans Karl 1977: Der Geokomplex Sahel: Untersuchungen zur<br />
Landschaftsökologie im Sahel <strong>Mali</strong>s als Grundlage agrar- und weidewirtschaftlicher<br />
Entwicklungsplanung. Tübingen.<br />
BARTH, Hans Karl 1986: <strong>Mali</strong>. Eine geographische Landeskunde. Darmstadt.<br />
HAMMER, Thomas 2000: Desertifikation im Sahel. Geographische Rundschau 52 (11), S. 4-<br />
10.<br />
HAAS, Armin; Lohnert, Beate 1994: Ernährungssicherung in <strong>Mali</strong>. Geographische<br />
Rundschau 46 (10), S. 554-560.<br />
KRINGS, Thomas 1994: Probleme der Nachhaltigkeit in der Desertifikationsbekämpfung.<br />
Geographische Rundschau 46 (10), S. 546-552.<br />
KRINGS, Thomas 2004: Baumwollproduktion für den Weltmarkt: verzerrter Wettbewerb<br />
und die Folgen für <strong>Mali</strong>. Geographische Rundschau 56 (11), S. 26-33.<br />
STURM, Hans-Jürgen 1999: Weidewirtschaft in Westafrika. Geographische Rundschau 51<br />
(5), S. 269-274.<br />
72
Politische Entwicklung und<br />
politisches System<br />
des jungen Staates<br />
Sally Ollech<br />
73
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung: Nationale Symbole und Staatsform ...................................................................... 75<br />
2. Historischer Überblick................................................................................................................ 76<br />
2.1. 1960: I. Republik <strong>Mali</strong>........................................................................................................... 76<br />
2.2. 1968 Militärputsch und Militärdiktatur: II. Republik <strong>Mali</strong>............................................. 76<br />
2.3. 1991 Absetzung des Militärregimes und neue Verfassung: III. Republik <strong>Mali</strong> .......... 77<br />
3. Formaler Staatsaufbau ................................................................................................................. 78<br />
4. Genese von Zivilgesellschaft und Medienlandschaft ............................................................. 79<br />
5. Derzeitige Regierung ................................................................................................................... 79<br />
6. Demokratisierungsprozess......................................................................................................... 80<br />
7. Innenpolitische Themen.............................................................................................................. 81<br />
8. Außenpolitische Beziehungen .................................................................................................... 81<br />
9. Fazit: Versuch einer Bewertung ................................................................................................ 82<br />
74
1. Einleitung: Nationale Symbole und Staatsform<br />
Einleitend eine kurze Darstellung dreier nationaler Symbole von <strong>Mali</strong> (vgl. Seebörger,<br />
Flagge und andere nationale Symbole): Nationalhymne, Nationalflagge und Staatswappen<br />
sowie eine knappe Erläuterung der Präsidialdemokratie als Staatsform von <strong>Mali</strong> in<br />
Abgrenzung zu parlamentarischen Regierungssystemen.<br />
Der Text der Nationalhymne „Pour l’Afrique et pour toi <strong>Mali</strong>“ stellt die Umsetzung einer<br />
afrikanischen Einheit sowie die Verteidigung der malischen Nation in den Vordergrund.<br />
Neben dem französischen Text besteht auch eine Fassung in Bambara. Die Hymne wurde<br />
innerhalb der am 22.09.1960 durch Modibo Keita ausgerufenen, ersten unabhängigen<br />
Republik <strong>Mali</strong> im Jahr 1962 eingeführt. Der damalige Landwirtschaftsminister Badian<br />
Kouyaté verfasste den Text, während die Melodie von Banzoumana Sissoko komponiert<br />
wurde. Die Einführung einer Nationalhymne innerhalb der zweiten Hälfte des 20.<br />
Jahrhunderts ist für ehemalige Kolonien ein typischer Zeitpunkt, da nationale Symbole<br />
wie Hymne, Flagge und Staatswappen meist kurz nach der erlangten Unabhängigkeit<br />
eingeführt wurden.<br />
Die drei Farben der malischen Nationalflagge – grün, gelb, rot – stehen als Symbol für<br />
Hoffnung, Gold und das Gedenken an die im Kampf um die nationale Souveränität<br />
Gestorbenen.<br />
Das Staatswappen trägt die offizielle Staatsbezeichnung „République du <strong>Mali</strong>“ und<br />
darunter die Zeile „Un peuple, un but, une foi“, was übersetzt bedeutet „Ein Volk, ein<br />
Ziel, ein Glaube“. Des Weiteren sind drei Symbole abgebildet: ein in malischen Sagen<br />
vorkommender Geier, die berühmte Moschee von Djenné und ein Sonnenaufgang.<br />
Die Staatsform in <strong>Mali</strong> kann als ein Teil des kolonialen Erbes gesehen werden: Es handelt<br />
sich um eine Präsidialdemokratie und somit um ein Regierungssystem, in dem eine strikte<br />
Trennung zwischen gesetzgebender und ausführender Gewalt vorherrscht, an dessen<br />
Spitze der Präsident steht. Der malische Präsident ist Staatsoberhaupt, der<br />
Premierminister Regierungschef, gemeinsam bilden sie die Exekutive. Der Präsident und<br />
die Abgeordneten des Parlaments, der Volksvertretung, werden in freien und geheimen<br />
Wahlen für jeweils fünf Jahre direkt vom Volk gewählt.<br />
Den Gegensatz zum Präsidialsystem bilden parlamentarische Regierungssysteme, in<br />
denen die Regierung nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von der Mehrheit des<br />
Parlamentes bestimmt wird. Dabei handelt es sich folglich um eine repräsentative<br />
Demokratie, bei der die Regierung vom Vertrauen des Parlaments abhängig ist und eine<br />
enge Verknüpfung der Legislative und der Exekutive besteht – eine Kontrollfunktion<br />
erfüllt hier das Wechselspiel zwischen Regierungsmehrheit und Opposition im Parlament.<br />
Ein Hauptunterschied beider demokratischer Systeme liegt darin, dass es im<br />
Präsidialsystem häufig zu einer starken Personalisierung bei gleichzeitiger Endideologisierung<br />
der Politik kommt, bei der die Parteiprogramme tendenziell in den<br />
Hintergrund rücken und die jeweiligen Präsidentschaftskandidaten im Vordergrund<br />
stehen.<br />
75
2. Historischer Überblick<br />
2.1. 1960: I. Republik <strong>Mali</strong><br />
Nach der gescheiterten Föderation zwischen <strong>Mali</strong> und Senegal rief Modibo Keita am<br />
22.09.1960 die unabhängige Republik <strong>Mali</strong> aus. Der 22. September ist seither<br />
Nationalfeiertag. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs war in den französischen<br />
Kolonialgebieten Westafrikas ein wachsendes politisches Bewusstsein entstanden,<br />
welches im Jahr 1946 zur Gründung der Nationalbewegung „Rassemblement Démocratique<br />
Africain“ (RDA) geführt hatte (Seebörger, Geschichte und Staat). Einer der Führer<br />
der RDA war Modibo Keita, der 1960 erster Staatspräsident der Republik <strong>Mali</strong> wurde.<br />
Keitas Politik war am sozialistischen Lager orientiert. Es wurde eine zentrale Planung,<br />
Verstaatlichung sowie eine technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der UdSSR und<br />
der VR China verfolgt. Keita strebte eine Integration anderer politischer Parteien in die<br />
Regierungspartei „Union Soudanaise / Rassemblement Démocratique Africain“ (US-RDA)<br />
zu einer Art nationalen Front an und etablierte so ein sozialistisch orientiertes<br />
Einparteiensystem, das sich jedoch zu keinem Zeitpunkt fest stabilisieren konnte: Es kam<br />
zu Geldentwertung, Versorgungsengpässen, Nahrungsmittelknappheit, der Herausbildung<br />
eines Schwarzmarktes in allen Bereichen sowie zu Korruption (Treydte, Dicko, Doumbia<br />
2005, 6). Aufgrund dieser Entwicklung war <strong>Mali</strong> im Jahr 1967 nahezu gezwungen, wieder<br />
in die Franc-Zone zurückzukehren. Der Preis für die von Paris garantierte<br />
Währungsstabilität und den Kapitalzufluss aus Frankreich war hoch: Das Handelsmonopol<br />
der alten französischen Handelgenossenschaften wurde wieder eingeführt. Die<br />
Versorgungslage für den Großteil der Bevölkerung verbesserte sich dadurch nicht und es<br />
kam zu einer Radikalisierung politischer Lager innerhalb der US-RDA. 1967 wurde der<br />
Parteivorstand aufgelöst und ein Nationaler Rat zur Verteidigung der Revolution<br />
(CNDR) gegründet, unter dem sich totalitäre Instrumente wie Gesinnungspolizei sowie<br />
schwarze Listen entwickelten und Keita war nicht mehr in der Lage, diese Entwicklung zu<br />
lenken (Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 6).<br />
2.2. 1968 Militärputsch und Militärdiktatur: II. Republik <strong>Mali</strong><br />
Im November 1968 wurde das Regime von Modibo Keita durch einen Militärputsch einer<br />
Gruppe Offiziere um Moussa Traoré gestürzt. Es folgte eine Militärdiktatur unter dem<br />
Diktator Moussa Traoré, die bis 1991 andauern sollte. Nach einer siebenjährigen<br />
Übergangsphase wurde im Jahr 1974 unter Moussa Traoré die II. Republik <strong>Mali</strong><br />
eingeführt. Erneut etablierte sich mit der Partei „Union Démocratique du Peuple <strong>Mali</strong>en“<br />
(UDPM) ein Einparteiensystem, jedoch ohne sozialistische Ausrichtung der<br />
Wirtschaftspolitik. Dennoch blieben große, unproduktive Unternehmen und Bürokratien<br />
bestehen und es ging auch unter Traoré wirtschaftlich und sozial abwärts. Einem Bericht<br />
der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zu Folge, baute das Militär den Staat gewisser Weise in<br />
einen „Selbstbedienungsladen für Offiziere“ (Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 7) um. De<br />
Folgen waren Korruption und Villenakkumulation auf Seiten der nationalen Elite sowie<br />
auf Seiten der Arbeiter und Angestellten ausbleibende Löhne und Gehälter und vor allem<br />
76
innerhalb der gleichzeitig von der großen Sahel-Trockenheitsperioden betroffenen<br />
ländlichen Bevölkerungskreisen Hunger und Elend (Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 7).<br />
Verstärkt wurde diese Entwicklung durch drei von außen kommende Elemente (Treydte,<br />
Dicko, Doumbia 2005, 7): (1) Ab 1988 verordneten die Strukturanpassungsprogramme<br />
der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) dem malischen<br />
Militärregime eine Sparpolitik. (2) Eine Neuausrichtung der französischen Außenpolitik<br />
unter Mitterrand, welche im Juni 1990 Demokratiefortschritte im frankophonen Afrika<br />
forderte und französische Hilfe von Demokratisierungserfolgen abhängig machte. (3) Der<br />
Zusammenbruch der Sowjetunion sowie der Fall der Berliner Mauer führten zum Wegfall<br />
politischer Renten durch ideologisches Wechselwählertum im internationalen Kontext.<br />
2.3. 1991 Absetzung des Militärregimes und neue Verfassung: III. Republik <strong>Mali</strong><br />
Im Jahr 1991 kam es verstärkt zu Unruhen innerhalb der Bevölkerung, auf die das Regime<br />
mit Militäraktionen reagierte. Am 26.03.1991 wurde Moussa Traoré durch eine Gruppe<br />
Militärs unter Führung von Amadou Toumani Touré (populäre Kurzbezeichnung: ATT)<br />
abgesetzt. Im April 1991 wurde unter Touré ein Übergangskomitee für das Wohl des<br />
Volkes, „Comité de Transition pour le Salut du Peuple“ (CTSP), einberufen. Unter Touré<br />
begann ein politischer Transformationsprozess mit demokratischen Reformen. Im August<br />
1992 nahmen etwa 1.500 Delegierte an einer Nationalkonferenz in Bamako teil und die<br />
Erarbeitung einer neuen Verfassung sowie eines Wahlgesetzes begann, wodurch die Basis<br />
für das malische Mehrparteiensystem gelegt wurde (Seebörger, Entwicklung des heutigen<br />
Staates). Der Entwurf der neuen malischen Verfassung wurde am 12.02.1992<br />
verabschiedet und Anfang 1992 fand die erste freie Parlamentswahl in <strong>Mali</strong> statt, bei der<br />
die ADEMA-Partei als eindeutige Siegerin hervorging (Alliance pour la Démocratie<br />
<strong>Mali</strong>enne - Parti Africain pour la Solidarité de la Justice). Die ADEMA/PASJ ist „ein<br />
breites Sammelbecken politischer Meinungen und Multiplikatoren“ (Treydte, Dicko,<br />
Doumbia 2005, 12) und Mitglied der Sozialistischen Internationale, dem weltweiten<br />
Zusammenschluss von sozialistischen und sozialdemokratischen politischen Parteien, was<br />
wiederum eine grobe politische Einordnung der Partei ermöglicht.<br />
Alpha Oumar Konaré wurde als Kandidat der Regierungspartei ADEMA erster<br />
demokratisch gewählter Präsident von <strong>Mali</strong>. Im Jahr 1997 kam es zur zweiten<br />
Präsidentschaftswahl, welche die Wiederwahl Konarés beinhaltete. Im Jahr 2002 musste<br />
die ADEMA-Partei bei der dritten Parlamentswahl deutliche Verluste hinnehmen.<br />
Berichten zu Folge werden mögliche Gründe in parteiinternen Streitigkeiten und der<br />
Abspaltung eines Flügels sowie Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Misswirtschaft<br />
gesehen (Seebörger, Geschichte und Staat). Die dritte Präsidentschaftswahl im Mai 2002<br />
konnte der parteilose Amadou Toumani Touré mit 64 % der Stimmen für sich<br />
entscheiden und löste somit Konarés Präsidentschaft ab, der aufgrund der Verfassung<br />
ohnehin kein drittes Mal als Präsidentschaftskandidat antreten konnte. In einem Bericht<br />
der Friedrich-Ebert-Stiftung wird konstatiert, dass die Wahlbeteiligung mit 38,58 % der<br />
registrierten Wähler trotz mobiler Wahlbüros weit unter den Erwartungen blieb (Auga<br />
2002). Als ein möglicher Grund wird die verpflichtende Vorlage eines Personalausweises<br />
genannt: Laut FES-Bericht verfügen nur 30 % der <strong>Mali</strong>er über ein Ausweisdokument. Die<br />
Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen im Juli desselben Jahres war noch<br />
erschreckender: Sie lag bei 20 % der eingeschriebenen Wähler beim ersten und 14 %<br />
beim zweiten Wahlgang (Gierczynski-Bocandé, Lerch 2002). In dem Bericht der Konrad<br />
77
Adenauer Stiftung werden diese Negativ-Rekorde der Wahlbeteiligung auf die schlechte<br />
wirtschaftliche Entwicklung des Landes zurückgeführt, die dazu führe, dass die<br />
Bevölkerung das Vertrauen in die Politik verliert.<br />
Bei den Kommunalwahlen im Jahr 2004 war eine Wahlbeteiligung von 43,6 % zu<br />
verzeichnen, was als ein Erfolg der Wählermobilisierung durch den verstärkt<br />
eingeleiteten Dezentralisierungsprozess und die Förderung von politischem Engagement<br />
auf kommunaler Ebene gesehen werden kann (vgl. Gierczynski-Bocandé 2004).<br />
Im darauf folgenden Wahljahr 2007 wurde der Amtinhaber Touré mit 71,2 % der<br />
Stimmen wiedergewählt. Die besten Ergebnisse erzielte er in den nomadischen Regionen<br />
Timbuktu und Gao, während sein wichtigster Herausforderer Ibrahim Boubacar Keita<br />
vor allem in Bamako und Teilen Westmalis seine höchsten Stimmenanteile erzielte –<br />
insgesamt erhielt Keita 18,6 % der Stimmen in <strong>Mali</strong> (Seebörger, Wahlen). Des Weiteren<br />
bleibt zu vermerken, dass 2007 erstmals eine Frau unter den Präsidentschaftskandidaten<br />
war. Als problematisch galt vor allem die niedrige Wahlbeteiligung. Sie lag einem Bericht<br />
von InWent zu Folge bei der Präsidentschaftswahl im April 2007 bei 36 %. Internationale<br />
Wahlbeobachter bezeichneten die Wahlen im Jahr 2007 als fair.<br />
3. Formaler Staatsaufbau<br />
Der Grenzverlauf von <strong>Mali</strong> entspricht nach wie vor den Verwaltungsgrenzen der<br />
ehemaligen Teilkolonie Französisch-Sudan und vernachlässigt dabei geographische,<br />
ethnische oder sprachliche Einheiten. Der Staat ist in acht Regionen (Gao, Kayes, Kidal,<br />
Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, Timbuktu) und den Hauptstadtdistrikt Bamako<br />
aufgeteilt. Die acht zentralstaatlichen Verwaltungsregionen (régions) teilen sich in 49<br />
Kreise (cercles) und 703 Gemeinden (communes) als unterste Verwaltungsebene. Die<br />
malische Verwaltung besteht folglich aus vier Verwaltungsebenen: Zentralregierung,<br />
Regionalversammlungen, Kreisräte (conceils de cercle) und als unterste Machtebene die<br />
seit 1999 eingerichteten und von der wahlberechtigten Bevölkerung jeweils für fünf Jahre<br />
gewählten Gemeinderäte (conceils de commune). Diese dezentrale Struktur soll dazu<br />
beitragen, dass die Interessen der Gemeindebewohner Gehör finden (Seebörger,<br />
Formaler Staatsaufbau und Territorialverwaltung).<br />
Die Dezentralisierungspolitik gehört mit zu den wichtigsten Programmen der malischen<br />
Regierung und die Umsetzung stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Die<br />
malische Regierung hat zum Fernziel, dass die Gemeinden finanziell eigenständig sind<br />
(Kreditvergabe, eigenes Personal, Befugnis, Steuern zu erheben). Es wurde ein<br />
Förderungsministerium eingerichtet, welches die Förderung kommunaler Investitionen<br />
zur Aufgabe hat, um den Gemeinden mit Beratungs- und Fremdfinanzierungsoptionen zur<br />
Seite zu stehen (Seebörger, Wichtige politische Entscheidungen). Auf kommunaler Ebene<br />
sind aktuelle Themen vor allem die Armutsbekämpfung sowie die Frage der<br />
Flächennutzung.<br />
78
4. Genese von Zivilgesellschaft und Medienlandschaft<br />
Seit dem Sturz der Traoré-Diktatur im Jahr 1991 wird die Entwicklung der<br />
Zivilgesellschaft in Teilen der malischen Bevölkerung diskutiert. Tatsache ist, dass seit<br />
1991 die Zahl an gesellschaftlichen Vereinigungen, Interessensverbänden und<br />
Basisgruppen in <strong>Mali</strong> stark zugenommen hat (Seebörger, Zivilgesellschaft). Es<br />
entwickelten sich auf nationaler und regionaler Ebene Nichtregierungsorganisationen<br />
(NRO) und andere Interessensvertretungen und man kann diesbezüglich von der Genese<br />
einer Zivilgesellschaft sprechen. Allerdings weist der Verband Entwicklungspolitik<br />
Deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) in seinem Länderprofil <strong>Mali</strong> auf die<br />
Zweifel von einigen Beobachtern hin, dass die Vertreter der malischen Zivilgesellschaft<br />
eine breite Repräsentanz der Bevölkerung sicherstellen können. Es stellt sich die Frage,<br />
ob eine ausreichende Repräsentanz der Interessen der großen Bevölkerungsmehrheit mit<br />
geringer Bildung gewährleistet werden kann. Kritiker sprechen von einer relativ kleinen<br />
gebildeten Elite, welche den gesellschaftspolitischen Diskurs innerhalb des<br />
Regierungskreises sowie der nationalen Szene der NRO’s dominiert.<br />
Trotzdem hat sich seit 1991 in <strong>Mali</strong> eine vielfältige Medienlandschaft entwickelt. Vor<br />
allem in der Hauptstadt Bamako ist eine große Anzahl von Tageszeitungen erhältlich. Für<br />
die landesweite Informationsdistribution sind jedoch vor allem Hörfunkmedien<br />
entscheidend, da die Alphabetisierungsrate 2000-2005 bei Personen im Alter von 15<br />
Jahren und älter lediglich bei 24 % lag, bei männlichen Jugendlichen (15 – 24 Jahre, 2000-<br />
2006) bei 32 % sowie bei weiblichen Jugendlichen bei 17 % (Unicef, <strong>Mali</strong> Statistics).<br />
In <strong>Mali</strong> gibt es landesweit über 100 Radiostationen. Allerdings wird vielfach über<br />
Repressionen gegenüber kritisch berichtenden Journalisten geklagt und im letzten<br />
Präsidentschaftswahlkampf 2007 wurden Vorwürfe laut, dass die staatlichen Medien zu<br />
einseitig und pro-Touré berichtet hätten (vgl. Seebörger, Presse und andere öffentliche<br />
Medien).<br />
5. Derzeitige Regierung<br />
Seit Mai 2002 ist Amadou Toumani Touré Präsident von <strong>Mali</strong>. Im Jahr 2007 wurde<br />
Modibo Sidibé nach dem Rücktritt seines Vorgängers Premierminister. In der im<br />
Oktober 2007 neu gebildeten Regierung sind 27 Minister, darunter sieben Frauen. <strong>Mali</strong><br />
hat mit 27 Ministerien eine im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von 12,7 Mio. relativ<br />
große Anzahl an Ministerien (Seebörger, Staatsform, Verfassung und Gewaltenteilung).<br />
Zum Vergleich: Deutschland hat bei 82,2 Mio. Einwohnern lediglich 14 Ministerien<br />
(World Population Bureau 2008, 7 u. 10). Außerdem wird die Leistungsfähigkeit ebenso<br />
wie die Zusammenarbeit der einzelnen malischen Ministerien oft als begrenzt<br />
eingeschätzt.<br />
Es besteht ein Mehrparteiensystem in <strong>Mali</strong>. Von über 100 bestehenden Parteien sind<br />
derzeit 15 im Parlament vertreten. Diese 15 Parteien bilden zwei Parteienbündnisse: die<br />
ADP (Alliance pour la Démocratie et le Progès) und die FDR (Front pour la Démocratie<br />
et la République). Die APD ist ein Zusammenschluss von 12 Parteien, darunter die<br />
vorherige Regierungspartei (Alliance pour la Démocratie <strong>Mali</strong>enne) sowie die als<br />
Abspaltung aus der ADEMA hervorgegangene UDR (Union pour la Démocratie et le<br />
Déveleoppement). ADP und UDR gewannen bei der letzten Parlamentswahl im Juli 2007<br />
79
die meisten Stimmen, wobei die Wahlbeteiligung mit ca. 32 % wiederum als schwach<br />
einzustufen ist. Neben der ADEMA-Partei mit 51 Sitzen und der UDR mit 34 Sitzen sind<br />
verschiedene Parteien mit nur wenigen Abgeordneten und 15 Unabhängige im Parlament<br />
vertreten. Folglich ist die ADP weit stärker vertreten als die FDR (Seebörger,<br />
Machthaber und Machtgruppen). Eine Opposition ist somit nur schwach ausgeprägt.<br />
Außerdem stehen die meisten Parteien dem Präsidenten nahe. Eine Ausnahme bilden<br />
hier „Rassemblement pour le <strong>Mali</strong>” (RPM) mit acht Sitzen und „Solidarité Africain pour<br />
Démocratie et Indépendence“ (SADI) mit vier Sitzen (vgl. Auswärtiges Amt:<br />
Länderinformation <strong>Mali</strong>).<br />
6. Demokratisierungsprozess<br />
Betrachtet man den Demokratisierungsprozess in <strong>Mali</strong>, so stand am Anfang ein immer<br />
noch andauernder politischer Transformationsprozess, dessen Beginn in der<br />
Entkolonialisierung gesehen werden kann. Nach dem zweiten Weltkrieg gewährte<br />
Frankreich seinen Kolonien eine formelle Unabhängigkeit. Dass es zu dieser formellen<br />
Unabhängigkeit in den meisten Fällen ohne einen Befreiungskampf seitens der westafrikanischen<br />
Kolonien kam (Ausnahme Algerien; vgl. Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 4),<br />
begünstigte die Einbindung in die Communauté Francaise, die erst 1995 offiziell aufgelöst<br />
wurde. Mit dieser französischen Gemeinschaft handelte es sich um einen Staatenbund, in<br />
dem die ehemaligen französischen Kolonien „formal von Frankreich unabhängig wurden,<br />
politisch, wirtschaftlich und sozial hingegen am Tropf der Kolonialmacht hingen“<br />
(Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 4). Der Aufstieg der großen afrikanischen politischen<br />
Führer wie beispielsweise Modibo Keita und die allmähliche Genese des malischen<br />
Mehrparteiensystems ist auf diesem Hintergrund halb-autonomer Formen der<br />
Territorialverwaltung zu sehen.<br />
Die neue, jedoch zunächst nur formelle Unabhängigkeit, brachte einige Begleiterscheinungen<br />
mit sich (vgl. Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 4): zum einen die Erbschaft des<br />
Präsidialsystems und zum anderen eine Elitenbildung nach dem Muster der Entfremdung<br />
– hier wird häufig das 1952 erschienene Werk von Frantz Fanon als Vordenker der<br />
Entkolonialisierung zitiert: „Peau noire, masques blancs“, meint „Schwarze Haut, weiße<br />
Masken“, womit auf die ideologische Einflussnahme der Franzosen durch Bildungseinrichtungen<br />
während der Kolonialzeit angespielt wird. Weitere Begleiterscheinungen sind<br />
in dem festen Wechselkurs zwischen malischer (FCFA) und französischer Währung (FF<br />
bzw. EUR) zu sehen, bei der eine strukturelle Überbewertung zu beobachten war, einer<br />
wirtschaftlichen Abhängigkeit von Paris, verzerrten Export-/Importstrukturen, vehementer<br />
Defizite im Governance-Bereich in Form von Misswirtschaft und Korruption sowie<br />
einem demokratischen Defizit (vgl. Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 4). Diese<br />
Entwicklungen können darauf hindeuten, dass das neue politische System von oben<br />
aufgesetzt wurde und sich nicht aus sich heraus entwickelte.<br />
Neben dem historischen, bleibt im Hinblick auf den Demokratisierungsprozess auch der<br />
kulturelle Hintergrund zu berücksichtigen. Eine innerparteiliche Demokratie scheint in<br />
der traditionellen Umgebung der malischen Gesellschaft schwierig umsetzbar zu sein,<br />
denn traditionelle Wertesysteme beeinflussen weiterhin stark das Handeln. So spielen<br />
Altersstrukturen eine wichtige Rolle, junge Männer geben dem Patriarchen keine<br />
Widerworte, aber auch der Gender-Aspekt ist entscheidend, da Frauen im traditionellen<br />
Kontext nicht in der Öffentlichkeit sprechen (Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 10).<br />
80
Betrachtet man die Parteienlandschaft in <strong>Mali</strong>, so muss festgehalten werden, dass<br />
malische Parteien vielfach auf der Idee einer Führungspersönlichkeit und deren<br />
Anhänger basieren. Unterschiedliche Auffassungen führen zu einer Spaltung der ohnehin<br />
kleinen Partei. In unserem westlichen oder europäischen Demokratieverständnis kann<br />
eine innerparteiliche Demokratie ohne eine gewisse Breiten- oder Massenbasis jedoch<br />
nicht praktiziert werden.<br />
In <strong>Mali</strong> führte der äußere Druck unter dem Militärregime Moussa Traorés die Kritiker<br />
und Andersdenkenden zusammen. Folglich setzte mit der Demokratie auch ein fast<br />
natürlicher Zerfallsprozess der großen politischen Blöcke ein (Treydte, Dicko, Doumbia<br />
2005, 10). Nach dem Sturz der Militärdiktatur und rund 30 Jahren Einparteiensystem kam<br />
es zu einer regelrechten Explosion in der Parteienlandschaft. Einem Bericht der<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung zu Folge, wurde jedoch bei einer empirischen Untersuchung<br />
2004 festgestellt, dass nur 63 der 94 offiziell registrierten Parteien ausgemacht werden<br />
konnten (Treydte, Dicko, Doumbia 2005, 10). Häufige Kritik von internationalen<br />
Beobachtern ist das Fehlen von durchdachten und stringenten Partei- und Wahlprogrammen.<br />
Hinzu kommt das Phänomen der politischen Transhumance, was den<br />
häufigen Lagerwechsel einzelner Abgeordneter beschreibt. Entsprechend wechselhaft<br />
und personengebunden ist auch das Wählerverhalten (Treydte, Dicko, Doumbia 2005,<br />
10).<br />
7. Innenpolitische Themen<br />
Im Zentrum der innenpolitischen Themen stehen die Bekämpfung der Armut, die<br />
Förderung der Wirtschaftsentwicklung und die Konsolidierung des politischen Systems.<br />
Aber auch der Kampf gegen Korruption wurde ab dem Jahr 2000 zu einem wichtigen<br />
innenpolitischen Thema. Durch wiederkehrende Vorwürfe und mediale Aufdeckung von<br />
Korruptionsfällen berief die malische Regierung eine Antikorruptions-Kommission ein,<br />
die zum Teil erhebliche Fälle von Missmanagement und Korruption in einigen Regierungsinstitutionen<br />
dokumentiert (Seebörger, Korruption).<br />
Die Maßnahmen und Prozesse im Rahmen der Dezentralisierungspolitik sowie der<br />
Umgang mit der Konfliktzone Nordmali, die eine Lösung des Tuareg-Konfliktes fordert,<br />
gilt als kritische Bewährungsprobe der III. Republik.<br />
8. Außenpolitische Beziehungen<br />
<strong>Mali</strong>s Außenpolitik ist nicht ideologisch orientiert, sondern kann als pragmatisch<br />
ausgerichtet bezeichnet werden. Das wichtigste europäische Partnerland bleibt trotz<br />
temporärer Belastungen in den malisch-französischen Beziehungen die ehemalige<br />
Kolonialmacht Frankreich (Seebörger, Außenpolitische Themen). Im außenpolitischen<br />
Kontext mit Frankreich und der Europäischen Union werden Fragen bezüglich der<br />
Migration immer wichtiger. Die Emigration von <strong>Mali</strong>, welches als ein Transitland fungiert,<br />
in Richtung Europa, ist oftmals lebensgefährlich und stellt für beide Seiten eine große<br />
Herausforderung dar.<br />
Seit Mitte der 90er Jahre ist in <strong>Mali</strong> ein zunehmender US-amerikanischer Einfluss zu<br />
81
eobachten. Innerhalb der US-Afrikapolitik wird <strong>Mali</strong> eine wichtige Rolle in dem von den<br />
USA initiierten Kampf gegen den Terror zugesprochen (vgl. Abramovici 2004). Diese<br />
Entwicklung weist auf den postkolonialen Bedeutungsverlust von Frankreich in Afrika hin<br />
(vgl. Kambudzi; Lecoutre, 2006). Neben den Beziehungen nach Europa und in die USA<br />
pflegt <strong>Mali</strong> zudem gute Beziehungen zu der VR China sowie den wichtigsten islamischen<br />
Staaten (Seebörger, Außenpolitische Themen).<br />
9. Fazit: Versuch einer Bewertung<br />
<strong>Mali</strong> wird oft als gelungenes Beispiel für eine Demokratisierung in Westafrika angeführt<br />
(vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung 2005, 4; Seebörger, Machthaber und Machtgruppen) und<br />
scheint im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit aufgrund der relativen politischen<br />
Stabilität ein Liebling der internationalen Gebergemeinschaft zu sein.<br />
Gemäß des BTI-Ländergutachtens 2008 für <strong>Mali</strong> (Bertelsmann Transformation Index)<br />
haben sich die Erfolge der politischen Transformation verfestigt, während die<br />
wirtschaftliche Transformation nicht so stark vorangeschritten ist: <strong>Mali</strong> nimmt beim<br />
Länderranking nach dem Status Index Politik Rang 36 ein, befindet sich nach dem Staus<br />
Index Wirtschaft jedoch lediglich auf Rang 76 von 125 (Bertelsmann Stiftung 2008-1). Mit<br />
dem Bertelsmann Transformation Index wird versucht, Transformationsleistungen von<br />
Ländern bezüglich ihrer marktwirtschaftlichen Demokratie zu messen und somit<br />
Vergleiche zwischen einzelnen Regionen und Ländern zu erleichtern (Schmidt 2006, 9).<br />
Der BTI gliedert sich in zwei Indices: den Status Index (Status Politik und Status<br />
Wirtschaft) sowie den Management Index (vgl. Schmidt 2006, 10).<br />
Abb. 1: BTI 2008 für <strong>Mali</strong><br />
Bertelsmann Stiftung 2008-2, 1.<br />
Auch wenn die politische Transformation in <strong>Mali</strong> vergleichsweise weit fortgeschritten ist,<br />
bleibt aus unserem westlichen Demokratieverständnis heraus kritisch zu beurteilen, dass<br />
es sich in <strong>Mali</strong> weitestgehend um eine Konsensdemokratie handelt, in der eine<br />
Opposition bisher nur sehr schwach ausgeprägt ist, Pluralität zwar akzeptiert wird, alle<br />
Akteure jedoch eine soziale Hegemonie anzustreben scheinen. Konsensdemokratie<br />
meint in diesem Zusammenhang, dass mittels Dialog der Konsens zwischen allen<br />
angestrebt wird und die Machtausübung nicht durch die Mehrheit erfolgt.<br />
Konsensdemokratien zielen darauf ab, im Hinblick auf politische Entscheidungen eine<br />
möglichst breite Übereinstimmung zu erreichen und dabei auch die Vertreter der<br />
Minderheitsmeinungen einzubeziehen. Kritiker sehen in dieser Strategie eine<br />
82
Behinderung für realistische Lösungsstrategien und eine Behinderung von<br />
Reformprozessen. In <strong>Mali</strong> beträfe das beispielsweise den Umgang mit Themen wie der<br />
Stellung der Frau, dem geplanten Familienrechtsgesetzbuch oder der Genitalverstümmelung<br />
– bei letzterem Thema setzt <strong>Mali</strong>s Regierung eher auf eine allmähliche<br />
Bewusstseinsbildung und nicht auf rechtliche Veränderungen der Rahmenbedingungen.<br />
„Die politischen Parteien tendieren zur All-Parteienkoalition und es ist kein Zufall, dass<br />
der Präsident parteilos ist. Obwohl dadurch ein potentiell fruchtbarer Wettstreit der<br />
Ideen abgeschwächt wird, ist die Konsensneigung einer der Hauptgründe für den<br />
relativen Erfolg der Demokratie in <strong>Mali</strong>.“ (Bertelsmann Stiftung 2008-2, 3).<br />
Beim Blick auf die malische Demokratie werden außerdem häufig überzogene Privilegien<br />
von führenden Regierungsmitgliedern kritisiert. Die Regierung unternimmt erste Schritte<br />
im Kampf gegen Korruption, wobei die rechtliche Verfolgung oft nicht stringent ist.<br />
Verschiedene Länderberichte über <strong>Mali</strong> zeigen, dass Korruption immer noch auf vielen<br />
Ebenen verbreitete ist und als ein wichtiges Entwicklungshemmnis angesehen werden<br />
kann. <strong>Mali</strong> liegt bei dem Corruption Perceptions Index 2008 auf Platz 96 von 180<br />
Rangplätzen (Transparency International 2008).<br />
In aktuellen Diskursen zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, Demokratie in Afrika<br />
und einer Partnerschaft zwischen Europa und Afrika wird vielfach darauf hingewiesen,<br />
dass Teilaspekte einer afrikanischen Kultur 1 nur schwer mit westlicher Demokratie<br />
vereinbar sind, dass jedoch bereits seit jeher auf lokaler Ebene funktionsfähige Strukturen<br />
des Miteinanderlebens auf dem afrikanischen Kontinent bestanden. Die namibischen<br />
Staatsanwältin Unomwinjo Katjipuka-Sibolile stellte beim ZEIT Forum Politik (ZEIT<br />
Forum Politik: „Ein neuer Blick auf Afrika?“ am 19.04.09 in Hamburg) heraus, dass ihr der<br />
aus der Begriffsabgrenzung ‚westliche Demokratie’ zu folgernde Begriff einer ‚afrikanischen<br />
Demokratie’ geradezu suspekt erscheine. Es sei festzustellen, dass das<br />
Zusammenleben und das politische Leben in Afrika vielerorts immer westlicher geformt<br />
werden und dabei die Kultur und Tradition des jeweiligen afrikanischen Landes vielerorts<br />
verloren gingen, beziehungsweise sich im Wandel befinden. Es sei schwierig, die<br />
Traditionen zu erhalten und gleichzeitig zu einem demokratischen Umgang zu finden.<br />
Unerwünschte, vermeintliche Begleiterscheinungen der Demokratisierungen können<br />
folglich in einem zu beobachtenden, abnehmenden Respekt vor traditionellen Strukturen<br />
gesehen werden. Doch hierbei muss berücksichtigt werden, dass <strong>Mali</strong> sich in einem<br />
komplexen Prozess eines gesellschaftlichen Wandels befindet. Dieser gesellschaftliche<br />
und politische Transformationsprozess ist in gewisser Weise mühsam, bietet Chancen<br />
und Risiken und ist im Ergebnis noch offen.<br />
Als mögliche Blickwinkel und Fragestellungen für die <strong>Exkursion</strong> nach <strong>Mali</strong> stand die Frage<br />
nach einer Beteiligung der Bevölkerungsmehrheit am Demokratisierungsprozess:<br />
Inwieweit besteht ein politisches Bewusstsein, eine konkrete politische Position, die in<br />
Gesprächen vertreten wird. Wo liegen mögliche Gründe der geringen Wahlbeteiligung?<br />
Viele Gespräche mit <strong>Mali</strong>ern zeigten, dass ein demokratisches Bewusstsein ausgeprägt ist.<br />
Beispielsweise wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass sich bei der nächsten Wahl im<br />
Jahr 2012 zeigen werde, ob der regierende Präsident ATT sich an die demokratischen<br />
Spielregeln halte, da er gemäß Verfassung kein weiteres Mal kandidieren darf.<br />
Auf dem Hintergrund solcher Gespräche mit Menschen mit ausgeprägtem politischen<br />
Bewusstsein könnte ein Grund für die geringe Wahlbeteiligung in mangelnden<br />
1 Anm.: Eine zusammenfassende Verallgemeinerung des Kulturbegriffs ist ungenügend, dient in diesem Kontext jedoch der<br />
vereinfachten, zusammenfassenden Betrachtung.<br />
83
Alternativen liegen, da die programmatischen Unterschiede der Parteien häufig nicht<br />
deutlich werden und allgemein ein großes Konsensstreben zum Mangel einer Opposition<br />
führt. Zwar wurden bereits mobile Wahlbüros eingesetzt, um die ländliche Bevölkerung<br />
bei den Wahlen einzubeziehen, dennoch liegt ein weiterer Grund für eine geringe<br />
Wahlbeteiligung sicherlich in den maroden Verkehrsstrukturen sowie Mängeln auf Seiten<br />
der Verwaltungsinfrastruktur, was sich beispielsweise im Fehlen von Ausweisdokumenten<br />
zeigt. Bei dieser Betrachtung erscheint die Suche nach erfolgreichen Praxisbeispielen, die<br />
den Demokratisierungsprozesses unterstützen und nach Ansätzen, die traditionelle<br />
Strukturen und Demokratie verbinden und das kulturelle sowie nationale<br />
Selbstbewusstsein <strong>Mali</strong>s stärken, als wichtig. Der von der malischen Regierung<br />
vorangetriebene und auf Geberseite geförderte Dezentralisierungsprozess kann dabei als<br />
viel versprechend angesehen werden.<br />
84
Literaturverzeichnis<br />
ABRAMOVICI, Pierre 2004: Washington hat Afrika wiederentdeckt. Terror bekämpfen und<br />
Öl importieren. In: Le Monde Diplomatique 09.07.2004.<br />
AUGA, Michèle 2002: Präsidentschaftswahlen in <strong>Mali</strong>: Ex-Premier IBK gescheitert – ATT<br />
an der Spitze. In: Kurzberichte aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit<br />
Afrika. Bamako, 06.04.2002. Friedrich-Ebert-Stiftung.<br />
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG, Dokumentation November 2005: Die Sahelzone zwischen<br />
Demokratie und Hungerkrise - <strong>Mali</strong> als Vorbild? Bonn.<br />
GIERCYNSKI-BOCANDÉ, Ute; LERCH, Anke Christine 2002: Wahlverdrossenheit und<br />
politischer Pessimismus in <strong>Mali</strong>? In: Länderberichte <strong>Mali</strong> August 2002. Konrad Adenauer<br />
Stiftung.<br />
GIERCYNSKI-BOCANDÉ, Ute 2004: Regierungsumbildung und Kommunalwahlen. In:<br />
Länderbericht <strong>Mali</strong> Juni 2004. Konrad Adenauer Stiftung.<br />
KAMBUDZI, Admore Mupoki; LECOUTRE, Delphine 2006: Afrika sagt Frankreich leise<br />
Adieu. Die Grande Nation der Menschenrechte verspielt ihre Sonderstellung. In: Le<br />
Monde Diplomatique 09.06.2006.<br />
SCHMIDT, Siegmar 2006: Wie viel Demokratie gibt es in Afrika? In: Aus Politik und<br />
Zeitgeschehen 32-33/2006, 9 – 14.<br />
TREYDTE, Klaus-Peter; DICKO, Abdourhamane; DOUMBIA, Salabary 2005: Politische<br />
Parteien und Parteisysteme in <strong>Mali</strong>. In: Parteien und Parteisysteme in Afrika. Berichte der<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung.<br />
Auswärtiges Amt 2008: Länderinformation <strong>Mali</strong>. Innenpolitik. URL:<br />
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/<strong>Mali</strong>/Innenpolitik.html,<br />
Stand März 2009.<br />
Bertelsmann Stiftung 2008-1: Rangliste BTI 2008. URL: http://www.bertelsmanntransformation-index.de/fileadmin/pdf/Anlagen_BTI_2008/BTI_2008_Rangliste_DE.pdf,<br />
Stand 22.04.2009.<br />
Bertelsmann Stiftung 2008-2: BTI-Kurzgutachten <strong>Mali</strong>.<br />
URL: http://www.bertelsmann-transformationindex.de/fileadmin/pdf/Kurzgutachten_BTI_2008/WCA/BTI_2008_<strong>Mali</strong>.pdf,<br />
Stand 22.04.2009.<br />
Seebörger, Kai-Uwe: Länderüberblick <strong>Mali</strong>. Geschichte & Staat. Bei: Internationale<br />
Weiterbildung und Entwicklung (InWent).<br />
URL: http://liportal.inwent.org/mali/geschichte-staat.html, Stand 22.04.2009.<br />
85
Transparency International: Corruption Perceptions Index 2008:<br />
URL: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008,<br />
Stand 22.04.2009.<br />
Unicef: <strong>Mali</strong> Statistics, Basic Indicators and Education.<br />
URL: http://www.unicef.org/infobycountry/mali_statistics.html, Stand 22.04.2009.<br />
Verband Entwicklungspolitik Deutscher Regierungsorganisationen e. V. : Länderprofil<br />
<strong>Mali</strong>. URL: http://www.prsp-watch.de/index.php?page=laenderprofile/mali.php,<br />
Stand 22.04.2009.<br />
World Population Bureau 2008: World Population Data Sheet;<br />
URL: http://www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf, Stand 22.04.2009.<br />
86
Touristische Strukturen<br />
in <strong>Mali</strong><br />
Mirjam Krüger<br />
87
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Die Geschichte des Tourismus in <strong>Mali</strong>.................................................................................... 89<br />
2. Touristenankünfte........................................................................................................................ 89<br />
3. Darstellung <strong>Mali</strong>s bei den Reiseveranstaltern ........................................................................ 90<br />
4. Touristische Regionen in <strong>Mali</strong>.................................................................................................... 91<br />
5.1. Tourismus in der Dogon-Region ...................................................................................... 92<br />
5.2. Chancen und Risiken des Tourismus ............................................................................... 93<br />
5.3. Touristische Strukturen im Dogon-Land ........................................................................ 93<br />
5.4. Die Begegnung der Dogon mit Touristen....................................................................... 95<br />
5.5. Die neue Identitätsbildung bei den Reiseführern .......................................................... 95<br />
6. Tourismus in Timbuktu............................................................................................................... 96<br />
7. Resümee......................................................................................................................................... 97<br />
88
1. Die Geschichte des Tourismus in <strong>Mali</strong><br />
Die Wurzeln des Tourismus in <strong>Mali</strong> gehen streng genommen zurück auf die Zeit des<br />
Songhai-Reiches im 15. und 16. Jahrhundert. <strong>Mali</strong> war zu dieser Zeit eines der größten<br />
Reiche Afrikas- europäische sowie arabische Forscher kamen, um besonders Timbuktu<br />
als Handelszentrum dieses Reiches zu entdecken und im Westen darüber zu berichten<br />
(vgl. Krause 2006, 30). Auch die Dogon-Region im Südosten des Landes hat eine lange<br />
Tourismustradition. Ab den 1930er Jahren gab es ethnische Forschungen über das<br />
Dogon-Volk und in Besondere die ethnographischen Filme von Griaul haben dies<br />
Interesse geweckt. Die Dogon werden in seinen Filmen mystisch dargestellt und dieses<br />
Bild lockt bis heute Touristen an. (vgl. Luttmann 2002, 172f.). Das Land verfügt über<br />
einen großen kulturellen Reichtum auf Grund seiner Vergangenheit. Der Reichtum der<br />
einstigen großen territorialen Reiche spiegelt sich heute noch in dem sudanesischen<br />
Lehmbaustil, den Maskentänzen und dem Textilhandwerk wieder (vgl. ebd.) Die<br />
Tourismuswerbung bedient sich diesem ethnologisch geprägten Bild der Dogon und<br />
dem kulturellen Reichtum.<br />
Im Jahre 1960 wurde <strong>Mali</strong> unabhängig von den Franzosen und landesweit stieg die Zahl<br />
der Touristenankünfte (vgl. Tabelle Nr.1). Nach der Unabhängigkeit war der Tourismus<br />
vorerst staatlich organsiert und somit verdiente auch nur der Staat am ihm. 1990 kam es<br />
zur Liberalisierung und die Einheimischen konnten fortan als Tourenführer oder<br />
Hotelbetreiber Geld verdienen. Durch regen Straßenbau wurden viele kleine Dörfer,<br />
besonders im Dogon-Gebiet, nach der Liberalisierung für die Touristen zugänglich, die<br />
vorher noch abgeschnitten waren (vgl. Van Beek 2003, 265ff.). Obwohl der Tourismus<br />
heute liberalisiert ist, bleibt die Tendenz diesen zu begrenzen. Das Dogon-Land dürfen<br />
Touristen beispielsweise nur mit einem einheimischen Fremdenführer besuchen (vgl. Van<br />
Beek 2003, 272). Heute spielt der Staat keine große Rolle mehr bei der Organisation des<br />
Tourismus. In <strong>Mali</strong> gibt es keine politischen Leitlinien mit Maßnahmen hinsichtlich<br />
Qualitätssicherung der Hotels oder Touren und der Ausbildung der Angestellten<br />
(Luttmann 2002, 172).<br />
Die Kernbesuchszeit <strong>Mali</strong>s ist in der Trockenzeit von Oktober bis Februar. Ab März<br />
werden die Temperaturen sehr heiß und im Juli beginnt die Regenzeit (vgl. Velton 2008,<br />
S.33f.). Der Tourismus spielt sich seit der Tuareg-Rebellion zu Beginn der 90er Jahre fast<br />
ausschließlich im Sahel Gebiet ab, da die Sahara als unsicher eingestuft wird. Dies war zu<br />
Beginn der 90er Jahre noch anders, da viele Sahara Touristen auch nach <strong>Mali</strong> reisten.<br />
2. Touristenankünfte<br />
Die Bedeutung <strong>Mali</strong>s als Reiseland im internationalen Vergleich ist sehr gering. Der<br />
Kontinent Afrika verzeichnet 3,6% der weltweiten Touristenankünfte und auch im<br />
afrikanischen Vergleich ist der Tourismus noch gering ausgeprägt (vgl. WTO 2007). Die<br />
Zahlen der Ankünfte in <strong>Mali</strong> bis 2001 belegen aber, dass sich der Tourismus auf geringem<br />
Level aber stetig entwickelt. Besonders seit Mitte der neunziger Jahre, nachdem die<br />
Dürre-Periode und die Tuareg-Rebellion überwunden waren, haben sich die<br />
Touristenankünfte im Land verdreifacht (vgl. Krause 2006, 110).<br />
89
Abb. 1: Touristenankünfte <strong>Mali</strong><br />
KRAUS, Silke 2006: Mythos Timbuktu, Freie Universität Berlin. Magisterarbeit.<br />
Für die Bewohner <strong>Mali</strong>s hat der Fremdenverkehr jedoch eine wichtige Bedeutung, da<br />
durch ihn neue Arbeitsplätze im Land geschaffen werden. Ansonsten bietet das Land vor<br />
allem Beschäftigung im Agrarsektor. Der Tourismus ist in einigen Gebieten des Landes<br />
schon zu dem wichtigsten Standbein der Wirtschaft geworden. (vgl. VAN BEEK 2003,<br />
252)<br />
3. Darstellung <strong>Mali</strong>s bei den Reiseveranstaltern<br />
<strong>Mali</strong> als Reiseziel ist nur bei Spezialreiseveranstaltern und Studienreiseveranstaltern<br />
vertreten und wird meisten als geführte Rundreise angeboten. Daran lässt sich erkennen,<br />
dass es sich nicht um ein Massenreiseziel handeln kann und es ergibt sich die Chance die<br />
Entwicklung des Tourismus mit beeinflussen zu können. Bei den Reiseveranstaltern wird<br />
<strong>Mali</strong> als das unberührte, exotische Land mit einer unverfälschten Kultur und einer<br />
ethischen Vielfalt dargestellt. Gerade die Kombination aus Wüstenerlebnis und<br />
kultureller Vielfalt wird von vielen Veranstaltern in den Vordergrund gestellt (vgl.<br />
Africantours 2009). Dieses dargestellte Bild geht einher mit den Wünschen der<br />
Menschen nach Individualisierung und dem Drang immer wieder einzigartige und<br />
exotische Dinge zu erleben. Man möchte am liebsten als Tourist dorthin, wo noch kein<br />
Mensch vorher gewesen ist. Dieser Trend in unserer Gesellschaft eröffnet <strong>Mali</strong> viele<br />
Chancen.<br />
Gleichzeitig impliziert das Reiseland Afrika bei den Touristen auch Krankheiten und<br />
Unsicherheit. Aus dieser Kombination ergibt die Tendenz, dass die Touristen in <strong>Mali</strong> in<br />
einer für Sie geschaffenen Blase reisen. Von den Reiseveranstaltern wird eine<br />
durchgeplante Route vorgegeben und ein bestimmter Komfort gewährleistet, der meist<br />
nicht typisch für afrikanische Verhältnisse ist. So können die Touristen die exotische<br />
90
Anziehungskraft erleben, dennoch wird gleichzeitig zu viel Unsicherheit und ein<br />
Kulturschock vermieden (vgl. Van Beek 2003, 254).<br />
4. Touristische Regionen in <strong>Mali</strong><br />
Der Tourismus im Land beschränkt sich seit Mitte der 90er Jahre auf die Sahel-Zone, da<br />
die Sahara-Region seit der Tuareg-Rebellion als unsicher gilt. Ebenfalls halten sich in<br />
diesem Gebiet Al-Qaida Gruppen auf, weswegen von Reisen in diese Region abgeraten<br />
wird (vgl. Auswärtiges Amt 2009). Es gibt kaum noch Reiseveranstalter die Reisen in die<br />
Wüste anbieten- bis in die 80er Jahre waren diese grenzüberschreitende Karawanenreisen<br />
noch ein wichtiges touristisches Geschäft.<br />
Heute spielt sich das touristische Leben hauptsächlich entlang des Nigers in den Städten<br />
Bamako, Ségou, Mopti, Timbuktu und Gao sowie in Djenné und im Dogon-Land ab.<br />
Bamako ist die Hauptstadt des Landes und nahezu alle Rundreisen starten hier. In der<br />
Stadt sind drei große Märkte, auf denen man unter anderem traditionelles<br />
Kunsthandwerk erwerben kann (vgl. Velton 2008, 99ff.). In Mopti sind der große<br />
Fischerhafen mit den Pirogen und Pinassen sowie der turbulente Markt ein touristischer<br />
Anziehungspunkt (vgl. ebd. 160ff.). Djenné und Timbuktu waren die einstigen großen<br />
Zentren des Songhai-Reiches und die sudanesische Lehmbauarchitektur ist hier<br />
besonders ausgeprägt. In Djenné sei noch der immer montags stattfindende Markt<br />
erwähnt, der die ganze Stadt schlagartig belebt (vgl. ebd. 147ff.). Das Dogon-Land bietet<br />
dem Touristen einen Einblick in die reiche Dogon-Kultur mit ihren Riten, Maskentänzen<br />
und traditioneller Musik. Auch der Lehmbaustil ist in dieser Region verbreitet (vgl. ebd.<br />
175ff.).<br />
Foto 2 : eine Piroge auf dem Niger<br />
Aufnahme von Theresa Lauw<br />
91
Foto 3 /Foto 4: Beispiel der Lehmbauarchitektur in Mopti und Djenné<br />
Aufnahmen von Susann Aland<br />
Die wichtigsten touristischen Regionen stellen die Dogon-Region im Südosten und<br />
Timbuktu im Zentrum <strong>Mali</strong>s dar, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.<br />
5.1. Tourismus in der Dogon-Region<br />
Die Region im Südosten <strong>Mali</strong>s hat ein außergewöhnlich großes touristisches Potenzial.<br />
Dies ist bedingt durch die lange kulturelle Tradition der Ethnie, die seit dem<br />
15.Jahrhundert dort lebt. Die Dorfsiedlungen der Dogon sind in Felshänge im Bandiagara-<br />
Plateau gebaut, wodurch sich die Bevölkerung vor den Sklavenhändlern und anderen<br />
Feinden schützen konnte. Diese anscheinend unberührte Kultur zieht den westlichen,<br />
internationalen Touristen in besonderem Maße an (vgl. Van Beek 2003, 256ff). Im Fokus<br />
92
der Reisen steht für die Touristen meist die Kultur der Dogon, ihre Feste und ihr<br />
animistischer Glauben all dies in einer landschaftlichen Traumkulisse.<br />
Die Region der Dogon ist in der Agrarproduktion, im Vergleich zu vielen anderer<br />
Regionen in der Sahel-Zone entlang des Nigers, stark benachteiligt. Dieses ist vor allem<br />
geographisch (unebene Plateauregion) und klimatisch bedingt, da es sich um eine sehr<br />
trockene Region handelt (vgl. ebd. 255). Die Einnahmequelle aus dem Tourismus ergänzt<br />
sich gut mit der Landwirtschaft, da er zeitlich in die wirtschaftlich weniger aktive Zeit<br />
fällt. (vgl. Luttmann 2002, S.182). Bevor ich näher auf die heutigen touristischen<br />
Strukturen und die Begegnung der Dogon mit den Touristen eingehe, möchte ich kurz<br />
auf die Chancen und Risiken des Tourismus für eine Region zu sprechen kommen.<br />
5.2. Chancen und Risiken des Tourismus<br />
Es gibt ambivalente Diskussionen über die Rolle von Entwicklungsländern im Tourismus.<br />
Einerseits wird in dem internationalen Tourismus eine große Chance bezüglich des<br />
ökonomischen Wachstums gesehen. Gerade seit der Liberalisierung des Tourismus in<br />
<strong>Mali</strong> Anfang der 90er Jahre kommen die Einnahmen nicht mehr dem Staat sondern der<br />
Bevölkerung zu Gute. Andererseits ist der Tourismus ein Wirtschaftszweig, bei dem viel<br />
Geld in nationalen und internationalen Touristikunternehmen „hängenbleibt“ und vor<br />
allem gering qualifizierte, einheimische Saisonkräfte eingesetzt werden (vgl. Luttmann<br />
2002, 169). Auch wird beim Tourismus immer wieder über die negativen Auswirkungen<br />
auf die lokale Kultur und die Ökologie berichtet. Bei den negativen Auswirkungen auf die<br />
lokale Kultur ist die Rede von Überfremdung, Kulturverfall und Vermarktung der Kultur<br />
(vgl. Van Beek 2003, 251).<br />
Inzwischen findet ein differenziertes Denken bezüglich der positiven und negativen<br />
Auswirkungen statt- es muss bei jeder Region und bei jedem Land individuell betrachtet<br />
werden, wie die Bevölkerung mit dem Tourismus umgeht. Die Weiterentwicklung des<br />
sozial- und ökologisch tragfähigen Tourismus ist sehr wichtig, so dass die Einheimischen<br />
einen ökonomischen Vorteil haben und die Einnahmen aus dem Tourismus nicht<br />
ausschließlich an Großkonzerne gehen. Außerdem müssen die Gastgeber die<br />
Entscheidungen mit eingebunden werden und die Auswirkungen des Tourismus sollten<br />
aus ihrer Perspektive betrachtet werden und nicht aus der Perspektive der westlichen<br />
Welt (vgl. LUTTMANN 2002, 169) So kann der Tourismus auch die Chance zur<br />
Stärkung der Identität und Selbstwahrnehmung bieten und impliziert nicht immer sofort<br />
Zerstörung (vgl. ebd. 170)<br />
5.3. Touristische Strukturen im Dogon-Land<br />
Die Unterkünfte in der Region sind einfach, häufig auch unter freiem Himmel und<br />
werden meistens von Einheimischen geführt. Trotzdessen sind sie den Bedürfnisses des<br />
westlichen Touristen angepasst- sie sind ergänzt durch Baumbepflanzung und<br />
Blumensträuchern, die Nutzungsräume des einzelnen Touristen sind abgetrennt so dass<br />
93
jeder seine Privatsphäre hat. Die Speisen sind ebenfalls auf den europäischen Gaumen<br />
zugeschnitten (vgl. Luttmann, Tourismusstrukturen im heutigen Dogon-Land). Häufig sind<br />
die Unterkünfte um einen Souvenirshop ergänzt, in denen typische Kunst wie<br />
beispielsweise die Masken „kanaga“ der Dogon verkauft werden. Es ist nur eine Maske<br />
von vielen der Dogon und sie wird bei den Maskentänzen von den Männern getragen.<br />
Die Maskentänze gehören zu einem touristischen Highlight der Region und die Touristen<br />
zahlen ein Entgelt, damit diese Tradition extra für die „nachgeahmt“ wird.<br />
Die zentrale Rolle im Tourismus haben die jungen Dogon-Männer, die sich als Guides<br />
betätigen. Sie führen die Touristengruppen von Dorf zu Dorf und erklären ihnen die<br />
Lebensweise der Dorfbewohner und das animistische Glaubensprinzip. Es existiert ein<br />
starker Konkurrenzkampf da der Begriff Fremdenführer kein geschützter Begriff ist.<br />
Auch als Souvenirverkäufer und Hostelbetreiber betätigen sich in der Regel die jungen<br />
Männer, die gerne die ökonomischen Chancen ergreifen (vgl. Luttmann 2002, 172f.). Sie<br />
sind ansonsten wegen der hierarchischen Sozialstruktur stark benachteiligt, da erst mal<br />
die Brüder des Vaters erben wenn dieser verstirbt. Dadurch kommen die Männer erst<br />
im fortgeschrittenen Alter in den Besitz von guten Böden um Landwirtschaft zu<br />
betreiben (vgl. Van Beek 2003, 272)<br />
Die Touristenzahlen in der Dogon-Region sind genauso wie im gesamten Land <strong>Mali</strong><br />
steigend. Im Jahre 2000 lag die Zahl der Übernachtungen bei 15.000 im Jahr, heute sind<br />
es bereits doppelt so viele. Diese Zahl hört sich vergleichsweise sehr gering an aber man<br />
muss bedenken, dass es auch nur eine limitierte Zahl an Übernachtungsmöglichkeiten<br />
gibt die Region als Massenreiseziel nicht geeignet ist (vgl. Van Beek 2003, 268).<br />
Foto 5: Maske der Dogon: kagan<br />
Galerie für traditionelle Afrikanische Kunst<br />
94
5.4. Die Begegnung der Dogon mit Touristen<br />
Das Verhältnis zwischen Tourist und Bewohner des Landes ist bei Entwicklungsländern<br />
sehr asymmetrisch (vgl. Luttmann 2002, 170). Westliche Touristen, die ins Dogon-Gebiet<br />
gelangen, sehen sich anders als sie von den Einheimischen gesehen werden. Sie<br />
betrachten sich als überdurchschnittlich in anderen Kulturen interessiert und gebildet.<br />
Die Dogon nehmen den Touristen nicht so wahr- für sie sind sie eine „wandelnde<br />
Geldbörse“, die möglichst viel konsumieren sollten (vgl. Van Beek 2003, 278). Die<br />
Besucher erweisen sich in der Regel als sehr großzügig und teilweise entstehen sogar<br />
Initiativen zum Bau von neuen Schulen, Brunnen, Staudämmen etc. Die Frage ist, wie die<br />
einheimische Bevölkerung mit dieser Asymmetrie umgeht? Wie reagieren sie auf die<br />
materielle Überlegenheit und können sie ihre Kultur bewahren? Wie bereits an anderer<br />
Stelle erwähnt ist nur eine kleine Gruppe von jungen Männern direkt am Tourismus<br />
beteiligt, wobei das Gros der Bevölkerung sich von den Touristenströmen nicht<br />
betroffen fühlt (vgl. Luttmann 2002, 183). Das tägliche Leben orientiert sich an der<br />
Landwirtschaft, dem wöchentlichen Rhythmus der Märkte und der Trocken- und<br />
Regenzeit. Der Tourist stellt eine willkommene Abwechslung da, aber keinen Eingriff in<br />
den Alltag. Sie reisen sehr abgegrenzt von der Bevölkerung -halt in der künstlich für sie<br />
konstruierten Blase. Es findet auch kaum Kommunikation zwischen den beiden Gruppen<br />
statt, was auch durch sprachliche Barrieren hervorgerufen wird. Das Produkt „Kultur“<br />
ist die Hauptattraktion für die Besucher, deswegen sind auch die Maskentänze als<br />
wichtiger Teil dieser Kultur so beliebt. Dies birgt die Gefahr, dass die Bewohner den<br />
Eindruck bekommen ihre Kultur würde als Gebrauchsgegenstand gehandelt werden (vgl.<br />
Van Beek 2003, 273ff.). Andererseits kann der Tourismus auch dazu führen, dass die<br />
Identität noch mehr gestärkt wird durch das starke Interesse an der Kultur. Die Dogon<br />
sind sehr stolz, haben eine starke Verbindung zu ihrer Kultur, dadurch ein starkes<br />
Selbstbewusstsein und vermitteln dies auch den Touristen. Die Kultur ist geprägt durch<br />
Sesshaftigkeit- die Abenteuerkultur der Reisenden ist für sie schwer nachvollziehbar und<br />
deswegen begegnen sie ihnen auch eher skeptisch. Sie haben dem Touristen gegenüber<br />
ein Überlegenheitsgefühl, sind dabei aber trotzdem offen und gastfreundliche (vgl.<br />
Luttmann 2002 179f.)<br />
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Gefahr der kulturellen Überfremdung durch<br />
die Touristen in der Dogon-Region sehr gering ist. Einerseits ist es bedingt durch die<br />
wenigen Berührungspunkte und andererseits durch das starke Selbstbewusstsein und die<br />
Verbindung zu ihrer Kultur.<br />
Der Tourismus hat noch eine positive Folge: Den Dogon wurde durch das<br />
entgegengebrachte Interesse an ihrer Kultur die Notwendigkeit des Erhalts des<br />
kulturellen Erbes bewusst (vgl. LUTTMANN 2002 182f.).<br />
5.5. Die neue Identitätsbildung bei den Reiseführern<br />
Die jungen Dogon-Männer, die sich als Touristen- Guides betätigen, geraten durch ihre<br />
Tätigkeit in einen Zwiespalt zwischen Tradition und Moderne. Die Männer geraten in<br />
diesen Zwiespalt weil ihre Arbeit von der traditionellen Bevölkerung als nicht ehrenhaft<br />
95
angesehen wird. Soziale Anerkennung erfahren bei den Dogon lediglich die Feldarbeiter<br />
(walu) wohingegen die Arbeiten der Berufskasten (bire), zu denen auch die Händler<br />
zählen, als abhängig und heuchlerisch betitelt werden. Die Reiseführer bilden quasi eine<br />
neue Berufskaste, die sich durch Verhandlungsgeschick und auch Abhängigkeit zu den<br />
Kunden, auszeichnet und somit von den Dogon als nicht ehrenhaft gilt (vgl. Luttmann<br />
2002 188f.).<br />
Die Fremdenführer selber sehen sich als modernes Leitbild und streben nach sozialer<br />
Anerkennung in der Gesellschaft. Sie können als Fremdenführer schnelles Geld verdienen<br />
und Begeben sich auf Reisen, was den meisten anderen Dorfbewohnern verwehrt bleibt.<br />
Ihr äußeres Erscheinungsbild wird von den Touristen als traditionell wahrgenommen, da<br />
es auf den ersten Blick so aussieht aber die traditionelle Kleidung ist stark verfälscht.<br />
Auch das Freizeitverhalten der jungen, modernen Touristenführer wird von der<br />
traditionellen Bevölkerung verachtet. Einige der Männer kleiden sich in einem westlichen<br />
Kleidungsstil und tragen deren Konsumgüter, was auf Ablehnung in der Bevölkerung<br />
stößt (vgl. Luttmann 2002, 185 ff.).<br />
Abschließend kann man festhalten, dass die jungen Dogon-Männer auf Grund der<br />
soziokulturellen Konstruktion der Dogon nicht als das moderne Leitbild angesehen<br />
werden, als dass sie sich gerne sehen.<br />
6. Tourismus in Timbuktu<br />
Mit dem Namen „Timbuktu“ wird in der westlichen Welt etwas Geheimnisvolles<br />
verbunden. Einerseits wird die Stadt mit dem Bild vom „Ende der Welt“ assoziiert und<br />
andererseits existiert das Bild einer Stadt als Treffpunkt von Gläubigen und<br />
Intellektuellen (vgl. Kraus 2009, 29). Timbuktu war zur Zeit des Songhai-Reiches ab Mitte<br />
des 15.Jahrhunderts eine reiche Stadt und das Handelszentrum, in dem mit Gold,<br />
Elfenbein, Gewürzen und dem bekannten Wüstensalz gehandelt wurde. Aus dem Norden<br />
kamen die Kamelkarawanen und die Güter wurden weiter in den Süden gehandelt. Zu<br />
dieser Zeit war die Stadt ein Treffpunkt von Händlern und Gelehrten, außerdem gab es<br />
über 100 Koranschulen und Universitäten in der Stadt. Im Jahre 1591 wurde die Stadt<br />
von marokkanischen Truppen zerstört und die Reichtümer wurden geplündert. Heutzutage<br />
aber auch während des Songhai-Reiches leben in Timbuktu verschiedene Ethnien,<br />
überwiegend aber die Songhai und die Tuareg. Ursprünglich sind die Tuareg<br />
Halbnomaden und lebten von der Viehzucht aber die Dürrejahre in <strong>Mali</strong> haben viele in<br />
die Städte gezogen (vgl ebd. 30ff.)<br />
Heute reisen die Touristen nach Timbuktu um die Zeitzeugnisse dieser großen Ära zu<br />
entdecken: alte Kaufmannshäuser aus dem 15.Jahrhundert, Moscheen, Bibliotheken,<br />
sudanesische Lehmbaukultur. Auch die beeindruckende Halbwüstenlandschaft, in der für<br />
den Touristen Kamelritte inklusive Übernachtung in einem Campement angeboten wird.<br />
In den 80er Jahre waren auch noch Kamelritte durch die Wüste mit den Touristen eine<br />
Einnahmequelle der Tuareg. Die Nachfrage nach den mehrtägigen Trips aus dem Norden<br />
kommend ist in Folge der Tuareg-Rebellion aber quasi eingebrochen. Touristen reise<br />
ebenfalls nach Timbuktu um die Kultur der Tuareg kennenzulernen, die früher als<br />
Nomaden durch die Wüste gezogen sind (vgl. ebd. 64ff.). Der Tourismus hat sich in<br />
Timbuktu inzwischen zu der Haupteinnahmequelle entwickelt.<br />
96
Foto 6: Eine der drei Moscheen in Timbuktu<br />
Aufnahme von Susann Aland<br />
Für einen Besuch in dieser Stadt nehmen die Touristen eine beschwerliche Anreise auf<br />
sich. Mit Trucks fährt man einen Tag lang durch die Halbwüste oder man steigt in<br />
Bamako in ein kleines Flugzeug. Aber warum nehmen alle Touristen diese Kosten und<br />
Mühen auf sich? Was erwarten sie sich von ihrem Besuch in Timbuktu und wie sieht die<br />
Realität aus?<br />
7. Resümee<br />
Auch während unserer Reise durch <strong>Mali</strong> war in der Gruppe immer wieder eine ganz<br />
besondere Aufregung zu spüren, wenn wir über die bevorstehende Tour nach Timbuktu<br />
gesprochen haben. Was erwartet uns dort? Wie viele Zeitzeugnisse sind tatsächlich noch<br />
zu sehen? Wie beschwerlich wird die Reise?<br />
In den zwei Tagen in Timbuktu stellten wir Gemeinsamkeiten zu den bisher gesehenen<br />
Städten fest aber auch viele Unterschiede, besonders aus dem touristischen Blickwinkel.<br />
Tatsächlich haben wir festgestellt, dass nicht mehr viel in der Stadt an den einstigen<br />
Reichtum erinnert. Die Menschen leben in armen Verhältnissen in den traditionellen<br />
Lehmhäusern, die etwas betuchteren bauen Häuser aus Ziegelsteinen. Das Leben findet<br />
ebenso wie in den anderen Städten <strong>Mali</strong>s auf der Straße statt, die Einwohner verkaufen<br />
ihre Waren auf den Märkten, in kleinen Läden oder auf der Straße um ihre Familie zu<br />
ernähren. Die Stadt unterscheidet sich in ihrem Stadtbild nicht sehr von anderen<br />
malischen Städten, bis das wir uns in der Halbwüstenlandschaft befinden und die Straßen<br />
deshalb mit Sand bedeckt sind. Trotzdem war es ein besonderes Gefühl durch die<br />
Straßen zu gehen und sich vorzustellen, wie es hier wohl ausgesehen haben mag als die<br />
Stadt übersät war von Universitäten und Studenten. Und als riesige Karawanen mit bis zu<br />
400 Kamelen, aus dem Norden mit Gold und Salz beladen, eintrafen. Dieses<br />
Vorstellungsvermögen hatten wir auch unserem Fremdenführer Kalil zu verdanken, der<br />
97
uns in einem guten Englisch die Geschichte der Stadt, die heutigen Strukturen und viele<br />
Informationen über das Leben der Tuareg näher gebracht hat.<br />
Dies ist ein großer Unterschied Timbuktus zu den bis dahin besuchten Städten. Die<br />
Fremdenführer können nicht-französisch sprachigen Touristen mehr vermitteln wenn sie<br />
Touren auch auf Englisch anbieten können. Glaubt man der Aussage Kalils so können alle<br />
Tuareg, die sich als Fremdenführer betätigen, auch Englisch sprechen. Die Händler auf<br />
der Straße und auf den Märkten, die sich auf touristische Produkte wie etwa Tuareg-<br />
Schmuck spezialisiert haben, sprechen Brocken von Englisch um sich mit den Touristen<br />
unterhalten zu können und ihre Ware besser verkaufen zu können.<br />
Während der Stadtführung hat uns Kalil ebenfalls über das Kanalisationssystem<br />
aufgeklärt, dass in der Altstadt Timbuktus entsteht. Die Stadt erhofft sich durch diese<br />
Maßnahme natürlich bessere Lebensbedingungen für die Einwohner aber gleichzeitig, dass<br />
noch mehr Touristen die Stadt besuchen werden. In keiner anderen Stadt, die wir als<br />
Gruppe besucht haben sind solche Maßnahmen in Planung.<br />
In Timbuktu hat man ebenfalls damit begonnen regionale Ressourcen und Faktoren für<br />
die touristische Entwicklung der Stadt besser zu nutzen. Ein Beispiel hierfür ist die<br />
Kameltour durch die Halbwüste mit anschließender Übernachtung und Bewirtung im<br />
Campement, die auch wir unternommen haben. Auf Basis der endogenen Potenziale wird<br />
ein touristisches Programm entwickelt, für das keine zusätzliche Infrastruktur wie etwa<br />
Hotels geschaffen werden müssen, sondern das sich aus den Gegebenheiten vor Ort<br />
ergibt. Für den westlichen Touristen sind solche Angebote etwas Einzigartiges und sie<br />
haben das Gefühl die Kultur der Tuareg hautnah mitzuerleben. Auch die Tuareg schlafen<br />
unter freiem Himmel während sie mit Karawanen durch die Wüste ziehen. Vergleichbar<br />
ist dieses Angebot in Timbuktu mit den Maskentänzen bei den Dogon, die von den<br />
Touristen gebucht werden können um die Kultur hautnah mitzuerleben.<br />
Foto 7: Kameltour zum Wüstencamp<br />
Aufnahme von Susann Aland<br />
98
Wir als Gruppe hatten den Eindruck, dass der Tourismus in ganz <strong>Mali</strong> noch in den<br />
Kinderschuhen steckt. Während der Reise sind wir selten auf andere Touristen gestoßen<br />
und wenn waren es organisierte Kleingruppen von Touristen mittleren Alters, die<br />
vermutlich eine organisierte Rundreise gebucht hatten. Das Land hat viele touristische<br />
Potenziale vor allem aus kultureller Sicht, die ich in dieser Ausarbeitung ausführlich<br />
aufgeführt habe. Hinzu kommt, dass man in <strong>Mali</strong> als Tourist ein hohes Sicherheitsgefühl<br />
empfindet. Wir haben uns auf der Straße frei bewegen können, hatten keine Angst vor<br />
Überfällen und haben auch immer nach Einbruch der Dunkelheit das Hotel verlassen<br />
können. Dies ist nicht in allen afrikanischen Ländern so selbstverständlich möglich. Nicht<br />
vergessen möchte ich an dieser Stelle die Offenheit, mit der man als Tourist in <strong>Mali</strong><br />
empfangen wird. Wir waren immer wieder überwältigt von der Gastfreundschaft und der<br />
Freundlichkeit der Menschen. All dies macht <strong>Mali</strong> zu einem reizvollen und einzigartigen<br />
Reiseland.<br />
99
Literaturverzeichnis<br />
KRAUS, Silke 2006: Mythos Timbuktu, Freie Universität Berlin. Magisterarbeit.<br />
LUTTMANN, Ilsemargret 2002: Tourismus und Kulturerhalt. Ein Widerspruch? Der<br />
Umgang der Dogon (<strong>Mali</strong>) mit dem internationalen Tourismus. Baessler Archiv,51.<br />
VAN BEEK, Walter 2003: African tourist encounters. Effects of tourism on two West<br />
African societies. In: Africa, 73, 2.<br />
VELTON, Roos 2008: <strong>Mali</strong>. The Bradt Travel Guide, Guilford.<br />
AFRICANTOURS 2009: <strong>Mali</strong>. Durch den Sahel an den Rand der Wüste mit einer<br />
Wanderung durch das Land der Dogon. URL:<br />
http://www.africontours.de/103/<strong>Mali</strong>/Touren/<strong>Mali</strong>_MA_01.html, Stand 01.04.2009.<br />
AUSWÄRTIGES AMT 2009: Reise- und Sicherheitshinweise. URL: http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Laenderinformationen/<strong>Mali</strong>/Sicherheitshinweise.html,<br />
Stand 24.04.2009.<br />
WORLD TRAVEL ORGANIZATION 2009: Tourism Statistics <strong>Mali</strong>. URL:<br />
http://www.unwto.org/index.php, Stand 01.04.2009.<br />
100
Alles für die Katz?<br />
Lehren aus der Entwicklungspolitik<br />
Mathias Becker<br />
101
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Armut in Zahlen: <strong>Mali</strong> .............................................................................................................. 103<br />
2. Ursachen der Unterentwicklung............................................................................................. 104<br />
2.1. Die Sahelzone – naturräumliche Festsetzung von Armut?........................................ 104<br />
2.2. Nomadentum: rückständige oder angepasste Lebensweise? .................................... 105<br />
2.3. Das koloniale Erbe ............................................................................................................. 106<br />
2.4. Bevölkerungsexplosion...................................................................................................... 106<br />
2.5 Wirtschaftliche Defizite und Abhängigkeiten ................................................................ 107<br />
3. Entwicklung der Entwicklungszusammenarbeit ................................................................... 107<br />
4. Entwicklungszusammenarbeit an Beispielen ......................................................................... 109<br />
4.1. Das „Office du Niger“....................................................................................................... 109<br />
4.2. <strong>Mali</strong> Nord ............................................................................................................................. 111<br />
5. Fazit ............................................................................................................................................... 114<br />
102
1. Armut in Zahlen: <strong>Mali</strong><br />
<strong>Mali</strong> gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Weltbank beziffert das BIP 2006 auf<br />
6.1 Mrd. US-Dollar, das Pro-Kopf-Einkommen betrug 440 US-Dollar (vgl. Weltbank<br />
2008a, 388). 72 % der Bevölkerung leben unterhalb der internationalen Armutsgrenze<br />
von 2 US$ pro Tag (vgl. Weltbank 2008a, 391). Im aktuellen UNDP-Bericht über die<br />
menschliche Entwicklung verharrt <strong>Mali</strong> auf den hintersten Plätzen: zuletzt auf Rang 168<br />
von 179 Ländern (vgl. UNDP 2008) 2 .<br />
Abb. 1: <strong>Mali</strong>’s Human Development Index (Quelle: UNDP 2008)<br />
Einen anderen Ansatz, die Entwicklung eines Landes zu messen, verfolgt der Bertelsmann<br />
Transformation Index BTI der Bertelsmann Stiftung. Der BTI versucht, zwei Komponenten<br />
zu erfassen: Zum einen die Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades, der die<br />
Spielräume politischen Handelns beeinflusst. Diese Komponente, die erheblichen Einfluss<br />
auf das Länder-Ranking hat, lässt Rückschlüsse auf die Möglichkeiten und Grenzen<br />
entwicklungspolitischer Interventionen zu. Zum anderen hat die Bewertung der<br />
Bereitschaft der politischen Führungsgruppe zur Kooperation mit externen Akteuren<br />
und bei der Umsetzung von Reformpolitik viel mit der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit<br />
zu tun (vgl. Nuscheler 2008, 11f). Während UNDP und Weltbank <strong>Mali</strong><br />
auf die hintersten Plätze ihrer Indizes verweisen, sieht der BTI das vielzitierte<br />
„Musterbeispiel für Demokratie in Afrika“ aufgrund seiner politischen Stabilität erheblich<br />
positiver.<br />
2 Der Human Development Index (HDI) der UN ist eine Messzahl für den Entwicklungsstand eines Landes und<br />
setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Lebenserwartung, Ausbildung und Kaufkraft.<br />
103
Abb. 2: Der BTI für <strong>Mali</strong> (Quelle: BTI 2007, 1) 3<br />
2. Ursachen der Unterentwicklung<br />
2.1. Die Sahelzone – naturräumliche Festsetzung von Armut?<br />
„Sahel“ leitet sich aus dem arabischen Wort „as-sahil“ ab und bedeutet „Ufer“ oder<br />
„Küste“ – denn das war der Sahel für die Bewohner der Wüste: ein rettendes Ufer. Dort<br />
gab es Wasser, Getreide, dort begegneten sich hellhäutige, nomadische Viehzüchter und<br />
negride, sesshafte Bauern und Stadtbewohner. In unserem westlichen Weltbild hingegen<br />
steht der Sahel geradezu als Synonym für Dürrekatastrophen und Hungersnöte.<br />
Naturgeografisch weist dieser Raum nirgendwo klare Grenzen auf. Eine ungefähre<br />
Abgrenzung erfolgt meist durch die Isohyten (Linien gleichen Jahresniederschlags): den<br />
Nordrand bildet die 200mm-Linie und den Südrand die 600mm-Linie. Entscheidend für<br />
die Ökologie des Sahels ist jedoch nicht so sehr die absolute Niederschlagsmenge,<br />
sondern viel mehr die Niederschlagsschwankungen. In der Kernzone des Sahel beträgt<br />
die Niederschlagsvariabilität zwischen 20 und 30 % (vgl. Krings 1993 130).<br />
3 Der Status-Index informiert über den im Frühjahr 2007 erhobenen Entwicklungsstand eines Landes auf dem<br />
Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft, während der Management-Index die Qualität der<br />
Steuerungsleistungen der politischen Entscheidungsträger im Zeitraum von 2005 bis 2007 klassifiziert.<br />
104
Abb. 3: Die Sahelzone (Quelle: Krings 1993, 131)<br />
2.2. Nomadentum: rückständige oder angepasste Lebensweise?<br />
Die hohe Niederschlagsvariabilität verdeutlicht die Labilität des Naturhaushaltes, eine der<br />
größten Herausforderungen für das Leben im Sahel. Sie bedingt, dass in den nördlichen<br />
Gebieten des Sahel (im Gegensatz zum feuchteren Süden) kein sicherer Ackerbau mehr<br />
betrieben werden kann, hier dominieren daher vielfältige Formen der voll- und<br />
halbnoma-dischen Tierhaltung. Im Nordosten <strong>Mali</strong>s sind dies die vollnomadischen<br />
Stämme der Tuareg, weiter südlich vor allem die halbnomadischen Fulbe (vgl. Krings<br />
1993, 134-135).<br />
Abb. 4: Siedlungsgebiet der Tuareg (Quelle: Care 2008)<br />
105
Die Kolonialzeit brachte für die nomadischen Stämme Nord-<strong>Mali</strong>s weniger das Problem<br />
der „Seßhaftmachung“ als vielmehr die sukzessive Einschränkung ihre Landrechte. Die<br />
Ausdehnung der Feldbauzonen gen Norden führte zu Konflikten über angestammte<br />
Weideareale und Wasserstellen zwischen den Tuareg und sesshaften Siedlern. Die<br />
willkürlichen Grenzen, die mit der Unabhängigkeit der Sahelländer zementiert wurden,<br />
sorgen für weitere Schwierigkeiten. Eine großräumige Wandertierhaltung ohne Grenzverletzungen<br />
ist nicht mehr möglich. Die nomadische Lebensweise wurde in allen<br />
Sahelländern als rückständig und überkommen angesehen, die Seßhaftmachung der<br />
Stämme war (und ist) oft das erklärte Ziel. Nicht erkannt wird dabei meist, dass ihre<br />
nomadische Lebensweise die einzige ist, die in den Wüsten und Halbwüsten nachhaltig<br />
möglich ist. Die Stiefmütterliche Behandlung insbesondere der Tuareg führt bis heute<br />
immer wieder zu Spannungen und Konflikten.<br />
2.3. Das koloniale Erbe<br />
Der labile Naturhaushalt ist allerdings nicht die alleinige Ursache für die destabilisierte<br />
Landwirtschaft im Sahel. Die naturräumlichen Gegebenheiten ließen durchaus eine<br />
Selbstversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu. Verhindert wird dies im<br />
Wesentlichen auch durch die koloniale Ausrichtung auf den Export landwirtschaftlicher<br />
Güter anstatt auf agrarische Selbstversorgung. Diese Schieflage wurde wie in vielen<br />
Sahelländern so auch in <strong>Mali</strong> von den postkolonialen Eliten nicht beseitigt. Hauptexportgüter<br />
<strong>Mali</strong>s sind nach wie vor Baumwolle und Gold sowie Erdnüsse. Die<br />
Nahrungsmittelproduktion ist auf die Bedürfnisbefriedigung urbaner Eliten ausgerichtet<br />
(vgl. Krings 1993, 136). Eine weitere Hypothek aus der Kolonialzeit für die Sahelländer<br />
sind die künstlich gezogenen Staatsgrenzen. <strong>Mali</strong> als Binnenland ohne Zugang zum Meer<br />
hat dabei zusätzlich mit dem Problem zu kämpfen, dass Importgüter höhere<br />
Transportkosten aufweisen.<br />
2.4. Bevölkerungsexplosion<br />
Die Bevölkerung <strong>Mali</strong>s hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark zugenommen. Im<br />
Schnitt lag der Bevölkerungszuwachs von 1990 bis 2006 bei etwa 3 % pro Jahr (vgl.<br />
Weltbank 2008). Dies bringt eine Reihe von Problemen mit sich. Zunächst führt die<br />
steigende Nachfrage nach Lebensmitteln zu einer Ausweitung der Ackerflächen und<br />
zunehmender Entwaldung. Folge dieser Entwicklung ist zum einen die zunehmende<br />
Ausbreitung wüstenähnlicher Verhältnisse (Desertifikation). Zum Anderen werden<br />
gerade die ärmsten Bevölkerungsteile und insbesondere auch die Nomadenvölker in<br />
noch ungünstigere Räume abgedrängt, wo sie gezwungen sind, das Acker- und Weideland<br />
zu übernutzen, was wiederum die Desertifikation und Umweltzerstörung beschleunigt.<br />
(vgl. Krings 1993, 138-139). Konsequenz dieser Ursachenkette ist die Zunahme von<br />
Armut und Hunger, Armut und Hunger wiederum beschleunigen die Umweltzerstörung.<br />
106
2.5 Wirtschaftliche Defizite und Abhängigkeiten<br />
Nach wie vor hat die Landwirtschaft einen hohen Anteil an <strong>Mali</strong>s Wirtschaftsleistung,<br />
obwohl dieser kontinuierlich abgenommen hat: von 46% im Jahre 1990 auf 37% in 2006,<br />
der Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft liegt bei ca. 80 % (vgl. Broetz 1993,<br />
304; Weltbank 2008a, 394). Mit der Konzentration auf nur zwei Hauptexportgüter –<br />
Baumwolle und Gold – bleibt <strong>Mali</strong>s Wirtschaft stark abhängig von externen Faktoren wie<br />
dem Weltmarktpreis oder den Wetterbedingungen. Insbesondere in den 80er Jahren<br />
war der staatlich verwaltete Agrarsektor durch kontraproduktive politische Entscheidungen<br />
geprägt. Die Preise für Nahrungsmittel wurden staatlich festgelegt und zugunsten<br />
der städtischen Eliten niedrig gehalten wohingegen die Erzeuger kaum kostendeckend<br />
arbeiten konnten. Erst die sonst wenig erfolgreichen Strukturanpassungsprogramme von<br />
IWF und Weltbank Anfang der 90er Jahre konnten dieses Ungleichgewicht beenden (vgl.<br />
Broetz 1993, 306-307).<br />
<strong>Mali</strong>s Außenhandel ist defizitär. 2007 standen Importen im Wert von 1,59 Mrd. Euro,<br />
Exporte von 1,32 Mrd. Euro gegenüber (vgl. Weltbank 2008b). Der hohe Verschuldungsgrad,<br />
der <strong>Mali</strong> in den letzten Jahrzehnten fesselte, konnte durch weitreichende<br />
Schuldenerlassmaßnahmen 2006 deutlich verbessert werden. Betrug die Auslandsverschuldung<br />
2005 noch 65% des BIP, so waren es 2006 nur noch 27 % (vgl. BTI 2008,<br />
11). Nach wie vor gehört das Land zu den größten Empfängern internationaler<br />
Entwicklungshilfe. Pro Kopf beliefen sich die Leistungen 2005 auf 51 US$, während der<br />
Schnitt der Low-Income-Countries bei 17 US$ lag (vgl. ebda., 396-397).<br />
3. Entwicklung der Entwicklungszusammenarbeit<br />
Die Geschichte der Entwicklungspolitik in <strong>Mali</strong> lässt sich, wie in vielen anderen Ländern<br />
auch, in verschiedene Etappen oder auch „Entwicklungsdekaden“ einteilen. In den 60er<br />
Jahren standen Industrialisierung, Modernisierung und Wohlstand im Mittelpunkt aller<br />
Bemühungen. Die sogenannten Modernisierungsstrategien versuchten mittels massiver<br />
Kapitalspritzen das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, die Entwicklungsländer sollten auf<br />
dem „vorgezeichneten Weg der Industrieländer“ die Unterentwicklung ablegen. Statt des<br />
erhofften trickle-down-Effekts brachten diese von oben nach unten gerichteten Ansätze<br />
aber meist nur eine Verschärfung der Disparitäten mit sich und führten die Entwicklungsländer<br />
tiefer in die Abhängigkeit (vgl. Nuscheler 2006, 78). Zwar besann sich <strong>Mali</strong> in<br />
dieser Zeit auf die Bedeutung seines Agrarsektors. Allerdings geschah dies vor allem, um<br />
mit den Exporterlösen aus der Landwirtschaft die Modernisierung der urbanen Zentren<br />
finanzieren zu können. Aus der Vernachlässigung des ländlichen Raumes folgte eine<br />
Verstärkung der Landflucht, ein weiterer Schritt im vielbeschworenen „Teufelskreis der<br />
Armut“ war getan (vgl. Barth 1983, 321).<br />
Anfang der 70er Jahre zog der damalige Präsident der Weltbank Robert McNamara ein<br />
vernichtendes Fazit des Konzepts „Entwicklung durch Wachstum“. Er forderte eine<br />
Konzentration auf den Kampf gegen die Armut, Entwicklungsarbeit sollte an der Basis<br />
ansetzen, statt dem Ideal der Industrialisierung nach westlichem Vorbild<br />
hinterherzulaufen. Die Grundbedürfnisstrategien waren geboren. So orientierten sich an<br />
den Basisbedürfnissen der Bevölkerung. Aber nach wie verfolgte die Entwicklungs-<br />
107
zusammenarbeit einen top-down-Ansatz und war eurozentristisch geprägt, was<br />
zunehmend Misstrauen in den Entwicklungsländern hervorrief (vgl. ebda., 79-80).<br />
In den 80er Jahren, die manchmal auch als „das verlorene Jahrzehnt der<br />
Entwicklungspolitik“ bezeichnet werden (vgl. ebda., 80), begann in <strong>Mali</strong> ein Wandel hin<br />
zur Marktwirtschaft. Gezwungen durch die zunehmende Verschuldung des Landes<br />
versuchte der Militärdiktator Traoré, mit dem Internationalen Währungsfonds<br />
zusammenzuarbeiten. Die eingeleiteten Strukturanpassungsprogamme des IWF zielten<br />
auf eine vollständige Liberalisierung der Wirtschaft: Im- und Exportmonopole wurden<br />
aufgelöst, unrentable Staatsbetriebe geschlossen und rentable privatisiert, der öffentliche<br />
Dienst durch Entlassungen entschlackt und Sozialausgaben gekürzt (vgl. Broetz 1993,<br />
307-308). Allerdings waren die durchgeführten Maßnahmen nur wenig erfolgreich und<br />
nutzten vor allem der politischen Elite, was letztlich auch zum Sturz der Militärdiktatur<br />
beitrug (vgl. BTI 2007, 3).<br />
Mit dem Sturz Traorés im Jahre 1991 begann ein umfangreicher Demokratisierungs- und<br />
Dezentralisierungsprozess in <strong>Mali</strong>. Unter Präsident Konaré wurde die Liberalisierung von<br />
<strong>Mali</strong>s Wirtschaft weiter vorangetrieben: staatliche Elektrizitäts-, Wasser-, Textil- und<br />
Telekommunikationsunternehmen wurden privatisiert, staatliche Marktinterventionen<br />
und Preisfestsetzungen zurückgefahren. Letzteres nutzte vor allem der Landwirtschaft,<br />
die eine deutliche Produktionssteigerung verzeichnen konnte. Andere Wirtschaftszweige<br />
wie bspw. der Minenbergbau wurde für ausländische Investitionen geöffnet (vgl. ebda.)<br />
Konarés Nachfolger, General Touré (kurz ATT), führt die Reformpolitik seit 2002 fort.<br />
Lohn dieser Bemühungen waren weitreichende Schuldenerlässe durch den Internationalen<br />
Währungsfonds in den Jahren 2003 und 2006 (vgl. ebda.) <strong>Mali</strong>s politischer Erfolg<br />
steht allerdings in starkem Kontrast zu der nach wie vor katastrophalen wirtschaftlichen<br />
Lage des Großteils der Bevölkerung. Nach wie vor ist <strong>Mali</strong> stark von externer Hilfe<br />
abhängig. Diese wird seit Beginn der 90er Jahre verstärkt durch Nichtregierungsorganisationen<br />
(NGOs) geleistet, die mit Unterstützung der Basis eine Wirkung von<br />
unten nach oben erzielen wollen. Der politische Reformkurs erlaubt es den<br />
Geberländern zudem, verstärkt Finanzielle Zusammenarbeit (auch Budgethilfe genannt) in<br />
<strong>Mali</strong> zu leisten. Dabei werden unter Einforderung von Transparenz und Erfolgskontrollen<br />
finanzielle Mittel vom Geberland in den malischen Haushalt eingestellt, die für die<br />
Förderung der eigenen Entwicklung verwendet werden. (vgl. BMZ 2009a). Deutschland<br />
gehört dabei mit Frankreich, den USA, Kanada und den Niederlanden zu den wichtigsten<br />
Gebern <strong>Mali</strong>s. Die Bundesrepublik stellt für die bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit<br />
mit <strong>Mali</strong> von 2006 bis 2008 insgesamt 78 Millionen Euro zur Verfügung.<br />
Mit der malischen Regierung wurden die folgenden drei Schwerpunkte für die bilaterale<br />
Entwicklungszusammenarbeit vereinbart:<br />
Dezentralisierung und Kommunalentwicklung<br />
Landwirtschaft und nachhaltiges Ressourcenmanagement<br />
Trinkwasserversorgung und Abwasser- und Müllentsorgung<br />
Diese Schwerpunkte entsprechen den Zielen der nationalen malischen Strategie zur<br />
Armutsbekämpfung. Zusätzlich beteiligt sich die Bundesrepublik an der Bekämpfung von<br />
AIDS (vgl. BMZ 2009b).<br />
108
4. Entwicklungszusammenarbeit an Beispielen<br />
4.1. Das „Office du Niger“<br />
Mit seiner wechselvollen Geschichte geradezu beispielhaft für den Werdegang der<br />
Entwicklungspolitik ist das größte Bewässerungsprojekt Westafrikas, das „Office du<br />
Niger“ (ON). Das ON ist ein Gravitationsbewässerungssystem, d. h. Wasser gelangt<br />
ausschließlich<br />
über Niveauunterschiede auf die Felder. Der Staudamm bei Markala (1947), hebt den<br />
Wasserspiegel des Niger um 5,5 m über den niedrigsten Wasserstand. Über einen<br />
Zuleitungskanal fließt Wasser aus dem Staubecken zur Schleuse A, wo es durch drei<br />
Hauptkanäle bzw. ehemalige Flussbetten des Niger in die Zonen des ON weitergeleitet<br />
wird. Weitere Schleusensysteme verteilen das Wasser in kleinere Verteilerkanäle (vgl.<br />
Etz 2007, 29).<br />
Abb. 5: Projektgebiet des Office du Niger (Quelle: Etz 1997, 30)<br />
109
Das „Office du Niger“ mit Sitz in Ségou als halbstaatliche Gesellschaft wurde 1932 von<br />
der französischen Kolonialverwaltung ins Leben gerufen. Ziel war es, innerhalb von 50<br />
Jahren 960.000 ha Bewässerungsland. Zu gewinnen. Angebaut werden sollten vor allem<br />
Baumwolle, um die französische Textilindustrie zu stützen und Reis zur Ernährungssicherung.<br />
Dafür sollten bis zu 800.000 Arbeitskräfte im Projektgebiet angesiedelt<br />
werden. Zusätzlich sollte eine Trans-Sahara-Eisenbahn von Abidjan nach Algier den<br />
Abtransport der Ernteprodukte sicherstellen, die allerdings nie realisiert wurde (vgl.<br />
Barth 1983, 322-323). Bereits in der Anfangsphase zeigte sich die Unzulänglichkeit der<br />
Planungen. Es mangelte an nötigen Arbeitskräften, da sich die sesshaften Ackerbauern<br />
nicht freiwillig auf eine ungewisse Zukunft im Projektgebiet einlassen wollten. So wurden<br />
kurzerhand Arbeiter aus der Umgebung und aus ganz Französisch-Westafrika<br />
zwangsrekrutiert (vgl. Etz 2007, 30). Im Jahre 1947 wurde schließlich der Hauptdamm bei<br />
Markala fertig gestellt. Die Erwartungen der französischen Verwaltung konnten aber bei<br />
weitem nicht erfüllt werden.<br />
110<br />
„Die Investitionen für die bis dahin nur 25.000 ha bewässerten Felder waren enorm (2,3<br />
Milliarden €). Durch Mechanisierung der Anbaumethoden und Verpflichtung der<br />
angesiedelten als Lohnarbeiter versuchte man die Kontrolle über die Arbeiter noch zu<br />
erhöhen und die Produktion anzutreiben, doch dies misslang. Die koloniale Vision des<br />
delta mort als Baumwolllieferant für die französische Textilindustrie und als Reisversorger<br />
für Westafrika musste ständig nach unten redimensioniert werden. Als <strong>Mali</strong> 1960 die<br />
Unabhängigkeit erlangte, wurden nur 35-40.000 ha bewässert, weniger als 5 % der<br />
geplanten Fläche“ (ebda., 31).<br />
Nach der Unabhängigkeit <strong>Mali</strong>s wurde der ON zum Staatsbetrieb und die Reisproduktion<br />
in Kollektiven nach sowjetischem Vorbild umorganisiert. Der Anbau von Baumwolle im<br />
Delta wurde aufgrund zu geringer Erträge aufgegeben, stattdessen kam Zuckerrohr<br />
hinzu. Aber selbst massive Subventionen konnten die Zunahme der Armut unter den<br />
Bauern nicht verhindern. Die strenge staatliche Kontrolle sorgte zudem für Unmut unter<br />
den Siedlern (vgl. ebda.) Unter der Militärregierung Traorés konnten zwar einige<br />
Produktionsverbesserungen erreicht werden, aber die grundsätzlichen Probleme des<br />
Projekts nicht beseitigt werden. Die Erhöhung des Outputs stand in keinem Verhältnis zu<br />
den dafür notwendigen Kosten in dem zentralistischen und monopolistischen<br />
Großprojekt (vgl. Barth 1983, 329). Das Office du Niger war unrentabel, der gesunkene<br />
Preis für Reis deckte kaum noch die Produktionskosten, um 1980 es kam zu einem<br />
Einbruch der Agrarproduktion im ON (vgl. Etz 2007, 31-32).<br />
In den 80er Jahren wurden in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Geldgebern<br />
(Weltbank, Frankreich, Niederlande) Reformen des bis dato gescheiterten Großprojektes<br />
eingeleitet. Der Anbau wurde diversifiziert, die Bauern intensiv beraten und<br />
stärker beteiligt. So wurden ab 1984 Produzentenvereinigungen eingerichtet, die viele<br />
frühere Aufgaben des Office du Niger übernehmen und so eine stärkere Selbstbestimmung<br />
der Produzenten ermöglichen und ihre Position stärken sollten.<br />
„Liberalisierung der Vermarktung und Verarbeitung der Produkte, Restauration des<br />
Bewässerungsnetzes und die daran anknüpfende Ausweitung der Anbauflächen,<br />
Integration der Bauern und Dorfverbände in Entscheidungs- und Durchführungsprozesse<br />
sowie Diversifizierung, Intensivierung und Kreditmöglichkeiten machten ab 1982 den<br />
Office du Niger wieder zu einem Immigrationszentrum für die Bevölkerung der Region
und, in geringerem Ausmaße, ganz <strong>Mali</strong>s. Die Reisernte des Gebietes konnte bis zum<br />
Jahr 1994 verdreifacht werden und die Einnahmen der Bauern stiegen um 30 bis 70 %<br />
[…]. Eine umfassende Restrukturierung des Office du Niger erfolgte allerdings erst ab<br />
1994.“ (ebda. 33)<br />
1994 wurde das „Office du Niger“ in eine öffentlich-rechtliche Anstalt umgewandelt und<br />
ist seither nur noch für das Management der Wasserzufuhr sowie den Unterhalt des<br />
Wassernetzes zuständig. Die Kosten hierfür werden komplett aus den Wasserabgaben<br />
der ansässigen Bauern gedeckt. Zusätzlich stellt die Regierung Gelder für einige<br />
öffentliche Dienstleistungen (z.B. Bauernberatung, Infrastrukturverbesserungen, Landverwaltung)<br />
bereit. Außerdem wurde der malische Reismarkt liberalisiert und die daraus<br />
resultierenden Preissteigerungen sorgten in Verbindung mit Verbesserungen im Anbau<br />
für Ertragssteigerungen Mitte der 90er Jahre. Eine intensive Beteiligung der Bauern (z.B.<br />
über die sog. „Comités Paritaires“ oder die Wassernutzerorganisation OERT 4 ) an allen<br />
Planungs- und Entscheidungsprozessen sorgt für Akzeptanz des Projektes und ermöglicht<br />
so eine nachhaltige Steigerung der Effizienz (vgl. Etz 2007, 34).<br />
Bis 2020 soll das Office du Niger finanziert durch private Investoren von heute 70.682 ha<br />
auf ca. 200.000 ha ausgeweitet werden. Der ON soll in Zukunft das Werkzeug der<br />
Nahrungssicherung Westafrikas und der Sahelzone werden, in dem es etwa 100.000 ha<br />
Anbaufläche den Sahelländern zur Verfügung stellt (vgl. ebda., 27).<br />
4.2. <strong>Mali</strong> Nord<br />
Die bereits beschriebenen Konflikte zwischen den nomadischen Tuareg und den<br />
sesshaften Siedlern bzw. der malischen Regierung und der unerfüllte Wunsch nach<br />
Selbstverwaltung gipfelte Anfang der 90er Jahre in einer Rebellion der Tuareg mit<br />
bürgerkriegsähnlichen Ausmaßen. Mehr als 100.000 Menschen flüchteten zwischen 1990<br />
und 1994 aus der Region (diese und folgende Angaben über das Projekt <strong>Mali</strong> Nord<br />
stammen, wenn nicht anders vermerkt, aus <strong>Mali</strong> Nord 2009). Seit 1995 versucht das<br />
Programm „<strong>Mali</strong> Nord“ (ein Gemeinschaftsprogramm von GTZ und KfW), die<br />
bewaffneten Konflikte mit den Tuareg im Gebiet um Timbuktu zu überwinden.<br />
4 Organisation des Exploitants pour l’Entretien du Réseaux Tertiaire.<br />
111
Abb. 6: Projektgebiet des Programms <strong>Mali</strong> Nord (Quelle: <strong>Mali</strong> Nord 2009)<br />
Das Projekt <strong>Mali</strong> Nord umfasst eine Vielzahl verschiedene Kleinprojekte, die mehrere<br />
Schwerpunkte der Entwicklungsarbeit abdecken. Hauptaugenmerk liegt auf der<br />
wirtschaftlichen Förderung der Region. Zunächst sollten die lokalen Wirtschaftskreisläufe<br />
wiederbelebt werden. Waren und Dienstleistungen sollten dabei nicht von außerhalb<br />
importiert werden, sondern die Betroffenen sollten die Werte nach Möglichkeit selbst<br />
schöpfen. Entwicklungsgelder wurden dabei für die Löhne der lokalen Handwerker<br />
bereitgestellt, die bspw. die Unterkünfte für zurückkehrende Flüchtlinge errichteten.<br />
Ebenso wurden Mittel als Startkapital bzw. als Kredit an Gewerbetreibende vergeben. In<br />
einigen Dörfern konnten die geförderten Handwerker bereits Ende 1996 wieder<br />
selbständig wirtschaftlich arbeiten. 5 Ein Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auch auf<br />
der Förderung der Erwerbstätigkeit der Frauen. Des Weiteren unterstützt das<br />
Programm die nomadischen bzw. halbnomadischen Viehzüchter insbesondere durch eine<br />
Verbesserung der Gesundheit der Viehherden. Bspw. wurden ab 1995 jährlich Impfkampagnen<br />
durchgeführt, die von Jahr zu Jahr stärker und ab 2001 gänzlich von den<br />
Hirten selbst finanziert werden.<br />
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Sicherung der Wasserversorgung in der Region<br />
dar. Dafür wurden alte, versandete Brunnen wieder instandgesetzt und neue Brunnen<br />
errichtet. Dies geschah hauptsächlich durch lokale Brunnenbauer, die lediglich von<br />
Mitarbeitern der GTZ beraten und angeleitet wurden. Für die Versorgung der<br />
Viehherden dienen dabei die traditionellen Schachtbrunnen, in den das bis zu 60 Meter<br />
tiefe Grundwasser gefördert wird. Die begrenzt Fördermenge verhindert dabei, dass<br />
umliegende Weideflächen veröden. Der Zugang der Herden und Tierarten zu den<br />
Brunnen ist genau geregelt. Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser übernehmen<br />
neu errichtete mit Solarpumpen versehene Tiefbohrbrunnen.<br />
5 So z.B. in Lere (vgl. <strong>Mali</strong> Nord 2009).<br />
112
Abb. 7: Traditioneller Schachtbrunnen (Quelle: <strong>Mali</strong> Nord 2009)<br />
Das Programm <strong>Mali</strong> Nord fördert zudem den Ausbau der kleinbäuerlichen<br />
Bewässerungslandwirtschaft. Unter anderem auch im Rahmen der Budgethilfe werden<br />
Gelder für die Errichtung von Bewässerungssystemen bereitgestellt. In Kooperation mit<br />
dem malischen Beratungsdienst für Landwirte werden dabei fast ausschließlich lokale<br />
Arbeitskräfte eingesetzt, für Betrieb und Unterhalt der Anlagen sind die lokalen<br />
Produktionsgemeinschaften selbst verantwortlich. Im Rahmen des Programms wurden<br />
bislang 380 Motorpumpen zur Förderung der Bewässerungslandwirtschaft installiert, die<br />
Kosten für diese Anlagen müssen die Nutzergemeinschaften zu einem Drittel selbst<br />
tragen.<br />
Abb. 8: Errichtung einer Bewässerungsanlage für die Landwirtschaft (Quelle: <strong>Mali</strong> Nord 2009)<br />
Abb. 9: Errichtung einer Bewässerungsanlage für die Landwirtschaft (Quelle: <strong>Mali</strong> Nord 2009)<br />
113
Um die Dezentralisierung der Verwaltung zu fördern, unterstützt das Programm <strong>Mali</strong><br />
Nord außerdem die 1999 neu konstituierten Landgemeinden. Gefördert werden<br />
Projekte zum Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung, die von den Gemeinden selbst<br />
initiiert wurden, z.B. Wegebaumaßnahmen, Straßenreinigung, Müllabfuhr oder Ausbau<br />
der lokalen Märkte.<br />
Das BMZ zieht eine durchweg positive Bilanz seines Programms <strong>Mali</strong> Nord. Rund<br />
einhunderttausend Menschen sind an ihre Herkunftsorte zurückgekehrt und bestreiten<br />
heute selbständig ihren Lebensunterhalt. 80 öffentliche Gebäude sind in 45 ländlichen<br />
Gemeinden neu entstanden oder wurden vollständig instand gesetzt, daneben 200 offene<br />
Schachtbrunnen und 13 Wasserversorgungsanlagen (elektrisch oder solar betriebene<br />
Bohrbrunnen). Von 1996 bis 2007 sind 380 Diesel betriebene Motorpumpen importiert<br />
worden, die heute rund 10.000 Hektar bewässern, auf denen rund 40.000 Kleinbauern<br />
und -bäuerinnen arbeiten, die etwa 200.000 Familienangehörige unmittelbar ernähren<br />
und im Jahr 2006 mehr als 60.000 Tonnen ungeschälten Reis produziert haben. Fünf<br />
ländliche Kleinbanken (Mikrofinanzinstitutionen) sind gegründet worden und operieren<br />
bereits erfolgreich.<br />
5. Fazit<br />
Während unserer <strong>Exkursion</strong> hatten wir Gelegenheit eine ganze Reihe lokaler<br />
Entwicklungsprojekte zu besichtigen und mit zahlreichen Entwicklungs-Koordinatoren auf<br />
nationaler Ebene zu sprechen. Ansatzpunkt für die aktuelle Entwicklungszusammenarbeit<br />
ist eindeutig an der Basis, d. h., man finanziert keine monolithischen Großvorhaben, die<br />
an den Interessen der Betroffenen vorbei gehen, sondern fördert kleine, klar abgegrenzte<br />
Projekte. Dabei wird die lokale Bevölkerung sehr intensiv mit einbezogen bzw. die<br />
Projekte zum Teil von den Menschen vor Ort selbst initiiert und organisiert. Durch die<br />
Einbindung der örtlichen Bevölkerung wird deren Identifikation mit dem Projekt und<br />
damit dessen Aussicht auf Erfolg entscheidend verbessert. Darüber hinaus unterstützt<br />
dieses Vorgehen auch die nationale Strategie der Dezentralisierung der Verwaltung und<br />
der Entwicklung kommunaler Strukturen und trägt so dazu bei, das Leitbild von „Good<br />
Governance“ (auch gegen nach wie vor bestehende Widerstände) umzusetzen. 6<br />
Aber nicht nur auf lokaler Ebene setzen Nichtregierungsorganisationen verstärkt auf die<br />
Eigenverantwortlichkeit der lokalen Bevölkerung. Auch im Rahmen der internationalen<br />
Entwicklungspolitik hat sich die sog. Ownership der Zielländer als allgemein anerkanntes<br />
Prinzip durchgesetzt. Die Empfängerländer tragen dabei selbst die Verantwortung für die<br />
durchgeführten Projekte, denn wirklich nachhaltiger Wandel lässt sich nicht von außen<br />
erzwingen. Da allerdings die ODA (Official Devlopment Assistance) insbesondere westlicher<br />
Geberländer nach wie vor an Bedingungen gebunden ist, befürchten einige<br />
6 Eine gewisse Sonderstellung nimmt das oben beschriebene Kooperationsprogramm „<strong>Mali</strong> Nord“ ein: aufgrund<br />
seiner Ausmaße – das Interventionsgebiet umfasst 45 Landgemeinden (vgl. <strong>Mali</strong> Nord 2009) – und seines<br />
umfassenden Programminhaltes sehen einige Kritiker die Gefahr der Untergrabung der staatlichen Autorität im<br />
Projektgebiet. In gewissen Kreisen nennt man die Leiter des Programms auch „die Könige des Nordens“.<br />
Allerdings soll das Projekt seitens der GTZ 2011 auslaufen und dann in die Zuständigkeit des<br />
Landwirtschaftsministeriums eingegliedert werden.<br />
114
Akteure, dass sich die Verantwortlichen der Empfängerländer mehr an den Interessen<br />
der Geber als an den eigenen Interessen ihres Landes orientieren. Zudem befindet sich<br />
die internationale Entwicklungspolitik in einer Umstrukturierungsphase. Ziel dieser<br />
Reform im Rahmen der „Pariser Erklärung“ ist eine bessere Koordination unter den<br />
Geberländern. Die bereits angesprochene Budgethilfe wird von den Akteuren in <strong>Mali</strong> als<br />
nicht erfolgreich eingeschätzt. Insgesamt sei der Koordinations- und Verwaltungsaufwand<br />
bei dieser Art der Zusammenarbeit viel zu hoch, sie sei zu statisch und zu teuer und<br />
damit ineffektiv.<br />
Die besichtigten Projekte arbeiten allesamt in den Schwerpunktbereichen der deutschen<br />
Entwicklungszusammenarbeit (Dezentralisierung, Landwirtschaft und Ressourcenschutz,<br />
Trinkwasserversorgung und Abwasser- bzw. Müllentsorgung). Im Hinblick auf den<br />
Tuareg-Konflikt und das damit zusammenhängende Nomadenproblem lautet die offizielle<br />
Strategie zwar nicht Sedentarisierung zur Befriedung. Aber insbesondere im Raum von<br />
Timbuktu (dem Projektgebiet von „<strong>Mali</strong> Nord“) ist die zunehmende Sesshaftwerdung der<br />
nomadischen Stämme deutlich sichtbar. Dies geschieht aber weniger durch staatlichen<br />
Druck als vielmehr aufgrund immer schwieriger werdender Überlebensbedingungen in<br />
den Wüstenregionen. Die soziokulturellen Umwälzungen, die dieser Lebenswandel mit<br />
sich bringt, stellen eine zusätzliche Herausforderung dar, die es zu lösen gilt.<br />
Bleibt abschließend die Frage nach dem Sinn oder Unsinn von Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Entwicklungshilfe für Afrika wird massiv und radikal kritisiert – und<br />
zwar von Vertretern des „Nordens“ sowie von Afrikanern selbst. Die Entwicklungspolitik<br />
der Geberländer treibe die afrikanischen Nehmerländer in eine neue Abhängigkeit<br />
und behindere die Entwicklung eines afrikanischen Selbstvertrauens. Das daraus<br />
resultierende Anspruchsdenken auf afrikanischer Seite ebenso wie die Entwicklungszusammenarbeit<br />
zum Selbstzweck der Europäer ist in der Tat problematisch. Ist also<br />
alles für die Katz?<br />
Bundespräsident Horst Köhler wies jüngst darauf hin 7 , dass eine Partnerschaft auf<br />
gleicher Augenhöhe angestrebt werden sollte, eine Partnerschaft mit und nicht für Afrika.<br />
Denn vor dem Hintergrund einer globalisierten, zunehmend vernetzten Welt, sind wir<br />
geradezu auf eine Kooperation in wechselseitigem Interesse angewiesen. Es gilt globale<br />
Probleme wie Klimawandel, Armut und aus fehlenden Perspektiven vor Ort<br />
resultierende Migration, gemeinsam entgegen zu treten.<br />
Es ist sicherlich falsch, die bestehende Asymmetrie der Partner zu verleugnen. Wichtiger<br />
ist es hingegen, zu einem fairen Umgang zwischen Afrika und Europa zu finden.<br />
Entwicklungszusammenarbeit vor diesem Hintergrund ist notwendig und sinnvoll, wenn<br />
sie eine partnerschaftliche Basis hat und im Geiste der Gleichberechtigung geleistet wird.<br />
Aber Entwicklungszusammenarbeit ist nicht in der Lage, die verheerende Armut<br />
grundsätzlich und auf Dauer zu beseitigen. Hier muss vielmehr auf Ebene von<br />
Handelsverträgen angesetzt werden, denn wir können unseren Wohlstand in Europa<br />
unmöglich weiterhin auf Basis niedriger Preise halten. Eng verbunden ist hiermit auch das<br />
Thema Regierungsführung, der so genannten ‚Good Governance’ sowie der Zugang zu<br />
Bildung in afrikanischen Ländern.<br />
7 ZEIT FORUM POLITIK: "Ein neuer Blick auf Afrika?" Horst Köhler im Gespräch mit Prinz Asfa<br />
Wossen Asserate und Unomwinjo Katjipuka-Sibolile Moderation: Bartholomäus Grill (DIE ZEIT); Sonntag,<br />
19.04.2009, Thalia-Theater Hamburg.<br />
115
Literaturverzeichnis<br />
BARTH, Hans K. 1986: <strong>Mali</strong>. Eine geografische Landeskunde. Darmstadt.<br />
BROETZ, Gabriele 1993: <strong>Mali</strong>. In: NOHLEN, Dieter; NUSCHELER, Franz (Hg.) 1993:<br />
Handbuch der Dritten Welt. Westafrika und Zentralafrika. Bonn, 298-314.<br />
NUSCHELER, Franz 2006: Entwicklungspolitik. Bonn.<br />
KRINGS, Thomas 1993: Struktur- und Entwicklungsprobleme der Sahelländer. In:<br />
NOHLEN, Dieter; NUSCHELER, Franz (Hg.) 1993: Handbuch der Dritten Welt. Westafrika<br />
und Zentralafrika. Bonn, 130-155.<br />
WELTBANK 2008a: Weltentwicklungsbericht 2008. Agrarwirtschaft für Entwicklung.<br />
Düsseldorf.<br />
BMZ (Hg.) 2009a: Finanzielle Zusammenarbeit. URL:<br />
http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/zwischenstaatliche_ez/finanz_zusammenarbeit/i<br />
ndex.html , Stand 10.01.2009.<br />
BMZ (Hg.) 2009b: <strong>Mali</strong>. URL:<br />
http://www.bmz.de/de/laender/partnerlaender/mali/index.html , Stand 10.01.2009.<br />
BTI (Hg.) 2007: Bertelsmann Transformation Index. <strong>Mali</strong> Country Report. URL:<br />
http://www.bertelsmann-transformationindex.de/fileadmin/pdf/Gutachten_BTI_2008/WCA/<strong>Mali</strong>.pdf<br />
, Stand 10.01.2009.<br />
CARE (Hg.) 2008: Tuareg. Frei im Wandern und im Geist.<br />
http://www.care.de/fileadmin/redaktion/service/downloads/CARE_Tuareg.pdf ,<br />
Stand 20.12.2008.<br />
ETZ, Swen 2007: Möglichkeiten und Grenzen der Verbesserung des nachhaltigen<br />
Kanalunterhalts durch bäuerliche Selbstorganisation. Das Beispiel der OERT im<br />
Bewässerungsgebiet des Office du Niger/<strong>Mali</strong>. URL:<br />
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2007/1272/pdf/PKS41.pdf , Stand 10.01.2009.<br />
NUSCHELER, Franz 2008: Die umstrittene Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit.<br />
URL: http://inef.uni-due.de/page/documents/Report93.pdf, Stand 20.12.2008.<br />
MALI NORD (Hg.) 2009: Programm <strong>Mali</strong> Nord. URL: http://www.mali-nord.de ,<br />
Stand 10.01.2009.<br />
UNDP (Hg.) 2008: The Human Development Index. Going beyond income. <strong>Mali</strong>. URL:<br />
http://hdrstats.undp.org/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_MLI.html ,<br />
Stand 10.01.2009<br />
WELTBANK (Hg.) 2008b: <strong>Mali</strong> Country Brief. URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/<br />
EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/MALIEXTN/0,,menuPK:362193~pagePK:141132<br />
~piPK:141107~theSitePK:362183,00.html , Stand 20.12.2008.<br />
116
TEIL II: KURZREFERATE<br />
117
118
Reiseinformationen:<br />
Was bei Reisen nach <strong>Mali</strong>,<br />
in einen „fremden“ Kulturraum,<br />
von Bedeutung ist<br />
Julia Zimmermann<br />
119
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung...................................................................................................................................... 121<br />
2. Verhaltenstipps ........................................................................................................................... 121<br />
3. Sprache(n) – Bambara ............................................................................................................... 123<br />
4. Essen und Speisen ...................................................................................................................... 123<br />
5. Resümee....................................................................................................................................... 124<br />
120
1. Einleitung<br />
Zur Vorbereitung auf eine <strong>Exkursion</strong> in ein fremdes Land gehören neben der<br />
geografischen, der politischen und der materiellen auch die Vorbereitungen auf die<br />
Kultur. Anders als in europäischen oder westlich geprägten Ländern kann <strong>Mali</strong> als<br />
afrikanisches Land als eine Herausforderung bezüglich der Kommunikation und<br />
Verhaltensweisen empfunden werden.<br />
In Westafrika können sogar Alltäglichkeiten einen oft völlig unerwarteten Verlauf<br />
nehmen, es können sich überraschende Hindernisse, aber auch unerwartete Möglichkeiten<br />
auftun.<br />
Das eigentlich Faszinierende dieser Region sind die Menschen mit ihrer lebendigen<br />
Kultur. Fürsorge und Gastfreundschaft sind in <strong>Mali</strong> tief verwurzelte Bestandteile des<br />
Lebens. Besonders im ländlichen Bereich, stellen Freundlichkeit, Höflichkeit und<br />
Offenheit im Umgang miteinander hoch geschätzte Werte dar.<br />
Kommunikation beginnt mit kleinsten Gesten und bereits ein Lächeln kann Berge<br />
versetzten. Erweist man den Menschen ihren Respekt, achtet ihre Traditionen und bringt<br />
etwas Geduld auf, so wird man es in <strong>Mali</strong> nicht schwer haben.<br />
2. Verhaltenstipps<br />
Die folgenden Informationen sind ein Versuch einen Einblick in die Verhaltensweisen des<br />
täglichen Lebens, der Bräuche und Wissenswertes zu vermitteln.<br />
● In <strong>Mali</strong> wird sehr viel Wert auf Höflichkeit und Anstand gelegt. Höflichkeitsformeln<br />
bilden die Grundlage des Begrüßungszeremoniells ohne dass kein auch noch so<br />
unwichtiges Gespräch beginnt. Die Begrüßung ist nicht nur ein Austausch einer kurzen<br />
Grußformel, sondern eine regelrechtes Ritual, bei dem nicht nur die Befindlichkeit des<br />
Gegenüber erfragt wird, sondern die des Ehepartners, der Kinder, der gesamten Familie,<br />
der Arbeit etc. Es wird sich Zeit für den Anderen und die Muße zu plaudern genommen.<br />
Dieser für die <strong>Mali</strong>er übliche "Smalltalk" kann sich hinziehen und verläuft aber zumeist in<br />
sehr heiterer Atmosphäre. Trifft man eine Person mehrmals am Tag, ist sie erneut zu<br />
grüßen (Vgl. Ham 2006, 42). Muss auf der Straße nach dem Weg gefragt werden, so<br />
sollte, mit einem „Guten Tag wie geht es Ihnen?“ begonnen werden und dann erst die<br />
eigentliche Frage gestellt werden, um „nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen“, was<br />
als unhöflich empfunden würde.<br />
● „Die Europäer haben die Uhr, die Afrikaner die Zeit“ (Därr, Göttler 2005, 45). Was<br />
deutlich zum Ausdruck bringt, wie wichtig es ist auch in frustrierenden Situationen<br />
entspannt, freundlich, respektvoll und geduldig zu bleiben, um den Stolz der Gastgeber<br />
nicht zu verletzten.<br />
● Eine weitere äußerst wichtige Verhaltensregel ist der Gebrauch der rechten Hand. Es<br />
wird nur mit der rechten Hand gegessen, Geschenke werden mit der rechten Hand<br />
gereicht und beim Einkauf sollte die Ware stets mit der rechten Hand angefasst werden.<br />
Die linke Hand gilt als Arbeitshand und als unrein, da man sich mit ihr den Po reinigt (Vgl.<br />
Därr, Göttler 2005, 62).<br />
● In <strong>Mali</strong> als einem islamisch geprägten Land, ist es wichtig, die Gebetszeiten und<br />
121
eligiösen Feste zu respektieren sowie die herrschenden Sitten und Gebräuche zu<br />
beachten. Vor dem Betreten einer Moschee, bzw. der Gebetshalle, sind die Schuhe<br />
auszuziehen, denn Moscheen dürfen nur in Strümpfen oder barfuss betreten werden<br />
(Vgl. Ham 2006, 47).<br />
● Versprechungen sollten eingehalten oder vermieden werden. Im Zweifelsfall ist es<br />
vertretbar vage Formulierungen wie „Wir werden sehen“, „Es liegt in Gottes Händen“ o.<br />
Ä. zu verwenden. Werden z. B. Fotos versprochen, sollten sie auch geschickt werden<br />
(Vgl. Därr; Göttler 2005, 60).<br />
● Gemeinsames Essen ist ein wichtiger Teil der Gastfreundschaft, deshalb gilt es als<br />
unhöflich, Essen abzulehnen. Um ihnen nichts wegzuessen, kann eine kleine Ausrede<br />
oder Entschuldigung, wie: ich habe gerade gegessen, ich bin krank oder ich habe<br />
Magenschmerzen, hilfreich sein (Vgl. dies.).<br />
● Selbstbeherrschung ist den <strong>Mali</strong>ern sehr wichtig, sie zeigen ihre Emotionen nicht<br />
öffentlich. Das Austauschen von Zärtlichkeiten (Küssen, Umarmen) in der Öffentlichkeit<br />
gilt bei ihnen als unanständig und unpassend.<br />
● Obwohl es auch in <strong>Mali</strong> gebräuchlicher wird, dem Gegenüber in die Augen zu schauen,<br />
wird der direkte Augenkontakt vermieden. Ein betontes zur Seite schauen bei der<br />
Begrüßung gilt als Zeichen des Respekts, vor allem gegenüber Älteren. In <strong>Mali</strong> spielt die<br />
Hierarchie eine große Rolle. Wenn ein <strong>Mali</strong>er jemanden während einer Unterhaltung<br />
nicht in die Augen schaut, ist das nicht als Kälte oder Ablehnung zu werten, sondern als<br />
ein Zeichen von Höflichkeit (Vgl. Ham 2006, 42).<br />
● Es macht einen guten Eindruck bei einem Besuch in ländlichen Gegenden den<br />
Dorfältesten die Ankunft anzukündigen, ihn zu begrüßen und seine Erlaubnis einzuholen,<br />
bevor man durch das Dorf wandert.<br />
● Den Armen zu helfen ist ein Teil der afrikanischen Kultur und eine Säule des Islams.<br />
Dennoch sollten nicht einfach Geschenke an bettelnde Kinder verteilt werden, um diese<br />
nicht zu verführen und bei ihnen das Bild des reichen Touristen zu erzeugen (Vgl. ders.,<br />
40).<br />
● Da <strong>Mali</strong> ein moslemisches Land ist, ist Fotografieren ein etwas sensibles Thema. Der<br />
islamische Glaube verbietet es, Menschen abzubilden. Sollen Menschen fotografiert<br />
werden, ist es empfehlenswert vorher um Erlaubnis zu fragen. Es ist verboten, Polizei,<br />
Kontrollstellen und militärische Objekte aufzunehmen. Manchmal verlangen die<br />
Menschen Geld für Fotos. Besser ist es erst ein bisschen Smalltalk führen, um dann<br />
freundlich zu fragen (Vgl. Därr; Göttler 2005, 62).<br />
● Die Kleidung und das äußere Erscheinungsbild sind in Westafrika sehr wichtig.<br />
Kleidung ist ein Statussymbol, es wird viel Wert auf ordentliche Kleidung gelegt.<br />
Ungepflegt und in abgerissenem Outfit herumzulaufen, könnte als ungeschickt oder sogar<br />
als Provokation empfunden werden. Als Reisender sollte man sich eher konservativ<br />
kleiden. Denn Sporthemden, Shorts oder enge Hosen können als Angriff empfunden. Es<br />
ist angebracht in der Öffentlichkeit lange Röcke oder Hosen zu tragen, Schultern und<br />
Oberarme sowie die Beine vollständig zu bedecken. Speziell für Frauen gilt, um lokale<br />
Gegebenheiten zu respektieren sollten sie sittsam und anständig gekleidet sein, um<br />
Schwierigkeiten zu minimieren (Vgl. Ham 2006, 42). Allgemein kann gesagt werden, je<br />
besser man gekleidet ist, umso besser wird man aufgenommen.<br />
● Neben den persönlichen Gegenständen, die jeder für wichtig hält, eignen sich als<br />
Geschenke und Tauschobjekte z. B. Ansichtskarten von zu Hause, Seifen oder auch<br />
gebrauchte, gut erhaltene Kleidung. Fotos von Zuhause, der Familie oder der<br />
Heimatstadt kommen immer gut an, da man so eine Person mit Geschichte und<br />
Vergangenheit für die Einheimischen ist (Vgl. ders.).<br />
122
Es ist zu empfehlen ein Hals- bzw. Kopftuch mitzunehmen, das vielfältige Verwendung<br />
finden kann: zum Schutz vor Sonne, bei Busfahrten vor Erkältung, als Verbandszeug oder<br />
als Allzweckbeutel.<br />
3. Sprache(n) – Bambara<br />
Neben Französisch als Amtssprache ist Bambara die meistgesprochene Sprache in <strong>Mali</strong>.<br />
Weitere Sprachen sind zum Beispiel die Dogon-Sprachen, Fula, Songhaï, Soninke,<br />
Tamashek und Bozo.<br />
Ein paar Wörter oder Sätze der lokalen Sprache zu lernen macht einen guten Eindruck,<br />
kann sehr nützlich sein und vieles erleichtern (Vgl. Ham 2006, 42).<br />
Im Folgenden ein paar Vokabeln in Bambara:<br />
- Toubabou/ Toubab - Wort für Weißer<br />
- I be di? - Wie geht es dir?<br />
- Ni Ala sonna - So Gott will.<br />
- I togo ye di? - Wie heißt du?<br />
- N togo ye - Ich heiße<br />
- I ni sogoma - Guten Morgen<br />
- Nse - Danke<br />
- I ni tile! - Guten Tag (12-16 Uhr)<br />
- I ni wula - Guten Tag (16 Uhr - bis Dunkelheit)<br />
- I ni su - Guten Abend<br />
- Ayiwa, ne tagara! - Auf Wiedersehen!<br />
- Hippo - <strong>Mali</strong><br />
- n b’a fe - Ich möchte<br />
- n t’a fe - Ich möchte nicht<br />
- nburu - Brot<br />
- ji - Wasser (Straßenverkäufer rufen häufig: „ji be“ – verkaufe<br />
Wasser)<br />
(Vgl. Därr, Göttler 2005, 798)<br />
4. Essen und Speisen<br />
Der Speiseplan der Bevölkerung <strong>Mali</strong>s ist einfach. Regional verschieden wird dreimal am<br />
Tag eine Schüssel Hirsebrei, Yam-Wurzel, Maisbrei oder Reis, mittags und abends meist<br />
mit einer Gemüse-, Fisch-, oder Fleischsoße gegessen (Vgl. Ham 2006, 490). Es gibt eine<br />
Vielzahl an Saucen, in einer Vielfalt an Variationen, die das Essen schmackhaft machen.<br />
Ein sehr bekanntes Gericht in <strong>Mali</strong> ist das „Mafé“, auch „Riz Arachide“ genannt. Es<br />
besteht aus Reis mit Erdnusssauce. Die Erdnuss ist für die Ernährung sehr bedeutsam. Sie<br />
dient als Öl- und Pflanzenfettlieferant und wird zur Anreicherung von Sauce verwendet.<br />
Des Weiteren findet man Riz Yollof (Reis mit Sauce), Poulet Yassa (Hühnchen in<br />
123
Zwiebelsauce) und entlang des Nigers „Capitaine“, dem Nilbarsch auf den Speisekarten.<br />
Zum Essen setzt man sich in der Regel auf einen kleinen Holzschemel in einen Kreis. Vor<br />
der Mahlzeit wird ein Gefäß mit Wasser zum Händewaschen gereicht. Das Essen selbst<br />
wird in einer großen Schüssel serviert, die in die Mitte auf den Boden gestellt wird.<br />
Gegessen wird mit der rechten Hand. Jeder isst stets vom Rand zur Mitte hin, dem Gast<br />
werden in der Regel die besten Stücke zugeschoben(Vgl. Därr; Göttler 2005, 50).<br />
Nach dem Essen oder auch zwischendurch wird eine Teezeremonie zelebriert. Sie ist<br />
eine gute Gelegenheit mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen.<br />
Erwähnenswert ist auch ein bei uns unbekanntes Gemüse, genannt „Jaxatu“ oder „lokale<br />
Aubergine“. Sie sieht wie eine gelbe und unreife Tomate aus und schmeckt bitter (Vgl.<br />
Ham 2006, 52).<br />
5. Resümee<br />
„Reisen heißt leben lernen“, lautet ein geflügeltes Wort der Toureg. Eine Reise nach <strong>Mali</strong><br />
kann als ein Kennen lernen einer anderen Lebensart und –haltung gesehen werden, die<br />
bereichern. Die gezeigten Hinweise oder Verhaltensweisen sind nur ein Ausschnitt aus<br />
vielen kleinen Abweichungen zu unserem täglichen Leben. Es gibt noch weitere Nuancen,<br />
die <strong>Mali</strong> als Kulturraum prägen und interessant machen. Wenn man versucht die<br />
erwähnten Hinweise einzuhalten kann man einen sehr angenehmen Aufenthalt in <strong>Mali</strong><br />
erleben und der Umgang mit der Fremdartigkeit fällt einem leichter. Je respektvoller,<br />
höflicher und freundlicher wir ihnen begegnen, desto aufgeschlossener, toleranter und<br />
unkompliziert geben sie sich.<br />
124
Literaturverzeichnis<br />
DÄRR, Erika; GÖTTLER, Gerhard 2005: Reise Know How Westafrika Sahelländer. Bd. 1, 7.<br />
Aufl., Bielefeld.<br />
HAM, Anthony 2006: Lonely Planet West Africa. 6. Aufl., Footscray; Victoria.<br />
125
126
Timbuktu –<br />
Entwicklung einer nicht nur historischen Metropole<br />
Friederike Brumhard<br />
127
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung...................................................................................................................................... 129<br />
2. Etymologie ................................................................................................................................... 129<br />
3. Geographie .................................................................................................................................. 129<br />
4. Geschichte ................................................................................................................................... 130<br />
4.1. Gründung und Frühzeit ..................................................................................................... 130<br />
4.1.1. Gründung ca. 1100 ..................................................................................................... 130<br />
4.1.2. Reich <strong>Mali</strong> 1326........................................................................................................... 130<br />
4.1.3. Das Reich Songhai 1468/69 - Die „goldene Stadt“.............................................. 131<br />
4.2. Frühe Neuzeit...................................................................................................................... 132<br />
4.2.1. Die Herrschaft Marokkos 1591............................................................................... 132<br />
4.2.2. Die Herrschaft der Fulbe von Mesina 1826.......................................................... 133<br />
4.3. Kolonialzeit .......................................................................................................................... 133<br />
4.4. Republik <strong>Mali</strong> ....................................................................................................................... 134<br />
5. Bevölkerung................................................................................................................................. 134<br />
6. Kultur und Sehenswürdigkeiten.............................................................................................. 135<br />
6.1. Weltkulturerbe ................................................................................................................... 135<br />
6.2. Weitere Sehenswürdigkeiten........................................................................................... 135<br />
7. Wirtschaft .................................................................................................................................... 136<br />
8. Mythos Timbuktu ....................................................................................................................... 137<br />
128
„Timbuktu.<br />
Die Perle Afrikas.<br />
Die unauffindbare prächtige Stadt.<br />
Truhe aller Schätze,<br />
Sitz aller barbarischen Götter.<br />
Herz der unbekannten Welt,<br />
Bastion mit tausend Geheimnissen,<br />
gespenstisches Imperium aller Reichtümer,<br />
verfehltes Ziel endloser Reisen,<br />
Quelle aller Gewässer und<br />
Traum eines jeden Himmels.<br />
Timbuktu.<br />
Die Stadt, die kein Weißer je gefunden hat.“<br />
Alessandro Baricco (Baricco 2003, 73 f.)<br />
1. Einleitung<br />
Das oben genannte Zitat macht deutlich, das Timbuktu für uns weit mehr ist als eine<br />
kleine Wüstenstadt in Westafrika, die nach ihrer heutigen Bedeutung eigentlich keiner<br />
kennen dürfte. Es ließen sich endlos weitere Äußerungen anführen, die alle eines<br />
gemeinsam haben: Sie beschreiben Timbuktu als geheimnisvollen, reichen, mysteriösen,<br />
fantastischen Ort.<br />
Durch die folgende Beschreibung der Entwicklung Timbuktus von der Gründung bis<br />
heute wird an verschieden Stellen deutlich werden, wie diese Zuschreibungen entstehen<br />
konnten und welchen Timbuktu tatsächlich heute noch gerecht wird.<br />
2. Etymologie<br />
Es gibt verschiedene Ansätze für die Herleitung des Namens Timbuktu.<br />
Der französische Linguist René Basset leitet den Namen von einer altberberischen<br />
Wortwurzel ab, die „weit entfernt“ oder „versteckt“ bedeutet (Vgl. Basset 1909, 198.).<br />
3. Geographie<br />
Timbuktu liegt am südlichen Rand der Sahara 5km entfernt vom Niger am nördlichsten<br />
Punkt seines Laufes. Bei starkem Hochwasser füllen sich längst ausgetrocknete<br />
Nebenarme des Niger, die „Kanäle der Flusspferde“ tragen, und verursachen in einigen<br />
Stadtteilen heftige Überschwemmungen, zuletzt 2003. (Held 2004, 6.).<br />
Damit ist Timbuktu sehr abgelegen und auch heute ist es immer noch schwierig, den Ort<br />
zu erreichen. Die Schifffahrt ist nur möglich, wenn der Wasserstand es erlaubt. Die<br />
129
Straßen durch die Savanne vom Süden aus versanden schnell und sind dann zeitweise<br />
unpassierbar. Die modernste Variante der Anreise erfolgt über den Flughafen Timbuktu,<br />
der regelmäßig von der Hauptstadt Bamako angeflogen wird.<br />
Das Klima entspricht dem einer Halbwüste, es weht stets der trockenheiße Harmattan-<br />
Wind aus der Sahara. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei 28° C, wobei die<br />
Monate Mai und Juni mit etwa 34° C am heißesten sind. Der durchschnittliche jährliche<br />
Niederschlag beträgt 170mm. Juli und August sind mit jeweils etwa 56-66mm die<br />
feuchtesten Monate. Die Regengüsse können sintflutartig auftreten und große Schäden an<br />
den aus Lehm erbauten Wohnhäusern und Moscheen verursachen. An spärlicher<br />
Vegetation finden sich hier Dornenbüsche, Tamarisken, Akazien, und Ginster, aber auch<br />
der Baobabs und Palmen, sowie eine Reihe von Nutzbäumen (Held 2004, 6 ff.).<br />
4. Geschichte<br />
Die Geschichte Timbuktus ist wechselvoll, mehrere Reiche unterwarfen und regierten<br />
die Stadt.<br />
Dies wird im Folgenden dargestellt.<br />
4.1. Gründung und Frühzeit<br />
4.1.1. Gründung ca. 1100<br />
Zur Gründung Timbuktus herrscht keine einhellige Meinung. Die Gründung ist nach dem<br />
Tarikh Es-Soudan, einer Chronik des Songhai-Reiches aus dem 17. Jahrhundert, zu Beginn<br />
des 12. Jahrhunderts anzusetzen. Sie besagt, dass Timbuktu von nomadisierenden<br />
Messufa-Tuareg an einer Wasserstelle in der Nähe des Nigerbogens gegründet wurde.<br />
Vermutlich gehen die Ursprünge aber bis ins 9. oder 10. Jahrhundert zurück und<br />
wahrscheinlich müssen schwarzafrikanische Songhai als Gründer des Ortes angesehen<br />
werden (Vgl. Es-Sa’di 1964, 35 f.).<br />
4.1.2. Reich <strong>Mali</strong> 1326<br />
Die Stadt gehörte ab dem 13. oder frühen 14. Jahrhundert zum <strong>Mali</strong>-Reich. Der erste<br />
historisch verbürgte und wohl legendärste Herrscher Timbuktus war Kankan Musa,<br />
König von <strong>Mali</strong> von 1312 bis 1337 (Vgl. Ki-Zerbo 1981, 137.). In den Jahren 1324/25<br />
unternahm er eine prunkvolle Pilgerreise nach Mekka, auf der er von angeblich 60.000<br />
Bediensteten begleitet worden war, und zwei Tonnen Gold mit sich geführt haben soll.<br />
Um die arabischen Herrscher zu beeindrucken, verteilte er so viel Gold, dass in Ägypten<br />
für Jahre der Goldpreis sank und Kankan Musa sich selbst Mittel für die Rückreise leihen<br />
musste. Kankan Musa wurde auf seiner Rückreise von Gelehrten und Handwerkern u. a.<br />
130
nach Timbuktu begleitet. Die Stadt war strategisch von Bedeutung, um die Macht am<br />
Nigerbogen zu festigen. Der Herrscher <strong>Mali</strong>s übernahm die Regierung und ließ vom<br />
Dichter und Architekten Es-Saheli seinen Palast, den Madugu, und die Moschee Djingere<br />
Ber errichten. Timbuktu erlebte einen ersten Aufschwung und wuchs, begünstigt durch<br />
die Stabilität des gewaltigen Reiches <strong>Mali</strong>, zum religiösen und wirtschaftlichen Zentrum<br />
heran (Vgl. Es-Sa’di 1964, 13 ff.).<br />
Die Geschichte vom unermesslichen Reichtum eines großen Königs im Inneren Afrikas<br />
wurde durch Kaufleute auch nach Europa getragen. In den Hafenstädten verbreiteten<br />
Seeleute Geschichten wie diese und schmückten sie durch ihre Phantasie aus. Auf einer<br />
Karte von Abraham Cresques aus dem Jahr 1375 ist Kankan Musa mit Krone, Zepter<br />
und einer Kugel dargestellt, alle Insignien sind aus Gold. Neben seinem Thron, nördlich<br />
eines Sees, ist erstmals Timbuktu (Tenbuch) in einer Karte eingezeichnet.<br />
Abb. 1: Cresques, Abraham (1375): Katalanischer Atlas (http://www.manntaylor.com/africa1.html, Abruf v.<br />
01.05.09)<br />
4.1.3. Das Reich Songhai 1468/69 - Die „goldene Stadt“<br />
Die größte Blüte erreichte die Stadt unter den Songhai. 1468/69 eroberte Sonni Ali<br />
Timbuktu. Er leitete die Handelskarawanen nun nicht mehr länger durch Walata, sondern<br />
durch Timbuktu und Gao, so dass besonders Timbuktu zum Handelsmittelpunkt<br />
avancierte. Es wurden besonders Salz, Gold und Sklaven aus dem Mossi Land Richtung<br />
Norden transportiert, aber auch Elfenbein, Moschus, Kolanüsse, Pfeffer, Gummi,<br />
Lederwaren sowie Hirse aus dem Süden Westafrikas. Im Gegenzug gelangten aus dem<br />
Norden Metalle und Metallfertigprodukte, Pferde, Waffen, Seide, Schmuck, und Datteln,<br />
aber auch Bücher und Wissen nach Timbuktu. Händler kamen von weit her, um dort<br />
Geschäfte zu machen oder um sich niederzulassen und ihnen folgten die Gelehrten, die<br />
hier ein kosmopolitisches Umfeld fanden. Zu den Lehrern strömten wiederum die<br />
Schüler, so dass sich Timbuktu auch als Mittelpunkt des islamischen Geisteslebens in<br />
131
Westafrika entwickelte. Zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert gab es 150-180<br />
Koranschulen, an denen häufig von einem einzigen Lehrer religiöse und juristische<br />
Themen unterrichtet wurden. An der Sankoré-Mosche existierte eine Medresa,<br />
vergleichbar einer mittelalterlichen Universität, an der die arabische Sprache, Rhetorik,<br />
Astrologie, die Rechtsprechung und die Schriften des Korans gelehrt wurden (Vgl. Barth<br />
1858, Bd. 4, 421 f, 619 ff.).<br />
Auch in dieser Periode wurde in Europa die Illusion von Timbuktu als „goldene Stadt“<br />
weiter genährt, beispielsweise durch die Beschreibungen von Leo Africanus, der unter<br />
dem Namen Al-Hassan ben Mohammed ben Ahmed al-Wazzan al Gharnati al-Fassi im<br />
Jahr 1494 in Granada geboren, aber in Fes aufgewachsen ist. Als Diplomat besuchte er<br />
auf seinen Reisen 1510/11 sowie 1512/14 Timbuktu. Die Reise des Leo Africanus hatte<br />
möglicherweise zum Ziel, neue Handelswege zu erkunden (Vgl. Rauchenberger 1999, 36.,<br />
44., 52., 60.). Leo Africanus betont neben den Reichtümern den hohen Stellenwert von<br />
Bildung und Religion in der Stadt:<br />
132<br />
„[...] Der König von Tombutto hat einen großen Schatz von Edelsteinen<br />
und Goldbarren, die teils 50, teils 300 Pfund wiegen. [...] In dieser Stadt<br />
gibt es viele Gelehrte, Vorbeter und Richter, die der König alle unterhält;<br />
er achtet die gebildeten Männer sehr. In Tombutto werden auch viele<br />
Bücher abgesetzt, die aus Barbaria kommen und die alle handgeschrie-<br />
ben sind. Wer Bücher herbeischafft, verdient daran mehr als am Rest<br />
seiner Ware. [...]“ (Rauchenberger 1999, 280 f.)<br />
Sein ursprünglich nicht für den Druck vorgesehenes Manuskript wurde 1550 in Venedig<br />
publiziert, jedoch hatte der Herausgeber Ramusio die Daten durch phantasiereiche<br />
Übertreibungen ergänzt und zementierte damit den Mythos von der unermesslich<br />
reichen Stadt in Afrika. Vor allem die Zahlen, die den Goldhandel betrafen, waren<br />
offenbar bewusst verfälscht worden, um den Absatz des Buches zu steigern (Vgl.<br />
Rauchenberger 1999, 126., 140.).<br />
4.2. Frühe Neuzeit<br />
4.2.1. Die Herrschaft Marokkos 1591<br />
1578 wurde Timbuktu von den Truppen des marokkanischen Sultans Mulai Ahmad al-<br />
Mansur erobert. Die marrokanische Herrschft führte in Timbuktu zum wirtschaftlichen<br />
und intellektuellen Niedergang bis hin zu anarchischen Zuständen, die Stadt konnte nie<br />
mehr ihre alte Blüte entfalten und verlor an Bedeutung. Auch die Karawanen fielen<br />
zunehmend bescheidener aus, was auch am Niedergang des Transsaharahandels<br />
zugunsten des Handels über die Atlantikküste lag (Vgl. Barth 1858, Bd. 4, 442 f.).
4.2.2. Die Herrschaft der Fulbe von Mesina 1826<br />
Zwischen 1826 und 1862 stand die Stadt unter der Oberhoheit des Fulbe-Kalifats von<br />
Massina, jedoch lag die eigentliche Autorität in der Hand des Kunta-Clans der al-Baqquai,<br />
die im 19. Jahrhundert als die bedeutendsten Korangelehrten im westlichen Sudan galten.<br />
Zur Zeit dieser Spannungen gelangte Heinrich Barth nach Timbuktu. Er hielt sich in<br />
britischem Auftrag von September 1853 bis April 1854 in Timbuktu auf, um<br />
Handelsbündnisse abzuschließen. Die Fulbe, die die Stadt regierten, hätten einen<br />
Christen nicht toleriert. So reiste er im Gebiet der Fulbe als Muslim gekleidet. In<br />
Timbuktu gab es wegen seiner Religion ständig bedrohliche Auseinandersetzungen, die<br />
ihn zu dem langen Aufenthalt zwangen (Vgl. Barth 1858, Bd. 4, 447 ff.). Zu dieser Zeit<br />
war Timbuktu für Europäer die ,verbotene Stadt’.<br />
Dieses Verbot war religiös und bezog sich auf Christen und Juden, hatte seinen<br />
Hintergrund aber wahrscheinlich in der Sicherung von Handelsinteressen und der<br />
allgemeinen Unerreichbarkeit für Europäer. So schreibt Leo Africanus: „Der König von<br />
Tombutto ist Todfeind der Juden, von denen man deshalb nicht einen in jenem<br />
Landstrich antrifft“ (Rauchenberger 1999, 281.).<br />
4.3. Kolonialzeit<br />
Die Kolonialzeit begann in Timbuktu trotz des erbitterten Widerstandes der Tuareg und<br />
gegen den Willen der Regierung in Paris mit dem Einmarsch der Franzosen unter<br />
General Joffre im Jahr 1894. Damit hatten sie einen wichtigen strategischen Ort unter<br />
Kontrolle, der es ihnen ermöglichte, das französisch kontrollierte Gebiet über die Sahara<br />
zu erweitern und mit der bereits existierenden Kolonie Algerien zu verbinden. Somit<br />
wurde Timbuktu der Kolonie „Afrique Occidentale Française“, kurz „AOF“ (Französisch-<br />
Westafrika), einverleibt (Vgl. Miner 1953, 12 f.).<br />
Um die Zahl französischer Truppen und einheimischer Hilfstruppen möglichst niedrig zu<br />
halten und damit Kosten zu sparen, verfolgte die französische Kolonialverwaltung einen<br />
konzilianten Kurs gegenüber den Tuareg und sprach eine Amnestie für alle Anführer aus,<br />
die 1893 und 1894 Widerstand gegen die Besatzung geleistet hatten. Der Anführer des<br />
einheimischen Widerstandes, der Neffe des Scheich Ahmad al-Baqqai, Za'in al-Abidin<br />
Ould Sidi Muhamad al-Kunti, musste sich mit seiner Familie und seiner Bibliothek in<br />
Richtung Norden absetzen, wo er 1902 ebenfalls von französischen Truppen vertrieben<br />
wurde.<br />
1916 brach nach einer der schlimmsten Dürrekatastrophen, die der Sahel je erlebt hat,<br />
der Aufstand verschiedener Tuareg Gruppen entlang des Niger aus. Nach der<br />
Niederschlagung des Aufstandes wurden deren Anführer abgesetzt und durch loyale<br />
Personen ersetzt. Insgesamt wurde durch diese Maßnahme die traditionelle Autorität der<br />
Stammesführer systematisch und bewusst unterminiert.<br />
Wirtschaftlich verlor Timbuktu weiterhin an Bedeutung. Die letzte große Karawane alten<br />
Stils mit mehreren Tausend Kamelen kam 1937 von den Tafilalet-Oasen nach Timbuktu<br />
(Vgl. Kaufmann 1964, 218 ff.).<br />
Außer Offizieren und Vertretern von Handelshäusern kamen Europäer oder Amerikaner<br />
nur selten nach Timbuktu. Meistens handelte es sich um Völkerkundler und Schriftsteller,<br />
133
die Timbuktu oft als trostlosen Ort schilderten:<br />
„Dies also ist die Kehrseite der märchenhaften Legende, die auch heute noch um den<br />
Namen Timbuktu schwebt! Der Zauber verfliegt, um sofort einem neuen Zauber Platz<br />
zu machen. Es ist, als ob man ein geträumtes Königreich eines Tages tatsächlich fände.<br />
Man hat es also nicht nur geträumt, aber siehe, es ist nur ein Häufchen Staub, der<br />
leicht durch die Finger rinnt. Nichts ist trauriger als dies Verrinnen, aber es ist eine sehr<br />
große, sehr mächtige Traurigkeit.“ (Sieburg 1938, 244 f.).<br />
4.4. Republik <strong>Mali</strong><br />
Kurze Zeit später, am 22. September 1960, wurde die Republik <strong>Mali</strong> ausgerufen. Die<br />
Regierung unter Staatspräsident Modibo Keita verfolgte sowohl politisch als auch<br />
wirtschaftlich eine sozialistische Linie (Vgl. Imperato 1996, 134 f.). Diese Periode endete<br />
am 19. November 1968 durch einen Militärputsch des Comité Militaire de Liberation<br />
Nationale, der Moussa Traoré an die Macht brachte (Vgl. Imperato 1996, 227 f.). Mit<br />
Beginn seiner Herrschaft gewann der Tourismus an Bedeutung.<br />
Bereits in den 1950er Jahren war es zu Auseinandersetzungen zwischen den Tuareg und<br />
schwarzen Verwaltungsbeamten, die damals noch in französischen Diensten standen,<br />
gekommen. Nach der Unabhängigkeit eskalierte der Konflikt zwischen den Wüstennomaden<br />
und den Vertretern der Staatsmacht, die bemüht war, die unkontrollierbaren<br />
Tuareg sesshaft zu machen. Verstärkt wurden die Spannungen von den Dürren 1967- 73<br />
und 1983-85. In dieser Zeit verloren viele Nomaden ihr Vieh und damit ihre<br />
Existenzgrundlage und waren zur Migration gezwungen. Die Tuareg-Rebellion Anfang der<br />
90er Jahre wurde durch zurückkehrende Dürreflüchtlinge getragen, die zunächst<br />
protestierten, da Hilfslieferungen nicht bei ihnen ankamen. Aus dem Protest entwickelte<br />
sich der bewaffnete Kampf, der die Region destabilisierte. Diese Situation der<br />
Unsicherheit führte zu einem erheblichen Rückgang des zunehmenden Tourismus. Die<br />
Kämpfe setzten sich bis 1995 fort. Als sichtbares Zeichen für das Ende des Konfliktes<br />
wurden am 27. März 1996 feierlich die Waffen verbrannt. Die Friedensflamme in<br />
Timbuktu erinnert an den historischen Friedensschluss (Vgl. Imperato 1996, 235 ff.).<br />
5. Bevölkerung<br />
Timbuktu ist heute die Hauptstadt der gleichnamigen 6. Region, eine Kleinstadt, die<br />
heute ca. 35.000 Einwohner fast aller Ethnien <strong>Mali</strong>s zählt (Stadt Timbuktu:<br />
http://www.tombouctou.net, Abruf v. 21.01.09.). Hier trifft sich die sesshafte Bevölkerung<br />
mit den Nomaden (Mauren und Tuareg) des Nordens. Die Stadt wird von fast allen<br />
Ethnien <strong>Mali</strong>s bewohnt, mehrheitlich aber von Songhai, die vorwiegend Bauern sind und<br />
sich an den Ufern des Nigers angesiedelt haben (Vgl. N’Diaye 1970, 212 ff.). Die den<br />
Touristen bekannteste Ethnie sind die Tuareg. Sie leben als Viehzüchter vor allem<br />
nördlich und östlich von Timbuktu sowie im Nigerbogen. In den Dürrejahren 1968-73<br />
sowie 1983-85 verloren viele Tuareg ihre Herden und damit ihre Lebensgrundlage, was<br />
zu einem Zuzug in die Städte und deren nähere Umgebung führte (Vgl. Klute 1994, 201,<br />
203.). Heute leben fast alle Bewohner vom Tourismus, einige auch vom Handel (Vgl.<br />
Krause 2006, 12.).<br />
134
6. Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
6.1. Weltkulturerbe<br />
Auch wenn es keine goldgepflasterten Straßen zu entdecken gibt, so hat die Geschichte<br />
doch viele Zeugnisse hinterlassen. Heute ist die Mission Culturelle de Tombouctou für<br />
die Konservierung, Restaurierung und Promotion der zum Weltkulturerbe zählenden<br />
Stätten sowie für die Verbreitung der schriftlichen und mündlichen Quellen zur<br />
Lokalgeschichte zuständig.<br />
Die Architektur ist geprägt durch ein- bis zweistöckige Häuser, gebaut aus sonnengetrockneten<br />
Lehmziegeln und alhor, einem Kalkstein, der aus 2-3m unter dem<br />
Wüstensand liegenden Schichten gebrochen wird. In der Altstadt befinden sich die<br />
meisten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie die drei Lehm-Moscheen, die das Stadtbild<br />
prägen, die Djingere-ber-Moschee, die Sankoré-Moschee und die Sidi-Yahia-Moschee.<br />
Die Moschee Djingere Ber ist die einzige Moschee, die Touristen besichtigen dürfen<br />
(Stadt Timbuktu: http://www.tombouctou.net).<br />
Abb. 2: Moschee Djingere Ber (Krause 2006, 114.)<br />
6.2. Weitere Sehenswürdigkeiten<br />
Ein weiteres Erbe der Blütezeit der Universitäten und der Bildung sind die Bibliotheken.<br />
Obwohl der marokkanische Scheich Mulai Hamed im Jahr 1591 die Stadt eroberte und<br />
viele der Gelehrten sowie einen Großteil der Bücher nach Marokko verschleppte,<br />
konnten einige Familien ihre Schätze retten (Vgl. Obert 2005, 304 f.). Ein wichtiger<br />
Anziehungspunkt für Touristen sind die öffentlich zugänglichen Bibliotheken. In den<br />
letzten Jahren wurde vor allem in Europa, den Vereinigten Staaten und Südafrika auch in<br />
der Presse häufig über die Manuskripte berichtet, so dass die Bibliotheken seit 2001 viele<br />
Touristen angelockt haben (Vgl. Boye 2003, 4 f.).<br />
135
Im Bezirk Abaradiou im Nordwesten der Stadt befindet sich die Flamme de la Paix. An<br />
dem Ort, an dem zur Besiegelung des Friedens im März 1996 die Waffen verbrannt<br />
wurden wurde im März 2002 das gleichnamige Denkmal errichtet (Vance 2001,<br />
http://ww.stat.duke.edu/~ervance/wallemails.html, Abruf v. 19.12.08.). An diesem Platz<br />
treffen sich im Winter auch die Azalai ein: Die letzten Kamelkarawanen, die heute noch<br />
in der Sahara durchgeführt werden (Salzkarawanen). Der Ruhm der reichen Handelsstadt<br />
wird hier manchmal noch sichtbar.<br />
7. Wirtschaft<br />
Da der Region Timbuktu jegliche Industrie fehlt, und sie durch ihr Klima nicht für die<br />
Landwirtschaft geeignet ist, kommt dem Tourismus elementare Bedeutung als größte<br />
Einnahmequelle zu. Sichtbar ist eine Forcierung des Tourismus und der touristischen<br />
Infrastruktur ab Mitte der 90er Jahre. 1999, liegt die Zahl der Touristen, die Timbuktu<br />
jährlich besuchen, grob geschätzt bei 6.000, wobei die Tendenz steigend ist (Vgl. Krause<br />
2006, 50.). Dabei ist die starke Saisonabhängigkeit zu beachten. Den Höhepunkt erreicht<br />
der Tourismus im August und von Oktober bis Februar. In den restlichen Monaten gibt<br />
es aufgrund der großen Hitze kaum Besucher. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer<br />
beträgt lediglich zwei Tage (Vgl. Krause 2006, 51.).<br />
Von den klassischen Handelsgütern der Vergangenheit ist lediglich das Salz übrig<br />
geblieben, das immer noch aus dem Norden geliefert und in Timbuktu bzw. Kabara<br />
portioniert und an Händler verkauft wird, die es auf Pirogen flussaufwärts transportieren<br />
(Vgl. Krause 2006, 78.)<br />
Heute ist Timbuktu eine relativ arme Stadt, die historische Innenstadt ist von wenigen<br />
Ausnahmen abgesehen in einem schlechten Zustand. Sand und Dreck findet sich überall<br />
in den Straßen. Vom Glanz alter Tage ist heute nichts mehr übrig geblieben, die<br />
Bevölkerung ist arm und zum großen Teil arbeitslos. Timbuktu wirkt noch karger als<br />
andere Städte in der Sahelzone. Insgesamt scheint sich die Stadt noch nicht von den<br />
Folgen des Bürgerkriegs mit den Tuareg erholt zu haben. (Vgl. Krause 2006, 89 ff.).<br />
Abb. 3: Timbuktu Viertel Abaradiou (Krause 2006, 118.)<br />
136
8. Mythos Timbuktu<br />
Über die Jahrhunderte hinweg wurde Timbuktu zum Mythos, zur ,goldenen’, ,heiligen’,<br />
,verbotenen’ Stadt, und weil nur so wenige die Stadt tatsächlich sahen somit zum<br />
Synonym für einen weit entlegen exotischen Ort, das Ende der Welt, das schließlich<br />
neben dem tatsächlichen Ort existierte. In dieser Funktion erscheint der Name in<br />
verschiedenen Sprachen, unter anderem im Deutschen und Niederländischen, vor allem<br />
aber im Englischen.<br />
Timbuktu ist ein realer Ort, ein geographischer Ort. Man kann diese Stadt heute<br />
tatsächlich erreichen. Doch ist sie vielen nur als Sprichwort, als Symbol für die Ferne<br />
bekannt, ohne diese lokalisieren zu können oder zu wollen. Der Name an sich weckt<br />
Assoziationen und Phantasien. Und gerade deshalb zieht die Stadt immer noch und<br />
immer mehr Reisende an, die dem Mythos auf den Grund gehen wollen. So auch wir.<br />
137
Literaturverzeichnis<br />
BARICCO, Alessandro 2003: Oceano Mare. Das Märchen vom Wesen des Meeres,<br />
München.<br />
BARTH, Heinrich 1857-58: Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den<br />
Jahren 1849 bis 1855. Tagebuch seiner im Auftrag der Britischen Regierung<br />
unternommenen Reise, Bd. 1-5, Gotha.<br />
BASSER, René 1909: Mission au Sénégal, Paris.<br />
ES-SA’DI, Abderrahman 1964 [1652/55]: Tarikh Es-Soudan. Texte Arabe Edité et Traduit<br />
par O. Houdas, Paris.<br />
HELD, Matthias; BERGEMANN, Sybille 2004: „Die geheime Wüstenstadt“, in: Horizonte.<br />
Das moderne Magazin für Reportage und Wissen, Jg. 1, Heft 2, S. 6-27.<br />
IMPERATO, Pascal James 1996: Historical Dictionary of <strong>Mali</strong>, 3. Aufl., London.<br />
KAUFMANN, Herbert 1964: Wirtschafts- und Sozialstruktur der Iforas-Tuareg, Köln.<br />
KI-ZERBO, Joseph 1981: Die Geschichte Schwarz-Afrikas, Frankfurt am Main.<br />
KLUTE, Georg 1994: „Flucht, Karawane, Razzia. Formen der Arbeitsmigration bei den<br />
Tuareg“, in: Laubscher, Matthias; Turner, Bertram (Hg.): Systematische Völkerkunde.<br />
Völkerkunde Tagung 1991, Band 1, München, S. 197-213.<br />
MINER, Horace 1953: The Primitive City of Timbuctoo, Princeton.<br />
N’DIAYE, Bokar 1970: Groupes Ethniques au <strong>Mali</strong>, Bamako.<br />
OBERT, Michael 2005: Regenzauber. Auf dem Niger ins Innere Afrikas, München.<br />
RAUCHENBERGER, Dietrich 1999: Johannes Leo der Afrikaner. Seine Beschreibung des<br />
Raumes zwischen Nil und Niger nach dem Urtext, Wiesbaden.<br />
SIEBURG, Friedrich 1938: Afrikanischer Frühling. Eine Reise, Frankfurt am Main.<br />
BOYE, Alida Jay 2003: Timbuktu Manuscripts Project. Annual Report 2003. NORAD<br />
Financing, URL:<br />
http://www.sum.uio.no/research/mali/timbuktu/project/2003_Annual%20Report.pdf,<br />
Stand 27.01.2009.<br />
Timbuktu Stadt, URL: http://www.tombouctou.net. Stand 21.01.2009.<br />
VANCE, Eric 2002: URL: http://www.stat.duke.edu/~ervance/wallemails.html<br />
Stand 21.01.2009.<br />
138
Stadtentwicklung:<br />
Bamako, Djenné, Mopti<br />
Ute Tschirner<br />
139
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Bamako – Hauptstadt und charakteristisches Beispiel einer Primatstadt..................... 141<br />
1.1. Historische Stadtentwicklung........................................................................................... 141<br />
1.2. Siedlungsstruktur ................................................................................................................ 142<br />
1.3. Maßnahmen zur städtischen Entwicklung in den 1990ern......................................... 143<br />
2. Djenné – Stadt des Mittelalters............................................................................................... 144<br />
3. Mopti – Neue Hafenstadt am Niger....................................................................................... 146<br />
140
Städtegründungen und urbane Entwicklung wurden durch den Transsaharahandel und das<br />
spätere koloniale Handelssystem wesentlich beeinflusst. Am Beispiel dreier Städte<br />
werden die jeweils unterschiedlichen Bedingungen der Stadtentwicklung dargestellt und<br />
der Bedeutungswandel der Städte von der vorkolonialen Zeit bis zur Gegenwart<br />
herausgearbeitet.<br />
1. Bamako – Hauptstadt und charakteristisches Beispiel einer<br />
Primatstadt<br />
1.1. Historische Stadtentwicklung<br />
Bamako wurde entsprechend verschiedenster oraler Überlieferungen als ein kleines<br />
Fischerdorf im 16. Jh. gegründet (vgl. Brandt, 99-100). Vor der französischen Einnahme<br />
<strong>Mali</strong>s im Jahr 1880 hatte Bamako als Stadt am Ufer des Niger lediglich für das<br />
Herrschaftsgebiet des Bambara-Stammes eine lokale Bedeutung. Mit der Einnahme des<br />
Landes und der Etablierung kolonialer Administration zum Ende des 19. Jh. setzte die<br />
Entwicklung zur heutigen Primatstadt ein.<br />
Zu Beginn der französischen Okkupation diente Bamako als militärischer Stützpunkt.<br />
Nachdem sich die französische Kolonialmacht etabliert hat, begann die Kolonialverwaltung<br />
mit dem Ausbau und der infrastrukturellen Erschließung Bamakos. Durch den<br />
Bau der Sticheisenbahnlinie wurde die Stadt 1904 mit der senegalesischen Hafenstadt<br />
Saint-Louis verbunden und so in das koloniale Handelssystem eingegliedert. Im Jahr 1908<br />
wurde Bamako zur offiziellen Hauptstadt von Französisch-Sudan erklärt und erhielt<br />
dadurch insbesondere eine zentrale administrative Funktion. Die Kolonialherrschaft und<br />
die sich neu etablierenden Handelswege veränderten das urbane Systems <strong>Mali</strong>s<br />
grundlegend, sodass sich Bamakos ehemals lokale Umlandfunktion bis 1950 zu einer<br />
überregionalen entwickelte und die Stadt zum zentralen Markt in Westafrika wurde.<br />
Diese wirtschaftliche Funktion als Haupthandelspunkt verlagerte sich jedoch mit der<br />
Unabhängigkeit <strong>Mali</strong>s zunehmend Richtung Osten nach Mopti (vgl. Jones, 46-48).<br />
Die Bevölkerungsentwicklung Bamakos spiegelt diesen Bedeutungswandel der Stadt<br />
wieder. Noch zu Beginn der französischen Präsenz belief sich die Einwohnerzahl<br />
Bamakos schätzungsweise auf 7.000, 1960 lebten bereits 130.000 Menschen in der Stadt<br />
und in den 1970ern kam es, wesentlich beeinflusst durch zahlreiche Dürren, zu einem<br />
überdurchschnittlich starken Bevölkerungsanstieg auf Grund von Zuwanderung (1970-<br />
1775: 10%, 1975-1980: 6%). Niederschlagsreichere Jahre ab 1980, sowie die<br />
Implementation von Programmen zum Ausgleich von ländlicher und urbaner Entwicklung<br />
bewirkten in den folgenden Jahren eine geringere Stadt-Land-Migration, sodass sich die<br />
Wachstumsrate reduzierte (UN, 2007).<br />
Heute liegt die Einwohnerzahl Bamakos bei 1,5 Millionen mit einer jährlichen<br />
Wachstumsrate von 4,4% zwischen 2005 und 2010. Damit leben 12% der Gesamtbevölkerung<br />
<strong>Mali</strong>s in Bamako, wobei insgesamt 38% der städtischen Bevölkerung <strong>Mali</strong>s in<br />
141
der Hauptstadt leben (UN, 2007). Bamako ist sechsmal größer als Segou, die zweitgrößte<br />
Stadt <strong>Mali</strong>s und damit rein quantitativ betrachtet eindeutig eine Primatstadt (vgl. Sokono,<br />
6-7). Doch auch funktional ist die Stadt ein charakteristisches Beispiel. Dreiviertel des<br />
industriellen Sektors befindet sich im Distrikt Bamako und bis 1991 zentrierte sich die<br />
gesamte staatliche Administration in diesem Gebiet. Dieser, aus der Kolonialzeit<br />
stammende und durch die späteren Eliten weitergeführte, Verwaltungs-zentralismus ist<br />
eine wesentliche Ursache für die Entstehung einer Primatstadt (vgl. Hoffmann, 31). Die<br />
charakteristische herausragende Position in der nationalen Städtehierarchie wurde über<br />
einen längeren Zeitraum strukturell herbeigeführt und hat sich dementsprechend<br />
verfestigt.<br />
Mit dem Sturz der Militärdiktatur Moussa Traorés und der Gründung der dritten<br />
Republik trat 1992 eine neue demokratische Verfassung in Kraft, die Dezentralisation in<br />
ihren Grundprinzipien verankerte. Entsprechend dieser politischen Maßnahme wurde<br />
auch die Hauptstadt administrativ dezentralisiert, sodass Bamako heute aus sechs<br />
Kommunen besteht, die sich jeweils in mehrere Quartiere aufgliedern. Insgesamt gibt es<br />
etwa 60 verschiedene Quartiere. Die ältesten dieser Viertel (Bozolo, Niaréla, Cité de<br />
Niger) liegen in der Kommune II und III im nördlichen Teil der Stadt und bilden heute<br />
das Stadtzentrum. Ursprünglich vollzog sich die Stadtentwicklung von diesen Gebieten<br />
ausgehend, auf der nördlichen Seite des Nigers. Mit dem stetigen Bevölkerungszuwachs<br />
expandierte die Stadt um 1960 über den Niger hinaus, sodass auf der südlichen Seite des<br />
Flusses große Wohngebiete entstanden, welche die Stadtfläche nahezu verdoppelten<br />
(Kracher. Die einzige Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen besteht durch zwei<br />
Brücken. Der Bau einer dritten Brücke, der von China durchgeführt wird, soll bis in Jahr<br />
2010 realisiert werden.<br />
1.2. Siedlungsstruktur<br />
Das Stadtzentrum ist durch den großen Markt und eine allgemeine Konzentration von<br />
Handwerk und Gewerbe entlang der Straßen gekennzeichnet. Hier und in den<br />
angrenzenden Wohnvierteln ist eine hohe Bebauungsdichte vorzufinden. Um dieses<br />
Kerngebiet herum und auf der südlichen Seite des Nigers wird das Stadtbild durch<br />
Wohnviertel mit einer vergleichsweise geringeren Bebauungsdichte bestimmt (vgl.<br />
Karcher, 226-227). Ingesamt fällt innerhalb vieler Wohngebiete eine Vermischung von<br />
Gebäuden mit einfachem und gehobenem Standard auf, sodass sich Villen in<br />
unmittelbarer Nähe zu kleinen Lehmhäusern finden lassen. Dennoch lassen sich die<br />
einzelnen Quartiere durchaus durch den quantitativen Bestand an gehobenem<br />
Baustandard und der vorhandenen Infrastruktur unterscheiden.<br />
An der Peripherie haben sich so genannte Spontansiedlungen entwickelt, die in ihrem<br />
Entstehen jedoch keineswegs „spontan“ waren. Da die bestehenden Strukturen und<br />
bauliche Maßnahmen auf den starken Bevölkerungszuwachs nicht reagieren konnten,<br />
entstanden in den späten 1960ern in zahlreichen Außenbezirken Bamakos illegale<br />
Siedlungen. Diese entwickelten sich häufig aus älteren Dorfstrukturen, indem lokale<br />
Chief’s Land an Freunde und Verwandte übertrugen. Einige der neuen Besitzer<br />
verkauften das Land an Spekulanten oder Hausbauer, sodass sich über einen längeren<br />
Zeitraum eine neue Siedlung entwickelte. Vom architektonischen Stil und der Bebauungs-<br />
142
dichte unterscheiden sich viele dieser Spontansiedlungen nicht von den einfacheren,<br />
legalen Quartieren. Die wesentliche Differenz besteht jedoch bei der Infrastruktur, da zu<br />
Beginn der Entstehung keines der Gebiete in der städtischen Versorgung integriert war<br />
(vgl. Vaa, 28).<br />
1.3. Maßnahmen zur städtischen Entwicklung in den 1990ern<br />
Nach dem Sturz des Traoré-Regimes und der Gründung der neuen demokratischen<br />
Republik wurden zahlreiche neue Richtlinien eingeleitet. Bereits 1992 veranlasste die<br />
neue Regierung ein spezielles Programm um die Lebensbedingungen in den illegalen<br />
Wohngebieten zu verbessern. Ursache hierfür war die rasante Ausbreitung und<br />
Neugründung von Siedlungen. Noch 1965 lebten nur etwa 5% der Bevölkerung Bamako’s<br />
in den Spontansiedlungen, 1983 waren es etwa 31% und um 1990 bereits 70% (vgl. Vaa,<br />
28). Die Ausstattung der Gebiete mit Straßenlicht und Wasserleitungen, sowie die<br />
Einführung eines Kanalisationssystems an den Hauptstraßen und der Bau von Schulen,<br />
Gesundheitszentren und Marktplätzen waren wesentliche Bestandteile des Programms<br />
(vgl. Karcher, 227). Um diese Umstrukturierung realisieren zu können, wurden<br />
bestehende Häuser abgerissen und deren Bewohner in andere, ausgewiesene Gebiete<br />
umgesiedelt. Leitgedanke der Vorhergehensweise war es, ein Minimum an Wohnhäusern<br />
zu zerstören um ein Maximum an Infrastruktur zu schaffen (vgl. Vaa, 30). Insgesamt<br />
wurden 25 von 33 Siedlungen in das Programm aufgenommen und damit ein sehr großer<br />
Teil der illegalen Wohnviertel zeitgleich legalisiert. Vier Jahre später wurde das<br />
Programm wieder eingestellt. Hauptursache hierfür war, dass die Zuweisung von neuen<br />
Siedlungsgebieten außer Kontrolle geriet. Ursprünglich waren die Grundstücke für die<br />
Ansiedlung der Bewohner der ehemals illegalen Siedlungen vorgesehen. Es kam jedoch<br />
dazu, dass Land an etwaige Interessenten verkauft wurde und ein Großteil der zur<br />
Verfügung stehenden Fläche der Spekulation unterlag. Die zuständigen Akteure der<br />
Landvergabe sahen darin die Möglichkeit um sich für die nächsten Wahlen zu<br />
positionieren. Letztendlich stiegen die Preise so stark an, dass die eigentlichen<br />
Adressaten des Programms von der Erwerbsmöglichkeit von Land ausgeschlossen<br />
wurden (vgl. ebda. 31).<br />
Insgesamt steht das legale Angebot an Land in keiner Relation zu der hohen Nachfrage,<br />
sodass sich ein illegaler Markt für Landverkauf etabliert hat. Um diese Tatsache<br />
einzudämmen und das Angebot an Land zu erhöhen, hat die malische Regierung im Jahr<br />
1992 in Kooperation mit der Weltbank eine Agentur zur Stärkung des Wohnungsbaus<br />
gegründet. Die so genannte „Agence de Cession Immobilière“ (ACI) überwacht den<br />
staatlichen Landbesitz, sorgt für den Aufbau von Infrastruktur und verkauft Land auf<br />
öffentlichen Auktionen. Von den 7.500 Grundbesitztümern, die zwischen 1970 und 2000<br />
verkauft wurden, sind 87 % in der Zeit von 1992-1995 durch die ACI entstanden.<br />
Quantitativ zeigt dies die Wirksamkeit der ACI. Jedoch muss hinterfragt werden, welche<br />
Gruppe die Dienste der Kooperation erreichen: „In the word of <strong>Mali</strong>an researchers, it is a<br />
road of access to property for an economic elite. The overwhelming marjority of Bamako’s<br />
population do not feel concerned by the services this agency has to offer“ (Vaa, 32). Die<br />
Kosten für die Grundstücke sind für die Mehrheit der Bevölkerung unerschwinglich,<br />
sodass auch diese Maßnahme sie indirekt vom legalen Landerwerb ausschließt.<br />
143
Die Errichtung einer weiteren, von der Weltbank und der KfW finanzierten Agentur,<br />
der„Agence d’exécution des trevaux d’intéret public pour l’emploi“ (AGETIPE), wurde<br />
ebenfalls im Jahr 1992 umgesetzt. Die Agentur gehört zu den ausländischen und<br />
internationalen Entwicklungsorganisationen, die eine Art parallele Verwaltung zur<br />
eigentlichen Stadtverwaltung bilden und finanziell und strukturell meist besser<br />
ausgestattet sind. Hauptziele von AGETIPE sind es, temporäre Anstellung in<br />
arbeitsintensiven Kleinprojekten zu fördern um einen Einkommenszuwachs und die<br />
Partizipation der lokalen Bevölkerung zu ermöglichen. Darüber hinaus soll der private<br />
Sektor gefördert und ausgebaut werden. Um dies umzusetzen, finanziert die Agentur<br />
Projekte, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen und in ihrer Wirkung einem<br />
öffentlichen Interesse dienen (vgl. Karcher, 231). Entsprechend einer Evaluation der<br />
Weltbank aus dem Jahr 1997 war die Arbeit der AGETIPE sehr erfolgreich und hat in<br />
vielen Bereichen Bamakos sichtbare Veränderungen hervorgebracht. (vgl. Vaa, 32). Die<br />
Struktur des Programms ermöglicht es auch Projekte, meist von NGO’s, in den nicht<br />
autorisierten Siedlungen zu fördern und bietet so die Chance die dortigen<br />
Lebensbedingungen zu verbessern.<br />
Dies stellt einen entscheidenden Vorteil gegenüber den zuvor vorgestellten Programmen<br />
dar. Die mangelnde Umsetzung staatlicher Programme liegt oftmals an dem schwach<br />
ausgeprägten Verwaltungssystem, Korruption und der damit verbundenen Missachtung<br />
der staatlichen Autorität und der eigentlichen Zielsetzungen. Dennoch muss die<br />
flächendeckende Schaffung von Infrastruktur langfristig durch die Stadtverwaltung<br />
realisiert werden, sodass die Verantwortung von der nationalen Regierung getragen wird.<br />
2. Djenné – Stadt des Mittelalters<br />
Das heutige Djénne ist berühmt für seine sudanesische Lehmarchitektur und der großen<br />
Moschee. Im Jahr 1981 wurde die Stadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt<br />
und seitdem bestimmen strikte Baureglementierungen den Erhalt des von<br />
Lehmarchitektur geprägten Stadtbildes. Die Stadt ist eine der touristischen<br />
Hauptattraktionen <strong>Mali</strong>s und nimmt damit eine sehr wichtige Funktion innerhalb des<br />
tertiären Sektors ein.<br />
BILD<br />
Die historische Bedeutung der Stadt war vielseitig und wesentlich durch den<br />
Transsaharahandel und den damit verbundenen islamischen Einfluss geprägt. Darüber<br />
hinaus finden sich in der Nähe der heutigen Djennés die archäologischen Überreste einer<br />
wesentlich älteren Stadt. Dies stellt einen wichtigen Beweis für die Existenz von<br />
städtischen Formen in Westafrika dar, die unabhängig vom Fernhandel der<br />
Transsahararoute entstanden sind (vgl. Devisse, 29). Das Forscherehepaar Susan und<br />
Roderick McIntosh entdeckten das so genannte Jenné-Jenno, das vergessene oder alte<br />
Djenné, drei Kilometer östlich der heutigen Stadt. Die erste Ansiedlung in diesem Gebiet<br />
wird auf etwa 250 Jahre v. Chr. datiert (vgl. Snelder, 67). Ausgrabungen zeigten, dass die<br />
Stadt mit ihren runden und rechteckigen Häusern eine Ausbreitung von etwa 30 Hektar<br />
besaß und von einer Stadtmauer umgeben war. Dies deutet daraufhin, dass die Stadt eine<br />
wichtige wirtschaftliche bzw. politische Bedeutung haben musste. Eine genauere<br />
144
Datierung der Stadtmauer ist bisher nicht möglich, es wird aber angenommen, dass<br />
Jenné-Jenno zwischen dem 5. und dem 10. Jahrhundert die heute vorgefundene<br />
Ausdehnung erreichte (vgl. Snelder, 67, Devisse, 3).<br />
Zur Gründung von Djenné gibt es unterschiedliche Auffassungen und Datierungen. Ein<br />
Großteil der Informationen zur historischen Entwicklung von Djenné stammen von<br />
Abderrahman Es-Sa’di, er war Imam der großen Moschee in den 1620ern und 1630ern.<br />
Seiner Chronik zu Folge wurde Djenné etwa 770 n. Chr. gegründet und zu einem<br />
späteren Zeitpunkt an einen anderen Ort verlagert. Der Franzose Maurice Delafosse<br />
vertritt in seinen Schriften die Ansicht, dass die Stadt durch eine Gruppe von Soninke<br />
bereits 800 n. Chr. gegründet wurde, jedoch erst in den 1240ern zu einer<br />
nennenswerten Größe anwuchs (vgl. Snelder, 67). Unter Vernachlässigung der Datierung<br />
lässt sich jedoch bei beiden eine Übereinstimmung in Bezug auf die Bedeutungsentwicklung<br />
von Djenné feststellen. Dementsprechend erlangte die Stadt durch die<br />
Einbindung in den Fernhandel sowohl eine wirtschaftliche, als auch eine zentrale religiöse<br />
Funktion. Seit dem 9. Jahrhundert führte der Fernhandel zwischen dem Norden und dem<br />
Süden Westafrikas zu Stadtgründungen entlang der Handelsroute. Insbesondere an<br />
Grenzgebieten, zwischen Klima- bzw. Vegetationszonen und verschiedenen<br />
Herrschaftsbereichen, kam es zu Stadtgründungen. Diese anfänglichen Siedlungen dienten<br />
zunächst als Lagerstätte bzw. Umschlagsorte. Da der Routenverlauf des Transsaharahandels<br />
wesentlich von gegenwärtigen Machtstrukturen und Herrschaftsreichen<br />
bestimmt war, kam es immer wieder zu einer Verlagerung, sodass neue Städte<br />
entstanden und ehemals wichtige Handelsorte an Bedeutung verloren. Mit dem<br />
Untergang des Ghana-Empires verlagerte sich die Route und Timbuktu wurde zu einer<br />
zentralen Handelsstadt. Etwa zeitgleich wuchs auch die Bedeutung Djennés, sodass die<br />
Stadt zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert durch den Handel bestimmt wurde<br />
(vgl. Winters, 145-146). Der kurze Vergleich zwischen der Entwicklung beider Städte<br />
verdeutlicht die Interdependenz innerhalb der Stadtgenese. Djenné profitierte von der<br />
Bedeutung Timbuktus indem es einerseits ein bedeutender Umschlagsort für<br />
Handelsgüter wurde und andererseits erfüllte es für Timbuktu eine wichtige<br />
Versorgungsfunktion. Auf Grund der vorherrschenden klimatischen Bedingungen konnte<br />
in der Region Timbuktu keine Agrarwirtschaft betrieben werden, sodass die Stadt auf<br />
externe Versorgung angewiesen ist um den Nahrungsmittelbedarf der damaligen hohen<br />
Bevölkerung decken zu können. Djenne diente daher als Sammelstelle für<br />
Agrarprodukte, die über den Niger nach Timbuktu transportiert wurden.<br />
Im 15. Jahrhundert weitete die erste Songhay-Dynastie ihren politischen Machtbereich<br />
von der Hauptstadt Gao Richtung Westen aus und Djenné wurde durch ihren Herrscher<br />
Sonni Ali Bar eingenommen. Anschließend folgte die Fortsetzung der Dynastie durch den<br />
neuen Songhay-Herrscher Askia Mohammed (vgl. Brandt, 148-149). Die politische<br />
Stabilität innerhalb dieser Periode stützte das florierende Wirtschaftsleben und Djenné<br />
erlebte seine Blütezeit. Mit dem Einzug der Marokkaner zum Ende 16. Jahrhunderts und<br />
der erneuten Veränderung der Handelsrouten begann ein stetiger Bedeutungsverlust<br />
Djennés (vgl. Snelder, 69).<br />
Diese historische Entwicklung Djennés lässt einen Vergleich zur Stadtentwicklung von<br />
Lüneburg zu. Beide Städte erlebten im Mittelalter auf Grund ihrer einflussreichen<br />
Positionierung im Handel eine Blütezeit und gerieten nachfolgend in eine Art<br />
Vergessenheit. Die geringeren Einnahmen und die zunehmende Bedeutungslosigkeit im<br />
145
überregionalen Handelsystem hemmten die städtische Entwicklung, sodass die alten<br />
Stadtstrukturen größtenteils erhalten blieben.<br />
3. Mopti – Neue Hafenstadt am Niger<br />
Heute ist Mopti eine kommerzielles Zentrum am Niger und gleichzeitig Hauptstadt der<br />
Region. Noch vor dem 19. Jahrhundert war es jedoch lediglich ein Haltepunkt entlang<br />
der Strecke von Djenné nach Timbuktu. Das kleine Bozo-Fischerdorf zog ausschließlich<br />
einige nomadische Schafhirten an und spielte darüber hinaus nur für die lokale<br />
Versorgung eine wichtige Rolle.<br />
Mit dem Bedeutungsverlust Djennés erlangte Mopti eine neue Position als Hafenstadt am<br />
Niger. 1893 errichteten die Franzosen hier einen Militärstützpunkt und leiteten damit die<br />
wirtschaftliche Entwicklung ein. Wenige Jahre später siedelten die ersten französischen<br />
Händler in dem Gebiet und organisierten von Mopti ausgehend den Warentransport.<br />
Der Bau der Eisenbahnlinie zwischen Bamako und St. Louis integrierte Mopti in das<br />
größere Gebiet von Französisch Sudan und die Stadt wurde wichtiger Exporteur für<br />
Agrarprodukte innerhalb der Kolonien. Hauptexportgut war Reis, der über den Niger<br />
nach Bamako geschifft, und von dort weiter in den Senegal transportiert wurde (vgl.<br />
Guibbert, 108).<br />
Die naturräumlichen und klimatischen Bedingungen schaffen in diesem Gebiet gute<br />
Voraussetzung für die agrarwirtschaftliche Produktion. Die Stadt liegt direkt im<br />
Innendelta des Nigers. Während der Regenzeit kommt es im gesamten Einzugsgebiet des<br />
Nigers und seinen Nebenflüssen zu Überschwemmungen, sodass ein Großteil der Fläche<br />
durch das Schwemmwasser und die mitgetragenen Mineralien fertilisiert wird. Die<br />
heutige wirtschaftliche Stellung Moptis basiert einerseits auf diese naturräumlichen<br />
Bedingungen und andererseits auf die veränderten Handelsstrukturen des 19.<br />
Jahrhunderts und den damit verbundenen, neuen Absatzmärkten.<br />
1908 wurde die große Moschee von Mopti erbaut. Auch dieses Ereignis ist im<br />
Zusammenhang mit der neuen Stellung der Stadt zu sehen. Das wirtschaftliche<br />
Aufstreben einer Region führt zu einer stärkeren Zuwanderungsrate und damit zu einer<br />
höheren städtischen Bevölkerungszahl. Insbesondere in stark religiös geprägten Nationen<br />
bedeutet dieses Bevölkerungswachstum auch die Errichtung neuer Glaubensstätten. „In<br />
general, learning followed commerce. (....) In the twentieth century Mopti, which<br />
boomed owing to it position on the colonial trade routes, eventually became a religious<br />
centre. Even teachers of religion have to eat“ (Winters, 353). In der späteren<br />
Stadtentwicklung kommt es durch diese anfängliche Verbindung zwischen Kommerz und<br />
Religiosität zu einem sich selbst verstärkenden Bevölkerungswachstum: Nicht nur das<br />
wirtschaftliche Potential einer Stadt, sondern auch das Ansehen als religiöses Zentrum,<br />
führt zu einer erhöhten Zuwanderung.<br />
Mit der steigenden Bevölkerungszahl der Stadt musste sich auch die Siedlungsfläche<br />
vergrößern. Um dies zu erzielen, wurde im Jahr 1910 mit dem Bau von Dämmen<br />
begonnen, die bis in Jahr 1954 der Landgewinnung dienten und so die sukzessive<br />
Ausbreitung der Stadt ermöglichten (vgl. Guibbert, 108). Ursprünglich erstreckte sich<br />
146
die Stadt auf mehreren kleinen Inseln im Schwemmbereich der Flüsse Niger und Bali.<br />
Während der Regenzeit waren die Stadteile daher voneinander getrennt. Durch den<br />
Dammbau wurden diese Teile erweitert und insgesamt zu drei, auch in der Regenzeit,<br />
miteinander verbundenen Siedlungsflächen umgeformt (vgl. Brandt, 160).<br />
147
Literaturverzeichnis<br />
GUIBBERT, Jean-Jacques 1983: Mopti: Tradition in the Present. Elements for Reflection<br />
and Action in Medium-Sized Cities in Africa. <strong>Mali</strong>. In: Taylor, Brian: Reading the<br />
Contemporary African City. Singapore, 101-112.<br />
WINTERS, Christopher 1981: The urban systems of medieval <strong>Mali</strong>. Journal of Historical<br />
Geography 7 (4), 341-355.<br />
VAA, Mariken 2000: Housing policy after political transition: the case of Bamako.<br />
Environment&Urbanization 12 (1), 27-34.<br />
KARCHER, Silke 1995: Stadtsanierung in Bamako. Die Rolle lokaler Selbsthilfegruppen für<br />
die Stadtsanierung in Bamako/ <strong>Mali</strong>. In: GROHMANN, Peter; HOFFMANN, Dirk (Hg.):<br />
Andere Städte Anderes Leben. Stadtentwicklung, Umweltkrise und Selbsthilfe in Afrika,<br />
Asien und Lateinamerika. Saarbrücken, 225-242.<br />
VELTON, Ross 2008: <strong>Mali</strong>. The Bradt Travel Guide. 2. Aufl. Guilford.<br />
SOKONO, O. 1985: Urban primacy in developing countries: the case of <strong>Mali</strong>. In:<br />
Population Today 13 (4), 6-7.<br />
JONES, Rachel 2007: “You Eat Beans!”: Kin-based Joking Relationships, Obligations, and<br />
Identity in Urban <strong>Mali</strong>. Macalester College.<br />
SNELDER, Raoul 1984: The Great Mosque at Djenné. Its impact today as a model. Mimar:<br />
Architecture in Development 12, 66-74.<br />
HOFFMANN, Dirk 1995: Die Welt ist Stadt. Aktuelle Entwicklung und Tendenzen der<br />
globalen Urbanisierung. In: GROHMANN, Peter; HOFFMANN, Dirk (Hg.). Andere Städte<br />
Anderes Leben. Stadtentwicklung, Umweltkrise und Selbsthilfe in Afrika, Asien und<br />
Lateinamerika. Saarbrücken, 17-38.<br />
DEVISSE, Jean 1983: Urban History and Tradition in the Sahel. In: TAYLOR, Brian: Reading<br />
the Contemporary African City. Singapore, 1-8.<br />
148
Traditionelle Architektur in Stadt und Land:<br />
Der Sudanstil<br />
Susann Aland<br />
149
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Ursprung und Verbreitung der sudanischen Lehmbauweise ............................................ 151<br />
2. Merkmale der Lehmarchitektur.............................................................................................. 152<br />
2.1. Bürgerliches Wohnhaus .................................................................................................... 152<br />
2.2. Sakrale Bauten..................................................................................................................... 154<br />
3. Stilistische Einflüsse.................................................................................................................... 155<br />
3.1. Animistische Elemente ...................................................................................................... 155<br />
3.2. Islamische Elemente ........................................................................................................... 156<br />
4. Zur Bauweise .............................................................................................................................. 156<br />
5. Vorteile der Lehmbauweise ..................................................................................................... 159<br />
150
1. Ursprung und Verbreitung der sudanischen Lehmbauweise<br />
Der Ursprung der bis heute für westafrikanische Sahel-Länder charakteristischen<br />
Lehmarchitektur ist auf den Raum des Nigerbinnendeltas in <strong>Mali</strong> zurückzuführen. In<br />
Handelsstädten wie Djenné und Timbuktu entwickelte sich der so genannte Sudanstil aus<br />
zwei verschiedenen kulturellen und religiösen Strömungen, dem Animismus der Volta-<br />
Völker und dem Islam aus Nordafrika (vgl. Abb. 1). Djenné kam im Mittelalter eine große<br />
Bedeutung als Marktzentrum zu, und der Saharahandel verband die beiden Städte eng<br />
miteinander. Über den Wasserweg wurden u. a. Stoffe, Steinsalz, Datteln und Keramik<br />
aus Timbuktu in den Süden gebracht und landwirtschaftliche Produkte, wie Reis, Hirse,<br />
Erdnüsse, aber auch Gold und Sklaven, in den Norden transportiert.<br />
Mit dem Handel breiteten sich der Islam, alte Handwerkstraditionen und Bauweisen aus<br />
Marokko, Algerien und Tunesien in den südlicheren Ländern Westafrikas aus. Hier<br />
vermischte sich der islamische Glaube mit schwarzafrikanischen Traditionen und nahm<br />
animistische Züge in sich auf. Die Verknüpfung von Islam und Animismus ist in der daraus<br />
hervorgehenden Lehmbauweise wieder zu erkennen.<br />
Abb. 1: Verbreitung der Sudanarchitektur im westlichen Afrika<br />
(Krings, Thomas 1984: Die Tradition der urbanen Lehmarchitektur im Obernigergebiet von <strong>Mali</strong>. In: Die Erde<br />
Nr. 115, 127.)<br />
151
Die Karte in Abbildung 1 zeigt neben dem Kernraum des Sudanstils um Djenné, Mopti<br />
und San auch die weiteren Ausbreitungsrichtungen in den (Nord-)Osten <strong>Mali</strong>s, nach<br />
Guinea und in die Elfenbeinküste.<br />
Auf die stilistischen Merkmale der Lehmarchitektur wird in Kapitel 3 näher eingegangen.<br />
(Krings 1984, 123-128.)<br />
2. Merkmale der Lehmarchitektur<br />
2.1. Bürgerliches Wohnhaus<br />
Der Grundriss der Bürgerhäuser in Djenné ist prinzipiell viereckig. Die Wohngebäude<br />
bestehen in der Regel aus zwei Stockwerken mit einem Flachdach.<br />
Abb. 2: Grundriss eines Bürgerhauses<br />
(Krings 1984, 132.)<br />
152<br />
Erdgeschoss:<br />
1 Hauseingang (goumhu)<br />
2 Vestibül (tafarafara)<br />
3 Innenhof (batuma)<br />
4 Abstellraum (tassike)<br />
Obergeschoss:<br />
5 Zimmer d.<br />
Hausherren<br />
(tafarafara/sifa)<br />
6 Toilette (salanga)<br />
Wie in Abbildung 2 nachzuvollziehen, gelangt man durch den Hauseingang zunächst in ein<br />
Vestibül. In diesem fensterlosen Raum werden Freunde und Bekannte der Familie<br />
empfangen, und auf Grund der relativ kühlen Temperaturen hält man sich während des<br />
Tages hier gerne auf. Wenn die Größe des Raumes es erfordert, wird die Decke von<br />
einer eckigen Säule in der Raummitte gestützt.<br />
Durchquert man einen oder mehrere dieser dunklen Räume, erreicht man den für<br />
islamische Bauten typischen Innenhof. Als Aufenthaltsort für die Frauen und Mädchen, an<br />
dem sie die Mahlzeiten zubereiten, ist er von mehreren viereckigen Räumen umgeben, so<br />
dass Fremden der Einblick verwehrt bleibt. Die umliegenden Räume sind ebenfalls für die<br />
Frauen und Kinder des Hauses vorgesehen.
Vom Innenhof oder einem der Räume führt eine schmale und steile Treppe ins<br />
Obergeschoss, zu den Räumlichkeiten des Hausherrn. Sein Schlafzimmer liegt direkt über<br />
dem Eingangsbereich. Weitere Zimmer im zweiten Stockwerk fungieren als Lagerräume<br />
für Hirse und Reis, und der hintere Teil setzt sich meist als Dachterrasse, die in warmen<br />
Nächten gern als Schlafplatz genutzt wird, fort. Eine niedrige Lehmmauer schließt sie zum<br />
Rand des Gebäudes ab. In einer hinteren Ecke des Flachdaches befindet sich die Toilette,<br />
ein kleines einzelnes Lehmhäuschen. In die Außenmauern sind auf Höhe des Daches<br />
tönerne Wasserspeier mit eingearbeitet, über die das Regenwasser abfließen kann.<br />
Abb. 3a: Schema Bürgerhausfassade<br />
(Krings 1984, 132.)<br />
Abb. 3b: Fassade eines Bürgerhause in Djenné<br />
(eigene Aufnahme)<br />
1 Hauseingang (goumhu)<br />
2 Tür-Vorbau (saria)<br />
3 Risalit (sara fa wey)<br />
4 Fenster im Aijimez-Stil (soro funey)<br />
5 Tritthölzer (toron)<br />
6 Phallische Lehmsäulchen (potige idye)<br />
7 Lehmzinnenkrone (soro diokoti)<br />
8 Zierlöcher (soro tabai)<br />
9 Eckzinnen (sara fa har)<br />
153
Je nach Vermögen der Hausbewohner ist die Straßenfront mehr oder minder reich<br />
gestaltet. Abbildung 3 veranschaulicht das Idealschema der Fassadengesaltung. Der<br />
Haupteingang wird durch zwei massive Mauerstützen und ein beide verbindendes kleines<br />
Vordach eingerahmt, so dass ein kleiner Vorraum entsteht. Der Eingangsbereich wird<br />
durch ein sich nach oben hin anschließendes Risalit mit einer Querverbindung, die mit<br />
einer Reihe von Holzbündeln verziert ist, weiter betont. Die aus der Fassade hervor<br />
stehenden „toron-Hölzer“ dienen neben ihrer dekorativen Funktion vor allem als<br />
Baugerüst für Renovierungsarbeiten. Das kleine Fenster zwischen diesen Hölzern und<br />
dem Eingang ist mit einem Gittertürchen aus Holz im marokkanischen Stil versehen.<br />
Über den Holzbalken befindet sich ein eckiges Lehmrelief, das kleine eckige und<br />
phallusartige Lehmsäulen umschließt und über dem Niveau des Flachdaches in einer<br />
Lehmzinnenkrone endet. Eckzinnen des Daches, auf die lehmumkleidete Keramiktöpfe<br />
gesteckt sind, lassen das Gebäude optisch höher erscheinen, als es tatsächlich ist. (Krings<br />
1984, 130-134.)<br />
2.2. Sakrale Bauten<br />
Bei der Betrachtung der Lehmarchitektur im Sudan dürfen die Gebäude der Geistlichkeit<br />
nicht fehlen. Die Moschee ist nicht nur zentraler Punkt des islamischen Glaubens und der<br />
Stadt, sondern auch der Inbegriff der sudanischen Lehmarchitektur. Da die Moschee von<br />
Djenné in der Literatur häufig als eine der eindrucksvollsten Sakralbauten dieser Art<br />
genannt wird, soll sie nun beispielhaft näher beschrieben werden.<br />
Der quadratische Bau wurde 1907 nach einem Vorbild aus dem Jahr 1830 errichtet und<br />
misst bei einer Höhe von 20 Metern etwa 150 Meter Länge. Eine breite Terrasse mit<br />
umlaufender niedriger Lehmmauer trennt das Gebäude vom direkt anschließenden<br />
Marktplatz, der etwas tiefer liegt. Über Treppenaufgänge, die beidseitig von<br />
Lehmzinnenpaaren begleitet werden, ist die Moschee für Gläubige zugänglich.<br />
Abb. 4: Moschee in Djenné<br />
(eigene Aufnahme)<br />
154
Die Struktur der Außenmauern macht deutlich, warum man von der Sudanarchitektur<br />
auch als Sudangotik spricht: Viele gleichmäßig angeordnete Stützpfeiler treten aus der<br />
Fassade hervor und betonen die Senkrechte des Bauwerk Zusätzlich erhöhen optisch<br />
drei Minarette, die auf der Marktplatzseite über das Niveau des Daches hinaus ragen, die<br />
Moschee. Die viereckigen Türme werden nach oben hin schmaler, gehen in dünne<br />
Lehmzinnen über und tragen an ihren Enden Keramikgefäße und Straußeneier. Die in<br />
Kapitel 2.1 bereits erwähnten funktionalen und dekorativen Holzbalkenbündel zieren in<br />
gleichen Abständen neben den Türmen der Moschee auch die restliche Außenfassade.<br />
Jedes Jahr vor Beginn der Regenzeit dienen sie als Tritthölzer für die Maurer, die im<br />
Rahmen eines geschäftigen Volksfestes eine neue Wasser abweisende Lehmschicht<br />
auftragen. (Krings 1984, 128 ff.)<br />
100 massive viereckige Lehmsäulen stützen das Flachdach, welches auf einer Grundlage<br />
aus Holzbalken konstruiert ist. Am Fuße sind die Säulen etwa einen Meter dick und<br />
gehen unter der Decke in Form von Spitzbögen ineinander über, was erneut die<br />
Bezeichnung Sudangotik erklärt. Da in die Mauer nur wenige kleine Fenster eingearbeitet<br />
sind, tragen in das Dach eingemauerte Tontöpfe ohne Boden zur Be- bzw. Entlüftung des<br />
Gebäudes bei. Bei Regenfällen können diese mit Deckeln verschlossen werden. (Gardi,<br />
René 1973: Auch im Lehmhaus lässt sich’s leben. Über traditionelles Bauen und Wohnen<br />
in Westafrika, 241 f.)<br />
3. Stilistische Einflüsse<br />
Im einleitenden Kapitel über Ursprung und Verbreitung der Sudanarchitektur wurde<br />
bereits angesprochen, dass sich in dieser Bauweise verschiedene Einflüsse vereinen und<br />
zu besonderen stilistischen Merkmalen führen. Einige der charakteristischen<br />
Eigenschaften werden in den beiden folgenden Teilkapiteln näher beleuchtet.<br />
3.1. Animistische Elemente<br />
Als eine schwarzafrikanische Naturreligion beinhaltet der Animismus den Glauben an<br />
übernatürliche Kräfte, die sämtlichen Erdenbewohnern, Tieren, Pflanzen und Elementen,<br />
wie Feuer und Wind, innewohnen und sich auf das Schicksal der Menschen auswirken.<br />
Um diese Mächte positiv zu stimmen, werden diverse Opfergaben gebracht und<br />
Zauberrituale durchgeführt, wie z. B. Fruchtbarkeitszeremonien. Auch die Seelen<br />
verstorbener Ahnen werden verehrt und in diese Praktiken mit einbezogen, da sie<br />
weiterhin Bewohner der Erde bleiben.<br />
Dieser Hintergrund lässt sich mit einigen Elementen der Fassadengestaltung sudanischer<br />
Gebäude in Verbindung bringen: mit den konischen Lehmzinnen, die zu mehreren oder<br />
auch einzeln vor dem Haus oder auf dem Dach des Dorfchefs stehen. Ihnen wird von<br />
vielen Volksgruppen der Savanne eine mythische Bedeutung zugeschrieben. Konische<br />
Pfeiler aus Lehm oder Stein fungieren als Ahnengräber oder bei den Dogon auch als<br />
155
Opferaltäre für ihren Schöpfergott Amma. Die Form der Lehmpfeiler ist vermutlich<br />
durch die in der umliegenden Landschaft typischen Termitenhügel inspiriert. In einem<br />
Schöpfermythos der Dogon stellen die Termitenhügel Vorbilder für das Wohnen und<br />
Speichern von Vorräten dar und bieten Schutz vor wilden Tieren. Diese Symbolkraft<br />
kann somit mit den Lehmzinnen der sudanischen Architektur assoziiert werden, um<br />
damit nur eine unter zahlreichen Interpretationsmöglichkeiten zu nennen. In der Mande-<br />
Sprache lautet die Bezeichnung für die Eckzinnen auf den Dächern „sara far har“, was mit<br />
„Grabstätte“, „Schönheit“ und „Fruchtbarkeit“ gleich gesetzt werden kann. Hier werden<br />
wiederum der Kreislauf des Lebens und der enge Zusammenhang mit dem Tod<br />
symbolisiert.<br />
Neben den Lehmpfeilern wird auch dem architektonisch betonten Hauseingang eine<br />
kultisch-religiöse Bedeutung zu geschrieben. Die durch das aufwärts strebende<br />
Lehmrelief über dem Portal betonte Senkrechte unterstreicht die Vormachtstellung des<br />
Hausherrn. (Krings 1984, 136-139.)<br />
3.2. Islamische Elemente<br />
Bei der Beschreibung des Aufbaus eines Bürgerhauses im Sudanstil in Kapitel 2.1 wurde<br />
schon die Innenhoforientierung als typisches islamisches Merkmal genannt. Die Innenhöfe<br />
als Aufenthaltsort und die ebenfalls charakteristischen kleinen Fenster in den Außenmauern<br />
schützen die Intimität der Hausbewohner. Vor den Fenstern sind traditionell<br />
Gittertürchen aus Holz angebracht, deren Verarbeitungsweise in Hufeisen- oder<br />
Schlüssellochformen ihre marokkanische Herkunft verraten.<br />
Weitere islamische Kennzeichen sind der viereckige Grundriss der Häuser, das leicht<br />
geneigte Flachdach, deren Entwässerung über tönerne Wasserspeier in den Außenmauern<br />
erfolgt, die Lehmziegel und die spezielle Deckenkonstruktion, die aus mehreren<br />
Schichten Holzbalken und Palmblättern besteht. (Nähere Details dazu sind in Kapitel 4 zu<br />
finden.)<br />
Die islamischen Einflüsse machen sich darüber hinaus auch in der Struktur der Stadt<br />
bemerkbar. Das orientalische Sackgassenprinzip ist in Djennés Altstadt durch schmale,<br />
häufig abbiegende Gassen, die durch eng aneinander anschließende Außenmauern der<br />
Wohnkomplexe begrenzt sind, zu erkennen. (Krings 1984, 139-142.)<br />
4. Zur Bauweise<br />
Da sich die Arbeitsschritte und die Konstruktion von Wohnhäusern und sakralen<br />
Gebäuden in ihrem Grundaufbau kaum unterscheiden, wird im Anschluss allgemein die<br />
Bauweise der Sudanarchitektur erläutert.<br />
Nachdem das Baugelände mit einer Feldhacke eingeebnet wurde, zeichnet der Bauherr<br />
ohne jegliche Bauzeichnungen den Grundriss auf den Boden. Bei einer Moschee wird als<br />
156
erstes die nach Osten gerichtete Wand („kibla“) vermerkt. Die Linien werden<br />
mittlerweile mit Hilfe von Schnüren bestimmt. Für die Grundmauern, die gewöhnlich aus<br />
zwei Ziegelreihen bestehen, reicht ein flacher Erdaushub au Der Fußboden der<br />
Innenräume, deren Höhe meist über dem äußeren Boden liegt, um dem Eintreten von<br />
Regenwasser entgegen zu wirken, wird mit Lehmmörtel gefüllt und fest gestampft.<br />
Lehm als Grundbaustoff ist auf Grund der vielen Seitenarme des Nigers fast überall zu<br />
finden. Mit der Feldhacke wird der lehmige Boden entnommen, Wasser und je nach<br />
Verwendungszweck unterschiedliche pflanzliche Zusätze hinzu gegeben und mit den<br />
Füßen vermengt. Oft werden auch Reste von alten Gebäuden als Bausubstanz weiter<br />
verwendet und unter den Lehmbrei gemischt. In drei Formen wird der Lehm verarbeitet:<br />
Zur Ziegelherstellung kommen grobe Reis- und Hirsehäcksel dazu, Bindemörtel bedarf<br />
der Zufuhr von Dung, und für Putzmörtel wird neben Reisspreu, Dung, Mehl von<br />
Baobab-Früchten und Erde von Termitenhügeln auch Karité-Butter beigemengt.<br />
Letzteres ist für die Außenwände und das Dach von besonderer Bedeutung, denn die<br />
Karité-Butter sorgt für eine Wasser abweisende Außenschicht. Der Putzmörtel muss<br />
mindestens drei Monate lang unter ständiger Wasserzufuhr lagern, bevor er verwendet<br />
werden kann. Die Ziegelherstellung kann schon nach zwei bis drei Tagen beginnen. Vor<br />
der Kolonialisierung wurden die Ziegel mit Händen geformt und hatten eine eher<br />
rundliche Gestalt. Die Kolonialherren führten Holzrahmen ein, mit denen fortan<br />
quaderförmige Ziegel produziert wurden. Die geformten Ziegel müssen zwei bis drei<br />
Wochen trocknen, dabei täglich gewendet werden, damit sie gleichmäßig trocknen und<br />
keine Risse entstehen.<br />
Um die Mauern hoch zu ziehen, muss viel Mörtel benutzt werden. Deshalb ist allerdings<br />
recht schnell eine Baupause erforderlich, damit der Mörtel nachtrocknen kann und die<br />
Mauer sich nicht unter ihrem Eigengewicht und dem des Maurers, der gewöhnlich<br />
zusätzlich auf ihr lastet, verformt.<br />
Abb. 5a: Schema einer Treppenkonstruktion<br />
(Gruner, Dorothee 1990: Die Lehm-Moschee am Niger: Dokumentation eines traditionellen Bautyps, 67.)<br />
157
Abb. 5b: Treppenkonstruktion<br />
(eigene Aufnahme)<br />
Die Treppen im Haus hingegen bestehen weniger aus massiven Mauern, sondern eher<br />
aus einer Konstruktion aus Holzbalken. Die Basisbalken werden schräg in die Mauern mit<br />
eingearbeitet und schaffen einen Hohlraum, der gern als kühler Lagerraum für<br />
Wasserkrüge genutzt wird. Auf den langen Balken werden kürzere Querhölzer befestigt,<br />
auf denen dann die Lehmziegel der einzelnen Treppenstufen folgen.<br />
Abb. 6: Deckenkonstruktion auf Stützwänden<br />
(eigene Aufnahme)<br />
158
Das Flachdach in der Mittelniger- und Volta-Niger-Region ruht auf den Außenmauern des<br />
Gebäudes und je nach Raumgröße zusätzlich auf einzelnen Stützen oder Stützwänden,<br />
welche wiederum Grundlage für die Holzprofile der Decke sind. Auf die durchschnittlich<br />
zwei bis zweieinhalb Meter langen Holzbalken werden Flechtmatten oder Palmblätter<br />
gelegt. Darauf folgen schichtweise Lehmmörtel, Lehmziegel, Lehm- und schließlich<br />
Putzmörtel. Die oben erwähnten Wasserspeier bestehen heute in den Städten<br />
größtenteils aus gebranntem Ton, während sie auf dem Land manchmal noch nach alter<br />
Methode aus halbierten Palmhölzern zu sehen sind.<br />
Abb. 7: Wasserspeier aus Holz in Kenekolo, nahe Kati<br />
(eigene Aufnahme)<br />
In einer zwei bis fünf Zentimeter dicken Schicht schützt der Putzmörtel Dach und<br />
Außenfassaden vor zu schneller Verwitterung. Die Europäer brachten zwar die<br />
Maurerkelle mit nach <strong>Mali</strong>, jedoch sieht man noch heute mancherorts, wie der Putz ohne<br />
Werkzeug nur mit der flachen Hand aufgetragen wird. (Gruner 1990, 59-70.)<br />
Zu den traditionellen Werkzeugen zählen die Feldhacke, Flechtkörbe und Kalebassen für<br />
die Mörtelherstellung, das permanente Baugerüst in Form der „toron-Hölzer“ und<br />
Leitern. (Gruner 1990, 75 f.)<br />
5. Vorteile der Lehmbauweise<br />
Wie zuvor mehrfach angedeutet, ist die Lehmbauweise besonders an die klimatischen<br />
Bedingungen im Sudan angepasst. Die Wände und die massiven Decken, die auf die Art<br />
und Weise, wie sie in Kapitel 4 beschrieben ist, bis zu 60 Zentimeter stark werden<br />
können, haben den großen Vorteil, dass sie tagsüber die Räume verhältnismäßig kühl<br />
halten und umgekehrt ebenso die Wärme des Tages in kühlen Nächten speichern.<br />
(Gruner 1990, 66.)<br />
Lehm ist auf Grund seiner großräumigen Verfügbarkeit außerdem ein sehr<br />
kostengünstiger Baustoff und ermöglicht das Bauen ohne auf teure Importe aus<br />
Industrieländern, wie Zement und Stahl, angewiesen zu sein. Des Weiteren sind für die<br />
Herstellung der Lehmziegel und des Mörtels keine modernen Technologien notwendig,<br />
159
denn die Lehmmasse wird mittels Händen und Füßen vorbereitet und weiterverarbeitet.<br />
Auch der Transport bedeutet keine großen zusätzlichen Kosten, da gewöhnlich keine<br />
weiten Strecken vom Herstellungsort zur Baustelle zurückgelegt werden müssen.<br />
Aus der Tatsache, dass viele einzelne Arbeitsschritte dieser Architektur auf Handarbeit<br />
und schwerer körperlicher Arbeit basieren, leitet sich ein weiterer Vorteil ab: Der<br />
Einsatz von vielen Arbeitskräften ist notwendig und die Beschäftigtenzahl hoch. Hinzu<br />
kommt die recht hohe Anfälligkeit für Verwitterung der Bausubstanz, so dass über das<br />
Bauen der Gebäude hinaus auch regelmäßig Renovierungsarbeiten vorgenommen werden<br />
müssen. Die Tradition der Lehmbauweise zählt somit zu den so genannten „angepassten<br />
Technologien“ im Rahmen entwicklungspolitischer Überlegungen. Nicht nur das<br />
Errichten von Lehmgebäuden, sondern vor allem auch das Reparieren der<br />
Außenfassaden, was bspw. bei der Moschee in Djenné die gesamte Stadt mit einbezieht,<br />
stärkt den Zusammenhalt der Helfenden untereinander und fördert die Identifizierung<br />
mit der regionalen Kultur. (Krings 1984, 126.)<br />
160
Literaturverzeichnis<br />
GARDI, René 1973: Auch im Lehmhaus lässt sich’s leben. Über traditionelles Bauen und<br />
Wohnen in Westafrika. Graz.<br />
GRUNER, Dorothee 1990: Die Lehm-Moschee am Niger: Dokumentation eines<br />
traditionellen Bautyps. Stuttgart.<br />
KRINGS, Thomas 1984: Die Tradition der urbanen Lehmarchitektur im Obernigergebiet<br />
von <strong>Mali</strong>. In: Die Erde Nr. 115, 123-144.<br />
161
162
Kulturelle Konstruktion von Landschaft -<br />
die Wissenschaftsreisen von Heinrich Barth<br />
Lisa Trager<br />
163
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Biographie .................................................................................................................................... 165<br />
2. Die große Expedition durch Afrika ........................................................................................ 165<br />
3. Besonderheiten der Forschung Barths .................................................................................. 166<br />
4. Kulturelle Konstruktion von Landschaft ............................................................................... 167<br />
164
1. Biographie<br />
Johann Heinrich Barth wurde 1821 in Hamburg geboren. Er war der jüngste Sohn eines<br />
Überseekaufmannes und dessen Frau, die zwar beide nicht zum Bildungsbürgertum<br />
gehörten, aber alles taten um ihren Kindern Zugang zu höherer Bildung zu verschaffen.<br />
So besuchte Heinrich Barth zunächst eine Privatschule in Hamburg und wechselte später<br />
auf das Johanneum, wo er schon in frühen Jahren durch großen Ehrgeiz und Fleiß auffiel.<br />
So brachte er sich beispielsweise neben der Schule selbst Englisch und Arabisch bei (vgl.<br />
Deck 2006, 5ff). Sein großes Sprachentalent war ihm auf seinen späteren Reisen natürlich<br />
äußerst nützlich. 1839 begann er sein Studium in Berlin, wobei er sich mit der Wahl des<br />
Studiengebiets sehr schwer tat und schließlich Altertumswissenschaften, Germanistik,<br />
sowie Geographie studierte. Nach einer einjährigen Reise nach Italien promovierte er<br />
1844 schließlich August Boeck, einem Altertumswissenschaftler, sowie Carl Ritter, der<br />
bis heute als Begründer der modernen Geographie gilt. Nach seinem Studium versuchte<br />
Barth als Hauslehrer und Dozent zu arbeiten, war aber auf Grund seiner mangelnden<br />
pädagogischen und rhetorischen Fähigkeiten nur mäßig erfolgreich. 1845 unternahm er<br />
dann seine erste Reise außerhalb Europas, auf die er sich in London vorbereitete. Zu<br />
diesem Zeitpunkt sprach er bereits vier Sprachen und studierte den Koran. Die Reise<br />
führte ihn durch Südfrankreich, Spanien, Algerien, Tunesien, Malta, Ägypten, Palästina,<br />
Damaskus, Beirut, Zypern, Rhodos, Konstantinopel und im Dezember 1847 erreichte er<br />
wieder Hamburg (vgl. Deck 2006, 7).<br />
1849 wurde der britische Forscher James Richardson von der britischen Regierung mit<br />
einer Reise in das Innere Afrikas und vor allem in das Sultanat von Bornu beauftragt, mit<br />
welchem sich die Regierung ein Handelsverhältnis erhoffte. Heinrich Barth wurde als<br />
Richardsons Begleiter ausgewählt, ebenso wie Adolf Overweg, ein deutscher Astronom<br />
und Geologe. Insgesamt dauerte die <strong>Exkursion</strong> knapp sechs Jahre; 1855 kehrte Barth als<br />
einziger Überlebender zurück nach Europa (vgl. Deck 2006, 12ff). Zwei Jahre später<br />
veröffentlichte er dann sein fünfbändiges Werk „Reisen und Entdeckungen in Nord- und<br />
Centralafrika in den Jahren 1849 bis 1855“, welches er aus seinen präzisen Aufzeichnungen<br />
während der Reise erstellte. Zu diesem Zeitpunkt wurde Barth in wissenschaftlichen<br />
Kreisen als Forscher geschätzt, in gesellschaftlichen Kreisen jedoch kaum<br />
wahrgenommen, da seine nüchternen, faktenreichen Erzählungen nicht der Stimme der<br />
Zeit entsprachen, welche lieber fantastische Abenteuer von dem „schwarzen Kontinent“<br />
erzählt bekam. So verließ er 1858 England und ging mit der Hoffnung die Professur Carl<br />
Ritters übernehmen zu können nach Berlin. Von dort aus unternahm er noch mehrere<br />
kürzere Reisen und bekam schließlich eine außerordentliche Professur. 1865, mit nur 44<br />
Jahren verstarb Barth an einem Magendurchbruch und wurde auf dem Kreuzberger<br />
Friedhof in Berlin beigesetzt (vgl. Deck 2006, 25).<br />
2. Die große Expedition durch Afrika<br />
Die große Expedition durch Afrika stellt die wichtigste <strong>Exkursion</strong> von Heinrich Barth dar.<br />
James Richardson, der englische Forscher, der mit der Führung der Reise beauftragt<br />
wurde, hatte in vorherigen Jahren bereits das gesamte nördliche Afrika bereist. Mit der<br />
großen Expediton verfolgte er nicht nur die ökonomischen Ziele der britischen<br />
165
Regierung, sondern auch eigene, vor allem politisch geprägte Absichten. Richardson galt<br />
als einer der bedeutendsten Gegner des Sklavenhandels zu seiner Zeit und die<br />
Abschaffung selbigen war ein erklärtes Ziel seiner <strong>Exkursion</strong>. Barths Absichten waren<br />
weniger ökonomischer oder politischer Natur: er wollte schlicht und einfach einen<br />
Kontinent erforschen, von dem die westliche Welt bisher kaum etwas wusste (vgl. Deck<br />
2006, 11f). Diese unterschiedlichen Beweggründe für die Reise ließ die zwei Forscher<br />
während der Reise immer wieder aneinander stoßen. Die knapp sechsjährige Reise<br />
würde heute rund zehn Landesgrenzen überqueren: Libyen, Niger, Nigeria, Tschad,<br />
Benin, Burkina Faso, <strong>Mali</strong> und Kamerun. Nicht nur die unterschiedlichen Interessen<br />
stellten immer wieder ein Problem während der Reise dar, auch die finanzielle Situation<br />
war oft schwierig. Dazu kam, dass die Forscher sich in teilweise kaum erforschten<br />
Gebieten bewegten, es deswegen kaum Karten zur Orientierung gab. Nach mehreren<br />
Monaten Vorbereitungszeit in Tripolis, startete die Expedition schließlich im März 1950.<br />
Ab diesem Moment nannte sich Barth „Abd al-Karim“ (Diener des Allerhöchsten) und<br />
trug einheimische Tracht. Diese Maßnahmen, ebenso wie seine Kenntnisse der Sprache<br />
und des Korans, sollten zu seiner eigenen Sicherheit dienen. 1851 entschließen sich die<br />
drei Forscher zu trennen und jeder für sich weiterzuforschen. Kurze Zeit später starb<br />
Richardson, Barth zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und übernahm die Führung der<br />
Reise, deren Route er änderte und nach Timbuktu verlegte (vgl. Deck 2006, 18f). Kurze<br />
Zeit bevor Overweg und Barth nach Timbuktu aufbrachen, starb jedoch auch Overweg<br />
an Malaria. Heinrich Barth zog also alleine los und gab sich aus Angst wie Alexander<br />
Gordon Laing zuvor ermordet zu werden als islamischer Prediger aus. Sein Versteckspiel<br />
flog jedoch sehr schnell auf und er zog damit noch mehr Unmut auf sich und bekam<br />
sogar Morddrohungen gesendet. Dies lag auch daran, dass er zu einem äußerst<br />
ungünstigen Zeitpunkt in Timbuktu ankam, da der einzige ihm wohlgesonnen Mann, der<br />
Scheich Ssid Ahmed El-Bakay nicht vor Ort war. Als dieser jedoch kurze Zeit später in<br />
der Stadt ankam, rettete er Barth vor den aufgebrachten Menschen. Zuhause in Europa<br />
galt Barth mittlerweile als verschollen, deswegen wurde der deutsche Ernst Vogel<br />
geschickt ihn zu suchen. Sie trafen in Timbuktu aufeinander, trennten sich jedoch kurz<br />
darauf erneut und Vogel wurde einige Monate später in Wadai ermordet, wo er für<br />
einen Spion gehalten wurde. Im Mai 1955 begann Barth schließlich seine Rückreise nach<br />
Tripolis über die Bornu-Straße, eine berühmte Handelsroute zu der Zeit. Insgesamt legte<br />
er rund 15.500 km zurück (vgl. Deck 2006, 24).<br />
3. Besonderheiten der Forschung Barths<br />
Wichtig zu beachten ist, dass die Dinge, die die Forschung Heinrich Barths so besonders<br />
gemacht haben immer im Kontext des 19. Jahrhunderts gesehen werden müssen. Auch<br />
wenn sie in der heutigen Zeit und beim heutigen Standpunkt der Wissenschaft teilweise<br />
banal erscheinen, waren es zu Lebzeiten Barths grundlegende Besonderheiten gegenüber<br />
dem üblichen Verhalten von Forschungsreisenden. Die Tatsache, dass Barth die Sprache<br />
der Kulturen, die er besuchte, lernte und später sogar analysierte ist ein anschauliches<br />
Beispiel dafür. Auch sein Interesse für den Koran und den Islam waren außergewöhnlich.<br />
Außerdem versuchte Barth in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung zu treten und suchte<br />
das Gespräch mit fremden Menschen. Seine Anpassung ging sogar so weit, dass er sich<br />
selbst verleugnete und sich als andere Personen ausgab, so zum Beispiel als „Abd al-<br />
Karim“. Ein weiterer besonderer Aspekt seiner Reisen war die Tatsache, dass er es<br />
166
vermied Gewalt und Waffen anzuwenden. Dies war eine durchaus übliche Vorgehensweise<br />
der Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Barth war jedoch vor allem interessiert<br />
am Alltag der Menschen, er betrieb als einer der ersten Wissenschaftler die so genannte<br />
„teilnehmende Beobachtung“, eine ethnologische Forschungsmethode, die erst einige<br />
Jahre nach Barth offiziell eingeführt wurde (vgl. Deck 2006, 42). Um den Alltag der<br />
Menschen beobachten und daran teilnehmen zu können, war Barth klar, dass er auf<br />
Gewalt verzichten musste. Eine der wichtigsten Errungenschaften der Wissenschaft<br />
Barths war jedoch die Tatsache, dass er Afrika eine Geschichte und damit Wichtigkeit<br />
zusprach. Die traditionelle Geschichtswissenschaft beschäftigte sich hauptsächlich mit<br />
schriftlichen Quellen, diese waren aber kaum zu finden in Afrika, aus diesem Grund<br />
wurde oft argumentiert, Afrika hätte keine Geschichte. Barth hingegen beschäftigte sich<br />
explizit mit der oralen Kultur, d.h. mit mündlichen Überlieferungen und Geschichten (vgl.<br />
Heinrich-Barth Institut 2006). Außerdem war er durch sein breitgefächertes Studium<br />
wohl einer der ersten Wissenschaftler, der einen interdisziplinären Ansatz vertrat und<br />
damit vielleicht ein Ahne der heutigen Kulturwissenschaft.<br />
All diese Besonderheiten der Forschung Barth sind jedoch, wie Yvonne Deck feststellt<br />
mit Vorsicht zu genießen, da die heutige Sicht leicht dazu tendiert Barth zu verherrlichen.<br />
Heinrich Barth war trotz der teils außergewöhnlichen Merkmale seiner Forschung<br />
trotzdem Mann seiner Zeit, er war europäisch geprägt und auch stolz auf sein<br />
europäisches Erbe. So hielt er trotz seines Interesses für Afrika Europa für das Ideal des<br />
Fortschritts und Afrika für zurückgeblieben (vgl. Deck 2006, 45).<br />
4. Kulturelle Konstruktion von Landschaft<br />
Dass Forscher ihre Ergebnisse durch ihre Erfahrungen, Gefühle und Wahrnehmung<br />
beeinflussen, ist lange bekannt, dabei stand aber immer eher die Betrachtung von<br />
anderen Menschen im Fokus der Kritik. Gleichzeitig ist aber auch die Wahrnehmung von<br />
scheinbar „objektiven“ Landschaften subjektiv geprägt (vgl. Harms 2006, 174). Dies wird<br />
umso deutlicher beschäftigen wir uns mit den scheinbar objektiven Landschaftsbeschreibungen<br />
Heinrich Barths. Robert Harms stellt in seinem Essay zwei wichtige<br />
Einflüsse auf die Konstruktion von Landschaft in Barths Berichten fest: die aufkommenden<br />
Naturwissenschaften mit ihrem Drang zu Kategorisierung und Ordnung, sowie die<br />
europäische Landschaftsmalerei, bei der ästhetische Ideale aus Europa auf die Landschaft<br />
appliziert wurden (vgl. Harms 2006, 176ff) . Beide Aspekte kann man in den Berichten<br />
Barths und seinen Beschreibungen von Natur immer wieder erkennen. In seinen<br />
Schilderungen kopierte Heinrich Barth allerdings nicht nur vorherrschende Ideale,<br />
sondern verknüpfte sie auch untereinander und ließ seine lokalen Kenntnisse in seine<br />
Berichte mit einfließen. Es bleibt festzuhalten, dass wir uns stets der Tatsache bewusst<br />
machen müssen, dass wir die Dinge immer in einem kulturellen Kontext erfassen,<br />
reflektieren und mit unserem europäischem Hintergrund viele Dinge nicht verstehen<br />
bzw. sehen können oder sie anders interpretieren.<br />
167
Literaturverzeichnis<br />
DECK, Yvonne 2006: Heinrich Barth in Afrika. Der Umgang mit dem Fremden. Eine<br />
Analyse seines großen Reisewerks. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Universität<br />
Konstanz.<br />
HARMS, Robert 2006: Heinrich Barth’s Construction of Nature. In: DIAWARA, Mamadou<br />
et al: Heinrich Barth et l’Afrique. Köln, 173 -183.<br />
Heinrich-Barth-Institut 2006: Zehn Seiten eines Afrikaforschers. URL: http://www.unikoeln.de/hbi/10_s_barth_bio.html,<br />
Stand 02.02.2009.<br />
168
Die Frau im islamisch geprägten <strong>Mali</strong><br />
Elena Konrad<br />
169
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Die Frau im islamisch geprägten <strong>Mali</strong>...................................................................................1721<br />
2. Weibliche Genitalverstümmelung........................................................................................... 172<br />
170
1. Die Frau im islamisch geprägten <strong>Mali</strong><br />
Die Frauen spielen eine sehr wichtige Rolle im sozialen, sowie auch wirtschaftlichen<br />
Leben <strong>Mali</strong>s. Sie arbeiten sehr hart und verdienen aber meistens nur wenig Geld, ganz zu<br />
schweigen von der unbezahlten Arbeit im Haushalt. Generell lässt sich feststellen, dass<br />
die Frauen in <strong>Mali</strong> in vielen Bereichen, wie z.B. soziales und ökonomisches Leben, Zugang<br />
zu Bildung und generelle Rechte noch sehr benachteiligt werden. Dabei spielen jedoch<br />
viele Faktoren eine Rolle, so genießen die Frauen in der Stadt oft größere Freiheiten als<br />
die Frauen im ländlichen Raum. Weitere Faktoren welche die Stellung der Frau<br />
beeinflussen sind die finanzielle Situation der Familie, der Bildungsgrad des Ehemanns<br />
bzw. der Familienmitglieder und auch deren religiöse Überzeugungen, sowie die<br />
Persönlichkeit der Frau. Die Rechte der Frau können auch je nach Ethnie variieren, so<br />
gilt z.B. bei den Tuareg das Mutterrecht und die Frau nimmt eine besondere Stellung in<br />
der Familie ein u.a. als „Herrin des Familienzelts“. Im Gegensatz haben bei den Soninké<br />
die Frauen generell eher wenig Freiraum und verlassen kaum das Haus.<br />
Laut Verfassung sind Frau und Mann gleichberechtigt, doch in der Realität sieht dies meist<br />
anderes aus. Zum Teil stehen den Frauen bestimmte Recht zwar per Gesetz zu, doch der<br />
Alltag ist vor allem an den Traditionen orientiert. Eine Gleichberechtigung ist weit<br />
entfernt, so liegt z.B. die Analphabetenquote bei Frauen um einiges höher als bei den<br />
Männern und auch im Wirtschaftsleben und bei der Einklage ihrer Rechte herrscht<br />
weiterhin Ungleichheit. Dabei sind die Frauen im Wirtschaftsleben stark vertreten, wie<br />
wir auch vor Ort feststellten, arbeiten sehr viele von ihnen als Händlerinnen oder<br />
Verkäuferinnen. Doch laut IHK sind nur 1% der Frauen Inhaberinnen eines festen<br />
Ladenlokals. Sobald es Richtung Massenabsatz geht, finden sich fast nur Männer wieder<br />
und verdrängen z.T. sogar die Frauen aus ursprünglichen Frauendomänen. Erschwerend<br />
kommt hinzu, dass Frauen traditionell eher leicht verderbliche Waren verkaufen und<br />
Männer länger haltbare und auch besser nachgefragte Produkte.<br />
In der Landwirtschaft übernehmen Frauen ebenfalls einen Großteil der Arbeit, doch auch<br />
hier haben sie zu kämpfen mit Gesetzten die ihnen den Besitz von Land verbieten, sowie<br />
erschwertem Zugang zu landwirtschaftlichem Equipment und Krediten. In der Politik sind<br />
die Frauen noch relativ wenig vertreten, 10% macht ihr Anteil in der Nationalversammlung<br />
aus, von 26 Ministerposten sind 6 von Frauen besetzt. Seit 1997 gibt es<br />
erstmals eine Frauenministerin, welche sich für die Stärkung der Rechte der Frauen<br />
einsetzt. Für sie ist es wichtig, dass auch in anderen Bereich der Politik, wie Agrarwirtschaft<br />
oder Umwelt, die Frauen in Fragestellungen miteinbezogen werden. Doch sie<br />
hatte anfangs, zum Teil aber auch bis heute, mit vielen Vorurteilen vor allem ihrer<br />
männlichen Kollegen zu kämpfen.<br />
Der Alltag der Frauen ist vor allem durch familiäre Pflichten geprägt, die klassische Rolle<br />
ist immer noch die der Hausfrau und Mutter. Zu den Aufgaben gehören meist Kochen,<br />
Wasser und Brennholz holen, Sauberhalten des Haushalts und Wäschewaschen – oft mit<br />
großer körperlicher Anstrengung verbunden. Schon als kleines Mädchen werden<br />
schwere Aufgaben im Haushalt übernommen. Die meisten Mädchen werden sehr jung<br />
verheiratet mit einem oftmals wesentlich älteren Partner. Offiziell dürfen Mädchen erst<br />
mit 18 verheiratet werden, mit Einverständnis der Eltern mit 15 Jahren, doch die<br />
Grenzen werden oft unterschritten. Die Eheschließung gilt meist als Verbindung zweier<br />
Familien und wird von den Eltern arrangiert. Häusliche Gewalt ist keine Seltenheit. In<br />
171
<strong>Mali</strong> ist die Polygamie erlaubt, bis zu vier Ehefrauen darf laut Koran ein Mann haben,<br />
unter der Voraussetzung alle gleich zu behandeln. In der Realität kommt es jedoch oft zu<br />
Problemen und Streitigkeiten zwischen den Familienmitgliedern. Besonders auch bei<br />
sogenannten „Versorgungsehen“, die entstehen wenn eine verwitwete Frau den Bruder<br />
ihres verstorbenen Mannes heiratet bzw. heiraten muss.<br />
Mit der Mutterrolle steigt der soziale Status einer Frau und viele Kinder bedeuten im<br />
Großteil des Landes immer noch ein gesellschaftliches Prestige. Ein großes Problem<br />
stellen Schwangerschaften bei jungen, unverheirateten Mädchen dar, da auf diese, um<br />
nicht von der Familie ausgestoßen zu werden, oft illegale Abtreibungen erfolgen. Laut<br />
Schätzungen des Familienministeriums sind 90% der Bevölkerung nicht auszureichend<br />
aufgeklärt.<br />
Abschließend lässt sich sagen, dass es auch einige positive Entwicklungen gibt, so steigt<br />
zum Beispiel die Einschulungsrate der Mädchen, die Zahl der arrangierten Ehen ist<br />
rückläufig und es gibt immer wieder Beispiele von Frauen die sich erfolgreich im<br />
Wirtschaftsleben behaupten. Als erfolgreiches Beispiel kann man die Frauen des Cercle<br />
de Niono nennen. Sie leisten einen erfolgreichen Beitrag der Stärkung der Frauen im<br />
Bereich Politik und Landwirtschaft und können durch ihre aktives Engagement als Vorbild<br />
für andere Frauen der Region dienen. Kritisch anzumerken ist, dass die Führungsfrauen<br />
des Cercle de Niono alle aus besseren Verhältnissen kommen und es sich so erst leisten<br />
können viel Zeit für politische Arbeit aufzuwenden. Frauen aus armen Verhältnissen, die<br />
den ganzen Tag schwer arbeiten müssen, werden kaum die Kraft finden sich nebenher<br />
noch politisch zu betätigen. Bis die Benachteiligung der Frauen in allen Bereichen<br />
schrittweise überwunden werden kann, ist es noch ein langer Weg.<br />
2. Weibliche Genitalverstümmelung<br />
In <strong>Mali</strong> sind über 90% der Frauen von der weiblichen Genitalverstümmelung betroffen.<br />
Dabei variiert der Anteil der beschnittenen Frauen geringfügig je nach Ethnie. Der Eingriff<br />
wird im Vergleich zu früher bei immer jüngeren Mädchen durchgeführt – 80% sind bei<br />
der Beschneidung unter 5 Jahren alt. Es birgt ein enormes gesundheitliches Risiko und<br />
beschränkt die Frauen in weiten Bereichen ihres Lebens. Als Gründe für die<br />
Praktizierung werden Tradition, Religion und die Kontrolle der weiblichen Sexualität<br />
angegeben. Oftmals gilt die Einstellung, nur eine beschnittene Frau ist sozial anerkannt<br />
und findet einen Ehemann. Über die Risiken sind jedoch die wenigsten aufgeklärt, denn<br />
Beschneidung ist ein gesellschaftliches Tabuthema. Meist kann sich dem Thema nur über<br />
gesundheitliche Aspekte bzw. Risiken im Gespräch mit der Bevölkerung genährt werden.<br />
In <strong>Mali</strong> wird das Problem nur von einer kleinen Elite wahrgenommen und Befürworter<br />
der Praxis nehmen laut Umfragen sogar zu. Bei vielen herrscht die Meinung vor, dass das<br />
Verbot der Beschneidung ein Feldzug des Westens sei, welchem man nicht nachgeben<br />
dürfe. Von Staatesseite ist die Beschneidung theoretisch verboten, da <strong>Mali</strong> das Maputo<br />
Protokoll unterschrieben hat, was deren Abschaffung fordert. Es gab bisher jedoch noch<br />
keinen einzigen Fall vor Gericht und auch im Staatsrecht scheiterten bisherige Versuche<br />
einer Gesetzesausarbeitung. Ein Programm zur Abschaffung der FGM 8 wurde geschaffen,<br />
8 FGM : Female Genital Mutilation : englischer Begriff für Weibliche Genitalverstümmelung.<br />
172
doch viele NGOs kritisieren, dass sich der malische Staat zu dem Thema nicht eindeutig<br />
positioniert.<br />
Einen großen Einfluss auf das Thema haben auch religiöse Führer, da der Großteil der<br />
Bevölkerung davon ausgeht die Beschneidung sei islamisch und in der Religion begründet.<br />
Viele Imame üben Druck aus zur Aufrechterhaltung der Praxis, z.B. durch Gebete und<br />
auch über Radiosendungen. Von konservativen Kreisen werden Aktionen gegen FGM<br />
sabotiert und Druck auf die Regierung ausgeübt. Nur eine sehr kleine Gruppe von<br />
Imamen hat sich bisher öffentlich gegen FGM ausgesprochen.<br />
Zahlreiche NGOs engagieren sich gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Nur durch<br />
viele kleine Schritte wie z.B. auch die Sensibilisierungsarbeit von GAAS <strong>Mali</strong> kann langsam<br />
ein Umdenken bewirkt werden. Förderlich ist sicher ein integrativer Ansatz, der den<br />
Staat, die Religionsführer, die gesamte Zivilgesellschaft und Beschneiderinnen mit<br />
einbezieht. Den Beschneiderinnen muss zum Beispiel die Möglichkeit einer alternativen<br />
Erwerbstätigkeit nach Beendigung der Praktik gegeben werden.<br />
Auch im Bereich Entwicklungszusammenarbeit spielt das Thema FGM eine Rolle. Es gibt<br />
eine „Geber-Themengruppe“ zu deren Mitgliedern z.B. UNICEF, WHO, EU und NGOs<br />
wie Care <strong>Mali</strong> zählen und welche im Reglfall alle zwei Monate tagt. Zusammengearbeitet<br />
wird zum Beispiel bei der Organisation von verschiedenen Aktivitäten am Internationalen<br />
Tag „Null Toleranz der Weiblichen Genitalverstümmelung“, sowie der Organisation von<br />
Konferenzen zum Thema FGM. Zu den Aktivitäten der einzelnen Gruppen zählen etwa<br />
die Behandlung von Folgeschäden der FGM, Organisation einer Konferenz mit Religionsführern,<br />
Sensibilisierung im Bereich Gesundheit und Menschenrechte. Der ded sieht ein<br />
voranbringendes Vorgehen in der Kombination folgender Schritte: einen rechtlichen<br />
Rahmen gegen die FGM zu schaffen und Aufklärungsarbeit bei relevanten Berufsgruppen<br />
leisten, den Staat bei der Durchführung des Programms gegen FGM und seiner<br />
Positionierung zu unterstützen, Dialog mit religiösen Führern führen und auch Rat von<br />
Imamen außerhalb <strong>Mali</strong>s suchen und die Aktivitäten der NGOs und der Geber-Grupper<br />
zu koordinieren, so dass möglicht effektiv gearbeitet und kooperiert werden kann.<br />
173
Literaturverzeichnis<br />
RICHTER, Gritt 2007: Hintergründe und Empfehlungen für den Politikdialog zur<br />
Überwindung von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) in <strong>Mali</strong>. Positionspapier der<br />
deutschen EZ in <strong>Mali</strong> für die Regierungsverhandlungen im Dezember 2007. Bamako.<br />
RONDEAU, Chantal; BOUCHARD, Hélène 2007: Commerçantes et épouses à Dakar et à<br />
Bamako. Paris.<br />
SCHNEIDER, Claudia 2001: Das starke Geschlecht. Frauenleben in <strong>Mali</strong>. Bamako.<br />
United Nations Development Fund for Women: The Struggle Against FGM in <strong>Mali</strong>. URL:<br />
http://www.unifem.org/gender_issues/voices_from_the_field/story.php?StoryID=396,<br />
Stand 10.05.2009.<br />
174
Umweltsituation in <strong>Mali</strong><br />
Theresa Lauw<br />
175
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Wasser.......................................................................................................................................... 177<br />
2. Desertifikation ............................................................................................................................ 177<br />
3. Müll................................................................................................................................................ 177<br />
4. Ufererosion ................................................................................................................................. 178<br />
5. Abholzung .................................................................................................................................... 178<br />
176
Der Reiseführer Lonley Planet nennt in dem Abschnitt über <strong>Mali</strong> Überholzung,<br />
Überweidung und Desertifikation die größten Umweltprobleme des Landes. Auf der<br />
Webseite von Germany Trade and Invest zu z. B., finden sich zahlreiche Artikel zum<br />
Thema Wasserressourcenmanagement, was darauf schließen lässt, dass diese Institution<br />
dies als primär zu behebendes Problem sieht. Andere Internetquellen beschreiben ganz<br />
andere Probleme als die Gravierernsten. Insgesamt ist nur sehr wenig zu dem Thema zu<br />
finden. Im Folgenden möchte ich die unterschiedlichen Auffassungen die ich vor der Reise<br />
nach <strong>Mali</strong> recherchieren konnte Stichpunktartig zusammenfassen.<br />
1. Wasser<br />
Abwasser: Die Abwasserversorgung in <strong>Mali</strong> ist kaum, und wenn dann unzureichend<br />
vorhanden. Eine staatliche Organisation dieser gibt es nicht. Die Abwässer gelangen auf<br />
direktem Weg in stehende und fließende Gewässer sowie in den Boden.<br />
Gewässerverschmutzung: In die Gewässer <strong>Mali</strong>s gelangt ein sehr großer Teil der<br />
Abwasser von Haushalten und Industrie. Zudem wird in den Flüssen und Seen <strong>Mali</strong>s mit<br />
stark tensidhaltigen Waschmitteln gewaschen und die Abfallstoffe von Stickstoff-<br />
Düngemitteln aus der Landwirtschaft in die Gewässer geleitet.<br />
Trinkwasser: Lediglich rund 12% der malischen Bevölkerung steht sauberes Trinkwasser<br />
zur Verfügung.<br />
2. Desertifikation<br />
Desertifikaton oder auch fortschreitende Wüstenbildung wird in <strong>Mali</strong> durch Deflation,<br />
Abholzung, Überweidung und Versalzung der Böden hervorgerufen.<br />
Weite Teile des Landes sind von diesem Problem betroffen. Insbesondere die nördlichen<br />
Regionen <strong>Mali</strong>s, südlich der Sahara sind gezwungen gegen den fortschreitenden Prozess<br />
anzukämpfen. In den letzten 20 Jahren soll der Harmattan, ein Nordostpassat zwischen<br />
0° und 20° nördlicher Breite, die Wüste um ungefähr 100 Kilometer weiter nach Süden<br />
vorgeschoben haben.<br />
Timbuktu, heute eine mitten in der Halbwüste gelegene Stadt, lag vor 100 Jahren noch in<br />
grünen Landschaften und vor 40 Jahren direkt am Niger. Die malische Regierung<br />
versucht nun gemeinsam mit Hilfsorganisationen die Dünen zu stoppen. Es werden<br />
Erosions-Schutzwälle gebaut, widerstandsfähige Bäume gepflanzt und die Dünen mit<br />
Hecken und Gräsern befestigt, um Wind und Sand auszubremsen.<br />
3. Müll<br />
In <strong>Mali</strong> gibt es keine hinreichende Müll- oder Abfallentsorgung. Keinerlei staatliche<br />
Organisation. In Großstätten werden die Abfälle teilweise von privaten Unternehmen aus<br />
den Haushalten abgeholt jedoch danach lediglich außerhalb der Stadt gelagert oder in<br />
nahe gelegene Gewässer entsorgt.<br />
177
4. Ufererosion<br />
Alle Fließgewässer <strong>Mali</strong>s, insbesondere der Niger, sind von Ufererosion und drohender<br />
Versandung betroffen. Dies führt zu einer Abnahme der Wassermenge und somit zu<br />
einer Verringerung des hydrostatischen Niveaus und zur Störung der Fließgeschwindigkeit.<br />
Unzureichende Mengen an Wasser, für Landwirtschaft und zur<br />
Trinkwasserversorgung sind die Folge.<br />
5. Abholzung<br />
Zur Gewinnung von Brennholz werden in <strong>Mali</strong> aktuell 100.000 Hektar Wald pro Jahr<br />
abgeholzt. Dies bedeutet eine durchschnittliche jährliche Entwaldung von 0,71%.<br />
Die Prognosen besagen, dass es eine sofortiges Einstellen der Abholzung sowie<br />
breitflächige Aufforstungsprojekte bedarf, da es sonst bis im Jahr 2011 nicht mehr genug<br />
Brennholz für die gesamte malische Bevölkerung zum Kochen gäbe.<br />
Zudem hat fortlaufende Abholzung weitere Verwüstung zur Folge.<br />
178
Literaturverzeichnis<br />
HAM, A. 2006: West Africa. 6. Aufl.<br />
WODTCKE, A. 1991: West-Afrika: Reisehandbuch; Niger, Burkina Faso, <strong>Mali</strong>, Senegal<br />
Elfenbeinküste, Ghana, Togo Benin. 2. Aufl., Hohenthann.<br />
BRITISH GEOLOGICAL SURVEY 2002: Groundwater Quality: <strong>Mali</strong>. URL:<br />
http://www.wateraid.org/documents/plugin_documents/maligroundwater.pdf,<br />
Stand 14.01.2008.<br />
PAPE, C. 2006: Kampf gegen endlose Sandlandschaften in <strong>Mali</strong>. URL:<br />
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1962583,00.html, Stand 11.01.2008.<br />
SCHUBERT, R. 2005: Konfliktprävention bei der Nutzung internationaler Gewässer am<br />
Fallbeispiel Niger. URL: http://www.fes.de/in_afrika/pl_mali.htm, Stand 09.01.2008.<br />
SEEBORGER, K. U.: Landesübersicht & Naturraum in Kürze: <strong>Mali</strong>. URL:<br />
http://liportal.inwent.org/mali/ueberblick.html, Stand: 11.01.2008.<br />
http://www.les-eaux-du-sahel.ch/<br />
http://mongabay.com/<br />
179
180
TEIL III: REISEPROTOKOLLE<br />
181
Samstag, 07. Februar 2009<br />
Abreise Hamburg<br />
Um 11:00 Uhr Treffen am Flughafen Hamburg, AirFrance-Schalter.<br />
● Es kommt zu Unruhe vor der Abreise, da Mirja Greßmann ihren alten Pass<br />
eingepackt hat. Glücklicherweise regelt sich das Problem und wir können<br />
gemeinsam die Reise nach Bamako antreten.<br />
● Flug Hamburg-Paris: 13:00-14:35 Uhr. Landung bei Schneetreiben in Paris.<br />
Warten auf das „Boarding“ unseres Anschlussfluges nach Bamako.<br />
● Flug Paris-Bamako: geplant 16:40-21:20 Uhr. Aufgrund von vereisten<br />
Tragflächen des Flugzeugs eine Verzögerung der Abreise um etwa vier Stunden.<br />
Unterhaltungsprogramm durch die Stewards. Nach etwa zwei Stunden ein kleiner<br />
Snack in Form von Salzbrezeln. Informationen über die Weiterreise erfolgen sehr<br />
spärlich.<br />
Ankunft Bamako<br />
● Um 01:30 Uhr Ortszeit Ankunft im angenehm warmen, nächtlichen Bamako.<br />
Warten auf unser Gepäck. Am Airport in Bamako treffen wir auf unsere Guides<br />
Oumar und Mohamed sowie unseren Bus. Sie bringen uns ins Hotel „Ségueré“ im<br />
Stadtteil Torokorobougou in Bamako.<br />
182
● Check-in. Aufteilung der Zimmer. Erste Nacht im sommerlichen <strong>Mali</strong> ...<br />
Verfasser: Sally Ollech, Robert Oschatz<br />
183
Sonntag, 08. Februar 2009<br />
Frühstück<br />
● Bis 10:00 Uhr Frühstück auf der Dachterrasse unseres Hotels mit Blick über<br />
Bamako. Im Innenhof des Hotels hören wir die Referate von Susann Arland<br />
„Denkmäler in Bamako“ und Ute Tschirner zu der „Stadt Bamako“.<br />
Stadtrundfahrt<br />
● Um 11:00 Uhr beginnt die Stadtrundfahrt zu den einzelnen Denkmälern.<br />
Währenddessen hielten Susann Arland und Marie Dorstewitz direkt zu den<br />
einzelnen Monumenten Kurz-Referate.<br />
184<br />
Abb.: Le Tour de l’Afrique<br />
Hier konnten wir erstmals mit etwas mehr Zeit den Straßenverkehr in Bamako<br />
beobachten, da sich das Denkmal auf einer Verkehrsinsel inmitten eines<br />
Kreisverkehrs befindet: Motorräder, Busse, Autos, Fahrräder und Eselskarren –<br />
alles bewegt sich in gegenseitiger Rücksichtnahme um „Le Tour de L’Afrique“<br />
herum.
● Besichtigung des Denkmals, von oben hatte man einen guten Blick über<br />
Bamako. Von dort konnten wir auch eine Hochzeitsgesellschaft am Fuße des<br />
Turmes beobachten, die sich mit einem Teil unserer Gruppe fotografieren ließ.<br />
● An den Innenwänden des Turmes befinden sich auf jedem Stockwerk<br />
Wandmalereien:<br />
● Anschließend folgte ein Besuch des Märtyrer-, des Independence- und des<br />
Peace-Monuments, jeweils mit Ausführungen zum Hintergrund der Monumente.<br />
Abb.: Märtyrer-Monument<br />
● Beim Peace-Monument beobachteten wir erneut die verschiedene Nutzung der<br />
Verkehrsflächen. Hier folgte ein kleiner theoretischer Input von Herrn Pez: Zu<br />
beobachten war die Umsetzung des sogenannten „Shared space“-Konzepts, bei<br />
dem verschiedene Verkehrsteilnehmer – Fahrradfahrer, Autofahrer oder auch<br />
Fußgänger – ohne weitere Regulierungsmaßnahmen die gleiche Verkehrsfläche<br />
nutzen. Dies erfordert einen gegenseitige Rücksicht und Aufmerksamkeit aller<br />
Verkehrsteilnehmer.<br />
Abb.: Verkehr am Peace-Monument, Ambulanter Straßenhandel<br />
185
● Außerdem wies Herr Pez auf die lokale Einzelhandelsstruktur hin: Ambulanter<br />
Straßenhandel im Gegensatz zum stationären Straßenhandel. Dieses Phänomen<br />
war schon zuvor im Straßenbild zu erkennen.<br />
Mittags: 14:00 Uhr, Mittagessen im Restaurant „Bintou Bamba“ (Reis)<br />
Nachmittags:<br />
15:00 Uhr, Besuch im Nationalmuseum (Frauenmuseum war leider geschlossen).<br />
● Dabei wurde als erstes der Bereich ‚Textilien aus <strong>Mali</strong>’ besucht. In dieser<br />
Abteilung werden verschiedene Kleidungsstücke präsentiert, wie beispielsweise<br />
der Boubou als ein klassisches malisches Gewand. Des Weiteren werden die<br />
unterschiedlichen Färbetechniken und Stoffe erklärt. Es gibt traditionell<br />
verschiedene Möglichkeiten zu färben, beispielsweise mit Ton oder Blättern.<br />
Ausgestellte Stoffe: Batik- und Indigo-Stoffe, Bogolan- und Damast-Stoffe,<br />
Wollstoffe (laine) sowie Kaasa als ein Schafswollstoff. Neben Kleidungsstoffen ist<br />
auch der Tapis ausgestellt, ein Stoff der in Häusern für dekorative Zwecke<br />
genutzt wird.<br />
● Im zweiten Abschnitt der Museums-Führung wurde uns die Abteilung der<br />
‚Rituellen Objekte’ gezeigt. Jede Ethnie besitzt ihre eigenen rituellen Figuren, die<br />
in Form von Masken und Plastiken dargestellt werden. Häufig sind es dabei Tiere,<br />
die jeweils eine Bedeutung besitzen, z. B. Krokodile dienen dem Schutz oder<br />
Schlangen stellen meist eine Gefahr dar.<br />
● Im dritten Bereich ‚Le <strong>Mali</strong> Millenaire’ befinden sich Exponate, welche die<br />
Geschichte <strong>Mali</strong>s dokumentieren, wie beispielsweise geologische Fundstücke<br />
186
und Darstellungen der Siedlungen der Tellem, einem Pygmäenvolk, das während<br />
des 11. bis 16. Jahrhunderts im Dogonland in Felswänden gesiedelt haben soll.<br />
Abb.: Nationalmuseum Bamako<br />
Abends: Geldwechsel im Hotel zum unsagbar guten Kurs von 1 Euro : 653 CFA.<br />
● Erstes abendliches Erkunden der Umgebung.<br />
Verfasser: Sally Ollech, Robert Oschatz<br />
187
Montag, 09. Februar 2009<br />
Frühstück: 09:00 Uhr „Petit déjeuner“ mit Blick über Bamako!<br />
● Um 10:00 Uhr Gesprächstermin bei der Deutschen Botschaft in Bamako.<br />
Begrüßung durch Botschafter Karl Flittner. Ausführliches Gespräch über <strong>Mali</strong> und<br />
die Tätigkeitsfelder der Deutschen Botschaft in Bamako. Außerdem stand Birgit<br />
Joussen, Referentin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit der Botschaft Bamako,<br />
uns für Fragen zur Verfügung. Sie ist Hauptverantwortliche für die „Coopération<br />
<strong>Mali</strong> Allemagne“.<br />
● Markt: 12:45 Uhr. Unser erster, wenngleich auch kurzer, Marktbesuch beim<br />
„Maison des Artisans“ an der „Grand Mosquée“. Erste Erkundung der Stadt zu<br />
Fuß.<br />
● Essen: 14:00 Uhr, Mittagessen im Restaurant „Bintou Bamba“ (Hirse)<br />
● Um 15:00 Uhr Gesprächstermin beim Deutschen Entwicklungsdienst (DED) in<br />
Bamako. Begrüßung durch die Landesdirektorin Anke Weimann. Im Anschluss<br />
folgten die Präsentationen der einzelnen Koordinatoren: Arnim Fischer zum<br />
Sektor ‚Kommunale Entwicklung’, Emanuela Finke zum Sektor ‚Zivilgesellschaft’<br />
und Anne Marie Ran zum Sektor ‚Landwirtschaftliche Entwicklung’.<br />
188
● Im Anschluss ein Spaziergang durch die Straßen von Torokorobougou zurück<br />
zum Hotel: spielende Kinder, Frauen, die Wäsche waschen, Kühe, Ziegen und<br />
Hühner neben parkenden Autos und teetrinkenden Männern – das alles mitten in<br />
Bamako, der Hauptstadt von <strong>Mali</strong>.<br />
● Abends ein Besuch bei der Färberin Fatoumata Sidibé und ihrer Familie in<br />
Badalabougou.<br />
● Ausklang des zweiten Tages in Bamako auf unserer Dachterrasse mit<br />
nächtlichem Blick über den Niger im Mondschein.<br />
Verfasser: Sally Ollech, Robert Oschatz<br />
189
Dienstag, 10. Februar 2009<br />
Am dritten <strong>Exkursion</strong>stag fuhren wir nach Kati, einem Ort ca. 15 km von Bamako<br />
entfernt, um das Projekt „Petits Barrages Beledougou“ zu besichtigen.<br />
Das sich zurzeit in einer Evaluierungsphase befindende Pilotprojekt wird<br />
unterstützt von DNA (Direction Nationale Agriculture), ded und kfw (Kreditanstalt<br />
für Wiederaufbau). Ein bereits existierendes Konzept in Bandiagara diente als<br />
Vorbild. Nach einer kurzen Einführung durch die Mitarbeiter fuhren wir weiter in<br />
das Dorf Kénékolo um einen Eindruck vor Ort zu gewinnen. 2007 wurden im Dorf<br />
Kénékolo, welches etwa 730 Einwohner zählt, ein Staudamm, ein<br />
Drahtschotterkastendamm und 18 Brunnen gebaut. Der Impuls, das Projekt dort<br />
durchzuführen, kam von der lokalen Bevölkerung selbst und wurde auch mit ihrer<br />
aktiven Mitarbeit durchgeführt. Drei umliegende Dörfer profitieren vom Staudamm<br />
und konnten ihre Ernteerträge wesentlich erhöhen. Durch das Stauen des<br />
Regenwassers während der Regenzeit erhöht sich der Grundwasserspiegel und<br />
das Wasser kann über einen längeren Zeitraum genutzt werden. Somit hat sich<br />
die Anbaufläche verdoppelt und es sind in diesem Jahr erstmals drei Ernten<br />
möglich. Auch die Vielfalt der Agrarprodukte hat sich erhöht, angebaut werden<br />
unter anderem Zwiebeln, Kartoffeln, Paprika, Kohl, Tomaten, Tabak und Reis.<br />
Außerdem wird die lokale Aubergine kultiviert, welche uns auch sogleich zur<br />
Verkostung angeboten wurde, aber auf wenig Begeisterung stieß, da sie bitter<br />
schmeckt. Ein Teil der Ernte dient der Selbstversorgung, der Überschuss wird<br />
selbst auf den umliegenden Märkten oder an Zwischenhändler aus Bamako und<br />
Kayes verkauft.<br />
Als wir im Dorf ankamen, wurden wir von den Bewohnern freudig und mit<br />
persönlichem Handschlag begrüßt. Bei der anschließenden Vorstellungsrunde<br />
wurden uns die Dorfältesten und Komiteemitglieder vorgestellt. Nach einer<br />
Besichtigung des Staudamms und der Anbaufelder in der glühenden Mittagshitze<br />
kehrten so manche mit roten Köpfen zurück.<br />
190
Um das Mittagessen, das aus Reis und Soße bestand, einzunehmen, gruppierten<br />
wir uns um große Schüsseln, aus denen wir mit den Händen aßen. Erst später<br />
erfuhren wir, dass Reis für die Dorfbewohner etwas Besonderes ist und nur zu<br />
festlichen Anlässen verzehrt wird. Danach gab es die Gelegenheit gegenseitig<br />
Fragen zu stellen, was viel Zeit in Anspruch nahm, da alles Gesagte von<br />
Bambara ins Französische und ins Deutsche bzw. andersherum übersetzt<br />
werden musste. Margarethas Frage nach den Dorffesten gab den Anstoß eine<br />
Musik- und Tanzeinlage vorzuführen, wofür extra eine Trommel aus dem 7 km<br />
entfernten Nachbardorf mit dem Fahrrad geholt wurde. Danach waren wir mit<br />
einem Lied an der Reihe und sangen nach langer Diskussion „An der<br />
Nordseeküste“. Anschließend wurden Frau Luttmann und Herr Pez offiziell in die<br />
Diara Familie aufgenommen und es folgte eine ausgiebige Verabschiedung.<br />
Verfasser: Julia Zimmermann, Elena Konrad<br />
191
Mittwoch, 11. Februar 2009<br />
Nach drei Tagen in der pulsierenden Hauptstadt Bamako ging es weiter ins eher<br />
beschauliche und von Lehmbauten geprägte Ségou. Nachdem die Fahrt bereits<br />
von zwei Motorpannen unterbrochen wurde, mussten wir in Ségou auf einen<br />
Ersatzbus ausweichen, da unserer seinen Dienst verweigerte. Nach dem<br />
Mittagessen ging es zum CPEL (Conseil pour la Promotion de l’Économie locale),<br />
eine von privaten Wirtschaftsleuten finanzierte Organisation, die sich im Bereich<br />
Tourismus, Agrarwirtschaft, Ressourcenschutz und Abfallbeseitigung einsetzt. Als<br />
erstes besichtigten wir eine Frauenkooperative, welche u.a. Karitébutter und<br />
Trockenfrüchte herstellt. Das Projekt wurde 1996 von der UN ins Leben gerufen<br />
und läuft seit 2003 eigenständig. 11 Dörfer aus der Umgebung liefern<br />
Kariténüsse, welche von 20 Frauen weiterverarbeitet werden. Die Karitébutter<br />
wird in <strong>Mali</strong> als Körperpflegeprodukt und Ingredienz zur Soßenherstellung<br />
verwendet. Auf demselben Gelände stehen zwei solarbetriebene Trockengeräte,<br />
in denen Früchte, Gemüse und Fleisch getrocknet werden, und zwar bis zu 800<br />
kg pro Tag.<br />
Später, im Centre d’Information, wurden uns dann weitere Projektbereiche<br />
vorgestellt. Ziel von CPEL ist es die Vernetzung der lokalen Wirtschaftsakteure zu<br />
fördern, Jungunternehmern Starthilfe zu geben und den Austausch mit Experten<br />
zu ermöglichen. Außerdem soll aus der Transitstadt Ségou ein attraktiver<br />
Tourismusort gemacht werden. Mit Hilfe eines Festivals, einer Kunstgalerie sowie<br />
neuer Informationsmedien (Internetseite, Prospekt etc. ) sollen die Touristen dazu<br />
animiert werden, ihren Aufenthalt in Ségou zu verlängern.<br />
Verfasser: Julia Zimmermann, Elena Konrad<br />
192
Donnerstag, 12. Februar 2009<br />
Heute besuchten wir die Organisation ALPHALOG in Niono, ein etwa 150 km von<br />
Ségou entfernter Ort. Auf dem Programm standen Projekte zu Sanitäranlagen,<br />
Abfallbeseitigung und Frauenförderung.<br />
Anschließend fuhren wir zu einer Interessengemeinschaft zur Müllentsorgung und<br />
Abwasserreinigung, die 1999 durch die Unterstützung Alphalog ins Leben gerufen<br />
wurde und heute als eigenständiges Unternehmen arbeitet. Nach einer<br />
dreimonatigen Sensibilisierungskampagne, um der Bevölkerung die Bedeutung<br />
der Nutzung sanitärer Anlagen bewusst zu machen, wurden die ersten Latrinen in<br />
den Höfen der Haushalte installiert. Sie werden von 10 – 20 Personen benutzt<br />
und alle 6 Monate von der GIE geleert. Die Fäkalien werden zu Kompost<br />
weiterverarbeitet und teilweise auch verkauft. In einem Viertel von Niono werden<br />
seit neustem auch Öko-Toiletten installiert, die eine Weiterentwicklung der<br />
Latrinentoilette darstellen. Die Stehtoilette setzt sich aus einem Abfluss für Urin<br />
und einen Abfluss für Exkremente zusammen, ein dritter Abfluss dient dem<br />
Auffangen des Handwaschwassers. Durch diese Trennung wird eine spätere<br />
Nutzung zur Bewässerung bzw. als Dünger für die Haushalte möglich.<br />
Im Bereich der Abfallbeseitigung werden von GIE Mülltonnen an die Familie<br />
verteilt und regelmäßig entleert. Das Mülldepot wurde ebenfalls von uns<br />
besichtigt. Es gibt Pläne den Müll in Zukunft zu Autostoppern, Pflastersteinen und<br />
Kunststoffgegenständen zu verarbeiten.<br />
Am Nachmittag trafen wir uns mit den Repräsentantinnen des Cercle de Niono.<br />
193
Das Netzwerk, dem alle Kommunen von Niono angehören, wurde 2007<br />
gegründet und dient der Stärkung der Frauen in der Politik. Der Anteil der Frauen<br />
in offiziellen Institutionen und Gremien soll erhöht werden. Beispielsweise sind in<br />
landwirtschaftlichen Gremien bisher keine Frauen vertreten, dies soll unter<br />
anderem durch Sensibilisierungskampagnen geändert werden. Abschließend<br />
lernten wir einen Abschiedsgruß, den die Frauen am Ende ihrer Treffen<br />
durchführen.<br />
Verfasser: Julia Zimmermann, Elena Konrad<br />
194
Freitag, 13. Februar 2009<br />
Abfahrt Ségou: 8:00 Uhr<br />
unterwegs:<br />
• Die Dornsavanne ist gekennzeichnet durch schüttere Vegetation, kein kniehohes<br />
Gras und Sukkulenten wie Dornensträucher und Baobab-Bäume.<br />
• Termitenhügel: Die Termiten selbst leben tiefer unter der Erdeoberfläche.<br />
In den Termitenhügeln befinden sich Gänge und Löcher, die Zugang zur<br />
Oberfläche haben. Wenn der Wind über die Öffnungen streicht, entsteht<br />
ein Unterdruck, so dass Luft der unterirdischen Höhle entzogen wird. Ohne<br />
dieses Entlüftungssystem wären die Temperaturen für die Termiten und<br />
deren Eier zu hoch, um überleben zu können. (Anmerkung: Das gleiche<br />
Prinzip wird beim Bau von Moscheen angewandt. Bodenlose Tonkrüge, die<br />
in das Dach mit eingemauert werden, sorgen für eine Entlüftung des Gebäudes.)<br />
Mittag in San: 12:30 Uhr (ca. 200 km nördlich von Ségou)<br />
unterwegs: Schichtstufen (vgl. Referat)<br />
Ankunft Sévaré: 16:30 Uhr (ca. 12 km von Mopti entfernt)<br />
Mopti: 18:00 Uhr<br />
• Gemeinsame Runde im Restaurant am Bani<br />
Verfasser: Susann Ahland, Mirja Greßmann<br />
195
Samstag, 14. Februar 2009<br />
Gruppentreffen<br />
• Belastungen durch das Bio-Klima: Gefühl des „verkartert“ seins, verstärkte<br />
Müdigkeit, Reizung der Atemwege<br />
Gründe für die Belastungen sind<br />
• die Hitze, welche zu einer hohen Wärmegrundbelastung des Körpers<br />
führt,<br />
• die Trockenheit: der Körper gibt Feuchtigkeit an die Umgebung ab,<br />
wodurch die Schleimhäute austrocknen können<br />
• die starke Luftverschmutzung, insbesondere durch Staub und Abgase<br />
Folglich kann Bronchialkranken eine Reise nach <strong>Mali</strong> nicht empfohlen werden.<br />
Maßnahmen um den Belastungen entgegen zu wirken sind neben der<br />
Aufnahme von viel Flüssigkeit, die Vermeidung von direkter<br />
Sonneneinstrahlung, die Zufuhr von Mineralien, die Anregung des Kreislaufs<br />
durch Bewegung sowie das Schwenken eines nassen Tuchs. Die einsetzende<br />
Verdunstungsenergie bewirkt, dass sich die zugeführte Luft und das Tuch<br />
abkühlen. Mit dem nassen Tuch können Gesicht, Nacken und Extremitäten<br />
befeuchtet werden.<br />
• Erläuterung zur Entstehung der Schichtstufenlandschaft (Vgl. Ausarbeitung)<br />
• Referat über Mopti (Vgl. Ausarbeitung)<br />
• Referat über Lehmbauten (Vgl. Ausarbeitung)<br />
Besuch des Perlenmuseums<br />
• Farafina Tigne, Besitzer des Perlenmuseums, erzählte die Geschichte und<br />
Bedeutung der verschiedenen Perlen. Perlen aus Venezien wurden beispielsweise<br />
als Tauschmittel verwendet (1 Perle = 3 Sklaven). <strong>Große</strong>r<br />
Perlenschmuck ist auch heute noch ein Zeichen für Reichtum und jede<br />
Ethnie bevorzugt einen bestimmten Perlentyp. Neben der privaten Perlenausstellung<br />
bot das Museum auch einen Einblick in die malische Kultur.<br />
Gezeigt wurden u. a. ein ein Kilogramm schweres Silberarmband einer Touareg-Frau,<br />
welches den Reichtum und die Stärke dieser Frauen symbolisiert<br />
sowie ein fünfschneidiges Schwert und ein Türschloss. Das Türschloss<br />
besitzt drei Phasen der Öffnung: das kleine Schloss symbolisiert<br />
das Kind, das Mittlere die Mutter und das große Schloss steht symbolisch<br />
für den Vater. Zum Öffnen der Tür muss grundsätzlich mit allen Dreien verhandelt<br />
werden, allerdings wird auch davon ausgegangen, dass wenn das<br />
Kind überzeugt wurde, alle überzeugt wurden. Gegen Ende der Führung<br />
wurde noch auf die Bedeutung der Frau eingegangen: ohne Frauen geht<br />
gar nichts, mit Frauen ist man(n) allerdings verloren. Dennoch sei die Frau<br />
nach Gott das Wichtigste im Leben eines Mannes.<br />
• Möglichkeit zum Kauf von Perlenschmuck und Souvenirs<br />
Mittagessen: 13:00 Uhr<br />
Einladung zu Musik und Tanz vor dem Perlenmuseum: 15:00 Uhr<br />
Mopti: 17:00 Uhr<br />
• Pirogenfahrt auf dem Bani<br />
196
• Besuch eines Bozo-Fischerdorfs: Gezeigt wurde u. a. wie die Bozo-Fischer<br />
ihren Fisch konservieren, wobei zwischen zwei Methoden unterschieden<br />
werden kann:<br />
• Räuchern: Das Verbrennen des Fisches, das zwar schnell geht, der<br />
so konservierte Fisch ist allerdings nur ein paar Tage haltbar<br />
• Trocknen: Der Fisch wird ca. einen Monat in der Sonne getrocknet.<br />
Dieses Verfahren dauert zwar länger als das Räuchern, dafür ist<br />
dieser konservierte Fisch aber auch länger haltbar.<br />
• Gemeinsame Runde im Restaurant am Bani<br />
Sévaré: abends<br />
• Agence de Bassin du Fleuve Niger<br />
Die Agentur ist eine öffentliche Verwaltung zum Schutz des Flusses Niger. Sie<br />
wurde 2002 gegründet und ist eine Unterabteilung des Umweltministeriums mit<br />
Hauptsitz in Bamako.<br />
Die Hauptaufgabe der ABFN ist die Wahrung des Niger als Lebensader des<br />
Landes.<br />
Je nach Region (Sahara, Sahel, Sudanzone) werden zum Schutz des Nigers<br />
unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt. Im Norden des Landes<br />
beispielsweise ist der Niger von der Sandabtragung durch den Wind bedroht. Die<br />
Deflation begünstigt eine Versandung des Flusses. Mit der Hilfe von<br />
Aufforstungsprojekten wird der Deflation entgegengewirkt.<br />
In Bamako stellt die Einleitung der Industrieabfälle für den Niger ein großes<br />
Problem dar. Zur Zeit der Einführung von Industrieanlagen gab es noch keine<br />
Organe für den Umweltschutz. Heute wird, bevor eine Industrie eingerichtet wird,<br />
überprüft, ob die Umweltschutzvorgaben eingehalten werden. Gesetzestexte sind<br />
zwar vorhanden, allerdings fehlt es an Personal und den finanziellen Mitteln, um<br />
die Einhaltung zu überprüfen.<br />
Um die Umwelt und den Niger zu schützen setzt die Agentur außerdem auf<br />
Aufklärung, Sensibilisierung, Kommunikation und Ausbildung. Jedoch ist die<br />
Ansprache der Bevölkerung schwierig, da 80 % der Bevölkerung nicht zur Schule<br />
gegangen sind.<br />
Weitere Umweltprobleme ergeben sich aus<br />
• der Übernutzung der Weideflächen: nach Aussagen der ABNF beuten<br />
80 % der Bevölkerung die Natur aus, sodass jedes Jahr 1000 ha verloren<br />
gehen.<br />
• dem Umgang mit Plastiktüten<br />
• dem steigenden Holzbedarf z. B. zum Kochen, wobei es an finanziellen<br />
Mitteln fehlt, um Alternativen nutzen zu können.<br />
der starken Sedimentation: Vor 20 Jahren war der Niger noch 0,5 m tiefer.<br />
Gegenmaßnahmen sind der Uferschutz und das kostspielige Ausbaggern<br />
des Nigers<br />
197
Damit der Niger als Lebensader des Landes gewahrt wird, können die<br />
Schutzmaßnahmen nicht ausschließlich auf den Niger angewendet werden,<br />
sondern müssen auch dessen Zuflüsse mit einbeziehen.<br />
Verfasser: Susann Ahland, Mirja Greßmann<br />
198
Sonntag, 15. Februar 2009<br />
Abfahrt Sévaré: 9:00 Uhr<br />
Ankunft Djenné: 12:00 Uhr<br />
Referate: Djenné; sakrale Architektur (Teil 2)<br />
Mission Culturelle: 16:00 Uhr Stadtführung durch Djenné<br />
• Die Geschichte der Stadt Djenné beginnt mit dem Grab der Jungfrau „Tapama“.<br />
Der Name bedeutet „unsere große Schwester“. Die Stadtmauer<br />
brach bei Bauarbeiten immer wieder zusammen. Ein Menschenopfer war<br />
notwendig, um die Zukunft der Stadt zu retten. Tapama, die einzige Tochter<br />
eines Bozo-Ehepaares, opferte sich freiwillig. Danach wurde ihr Name<br />
nie wieder ausgesprochen. Der Ort des Grabes hat weiterhin rituelle Bedeutungen,<br />
so sollen z. B. Wünsche, die hier ausgesprochen werden auch<br />
in Erfüllung gehen. Neben dem Grab befand sich das ursprüngliche Eingangstor<br />
der Stadtmauer.<br />
• Zur Abwasserproblematik:<br />
Bis 2006 wurde Abwasser über offene Aquädukte aus den Häusern<br />
geleitet. Heute erfolgt die Abwasserentsorgung einiger Haushalte über<br />
Rohre, die mit Filtern (in Form von Sand in Zwischenauffangstationen)<br />
ausgestattet sind. Das Rohrsystem wird von der KfW-Bank finanziert. Da<br />
die Filter jedoch nicht regelmäßig gesäubert werden, tritt das Abwasser<br />
stellenweise aus.<br />
• Zu Besonderheiten der Bauweise:<br />
Das Wohnhaus, das wir besichtigten, ist ca. 100 Jahre alt. Umbauten<br />
wurden in den 1960er Jahren unternommen.<br />
Der Vorbau des Eingangsbereiches sollte die Bewohner des Hauses vor<br />
Eindringlingen schützen. Die Dunkelheit in diesem Bereich wurde durch<br />
teilweise zwei oder drei fensterlose Vestibüle hintereinander verstärkt und<br />
erschwerte die Orientierung. Durch ein kleines rundes Fenster im ersten<br />
Obergeschoss (in der Straßenfront) und zusätzlich ein kleines Loch im<br />
Fußboden kann der Hausherr kontrollieren, wer durch den Eingang kommt.<br />
Der Aufenthaltsort der Frauen ist der Innenhof. Aus klimatischen Gründen<br />
ist er gewöhnlich recht klein.<br />
Die Anzahl der Zinnen in der Lehmzinnenkrone hat heute keine einheitliche<br />
Bedeutung mehr. Sie sind eher Schmuckelemente. Zwei Säulen in der<br />
Fassade des Hauses kann bedeuten, dass der Mann zwei Frauen hat. (Es<br />
gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten.)<br />
Seit der Ernennung zum Weltkulturerbe im Jahr 1988 ist es verboten mit<br />
Beton zu bauen. Basis der Lehmbauweise ist die ständige Erneuerung,<br />
hauptsächlich der Fassaden. Jedes Jahr im April bzw. Mai, bevor die<br />
Regenzeit beginnt, wird die Fassade der Moschee restauriert, um sie<br />
besser vor dem Regen zu schützen. Frisch verputzte Fassaden (mit einer<br />
Mischung aus Lehm, zermahlenen Baobab-Blättern, Foniohäcksel und<br />
Karité-Butter) wirken wie Zement. Die typisch marokkanischen<br />
Fensterläden sind so konzipiert, dass man von drinnen hinaus, aber nicht<br />
von außen hinein sehen kann.<br />
• 1819 wurde die erste große Moschee zerstört, woraufhin mehrere kleine<br />
Moscheen gebaut wurden. Der große Friedhof, der noch aus der Kolonialzeit<br />
stammt, liegt außerhalb der Stadt und wird heute nicht mehr genutzt.<br />
199
• Zur Baustelle des zukünftigen Museums:<br />
Das Museum soll im Mai fertig gestellt sein und wird u. a.<br />
Archäologieausstellungen zeigen. Der Bau wird von der EU unterstützt. Die<br />
Mission Culturelle kontrolliert die Baufortschritte.<br />
• In Djennés Südosten befinden sich Schmieden, im Süden leben Bozo, im<br />
Norden und Nordosten Händler und im Westen der Stadt Bambara und<br />
Bobo.<br />
• Seit der Ernennung zum Weltkulturerbe gewann der Tourismus in Djenné<br />
an Bedeutung. Mit der Aufnahme in Reiseführer usw. wurden bspw. Anfahrtswege<br />
ausgebaut. Vorher brauchte man zwei Tage, um in die Stadt zu<br />
kommen.<br />
• Die Bibliothek befindet sich im Aufbau. Von der teils schon vorhandenen<br />
Sammlung ist noch nichts ausleihbar.<br />
zur Mission Culturelle:<br />
Die Mission Culturelle ist eine staatliche Organisation und Teil des<br />
Kultusministeriums. Die ca. 10 Beschäftigten werden vom Staat bezahlt.<br />
Sie wurde nach der Ernennung zum Weltkulturerbe gegründet, um die u. a.<br />
Erfüllung der Auflagen zu kontrollieren und ist in <strong>Mali</strong> neben Djenné in<br />
Timbuktu und Bandiagara vertreten. Alle sechs Monate muss ein Bericht an<br />
die UNESCO geschickte werden. Zusätzlich überprüft alle drei Jahre eine<br />
Delegation von Spezialisten die Situation. Die zwei Hauptaufgaben der<br />
Mission Culturelle sind a) Recherche, Forschung und Dokumentation und<br />
b) Sensibilisierung. Ausländische Projekte können an sie heran treten und<br />
finanzielle Unterstützung bekommen. Die Projekte in Djenné werden mit<br />
der Mission Culturelle als Partner zusammen durchgeführt.<br />
Verfasser: Susann Ahland, Mirja Greßmann<br />
200
Montag, 16. Februar 2009<br />
8.00h Besuch der Ausgrabungsstätte Djenné djeno<br />
- Die Ausgrabungsstätte (33ha, höher gelegen als das heutige Djenné) wird<br />
von der Mission Culturelle von Djenné betrieben, die und bereits am Tag<br />
zuvor durch die Stadt geführt hatten.<br />
- Es handelt sich um das historische Djenné, 7km vom heutigen<br />
Stadtzentrum entfernt.<br />
- 1975 wurde die Stätte durch die Grabungen des Ehepaars McIntosh<br />
international bekannt, unterstützt wurden diese von American Express und<br />
National Geographic, die auch einen Preis an dieses Projekt für den am<br />
besten konservierten Ort Afrikas verliehen – unter anderem ist er mit<br />
Bäumen umpflanzt worden zum Schutz vor Erosion.<br />
- Zu den historischen Einwohnern sagt die traditionelle Überlieferung es<br />
habe sich um Bozo gehandelt, aber die Untersuchung der Gebisszähne,<br />
kam nicht zu dem Schluss, dass sie viel Fisch aßen. Sie kamen aus Dja,<br />
was auch kleines Dja – djani genannt wurde und daher der heutige Name<br />
djenné.<br />
- Djenné gilt als die älteste Stadt Westafrikas und war bis 1970 von Wasser<br />
umgeben.<br />
- Der Zeittafel konnten wir Folgendes entnehmen:<br />
© Mathias Becker<br />
- Die Piktograme in den einzelnen Ebenen zeigen an, welche kulturellen<br />
Errungenschaften nachweisbar sind<br />
- Bei den Krügen mit Deckel handelt es sich nicht um Vorratsgefäße,<br />
sondern in diesen wurden die Toten begraben. Dazu wurde der Körper vor<br />
201
202<br />
der Leichenstarre in die Embryonalstellung gebracht, ein Loch im Boden<br />
ließ die Körperflüssigkeiten austreten.<br />
- Ausgrabungsstätten sind mit dem Problem der Grabräuber konfrontiert, in<br />
diesem Fall kommen auch Viehhirten, um das ungenutzte Land zu nutzen<br />
– das Gebiet ist von einem Grüngürtel umgeben, um es vor weiterer<br />
Erosion zu schützen. Leider gibt es derzeit kein Projekt, dass vor Ort<br />
arbeitet und die Erde wird stetig durch den Wind abgetragen – vieles liegt<br />
frei und wird nicht geborgen, da es im Boden noch am Besten konserviert<br />
werden kann. Außerdem gäbe es keinen, der die Objekte archivieren<br />
könnte und in <strong>Mali</strong> selbst fehlen z. B. Labore für die Altersbestimmung.<br />
© Prof. Dr. Peter Pez<br />
- Wir hatten ein mulmiges Gefühl von einem studierten Archäologen geführt<br />
über die Häuser, Krüge und – wenn er uns nicht darauf hingewiesen hätte<br />
– Schädel zu laufen...
© Prof. Dr. Peter Pez<br />
- Es gibt einen Wächter. Allerdings ist der montags auf dem Markt in Djenné.<br />
Musée du site<br />
- Ausgangspunkt unsere Besichtigung war das Museum der Mission<br />
Culturelle gewesen, in dem Tafeln und Exponate die Siedlungsgeschichte<br />
im Gebiet des heutigen Djenné beleuchteten und dabei auch<br />
Überlieferungen der oralen Tradition berücksichtigten<br />
- Mamadou nutzte die Gelegenheit uns mit einigen Besonderheiten der<br />
Bambara-Kultur, aber auch der Bozo vertraut zu machen (schließlich war<br />
Djenné früher eine Insel) und versuchte uns auch das „Kastensystem“ und<br />
die Rolle der Frau im Islam näher zu bringen – letztlich eine gute<br />
Wiederholung dessen, was wir schon in den Seminarsitzungen diskutiert<br />
hatten<br />
Markttag in Djenné<br />
© Prof. Dr. Peter Pez<br />
203
11.00h – 12.30h Marktbummel<br />
© Mathias Becker<br />
© Mathias Becker<br />
13.00h Gemeinsames Mittagessen im Hotel<br />
14.00h Referat zu Timbuktu<br />
Fahrt Djenné – Mopti-Sevaré<br />
204
© Mathias Becker<br />
Am späten Nachmittag fuhren wir zurück nach Mopti-Sevaré bevor die Händler<br />
mit ihren Pferdekarren die Ausfahrten blockieren würden. Dort verbrachten die<br />
Timbuktu-Reisenden eine Nacht bevor sie Ihre Wüstentour starteten. Die<br />
Bandiagara-Reisenden fuhren dagegen nach einem herzlichen Abschied noch<br />
eine kurze Stunde bis zur Unterkunft „Toguna“, in der Hauptstadt des<br />
Dogonlandes.<br />
Verfasser: Margaretha Kühneweg, Mathias Becker<br />
205
206
Bandiagara<br />
17. – 20. Februar 2009<br />
207
Dienstag, 17. Februar 2009<br />
Mission Culturelle Bandiagara (Vormittags)<br />
Birgit Fecher vom ded heißt uns Willkommen, stellt uns die Mission Culturelle<br />
(MC) und die Mitarbeiter vor und gibt einen Überblick über die Zusammenarbeit<br />
von der MC und dem ded.<br />
Mission Culturelle<br />
• 1989 Dogonland wird zum Weltkulturerbe erklärt, daher Bedarf nach<br />
dezentralen Strukturen zum Schutz und der Inwertsetzung<br />
• 1993 Gründung der Mission Culturelle als Zweigstelle des Kultusministeriums<br />
• Entwicklung eines Planes zur Konservierung des Weltkulturerbes auf der<br />
einen Seite und der Entwicklung eines angepassten Tourismus auf der anderen<br />
Seite<br />
• Entsprechende Aktivitäten zusammen mit Unesco, Auswärtigem Amt und<br />
Universtäten in Cratère und Leiden:<br />
208<br />
o Inventarisierung der Architektur, Bauformen und Bautechniken der<br />
Dörfer an der Falaise<br />
o Generationenübergreifende Instandsetzung der Gemeinschaftshäuser<br />
zum Transfer der alten Bauweisen. Dabei Harmonisierung von<br />
alten und neuen Bauformen, zum Beispiel traditionelle Bauweise mit<br />
neuen Bauformen (Stahlträger) um Ressourcen zu schützen, und<br />
Bevölkerung zur selbständigen Instandhaltung zu befähigen<br />
o Recherche der eigenen Geschichte<br />
o Sensibilisierung für das Kulturerbe und die eigene Geschichte und<br />
gegen einen Ausverkauf der Kultur bedingt durch Armut und Konflikte<br />
mit dem Islam und dem Christentum (durch Theaterstücke). In<br />
diesem Zusammenhang Bau von kommunalen Museen in Nombori,<br />
Endeé (Handwerkermuseumm zum Erhalt von Handwerkstechniken)<br />
und Soroly<br />
o Organisation eines Museumsfestivals der drei Museen um die regionale<br />
Zusammenarbeit zu fördern<br />
o Beratung der Kommunen und Anregung zur Zusammenarbeit von<br />
Kommunen und privatem Sektor (ähnlich wie bei CPEL in Ségou)<br />
o Organisation des internationalen Tages der Biodiversität zum Austausch<br />
über das Wissen über Weltnaturerbe und einheimische<br />
Pflanzen<br />
o Daraufhin Auflegen eines Guide d`Ecotourisme, um den Tourismus<br />
zeitlich zu entzerren<br />
o Beschilderung als Information für Touristen<br />
o Einrichtung einer Website<br />
o Führung von Besuchergruppen<br />
Allgemeines Problem ist die kurzfristige Unterstützung von Projekten für 2-3<br />
Jahre, so dass Dezentralisierung und Infrastrukturen nicht nachhaltig etabliert<br />
werden können, da eine richtige Verwaltung fehlt. Schwierig ist auch die
Abstimmung von den Bedürfnissen der Bevölkerung und denen der Touristen.<br />
Zusammenarbeit mit ded<br />
• 1999 Beginn der Zusammenarbeit für Projekt „Ecotourisme en pays Dogon“,<br />
mit dem Ziel einen angepassten Tourismus zum Profit der Bevölkerung<br />
und gleichzeitig zum Schutz des kulturellen Erbes zu entwickeln<br />
Mittagessen in der Stadt<br />
Centre médicine traditionnelle Bandiagara (Nachmittags)<br />
• Gegründet 1986 durch den Italiener Pierro Copo, der die traditionelle Medizin<br />
erforschen und stärken wollte und begann ein umfangreiches Magazin<br />
mit Pflanzenproben anzulegen<br />
• Heute Sammelstelle für Wissen über traditionelle Heilpflanzen,<br />
Forschungszentrum und Produktionsort (staatlich gestütztes Privatunternehmen)<br />
• Forschung nach genauer Dosierung der Heilmittel und Kultivierung und<br />
Zuchtforschung seltener Pflanzen unterstützt durch die Heilerassoziation<br />
auf dem Gelände<br />
• Herstellung von Hustensaft und verschiedenen Pulvern aus Pflanzen gegen<br />
Verstopfung, Durchfall, Rheuma, Hepatitis B, Bluthochdruck, Hämmoriden,<br />
Diabetes, Malaria (Zutaten werden von Frauen gesammelt, die dafür<br />
bezahlt werden)<br />
• Vertrieb über Zusammenschluss von Apothekern in mehreren Regionen,<br />
auch in Krankenhäusern beliebt, da als Generika anerkannt und billiger als<br />
Schulmedizin<br />
• Kompetenzen des Centres regional bekannt, deshalb wird besonders<br />
Ambulanz zur Geburtshilfe viel genutzt und qualifizierte Heiler werden bei<br />
Anfragen vermittelt www.inrspmali.org<br />
Danach Besuch beim Schneider Almoctar Diarra, der ein Ausbildungs- und<br />
Alphabetisierungsprogramm für benachteiligte Mädchen ins Leben gerufen hat.<br />
• Er bringt ihnen neben Schneidern auch lesen und schreiben bei, was in der<br />
staatlichen Ausbildung eigentlich nicht enthalten ist<br />
• Um ihnen einen Berufseinstieg zu erleichtern teilen sich drei Schülerinnen<br />
sein altes Atelier ohne Miete zu zahlen<br />
• Eine seiner Schulerinnen arbeitet mittlerweile erfolgreich in Bamako<br />
Abends Einladung zu Mariam Cissé, einer Freundin von Anke und Frau<br />
Luttmann, die für uns kocht und uns ihre selbst gemachten Perlenketten zeigt<br />
Verfasser: Friederike Brumhard<br />
209
Mittwoch, 18. Februar 2009<br />
École Mamadou Tolo Bandiagara (Vormittags)<br />
Gespräch mit M. Touré, dem Schuldirektor über seine eigene Schule und das<br />
Schulsystem in <strong>Mali</strong>. Er nimmt sich sehr viel Zeit für uns, da auch an diesem Tag<br />
gestreikt wird.<br />
210<br />
• Allgemeines Schulalter in <strong>Mali</strong> 7 bis 14 Jahre<br />
• Nach der Grundschule (bis zur 6. Klasse) folgt Abschlusstest als Zulassung<br />
für weiterführende Schule<br />
• Nach der weiterführenden Schule folgt ein Beratungsgespräch und<br />
Entscheidung für Gymnasium oder Ausbildung<br />
• Die Ausbildung der Lehrer erfolgt an der Universität (Institut formation du<br />
metre) dauert 4 Jahre, dabei gibt es Ausbildung in den Fächern, aber auch<br />
in Psychologie und Pädagogik<br />
• Nach dem Studium wird man einer Stadt zugewiesen<br />
• Lehrer werden vom Staat bezahlt und erhalten Rente und<br />
Krankenversicherung, es gibt aber häufig Streiks wegen der schlechten<br />
Bedingungen, so wird zum Beispiel Wohngeld<br />
• Den Beruf Lehrer ergreifen sowohl Männer als auch Frauen<br />
• Die École Mamadou Tolo ist eine der zwei weiterführenden Schulen (Collège)<br />
in Bandiagara mit 7., 8. und 9. Klasse<br />
• Sie gehört zu einem Schulzentrum mit 7 Schulen (5 Grundschulen und 2<br />
Weiterführende)<br />
• Es gibt 369 Schüler (159 Mädchen und 210 Jungs)<br />
• Über 110 Schüler pro Klasse<br />
• 7 Lehrer<br />
• Angebotene Fächer: Französisch, Englisch, Geographie, Mathematik, Physik,<br />
Chemie, Biologie, Geschichte, Hauswirtschaftslehre, Ethik, Musik,<br />
Sport<br />
• Unterrichtszeiten: 6 Stunden täglich, außer Donnerstags (4 Stunden)<br />
• Es wird kein Schulgeld erhoben, aber einmal pro Jahr 650 FCFA für Kreide<br />
und Kopien<br />
• In Bandiagara gehen 50 % der Kinder in die Schule, weil keine Schulpflicht<br />
besteht und sie für die meisten Familien immer noch zu teuer ist bzw. der<br />
Arbeitsausfall der Kinder zu groß. Muslime haben außerdem Vorbehalte<br />
davor, Mädchen in die Schule zu schicken<br />
• Die Schüler kommen aus Bandiagara, aber auch aus entfernten umliegenden<br />
Dörfern mit dem Fahrrad oder Motorrad, trotzdem ist Schwänzen sehr<br />
selten<br />
• 65% der Abgänger vom Collège gehen aufs Gymnasium, davon nur 20%<br />
Mädchen<br />
• Es bestehen Brieffreundschaften zu Schulen im Ausland, zum Beispiel in<br />
Frankreich<br />
• Jeden Morgen versammeln sich alle Schüler beim Fahnenapell und singen<br />
die Nationalhymne
• Es gibt keine Schuluniform, an anderen Schulen ist dies aber durchaus üblich<br />
Nach dem Gespräch interviewen wir noch einige Kinder, die trotz des Streiks zur<br />
Schule gekommen sind. Die meisten wollen Arzt, Lehrer oder Juristen werden<br />
und sind traurig, dass die Schule ausfällt.<br />
GAAS <strong>Mali</strong> Bandiagara (Nachmittags)<br />
Besuch der malischen NGO, wo uns die Mitarbeiter die umfassende Arbeit der<br />
NGO vorstellen.<br />
GAAS <strong>Mali</strong><br />
• GAAS <strong>Mali</strong> setzt sich seit vielen Jahren für die Bekämpfung von Aids,<br />
weiblicher Genitalverstümmelung und Kinderhandel ein und fördert Demokratisierung,<br />
Nahrungsmittelsicherheit (Wasserhygiene, Abfallentsorgung)<br />
und Alphabetisierung<br />
• Die NGO hat ihren Hauptsitz in Bandiagara, aber sie ist auch in Ségou und<br />
Bamako vertreten<br />
• Die Hauptstelle beschäftigt 60 Mitarbeiter und vor allem auch Mitarbeiterinnen,<br />
die in 20 Gemeinden und 260 Dörfern arbeiten<br />
Thema Beschneidung<br />
• In <strong>Mali</strong> sind 98% der Frauen beschnitten<br />
• Es gibt kein Gesetz gegen die Beschneidung, laut GAAS <strong>Mali</strong> ist die Überzeugung<br />
der Menschen ohnehin wichtiger<br />
• Die Gründe für die Beschneidung sind vielfältig:<br />
o Die Menschen glauben, dass sie Klitoris einem Penis entspricht und<br />
sie deshalb einer Frau entfernt werden muss<br />
o Es wird außerdem argumentiert, dass eine unbeschnittene Frau frivol<br />
ist und einen schlechten Charakter hat<br />
o Teilweise wird die Beschneidung auch auf den Koran zurückgeführt,<br />
eine Konferenz wichtiger Imame vor zwei Jahren konnte sich aber<br />
nicht einigen, ob der Koran die Beschneidung vorschreibt oder nicht,<br />
dazu gibt es durch verschiedene Auslegung sehr unterschiedliche<br />
Standpunkte<br />
o Früher war die Beschneidung ein Initiationsritus im frühen Erwachsenenalter,<br />
heute wird sie allerdings im frühen Kindesalter durchgeführt<br />
• Nicht alle Ethnien führen die Beschneidung durch, daher ist eine Heirat für<br />
unbeschnittene Frauen durchaus möglich, sogar mit Partnern, in deren<br />
Dorf Beschneidung eigentlich üblich ist (dies wird meist erst bei Vielehe<br />
zum Problem)<br />
• Die Beschneidungskampagne von GAAS <strong>Mali</strong> wird von PLAN <strong>Mali</strong> finanziert<br />
211
212<br />
• Sie ist Teil hervorgegangen aus dem Projekt „Reproduktionsgesundheit“,<br />
das über Beschneidung, Aids, Verhütung und Familienplanung aufklären<br />
soll<br />
• Dabei ist das Vorgehen die Gefahren aufzuzeigen und nicht einfach ein<br />
Verbot zu fordern<br />
• Im Mittelpunkt steht die Einbeziehung der Menschen, die mittlerweile selber<br />
zu Botschaftern werden<br />
• GAAS <strong>Mali</strong> Mitarbeiter treten in Kontakt mit wichtigen Personen im Dorf<br />
(Imam, Dorfchef, Frauenchefin, Pastor) und fragen sie, wie eine Sensibilisierung<br />
erfolgen könnte<br />
• Dann folgt Sensibilisierung aller Gruppen einzeln in Gesprächen (Mädchen,<br />
Jungen, Männer, Frauen)<br />
o Kinder werden sensibilisiert für ihr Recht auf Gesundheit<br />
o Frauen werden durch Videopräsentation sensibilisiert für den<br />
Zusammenhang zwischen der Beschneidung und späteren Komplikationen<br />
• Teilweise auch „Tag des Nachdenkens“ mit Workshops für Lehrer, Dorfvertreter<br />
und Kommunalbeamter, in dem sie Sensibilisierung reflektieren<br />
• Besonders gefördert wird die Aufklärung an den Schulen, da Sexualität eigentlich<br />
ein Tabuthema ist, aber Lehrer sie thematisieren dürfen (Durch die<br />
Plädoyerarbeit der NGOs stehen sexuelle Aufklärung und Aids Aufklärung<br />
jetzt fest im Lehrplan)<br />
• GAAS <strong>Mali</strong> wählt unter den Schülern Botschafter aus, die dann die Aufklärungsarbeit<br />
bei den Gleichaltrigen leisten sollen<br />
• Wenn ein Dorf entschlossen hat, die Beschneidung abzuschaffen, gibt es<br />
als Offizielle Bestätigung eine große Zeremonie mit dem Bürgermeister und<br />
Politikern<br />
• Die Dörfer sollen sich dann gegenseitig „anstecken“, indem sie Aktionspläne<br />
erstellen, wie sie andere vom Beenden der Beschneidung überzeugen<br />
können und dann selbst Sensibilisierungsarbeit leisten<br />
• Eine von PLAN <strong>Mali</strong> finanzierte Studie nach 5 Jahren belegte einen großen<br />
Erfolg dieser Art von einbeziehender Aufklärungsarbeit, sodass das Projekt<br />
verlängert wird<br />
• GAAS <strong>Mali</strong> vermittelt nun seine Strategie an anderer NGOs<br />
Thema Aids<br />
• In <strong>Mali</strong> sind „nur“ 1,3% der Bevölkerung HIV positiv<br />
• Laut GAAS <strong>Mali</strong> ist dies auch ein Verdienst der NGOs und ihrer<br />
Aufklärungsarbeit<br />
• Besonders stark gefährdet sind Gruppen wie<br />
o Prostituierte<br />
o LKW Fahrer<br />
o Reisende Frauen und Händlerinnen, die sich durch Sex die Weiterreise<br />
verdienen<br />
o Soldaten, die in stärker HIV betroffenen Ländern Frauen vergewaltigen
• Kondome sind nicht wirklich verbreitet und akzeptiert und die meisten Menschen<br />
lassen sich nicht testen<br />
• Die Regierung betreibt eher passive Aufklärungsarbeit durch Schilder<br />
• GAAS <strong>Mali</strong> leistet aktive Aufklärungsarbeit durch Rollenspiele, Videos,<br />
Theater, die die Menschen zur Diskussion über Risiken und Verhütungsmethoden<br />
anregen soll<br />
• GAAS <strong>Mali</strong> unterstützt aber auch Infizierte indem es ihnen Kleidung,<br />
Medikamente und Schulgeld für die Kinder bezahlt, oder nach der Diagnose<br />
die Angehörigen aufklärt<br />
• HIV Infizierte sind mittlerweile nicht mehr so stark tabuisiert wie früher, und<br />
werden in Aufklärungsarbeit einbezogen<br />
Danach Bummel durch die Stadt und spontanes Gruppenfoto bei einem<br />
einheimischen Fotografen und der Rest des Tages FREI!<br />
Verfasser: Friederike Brumhard<br />
213
Donnerstag, 19. Februar 2009<br />
214<br />
Nombori<br />
• Gegen 9.30 Uhr Abfahrt Richtung Nombori (Dogondorf an der Falaise)<br />
• Die Fahrt geht zunächst an einem Fluss entlang, an den die typischen<br />
Zwiebelfelder der Dogon angrenzen. Der Boden ist ursprünglich völlig unfruchtbar,<br />
da felsig, deshalb wurde eine dünne Schicht Erde aufgetragen,<br />
die zum Zwiebelanbau genügt. Ein anderer Grund für die Konzentration auf<br />
den Zwiebelanbau ist die große Nachfrage und der gute Preis. Die Gärten<br />
sind durch niedrige Steinmauern voneinander getrennt. Nach der Ernte<br />
wird das Grün der Zwiebeln zu Bällchen gerollt, getrocknet und ebenfalls<br />
verkauft.<br />
• Je näher wir der Schichtstufe kommen, desto karger wird die Landschaft,<br />
sie ist dominiert von dem relativ ebenen Felsplateau.<br />
• Am Rand der Schichtstufe halten wir an und lassen den Bus zurück. Unser<br />
Gepäck wird mit einem Eselswagen transportiert, wir klettern den Steilhang<br />
(250m bis 400m hoch) hinunter. Der Blick hinunter ins Tal ist fantastisch.<br />
Nombori liegt direkt am Fuß des Steilhangs, davor wieder die typischen<br />
Zwiebelfelder, an die eine Dünenlandschaft mit spärlicher Vegetation angrenzt.<br />
• In Nombori angekommen klettern wir zu unserem Campement „Baobab“<br />
hinauf. Das Ganze Dorf besteht aus Lehmhäusern, die sich relativ weit den<br />
Abhang hinaufziehen und zwischen großen Felsbrocken oft erst auf den<br />
zweiten Blick zu erkennen sind. Dazwischen befinden sich die typischen<br />
Getreidespeicher mit spitzen Strohdächern. Männer und Frauen haben<br />
darin getrennte Aufbewahrungsräume.<br />
• Nach einer Mittagspause begrüßen wir zuerst den Dorfältesten, der die<br />
„Geschäfte“ an seinen Sohn abgegeben hat und nur noch eine Repräsentationsfunktion<br />
inne hat. Nach eigenen Angaben ist er 107 Jahre alt, und<br />
das Geheimnis für sein hohes Alter ist, dass er in seinem Leben sowohl<br />
Gutes, als auch Schlechtes gesehen hat.<br />
• Anschließend teilen wir uns in zwei Gruppen auf, und erkunden mit zwei<br />
(jugendlichen) Führern das Dorf. Nombori hat vier Viertel, die jeweils nach<br />
den Sippen Gindo, Togo, Cassagé und Arou getrennt sind. Die Einwohnerzahl<br />
die sie uns nennen, schwankt zwischen 1000 und 15.000 Menschen.<br />
• Abdul führt uns zunächst zur protestantischen Kirche, die in Nombori neben<br />
dem Islam relativ stark vertreten ist. In dem Lehmbau mit Vorraum und<br />
Innenraum findet jeden Sonntag ein Gottesdienst statt, zu dem nach seinen<br />
Angaben 3000 Menschen kommen (das ist jedoch aufgrund der Größe<br />
eine völlig utopische Angabe). Außerdem gibt es täglich Andachten und<br />
Gesangsübungsstunden. Interessant sind auch die Gesangsbücher auf<br />
Dogon und die verschiedenen Instrumente, die im Gottesdienst benutzt<br />
werden. So wird beispielsweise auch die Glocke durch eine Tröte ersetzt.<br />
• Es folgt ein Besuch beim Imam, dessen Sohn Priester geworden ist. Als<br />
bewundernswertes Beispiel für Respekt zwischen den Religionen erklärt er<br />
uns, dass das Nebeneinander verschiedener Religionen im Dorf für ihn völlig<br />
normal ist und die toten der verschiedenen Konfessionen sogar nebeneinander<br />
beerdigt werden.
• Mit Blick auf die Speicherhäuschen erzählt Abdul uns, dass der Anbau zwischen<br />
Männer und Frauen getrennt wird. So bauen die Frauen Datteln und<br />
Erdnüsse an, die Männer hingegen Bohnen, Tomaten, Auberginen, Hirse,<br />
Couscous, Zwiebeln und Salat. Die Frauen bekommen dann Hirse und<br />
Gemüse von den Männern und lagern es nach der Weiterverarbeitung in<br />
ihrem Speicher. Alle fünf Tage findet ein Markt statt.<br />
• Ganz oben am Rande des Dorfes befinden sich Löcher im Fels, in denen<br />
zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert die frühen Siedler – die Telem –<br />
lebten. Da die Löcher so klein sind glauben die Menschen noch heute,<br />
dass die Tellem Zwerge waren, Knochenfunde haben das aber widerlegt.<br />
Noch heute werden selten Bewohner in den Felshöhlen beerdigt, überwiegend<br />
jedoch in der Ebene. Hier oben ist auch der Platz des Hogons, dem<br />
religiösen Oberhaupt der Dogon. Er ist unter anderem für die Opferungen<br />
zuständig. Eigentlich wurde in Nombori von drei Alten bereits ein Hogon<br />
ernannt, aber er hat noch nicht seinen Platz eingenommen, weil er seine<br />
Familie nicht verlassen will. Der Hogon muss nämlich wie ein Eremit völlig<br />
abgeschieden leben und darf Essen uns Wasser nur von einer Jungfrau<br />
empfangen. Zu den Dogon Zeremonien kommen nur die Animisten, Christen<br />
und Muslime können sich mit ihrer ursprünglichen Religion nicht mehr<br />
identifizieren und verkaufen ihre alten Kultobjekte.<br />
• Danach passieren wir die Togina – das Palaverhaus – von der es in jedem<br />
Viertel eins gibt und eins für das gesamte Dorf. Es besteht aus vier Pfählen<br />
und einem ca. 50cm dicken, strohgedeckten Dach gegen die Sonne. Das<br />
Dach ist so niedrig gebaut, dass man nur sitzen, und nicht vor Problemen<br />
„weglaufen“ kann. Bei Problemen wird hier eine Versammlung einberufen,<br />
aber auch um Kinder zu Impfen oder die Mädchen auf die Beschneidung<br />
vorzubereiten.<br />
• In Nombori gibt es außerdem eine Schule mit 6 Lehren, ein (unnutzbares)<br />
Krankenhaus und ein Museum, das in Zusammenarbeit mit der Mission<br />
Culturelle aufgebaut wurde.<br />
Zum Abendessen gibt es To (Hirsebrei mit Sauce, die mit Fischbrühwürfeln<br />
gewürzt wurde), den die meisten von uns wegen des intensiven Geschmacks nur<br />
probieren wollen. Dazu gibt es Yam mit Gemüse und Hirsbier aus einer großen<br />
Kalebasse.<br />
Unser Fahrer Oumar liegt schon betrunken am Tisch, er hat als Songhai eine<br />
Scherzbeziehung mit dem gesamten Dogondorf, war den ganzen Tag über sehr<br />
aufgedreht und hat wohl ein Beruhigungsbier zu viel getrunken.<br />
Nach dem Essen tanzen die Frauen des Dorfes in ihren wunderschönen<br />
Indigogewändern für uns bzw. besonders für Frau Luttmann. Die Systematik des<br />
Tanzes bleibt über die gesamten zwei Stunden immer gleich, und bald werden<br />
junge Männer und Frauen ebenfalls mit einbezogen und natürlich auch wir<br />
Besucher.<br />
Verfasser: Friederike Brumhard<br />
215
Freitag, 20. Februar 2009<br />
Nach einer Nacht im Freien auf dem Dach des Campements und einem<br />
Frühstück mit köstlichen Baignets sprechen wir mit M. Guindo, unserem Begleiter<br />
und langjährigen Mitarbeiter der Mission Culturelle über seine Arbeit in Nombori.<br />
Er hat mit der Sensibilisierungsarbeit gegen den Ausverkauf der Dogonkultur<br />
begonnen und den Aufbau des Museums begleitet.<br />
216<br />
• Nachdem das Dogonland zum Weltkulturerbe erklärt wurde, wurde in mehr<br />
als 200 Dörfern mit Informations- und Sensibilisierungsarbeit begonnen um<br />
den Schutz der Kultur voranzutreiben<br />
• Vorher gab es zahlreiche Läden, wo Kultobjekte verkauft wurden, nun sollten<br />
Museen gebaut werden, um die Kultur zu bewahren und nachhaltig<br />
daran zu verdienen<br />
• In Nombori wurden den Menschen die Objekte nicht abgekauft, sondern<br />
die Spender erhalten eine Art Steuer dafür oder Lebensmittel in schlechten<br />
Zeiten. Man kann auch einen Kredit beim Museum aufnehmen, wenn man<br />
ein Objekt eingelagert hat, was besonders in Krisenjahren stark genutzt<br />
wird um zum Beispiel Tiere zu kaufen (Feldbau nur 3 Monate möglich)<br />
• Die Bezahlung der Objekte richtet sich dabei nach dem Alter, dem Hersteller<br />
und der Genauigkeit der Geschichte des Stückes, die von einem Komitee<br />
aus alten erfahrenen Menschen begutachtet werden<br />
• Am Anfang war die Betreuung des Museums sehr schwierig, weil sie für die<br />
Menschen neben der Feldarbeit eine Zusatzarbeit darstellt, oft vergaßen<br />
sie es einfach<br />
• Heute ist das Dorf sehr zufrieden mit dem Museum, weil es mehr Touristen<br />
in das Dorf bringt. Früher war Nombori nur ein Durchgangsort, heute bleiben<br />
immer mehr Touristen über Nacht. Dadurch sind mehrere private<br />
Campements entstanden.<br />
• Mittlerweile gibt es jeden Monat ein Treffen, um über die Entwicklung des<br />
Museums zu beraten<br />
• Es wurde eine Cafeteria eingerichtet, für welche die Mitarbeiter in einem<br />
Restaurant in Bandiagara ausgebildet werden<br />
• Die Führer werden im Nationalmuseum in Bamako ausgebildet<br />
• Es liegen Pläne vor, dass am Fuß der Falaise von Marrokanern ein Hotel<br />
gebaut werden soll. M. Gindo erzählt von guten Verträgen mit dem Dorf, da<br />
diese angeboten haben, dass Nombori den geplanten Wasserturm mitnutzen<br />
kann. Wegen der starken Wasserknappheit, erscheint uns der Plan in<br />
dieser Gegend ein Hotel zu bauen schlichtweg wahnsinnig.<br />
Besuch beim Sohn des Dorfchefs, dessen Frau in der Nacht ein Kind geboren<br />
hat.<br />
Besuch des Museums, das uns noch nicht so fortschrittlich erscheint, wie M.<br />
Guindo es angepriesen hat. Der Führer ist sehr unsicher und liest meist nur von<br />
den Schildern ab und die Cafeteria ist völlig verwaist.<br />
In der Schule bringen zwei Touristengruppen den Unterricht völlig zum Erliegen.
Rückweg durch die Dünen und zurück auf das Plateau wo unser Bus noch auf<br />
uns wartet.<br />
Rückfahrt nach Bandiagara.<br />
Abends Essen mit Birgit Fecher vom ded, in dem wir unsere Eindrücke bezüglich<br />
der Touristenfreundlichkeit in Nombori schildern. Insgesamt sind wir überwältigt<br />
von der Gastfreundschaft, wir würden den Bewohnern aber mehr Bewusstsein für<br />
ihre Intimsphäre wünschen, da wir das Gefühl hatten, dass sie sich vor Touristen<br />
selten trauen schlechtes Verhalten anzusprechen oder Besichtigungswünsche<br />
abzuschlagen.<br />
217
218
Timbuktu<br />
17. – 20. Februar 2009<br />
219
Dienstag, 17. Februar 2009<br />
Hinfahrt nach Timbuktu<br />
220<br />
• Aufteilung der 15 Personen auf die drei Geländewagen<br />
• Nach der Stadt Douzenta passieren wir den Zeugenberg „Montane de<br />
Gambia“ (vgl. Mirjas Ausarbeitung - Zeugenberge, siehe Abb. 1). Der Berg<br />
wurde von der Falaise abgetrennt und spaltet sich wiederum in kleine<br />
Bestandteile. Um den Zeugenberg herum befindet sich ein Schuttwall aus<br />
dem Erosionsmaterial, der Glacier genannt wird<br />
• Auf dem Weg nach Timbuktu stellen wir eine beginnende Dünenbildung<br />
fest. In der Halbwüste befinden sich Trockenflussbetten (Wadis), die an<br />
den Furten betoniert sind damit die Vielzahl an kleinen Orten ,und auch<br />
Timbuktu, nicht von der Außenwelt abgeschnitten werden wenn Regenzeit<br />
ist<br />
• Abends: gemeinsames Essen mit unserem Fremdenführer in Timbuktu.<br />
Anschließendes Teetrinken mit Mohammed.<br />
Verfasser: Mirjam Krüger
Mittwoch, 18. Februar 2009<br />
Stadtführung mit unserem Fremdenführer Kalili, der uns die 3 Tage in Timbuktu<br />
begleiten wird.<br />
• 3. Moscheen in Timbuktu: Die Moschee Djngurei-Ber ist die älteste und<br />
größte Timbuktus und wurde im Jahre 1325 von Kanaka Musa erbaut. Sie<br />
verfügt über 2 Minarette und es finden mehr als 1300 Personen in ihr Platz.<br />
In der Moschee gibt es getrennte Bereiche für Frauen und Männer, junge<br />
Frauen und ältere Frauen (ab den Wechseljahren) dürfen die Moschee<br />
nicht betreten.<br />
Die zweite Moschee in Timbuktu ist kleiner und wurde im Jahre 1400<br />
erbaut. Sie ist nach ihrem ersten Imam Sidi Yahiga benannt, der aus<br />
Andalusien kam und gleichzeitig der letzte Heilige Timbuktus ist.<br />
Auch die dritte Moschee Sankoré wurde im 15. Jahrhundert, also zur<br />
Blütezeit Timbuktus, erbaut. An ihr war die wichtigste Universität<br />
angegliedert, in der alle Dokumente der Stadt gelagert waren. Nachdem<br />
das Songhai-Reich zerbrach und der Reichtum verflogen war verließen<br />
viele der Gelehrten und Reichen <strong>Mali</strong> und viele Dokumente der Stadt<br />
gelangten so ins Ausland (beispielsweise nach Frankreich, Marokko). Bis<br />
heute kämpft der Präsident <strong>Mali</strong>s dafür diese Dokumente zurück in die<br />
Stadt zu bekommen.<br />
221
222<br />
Alle drei Moscheen bestehen aus Lehm und müssen jährlich vor der<br />
Regenzeit wieder restauriert werden, da der Lehm ausgewaschen wird.<br />
Lehmbauweise vs. Kalkstein: Die Häuser und Moscheen werden traditionell<br />
aus Lehm erbaut, allerdings benutzten inzwischen wohlhabende Einwohner<br />
auch Kalkstein, da dieser länger hält als der Lehm und nicht jedes Jahr<br />
restauriert werden muss. Es muss beim Bau von Kalksteinhäusern ein<br />
Antrag bei der UNESCO gestellt werden, da die traditionellen Lehmhäuser<br />
zu dem Kulturerbe Timbuktus gehören. Viele Einwohner Timbuktus sind<br />
gegen die Bauweise mit Kalkstein, weil eine jahrhundertlange Tradition<br />
verloren geht<br />
• Heiligenkult: In Timbuktu gibt es 333 Heilige, die über die ganze Stadt<br />
verteilt sind. Die Einwohner kontaktieren bei familiären oder anders<br />
gelagerten Problemen den Ältesten und dieser sagt ihm, zu welchem<br />
Heiligen die Person gehen muss. In Timbuktu gibt es eine sehr<br />
ausgeprägte Heiligenkultur, so dass auch viele Menschen aus den<br />
Nachbarländern hierhin pilgern und die Heiligen kontaktieren.<br />
• Der Friedhof: Die Muslime kennen das Kreuz als Symbol auf einem Grab<br />
nicht und es ist ebenfalls unüblich den Namen des Toten aufzuschreiben.<br />
Der Leichnam wird in Stoff eingewickelt und mit dem Kopf gen Mekka<br />
begraben.<br />
• <strong>Große</strong> Feste: In der Stadt werden traditionell drei große Feste gefeiert.<br />
Dazu zählt die Feier zum Ende des Fastenmonats Ramadan, das Sheep-<br />
Festival, bei dem ein Schaf für die Gläubigen, die zu Arm oder Krank sind<br />
um nach Mekka zu pilgern geopfert wird und das Maulut Festival. Dieses<br />
Festival wird zu Ehren der Geburt des Propheten Mohammeds gefeiert und<br />
findet um die größte Moschee Djngurei-Ber herum statt. An diesem Fest<br />
können alle Anwohner teilnehmen und eine dreifache Teilnahme ist<br />
gleichzustellen mit einer Fahrt nach Mekka.<br />
• Die Koranschulen: Sowohl Mädchen als auch Jungen in Timbuktu gehen<br />
zur Koranschule, in denen sie den Koran und die Religion erlernen. Viele<br />
Kinder besuchen die Koranschulen nur in den Ferien oder am<br />
Wochenende, wenn sie nicht in der „richtigen“ Schule (Medersen) sind oder
ihren Familien bei der Hausarbeit helfen. Einige Jungs werden von ihren<br />
Familien geschickt, um bei dem Koranlehrer zu leben. Sie müssen dafür<br />
Essen und Kleidung erbetteln und dieses an den Lehrer abgeben. Viele<br />
dieser Kinder sprechen kein arabisch und lernen „nur mit dem Herzen“- sie<br />
werden Talise genannt. Es sind vor allem Jungen aus armen<br />
Verhältnissen, dessen Eltern keine andere Möglichkeit sehen ihre Kinder<br />
aufzuziehen<br />
• Im Hause der Tuareg: Die Haustüren der Tuareg bestehen aus drei<br />
Ringen, die symbolisch für den Vater, die Mutter und das Kind stehen. Sie<br />
bestehen aus Tik-Holz, dass aus der Elfenbeinküste stammt. Das Innere<br />
des Hauses besteht aus Lehm, der Boden ist aus Sand und die Wände<br />
sind häufig farbig bemalt. Die Töchter des Hauses folgen im Alltag der<br />
Mutter und lernen so ihre Aufgaben währen die Söhne die handwerklichen<br />
Tätigkeiten vom Vater erlernen. Ein Tuareg-Mann muss in seinem Leben<br />
ein Handwerk erlernen um eine Frau zu bekommen und die Familie später<br />
zu ernähren.<br />
Die Frau hat bei den Tuareg eine sehr hohe Stellung…<br />
Einige Familien haben vor ihren Häusern einen großen Lehmofen stehen,<br />
in dem das traditionelle Brot „Takula“ gepacken wird.<br />
• Die Bellas: Die Bellas sind eine Ethnie, die als Hausangestellte der Tuareg<br />
arbeiten. Bis ins 20. Jahrhundert waren die Bellas die Sklaven der Tuareg.<br />
Sie leben in Zelten um Timbuktu herum, die aus einem Holzgepflecht<br />
bestehen und mit Tierhaut abgedeckt werden.<br />
• Kanalisation: In Timbuktus Altstadt entsteht Schritt für Schritt ein<br />
Kanalisationssystem. Das Abwasser fließt über Pipelines aus den Häusern<br />
und gelangt in eine Unterwasserleitung. Dort wird es gesammelt und<br />
beispielsweise für die Lehmherstellung verwendet. Dieses System ist ein<br />
riesen Fortschritt, da in vielen Teilen Timbuktus und in allen anderes<br />
Städten <strong>Mali</strong>s das Abwasser direkt auf die Wege gekippt wird.<br />
Einhergehend mit diesem Projekt werden die Sandwege in der Altstadt<br />
ebenfalls mit Steinen ausgelegt, damit die Unterwasserleitungen entstehen<br />
können. Die Tuareg versprechen sich von diesen Maßnahmen, dass in<br />
Zukunft noch mehr Touristen Timbuktu besuchen.<br />
• Das „reiche“ Timbuktu: im 15. Jahrhundert war Timbuktu eine bekannte<br />
und reiche Handelsstadt des Songhai-Reiches. In der Stadt waren mehr als<br />
150 Koranschulen ansässig und 20.000 Studenten lebten hier, sie galt als<br />
das Zentrum der Gebildeten. Timbuktu war ebenfalls ein wichtiges Zentrum<br />
für den Handel von Wüstensalz und Gold. In dieser Blütezeit kamen auch<br />
viele Erforscher aus dem Ausland und der erste von ihnen war der Araber<br />
Ibn Battula im Jahre 1353, der auch viele Bücher über Timbuktu schrieb.<br />
Für die nachfolgenden Forscher gestaltete es sich schwieriger, da sie der<br />
arabischen Sprache nicht mächtig waren. Der Schotte Major Alexander<br />
Gordon Laing kam 1826 nach Timbuktu und wurde von den Tuareg<br />
ermordet, da er sich nicht mit ihnen Verständigen konnte und die Tuareg<br />
dachten, dass er in Europa über ihr Handelsgeschäft berichten wollte. Der<br />
Eroberer René Caillié, der kurz nach dem Schotten eintraf bereitete sich<br />
besser auf seine Afrika-Forschung vor- er lernte arabisch und gab sich als<br />
Muslim aus. Er kehrte als erster Europäer erfolgreich nach Frankreich<br />
zurück und keiner glaube ihm, dass er tatsächlich in Timbuktu gewesen ist.<br />
223
224<br />
Um dies zu prüfen würde dann der deutsche Andreas Barth nach Timbuktu<br />
entsandt. (vgl. Referat von Friedericke Brumhardt). Die Häuser der<br />
europäischen Afrika-Forscher sind in Timbuktu zu besichtigen.<br />
• Der Markt: Der größte Markt Timbuktus ist in die Quartiere Kochen, Tiere<br />
und Dekoration unterteilt. Die Früchte und das Gemüse müssen aus dem<br />
Süden <strong>Mali</strong>s hierher transportiert werden und sind deshalb durchschnittlich<br />
teurer als im restlichen <strong>Mali</strong>.<br />
• Das Salz, für das Timbuktu bekannt ist, wird in einer Salzmine in der Wüste<br />
gewonnen. Die Reise dorthin dauert 15 Tage hin und wieder zurück mit<br />
einer Karawane. Anschließend an die Stadtführung haben wir auf dem<br />
größten Markt Timbuktus in dem Restaurant „Poulet dòr“ zu Mittag<br />
gegessen.<br />
• Um vier Uhr nachmittags sind wir mit Dromedaren in ein Campement in der<br />
Wüste geritten. Dort wurden wir herzlich mit einem Abendessen begrüßt,<br />
es gab ein Lamm und dazu Takula, das traditionelle Brot. Nach einem<br />
kleinen Lagerfeuer haben wir in Zelten oder optional im Freien übernachtet.
• Wir haben das außergewöhnliche Phänomen erlebt, dass es in der Wüste<br />
während der Trockenzeit leicht geregnet hat. (siehe Abb. 7) Dieses lässt<br />
sich dadurch erklären, dass der Passatwind ausgesetzt hat. Dadurch kann<br />
die thermische Inversion stattfinden- die Flüssigkeit aus dem Wasser<br />
(Niger) verdunstet und es regnet. Durch die Wolkendecke hatten wir aber<br />
eine sehr milde Nacht.<br />
• Das Campement ist ein gutes Beispiel wie endogene Potenziale des<br />
Landes wie in diesem Beispiel die Landschaft optimal genutzt werden um<br />
nachhaltigen Tourismus auszuüben (vgl. Ausarbeitung „Nachhaltiger<br />
Tourismus“ von Mirjam Krüger<br />
Verfasser: Mirjam Krüger<br />
225
Donnerstag, 19. Februar 2009<br />
226<br />
• Frühstück im Camp<br />
• Rückfahrt nach Timbuktu mit Geländewagen<br />
• Tin Telout/Treffen mit El Kassim Ag Hade<br />
Tin Telut (Ort an dem die Elefanten waren) ein 1963 als Durchgangscamp<br />
der Nomaden gegründeter Ort unweit des Niger, heute eines der<br />
Vorzeigeprojekte der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit in <strong>Mali</strong>.<br />
Die dort lebenden Menschen sichern ihren Lebensunterhalt hauptsächlich<br />
als nomadische Viehhalter, Ackerbauen und Fischer. Desertifikation,<br />
Dürren und Bevölkerungswachstum erschweren die Lebensbedingungen.<br />
Bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen, ausgelöst durch<br />
Forderungen der Tuareg nach Selbstverwaltung, erschütterten zwischen<br />
1990 und 1995 die Gegend.<br />
In Tin Telut treffen wir El Kassim Ag Hade, den Vertreter des Programms <strong>Mali</strong>-<br />
Nord in Timbuktu.<br />
Wegen der miserablen Situation der Gegend – neben dem Krieg wurden die<br />
ansässig gewordenen Menschen zusätzlich mit großen Dürren, Aufteilung der<br />
Wüste in Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen und Ägypten im Norden,<br />
Westsahara, Mauretanien und <strong>Mali</strong> im Westen und Niger, Tschad und Sudan<br />
im Süden bzw. Osten und dauerhaft zunehmender Desertifikation konfrontiert -<br />
sowie die Gunstlage Tin Telouts dank der Nähe zum Niger wählte die GTZ im<br />
August 1995 den Ort als Standort für ein Notfallprojekt. 1998 ging dies zu<br />
einem der heute 36 Landgemeinden für das Programm <strong>Mali</strong> Nord über.
Folgende Ziele wurden formuliert:<br />
• Aufbau der Infrastruktur (Neubau und Wiederherrichtung von<br />
Brunnen, Bewässerungsanlagen, Wohnhäusern, Schulen,<br />
Krankenhäusern und Strassen)<br />
• Wiederherstellung der staatlichen Verwaltung<br />
• Schaffung einer neuen Existenzgrundlage für die nun sesshaft<br />
gewordene Bevölkerung mit modernen Bewässerungsmethoden<br />
durch Motorpumpen<br />
• (Wieder-)Aufbau der politischen Unterstützung durch die malische<br />
Regierung<br />
• Materielle Förderung<br />
Nachdem die Finanzierung abgeklärt war 9 , wurde direkt mit der Arbeit begonnen.<br />
Saatgut und langwirtschaftliche Geräte sind gestellt worden. Es galt keine Zeit zu<br />
verlieren, da der Monat August mit der Aussaht stets den Beginn der<br />
landwirtschaftlichen Saison darstellt.<br />
Parallel dazu bauten die Zivilbevölkerung in Zusammenarbeit mit Fachkräften das<br />
Dorf auf – Gesundheitszentren, ein Schulgebäude mit sechs Klassen für rund 100<br />
Kinder und eine solarbetriebene Wasserpumpe zur Trinkwasserversorgung des<br />
gesamten Dorfes wurden gebaut und die GTZ begann mit der politische<br />
Aufklärungsarbeit Verschiedene Ethnien wurden zusammengeführt, indem sie u.<br />
a. gemeinsam von ein und derselben Wasserpumpe Gebrauch machen mussten.<br />
Zudem bildete die GTZ KrankenpflegerInnen für die Gesundheitszentren aus.<br />
!998 wurde das Notfallprojekt zu einem Entwicklungsprojekt erweitert, welcher in<br />
1. Linie den großflächigen Reisanbau (trotz des Wüstengebiets) als kurzfristiges<br />
Ziel setze. Erste Maßnahmen waren die Installation einer solarbetriebenen<br />
Wasserpumpe. Bis 1990 konnten 30 ha Reisfelder kultiviert werden, bis heute<br />
sind es 300 ha.<br />
Bei unserer Rundfahrt durch das Dorf, entlang der landwirtschaftlich genutzte<br />
Fläche bis hin zu einem Seitenarm des Niger erzählt uns El Kassim Ag Hade von<br />
den zwei zentralen Problemen der Region.<br />
1. die zwei Extremen von zu viel Wasser in der Regenzeit zwischen Juni und<br />
September und kein Wasser über den Rest des Jahres. Dies sagt uns, dass die<br />
Nebenarme des Niger keine perennierenden Gewässer sind, d. h. sie nicht das<br />
ganze Jahr über Wasser führen.<br />
2. die stetig zunehmende Verwüstung, Desertifikation. Zu letzteren Punkt sagt er,<br />
dass wenn in den nächsten 50 Jahre die Wüstenbildung in einem ähnlichen<br />
Tempo voranschreite wie es die letzten 50 Jahre der Fall war, der Niger nicht<br />
mehr vorhanden sein werde. Dies führe zu einer starken Gefährdung der<br />
9 Finanziert wird das Projekt <strong>Mali</strong> Nord aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit der<br />
Bunderregierung. Drei Fünftel der 63,9 Mio. Euro in Form von Technischer Zusammenarbeit über die<br />
GTZ, zwei Fünftel in Form von Finanzieller Zusammenarbeit über die KfW. Zudem hat das<br />
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) das Programm <strong>Mali</strong>-Nord von 1996 bis 1999 mit<br />
Euro 2 Mio. finanziert. Das Nothilfeprogramm der Europaeischen Kommission (ECHO) hat zwischen<br />
1996 und 1999 insgesamt EURO 4 Mio. beigesteuert.<br />
Das Welternährungsprogramm (WEP) gewährt keine finanziellen Leistungen, sondern liefert Getreide,<br />
Öl und Fischkonserven. Seine Zuwendungen von 1996 bis Ende 2006 hatten einen Gegenwert von<br />
rund Euro 3,2 Mio. Aus Mitteln der japanischen Kooperation beauftragt das WEP das Programm <strong>Mali</strong>-<br />
Nord daneben seit dem Jahr 2006 alljährlich drei neue dörfliche Bewässerungsfelder (PIV) im Sektor<br />
Bara Issa herzurichten. Quelle: http://www.mali-nord.de (13.04.2009)<br />
227
Landwirtschaft rund um Tin Telut. Diesem Prozess, werde durch Anpflanzung von<br />
Bäumen und Sträuchern entgegengearbeitet, sagt er.<br />
Während dieser Fahrt stellen wir fest, das der ausgetrocknete Boden sehr<br />
sandhaltig ist und schließen auf Grund der Rissbildung auf einen erhöhten Gehalt<br />
von Ton.<br />
Am Fluss angelangt zeigt uns der Vertreter des Programms <strong>Mali</strong> Nord eine der<br />
420 motorisierten Wasserpumpen der Region Timbuktu, die zur Bewässerung der<br />
Felder verwendet werden. Diese bewässern jeweils 40 ha, haben eine Wert von<br />
15 000 000 CFA ( ca. 23 000€) und seien von der GTZ bezahlt worden. Zudem<br />
bilde die GTZ pro Pupe zwei Fachkräfte aus, welche diese warten können und<br />
stelle eine Reperaturwerkstatt mit Ersatzteilen und zwei Ingeneuren.<br />
Dank dieser Pumpen, könne pro Hektar im Jahr bis zu fünf mal geerntet werden.<br />
Auf der Rückfahrt kommen wir auf das Thema Bodenversalzung zu sprechen.<br />
Das Problem liegt der fehlenden Entwässerung trotz Bewässerung zu Grunde.<br />
Im Boden werden Salze angereichert, welche nicht wieder herausgewaschen<br />
werden. Eine Versalzung des Bodens ist die Folge.<br />
Später unterhalten wir uns in Gemütlicher Runde mit einem Glas Tee unter einem<br />
typischen Tuareg-Zelt. El Kassim Ag Hade erzählt uns von der heutigen<br />
Lebensweise der Touareg on Tin Telut. Auch wenn die Dorbewohner unserer<br />
Ansicht nach sesshaft geworden seien, seien sie es von der Mentalität noch<br />
lange nicht, sagt er. Auch wenn sie nicht mehr die Herren der Wüste mit ihren<br />
über 100 Rinden und Kamelen sind, träumen jedoch alle noch von dem Leben als<br />
Nomaden. Dies führe dazu, dass es nach wie vor viele gibt die in der<br />
landwirtschaftlichen Nebensaison zwischen Januar und August mit einer kleinen<br />
Herde unterwegs seien, auch wenn dies nicht mehr zum Überleben notwendig<br />
sei. Dies sei die Balance zwischen Tradition und Moderne. Übrigens, sagt er,<br />
habe der Krieg nicht nur Nachteile, insbesondere für die heutige Zeit mit sich<br />
geführt. Zum Beispiel haben viele junge Männer in den Gefangenlagern andere<br />
Dinge gelernt, als bisher von Generation zu Generation weitergegeben wurde<br />
(Nomadentum und Viehzucht). Das habe dazu geführt, dass einige heute<br />
228
Einstellungen beim Staat oder dem Militär bekommen konnten.<br />
Auf unsere Fragen antwortet El Kassim Ag Hade wie folgt:<br />
StudentIn: „Wie groß ist das Land in etwa, was eine Familie zu bestellen hat?“<br />
Antwort: „Die Größe des Feldes ist abhängig von der Größe der Familie.<br />
Zwischen einen halben und drei Hektar. Dabei wird grundsätzlich ein Teil er<br />
Erträge gespart. Dies gleicht einem nachhaltigem Ansatz“.<br />
StudentIn: „ Wie ist die Arbeit zwischen Männern und Frauen aufgeteilt?“<br />
Antwort: „Es gibt eine klare Aufteilung der Aufgaben. Die Frauen kümmern sich<br />
um den Haushalt, die Wäsche und die Kinder und erledigen die Aussaht und die<br />
Pflege auf dem Feld. Die Männer sind für das Ernten und Lagern der Erträge<br />
zuständig.<br />
StudentIn: „Hat die schöne Zufahrtsstarsse nach Tin Telut auch was mit dem<br />
Projekt zu tun?“<br />
Antwort: „Nein, die Strasse wurde von der EU subventioniert.“<br />
StudentIn: „ Wie ist die Trinkwasserversorgung organisiert?<br />
Antwort: „Alle haben gleichermaßen das Recht zum Zugang zum Wasser und<br />
zahlen dafür den gleichen monatlichen Beitrag. Von dem Geld werden<br />
Reparaturen bezahlt. Normalerweise liegt es in der Tradition, dass ein Touareg<br />
einen Anderen, sowie dessen Vieh immer von seinem Wasser umsonst trinken<br />
lässt. Niemand darf einem Anderen Wasser verweigern. Leider ist das in der<br />
Größenordnung wie die es heutzutage der Fall ist nicht mehr möglich. Manchmal<br />
kommen bei absoluter Trockenheit Savannenführer mit über 400 Kamelen. Also<br />
zahlen die Vorüberziehenden einen kleinen Betrag für das Wasser, in er Regel<br />
pro Kamel.“<br />
StudentIn: „Wie gelangen die Dorfbewohner an Güter die sie nicht selbst<br />
produzieren können?“<br />
Antwort: „Es wird immer etwas von den Erträgen aber z. B. auch vom<br />
229
Kunsthandwerk zum Tausch aufbewahrt.“<br />
Leider haben wir auf Grund von Zeitmangel nicht mehr die Möglichkeit über das<br />
Erreichen oder das Scheitern der zu Beginn formulierten Ziele von 1995 zu<br />
sprechen.<br />
• Einladung bei Mohameds Familie<br />
Am Abend sind wir die der Familie unseres „Busguides“ (er ist nicht der Fahrer,<br />
sondern dessen Assistent) Mohammed eingeladen. Wir werden laut singend und<br />
tanzen empfangen (siehe Abb. 11) und uns werden sofort Getränke angeboten.<br />
Als es dunkel wird werden wir in das Haus einem von Mohammends Brüdern<br />
geleitet um dort Abend zu essen (siehe Abb.12). Wir bekommen ein 3-gängies<br />
Menü (Salat mit Brot, Hünchen mit Couscous und Pommes Frites, süßes<br />
Hirsegetränk) bei dem allem Anschein nach weder Kosten noch Mühen gespart<br />
wurden. Die symbolische (Geld-)Geschenkübergabe verläuft sehr emotional.<br />
Gegen 22.00Uhr verabschieden wir uns von der großen Familie.<br />
• Übernachtung im Hotel in Timbuktu<br />
Verfasser: Theresa Lauw<br />
230
Freitag, 20. Februar 2009<br />
• Rückfahrt von Timbuktu nach Sevare´ über Douzenta.<br />
Erste Krankheiterscheinungen bei StudentInnen treten auf. Mittagessen in<br />
Douzenta (Brot mit Omelette).<br />
• Ankunft in Sevaré gegen 17.30Uhr<br />
Verfasser: Theresa Lauw<br />
231
Samstag, 21. Februar 2009<br />
Abfahrt in Bandiagara<br />
232<br />
- nach dem Frühstück machen wir noch ein Abschiedsfoto mit M. Guindo<br />
(der frühere Haushälter von Dr. Luttmann) und Marianne (die Nachbarin,<br />
die Perlenketten fertigt), die mit ihrer Tochter Fatime gekommen ist<br />
- beim Gepäckeinladen kommt es noch zu einem schmerzhaften<br />
Zwischenfall für Friederike: sie wird von einem Skorpion gebissen, der wohl<br />
von unseren Essensvorräten angelockt wurde – Anke therapiert mit den<br />
berühmten Dogonzwiebeln<br />
Fahrt nach Mopti-Sevaré<br />
- beim Aufbruch gegen 9.00h winkt das gesamt Personal der Toguna<br />
- wir haben strahlenden Sonnenschein und die Stimmung ist gut<br />
- die restlichen Berge an Gastgeschenken, die wir während der letzten Tage<br />
in B. eingeheimst haben, teilen wir auf der Fahrt untereinander auf<br />
- Lisa nutzt die Gelegenheit, um die Perspektive von Muhammeds Platz aus<br />
zu testen<br />
- da die Fahrertür des Busses immer wieder während der Fahrt von selbts<br />
aufgeht, greifen wir durch und fixieren sie mit Hilfe einer Kordel – auch<br />
wenn Omar das für überflüssig hält...<br />
Ankunft in Mopti-Sevaré<br />
- nach einem fröhlichen Wiedersehen mit den Timbuktu-Reisenden wird uns<br />
das Ausmaß der Krankenfälle erst richtig bewusst – in den vergangen<br />
Tagen hatten immer mehr mit Durchfallerkrankungen zu kämpfen<br />
- Prof. Pez greift auf seine Ausbildung als Sanitäter zurück und steht allen<br />
bei – Nachtwachen inklusive<br />
- wir bemühen uns Kranke und Gesunde trotz beengten Räumlichkeiten zu<br />
trennen<br />
- die für heute geplante Weiterfahrt nach Ségou ist unter diesen Umständen<br />
nicht möglich – dankenswerterweise überließ uns Jutta das Gästehaus<br />
spontan für eine weitere Nacht<br />
- da es nicht genug Betten für alle gab, nutzten wir unsere Moskitodome und<br />
breiteten uns auf Terasse und Dach aus<br />
Atelier de transformation des des déchets plastiques de Sevaré<br />
- Prof. Pez fuhr am Nachmittag mit allen Gesunden zu einem Projekt der<br />
NRO „AGAKAN“, die Plastikmüll recyclen<br />
- Die Wertstoffe werden von (überwiegend) Frauen auf den Feldern<br />
aufgelesen (wie an anderer Stelle erwähnt, wird in <strong>Mali</strong> der Müll, der zum
größten Teil organisch ist, als Dünger verwendet, wodurch auch<br />
Plastiktüten etc. überall herum liegen). Samstags kann das Material<br />
abgegeben werden – daher sahen wir viele Frauen auf dem Gelände.<br />
- Pro Kilo gibt es 50 CFA<br />
- So können auch Familienmitglieder, die bisher nichts zum<br />
Haushaltseinkommen beitrugen, dieses steigern<br />
© Prof. Dr. Peter Pez<br />
- Das Material wird in Öfen geschmolzen und mit Sand versetzt<br />
- Die entstehende schwarze Masse wird in Formen gegossen und zu Briketts<br />
gebrannt<br />
- Diese werden zum Straßenbau genutzt und halten normaler Belastung<br />
stand. Es gibt sie in zwei Qualitäten (4kg schwere für Plätze und Wege, 7<br />
kg schwere für Straßen, die von LKWs und Bussen befahren werden). Für<br />
die 4kg-Briketts braucht man 25kg Plastik und 60kg Sand, für die 7kg-<br />
Briketts 35kg und ebensoviel Sand. Man erhält 20 Briketts. Teilweise wird<br />
auch Gummi beigemischt.<br />
- Es gibt ein Archiv mit Mustern unterschiedlicher Form/Zusammensetzung:<br />
© Mathias Becker<br />
233
234<br />
- Die Arbeiter tragen Masken zum Schutz gegen giftige Gase, die uns der<br />
Vorarbeiter auf Nachfrage zeigte – eine konsequente Anwendung war für<br />
uns aber nicht zu erkennen. Viele der Stoffe, die noch auf dem Schild an<br />
der Einfahrt aufgeführt sind, werden nicht mehr verarbeitet, da sie zu giftig<br />
sind:<br />
© Mathias Becker<br />
- Insgesamt werden zehn Leute beschäftigt.<br />
Lateritabbau<br />
© Prof. Dr. Peter Pez<br />
- Anschließend weist uns Prof. Pez noch auf einen nahe gelegenen<br />
Lateritabbau hin
- Das Material wird in Gruben abgegraben und für den Straßenbau<br />
verwendet, wobei es durch bewässerte Walzen verfestigt wird.<br />
- In seiner Mikroform kann es als Granulat für wirtschaftliche oder private<br />
Zementherstellung dienen. Die Granulatmischungen differieren je nach<br />
Klima, letztendlich ist das Material aber nicht geschützt genug gegen<br />
Erosion.<br />
- In unserem Fall war das Laterit bis auf den Grundwasserspiegel<br />
abgegraben worden.<br />
- Prof. Pez wies darauf hin, dass das Material über Jahrmillionen der Erosion<br />
ausgesetzt war und so auch andere Stoffe ausgewaschen wurden. Hier<br />
vermutete er Kieselerde, Hermathit und Fe2O (Eisen) wegen der<br />
Rotfärbung.<br />
- Es handelt sich um Sedimentgestein, was an der Schichtung des<br />
Ausgangsgesteins auf 10 m Tiefe zu sehen ist.<br />
- Auch weiße Teile waren sichtbar, vermutlich Kalk (vgl. Kreideberg in<br />
Lüneburg, wo die Kreide oberflächlich angeschnitten ansteht).<br />
- In einer Pfütze wies Prof. Pez des weiteren auf eine Schrumpfrissbildung<br />
doppelter Handbreite hin – hier quillt Ton.<br />
- Der gefundene Lateritklumpen ist verhüttungsfähig, aber nicht<br />
verhüttungswürdig.<br />
- Entstanden ist das Material durch Insolationsverwitterung (gr.<br />
Temperaturunterschiede)<br />
Anschließend hatten wir Freizeit bzw. die Möglichkeit nochmals nach Mopti zu<br />
fahren.<br />
Verfasser: Margaretha Kühneweg, Mathias Becker<br />
235
Sonntag, 22. Februar 2009<br />
Fahrt von Mopti-Sevaré nach Ségou<br />
236<br />
- Am Morgen verkündete Prof. Pez, dass Transportfähigkeit gegeben<br />
- Abdoulaye Guindo, der uns am 14.02. über die Arbeit der Agence du<br />
Bassin du fleuve Niger berichtet hatte, kam um uns zu verabschieden und<br />
machte ein Gruppenfoto<br />
- Gegen 9h traten wir die Fahrt nach Ségou an<br />
- Mittagessen in San<br />
- Bei einer kleineren Panne vertrieben wir uns die Zeit mit Papayaessen und<br />
wurden unfreiwillig zu einer Attraktion – eine große Reisegruppe ruht sich,<br />
teils liegend, im Schatten der verwaisten Markständen aus und isst auch<br />
noch in der Öffentlichkeit! Nein, keines der Kinder wollte mit essen.<br />
Ségou – Bogolanzentrum „Le Ndomo“<br />
- Nach mehr als sechs Stunden Fahrt erreichten wir das uns bereits<br />
bekannte Hotel „Djoliba“<br />
- Direkt nach dem Abladen brachen alle, die noch Energie hatten zu einem<br />
mit Dr. Luttmann zu einem berühmten Handwerkszentrum auf<br />
- Wir hatten kein Treffen vereinbart und der anwesende Hausmeister konnte<br />
den Besitzer auch nicht mehr erreichen, aber Mamadou, einer seiner<br />
Schüler, der sich bereits selbständig gemacht hat, kam eigens um uns alles<br />
zu zeigen<br />
- Das Zentrum befindet sich in einem großen Gebäudekomplex, der<br />
aufwendig im Bankostil gestaltet wurde, und das typische Rot der Häuser<br />
von Ségou aufweist<br />
- Wir wurden auf die Architektur des Eingangsbereichs hingewiesen: die fünf<br />
Zinnen verweisen auf die fünf Hörner an der Maske der ersten<br />
Initiationsphase in der Mandégesellschaft, die wiederum für die fünf Finger<br />
einer Hand stehen; Kaurimuscheln dienten früher als Währung und<br />
symbolisieren Reichtum; die Anzahl fünf kann man auch als drei und zwei<br />
sehen – die Symbole für Mann bzw. Frau und zusammen genommen das<br />
Symbol für Vollkommenheit
© Robert Oschatz<br />
- Fazit: es handelt sich um einen Ort für junge Menschen<br />
- Die Zeit der Initiation soll jungen Menschen, die auf der Suche nach<br />
Wissen sind, jemanden an die Seite stellen, der Ihnen zeigt, wie man im<br />
Leben zurecht kommt<br />
- „Le Ndomo“ bietet Kurse in der Bogolantechnik für junge Leute<br />
- In der Stadt gibt es noch ein weiteres Zentrum für Frauen<br />
-<br />
- Zum Färben werden Pflanzen verwendet – diese bei den Bambara und den<br />
Bozo bekannten natürlichen Farbstoffe werden erforscht und weiter<br />
entwickelt<br />
- Die Stoffe müssen mind. 24 Stunden einweichen<br />
- Beispiele für Farbstoffe sind „Ngalama“ (Blättersud; grün), wilde Trauben<br />
(blau), Rinde (rot) – mit Hilfe dieser Grundfarben werden alle anderen<br />
gemischt<br />
© Robert Oschatz<br />
- Das eigentliche Muster ist schwarz (Tonerde)<br />
Traditionell wurde der gesamte Stoff schwarz gefärbt, indem der aufgetragene<br />
Ton mit einem natürlichen Fixierer reagierte und das Muster anschließend mit<br />
einem anderen Mittel heraus geätzt – heute trägt man einfach die schwarzen<br />
Linien auf, was wir auch ausprobieren und dank der schnellen Wirkung des<br />
Fixieres das Produkt auch mit nehmen durften<br />
© Robert Oschatz<br />
- Unser Muster lehnte sich allerdings nicht an die historischen Vorbilder an –<br />
zuvor hatten wir einen Crashkurs in den Symbolen erhalten, die traditionell<br />
237
238<br />
- bei Bogolanstoffen Verwendung finden – vielen waren so mystisch und<br />
mehrfach codiert, dass wir nicht mehr zwischen Scherzen unseres Führers<br />
und tatsächlichen Bedeutungen zu unterscheiden vermochten<br />
- Auf dem Gelände gab es auch ein Museum mit einer sehr gut gemachten<br />
Ausstellung (von den Rohstoffen, über die gefärbten Stoffe bis zu den<br />
Varianten der Muster wurde alles von Exponaten repräsentiert) mit einem<br />
umfangreichen Shop.<br />
Verfasser: Margaretha Kühneweg, Mathias Becker, Robert Oschatz
Montag, 23. Februar 2009<br />
08:00 Uhr Abfahrt in Segou<br />
ca. 13:00 Uhr Ankunft in Bamako<br />
Mittagessen bei Bintou<br />
15:00 Uhr Termin bei der Friedrich Ebert Stiftung Bamako (FES)<br />
• Empfang durch Dr. Salabary Doumbia, Programmassistent, sowie<br />
Reinhold Plate, Leiter der FES Bamako. Die deutsche politische Stiftung<br />
FES gibt es seit 1968 in <strong>Mali</strong>, entstanden ist sie durch ein<br />
Vermarktungsgesellschaftsprojekt für eine Fischereigenossenschaft in<br />
Mopti. Während der Traoré Diktatur unterstützte die FES die<br />
Oppositionsbewegung, bis die Diktatur schließlich 1986/87 anfing zu<br />
bröseln. In den Jahren 1990-92 erfolgte dann eine Revolution angeführt<br />
durch Konaré, welcher im Anschluss der erste demokratisch gewählte<br />
Präsident <strong>Mali</strong>s wurde. Unter Konarés Präsidentschaft förderte die FES<br />
die Entstehung von Genossenschaften, klein- und mittelständiger<br />
Industrie, sowie demokratische Ansätze. Dabei unterstützte sie z.B. die<br />
unterschiedlichen Parteien (wie Adema, RPM…), Medien und<br />
unterschiedliche Organisationen und Gewerkschaften.<br />
• Heute arbeitet die FES weniger auf nationaler und mehr auf regionaler<br />
Ebene. Die dabei wichtigsten Punkte sind Handel und sicherheitspolitische<br />
Fragen.<br />
• Hauptaufgabe der FES ist die politische Beratung der Parteien,<br />
Nationalversammlung, Gewerkschaften, Medienverbänden,<br />
Jugendverbänden… Dabei fungiert sie weniger als Geber, eher als Partner<br />
der Organisationen. Den Organisationen werden Themen vorgeschlagen,<br />
auch werden Seminare, Workshops, Ateliers durchgeführt. Außerdem<br />
bietet die FES Orientierung für schlecht organisierte Parteien und hilft bei<br />
der Entwicklung von neuen Parteien.<br />
• Die FES hat als einzige deutsche politische Stiftung einen Sitz in <strong>Mali</strong>. Es<br />
gibt eine gewisse Spezialisierung zwischen den einzelnen Stiftungen,<br />
diese Abstimmung und Spezialisierung ist gewünscht von Seiten der<br />
Geberländer um eine Vielfalt entwicklungspolitischer Ansätze zu<br />
ermöglichen. Jede Woche findet ein Entwicklungszusammenarbeitstreffen<br />
in der deutschen Botschaft statt, bei der die Arbeit gegenseitig abgestimmt<br />
wird.<br />
• Gewerkschaftsbewegung <strong>Mali</strong>s: Die UNTM war die ursprüngliche<br />
Dachorganisation der Gewerkschaften, nach 1998 wurde sie durch die<br />
CSDM abgelöst. Die CSDM umfasst 12 Gewerkschaftsbranchen und ist<br />
auch regional/lokal vertreten. Mit beiden Organisationen arbeitete die FES<br />
zusammen. Themen der Zusammenarbeit waren u.a. Arbeitsnormen,<br />
Vorbereitung internationaler Treffen oder auch das Kyoto-Abkommen.<br />
• <strong>Mali</strong> orientiert sich in seiner politischen und wirtschaftlichen Organisation<br />
am französischen Modell: Im öffentlichen Dienst (Schulen, Universitäten,<br />
Verwaltungen…) sind die Gewerkschaften stark vertreten, im<br />
privatindustriellen Bereich, vor allem in der Goldindustrie, eher weniger.<br />
• Bureau d’Immigration CGEM: Das Immigrationsbüro besteht erst seit<br />
wenigen Monaten in Bamako. Es hat die folgenden Aufgaben: 1)<br />
Erforschung der Migration in <strong>Mali</strong> 2) Information und Unterstützung<br />
239
240<br />
freiwilliger und unfreiwilliger Rückkehrer 3) Informationen über legale<br />
Migrationsmöglichkeiten 4) Sensibilisierung für Gefahren illegaler<br />
Migration 5) Einbeziehung von im Ausland lebenden <strong>Mali</strong>ern in die<br />
malische Entwicklung. Das Projekt ist EU finanziert und entstand aus der<br />
Argumentation, dass der Geldfluss von in der EU lebenden Migranten<br />
größer sei als die EU Fördermittel. Diese Geldströme werden jedoch nicht<br />
für die Entwicklung ausgegeben. Das CGEM stellt damit ein Testprojekt<br />
und einen Versuch die Migration zu kanalisieren dar. Das Projekt wird<br />
äußerst kritisch betrachtet, da unterstellt wird lediglich billige malische<br />
Arbeitskräfte für die europäische Landwirtschaft finden zu wollen.<br />
• Mangel an politischem Interesse ist ein großes Problem für <strong>Mali</strong>,<br />
verursacht durch Geldmangel und Mangel an Bildung. <strong>Mali</strong> hat eine sehr<br />
hohe Analphabetenquote und das Niveau der Bildung sinkt. Ein<br />
Strukturanpassungsprogramm in den 80er Jahren führte zu zahlreichen<br />
Entlassungen von Lehrkräften und zur Schließung von<br />
Lehrerbildungsinstituten. Durch die mangelnde Bildung sind die <strong>Mali</strong>er<br />
weder regional noch international konkurrenzfähig. Ein Grund dafür ist<br />
auch die Nicht- Unterstützung der mittleren Schicht.<br />
• Ein weiteres Problem ist die Abwanderung der Jugendlichen vom Land in<br />
die Stadt. Eine Lösung hierfür wäre die Landwirtschaft attraktiver zu<br />
machen.<br />
• Die extreme Vermehrung der Non-Governmental Organizations wird<br />
problematisch gesehen, da viele Gelder aus dem Ausland fließen, es<br />
Modethemen gibt und die gesamte Arbeit relativ wenig koordiniert wird.<br />
Die FES unterstützt NGO Arbeit in der Legislative und im Parlament nicht.<br />
Auch werden z.B. Frauen nur innerhalb von Parteien gefördert.<br />
Verfasser: Lisa Trager, Melanie Kühl
Dienstag, 24. Februar 2009<br />
10:30 Uhr Termin bei Point Sud (PS), ein wissenschaftliches<br />
Forschungszentrum in Bamako<br />
• Empfang durch Moussa Sissoko, Leiter des Zentrums und mehrere<br />
Mitarbeiter unterschiedlicher Projekte<br />
• Ziel von Point Sud ist die Erforschung lokalen Wissens. Das Zentrum<br />
kooperiert mit der Universität Frankfurt. Es wurde 1998 gegründet durch<br />
die Universität Bayreuth, damals noch mit einer Konzentration der<br />
Forschung auf das Office du Niger. Heute ist es ein Treffpunkt und bietet<br />
Austausch an für internationale Forscher, die nach <strong>Mali</strong> kommen. Das<br />
Zentrum vertritt einen multidisziplinären Ansatz, vertreten sind z.B. die<br />
Felder Medizin, Soziologie, Agronomie, Ethnologie… Auch die Ausbildung<br />
junger malischer Forscher ist eine wichtige Aufgabe von PS. Diese wird in<br />
der Regel von malischen oder senegalesischen Lehrern übernommen.<br />
Auch ist eine punktuelle Ausbildung möglich durch bestimmte „personnes<br />
resources“. Bisher wurden 50 Akademiker weitergebildet und an<br />
ausländische Forschungsgruppen vermittelt. Das Zentrum hat außerdem<br />
eine Koordinierungsfunktion in den folgenden Forschungsfeldern: 1)<br />
Konfliktmanagement 2) Dezentralisierung 3) Auswirkungen der Menschen<br />
auf ihre natürliche Umwelt 4) Medien/Technik 5) Immigration. Ein weiteres<br />
Aufgabenfeld ist die Informationsvermittlung durch Konferenzen.<br />
• Ein großes Problem in <strong>Mali</strong> stellt die Konkurrenz zwischen traditionellen<br />
Machtstrukturen und der Macht des Staates dar.<br />
• Dezentralisierung ist erst seit 1992 in <strong>Mali</strong> in Angriff genommen worden,<br />
die konkrete Umsetzung erst in den 2000er Jahren. Faktoren, die zu dem<br />
Dezentralisierungsprozess geführt haben waren u.a. die Überwindung des<br />
Regimes von Traoré 1990/91 und die Touareg Rebellion im Jahre 1991.<br />
<strong>Mali</strong> ist damit das erste afrikanische Land, das Dezentralisierung auf<br />
nationaler Ebene durchgesetzt hat. Heute hat <strong>Mali</strong> insgesamt 703<br />
Gemeinden.<br />
• Ziel der Dezentralisierung war die Stärkung der Demokratisierung der<br />
staatlichen Institutionen und der Gesellschaft. Heute nehmen die meisten<br />
Gemeinden die Dezentralisierungsideen an, halten aber gleichzeitig auch<br />
an stark traditionellen Strukturen fest. Der Dezentralisierungsprozess<br />
erweist sich als äußerst schwierig, ein Erfolg ist aber die Tatsache, dass<br />
heute mehr Entscheidungen als zuvor auf kommunaler Ebene getroffen<br />
werden.<br />
• Das lokale Wissen kann auch helfen menschliche Auswirkungen auf die<br />
Umwelt zu beschränken. Viele der heutigen „modernen“ Techniken sind<br />
nicht angepasst an die lokalen Gegebenheiten. Wichtig ist hier eine<br />
Bewusstseinsstärkung und die Hervorhebung der Vorteile lokalen Wissens.<br />
• Wissensvermittlung erfolgt bei PS durch das Aussprechen von<br />
Handlungsempfehlungen, Studien und Workshops, zu denen Politiker,<br />
Minister… eingeladen werden.<br />
• Ein aktuelles Forschungsprojekt ist die Erforschung des Einflusses des<br />
Handys auf das Festnetz. Das malische Festnetz kann die Bedürfnisse der<br />
Bevölkerung nicht stillen, da die Hauptanbieter überfordert sind.<br />
241
242<br />
Gleichzeitig wird erforscht wie das Handy unterschiedliche Formen des<br />
sozialen Miteinanders verändert.<br />
Verfasser: Lisa Trager, Melanie Kühl
Mittwoch, 25. Februar 2009<br />
10:00 Uhr Termin bei der Deutschen Gesellschaft für Technische<br />
Zusammenarbeit (GTZ) in Bamako<br />
• Empfang durch Dr. Michaela Braun Yao, technische Beraterin<br />
• Umweltpolitik <strong>Mali</strong>s: Ziel der GTZ ist es u.a. die Millenium Goals in <strong>Mali</strong><br />
umzusetzen. Diese waren zunächst eher sozial orientiert, mittlerweile liegt<br />
der Schwerpunkt auf Wirtschaft, Landwirtschaftsförderung, sowie auf<br />
Umweltthematiken. Die GTZ versucht den Gedanken an Umwelt in den<br />
nationalen Parteien durch strategische Umweltprüfungen zu fördern.<br />
Hauptaspekte sind hier erstens Fluss- und Wassermanagement und<br />
zweitens Forst.<br />
• Geberabstimmung: Ein großes Problem ist hier die Kanalisierung der<br />
Gelder. Es gibt zahlreiche Geber in <strong>Mali</strong> (z.B. Weltbank, UNO,<br />
europäische, chinesische, amerikanische Geber), die Gebergelder jedoch<br />
zu kanalisieren bedeutet einen sehr großen Verwaltungsaufwand. Um dies<br />
zu umgehen wurde die sogenannte SCAP (stratégie commune d’appui de<br />
paye) eingeführt, nach der sich auf maximal drei Sektoren konzentriert<br />
werden soll. Privilegierter Sektor ist hier vor allem die Agrarwirtschaft, das<br />
Thema Umwelt hat viel Aufmerksamkeit verloren durch diesen Prozess.<br />
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit wird sich nur noch bis 2011<br />
damit beschäftigen. Danach werden sich hauptsächlich die dänische und<br />
schwedische EZ mit dem Thema Umwelt beschäftigen, aber auch diese<br />
haben keine längerfristige Agenda. Das neueste Modethema ist<br />
Klimawandel, dementsprechend viele Gelder fließen hier.<br />
• Ein Problem in <strong>Mali</strong> ist, dass die nationalen Strukturen wenig<br />
zusammenarbeiten und jeder eher für sich kämpft. Ein Beispiel hierfür ist<br />
die nationale Forstbehörde, die in insgesamt drei Bereiche aufgeteilt<br />
wurde: 1) Landwirtschaft 2) Fischerei, Viehzucht 3) Umwelt. Durch den<br />
Dezentralisierungsprozess konnten kleine Infrastrukturverbesserungen<br />
ermöglicht werden, aber es fehlen weiterhin finanzielle Mittel um die<br />
laufenden Kosten zu decken. Eine Möglichkeit wäre eine Kopfsteuer der<br />
Gemeinden, dies ist aber sehr schwierig umzusetzen.<br />
• Bei einer Ausweitung der Reisproduktion in <strong>Mali</strong> stellt vor allem die<br />
spontane und willkürliche Landvergabe durch den Präsidenten ein Problem<br />
dar. Auch das Wassermanagement ist stark betroffen. Korruption und<br />
Skandale spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Verbesserung der<br />
Bewässerungsmethoden steht zwar bereits auf den Agenden, wichtig ist<br />
jedoch auch zu beachten, dass eine Ausweitung der Reisproduktion ein<br />
zusätzlicher CO2 Produzent wäre (durch Abholzung und Methangase).<br />
• Solarenergie und Photovoltaik sind häufig nur Thema in kleineren<br />
Projekten, das nationale Energieministerium beschäftigt sich eher mit<br />
Holzenergie. Probleme bei Solarenergie/Photovoltaik sind der Unterhalt der<br />
Anlagen und die Ausbildung der Betreiber.<br />
• Budgethilfe ist, anders als Projektfinanzierung, nicht an bestimmte<br />
Projekte, wohl aber an bestimmte Sektoren, gebunden. Voraussetzung<br />
hierfür sind eine klare Politik, Aktionspläne, sowie die Zusicherung der<br />
243
244<br />
Eigenkompetenz an die Länder. Dies wird jedoch stark kontrolliert durch<br />
harte Indikatoren.<br />
• Die Verkehrsinfrastruktur <strong>Mali</strong>s weist starke Mängel auf. Eine evtl. groß<br />
angelegte Budgethilfe durch die EU ist deswegen schwierig, da unklar ist<br />
auf welchen Verkehrssektor sich konzentriert werden sollte. Probleme des<br />
Eisenbahnverkehrs sind seine große Statik, dadurch entstehende<br />
mangelnde Flexibilität, sowie hohe Unterhaltskosten. Auch die Grenzen<br />
und eventuelle Grenzüberschreitungen sind für die Eisenbahnen<br />
komplizierter als für den Flugverkehr. Momentan sind jedoch Straßen der<br />
Favorit der Förderer.<br />
• Die Abstimmung in Umweltfragen mit den Nachbarländern ist bisher noch<br />
relativ begrenzt. Es existiert zwar die ABN (Authorité du bassin du Niger)<br />
mit einem zentralen Sitz in Niamé, welche die Abstimmung zwischen den<br />
Sahelländern regeln soll, jedoch bleibt es fraglich ob es über die politischen<br />
Debatten hinaus auch zur Umsetzung von Plänen kommt.<br />
Verfasser: Lisa Trager, Melanie Kühl