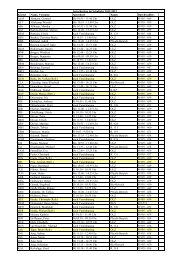UNTOLD FAMILY STORIES - Friedensschule Münster
UNTOLD FAMILY STORIES - Friedensschule Münster
UNTOLD FAMILY STORIES - Friedensschule Münster
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>UNTOLD</strong> <strong>FAMILY</strong> <strong>STORIES</strong><br />
Projektdokumentation<br />
Schüleraustausch <strong>Friedensschule</strong> <strong>Münster</strong><br />
und Gymnasia Realit Rishon LeZion<br />
im Schuljahr 2011/2012<br />
1
Für den Schüleraustausch mit Israel und für das umfassende Vorbereitungsprojekt<br />
Untold Family Stories erhielten wir vielfältige Unterstützung, auch finanzielle Reise-<br />
und Projektförderung.<br />
Besten Dank<br />
Schulleitung <strong>Friedensschule</strong> <strong>Münster</strong> und Gymnasia Realit Rishon LeZion, Fachlehrer der<br />
<strong>Friedensschule</strong>, die an der fächerübergreifenden Vorbereitung der Schüler beteiligt waren,<br />
Bistum <strong>Münster</strong>, Christiane Lösel – Stadt <strong>Münster</strong>, Sigi Winter und Christa Lindfeld<br />
– Förderverein Freunde für Rishon LeZion e.V., Schulamt der Stadt <strong>Münster</strong>, Ulrich Stein<br />
– Bezirksregierung Düsseldorf, Gottfried Böttger und Maike Retat-Amin – Pädagogischer<br />
Austauschdienst der Kultusminister-Konferenz Bonn, Landesprogramm NRW Kultur und<br />
Schule, Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen.<br />
<strong>Friedensschule</strong> <strong>Münster</strong><br />
Echelmeyerstr. 19<br />
48163 <strong>Münster</strong><br />
Tel. (02 51) 91 99 53<br />
Email: friedensschule-ms@bistum-muenster.de<br />
www.friedensschule.de<br />
Schulleiter Ulrich Bertram, Leitung Schüleraustausch mit Israel Marion Bathen-Reicher<br />
und Thomas Konnenmann, Projektleitung Untold Family Stories Benno Reicher.<br />
Impressum<br />
Gesamtkonzept und Redaktion: Benno Reicher<br />
Layout, Gestaltung: Christine von Burkersroda<br />
www.graphikdesign-vonburkersroda.de<br />
Übersetzung: Annette Hahn<br />
Druck: Druckerei Höhn, Laudenbach<br />
<strong>Münster</strong>, Juni 2012<br />
3
Benno Reicher, Projektleiter<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
4<br />
Laras Vater<br />
war schon vor über 30 Jahren, auch in seiner Schulzeit, in Israel. In ihrer <strong>UNTOLD</strong> <strong>FAMILY</strong><br />
STORY beschäftigt sich die Tochter mit seinen damaligen Erlebnissen. „Die Vorbereitung<br />
für die Reise war anstrengend“, schreibt Lara über die Fahrt ihres Vaters, „und dauerte<br />
ein volles Jahr.“ Auch die deutschen und die israelischen Schüler hatten mit dem<br />
bilateralen Schulprojekt <strong>UNTOLD</strong> <strong>FAMILY</strong> <strong>STORIES</strong> für den Schüleraustausch der <strong>Friedensschule</strong><br />
<strong>Münster</strong> mit dem Gymnasia Realit in Rishon LeZion im Schuljahr 2011/12<br />
umfassende Vorbereitungsarbeiten zu leisten. Ulrich Bertram, Leiter der <strong>Friedensschule</strong>,<br />
hatte in einem Gespräch mit seiner israelischen Kollegin Shosh Winter vor ein paar<br />
Jahren am Aasee in <strong>Münster</strong> die Vorstellung, dass die beiden Schülergruppen sich besser<br />
kennen lernen könnten, wenn sie miteinander arbeiten würden. Seine Idee regte mich an,<br />
dieses Projekt zu entwickeln und mit den Schülern durchzuführen. Dass eine Begegnung<br />
zwischen deutschen und israelischen Gruppen keine reine touristische Veranstaltung<br />
sein kann, das habe ich in vielen Jahren immer wieder erlebt. Dass die Vermittlung von<br />
Hintergründen hilft, das andere Land, die andere Kultur besser zu verstehen, ist einleuchtend.<br />
In diesem Projekt sollte durch den Austausch familiärer Hintergründe eine<br />
besondere Nähe, ein persönliches Interesse an dem anderen Austauschschüler angeregt<br />
werden. „Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte“, sagen die Israelis, und sind es nicht<br />
diese Menschen-Geschichten zusammen, die die „große Geschichte“ schreiben?<br />
Im März 2012 hat die Schülergruppe der <strong>Friedensschule</strong> gemeinsam mit ihren Lehrern<br />
Marion Bathen-Reicher und Thomas Konnenmann die Partnerschule in Rishon LeZion<br />
besucht und zum Abschluss des Projektes stand der Austausch der Familiengeschichten<br />
im Gymnasia Realit auf dem Programm. Lara übergab ihrem Austauschschüler Asaf die<br />
Geschichte mit den Israelerlebnissen ihres Vaters. Sie erhielt dafür von Asaf die Geschichte<br />
seiner Großeltern, die erst 1958 aus Rumänien nach Israel einwanderten. Gal,<br />
der israelische Partner von Carlotta aus <strong>Münster</strong>, schenkte ihr die Geschichte seiner Berliner<br />
Vorfahren, darunter auch ein bekannter Rabbiner, der seinem Sohn im Alter von 82<br />
Jahren 1909 einen Brief mit einem eindrucksvollen Segen schickte. Gal zitiert in seinem<br />
Text den Brief. Er endet mit dem Satz: „Ich hoffe, Gott wird mir noch viele Lebensjahre<br />
schenken und dass ich noch oft die Gelegenheit haben werde, gute Taten zu tun.“<br />
Für Carlotta war es nicht die erste Erfahrung mit internationalem Schüleraustausch.<br />
Etwa ein Schuljahr lang war sie bereits in den USA. Sie wusste, wie wichtig es ist, dass<br />
sich die jungen Menschen in der fremden Familie wohl fühlen. In ihrer <strong>UNTOLD</strong> <strong>FAMILY</strong><br />
STORY beschreibt sie dazu den familien-internen Diskurs. Jana aus <strong>Münster</strong> war in Israel<br />
Gast von Reut. Deren Großmutter, auch aus Deutschland, wurde in den vierziger Jahren<br />
in einem französischen Kloster versteckt und sie konnte sich so vor den Nazis retten.<br />
Reut schreibt über sie: „Heute ist Großmutter Dora 85 Jahre alt und ich finde nichts<br />
schöner, als bei ihr zu sitzen und ihre Geschichten zu hören.“ Auch Jana hört gerne<br />
ihrer Oma zu und in ihrer <strong>UNTOLD</strong> <strong>FAMILY</strong> STORY spielt die Oma eine wichtige Rolle.<br />
Sie möchte diese Geschichten festhalten und in ihrem Text stellt sie fest: „Es gibt keine<br />
bessere Zeitmaschine als Familiengeschichten.“<br />
Allen Omas und Opas, allen Onkeln und Tanten, allen anderen Familienmitgliedern, die<br />
unseren Austauschschülern diese spannenden Episoden aus ihrem Leben erzählt haben<br />
und sich geduldig interviewen ließen, möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich danken.<br />
Sie waren Mitwirkende in unserem Projekt, ohne dass wir uns kennen lernen konnten.<br />
Aber ich habe hier ja Ihre Geschichten.<br />
<strong>Münster</strong>, Juni 2012
Ich habe einen Traum,<br />
dass sich eines Tages deutsche und israelische Schüler nicht nur durch ihre gemeinsame<br />
Geschichte verbunden fühlen, sondern dass sich beide, Deutsche und Israelis, als gleichberechtigte<br />
Teile der globalen Familie verstehen. Das Projekt „Untold Family Stories“<br />
ist ein kleiner Schritt in diese Richtung. Schüler der <strong>Friedensschule</strong> <strong>Münster</strong> und des<br />
Gymnasia Realit Rishon LeZion stellen sich gegenseitig ihre Familiengeschichten vor. Und<br />
durch dieses Erzählen von Episoden der jeweiligen Lebensgeschichte können diese jungen<br />
Deutsche und jungen Israelis vielleicht verstehen, dass sie selbst und ihre Familien<br />
deutlich mehr verbindet, als dass sie trennt. Hoffnungen und Niederlagen, Visionen und<br />
Tragödien, Augenblicke der Freude und der Enttäuschung sind nicht nur Teil der gemeinsamen<br />
Geschichte unserer beiden Länder. Sie sind Teil jeder Familiengeschichte im<br />
Verlauf vieler Generationen. Wir haben vergleichbare Werte und gehen auf vergleichbaren<br />
Wegen durch unsere Lebensjahrzehnte. Neben diesem erzieherischen Aspekt können<br />
beide Schulen jedoch hoffentlich auch auf Dauer als schulische Organisation von diesem<br />
Projekt profitieren. In der Hoffnung, dass sich die nun über 30-jährige Tradition unseres<br />
gemeinsamen Austausches auch in der Zukunft fortsetzt, können diese „Familiengeschichten“<br />
auch ein Teil unserer Schulgeschichte werden.<br />
Von Herzen danke ich Shosh Winter, Haya Arbeitman und Erez Amit dafür, dass sie dieses<br />
Projekt von Anfang an unterstützt und zum verpflichtenden Teil unseres gemeinsamen<br />
Austauschprogrammes gemacht haben.<br />
Zu großem Dank bin ich unseren beiden Lehrkräften Marion Bathen-Reicher und Thomas<br />
Konnemann verpflichtet. Mit besonderem Zeiteinsatz und viel Energie, die ein solches<br />
Projekt erfordert, haben sie die Schüler auf diesen Austausch vorbereitet. Ich danke<br />
ihnen besonders dafür, dass sie dieses Projekt trotz mancher „Diskussionen“ zu einem<br />
verpflichtenden Teil unseres Austauschprogrammes gemacht haben. Jede Neuerung stößt<br />
zunächst auf Zurückhaltung oder Widerstand und es erfordert Rückgrat und Kraft, den<br />
Schülern den Wert dieses Projektes vor Augen zu führen. Die wesentliche Projektarbeit<br />
lag in den Händen von Herrn Benno Reicher. Er entwickelte die Projektidee und begleitete<br />
die Arbeit der Schüler. Die Realisation des Projektes verdanken wir seinem journalistischen<br />
Können, seiner Kenntnis der Geschichte und Kultur Israels und seinem großen<br />
Einsatzwillen. In der Zusammenarbeit mit den Schülern wurde seine Geduld mehr als<br />
einmal auf die Probe gestellt. Ich bin dankbar, dass er durchgehalten und dieses Projekt<br />
zu einem guten Ende geführt hat.<br />
Mein abschließender Dank geht an unsere Schüler und Schülerinnen. Sie hatten anfangs<br />
Schwierigkeiten mit der neuen Aufgabe und mussten lernen, mit dieser Herausforderung<br />
umzugehen. In einem letztendlich fruchtbaren Prozess intensiver Diskussionen und<br />
Überlegungen haben sie schließlich den Stellenwert und die Bedeutung dieses Projektes<br />
für sich selbst und auch für die Schule als Ganzes verstanden.<br />
Ich träume immer noch davon, dass dieses Projekt der „Untold Family Stories“ zu einem<br />
festen, akzeptierten Bestandteil unseres Israel-Austauschprogramms wird und dass die<br />
zukünftig teilnehmenden Schüler und Schülerinnen und deren Eltern sowie alle, die sich<br />
für diesen wunderbaren Austausch einsetzten, das Potential dieses Projektes verstehen<br />
werden.<br />
Ulrich Bertram, Schulleiter<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
5
Marion Bathen-Reicher, Lehrerin<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
6<br />
Dieser Schüleraustausch 2011/12<br />
ist für mich etwas Besonderes, denn er war erstmals an das Projekt <strong>UNTOLD</strong> <strong>FAMILY</strong><br />
<strong>STORIES</strong> gekoppelt. Die Idee, einander Familiengeschichten zu schenken, begleitete den<br />
gesamten Austausch von der Vorbereitung bis zum letzten Tag der Begegnung in Israel,<br />
an dem alle Schüler ihre mitgebrachten Geschichten im Gymnasia Realit vorstellten<br />
und verschenkten. Wenn auch die Erarbeitung der Geschichten oft recht mühsam und<br />
langwierig war, so war die Übergabe der englischen Fassung in Rishon LeZion doch ein<br />
bewegender Moment, dessen Bilder bis heute in mir nachwirken. Ich bedanke mich bei<br />
allen, die dieses Projekt wohlwollend und aktiv begleitet und unterstützt haben, auch bei<br />
den Interviewpartnern, die es den Schülern und Schülerinnen erst möglich gemacht haben,<br />
ihre Geschichten zu schreiben.<br />
Im Oktober 2011 begegneten sich beide Gruppen zum ersten Mal<br />
Wir trafen uns in Düsseldorf. Auf einer Rheintour mit Open-air-Picknick an Bord wurden<br />
den jungen Israelis erste Eindrücke des herbstlichen Deutschlands geboten und erste<br />
Kontakte zwischen den deutschen und israelischen Schülern wurden geknüpft. <strong>Münster</strong><br />
zeigte sich in diesen Tagen eher von der regnerischen Seite, aber die von unseren Schülern<br />
vorbereitete Stadtführung hatte auch bei Regen ihren Reiz. Die Kunstausstellung HEIMAT<br />
in der Stadthausgalerie, ein deutsch-israelisches Projekt, regte uns zum gemeinsamen<br />
Nachdenken an. Auch hier stellt sich für mich eine Verbindung zum Projekt <strong>UNTOLD</strong> FAMI-<br />
LY <strong>STORIES</strong> her. Weitere Anregungen für alle Schüler in Form von Interviews und Diskussionen<br />
folgten in den gemeinsamen Projekttagen an der <strong>Friedensschule</strong>. Ein Höhepunkt<br />
für beide Gruppen war wie immer die Tour nach Berlin. Wir hatten Glück, denn in diese<br />
Zeit fiel auch das Festival of Lights, das Berlin nachts in ungewöhnlichen Farben erstrahlen<br />
ließ. Auf der Hinfahrt besuchten wir die Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz<br />
und auf der Rückfahrt das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Die Israelis hatten eine<br />
sehr persönliche Zeremonie vorbereitet. Abwechselnd lasen beide Gruppen Auszüge aus<br />
dem Tagebuch der Anne Frank und sangen gemeinsam „Imagine“ von John Lennon. Dieses<br />
hebe ich hervor, weil es meiner Meinung nach ein besonders wichtiges gemeinsames und<br />
nachhaltiges Erlebnis war.<br />
Im März 2012 flogen wir dann nach Israel<br />
Die Eindrücke dort waren für unsere Schüler großartig und teilweise überwältigend. Ich<br />
werde nur einige Blitzlichter darauf werfen. Mit einem kleinen Festmahl aus Falafel,<br />
Humus, Pita und Burekas empfingen uns die israelischen Schüler in ihrer Schule. Auch<br />
jetzt hatten wir Glück, denn wir durften das jüdische Purimfest miterleben, eigentlich ein<br />
religiöses Fest, das aber mittlerweile eher unserem deutschen Karnevalsfest gleicht. Wir<br />
waren darauf vorbereitet, hatten Kostüme mitgebracht und bereicherten das bunte Treiben<br />
in der Schule und auch das nahe gelegene Tel Aviv, das wir anschließend besuchten. Hier<br />
erlebten unsere Schüler erstmals einen orientalischen Markt, den Schuk ha-Carmel. In den<br />
folgenden Tagen durften wir das kleine Land Israel vom Süden bis zum Norden kennen lernen.<br />
So wanderten wir in der Negev-Wüste durch den bunten Sand eines alten Canyons,<br />
in dem es aufgrund des feuchten Winters allerlei Pflanzen zu bestaunen gab. Zum Schluss<br />
nahmen wir noch ein salziges Bad im Toten Meer. Die zweitägige Tour in den Norden<br />
führte uns vorbei an den „Hängenden Gärten“ der Bahai in Haifa, durch Daliat al-Carmel,<br />
einem Dorf der Drusen, anschließend durch Nazareth und entlang des Sees Genezareth,<br />
bis wir die Golanhöhen erreichten, die zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich grün und feucht<br />
wirkten. Bei diesem Anblick jubelten die Israelis, da Wasserknappheit ein schwerwiegendes<br />
Problem in ganz Israel ist. Danach freuten sich alle auf Jerusalem.<br />
Zuvor besuchten wir die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Nicht nur die ausgefallene,<br />
symbolträchtige Architektur faszinierte die Schüler, sondern vor allem die Art und Weise,<br />
wie hier jedem einzelnen Menschen, jedem Opfer, gedacht wird, anstatt nur Zahlen zu<br />
nennen. Bevor wir die Altstadt erkunden konnten, blickten wir auf die Hügel Jerusalems<br />
und konnten unseren Guide über die Geschichte und die politische Situation dieser Stadt<br />
ausfragen. Die Klagemauer, dieser ganz besondere Schauplatz jüdischer Geschichte, begeisterte<br />
die Schüler besonders, sie sahen orthodoxe Juden neben säkularisierten Israelis,<br />
Touristen neben jungen israelischen Soldaten. Fast alle, so auch wir, steckten Zettel mit<br />
einem Wunsch in die Mauer. Am letzten Tag unserer Reise nahmen wir noch am Englischunterricht<br />
unserer Austauschschüler teil und alle Partner tauschten schließlich ihre ganz<br />
persönlichen Familiengeschichten im Auditorium der Schule aus.
„We will see us again”, darüber sind sich alle einig. Das zeigte sich am Farewell-Abend<br />
unter Zitronenbäumen und auch beim Abschied am Bus, der uns zum Flughafen Ben<br />
Gurion bringen sollte. Unsere israelischen Freunde winkten uns nach und rannten neben<br />
dem anfahrenden Bus her, bis wir außer Sichtweite waren.<br />
Ich freue mich über diesen gelungenen Austausch, den ich gemeinsam mit meinem<br />
Kollegen Thomas Konnemann vorbereitet und durchgeführt habe. Nur mithilfe der<br />
freundlichen und tatkräftigen Unterstützung unseres Schulleiters Ulrich Bertram, unserer<br />
Englischlehrer des 12. Jahrgangs und des Projektleiters Benno Reicher sowie durch das<br />
Engagement der israelischen Kollegen Haya Arbeitman und Erez Amit und deren Schulleiterin<br />
Shosh Winter konnte dieses Austauschprojekt so erfolgreich werden.<br />
Seit 1976 führen das Gymnasia Realit<br />
in Rishon LeZion und die <strong>Friedensschule</strong> <strong>Münster</strong> im Rahmen der Städtepartnerschaft<br />
Schülerbegegnungen durch.<br />
Untold Family Stories ist ein innovatives gemeinsames Projekt, das mit dem Austausch<br />
dieses Schuljahres 2011/12 begonnen wurde. Die Idee zu diesem besonderen Projekt<br />
stammt von Benno Reicher, der überzeugt ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler der<br />
Austauschpartnerin oder dem Austauschpartner eine interessante Familiengeschichte<br />
erzählen kann.<br />
Die Arbeit an und mit diesen Geschichten hat das Band zwischen beiden Gruppen gestärkt<br />
und gleichzeitig dazu beigetragen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schreiben<br />
und Recherchieren üben und verbessern.<br />
Jetzt, nachdem der Austausch beendet ist, freuen wir uns, ein einzigartiges Mosaik aus<br />
faszinierenden Geschichten präsentieren zu können, das die Vielfalt der Menschen, Völker<br />
und Kulturen aufzeigt.<br />
Wir danken den Schulleitern Dr. Shosh Winter und Ulrich Bertram für ihre Unterstützung,<br />
Benno Reicher für die Initiative zu diesem Projekt und dessen Begleitung sowie Marion<br />
Bathen-Reicher und Thomas Konnemann für ihren engagierten Einsatz. Unser Dank gilt<br />
nicht zuletzt auch allen Schülerinnen und Schülern für ihre harte Arbeit und für ihre<br />
Mühe.<br />
Haya Arbeitman und Erez Amit<br />
Gymnasia Realit,<br />
Rishon LeZion<br />
7
Ein Projekt der <strong>Friedensschule</strong><br />
<strong>Münster</strong> von Benno Reicher<br />
8<br />
Untold Family Stories<br />
In diesem innovativen literarischen Projekt beschäftigen sich die Austauschschüler mit<br />
der eigenen Familiengeschichte. Sie recherchieren, machen Tonband-Interviews mit Mitgliedern<br />
ihrer Familie, sie verschriftlichen die Geschichten und bringen sie nach abschließender<br />
redaktioneller Bearbeitung in eine eigene literarische Form.<br />
Durch die Arbeit in der Gruppe, durch die eigene Schülerarbeit, individuell betreut durch<br />
den Projektleiter, durch das Nebeneinander von unterschiedlichen Geschichten entsteht<br />
ein sehr differenziertes Bild von Zeitgeschichte, an der die Eltern- und Großelterngenerationen<br />
beteiligt waren und sind, ergänzend zur allgemeinen Zeitgeschichte. Und die<br />
Alltags- und Sozialgeschichte der eigenen Familie wird ein wichtiger Bestandteil der<br />
eigenen Rezeption von Zeitgeschichte.<br />
Das Projekt <strong>UNTOLD</strong> <strong>FAMILY</strong> <strong>STORIES</strong> ist in die langjährige Schulpartnerschaft der <strong>Friedensschule</strong><br />
mit dem Gymnasia Realit in Rishon LeZion/Israel eingebunden und wird gemeinsam<br />
mit der Partnerschule durchgeführt, denn auch die israelische Gruppe schreibt<br />
ihre Familiengeschichten. Durch diese binationale Zusammenarbeit wird der eigene<br />
kulturelle, historische und alltagsgeschichtliche Erfahrungsraum um völlig neue interkulturelle<br />
und sprachliche Aspekte erweitert. Generell orientiert sich der Schüleraustausch<br />
der <strong>Friedensschule</strong> an begegnungspädagogischen, statt an touristischen Aspekten.<br />
Zum Abschluss des Projektes bringen die deutschen Schüler ihre auf Englisch übersetzten<br />
„literarischen“ Produkte nach Israel und übergeben sie dort auf einer Schulveranstaltung<br />
ihren Gastfamilien, im Austausch mit den Familiengeschichten ihrer israelischen Freunde.<br />
Die notwendige Offenheit gegenüber der fremden Geschichte setzt durch das Projekt<br />
erworbene interkulturelle Kompetenzen voraus.<br />
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf: www.friedensschule.de<br />
Die hier dokumentierten deutschen und israelischen Familiengeschichten basieren auf<br />
persönlichen Erinnerungen und Ansichten der beteiligten Personen. Sie sind Teil „erlebter<br />
Geschichte“, manchmal über Generationen tradiert, und sie müssen keinen wissenschaftlichen<br />
Ansprüchen genügen. Ein klärender Diskurs zu historisch nicht belegten<br />
Darstellungen war aber innerhalb der deutsch-israelischen Gruppe möglich. Neben den<br />
Familiengeschichten hatten die israelischen Schüler noch die Aufgabe, ihre persönlichen<br />
Gedanken zu Israel darzustellen.
Israel vor 30 Jahren<br />
Natürlich hat mich interessiert, was meine Familie mit dem jüdischen Glauben und dem<br />
Staat Israel verbindet. Während des Nationalsozialismus galt mein Großvater als Halbjude,<br />
weil sein Vater eine jüdische Großmutter hatte. Ich habe daher meinen Vater befragt,<br />
der ja schließlich nach der Terminologie der Nazis Vierteljude ist.<br />
Mein Vater ist 1961 geboren, das sind nur 16 Jahre, nachdem die Juden aus den Konzentrationslagern<br />
befreit wurden. Als Leistungskurs hat mein Vater Geschichte gewählt<br />
und daher die Geschehnisse während des Nationalsozialismus schon in der Schule sehr<br />
intensiv verfolgt. Es war für ihn somit klar, dass er nach Israel reisen und die Spuren,<br />
die der Nationalsozialismus dort hinterlassen hat, verfolgen wollte. Der Leistungskurs<br />
Geschichte wurde von einem Lehrer gehalten, der zugleich Religion unterrichtete. Dieser<br />
bot im Jahr 1980 einem ausgewählten Kreis an Schülern an, nach Israel zu reisen, dort<br />
zunächst in einem Kibbuz zu arbeiten und danach herumzureisen. So wurden mehrere<br />
Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits war es eine Aufarbeitung der Geschichte,<br />
andererseits das Erleben des israelischen Staates und nicht zuletzt die Erfahrung im Kibbuz,<br />
in dem eine vollständig andere Gesellschaftsordnung, auf sozialistischen Prinzipien<br />
beruhend, besteht. Die Vorbereitung für die Reise war anstrengend und dauerte ein volles<br />
Jahr. In dieser Zeit trafen sich die Teilnehmer zweimal die Woche für je zwei Stunden, um<br />
den geschichtlichen Hintergrund zu vertiefen, bisher nicht Bekanntes über den israelischen<br />
Staat und insbesondere über die Kibbuz-Idee zu erfahren. Es sollte sich später<br />
herausstellen, dass diese lange Zeit angemessen und die Beschäftigung mit den Themen<br />
durchaus hilfreich war.<br />
Die Arbeit in einem Kibbuz bot die Gelegenheit, Israel nicht nur als Tourist kennen zu<br />
lernen, sondern die Möglichkeit zu bekommen, das Land als besonderen Teil der israelischen<br />
Gesellschaft erleben. Der Kibbuz, in dem die Gruppe meines Vaters arbeitete, liegt<br />
nordöstlich von Tel Aviv und heißt Nir Eliyahu (www.nirel.org.il). Der Betrieb bewirtschaftet<br />
eine Zitrusfrüchte-Plantage, mehrere Erdnussfelder, eine Hühneraufzucht-Station<br />
und, zum Erstaunen aller, eine Fabrik, die Plastiktüten (auch für den deutschen Markt)<br />
herstellte.<br />
Die Idee dieses Kibbuz besteht darin, auf einem großen Areal ohne soziale und materielle<br />
Unterschiede gemeinschaftlich zu arbeiten und zu leben. Dabei steht alles, was durch<br />
die Kibbuznikim, so nennt man die Bewohner, erwirtschaftet wird, nicht dem Einzelnen<br />
zu, sondern dem Kibbuz als Ganzem. Ein von allen gewählter Rat entscheidet über die<br />
Verwendung der erwirtschafteten Mittel. Eigentum gibt es nur an den Einrichtungsgegenständen<br />
in den Häusern selbst. Autos dagegen werden durch den Kibbuz angeschafft<br />
und den Kibbuznikim bei Bedarf zur Verfügung gestellt.<br />
Ein Teil des Gemeinschaftsgedankens besteht darin, die Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen.<br />
Für die Arbeit meines Vaters, der abwechselnd in allen Bereichen tätig war,<br />
wurde durch den Kibbuz kein Lohn gezahlt, es gab nur freie Kost und Logis. Mein Vater<br />
und seine Mitreisenden wurden zusammen in sehr spartanischen Unterkünften untergebracht.<br />
Mit dem einfachen Leben und der gleichen Behandlung aller hatten insbesondere<br />
junge Kibbuznikim auch Schwierigkeiten. Viele zogen daher zunächst aus dem Kibbuz<br />
aus, die Mehrzahl kam jedoch wieder zurück, nachdem sie eine Familie gegründet hatten.<br />
Der Bildungsstand in Nir Eliyahu war beeindruckend. 90% der Einwohner hatten einen<br />
dem Abitur vergleichbaren Abschluss und 80% einen Hochschulabschluss. Da dies in<br />
anderen Kibbuzim ähnlich war, waren zum Zeitpunkt des Besuches meines Vaters, in der<br />
Knesset, dem Israelischen Parlament, nach seiner Erinnerung, die Mehrzahl der Mitglieder<br />
Kibbuznikim. Abschließend betrachtet ist mein Vater froh und stolz, ein trotz aller<br />
Schwierigkeiten bestehendes und gut funktionierendes sozialistisches System mit echter<br />
Gleichheit erlebt zu haben.<br />
Die Erlebnisse in Israel waren insgesamt prägend. Es gab eine mehrtägige Tour mit einer<br />
Gesellschaft, die „Society for Protection of Nature“ hieß. Zu diesem Zeitpunkt war die<br />
Sinai Halbinsel erst zur Hälfte an Ägypten zurückgegeben, so dass die Ausflüge bis zu<br />
dem Katharinenkloster reichen konnten. Ebenso beeindruckend waren das Rote und das<br />
Tote Meer. Dagegen war der Anblick des Flusses Jordan enttäuschend, der entgegen der<br />
biblischen Bedeutung eher ein Rinnsal ist. Die massive Abriegelung des Staates zum<br />
Norden, in Richtung des Libanon, war ein bildliches Zeichen für den in der Region bis<br />
Lara<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
9
10<br />
heute herrschenden Konflikt. Dass es nicht gelingt, diesen nach Jahrzehnten endlich zu<br />
beenden, war und ist für meinen Vater ebenso unverständlich wie desillusionierend.<br />
Es hat Situationen gegeben, in denen die Gruppe meines Vaters von älteren Menschen<br />
teilweise auf Deutsch angesprochen wurde. Meinem Vater ist besonders in Erinnerung,<br />
dass ein älterer Mann erst nach einem längeren Gespräch beiläufig die Ärmel seines<br />
Hemdes aufkrempelte und auf der Unterseite seines rechten Armes eine tätowierte<br />
Nummer sichtbar wurde. Dies konfrontierte die Deutschen damit, dass der Mann Gefangener<br />
in einem Konzentrationslager gewesen war. Die Tatsache des Ansprechens und<br />
die Freundlichkeit und Offenheit des Mannes haben meinen Vater und die anderen sehr<br />
beschämt und anschließend zu langen Auseinandersetzungen geführt.<br />
Ein ähnliches Gefühl erlebte die Gruppe meines Vaters in der Holocaust-Gedenkstätte<br />
Yad Vashem. Während sich auf der Hinreise alle noch fröhlich unterhalten hatten, erstarben<br />
schon in der Gedenkstätte alle Worte.<br />
Das lag daran, dass sämtliche mit diesem unsäglichen Leid verbundenen und diesen<br />
zugeordneten Dokumenten auf Deutsch verfasst waren. Für meinen Vater war dies die<br />
körperliche Konfrontation mit der Tatsache, dass das Volk, zu dem er gehört, die furchtbarsten<br />
Verbrechen begangen hatte. Diese Erfahrung hat sich tief bei meinem Vater<br />
eingeprägt und bestimmt bis heute seinen Umgang mit dem Thema. Die letzten zwei<br />
Tage waren einem Besuch am Strand in Tel Aviv gewidmet. Da die Reise im November<br />
stattfand, war es erstaunlich, dort Badetemperaturen vorzufinden. Nach der spartanischen<br />
Unterkunft im Kibbuz und den Nächten im Schlafsack in der Wüste während der<br />
Exkursion waren ein komfortables Bett, ein sauberes WC und eine warme Dusche ein<br />
echter Luxus.<br />
Zusammenfassend meint mein Vater, sein Aufenthalt in Israel sei ein echtes Abenteuer<br />
gewesen und eine prägende und bleibende Erfahrung. Ein derartiger Besuch ermöglicht<br />
es, auf den Spuren der Bibel zu wandeln, deutsche Geschichte zu begreifen, ein wunderschönes<br />
Land zu entdecken und einem aktuellen Konflikt näher zu kommen, der keine<br />
weiteren Opfer duldet und endlich gelöst werden muss.<br />
Asaf Von Rumänien über Italien nach Israel<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
Mein Großvater Michael und meine Großmutter Esther väterlicherseits stammen aus<br />
sehr großen Familien. Beide verloren den Großteil ihrer Familien durch den Holocaust.<br />
Danach lebten sie in Timioara (Rumänien) und lernten sich dort kennen. Sie heirateten<br />
und zwei Jahre später wurde mein Onkel geboren, und sechs Jahre später (1951) mein<br />
Vater.<br />
1958 beschlossen sie, nach Israel zu gehen. Sie wollten dort hinziehen, weil auch ihre<br />
Familien dort hingingen. Sie reisten über Wien nach Neapel und dann per Schiff nach<br />
Haifa. Von dort kamen sie nach Rishon LeZion und ließen sich dort nieder. Mein Vater<br />
verbrachte hier seine Kindheit und lernte dann später meine Mutter kennen.<br />
Mein Großvater eröffnete eine Schneiderei für Herrenanzüge und meine Großmutter<br />
arbeitete als Krankenschwester in einem Krankenhaus. Mein Großvater starb 1975 an<br />
einem Herzinfarkt. Meine Großmutter heiratete erneut, einen Mann namens Ephraim. Sie<br />
starb 1989 an einem Herzinfarkt.<br />
Mein Großvater Shimon und meine Großmutter Betty mütterlicherseits wurden in Suceava<br />
(Rumänien) geboren. Sie waren mit ihren Familien von den Nazis nach Transnistrien,<br />
heute Ukraine, in ein Arbeits- und Konzentrationslager gebracht worden, wo sie Hunger,<br />
schlechter Hygiene und Krankheiten ausgesetzt waren. 1944 wurden sie befreit und<br />
kehrten in ihre Heimatstadt zurück. Shimons Bruder und Bettys Schwester heirateten<br />
und so lernten meine Großeltern sich kennen. Sie heirateten 1946. Ein Jahr später wurde<br />
mein Onkel geboren und fünf Jahre später (1952) meine Mutter. Im Jahr 1965 beschlossen<br />
sie, nach Israel auszuwandern.<br />
Sie reisten über Wien nach Neapel und von dort per Schiff nach Haifa. Sie ließen sich<br />
in Rishon LeZion nieder. Beide arbeiteten in ihren verschiedenen Berufen sehr hart, um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mein Großvater starb 1970 an einem Hirnschlag.<br />
Meine Großmutter heiratete 1977 ihren zweiten Mann Abraham. Meine Eltern lernten<br />
sich kennen und so entstand meine Familie. Sie brachten meine zwei Schwestern, Keren<br />
und Shirley, meinen Bruder Michael und mich zur Welt.<br />
Für manche Menschen ist Israel ein winziges Land irgendwo in Nahen Osten. Für mich<br />
bedeutet es viel mehr. Ich finde, Israel ist ein wunderschönes und einzigartiges Land, das<br />
viele Besonderheiten hat.<br />
Bei den Israelis besteht untereinander eine ganz besondere Verbindung. Auch wenn ihr<br />
Verhalten manchmal als grob angesehen wird, so stehen meistens doch gute Absichten<br />
dahinter.<br />
Ein weitere Aspekt sind die Errungenschaften in den Bereichen Naturwissenschaften,<br />
Computer und anderen Technologien. Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es in Israel<br />
sehr viele erfolgreiche Wissenschaftler und Erfinder. Aus Israel stammen viele Neuerungen<br />
und Erfindungen für die ganze Welt.<br />
Für mich ist Israel viel mehr als ein Land. Es ist meine Heimat.<br />
Von Berlin nach Tel Aviv<br />
Die Familie Tworoger war eine der bekannten jüdischen Familien in Berlin und lebte dort<br />
seit vielen Jahren. Hugo Tworoger und seine Frau hatten drei Kinder. Die jüngste Tochter<br />
hieß Flora. Als Flora größer wurde, lernte sie in Berlin einen jungen Mann kennen, Max<br />
Loewy.<br />
Max Loewy stammte nicht aus Berlin. Er kam am 25. Juni 1870 als Sohn von Wolff und<br />
Rosalie Loewy in Kreuzburg zur Welt. (Kreuzburg war früher in der deutschen Provinz<br />
Ostpreußen, heute gehört die Ortschaft zu Russland und heißt Slawskoje.)<br />
Nachdem sie einige Zeit miteinander ausgegangen waren, heirateten Max und Flora im<br />
Jahr 1898. Sie bekamen zwei Töchter, die beide in Berlin geboren wurden: Johana Hana,<br />
geboren am 16. Dezember 1900, und Rosalie Ruth, geboren am 29. Dezember 1902.<br />
Wolff Loewy (der Vater von Max) war ein berühmter Rabbi. Mit 82 Jahren, im November<br />
1909, schrieb er Max und Flora einen Brief auf Hebräisch und auf Deutsch. Darin steht<br />
ein Zitat aus dem berühmten 15. Kapitel des Buches der Psalmen (Tehilim), in dem die<br />
guten Eigenschaften und das Verhalten eines Menschen beschrieben werden, der erwählt<br />
ist, im Heiligen Tempel zu wohnen. Der Brief enthält auch folgenden Segen:<br />
„Mit dem Schreiben dieses Briefes erfülle ich den Wunsch meines geliebten Sohnes, Gott<br />
schenke ihm ein langes Leben, stets meine Handschrift in seinem Hause zu sehen. Ich<br />
danke Gott, dass ich ein langes Leben führen durfte und ein hohes Alter erreicht habe<br />
(ich bin nun zweiundachtzig). Ich hoffe, Gott wird mir noch viele Lebensjahre schenken<br />
und dass ich noch oft die Gelegenheit haben werde, gute Taten zu tun.“<br />
Ruth Loewy lebte gern in Berlin. Als sie älter wurde, lernte sie einen Mann namens Alfred<br />
Avraham Ordo kennen, und im Jahr 1931 heirateten die beiden. Ein Jahr später, 1932,<br />
bekamen sie eine Tochter, die sie Judith Flora nannten, nach Ruths Mutter Flora Loewy,<br />
die 1927 gestorben war. Als Hitler Anfang 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde und<br />
der Antisemitismus immer stärker wurde, bekamen Ruth und Avraham (glücklicherweise)<br />
das Gefühl, ihr Heimatland Deutschland verlassen zu müssen. Die einzige Alternative, die<br />
ihnen dazu einfiel, war das Land Israel, damals auch als Palästina bekannt. Ende 1934<br />
zog zunächst Avraham nach Israel, um die notwendigen Vorbereitungen für die Einreise<br />
der restlichen Familie zu treffen (ein Haus finden, Arbeit usw.). Später, im Jahr 1935,<br />
kamen Ruth und Judith dann nach.<br />
Als sie Berlin verließ, musste Ruth die lange Geschichte ihrer Familie dort hinter sich<br />
lassen. Sie musste das Grab ihrer Mutter Flora Loewy und das ihres Großvaters Hugo<br />
Tworoger (Floras Vater) zurücklassen. Beide waren auf dem alten Friedhof von Berlin begraben.<br />
Deutschland zu verlassen und nach Israel auszuwandern, war für die Ordos nicht<br />
Gal<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
11
Ruth Ordo und ich mit 4 Monaten<br />
Carlotta<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
12<br />
einfach, nicht nur in emotionaler Hinsicht. Zu der Zeit mussten Juden, um Deutschland<br />
zu verlassen, eine Bescheinigung der Nazi-Polizei erhalten. Und um in Israel einreisen zu<br />
dürfen, mussten sie eine Bescheinigung der britischen Regierung erhalten, die damals<br />
das Land regierte.<br />
1936, ein Jahr, nachdem Ruth zu Avraham nach Israel gekommen war, wurde ihre Sohn<br />
Gideon geboren. Er ist mein Großvater, der Vater meines Vaters. Er starb, bevor ich geboren<br />
wurde, und ich wurde nach ihm benannt (mein voller Name lautet Gal Gideon).<br />
Der Brief aus dem Jahr 1909, den Wolff Loewy an Max und Flora Loewy geschrieben<br />
hatte, hing viele Jahre lang im Haus meiner Urgroßmutter Ruth Ordo. Als Ruth starb,<br />
hinterließ sie den Brief meinem Vater. Jetzt hängt der Brief an einem besonderen Platz in<br />
unserem Haus und mein Vater ist sehr stolz, ihn zu besitzen.<br />
Israel ist mein Heimatland. Es ist das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin.<br />
Es ist ein faszinierendes, einzigartiges Land, voller Widersprüche. Israel ist ein kleines<br />
Land, aber sehr stark; es bekämpft den Terror und strebt nach Frieden; es ist ein relativ<br />
junges Land, hat aber in vielen Bereichen viel erreicht, etwa in High-Tech und Technologie<br />
auf der einen und Kultur und Landwirtschaft auf der anderen Seite. Israel ist ein<br />
Land mit einer langen, ereignisreichen Geschichte, einer komplizierten Gegenwart und<br />
einer hoffentlich viel versprechenden Zukunft. Es ist ein Land, in dem alle Menschen vor<br />
dem Gesetz gleich sind, und es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Aus all diesen<br />
Gründen und noch vielen anderen liebe ich Israel und bin stolz, Israeli zu sein.<br />
Reibeplätzchen mit Rübenkraut<br />
In weniger als einer Woche sollte Gal als Gastschüler in unserer Familie wohnen. Unser<br />
neues Familienmitglied, ein Junge aus Israel, hatte sich in den letzten Tagen zu einem<br />
wichtigen Gesprächsthema entwickelt. Dabei stießen wir immer wieder auf Fragen sowohl<br />
organisatorischer als auch sozialer Art. Zum Glück verfügt mein Vater über ein großes<br />
Know-How im Bereich des Austausches, da er sich im Alter von 16 Jahren entschied,<br />
für ein Jahr seine Familie und seine gewohnte Umgebung zurückzulassen. Ausgestattet<br />
mit etwas brüchigem Schulenglisch, begab er sich auf ein großes Abenteuer: ein Jahr<br />
Schüleraustausch in Indiana, USA. Noch heute glänzen seine Augen, wenn er von seinen<br />
„ersten Schritten auf amerikanischem Boden“ berichtet und sich an den „riesigen“ Empfang<br />
bei seiner Ankunft am Flughafen erinnert. Daher hatte er viele gute Ideen, als wir<br />
über eine geeignete Begrüßung für unseren baldigen Gast Gal diskutierten.<br />
Für uns alle stand fest, dass wir unserem Gast eine angenehme Zeit machen wollten und<br />
er sich bei uns wohl fühlen sollte. „Ich weiß noch, dass wir auf dem Weg vom Flughafen<br />
nach Hause in einem typischen American Steakhouse zu Abend aßen. Da wusste ich:<br />
Jetzt ist es real, ich bin in den USA“, erzählte mein Vater. Ein typisches deutsches Abendessen<br />
schien uns allen eine gute Idee. Doch schon standen wir vor der nächsten Frage:<br />
Was ist typisch deutsch?<br />
„Na, erinnere dich doch mal zurück! Vor kurzem warst du in den USA. Was hast du dort<br />
nicht bekommen, was für dich vorher zum Alltag gehörte?“, fragte mein Vater. Da hatte<br />
er Recht. Letzten Sommer war ich es, die sich entschied, in die Spuren ihres Vaters zu<br />
treten. Zum einen begeistert durch seine authentischen Berichte, zum anderen durch den<br />
Wunsch, etwas Neues kennen zu lernen und ein Jahr „ganz alleine“ zu meistern, nahm<br />
ich an einem einjährigen Austausch teil. Ebenfalls in den USA. Nach kurzem Grübeln fiel<br />
es mir ein: Reibeplätzchen mit Rübenkraut! Das gab es einfach nirgendwo, damit sollten<br />
wir Gal begrüßen!<br />
Sowohl meine noch nicht allzu lang zurückliegenden Erinnerungen als auch die im Laufe<br />
der Jahre reflektierten Erfahrungen meines Vaters dienten nun als Grundlage unserer<br />
Ideen. Wir überlegten, wie wir uns in den ersten Tagen unseres Austausches gefühlt<br />
hatten, durch welche Gesten unserer Gastgeber wir uns willkommen und aufgehoben<br />
fühlten.<br />
Zunächst mussten aber auch organisatorische Dinge geklärt werden. Wie würden wir die<br />
Orte des doch sehr komplexen Programms erreichen? Für mich eingefleischten Münste-
aner war die Sache klar - natürlich mit dem Fahrrad! Doch nach dem ersten Kontakt mit<br />
Gal sollte sich herausstellen, dass mein Austauschschüler es vorzog, weder Roller noch<br />
Fahrrad zu fahren. Ich erinnere mich, dass gerade der zweite Punkt bei einem wie mir auf<br />
großes Unverständnis stieß. Kein Fahrrad fahren wollen? Wie ist das nur möglich? Ich<br />
beschloss, die Fahrradfahrfähigkeiten meines Gastes nach seiner Ankunft noch einmal<br />
genauer unter die Lupe zu nehmen, setzte mich aber vorsichtshalber schon einmal mit<br />
den öffentlichen Verkehrsmitteln auseinander. Die ganze Familie wurde mit eingespannt.<br />
Jeder, der Zeit hatte, erklärte sich bereit, einen Weg zu fahren, uns von Freunden abzuholen<br />
oder zu der nächsten Bushaltestelle zu bringen.<br />
Das war also schon einmal erledigt! Wir würden überall hinkommen. „Was isst denn so<br />
ein Israeli?“ „Ach, der isst wie jeder andere Jugendliche auch: Pommes, Döner, Pizza.“<br />
„Quatsch, viele Israelis essen koscher! Oft werden Milch und Fleischprodukte nur getrennt<br />
gegessen!“ Es wurde spekuliert, Google wurde befragt und schließlich entschieden<br />
wir uns einfach, unseren Austauschschüler selber zu fragen. Es stellte sich heraus, dass<br />
alle Sorgen umsonst waren. So legte er weder Wert auf koscheres Essen, noch litt er<br />
unter einer Lebensmittelunverträglichkeit oder aß nach einer selbst auferlegten Diät. Er<br />
ließ mich wissen, dass er im Prinzip alles esse. „Der ist ja einfacher zu versorgen als du!“,<br />
witzelte meine Familie. Wir beschlossen also, den Kühlschrank für die ersten Tage noch<br />
einmal gut zu füllen, dann aber einfach zusammen einkaufen zu gehen. Ein Supermarkt<br />
in Deutschland müsste ja doch, so vermuteten wir, etwas anders aussehen als ein israelischer.<br />
Vielleicht gab es etwas, was mein Gast schon immer einmal ausprobieren wollte?<br />
Vielleicht hatte er ein Lieblingsmüsli, das es auch hier gab! Transport? Geklärt. Essen?<br />
Kann auch abgehakt werden. Nun blieb noch sein Zimmer. Passend zu seiner Ankunft<br />
hatten wir gerade ein Zimmer als Gästezimmer renoviert. Nun ging es darum, durch Accessoires<br />
eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, das Bett zu beziehen, Handtücher bereit<br />
zu stellen und auch für ein kleines Willkommensgeschenk wurde gesorgt.<br />
Nun waren alle organisatorischen Dinge geklärt. Ich tat mich mit einer kleinen Gruppe<br />
Freunde zusammen und auf unserem persönlichen Programm standen Schwimmbadbesuche,<br />
Stadttouren u.ä. Das letzte, was wir wollten, war ein gelangweilter Austauschschüler.<br />
Wir alle waren uns einig, dass unsere Partner bei ihrer Rückkehr nach Israel auf<br />
die Zeit in Deutschland mit einem Lächeln zurückblicken sollten und ihren Familien und<br />
Freunden von vielen interessanten Dingen, von viel Spaß und einer guten Zeit berichten<br />
sollten. Immer wieder tauchten während dieser Vorbereitung die unterschiedlichsten<br />
Vermutungen auf. Jeder hatte schon ein kleines eigenes Bild der Austauschschüler im<br />
Kopf und später sollten sich viele als nicht wahr herausstellen. Letztendlich verliefen die<br />
gemeinsamen Tage reibungslos. Wir hatten viel Spaß und konnten viel über die andere<br />
Kultur lernen. Mein Gastschüler integrierte sich wunderbar in meine Familie und auch<br />
die Schüler untereinander fanden unerwartet viele Gemeinsamkeiten und wir konnten<br />
eine interessante Zeit miteinander verbringen.<br />
Ich persönlich habe nur gute Erfahrungen als Gastgeber eines Austauschschülers gemacht<br />
und würde diese Chance auch jedem anderen wünschen. Familien öffnen ihre<br />
Arme, um etwas Unbekanntes herzlich zu empfangen. Meist ist es jedoch ungewiss,<br />
wer tatsächlich die Person ist, die am nächsten Morgen am Frühstückstisch sitzen wird.<br />
Wie wird diese Person auf meinen Alltag reagieren? Gastfamilie zu werden bietet die<br />
Möglichkeit, sich selber genauer kennen zu lernen. Aber nicht nur dies ist ein interessanter<br />
Aspekt. Entschließt man sich, einen Gast aufzunehmen, so geschieht dies mit dem<br />
Gedanken, sich selbst zu öffnen, den Familienalltag so normal wie möglich weiterlaufen<br />
zu lassen, in Kombination mit einem hohen Maß an Kommunikation. Es geht nicht darum,<br />
kurzfristig ein Gästezimmer bewohnen zu lassen, sondern darum, einen Fremden als<br />
volles Familienmitglied zu integrieren und zu akzeptieren. Gastfamilien haben die Möglichkeit,<br />
eine fremde Kultur im eigenen Wohnzimmer zu erleben, sich von ihr inspirieren<br />
zu lassen und das eigene Leben aus einem komplett anderen Blickwinkel zu sehen.<br />
Ein Schüleraustausch, ob nur in Form einer Woche oder in Form eines gesamten Jahres,<br />
stellt alle beteiligten Personen auf eine Probe. Ein Kulturaustausch ist ein großer Schritt<br />
in Richtung einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft, in der sichergestellt ist, dass<br />
Fremdes nicht abgestempelt wird, sondern dass man sich intensiv, kritisch und tolerant<br />
mit anderen Aspekten befassen kann.<br />
13
Reut Im Kloster versteckt<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
14<br />
Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, eine von einer Million Untold Family Stories,<br />
die mir sehr am Herzen liegt.<br />
Als meine Großmutter Dora zwölf Jahre alt war, floh ihre Familie aus Deutschland. Die<br />
Mutter meiner Großmutter, Tony, musste die Familie trennen, um das Leben der Kinder<br />
zu retten. Sie wusste, dass sie nur ein Kind mit auf ein Schiff nehmen konnte, das nach<br />
China fuhr, und das war meine Großmutter. Sie setzte eine Anzeige in die Zeitung und<br />
suchte eine Familie im Ausland, die ihre anderen drei Kinder aufnehmen könnte, bis der<br />
Krieg vorüber wäre. Eine schwedische Familie vom Land antwortete auf die Anzeige und<br />
sagte, sie würden nur ein Kind nehmen. Tony bat darum, sie möchten die zwei jüngsten<br />
nehmen, weil der dritte ältere Bruder auf dem Weg nach Israel sei. Nach einer Weile<br />
willigten sie schließlich ein und die beiden sieben und acht Jahre alten Kinder wurden<br />
per Schiff nach Schweden geschickt.<br />
Meine Großmutter bestieg mit ihren Eltern und ihrer Großmutter das Schiff für die lange<br />
Reise nach China. Da der Kapitän sich weigerte, Kinder an Bord zu nehmen, hatten sie<br />
vorher beschlossen, dass meine Großmutter das Schiff in Marseille, Frankreich, verlassen<br />
sollte. Dort wartete ein Verwandter auf sie, ein alter, unfreundlicher Mann, und sie<br />
musste mit ihm und seiner Frau in einem fremden Land leben, dessen Sprache sie nicht<br />
verstand. Sie war zu der Zeit dreizehn Jahre alt. Sie hatte schreckliches Heimweh und<br />
war entsetzt, dass niemand ihr gesagt hatte, dass man sie in Frankreich zurücklassen<br />
würde. Sie wusste nicht, dass es zu ihrer eigenen Sicherheit war.<br />
Ein Jahr später, als die Nazis Frankreich eroberten, wurde es für sie gefährlich, weiter<br />
bei dem Verwandten zu bleiben, also wurde sie in der Nähe in ein Waisenhaus gebracht.<br />
Von dort kam sie später in ein Kloster, wo sie sich zusammen mit elf anderen jüdischen<br />
Mädchen vor den Nazis versteckte, indem sie sich als Nonnen ausgaben. Die katholischen<br />
Nonnen behandelten sie gut, sie lernte Französisch und kochen, aber sie konnte nicht<br />
von dort weg, dort bekam sie Essen und Schutz. Obwohl die Nonnen versuchten, sie und<br />
die anderen jüdischen Mädchen zum Konvertieren zu überreden, wollte sie das nicht.<br />
Eines Tages kamen Nazisoldaten zum Essen in die Küche des Klosters. Meine Großmutter<br />
hatte gerade Dienst in der Küche und sie sollte dort bleiben und sich als Französin ausgeben.<br />
Die Soldaten setzten sich hin und riefen auf Deutsch nach ihr. Ihr erster Instinkt<br />
war es, sich umzudrehen und sie zu bedienen, da sie jedes Wort verstand. Aber zum<br />
Glück runzelte sie nur die Stirn und drehte sich nicht um. Das rettete ihr buchstäblich<br />
das Leben. Zwei Jahre später, als sie das Kloster verlassen musste, zog sie von Ort zu Ort.<br />
Und wieder rettete ihre Intuition ihr dabei das Leben. Als sie auf der Flucht war, fand<br />
sie häufig auf einem Bauernhof Unterkunft, nachdem sie den Bauern dort bei der Arbeit<br />
geholfen hatte. Sie stand aber immer schon früh am nächsten Morgen auf, nahm ihr<br />
Fahrrad und fuhr schnell ins nächste Dorf. Wie sich zeigte, war ihr Instinkt richtig, denn<br />
oft sah sie Nazisoldaten, die nach ihr suchten, weil Dorfbewohner sie gerufen hatten, um<br />
sie zu holen.<br />
Nach Kriegsende wusste sie nichts über das Schicksal ihrer Familie. Sie traf aber einen<br />
jüdisch-amerikanischen Soldaten, der ihr sagte, dass jüdische Flüchtlinge anfingen, nach<br />
Israel zu gehen. Sie suchte die Organisatoren dieser Aktion und machte mit.<br />
So kam sie nach Israel, wiederum in ein fremdes Land, eine junges, verängstigtes Mädchen,<br />
das mit achtzehn weder Hebräisch sprach noch jemanden kannte. Als sie ihren<br />
Bruder in Israel wiederfand, erfuhr sie zum ersten Mal, dass ihre Eltern lebten und in<br />
die USA gegangen waren. Leider sah sie ihre Eltern nie wieder. Ihre beiden jüngeren<br />
Brüder gingen von Schweden in die USA. Meine Großmutter lernte Krankenschwester<br />
und arbeitete in einem Krankenhaus in Jerusalem. Dann heiratete sie meinen Großvater<br />
Efraim und bekam zwei Kinder, meine Mutter und ihren Bruder. Heute ist Großmutter<br />
Dora fünfundachtzig Jahre alt und ich finde nichts schöner, als bei ihr zu sitzen und ihre<br />
Geschichten zu hören.<br />
Im Herzen eines jeden Israelis steckt eine tiefe Verbindung zu dem „heldenhaften Juden“,<br />
der all die Jahre überlebt hat. Die Tatsache, dass das jüdische Volk durch all das Leid<br />
gegangen ist und dennoch ein so schönes Land errichten konnte, macht mich stolz, ein<br />
Teil davon zu sein. Hier kommt der israelische Charakter ins Spiel. Israelis sind kühn, stur<br />
und sehr kreativ im Denken. So ist es nicht verwunderlich, dass sie auf dem Gebiet des<br />
Hi-Tech, der Kunst und Medizin weltweit führend sind.
Im Alltag ist der Israeli, den du triffst, ein offener Mensch, der normalerweise gerne hilft<br />
und dem Freundschaft viel bedeutet. Die jungen Israelis von heute stehen voll und ganz<br />
zu ihrem Land. Sie alle, Jungen und Mädchen, dienen mindestens zwei oder drei Jahre<br />
lang in der Armee. Wenn für mich die Zeit kommt, meinen Wehrdienst zu leisten, werde<br />
ich mehr als bereit sein, meine besten Jahre zu geben, um meine Nation, „mein Israel“,<br />
zu verteidigen.<br />
Geschichten einer Familie- die Relevanz unserer Erzählungen<br />
„Ich könnte jeden Tag vorm Spiegel stehen und meine Falten zählen, stattdessen<br />
unternehme ich aber lieber etwas Spannendes“, sagt meine Oma, der grau-weiße<br />
Pferdeschwanz schwingt im Nacken mit, während sie aufsteht und Tee holt. Oma Ulla<br />
ist zweiundsiebzig, zweimal in der Woche im Ruderverein, mindestens so oft auf dem<br />
Fahrrad unterwegs. Zu Weihnachten bekommt sie Post aus aller Welt, Karten aus Amerika,<br />
Australien und Neuseeland und häufig packt sie das blaue Wohnmobil und bricht zu<br />
einer ihrer Reisen auf. Reisen mit Oma war immer ein großes Abenteuer, genau wie die<br />
Abende vor dem Kamin, wo wir in alten Fotos stöberten und sie mich mitnahm auf eine<br />
Reise in die Vergangenheit, in die Zeit, in der mein Opa noch lebte und mein Vater so alt<br />
war wie ich. Durch meine Oma lebten die Erzählungen aus ihrer Jugend, die Erlebnisse<br />
meiner Familie und die alten Legenden weiter, immer gab es eine neue Geschichte zum<br />
richtigen Zeitpunkt, die sie erzählen konnte.<br />
Manche dieser Erzählungen sind einfach nur witzig und unterhaltsam. Es gibt da die<br />
Geschichte von Mike, meinem Onkel, der früher einen alten, nicht mehr funktionstüchtigen<br />
Honda besaß, der eigentlich auf den Schrottplatz gehörte. Nun war das Verschrotten<br />
ja kostenpflichtig und so stand der Wagen seit einer Weile auf dem Parkplatz am Haus<br />
meiner Oma. Nach einer großen Geburtstagsparty saß die ganze Familie auf dem Balkon,<br />
als Oma fragte: „Sag mal, Mike, wo ist denn der alte Honda hin?“ Das Auto blieb trotz<br />
einer ausgiebigen Suchaktion in <strong>Münster</strong>-Hiltrup verschwunden und es kam der Verdacht<br />
auf, dass einige von Mikes Freunden nachts auf die Idee gekommen waren, den<br />
Honda wegzuschaffen. Das Auto wurde als gestohlen angezeigt und tatsächlich, als<br />
einige Monate später der in der Nähe liegende Dortmund-Ems-Kanal wegen Bauarbeiten<br />
für Schiffe gesperrt wurde und sich das Wasser nach einiger Zeit klärte, wurde der alte<br />
Wagen gefunden, über und über bedeckt mit Algen und Muscheln und mit einer großen<br />
Einkerbung einer Schiffsschraube im Dach hatte er die letzten Monate auf dem Grunde<br />
des Kanals verbracht. Schließlich wurde der Wagen dann doch verschrottet, hatte aber<br />
noch ein kleines Abenteuer erlebt. Es blieb das Rätsel, wer ihn durch eine Unterführung<br />
und über eine Hauptstraße bis zum Kanal geschoben hatte.<br />
Eigentlich war mir schon immer klar, dass diese Familiengeschichten nicht in Vergessenheit<br />
geraten dürfen, diese Erzählungen, die zu Weihnachten oder am großen Esstisch<br />
wieder und wieder hervorgeholt werden und eine ganze Familie präsentieren. Diese<br />
Ausschnitte aus einem Leben, aus einer Generation, die auch meine Kinder noch kennen<br />
sollten. Es gibt keine bessere Zeitmaschine als Familiengeschichten. So habe ich auch<br />
von meinem Opa Bernd, der starb, als ich gerade drei Jahre alt war, ein erstaunlich genaues<br />
Bild im Kopf, nicht gezeichnet durch Bilder, sondern durch Erzählungen. Mein Opa<br />
war groß gewachsen, bestimmt 1,90 groß und hatte riesige Füße, Schuhgröße 47, mit<br />
seinen Schuhen konnte man ausgezeichnet Pipi Langstrumpf spielen.<br />
Märchen wie „Rapunzel“ oder „Dornröschen“ kennt heutzutage jedes Kind, die eigene<br />
Familiengeschichte, der Ursprung und die Beziehung der relevanten Personen leider<br />
kaum eines. Dabei ist die Historie der eigenen Verwandtschaft längst nicht nur das<br />
trockene Stammbaumforschen einiger entfernter Onkel. Gelebte Geschichte ist nicht nur<br />
eine Floskel, sondern hat eine tiefe, spannende Bedeutung. Woher kommen wir? Wie hat<br />
alles angefangen? Wie haben sich meine Eltern, wie meine Großeltern kennen gelernt,<br />
als sie noch jung waren? Eine schöne Geschichte zu diesem Thema erzählt Oma auch immer<br />
wieder gerne. Sie war damals, 1959, Turnerin in Sendenhorst und der Männerverein<br />
in <strong>Münster</strong>-Hiltrup hatte die Frauenmannschaft zum alljährlichen Vorturnen eingeladen.<br />
Dieses Fest gestaltete sich so, dass alle Zuschauer an einer langen Tafel saßen und den<br />
Jana<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
15
16<br />
Turnern bei der Vorstellung zuschauten. „ Die Truppe hatte sich in diesem Jahr als Clowns<br />
verkleidet, alle trugen rote Hosen mit weißen Sternchen drauf, die waren ziemlich groß,<br />
damit auch noch Luftballons als Bäuche reinpassten. Geturnt wurde auf dem Trampolin,<br />
man ließ sich ab und zu auf die Ballons fallen, die laut platzten. Ja, und Bernd, dein Opa,<br />
sprang fleißig mit, er machte einen Salto, zack, und landete genau auf dem Tisch, auf der<br />
weißen Tafel zwischen all den Flaschen und Gläsern, aber ich weiß es noch genau, nicht<br />
ein Glas zerbrach.“ So haben sich meine Großeltern kennen gelernt. Diese Geschichte ist<br />
längst zu einer Familienlegende geworden.<br />
Die Familie spielt eine große, eine überaus wichtige Rolle im Leben eines Jeden, sie ist<br />
die Heimat, sie gibt einem Halt, und aus dem Kreise der Verwandten übernimmt man<br />
oft auch eigene Lebensweisen, Einstellungen und Eigenarten. Meine Familie war schon<br />
immer eine Reisefamilie, sobald die Schulferien anfingen, war das Wohnmobil gepackt,<br />
die Kinder kamen nach Hause, schmissen ihre Tornister in den Flur und das Abenteuer<br />
konnte beginnen. „Einmal nahmen wir die Fähre nach England, wir waren ziemlich bepackt.<br />
Wir hatten zwei Surfbretter oben drauf - das Auto ist so ein 2,8-Tonner gewesen,<br />
also ein ausgebautes Wohnmobil - auf diesen beiden Surfbrettern zwei Fahrräder, dann<br />
hinten noch zwei Fahrräder und die Surfkarre draufgepackt. Und wir kommen dann in<br />
England an, mussten natürlich durch den Zoll und dachten schon, oh Gott, wenn die<br />
jetzt anfangen, uns auseinanderzurupfen... Und dann haben die uns nur durchgewinkt<br />
und gesagt: „Oh, klein Karstadt.“ Aus dieser Reisezeit, als mein Vater und mein Onkel<br />
noch kleiner waren, gibt es viele spannende, witzige Geschichten, die von fernen Ländern<br />
und Abenteuern erzählen. Als Opa einmal mit seinen Freunden verreist war, beschloss<br />
Oma ebenfalls, auf eigene Faust in den Urlaub zu fahren. Sie ließ einen Zettel auf dem<br />
Wohnzimmertisch liegen und machte sich samt der Kinder auf den Weg nach Römö, eine<br />
Halbinsel in Dänemark. Nun muss man wissen, dass es in Dänemark erlaubt ist, mit dem<br />
Auto auf den Strand zu fahren. Die drei stellten das blaue Wohnmobil also zwischen<br />
den vielen anderen Fahrzeugen ab, packten die Fahrräder aus und machten sich auf den<br />
Weg zum Hafen. Vergessen hatten sie allerdings die Gezeiten, die das Meer steigen und<br />
sinken lassen. „Ich weiß noch, es war ein ganz windiger Tag und wir haben uns gegen<br />
den Gegenwind in Richtung Hafen durchgekämpft und zurück rasten wir dann Richtung<br />
Auto. Und wir sahen am ganzen Strand nur noch ein einziges Auto stehen, inmitten von<br />
Wasser, und das war unser Wohnmobil. Mir wurde richtig übel in dem Moment, aber<br />
die Kinder schrien: ,Juhee, super, ein Abenteuer!‘ Ich wusste ja nicht einmal, wie tief der<br />
Priel war, aber ich musste das Auto dort wegschaffen. Die Sonne schien, um uns herum<br />
standen die Leute und fotografierten uns lachend, die Kinder lehnten in der geöffneten<br />
Seitentür. Das Wasser spritzte an den Seiten des Wagens hoch bis auf Höhe des Daches,<br />
aber irgendwie bekam ich das Auto da raus. Und ich hab gesagt: ,Ihr haltet aber<br />
den Mund, ihr sagt nichts zu Papa!‘ Das ganze Salzwasser ist ja Gift für das Getriebe.“<br />
Heutzutage fährt meine Oma ihr drittes Wohnmobil, in strahlendem Blau, und sie ist die<br />
meiste Zeit des Jahres auf Reisen. Mein Onkel hat eine ganze Weltreise hinter sich und<br />
die Weltkarte mit den Hier-war-ich schon-, Hier-will-ich-noch-hin-Fähnchen habe ich<br />
genauso wie mein Vater im Zimmer an einem Ehrenplatz hängen.<br />
Insofern hat mich meine Familie geprägt, genau wie jeder Mensch, den wir treffen, etwas<br />
in uns hinterlässt, ein Gefühl, einen Satz, ein Bild. Und diese Erfahrung, jede Erfahrung<br />
ist so wertvoll, dass sie weitergegeben werden muss, innerhalb einer Familie oder<br />
auch innerhalb eines Freundeskreises, als eine lehrreiche Geschichte, als ein erinnerungswürdiger<br />
Moment, um eine Person zu beschreiben oder um einfach etwas zum Lachen zu<br />
haben. Mit unserem Austausch werden ebenfalls neue Geschichten geschrieben, die es<br />
gilt, im Kopf zu behalten und im passenden Moment vorzutragen, denn eines ist sicher,<br />
jeder Mensch lauscht gerne den Geschichten eines anderen, ob als Buch verfasst, im<br />
Songtext eingebaut oder in einem Artikel verarbeitet. Geschichten bestimmen unseren<br />
Alltag. Warum dann nicht auch unsere eigenen Familiengeschichten?
Meine Großeltern<br />
Meine Großeltern väterlicherseits wurden in Tunis geboren. Zu der Zeit, als sehr viele<br />
Juden aus Tunis flohen, zog meine Großmutter mit ihrer Familie nach Frankreich. Mein<br />
Großvater blieb in Tunis. Die beiden kannten sich damals noch nicht.<br />
Mein Großvater wurde 1935 geboren, er hat eine Schwester und vier Brüder. Er und seine<br />
Familie machten „Alija“ (Einwanderung nach Israel), als er 18 Jahre alt war. Sie zogen<br />
nach Israel, weil sie viel über das Heilige Land gehört hatten, als Land für die Juden, und<br />
wegen des Antisemitismus.<br />
Meine Großmutter kam 1940 zur Welt, sie hat vier Schwestern und zwei Brüder. Sie war<br />
14, als sie Marseille in Frankreich verließ und „Alija“ machte. Sie ging nach Israel, weil<br />
ihre Familie wollte, dass sie einen Juden heiratet.<br />
Sie kam also allein nach Israel, ohne ihre Eltern, die sie zu einer Tante in einen Kibbuz<br />
(Gemeinschaftssiedlung auf freiwilliger Basis. Der gesamte Kibbuz gehört der Gemeinschaft)<br />
schickten. Von dort aus stieg meine Großmutter einmal in einen Bus und<br />
begegnete meinem Großvater. Er bat sie um eine Verabredung ... und der Rest ist, wie sie<br />
sagen, Geschichte. Nach ihrer Hochzeit zogen sie nach Lod. Mein Großvater arbeitete als<br />
Schuhmacher und meine Großmutter arbeitete im Kibbuz. Sie haben sieben Kinder, mein<br />
Vater ist das vierte.<br />
Israel ist eines der kleinsten Länder der Welt. Es ist erst 63 Jahre alt und wird ständig<br />
bedroht. Dennoch ist das Land für die Bevölkerung und für Touristen attraktiv. Mit einer<br />
Lebenserwartung von 80,7 Jahren steht Israel an achter Stelle in der Welt. Wir wollen<br />
einmal sehen, warum das so ist. Israel ist das Land, das zu Beginn des 21. Jahrhunderts<br />
die meisten Bäume besaß, dabei bestehen 60% des Landes aus Wüste.<br />
In Israel liegt bekanntermaßen der tiefste Punkt der Erde: das Tote Meer im Osten des<br />
Landes, dessen Wasser voller Salz und Mineralien ist. Das Wasser fühlt sich auf der Haut<br />
an wie Öl und lässt dich an der Oberfläche treiben.<br />
Wenn man vom Norden in den Süden reist, kann man morgens auf dem Berg Hermon<br />
Ski fahren und am Nachmittag einen Ausflug in die Wüste unternehmen. Das Wetter<br />
im Norden kann kalt und eisig sein, im Süden zugleich aber sonnig und warm und man<br />
müsste wegen der Hitze in der Negev-Wüste und in der Küstenstadt Eilat kurze Hosen<br />
tragen. In Israel gibt es viele unterschiedliche Klimazonen, das macht das Land so schön<br />
und besonders.<br />
Israel hat die höchste Einwanderungsrate der ganzen Welt, deshalb leben hier viele verschiedene<br />
ethnische Gruppen. Nachdem 1948 der Staat Israel gegründet wurde, kehrten<br />
viele Juden aus der ganzen Welt in ihr Heimatland zurück.<br />
Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem mit der berühmten Klagemauer. Sie ist der Überrest<br />
der früheren Westmauer des alten Tempels. Jerusalem ist auch für andere Religionen<br />
eine Heilige Stadt: für das Christentum und den Islam.<br />
In Israel ist es niemals langweilig. In der größten und sehr lebhaften Stadt Tel Aviv gibt<br />
es Museen, interessante Architektur, Nationaltheater, bunte Märkte, Nachtclubs und<br />
viele andere Attraktionen.<br />
Shiran<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
17
Manja<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
18<br />
Die Geschichte meines Onkels<br />
Vor langer Zeit war der Bruder meiner Mutter, Egon, mit dem Rucksack in Europa unterwegs.<br />
Er war unter anderem in Venedig, um sich ein eigenes Bild von der Schönheit<br />
dieser Stadt zu machen. Als Bauingenieur war er von der Stadt überaus begeistert und<br />
fasziniert von der Struktur der Altstadt mit ihren vielen Straßen, Plätzen und den zahlreichen<br />
Kanälen. Egon übernachtete in einer Jugendherberge, die zum damaligen Zeitpunkt<br />
total ausgebucht und völlig überfüllt war. So kam es, dass alle Jungs im Haus schliefen<br />
und die Mädchen eine Notunterkunft bekamen, doch zum Frühstücken kamen sie alle<br />
im Speiseraum der Jugendherberge zusammen. Am Morgen des 31. Juli 1979 begegnete<br />
mein Onkel beim Frühstück einer Frau namens Conny. Sie redeten eine Weile miteinander<br />
und tauschten ihre bisherigen Erlebnisse und Eindrücke aus. Conny war damals ebenfalls<br />
auf einer Rucksacktour und schlief in der Notunterkunft der Jugendherberge. Mein<br />
Onkel und Conny unterhielten sich den ganzen Morgen und so fand er heraus, dass sie in<br />
Australien aufgewachsen war, ihre Eltern jedoch ursprünglich ebenfalls aus Deutschland<br />
kamen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit wenigen Verwandten nach<br />
Australien auswanderten. Sie verabredeten sich noch ein zweites Mal und verbrachten<br />
einen wunderschönen Tag in Venedig. Sie gingen zusammen einkaufen und hatten ein<br />
gemeinsames, romantisches Abendessen an einem der vielen, für Venedig typischen<br />
Kanäle.<br />
Am darauf folgenden Tag reiste Conny weiter nach Hannover, um einige ihrer deutschen<br />
Verwandten zu besuchen, und mein Onkel machte sich auf nach Kreta. Als er nach kurzer<br />
Zeit wieder nach Hause kam, besuchte Conny ihn und verbrachte drei Monate mit Egon<br />
zusammen in <strong>Münster</strong>. Eines Abends saßen sie zusammen in einem Restaurant, als Conny<br />
meinen Onkel fragte, wie er die Situation zwischen ihr und ihm sehen würde und mein<br />
Onkel antwortete: „Das ist doch klar, wir sind ein Paar.“ Conny aber sagte ihm, dass es<br />
nicht so einfach ginge, und da fasste Egon den Entschluss, ihr einen Heiratsantrag zu<br />
machen, denn er sagte sich, so eine Frau wie Conny findest du nirgendwo sonst auf der<br />
Welt, die kannst du nicht gehen lassen! Er ging los, kaufte ihr einen Ring und fiel vor ihr<br />
auf die Knie, um sie zu bitten, ihn zu heiraten. Conny wollte Egon ebenfalls heiraten und<br />
zusammen entschieden sie, nach Australien zu fliegen. Als mein Onkel dort ankam, dachte<br />
er, man hätte ihn mitten im Urwald ausgesetzt. Alles war anders, fremd und irgendwie<br />
auch ein bisschen primitiv. Es war eine riesige Umstellung für ihn, aber was tut man<br />
nicht alles für seine große Liebe? Conny brachte Egon in ihren Lieblings-Pub. Als mein<br />
Onkel die Tür des Pubs öffnete, dachte er, er wäre im falschen Film. Denn der Boden war<br />
überdeckt mit Sägespänen, in einigen Ecken des Pubs lag Erbrochenes und alles machte<br />
einen, sehr milde ausgedrückt, rustikalen Eindruck. Doch sein Entschluss, nach Australien<br />
auszuwandern, stand schon nach dem ersten Monat fest und er war sich sicher,<br />
dass nichts und niemand etwas an dieser Entscheidung ändern könnte. Er wollte sich<br />
ein gemeinsames Leben mit Conny aufbauen, also flog er zurück nach Deutschland. Dort<br />
kündigte er seine Wohnung, sein Auto, seine Versicherungen und alles, was dazu gehört,<br />
außerdem verkaufte er alles, was er nicht mehr brauchen würde. Nachdem er sein Visum<br />
beantragt hatte, organisierte er alle restlichen Dinge für seine Einreise in Australien. Die<br />
Aufregung und die Vorfreude auf das neue Leben in Australien waren groß. Doch am<br />
Ende stand auch ein schwerer Abschied von der Familie und von den Freunden bevor, die<br />
von nun an am anderen Ende der Welt leben würden.<br />
Während der ersten Wochen in dem neuen Land gab es viel zu erledigen und viele Dinge,<br />
an die man sich gewöhnen musste, wie zum Beispiel der Linksverkehr oder die Mentalität<br />
der Menschen. Zu dieser Zeit lebte mein Onkel zusammen mit Conny bei ihren<br />
Eltern. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, denn mein Onkel begann sich nach einem<br />
Studienplatz zu erkundigen, da sein Studium als Bauingenieur, welches er in Deutschland<br />
abgeschlossen hatte, in Australien nicht anerkannt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war<br />
ein deutscher Abschluss des Bauingenieurstudiums in Australien so viel Wert wie eine<br />
Ausbildung zum technischen Zeichner in Deutschland. Egon wurde an der ‚‚University of<br />
Melbourne‘‘ angenommen, studierte dort ein Jahr, um anschließend seine Abschlussarbeit<br />
zu schreiben. Zur gleichen Zeit kauften mein Onkel und Conny ein kleines Haus in<br />
West Brunswick, einem Stadtteil von Melbourne, und planten ihre Hochzeit, die dann im<br />
Februar 1982 stattfand. Während sie beruflich für eine Forschungsarbeit drei Monate<br />
nach Indien ging, renovierte Egon das Haus und richtete es gemütlich für die beiden ein.<br />
Sie lebten allerdings nur für kurze Zeit in diesem Haus, da meine Tante zum ersten Mal<br />
schwanger war und sie sich nach einem neuen Haus umsahen.
Nachdem sie ein neues, größeres Haus gekauft hatten, kam auch schon meine Cousine<br />
Jasmine zur Welt. Nach ein paar Jahren kündigte sich auch schon meine Cousine Teagen<br />
an und die Suche nach einem größeren Haus begann erneut. Der geeignete Ort zum<br />
Bau eines Hauses war zur damaligen Zeit Keilor, eine kleine Stadt, die nordwestlich von<br />
Melbourne liegt. Mein Onkel baute dort ein Haus mit großem Garten und sehr viel Platz<br />
in einer kinderfreundlichen Umgebung. Nachdem meine Cousine Teagen einige Monate<br />
alt war, wurde meine Tante mit Simone schwanger. Sechszehn Jahre lebte die Familie<br />
zusammen in dem Haus in Keilor und sie verbrachten eine schöne Zeit dort. Doch dann<br />
zogen sie zurück nach Brunswick, da die Mädchen alle zur Universität gehen mussten<br />
und sie so einen kürzeren Weg zur Uni hatten. Mein Onkel sagte, es wäre schwer<br />
gewesen, Australien als seine Heimat zu sehen, doch letztendlich ist es seine Heimat<br />
geworden, auch wenn es zehn bis fünfzehn Jahre dauerte, bis er das so sehen konnte<br />
und sich an alles gewöhnt hatte.<br />
Zusammen mit ihren drei erwachsenen Töchtern haben sich mein Onkel und meine<br />
Tante ein eigenes, gemeinsames Leben in Australien aufgebaut. Dabei war es egal, ob<br />
sie innerhalb von Melbourne in neue Häuser gezogen waren oder zwischenzeitlich aus<br />
beruflichen Gründen in Afghanistan lebten. Das Wichtigste ist immer, dass die Familie<br />
zusammen ist. Wegen ihrer Berufe reisen Egon und Conny viel durch die Weltgeschichte,<br />
doch sie kehren immer wieder zurück in ihr gemeinsames Haus und ihre Heimat Melbourne.<br />
Im vergangenen Sommer verbrachte ich die Ferien bei ihnen und ich bekam viele<br />
Eindrücke von dem Land und dem Leben dort.<br />
Beziehungen auf Augenhöhe<br />
Mein Großvater Avraham (Moshe) Minkovski wurde am 18. Januar 1926 in Starachowice,<br />
Polen, geboren. Als Junge arbeitete er in der Bäckerei seiner Familie. Ende 1942 wurden<br />
er und seine Familie nach Auschwitz deportiert, wo er Zwangsarbeit leisten musste.<br />
Seine sieben Geschwister wurden in Auschwitz umgebracht. Als das Konzentrationslager,<br />
in dem sie gefangen waren, zerstört war, wurden er und die anderen Juden zum „Todesmarsch“<br />
gezwungen. Dabei gelang meinem Großvater die Flucht vor den Nazisoldaten<br />
und er fand Unterschlupf in einem leerstehenden Haus nahe einer kleinen polnischen<br />
Stadt. Er gab vor, ein polnischer Gefangener zu sein, der geflüchtet war, und überlebte,<br />
indem er in den umliegenden Häusern nach Essen suchte. Später wurde er von Nazisoldaten<br />
entdeckt und wieder gefangen genommen, aber sie dachten, er sei tatsächlich ein<br />
polnischer Gefangener, und ließen ihn eine Woche lang hart arbeiten, bis die Rote Armee<br />
kam und ihn am 6. Mai 1945 befreite. Von dort ging er zu Fuß durch mehrere europäische<br />
Länder, bis er das Schiff Altalena erreichte, das nach Israel fahren sollte. Er wollte<br />
nach Israel gehen, ein neues Leben anfangen und eine Familie gründen. In Israel lernte<br />
er meine Großmutter kennen, Rachel Levy. Sie heirateten und bekamen drei Kinder:<br />
Nava, Orna und Yaron.<br />
In den Jahren nach dem Holocaust redete mein Großvater nicht über den Krieg und<br />
wollte niemandem erzählen, was geschehen war, nicht einmal seiner Familie. Erst vor<br />
wenigen Jahren beschloss er, seine Geschichte und die seiner Familie aufzuzeichnen.<br />
Diese Geschichte ist im Archiv von „Yad Vashem“ zu finden.<br />
Israel ist mein Land und meine Heimat. Für mich ist Israel als Land für das jüdische Volk<br />
nicht selbstverständlich. Sowohl mein Bruder als auch mein Vater waren Kampf-Offiziere<br />
beim Militär. Durch ihre Erzählungen weiß ich etwas über die israelischen Kriege und wie<br />
wichtig es ist, unser Land zu verteidigen. Das hat mich in dem Wunsch bestärkt, meinen<br />
Militärdienst bei einer Spezialeinheit der IDF (Israel Defense Forces) zu leisten.<br />
Außerdem ist mein Großvater Überlebender des Holocaust. Nach dem Krieg immigrierte<br />
er aus Polen nach Israel. Ich bin stolz auf meinen Großvater und seine Vergangenheit<br />
bestätigt mich immer wieder in dem Glauben, dass unser Land unersetzbar und von<br />
unschätzbarem Wert ist.<br />
Die Altalena<br />
Eyal<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
19
Lowis<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
20<br />
Letztes Jahr bin ich mit einer Delegation nach Polen gereist, wo ich mich mit jüdischer<br />
Geschichte beschäftigen konnte. Auch mit der Vergangenheit meines Großvaters und<br />
seiner Tapferkeit. Die Erfahrungen, die ich während dieser Reise gemacht habe, haben mir<br />
außerdem gezeigt, dass wir uns immer an unsere Vergangenheit erinnern und uns dafür<br />
einsetzen müssen, dass so schreckliche Dinge wie damals nie wieder passieren.<br />
Ich glaube, dass die israelische Regierung demokratisch und richtig handelt. Dennoch<br />
werden nicht immer alle Handlungen Israels vom Rest der Welt verstanden. Sie werden<br />
oft fehlinterpretiert und in negativem Licht gezeigt. Deshalb war ich sehr gespannt, als<br />
ich von dem bevorstehenden Austausch mit Deutschland hörte. Ich möchte zum guten<br />
Ruf meines Landes beitragen, so gut ich kann, und bin der Überzeugung, dass Beziehungen<br />
zwischen Jugendlichen eine effektive Methode sind, weil wir auf Augenhöhe mit jungen<br />
Menschen unseres Alters reden können, so dass wir unser Land vorstellen und besser<br />
erklären können. Auch sind junge Menschen offener für neue Ideen und noch nicht durch<br />
Vorurteile beeinflusst. Deshalb glaube ich, dass wir wirksame Repräsentanten von Israel<br />
sein können, die dabei helfen, dass deutsche Jugendliche unser Land besser verstehen.<br />
Diese Jugendlichen werden dann zu einer neuen Generation von Deutschen heranwachsen,<br />
die Israel besser versteht und unterstützt.<br />
Wegen all der genannten Gründe möchte ich mein Leben in Israel verbringen, meine<br />
Kinder in Israel großziehen, sie lehren, Israel zu lieben und diese Gefühle und Emotionen<br />
an andere weiterzugeben.<br />
Der Ponyhof<br />
Bevor ich aufgrund meines Schulwechsels nach <strong>Münster</strong> gezogen bin, lebte ich mit<br />
meinen Eltern und anfangs mit drei Geschwistern in Lengerich, einer kleinen Stadt, auf<br />
einem Ponyhof. Auch wenn das Leben auf dem Land mit einigen Strapazen, wie zum Beispiel<br />
weiten Entfernungen zu verschiedenen Freunden und Freizeitmöglichkeiten sowie<br />
teilweise einer Menge Arbeit mit den Tieren verbunden ist, habe ich die Zeit auf dem Hof<br />
immer sehr genossen. Und auch andere, denen ich erzähle, ich sei auf einem Ponyhof<br />
aufgewachsen, reagieren stets mit viel Interesse und oftmals großer Begeisterung.<br />
Aus diesem Grund habe ich beschlossen, meiner Mama ein paar Fragen über ihren<br />
täglichen Ablauf und ihre Aufgaben mit den Tieren und den Menschen, die auf dem Hof<br />
leben, arbeiten oder zu Gast sind, zu stellen, um einen Überblick über das Leben auf dem<br />
Ponyhof zu geben, das sich doch sehr von dem in der Stadt unterscheidet.<br />
Auf unserem Hof gibt es drei Pferdeställe, in denen jeweils eine Herde (bestehend aus ca.<br />
zehn Pferden) steht.<br />
Weitere Tiere des Hofes sind zwei Wachhunde und ungefähr vier Katzen.<br />
Neben meinen Eltern und den Tieren leben in dem großen Wohnhaus, das in vier Wohnungen<br />
aufgeteilt ist, noch meine Kindergartenfreundin mit ihrer Mutter und Schwester,<br />
zwei Tanten und zwei Freunde meiner Eltern.<br />
Anders als in den meisten Berufen, in denen höchstens fünf bis sechs Tage in der Woche<br />
nur zu festen Zeiten gearbeitet wird, gibt es auf dem Hof bestimmte Aufgaben, die jeden<br />
Tag erfüllt werden müssen, und so beginnt im Sommer auch jeder Arbeitstag meiner<br />
Mutter um 5:30 Uhr.<br />
Sie steht auf, holt zusammen mit den Hunden die Pferdeherde, die die Nacht auf der<br />
Weide verbracht hat, zurück in den Stall und bringt die anderen beiden Pferdeherden<br />
zum Grasen auf die Weide.<br />
Die kommenden zwei Stunden verbringt sie mit dem Ausmisten der Ställe.<br />
Danach frühstückt sie in der Regel alleine, hin und wieder ist jedoch einer der Mitbewohner<br />
da und leistet ihr Gesellschaft.<br />
Vormittags finden regelmäßig Reitstunden statt. Diese werden zum Teil für Privatpersonen<br />
abgehalten, die ihre Pferde auf dem Hof meiner Eltern stehen haben. Aber auch für<br />
Reitgruppen, wie zum Beispiel einer Gruppe von Patienten der Psychiatrischen Klinik in<br />
Lengerich. Sie kommen seit fast 20 Jahren regelmäßig donnerstags mit ihren Betreuern<br />
zum Reiten zu uns.
Diese Menschen haben alle unterschiedliche geistige Behinderungen und nehmen bei<br />
meiner Mama, die diplomierte Reitpädagogin ist, heilpädagogische Reitstunden.<br />
Für diese Reitstunden muss meine Mutter zunächst die Pferde fertig machen. Sie putzt<br />
sie, legt ihnen eine Decke und einen Gurt auf, damit man bequem und sicher auf ihnen<br />
sitzen kann.<br />
Bei Einzelstunden oder Unterricht mit nicht-behinderten Reitern werden die Pferde in<br />
der Regel mit ihnen zusammen fertig gemacht.<br />
Nach seiner Ankunft wird jeder zu dem Pferd, auf dem er jedes Mal reitet, gebracht. Die<br />
Gruppe steigt auf die Pferde und wird auf eine große Runde um das Gelände geführt.<br />
Für die Behinderten ist das Reiten und der Umgang mit den Pferden generell immer ein<br />
sehr schönes Erlebnis, da es zum einen etwas Besonderes ist, das nicht jeder regelmäßig<br />
machen kann, zum anderen ist es für die, die durch ihre Behinderung auch körperlich<br />
eingeschränkt sind, eine Möglichkeit, ohne große Anstrengung verschiedene Bewegungsabläufe<br />
zu trainieren.<br />
Am Ende der Reitstunde müssen die Pferde wieder in den Stall gebracht werden.<br />
Nach den Vormittagsreitstunden macht meine Mutter eine Mittagspause. Sie kann dann<br />
etwas essen, sich ausruhen oder schlafen.<br />
Am Nachmittag gibt es Kinderreitstunden. Die Kinder machen die Pferde selbst fertig<br />
und bringen sie nach der Reitstunde wieder in den Stall. Da die Pferde den Tag oder die<br />
Nacht auf der Weide verbringen, müssen sie nicht zusätzlich gefüttert werden, jedoch<br />
muss abends ihr Wasser kontrolliert und weitere kleinere Aufgaben müssen erledigt werden.<br />
Ist dies alles erledigt, endet der Arbeitstag meiner Mutter gegen 18 Uhr. Um ca.<br />
23 Uhr muss sie allerdings noch die nächtliche Pferdeherde auf die Weide bringen. Danach<br />
ist der Tag dann endgültig vorbei und meine Mutter kann ins Bett gehen.<br />
Da der Alltag meiner Mutter zwar viele positive Erfahrungen und interessante Erlebnisse<br />
beinhaltet, aber auch anstrengend ist, wollte ich unbedingt von ihr wissen, wie sie auf<br />
die Idee gekommen ist, ihren eigenen Ponyhof zu betreiben.<br />
Sie sagt, sie habe ihr erstes Islandpony Brika, als sie 13 Jahre alt war, von ihren Eltern zu<br />
Weihnachten bekommen.<br />
Auf dem Hof, wo sie es untergestellt hatte, hat sie dann auch ein erstes Schulpraktikum<br />
gemacht. Die Arbeit mit den Pferden hat ihr unglaublich viel Spaß gemacht, so dass sie<br />
auch anschließend weiterhin dort gejobbt hat.<br />
Gleichzeitig hatte sie aber auch immer die Idee, dass sie später mal gerne mit Menschen<br />
arbeiten würde. Nach einer pädagogischen Ausbildung hat sie dann auch einige Zeit in<br />
Kindergruppen gearbeitet. Ihr Traum war, beides beruflich miteinander zu verbinden. In<br />
der Schweiz hat sie die Ausbildung für heilpädagogisches Reiten gemacht und dort 1994<br />
als diplomierte Reitpädagogin abgeschlossen. Kurz danach ist sie mit meiner Familie hier<br />
auf den Hof gezogen und hat sich selbständig gemacht.<br />
Zum Schluss hat mich noch die Frage nach ihrem schönsten Erlebnis interessiert. Spontan<br />
fällt ihr ein geistig behinderter Erwachsener ein, der ein ganzes Jahr lang mit seiner<br />
Gruppe zum heilpädagogischen Reiten gekommen war, sich aber nie aufs Pferd getraut<br />
hatte. Sie habe jede Woche mit ihm ein Pferd ausgesucht, fertig gemacht und mit ihm<br />
gemeinsam an die Aufstiegsrampe geführt. Dort ist er auch auf die Rampe gestiegen,<br />
aber im entscheidenden Augenblick, kurz vor dem Aufsteigen, immer wieder umgekehrt.<br />
Dann plötzlich, nach einem Jahr, kam der Moment, wo er sich getraut hatte und aufgestiegen<br />
war und damit seine Angst überwunden und einen für ihn großen und neuen<br />
Schritt gewagt hatte.<br />
21
Chen<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
Anna<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
22<br />
Claras Tagebuch<br />
Meine Großmutter Clara Sivroni wurde 1929 in Bazagic, Rumänien, geboren. Als der<br />
Zweite Weltkrieg ausbrach, war sie 10 Jahre alt. Hier folgt ein Auszug aus ihrem Tagebuch:<br />
„Meine Eltern mieteten einen sehr großen Wagen mit zwei Pferden und einem Kutscher<br />
und luden fast alles darauf, was sie hatten, einschließlich ihrer Kleidung (aber keine<br />
Möbel). Unser Plan war, aus Konstanza wegzufahren. Meine Mutter und mein Vater und<br />
die zwei Mädchen, Sophie und Willie Orchard und Tante Rachel waren auf dem Wagen.<br />
Auf dem Weg, nicht weit vom Haus entfernt, wurden wir von der Polizei verhaftet. Juden<br />
durften die Stadt nicht verlassen. Wir wurden an einen fremden Ort gebracht, zusammen<br />
mit anderen Juden, über zwanzig Personen wurden in einen kleinen überfüllten Raum<br />
geschoben. Die Polizei nahm uns alles weg und ließ es in ein Lager bringen. Wir sahen<br />
es nie wieder. Wir hatten keine Kleider zum Wechseln. Wir hatten nur ein paar Kekse<br />
übrig. Nach einer Weile holte uns die Polizei von Konstanza ab. Wir mussten alle auf dem<br />
Boden schlafen: Männer auf der einen, Frauen und Ältere auf der anderen Seite. Es war<br />
stockdunkel. Wir dachten, das wäre das Ende. Nach zwei Wochen in Cobden wurden wir<br />
mit dem Zug in ein anderes Dorf gebracht, nach Osmania, und so überlebten wir den<br />
Krieg.<br />
Am 23. August 1944 endete der Krieg. Hinter unserem Haus in Konstanza gab es Lagerhäuser<br />
der deutschen Armee. Dort lagerten Lebensmittel, Toilettenartikel, Kosmetika,<br />
Kleidung und mehr. Als die Deutschen flohen, ließen sie die Türen der Lagerhäuser offen<br />
und nahmen nichts mit. Wir fanden dort unter anderem Seife, auf die drei Buchstaben<br />
geprägt waren: F.I.R., was „Reines Jüdisches Körperfett“ bedeutet. Sie hatten es von<br />
Juden gemacht, die im Zweiten Weltkrieg gestorben waren. Die Juden in Konstanza<br />
sammelten die Seifenstücke und begruben sie auf einem Jüdischen Friedhof in der<br />
Stadt.“<br />
Aus meiner Perspektive ist Israel aus mehreren Gründen ein ganz besonderer Ort: Zunächst<br />
einmal ist es mein Zuhause. Der Ort, wo meine Familie, meine Freunde und alle<br />
Menschen sind, die mir etwas bedeuten.<br />
Außerdem hat Israel eine besondere Atmosphäre. Die Menschen in Israel haben einen<br />
anderen Charakter als alle anderen Menschen auf der Welt. Sie sind sehr ehrlich und<br />
direkt, manchmal sogar unverschämt, aber in Zeiten der Not halten wir alle zusammen<br />
und helfen einander, wie eine einzige große Familie.<br />
Ich fühle mich meinem Land verpflichtet und meiner Meinung nach ist es sehr wichtig,<br />
Militärdienst zu leisten.<br />
Zusammenfassend gesagt, bedeutet mir Israel sehr viel.<br />
Meine Schwester in Schweden<br />
Im letzten Herbst habe ich meine Schwester Miriam besucht. Sie ist 21 Jahre alt und<br />
wohnt in Borlänge, Schweden. Seit ihrer Geburt lebte sie, genau wie ich, in Nottuln,<br />
einem kleinen Dorf, das ungefähr 25 Kilometer von <strong>Münster</strong> entfernt liegt. Sie ging<br />
hier in den Kindergarten und in die Grundschule. Nach der vierten Klasse, im Jahr 2001,<br />
wechselte Miriam dann auf die <strong>Friedensschule</strong> in <strong>Münster</strong>. Während ihrer Schulzeit, in<br />
der 11. Klasse, lebte sie ein Jahr lang in Schweden. Sie suchte sich dieses Land aus, da<br />
unsere Familie schon sehr viele Sommerurlaube dort verbracht hat und es ihr einfach<br />
ans Herz gewachsen ist. Außerdem hinterließ der Schwedischkurs, den sie damals mit<br />
unserem Vater besuchte, den Wunsch, ihre bis dahin relativ schlechten Schwedischkenntnisse<br />
aufzubessern und es nicht nur bei den wenigen Floskeln zu belassen. Während<br />
des Auslandsaufenthaltes lebte meine Schwester in Malmö, einer südlich gelegenen<br />
Stadt am Meer. Dort wohnte sie in einer Familie, bestehend aus der Mutter Anki, dem<br />
Vater Anders und den drei Kindern Veronica, Philip und Marcus. In diesem Jahr erlernte<br />
Miriam die schwedische Sprache. Während ihres Aufenthaltes besuchte sie natürlich<br />
auch die Schule. Im ersten Halbjahr war sie in einer Klasse mit naturwissenschaftlichem<br />
Schwerpunkt. Doch da ihr das nicht so sehr lag, wechselte sie an eine Berufsschule, in<br />
der Bäckerinnen und Bäcker ausgebildet wurden. Dies gefiel ihr sehr gut und auch heute<br />
liebt sie es noch, Kuchen oder andere Leckereien zu backen. Nach einem Jahr kam sie<br />
wieder nach Deutschland zurück und machte dann im Sommer 2010 ihr Abitur.
Danach bewarb sie sich an verschiedenen Universitäten in Deutschland und Schweden<br />
um ein Lehramtsstudium. Da sie nur bei Universitäten angenommen wurde, die sie nicht<br />
interessierten, entschloss sie sich, zunächst ein Jahr lang Praktika in unterschiedlichen<br />
Grund-und Sonderschulen zu machen. Während dieser Zeit absolvierte sie außerdem einen<br />
3-monatigen Aufenthalt als Au-Pair-Mädchen in Sigtuna, einer Stadt, die ungefähr<br />
50 Kilometer von Stockholm entfernt ist.<br />
Ein Jahr später, im Sommer 2011, bekam sie dann die Chance, in Borlänge, einer<br />
kleinen schwedischen Stadt (etwa 250 Kilometer nördlich von Stockholm),<br />
mit einem Tourismusstudium zu beginnen. Da sie das Land ja bereits kennen<br />
und lieben gelernt hatte, entschied sie sich, in den hohen Norden zu ziehen und<br />
dort mit dem Studium zu starten, obwohl dies noch nicht ihr Traumstudium war.<br />
Nun lebt Miriam seit Anfang September 2011 dort und hat auch schon gute Freunde gefunden.<br />
Sie bewarb sich aber weiter um ein Lehramtsstudium und bekam schließlich am<br />
27. Dezember 2011 die Nachricht, dass sie ab dem 23. Januar 2012 an der Hochschule in<br />
Falun beginnen kann, Lehramt zu studieren. Da Falun nur wenige Kilometer von Borlänge<br />
entfernt liegt und die beiden Hochschulen kooperieren, nimmt sie das Studium an<br />
und wird umziehen.<br />
Während ihrer Aufenthalte in Schweden lernte meine Schwester eine neue Kultur und<br />
einen neuen Alltag kennen. Morgens ist es wie in Deutschland, dass die Kinder und<br />
Erwachsenen zunächst in die Schule, den Kindergarten, zur Uni oder zur Arbeit gehen.<br />
Die Kinder bleiben oft bis zum späten Nachmittag im Kindergarten, der Schule<br />
oder einer Art „Übermittagsbetreuung“, da meistens beide Elternteile berufstätig sind.<br />
Nachdem die Kinder dann abgeholt wurden und zu Hause sind, werden erst Hausaufgaben<br />
erledigt, es wird zusammen gekocht und gegessen. Manchmal stehen noch Freizeitaktivitäten<br />
an. Am Abend wird dann gemeinsam gespielt oder ferngesehen, bis es Zeit ist<br />
ins Bett zu gehen.<br />
Als Student ist das Ganze für Miriam noch einmal anders. Morgens muss sie sich nicht<br />
immer überwinden, früh aufzustehen und zur Universität zu gehen, da bei den Vorlesungen<br />
keine Anwesenheitspflicht ist und man den Inhalt der Vorlesung auch im Internet<br />
ansehen kann. An manchen Tagen muss sie sich aber mit Freunden treffen, die Mitglieder<br />
ihrer Arbeitsgruppe sind, um sich Aufgaben eigenständig zu erarbeiten oder Referate<br />
vorzubereiten. In ihrem Tourismusstudium ist es immer so, dass es 5- oder 10-Wochen-<br />
Kurse gibt, die besucht werden. Am Ende eines jeden Kurses wird dann ein Test geschrieben,<br />
welcher auch bewertet wird.<br />
Generell unterscheidet sich Schweden in vielen Bereichen von Deutschland. Zuallererst<br />
wäre da die Schulform, denn in Schweden gilt als Grundschule eine Schule, die von<br />
der 1. bis zur 9. Klasse besucht wird. Danach kann man selbst wählen, ob man noch<br />
drei Jahre zum Gymnasium geht. Hierbei kann man allerdings zwischen verschiedenen<br />
Schwerpunkten wählen.<br />
Wenn man in Schweden in einen Supermarkt geht, fällt einem auf, dass frisches<br />
Gemüse, Salat oder andere Lebensmittel sehr teuer sein können. Ein Eisbergsalat<br />
kostet dort zum Beispiel etwa 27 Schwedische Kronen (SEK), das sind ca. 3 Euro.<br />
Außerdem gibt es in normalen Supermärkten nur Alkohol unter 2,5 % Alkoholgehalt und<br />
diesen kann man auch erst ab dem 20. Lebensjahr erwerben. Dafür gibt es in Schweden<br />
Läden, die „System Bolaget“, in denen es nur Alkohol zu kaufen gibt. Diese Geschäfte<br />
darf mal allerdings erst ab Vollendung des 20. Lebensjahres betreten und Alkohol<br />
kaufen. In Bars und Discotheken bekommt man alkoholische Getränke aber schon ab 18.<br />
Auch die Öffnungszeiten der Discotheken und Bars sind im Norden anders, denn dort<br />
schließen alle Bars schon um 2 Uhr. Es gibt aber noch weitere Unterschiede zwischen<br />
Schweden und Deutschland. Miriam sagt, es sei „nicht unüblich“, dass nach der Geburt<br />
eines Kindes der Vater zu Hause bleibt und „den Haushalt schmeißt“. In schwedischen<br />
Parks sind häufig „Gruppen von Männern mit Kinderwagen“ zu sehen. Die Schweden sind<br />
außerdem auch viel naturverbundener als die Deutschen. Im Sommer wird „so viel Zeit<br />
wie möglich“ draußen verbracht und im Winter werden dann schöne Schneespaziergänge<br />
mit der ganzen Familie unternommen. Nach einem Picknick im Sommer ist es für<br />
Schweden auch selbstverständlich, ihren eigenen Müll wieder mitzunehmen, was man<br />
von den Deutschen ja nicht gerade behaupten kann.<br />
23
Nimrod<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
24<br />
Abschließend sagt Miriam: „Ich fühle mich wohl hier in Schweden, aber von zu Hause<br />
fehlen mir viele Dinge. Meine Familie, meine Freunde, unsere Spülmaschine fehlen mir<br />
sehr, aber auch das Autofahren, deutsche Musik und der deutsche Radiosender ‘Einslive‘.<br />
Am meisten jedoch vermisse ich meine Schwester und die Zeit mit ihr.“<br />
Nach Sibirien<br />
Mein Großvater Nathan wurde 1932 in einer kleinen Stadt namens Narrol in Polen geboren.<br />
Zu der Zeit waren die meisten Bewohner von Narrol Juden. Als er siebeneinhalb war,<br />
brach der Zweite Weltkrieg aus und die deutsche Armee fiel in Polen ein. Deutsche Truppen<br />
fielen in Narrol ein, die Stadt wechselte in jener Woche mehrmals von polnischer zu<br />
deutscher Herrschaft und die meisten Häuser der Stadt wurden verbrannt. So wurden<br />
die Bewohner der Stadt zu Flüchtlingen. Die Familie meines Großvaters beschloss, in das<br />
Gebiet zu gehen, das von der Sowjetunion besetzt war und wurde so gerettet, denn die<br />
Juden, die im deutschen Herrschaftsgebiet blieben, wurden im Holocaust ermordet.<br />
Die Russen deportierten ihn und seine Familie wegen angeblicher Spionage in ein<br />
Arbeitslager in Archangelsk, nahe des nördlichen Polarkreises. Dort verbrachten sie zwei<br />
Jahre und litten unter der Kälte und heftigen Schneefällen. Nach zwei Jahren zogen sie<br />
in den Kaukasus (heute Georgien) und lebten dort viereinhalb Jahre, bis 1946. In jenem<br />
Jahr, nach Kriegsende, kehrten sie nach Polen zurück und hofften, ihre Verwandten zu<br />
finden. Leider trafen sie niemanden mehr an – sie waren alle ermordet, die meisten im<br />
Vernichtungslager Belzec, das in der Nähe der Heimatstadt meines Großvaters errichtet<br />
worden war. Mein Großvater machte nun eine Ausbildung an einer Schule für Rundfunk-<br />
und Elektrotechnik. 1950, nach seinem Abschluss, emigrierte er mit seiner Familie nach<br />
Israel.<br />
In Israel lebte mein Großvater zunächst im Durchgangslager Ein Shemer, bis die Familie<br />
eine Wohnung in Tel Aviv mieten konnte. Die Eltern meines Großvaters arbeiteten als<br />
Näher, sie nähten Vorhänge und hängten sie auf, und mein Großvater wurde von der<br />
Luftwaffe rekrutiert. 1958 lernte er meine Großmutter kennen und neun Monate später<br />
heirateten sie. Nach Beendigung seines Militärdienstes arbeitete mein Großvater als<br />
Elektroniker bei der Luftwaffe, studierte nebenbei und qualifizierte sich schließlich als<br />
Elektroingenieur. Er installierte Kommunikationssysteme, Navigationssysteme und Radarsysteme<br />
und arbeitete dort vierzig Jahre lang, bis er das Rentenalter erreichte.<br />
Israel ist ein besonderes Land. Es besteht aus vielen ethnischen Gruppen, die sich in<br />
vielerlei Hinsicht voneinander unterscheiden, etwa Herkunft, Religion, Kultur, geschichtlicher<br />
Hintergrund und sogar Sprache. Außerdem findet man in Israel viele heilige Orte<br />
der großen monotheistischen Religionen, weshalb es in diesem Land durch die Geschichte<br />
hindurch viele Konflikte gegeben hat. Selbst jetzt ist Israel das Zentrum eines blutigen<br />
Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern, die beide im selben Gebiet leben, das<br />
beide für sich beanspruchen. Die Kombination all dieser Dinge macht Israel zu einem<br />
besonderen Ort und es ist interessant, hier zu leben.<br />
Was ich an Israel mag, ist, was ich bisher beschrieben habe: seine Vielfalt und die Tatsache,<br />
dass es ein sehr dynamisches Land ist und manchmal überraschend. Außerdem<br />
glaube ich, dass es der einzige Ort ist, wo Juden in einem eigenen Staat leben können.
Die goldene Mitte<br />
Meine Großtante Elisabeth ist nicht nur eine Tante,<br />
vielmehr ist sie wie eine weitere Großmutter für<br />
mich. Ich kenne sie schon mein ganzes Leben lang<br />
und wir stehen uns sehr nah. Ich war die Erste,<br />
der sie aus ihrem Tagebuch vorgelesen hat. Dieses<br />
hat sie sorgfältig über Jahre hinweg geführt. Und<br />
ich bin die Erste, die einen Teil ihrer Geschichte<br />
aufschreiben darf.<br />
Am 2. Januar bin ich zu ihr gefahren, sie lebt in<br />
einer Stadt 60 km entfernt von mir. Zuvor hatte ich<br />
ihr von meinem Vorhaben berichtet und sie willigte<br />
ein, ein Stück ihrer Geschichte zu erzählen. Es war,<br />
als würden wir einen ganz gewöhnlichen Nachmittag<br />
miteinander verbringen. Nachdem wir Kaffee getrunken und Kuchen gegessen<br />
hatten, setzten wir uns auf ihr kleines Sofa. Zuerst haben wir ganz normal miteinander<br />
gesprochen, aber als dann die Videokamera angeschaltet wurde, waren wir beide<br />
erst einmal sprachlos. Im Verlauf des Abends ist allerdings ein sehr interessantes und<br />
bewegendes Gespräch entstanden, indem sie mir ein weiteres Mal aus ihrem Tagebuch<br />
vorgelesen hat.<br />
Elisabeth ist 1927 in einer kleinen Stadt im <strong>Münster</strong>land geboren. Somit ist sie heute 84<br />
Jahre alt. Sie ist das sechste von 12 Kindern, die „goldene Mitte“. Lies, so nennen wir sie,<br />
ist in einer Zeit aufgewachsen, in der es die Menschen nicht gerade leicht hatten. Sie<br />
lebte mit ihren Geschwistern, zwei ihrer Tanten und ihren Eltern in einem großen Haus.<br />
Ihr Vater besaß eine Gärtnerei, welche jede Menge Arbeit bedeutete. In dieser Familie<br />
gab es keine Faulheit, jeder wusste, was er zu tun hatte und jeder half mit. Sei es in der<br />
Gärtnerei, auf dem Feld oder im Haushalt, jeder hat seinen Beitrag geleistet.<br />
Seit 1933 herrschte auch das Regime der Nationalsozialisten. Dies war für Lies allgegenwärtig.<br />
Als eines Tages eine jüdische Familie hilfesuchend vor ihrer Haustür stand,<br />
entschloss sich Lies‘ Tante, diesen Menschen, so gefährlich es auch sein mag, zu helfen.<br />
Sie bat die Familie in die Küche und versorgte sie dort. Lies bekam all dies zu Gesicht,<br />
ihrer jüngeren Schwester war es untersagt, dabei zu sein. Ihre Lehrerin war ein fanatischer<br />
Nazi, deswegen war es zu riskant, dass ihre kleine Schwester dieser etwas erzählen<br />
könnte. Denn die Nationalsozialisten ließen keinen Platz für Oppositionelle oder generell<br />
Menschen, die ihre Ideologie in Frage stellten. Jeder, der sich ihnen widersetzte, wurde<br />
strengstens bestraft. Dadurch lebten die Menschen in ständiger Angst, von Freunden,<br />
Nachbarn oder vielleicht sogar von der eigenen Familie verraten zu werden. Ein paar<br />
Tage später war die jüdische Familie verschwunden. Elisabeth hat seither nichts mehr<br />
von ihnen gehört.<br />
Als der Krieg begann, begannen auch die Probleme der Menschen zuzunehmen. Es wurde<br />
jeder Mann, der verfügbar war, an der Front gebraucht, und so wurden auch einige<br />
Brüder von Lies eingezogen. Einer von ihnen war in Afrika stationiert, ein anderer befand<br />
sich später in italienischer Gefangenschaft. Hinzu kam, dass die Lebensmittel immer<br />
knapper wurden. Ihre Familie hatte Glück, die Gärtnerei zu besitzen, zwar gab es dadurch<br />
nur selten Fleisch, aber immerhin hatten sie genügend Gemüse, um zu überleben. Als<br />
Lies einmal mittags von der Schule kam, wurde sie direkt in den Laden geschickt, um<br />
auszuhelfen. Um 14.30 Uhr sollte der Verkauf beginnen, sie hatten schon ein Schild<br />
angebracht, auf dem stand: „Heute werden von 14.30-18.00 Uhr Krupbohnen verkauft.“<br />
Eine Stunde vor Beginn zog die Schlange der Wartenden sich schon bis an das Ende der<br />
Straße. An diesem Tag bedienten sie etwa 1000 Menschen, allerdings gingen 80 von<br />
ihnen mit leeren Händen nach Hause. Nach Ladenschluss hängten sie ein weiteres Schild<br />
auf: „Krupbohnen ausverkauft.“<br />
In der Schule hatte sich auch einiges verändert. Es war keine angenehme Atmosphäre.<br />
Man musste sehr vorsichtig sein mit dem, was man dort sagte. Eine Pflicht war es,<br />
Briefe an fremde Soldaten zu schreiben. Als ich das gehört habe, habe ich versucht, mir<br />
vorzustellen, was ich jemandem schreiben könnte, der irgendwo an einem mir unbekannten<br />
Ort ist, der in der ständigen Angst lebt, dass jeder Moment sein letzter gewesen sein<br />
könnte, und vor allem, über den ich im Grunde nichts weiß.<br />
Marie<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
25
26<br />
Zudem wurden einem jungen Mädchen, wenn es arisch war, noch andere Pflichten<br />
aufgezwungen. Zum Beispiel der Eintritt in den BDM ( Bund deutscher Mädel). Eine<br />
Organisation, die wollte, dass die arischen Mädchen „dem Volk erhalten bleiben“. Dazu<br />
gehörte auch Lies, die 1944 in ein Lager des BDM dienstverpflichtet wurde. Dort lernten<br />
sie Lieder und Tänze, die sie zum einen den verwundeten Soldaten im Lazarett vorführen<br />
mussten und zum anderen bei Märschen durch die Stadt zu präsentieren hatten. Lies<br />
fühlte sich ganz und gar nicht wohl dabei und sie erzählte, wie sich das Lager bald in<br />
zwei Gruppen teilte. Die eine unterstützte all dies und fand es gut und richtig, was in<br />
diesem Lager gesagt und getan wurde, die andere Gruppe war dagegen. Lies zählte zu<br />
der zweiten Gruppe. Sie erzählte, wie diese, wenn sie Ausgang hatte, sofort die BDM-<br />
Binden abriss und erst bei der Rückkehr wieder befestigte. Dabei mussten sie achtgeben,<br />
nicht von der Führerin erwischt zu werden, die ohnehin öfters mit ihnen schimpfte,<br />
wenn sie ihren Pflichten nicht nachgekommen waren. In den letzten Kriegstagen stürmte<br />
der Vater einer Freundin in das Lager, er forderte seine Tochter auf sofort mitzukommen<br />
und bot auch Lies an, mit ihm das Lager zu verlassen. Lies ergriff diese Chance und<br />
floh. Auf halber Strecke begegneten sie der Führerin und wurden von ihr gefragt, wo sie<br />
gedenken hinzugehen. Der Vater antwortete, dass sie nach Hause gingen und die Führerin<br />
erwiderte erbost und wörtlich: „Wenn sie bis morgen früh um acht nicht wieder da<br />
sind, werden sie nach den Kriegsgesetzen bestraft.“ Meine Tante kommentierte dies mit<br />
den Worten: „Darauf warte ich heute noch.“<br />
Kurz darauf spitzte die Lage sich zu. Es war offensichtlich, dass die Deutschen den Krieg<br />
verlieren würden, die alliierten Truppen standen wenige Kilometer vor ihrem Heimatort.<br />
Lies‘ Vater hatte dies erkannt und hing zum Zeichen seines Ergebens die weiße Flagge<br />
aus dem Fenster. Daraufhin kam sofort ein Soldat in das Haus gestürmt und forderte ihn<br />
auf, die Waffe auf seinen Kopf gerichtet, die Fahne wieder hereinzuholen. Unter diesen<br />
Umständen sollten noch zwei ihrer Nachbarn umkommen.<br />
Nach dem Krieg bauten sie ihr Familienunternehmen erneut auf. Glücklicherweise kehrten<br />
alle Kinder heim. Lies beendete ihre Schulkarriere mit dem Abitur, allerdings war es<br />
ihr untersagt zu studieren, da die rückkehrenden Soldaten Vorrang hatten. Stattdessen<br />
nahm sie einen Job bei der Post an und half weiterhin zu Hause aus. Als sich dann die<br />
Möglichkeit bot, einen Job in einer größeren Stadt anzunehmen, lehnte sie dies ab. Denn<br />
zu gleicher Zeit benötigte ihre Schwester, meine Großmutter, dringend Hilfe. Sie brauchte<br />
jemanden, der für ihre Kinder sorgte, wenn sie und mein Großvater ihrer Tätigkeit<br />
als Internisten in ihrer eigenen Praxis nachgingen. Und da Lies ein absoluter Familienmensch<br />
ist, stellte sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten an und half ihrer Schwester aus.<br />
Nach einiger Zeit hatte die Praxis sich vergrößert und so sprang Lies auch hier ein, um<br />
den Arbeitsalltag zu erleichtern. Und so ergab es sich, dass Lies seither in der kleinen<br />
Stadt geblieben ist.<br />
Zu meinem Glück, denn dadurch ist sie in mein oder vielmehr bin ich in ihr Leben getreten.<br />
Seit meiner Geburt werde ich von ihr umsorgt und ich profitiere sehr von ihrem<br />
eingefleischten Familiensinn. Heute ist Lies mit ihren 84 Jahren eine lebenslustige,<br />
fürsorgliche und jung gebliebene Tante, die sich mit viel Herz um das Wohlergehen aller<br />
Familienmitglieder kümmert.<br />
In ihrer Schulzeit musste Lies einmal einen Aufsatz über einen Menschen schreiben,<br />
den sie verehrt und so habe auch ich heute über einen Menschen geschrieben, den ich<br />
verehre und bewundere, über unsere „goldene Mitte“ Elisabeth.
Mendelsohns Architekt<br />
Mein Urgroßvater Gad Asher wurde am 7. Oktober 1908 in Berlin geboren. Sein Vater<br />
Zigfrid Asher war dort Architekt. 1932 beendete er sein Studium an der Fachhochschule<br />
als Ingenieur und wurde Architekt wie sein Vater. Er heiratete Miriam. Als die Nazis an<br />
die Macht kamen, wurde ihr Besitz beschlagnahmt. Aufgrund der Verfolgung durch die<br />
Nazis zog die Familie nach Paris und wanderte dann aus zionistischen Gründen nach<br />
Israel aus. Die Familie lebte in Jerusalem. Sie bekamen zwei Töchter, Yael (meine verstorbene<br />
Großmutter) und Michal.<br />
Gad liebte das Land und lebte sich schnell in die Jerusalemer Gesellschaft ein. Er arbeitete<br />
als Chefarchitekt bei „Mendelsohn Office Architect“, das eines der berühmtesten<br />
Architekturbüros der Welt war. Er war verantwortlich für die Planung vieler Gebäude im<br />
ganzen Land, zum Beispiel des „Hadassah-Krankenhauses“, des Hauses von Professor<br />
Chaim Weitzman, der Landwirtschaftsschule „Kaduri“ und des „Rambam-Krankenhauses“<br />
in Haifa. Eine Abteilung des Krankenhauses wurde nach ihm benannt.<br />
Gad war während des Unabhängigkeitskriegs in der „Hagana“ (Vorgängerin der späteren<br />
Streitkräfte) und er war für die Bunker in Jerusalem zuständig. Noch während dieses<br />
Kriegs zog die Familie nach Tel-Aviv. Von 1948 bis 1965 war er Chefarchitekt des Staates<br />
Israel. Er war verantwortlich für die Planung der meisten öffentlichen Gebäude in Israel,<br />
beispielsweise des „Sde-Dov-Flughafens“, des ersten „Ben Gurion-Flughafens“, der ersten<br />
Entwürfe der „Knesset“ (israelisches Parlament) und vielem mehr.<br />
Im März 1965, mit 53 Jahren, starb Gad Asher an Krebs.<br />
Er war ein so angesehener Architekt, dass Jigal Allon, der damalige Arbeitsminister, bei<br />
seiner Beerdigung einen Nachruf hielt. Seine Frau starb etwa ein Jahr später ebenfalls<br />
an Krebs. Gad war außerdem Maler. Er liebte es, israelische Landschaften zu malen,<br />
vor allem Ansichten von Jerusalem und Zefat. Wir besitzen noch viele seiner Gemälde.<br />
Studenten der Architektur-Fakultät am Technion haben ihm zu Ehren eine Broschüre<br />
herausgegeben.<br />
Meine Freunde repräsentieren die Gesellschaft von Israel. Sie kommen aus aller Welt:<br />
Russland, Indien, Argentinien und Amerika. Ich liebe mein sonniges Land; alle lächeln<br />
und sind fröhlich, trotz der schwierigen Sicherheitslage.<br />
Israel ist ein kleines Land, umgeben von Feinden, aber die Israelis helfen einander,<br />
indem sie Familien aufnehmen, die in der Nähe der Grenzen leben, oder Süßigkeiten und<br />
Geschenke an die Soldaten verschicken. Mein Land schickt bei allen Naturkatastrophen<br />
medizinische Hilfe in andere Länder; israelische Ärzte helfen Kindern in der ganzen Welt.<br />
Ich liebe die Ferien in Israel, die magische Stimmung an Freitagnachmittagen in der<br />
Luft. Ich liebe die hebräische Sprache. Für mich bedeutet Israel Ausflüge mit der Familie,<br />
bei denen wir alte israelische Lieder singen. Es bedeutet auch, traditionelle Gerichte zu<br />
essen, die mein Großvater zubereitet.<br />
Nächstes Jahr werde ich meinen Militärdienst bei den IDF (Israel Defense Forces) antreten.<br />
Ich freue mich auf diese Erfahrung und auf die Gelegenheit, meinem Land dienen zu<br />
können.<br />
Haus in Zefat<br />
Nitzan<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
27
Julia<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
28<br />
Lena in Kenia<br />
Meine Schwester Lena ist 19 Jahre alt. Sie wohnte bis jetzt noch in <strong>Münster</strong>/Mecklenbeck<br />
in einem Einfamilienhaus bei unserer Familie. Momentan allerdings macht sie ein<br />
Auslandsjahr in Kenia.<br />
Schon lange bevor sie ihr Abitur an der <strong>Friedensschule</strong> in <strong>Münster</strong> machte, entschied<br />
sie sich, für ein Jahr nach Afrika zu gehen. „Ich dachte darüber nach, wie es wohl mit<br />
mir weiter gehen sollte, nachdem ich die Schule mit dem Abitur abschließen wollte. Ich<br />
wusste noch nicht, was ich später machen könnte, ob ich Arzt, ein Lehrer oder etwas<br />
ganz anderes werden wollte?“ Somit entschied sie sich schließlich dafür, nicht direkt<br />
studieren zu gehen, sondern ein Jahr in ein anderes Land. Sie wollte dort Erfahrungen<br />
sammeln, die sie sonst nicht machen könnte. Auch entsprach Afrika ihren Interessen, in<br />
einer anderen Kultur zu leben. „Ich habe schon immer davon geträumt, nach Afrika reisen<br />
zu dürfen und dort den ‚African Spirit‘ zu erleben. Ich wollte die schöne Landschaft<br />
genießen und etwas über die vielen verschiedenen Stämme lernen. Warum genau Kenia<br />
zur Wahl kam, weiß ich nicht. Ich informierte mich über den afrikanischen Kontinent<br />
und wusste dann, dass ich all das in Kenia sehen und erleben wollte.“<br />
Ruai, die Stadt, in der meine Schwester Lena zurzeit lebt, ist eigentlich recht ländlich.<br />
„Manchmal trifft man auf dem Weg zum nächsten Laden mehr Kühe als Menschen an.<br />
Viele der Leute haben ihre eigenen kleinen Läden, in denen sie Früchte, Gemüse, Eier<br />
oder Brot verkaufen. Besonders gern esse ich die kenianischen Früchte. Mangos sind hier<br />
sehr süß und wesentlich leckerer als in Deutschland.“<br />
Jetzt ist Lena bereits seit fünf Monaten dort und arbeitet in einem Waisenhaus für<br />
Kinder, welches ca. 30 km von Kenias Hauptstadt Nairobi entfernt liegt. Sie wohnt mit<br />
der Direktorenfamilie und teilt dort mit einem anderen Mädchen aus Deutschland ihr<br />
Zimmer. Das Waisenhaus verfügt über 133 Plätze für Kinder im Alter von 1 bis 22 Jahren.<br />
Es besitzt 9 Schlafzimmer für die Kinder, wo sie ihre Betten, ihre Boxen für ihre eigene<br />
Kleidung und manch andere Sachen stehen haben. Des Weiteren gibt es noch eine kleine<br />
Küche mit zwei Öfen, wo die Kinder selbstständig ihr eigenes Essen zubereiten. Feuer für<br />
den Ofen zu machen, lernen die Kinder schon im Alter von acht Jahren. Auch die Kleidung<br />
zu waschen, zu kochen oder das Zimmer sauber zu halten, wird den Jüngeren von<br />
den Älteren beigebracht. Das Waisenhaus hat auch eine Schule mit zehn Klassenräumen.<br />
Das Schulsystem ist anders als bei uns. Die Kinder gehen für acht Jahre zur ‚Grundschule‘<br />
und danach vier weitere Jahre zur ‚weiterführenden Schule‘. Wenn sie ihre Abschlussprüfungen<br />
in der zwölften Klasse bestanden haben, könnten sie auch an eine Universität<br />
gehen. Leider ist das Studieren dort sehr teuer, sodass viele diese Möglichkeit nur durch<br />
einen Sponsor finanziert wahrnehmen können.<br />
„Meine Arbeit ist es, wo auch immer ich kann, zu helfen. Auch unterrichte ich die Kinder<br />
im Fach Sport von Klasse 1 bis Klasse 8. Die Jungen lieben es, Fußball zu spielen. Andere<br />
Sportarten möchten sie weniger gerne machen, anders als die Mädchen. Diese sind mehr<br />
an Spielen, bei denen man rennen muss, interessiert.“ Alle Kinder singen gerne, was sie<br />
besonders am Morgen tun. Um 5 Uhr stehen sie auf, um die Klassenräume zu putzen, das<br />
Frühstück zuzubereiten, zu duschen oder sich für die Schulstunde vorzubereiten. „Zum<br />
Glück habe ich nie Schulstunden vor 10 Uhr, sodass ich schlafen kann, bis mich die Sonne<br />
gegen 7 Uhr aufweckt. Wenn die Schule vorbei ist, gibt es viel, was wir tun können.<br />
Zum Beispiel rasieren wir die Köpfe der Kinder, da es eine Schulregel ist, die Haare bis<br />
zur achten Klasse kurz zu haben. Man kann sich vorstellen, dass es sehr viel Zeit benötigt,<br />
sicher zu stellen, dass über 90 Köpfe zu jeder Zeit rasiert sind. Mir tun besonders die<br />
Mädchen Leid, weil die meisten von ihnen es nicht mögen, ihre Haare kurz zu haben. Sie<br />
sagen, sie schauen dann immer aus wie die Jungen. Ich bin wirklich froh darüber, meinen<br />
Kopf für die Schule nicht rasieren zu müssen. Ich muss immer darüber nachdenken, wie<br />
ich dann aussehen würde.“ Manchmal backen Lena und ihre Freundin aus Deutschland<br />
Brötchen für das Frühstück. Die Kinder bekommen für gewöhnlich nur vier Tage in der<br />
Woche Brot. An den anderen Tagen essen sie eine Art von Haferbrei. Wie alles dort, dauert<br />
auch das Brotbacken eine lange Zeit (um die drei bis vier Stunden). Weil die Kinder<br />
Brötchen lieben, nehmen sie den Aufwand gerne in Kauf. Hauptsächlich wird im Waisenhaus<br />
Ugali zubereitet. Dies ist ein Gericht aus Maismehl und abgekochtem Wasser. Dazu<br />
gibt es rote Bohnen oder Sukuma Wiki, eine Art Spinat.
„Mein Lieblingsessen ist Chapati, was man mit Pfannkuchen vergleichen kann. Ich habe<br />
bereits gelernt, wie man diese anfertigt, und ich habe vor, all das Essen auch in Deutschland<br />
meiner Familie zu kochen. Trotzdem vermisse ich auch das deutsche Essen, insbesondere<br />
die Vielfalt der Geschmacksrichtungen. Jetzt, während der Weihnachtszeit, hatten<br />
wir einen Weihnachtsworkshop, bei dem wir Sterne oder andere Dekoration für den<br />
Speisesaal bastelten. Meine Gastfamilie feiert Weihnachten wegen ihrer Religion nicht,<br />
dennoch wollten meine Zimmerpartnerin und ich unsere eigene kleine Weihnachtsfeier<br />
zelebrieren und auch für alle Kinder Plätzchen backen. An manchen Tagen genieße ich<br />
es einfach, Zeit mit den Kindern verbringen zu können, aber es gibt natürlich auch Tage,<br />
an denen ich meine Familie und Freunde sehr vermisse und ich am liebsten den nächsten<br />
Flug zurück nach Deutschland nehmen würde.“<br />
Die meiste Zeit sind die Kinder wirklich süß, aber manchmal können sie auch sehr frech<br />
sein. Dazu muss man wissen, dass Gewalt ein Teil des Lebens der Kinder bestimmt. Manche<br />
Lehrer schlagen die Kinder zur Strafe, auch wenn dies illegal ist. Auch kommen viele<br />
der Kinder schon mit schlechten Erfahrungen von Gewalt zum Waisenhaus. „Das ist nicht<br />
immer einfach, weil, wenn Kinder ein Paar deiner Schnürsenkel klauen oder auch etwas<br />
anderes, man persönlich wütend und sauer darüber wird. Glücklicherweise passiert das<br />
nicht oft, dennoch macht es mich traurig.“<br />
Lena hat bisher keine Ausbildung oder sonstiges zum Lehrerberuf, sodass dies etwas<br />
Neues für sie ist und sie sich manchmal nicht sicher ist, wie sie den Unterrichtsstoff<br />
vermitteln soll. Allerdings erkennt sie, dass sie mit der Zeit immer mehr Vertrauen darin<br />
gewinnt. Die kenianische Kultur zu beschreiben, gestaltet sich als schwierig. Es gibt über<br />
46 verschiedene Stämme, welche alle ihre eigene Kultur und Tradition pflegen und ihre<br />
eigene Sprache sprechen. Die Landeshauptsprachen sind jedoch Englisch und Kiswahili.<br />
Die Schulstunden werden auf Englisch gehalten. Die meisten Menschen, die Lena<br />
bereits getroffen hat, waren alle sehr religiös. Vor allem in dem Waisenhaus kennen die<br />
Kinder die Bibel perfekt und sie können viele Bibelverse auswendig aus dem Kopf heraus<br />
sagen. Oft reden sie über Gott (‚Mungu‘) und sie gehen in die Kirche The Seventh Day<br />
Adventist’s Church.<br />
„Eines Tages stellte mir ein Mädchen viele Fragen mit Bezug zur Bibel und war sehr enttäuscht,<br />
als ich ihr diese nicht beantworten konnte. Manchmal ist es wirklich schön zu<br />
sehen, wie sehr sie in Gott vertrauen und an ihn glauben, wenn jemand von ihnen mehrere<br />
schlechte Dinge erleben musste. Aber gleichermaßen bin ich ein bisschen skeptisch,<br />
nur zu Gott zu beten, anstatt etwas selbstständig zu verändern.“<br />
Ein neues Land<br />
Mein Großvater Shimshon wurde 1910 in Tarnopol geboren (damals Polen, heute Ukraine)<br />
und wuchs zunächst dort auf. Er hatte fünf Brüder und Schwestern – doch nur er<br />
überlebte als einziger den Holocaust.<br />
Als der Zweite Weltkrieg begann, floh er in die UdSSR – und rettete dadurch sein Leben.<br />
Als er nach dem Krieg in seine Heimatstadt zurückkehrte, fand er keine Überlebenden<br />
seiner Familie und auch keinerlei Hinweise über ihren Verbleib.<br />
Diese schreckliche Erfahrung machte ihn für den Rest seines Lebens zu einem verschlossenen,<br />
traurigen Menschen – was alle in seinem Umfeld berührte. Aus diesem Grund ist<br />
über ihn und seine Vergangenheit sehr wenig bekannt.<br />
Nach dem Krieg arbeitete er als Lehrer und Rektor einer Schule, wo er dann meine<br />
Großmutter kennenlernte, Bat-Sheva, die er 1948 heiratete. Ein Jahr später wurde meine<br />
Tante Fanny in Polen geboren.<br />
Mein Großvater war zionistischer Aktivist, was zu jener Zeit im kommunistischen Polen<br />
verboten war, so dass die Regierung ihn verhaften wollte.<br />
Sein Schwager, ein Regierungsbeamter, erfuhr davon und warnte meine Großeltern.<br />
Daraufhin packten sie schnell alles zusammen, was sie konnten, und verließen Polen<br />
zusammen mit meiner Tante in der Nacht vor der Verhaftung. So kamen sie 1957 nach<br />
Israel. Ein Jahr später wurde mein Vater Moshe geboren.<br />
Tomer<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
29
30<br />
Mein Vater glaubt, dass mein Großvater extrem enttäuscht darüber war, wie er in Israel<br />
behandelt wurde – er meinte, er habe aufgrund seiner vorherigen Erlebnisse und Taten<br />
eine andere Behandlung verdient.<br />
Mein Großvater leistete schwere körperliche Arbeit an verschiedenen Arbeitsstellen.<br />
Manchmal bekam er nicht einmal seinen Lohn, um die Familie zu ernähren, und es fiel<br />
ihm schwer, das alltägliche Leben zu bewältigen, auch als er später als alter Mann in<br />
den Ruhestand ging.<br />
Trotz seiner Schwierigkeiten verlor mein Großvater nie ein schlechtes Wort über Israel –<br />
er war immer der Meinung, dass Israel der Ort sei, wo alle Juden leben sollten.<br />
Mein Großvater starb 1992 im Alter von 82 Jahren an einem Herzleiden, ein halbes Jahr,<br />
nachdem seine Frau, meine Großmutter, ebenfalls an einem Herzleiden verstorben war.<br />
Zu der Zeit war mein älterer Bruder zwei Jahre alt und meine Schwester ein halbes Jahr.<br />
Ich bin stolz und fühle mich geehrt, dass ich nach meinem Großvater benannt bin, weil<br />
ich weiß, dass ich den Namen eines großen Mannes trage, der sich um die Menschen<br />
sorgte und kümmerte, die er liebte – selbst nach allem, was er durchgemacht hatte. Ich<br />
heiße Tomer Shimshon Shvadron und das war meine „Untold Family Story“ über meinen<br />
Helden – meinen Großvater Shimshon.<br />
Wenn ich über mein Israel nachdenke, kommt mir als erstes die israelische Musik in den<br />
Sinn. Da ich Musiker bin, hat mich diese Musik sehr beeinflusst. Ein Beispiel für einen<br />
Musiker, der mein Israel repräsentiert, ist Shlomo Artzi.<br />
Shlomo Artzi ist hier in Israel geboren und aufgewachsen. Seine Karriere als Musiker<br />
begann während seines Armeedienstes bei den IDF (Israel Defense Forces - Israelische<br />
Verteidigungskräfte).<br />
In Shlomos Musik geht es meistens um das Leben in Israel. Manche seiner Lieder drücken<br />
seinen Wunsch nach Frieden mit den umliegenden Ländern aus, in anderen singt er<br />
davon, dass er keinen Kummer und keine Traurigkeit haben will.<br />
Als Kind und Teenager habe ich Israel durch Shlomos Augen gesehen – ein wunderschönes<br />
Land, das unsere Liebe und Fürsorge verdient und das uns nach den Schrecken des<br />
Holocausts unser Leben wiedergegeben hat.<br />
Wenn ich über mein Israel nachdenke, denke ich an den patriotischen Stolz und die Ehre<br />
unserer großartigen Soldaten, die für uns Bürger ihr Leben opfern.<br />
Ich habe großen Respekt vor Israel und kann mir keinen anderen Weg vorstellen, meinen<br />
Dank zurückzugeben, als selbst in der Armee zu dienen.<br />
Dieses Gefühl kommt auch in Shlomos Liedern „Wir brauchen nicht“ und „Ein neues<br />
Land“ zum Ausdruck: „Wenn wir nicht langsamer werden, werden wir nicht sehen, werden<br />
wir die Einzelheiten nicht erkennen, werden wir nicht ankommen – in einem neuen<br />
Land.“<br />
Die Kriegsgefangenen<br />
Katharina<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion Dies ist die Geschichte meiner Oma Antonia, genannt Toni. Im Folgenden erzählt sie<br />
von den Kriegsgefangenen, die ihre Familie während des Zweiten Weltkrieges bei sich<br />
aufgenommen hatte.<br />
„Anfang der vierziger Jahre kamen die ersten Kriegsgefangenen zu uns auf den Bauernhof<br />
als Arbeiter. Es waren zwei Franzosen, ihre Namen waren Eduard und Renault.<br />
Jeden Tag mussten sie zu Fuß aus dem Dorf, wo sie in einem Sammellager einen Schlafplatz<br />
hatten, zu unserem Bauernhof laufen. Tagsüber arbeiteten die beiden dann auf<br />
dem Acker und verrichteten die Arbeiten, die auf einem Hof so anfallen. Abends haben<br />
die beiden sich dann wieder zu Fuß auf ihren zwei bis drei Kilometer langen Heimweg<br />
gemacht. Später wurde es genehmigt, dass der ältere der beiden, Eduard, bei uns auf<br />
dem Speicher schlafen durfte. Ich nehme an, dass die Aufseher des Sammellagers das so<br />
entschieden haben, damit er direkt an seinem Arbeitsplatz war. Sowohl Eduard als auch<br />
Renault waren sehr fleißige Personen und sehr ordentlich. Wir wohnten zwischen Bahn<br />
und Straße. Dort wurden oft Bomben auf die Bahnschienen abgeworfen. Zum Schutz<br />
hatten wir eine Art Röhrenunterstand. Darin konnte man nicht gerade stehen, aber es
gab Bänke zum Sitzen. Eduard hat meine körperlich behinderte Schwester oft auf seinem<br />
Arm in den Bunker getragen, bevor er selbst dorthin ging. Das fand ich sehr fürsorglich.<br />
Ich schätze, Eduard und Renault waren insgesamt von 1941 bis 1945 bei uns.“<br />
1945 sind die Amerikaner in das <strong>Münster</strong>land eingezogen. Nach der Einnahme durch die<br />
Amerikaner ging es chaotisch zu und die Menschen waren verunsichert. Die Amerikaner<br />
durchsuchten Häuser nach deutschen Soldaten, wobei viele Häuser in Flammen aufgingen.<br />
Doch auch die Deutschen plünderten und begingen Überfälle.<br />
„Während eines Volkssturms wurde ein Panzer der Amerikaner in Brand gesetzt. Als<br />
Rache haben sie dann zehn Höfe rund um das Dorf in Brand gesetzt. Als das passierte,<br />
waren Eduard und Renault auch noch bei uns. Wir versteckten uns im Keller in einem<br />
Unterstand, während das Wohnhaus und die Tenne brannten - alles stand bereits in<br />
Flammen, als wir etwas bemerkten. Dann haben die beiden meine behinderte Schwester<br />
herausgetragen und in eine Mulde hinter dem Garten gelegt. Die Franzosen haben<br />
geholfen, dass wir noch unseren Küchenherd, der in den Trümmern stand, und ich weiß<br />
nicht mehr, was noch alles, in unseren Speicher kriegten, damit wir dort, als unser Haus<br />
abgebrannt war, leben und auch kochen konnten. In dem Speicher, in dem wir dann<br />
lebten, war nur Lehmboden. Ansonsten waren ja auch Geschirr und Möbel weg, eigentlich<br />
alles war weg. Ein Teil der Tiere war auch verbrannt. Die Höfe konnten nur durch<br />
gegenseitige Hilfe aufgebaut werden. Wir hatten zwar wohl schon aufgeräumt und<br />
meine Schwester und ich haben Steine gekloppt, die man noch verwenden konnte. Da<br />
unser Nachbar auch komplett abgebrannt war, war das allerdings schwer bei uns mit<br />
den gegenseitigen Hilfeleistungen, die aber trotzdem geleistet worden sind. Da haben<br />
wir dann erst die Stallungen wieder fertig gemacht, damit die Kühe wieder in den Stall<br />
konnten und damit da wieder ein Dach drauf kam. Und später dann das Wohnhaus.<br />
Selbstverständlich haben auch wir Mädchen geholfen.<br />
Ein Problem war natürlich auch, dass wir kein Geld hatten. Unser Nachbar hat z.B.<br />
ein Stück Land verkauft, um Geld zu kriegen. So etwas wie Schadensersatz wegen<br />
Kriegseinwirkung bekamen wir nicht. 1952 wurde ein Gesetz über den Lastenausgleich<br />
verabschiedet. Ich glaube, der Lastenausgleich betrug 4 000 Mark damals. Aber was war<br />
das schon für einen ganzen Hof. Deswegen ist unser Hof auch viel kleiner neu gebaut<br />
worden. Möbel und Essensvorräte haben wir von anderen geschenkt gekriegt. 1954 war<br />
der Hof dann komplett fertig.<br />
Nach etlichen Jahren haben wir dann von den Kriegsgefangenen gehört und der Eduard<br />
hat uns auch mal mit seiner Frau und seiner Tochter besucht. Daraus ist eine ziemlich<br />
enge Verbindung entstanden, auch da unsere Nachbarn öfters in Frankreich waren.<br />
Eduard hat auch mich wiederholt nach Frankreich eingeladen, aber ich hatte hier so viele<br />
Pflichten, ich konnte nicht weg. Das war auch eigentlich das Ende dieser Verbindung.<br />
Obwohl seine Tochter während ihres Studiums einmal alleine bei uns war und ich mich<br />
mit ihr unterhalten habe.<br />
Wir haben auch einmal ein russisches Mädchen bei uns aufgenommen. Ihr Name war<br />
Anja. Anja war mit einem deutschen Arbeiter befreundet. Er arbeitete in Russland bei der<br />
Eisenbahn. Die deutschen Kollegen des Mannes wollten diese Freundschaft der beiden<br />
unterbinden. Deswegen hat man geplant, Anja nach Deutschland in ein Arbeiterlager zu<br />
schicken. Der Mann ist Anja nach Deutschland hinterher gereist und hat sie im Sammellager<br />
gefunden. Daraufhin hat er meinen Vater gebeten, Anja als Erntehelferin anzufordern.<br />
So ist sie dann bei uns gelandet. Unser Verhältnis war gut. Ich weiß noch, dass die<br />
Mutter von der Anja einmal für uns Schafswolle gesponnen hat. Anja hat erzählt, dass<br />
ihre Mutter das gut könnte, und hat die Sachen dann nach Russland geschickt. Aber<br />
dennoch war es natürlich hart für sie, denn sie musste, ja wie alt war sie da, mit 20 in<br />
der Fremde arbeiten. Anja ist bei uns bis zum Ende des Krieges geblieben. Ich meine,<br />
dass Anja dann später nach Amerika gegangen ist. Anja hat uns später ein paar Mal<br />
besucht, als wir schon im Speicher lebten, nachdem unser Haus abgebrannt war und als<br />
sie schon ein Kind mit einem Polen hatte. Danach haben wir von ihr nichts mehr gehört.<br />
Insgesamt war sie vielleicht auch nur zwei Jahre bei uns. Ja, was soll ich sagen? So war<br />
das Leben früher. Es war eine schwere Zeit. Für viele Menschen. Für die Gefangenen. Für<br />
die Ausländer. Und für uns auch. Schwierig in vielerlei Hinsicht. Was Entwicklung oder<br />
auch sich selbst weiterzubilden anging. Alles lag still. Ich denke, dass es für meine Eltern<br />
31
Noam<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
32<br />
schlimmer war. Sie waren alt und hatten keine Kräfte mehr und wir konnten arbeiten.<br />
Wir konnten etwas Neues schaffen.“<br />
Die Geschichte meiner Oma hat mir einen guten Einblick in die Zeit des Zweiten Weltkrieges<br />
gegeben. Besonders fasziniert hat mich der Kontrast in ihrer Geschichte. Zum<br />
einen hat sie während dieser schrecklichen Zeit neue Freundschaften schließen können.<br />
Aber andererseits sieht man an dem Beispiel von Anja, wie Freundschaften auch unterbunden<br />
wurden.<br />
Unser eigenes Land<br />
Meine Großmutter Rosa Kolel wurde 1949 in Jerusalem geboren und ihre Familie hatte<br />
dort schon zwei Jahre gelebt. 1951 zogen sie in die Türkei, weil ihr Vater ein Einzelkind<br />
war und sein Vater wollte, dass er in seiner Nähe lebte. Er organisierte ein Haus und eine<br />
Arbeit, und so überredete ihr Vater sie und sie zogen zurück in die Türkei. Sie lebten dort<br />
sehr gut. Ihr Vater arbeitete als Löter, er hatte seine eigene Werkstatt und ihre Mutter<br />
war Hausfrau. Meine Großmutter ging auf eine Jüdische Schule und führte ein normales<br />
Leben. Ende 1950 gingen zwei ihrer Brüder mit einer zionistischen Jugendorganisation<br />
nach Israel zurück, weil die Lebensbedingungen in der Türkei bedrohlich waren, und<br />
zwei Jahre später erhielt mein Urgroßvater Drohbriefe von Antisemiten. 1963 zogen sie<br />
zurück nach Israel und lebten in Aschkelon. Als sie dort ankamen, war die Familie wieder<br />
vereint. Ihr Bruder kam zur Familie zurück und ihr Vater fand eine Arbeit. Als meine<br />
Großmutter kam, hatte sie damit gerechnet, schreiben zu lernen. Dann dachte sie, sie<br />
hätte Zeit zu reisen und ihre Jahre als Teenager zu genießen, aber ihre Eltern hatten andere<br />
Pläne für sie. Sie beauftragten eine Heiratsvermittlerin und im Alter von 17 Jahren<br />
heiratete sie. Deshalb ging sie nicht in die Armee.<br />
Sie sagte mir, dass alles sehr schnell ging. Von einem Teenager, der gerade nach Israel<br />
gekommen war, wurde sie zur Ehefrau. Aber sie war froh, dass ihre Familie nach Israel<br />
zurückgegangen war, weil sie spürte, dass dies und kein anderer Ort ihre wahre Heimat<br />
war. In Israel musste sie nicht arbeiten, weil mein Großvater sich um alles kümmerte,<br />
also war meine Großmutter Hausfrau. Sie liebte es, auszugehen und zu reisen, sie<br />
lernte Hebräisch lesen und schreiben, aber vor allem liebte sie es, Zeit mit ihren Kindern<br />
Vivi und Yehuda zu verbringen. Ihre Kinder schlossen die Highschool mit Erfolg ab und<br />
absolvierten ihren Militärdienst. Sie arbeiten beide in einem Büro und haben jeweils<br />
zwei Kinder, Nitzan, Noam, Shaked und Yotam. Ich und mein Cousin Yotam werden nach<br />
Abschluss der Schule zur Armee gehen.<br />
Am Ende des Interviews fragte ich meine Großmutter, was sie an Israel am meisten liebe,<br />
und sie sagte: „... das Gefühl, dass dies meine Heimat ist! Egal, wohin ich gehe, spüre ich,<br />
dass es dort niemanden gibt, der einen dafür hasst, wer man ist.“ Nach dem Interview<br />
freute ich mich, dass ich neue Dinge über die Vergangenheit meiner Familie erfahren<br />
habe, und ich hatte auch das Gefühl, dass ich trotz des Generationsunterschieds genauso<br />
denke und fühle wie sie: Ich liebe Israel und bin stolz, hier zu leben!<br />
Für mich ist Israel nicht das Land, das Gott uns gegeben hat. Es ist der Ort, an dem du<br />
deine Zukunft auf der Grundlage der Geschichte gestaltest. Israel ist mein Land, meine<br />
Heimat, wo meine Eltern und Großeltern ihre Familien gründeten, ihre Traditionen weitergaben<br />
und dazu beitrugen, ihre Kultur zu bewahren.<br />
Für mich ist es ein Grund, stolz zu sein. Nach allem, was wir durch die Geschichte hindurch<br />
erlitten haben, vor allem im Holocaust, haben wir unser eigenes Land. Für mich ist<br />
Israel ein großer Teil meiner Persönlichkeit, meines Verhaltens, meines Stils und vor allem<br />
meiner Gedanken und Meinungen zu allen möglichen Dingen, die heute geschehen. Was<br />
ich an meinem Land am meisten liebe, ist die Natur, die wunderschönen Landschaften.<br />
Sie sind etwas Besonderes und in keinem anderen Land der Welt zu finden. Ich genieße<br />
es, Teil dieses erstaunlichen Landes zu sein, das seinen eigenen Charakter hat, und nirgendwo<br />
sonst findet man Menschen, die so sehr mit dem Ort verbunden sind, an dem sie<br />
leben, die die Bedeutung von „eine Heimat, ein Volk“ verstehen und dass wir unser Israel<br />
beschützen müssen.
Im Leben eines Kindes<br />
Im Leben eines Kindes sind Großeltern sehr wichtige familiäre Bezugspersonen. Meine<br />
Großmutter war einer dieser wichtigen Menschen für mich. Leider ist sie vor gut drei<br />
Jahren, als ich 15 Jahre alt war, verstorben. Es war das erste Mal, dass ich mich aktiv mit<br />
dem Tod auseinandersetzen musste und mit der Tatsache, eine geliebte Person zu verlieren.<br />
Dennoch habe ich meine Oma sehr gut in Erinnerung und wenn ich an sie denke,<br />
sehe ich eine herzliche und überaus hilfsbereite Person, die immer gute Laune versprüht.<br />
Sie hatte drei ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder und somit war sie eines von<br />
fünf Kindern. Bei einer solchen Anzahl von Kindern in einem Haushalt kann man sich<br />
durchaus vorstellen, dass es mitunter sehr lebhaft zugegangen sein muss. Meine Oma<br />
wurde im Jahr 1924 geboren und hieß Elisabeth. Wie es sich mit Großmüttern so verhält,<br />
erzählte auch sie gerne Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit. Eine Geschichte, die<br />
meine Oma mir erzählte, ist mir besonders gut in Erinnerung geblieben und sie hat mich<br />
schon früher des Öfteren erheitert.<br />
Zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Geschichte zugetragen hat, war meine Oma Elisabeth<br />
sechs Jahre alt. Sie ging genau wie ihre drei älteren Schwestern schon zur Schule. Es war<br />
ein normaler Wochentag, der 30. September 1931, denn an dem Tag, an dem die Geschichte<br />
sich abspielte, hatten sie Schule. Als Elisabeth und ihre drei Schwestern von der<br />
Schule nach Hause kamen, wurden sie von der Haushaltshilfe der Familie, die Trautchen<br />
Hündchen hieß und ungeachtet ihres Namens für die Kinder eine Respektsperson war,<br />
abgefangen und mit der Begründung, die Mutter brauche Ruhe, sie sei krank, zu einer<br />
bekannten Familie geschickt. Dort wurden sie mit einer bemühten Freundlichkeit empfangen.<br />
Den Nachmittag verbrachten sie alle ohne Trautchen bei der besagten Familie. Es<br />
gab reichlich Kuchen und Säfte für die Mädchen und die Zeit wurde mit diversen Spielen<br />
und Märchenvorlesen verbracht. Es herrschte eine merkwürdige Stimmung, im Nachhinein<br />
konnte man sie als freudige Erwartung bei den Erwachsenen deuten. Vor Einbruch<br />
der Dunkelheit kam schließlich Trautchen, um die Kinder abzuholen. Es war ihr anzusehen,<br />
dass sie nahe daran war, an einem Geheimnis zu ersticken und schließlich, kurz vor<br />
der Haustüre, rutschte es ihr heraus: „Es gibt eine riesengroße Überraschung für euch!“<br />
Damit war die Neugierde der vier Mädchen einschließlich die meiner Oma geweckt und<br />
sie sahen zu, dass sie schnell nach Hause kamen, denn jede wollte die Erste sein, die<br />
diese Überraschung zu Gesicht bekam. Trautchen schloss die Haustür auf. Noch bevor<br />
sie etwas sahen, war das erste, was sie hörten, ein quengelndes Weinen und die älteste<br />
Schwester Luise, die überaus tiervernarrte Luise, klatschte vor Begeisterung in die Hände<br />
und rief freudig: „ Eine Ziege, eine Ziege!“ Diese „Ziege“ entpuppte sich als ihr kleiner<br />
Bruder Heribert, der von den Eltern so lang ersehnte Sohn. Da es damals noch keine<br />
Ultraschallgeräte gab, war es eine große Überraschung, welches Geschlecht das neugeborene<br />
Kind wohl haben würde. Mit vier Mädchen wünschten sich die Eltern meiner<br />
Großmutter nichts sehnlicher als einen „Stammhalter“.<br />
„So war’s halt damals“, erzählte meine Oma mir. Mangels Aufklärung über Schwangerschaft<br />
und Geburt konnte es auch bei einem zwölfjährigen Mädchen, so alt war Luise<br />
schon zum damaligen Zeitpunkt, noch zu solch einem Irrtum kommen. Früher redete<br />
man nicht über Schwangerschaften oder Geburten. Es galt als ein Tabuthema und die<br />
Mädchen wurden erst sehr spät im erwachsenen Alter über Sexualität aufgeklärt.<br />
Mit dem nun geborenen Baby hatten die drei älteren Schwestern eine lebende Puppe,<br />
um deren Betreuung sie jedes Mal aufs Neue in eifersüchtigen Wettstreit gerieten - bis<br />
Annemie im Glauben, dass ein schreiendes Baby immer Hunger habe, dem kleinen Brüderchen<br />
eine Banane in den weit offenen Mund stopfte. Der drohende Erstickungsanfall<br />
konnte in letzter Sekunde durch beherztes Eingreifen von Trautchen beendet werden.<br />
Von nun an aber waren die Aufmerksamkeiten, die sie ihrem Brüderchen zuteil werden<br />
lassen durften, streng reglementiert.<br />
Diese Geschichte ist eine von vielen, die meine Oma Elisabeth erzählte. Damit konnte sie<br />
mich stets zum Lachen bringen und auch heute noch schmunzle ich, wenn ich sie von<br />
anderen Familienmitgliedern, sei es beim Abendbrottisch oder bei Familientreffen, höre.<br />
Heriberts Geschichte stammt aus der Kindheit meiner Oma, die, wie sie selbst sagte, mit<br />
15 Jahren ein abruptes Ende nahm, denn in den dreißiger Jahren wurde sie jäh in die<br />
politische Realität jener Zeit versetzt. Es war der Punkt, an dem die Kindheit für meine<br />
Oma ein Stück weit aufhörte. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 und<br />
dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen im Jahre 1939 begann der Naziterror<br />
in ganz Europa, der letztendlich in einen Weltkrieg mündete. Im Laufe des Krieges und<br />
Sandra<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
33
Omer<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
34<br />
auch noch in der Zeit danach passierte es ihr oft, dass sie von anderen Menschen auf<br />
Grund ihres Aussehens für eine Jüdin gehalten wurde.<br />
Sie erzählte mir, dass es irgendwo auf der Straße passierte, dass sie von Hitlerjungen<br />
in Uniform mit Steinen beworfen und mit fanatischem Geschrei beschimpft wurde:<br />
„Du Jüd, du Jüd!“ Sie rannte davon, so schnell sie konnte, verstand den Angriff nicht,<br />
war verängstigt und erschreckte die Eltern mit der Frage, ob sie eine Jüdin sei. Ihre<br />
Eltern fragten sie, wie sie denn darauf käme, und sie erzählte ihnen, was passiert war.<br />
Die Eltern versuchten, ihr die Angst zu nehmen, aber sie spürte, dass auch sie beunruhigt<br />
waren. Es seien die dunklen Locken, meinten sie, und so begann die Mutter ihr in<br />
schmerzhaften Sitzungen das Haar zu strähnen. Des Erfolges war sie sich wohl dennoch<br />
nicht sicher, denn bei jedem Heimkommen traf Elisabeth ein Blick, der wortlos fragte, ob<br />
alles in Ordnung sei.<br />
Du heißt jetzt Dina<br />
Meine Großmutter Dina erzählt: „Ich wurde 1936 in Tunesien geboren, das in Nordafrika<br />
liegt. Mein Geburtsname lautet Denis. Bis ich drei Jahre alt war, lebte ich mit meiner<br />
Familie in einem jüdischen Viertel mit vielen jüdischen Nachbarn. 1939, während des<br />
Zweiten Weltkriegs, mussten wir unsere Stadt verlassen und in die Hauptstadt Tunis<br />
umziehen. Wir waren Flüchtlinge und verließen unser Haus und unsere Stadt mit nichts<br />
als unseren Namen.<br />
In Tunis besuchte ich eine jüdische Schule der „Alliance.“ Das war eine internationale<br />
Organisation für jüdische Schulen. In meiner Schule wurden wir in Französisch unterrichtet<br />
und alle Schüler meiner Klasse waren Juden. Seitdem spreche ich einigermaßen<br />
gut Französisch.<br />
1949, ein Jahr nach Ende des israelischen Unabhängigkeitskrieges, kamen Abgesandte<br />
der Jewish Agency, um unsere Auswanderung nach Israel vorzubereiten. Meine Schwester<br />
Rachel, meine Eltern Chamisa und Refael und ich waren sehr aufgeregt wegen der<br />
Möglichkeit, Jerusalem zu sehen. Also fuhren wir mit einem französischen Schiff nach<br />
Marseille, Frankreich. Dort blieben wir drei Wochen, dann nahmen wir ein anderes Schiff<br />
nach Israel. Es legte am Hafen von Haifa an und das erste, wonach wir gefragt wurden,<br />
waren unsere Namen. Ich sagte, mein Name sei Denis und der Beamte sagte, Denis sei<br />
Dina, und seither heiße ich Dina. Nachdem wir registriert waren, wurden wir geduscht<br />
und desinfiziert, damit wir keine Krankheiten übertrugen, und bekamen unsere erste<br />
Mahlzeit im Gelobten Land. Nach der formalen Bürokratie am Hafen wurden wir mit dem<br />
Bus nach Pardes Hanah gebracht, in ein „Maabara“ (Durchgangslager für Immigranten).<br />
Dort blieben wir zwei Wochen, die Lebensbedingungen waren schrecklich und unhygienisch.<br />
Nach diesen zwei Wochen wurden wir gefragt, wohin wir gehen wollten und ob<br />
wir Verwandte hätten, in deren Nähe wir wohnen wollten. Ein Freund der Familie aus Lod<br />
lud uns ein, neben ihm und seiner Familie zu wohnen. Ein paar Wochen später kamen wir<br />
in Lod an und wurden in einem leerstehenden Haus untergebracht. In diesem Haus leben<br />
wir noch heute.<br />
Israel bedeutet für mich, ich selbst zu sein. Mich wohl in meiner Haut zu fühlen, in meiner<br />
dunklen jüdischen Haut. Hier hat man die Freiheit, als menschliches Wesen zu lernen<br />
und zu wachsen. Wenn ein Mensch geboren wird, hat er unendliche Möglichkeiten, egal,<br />
wo oder in welche Familie er geboren wurde. Ihr denkt wahrscheinlich, dass ich mich<br />
irre oder – Gott bewahre! – an das falsche Land denke. Nun, ich irre mich nicht, und<br />
ich meine auch nicht die USA oder Paris, ich meine ISRAEL! Dieses Land ist mit seiner<br />
Geschichte gesegnet und vereint auf seiner kleinen Fläche das Beste aller Kulturen der<br />
ganzen Welt. Es liegt nur wenige Kilometer von Europa entfernt und hat so viel Liebe<br />
und Charakter! Israel vereint alle Religionen an einem Ort. Von überall auf unserem geliebten<br />
Planeten, aus dem Osten, Westen, Norden und Süden, kommen Juden und beten<br />
an der Klagemauer. Christen versammeln sich in der Peterskirche in Jaffa, um zu beten<br />
und Gottesdienst zu halten. Muslime kommen zu ihren täglichen und wöchentlichen<br />
Gebeten in die al-Aqsa-Moschee, alle unter dem Dach unseres kleinen Landes Israel. Wo<br />
immer man in Israel auch hingeht, spürt man sofort die Wärme und das Bewusstsein von
Familie und Zusammengehörigkeit, man kann nicht umhin, das zu bemerken. Es fängt auf<br />
den kleinen Straßenmärkten an und endet bei großen Feiertagsversammlungen. Niemand<br />
kann den wohltuenden Düften von Heimat und Feiertagen entgehen, ob es nun Hanukka<br />
ist oder Weihnachten oder Ramadan. Israel ist einzigartig und es gibt keinen Ort, an dem<br />
ich lieber wäre.<br />
Das Leben von Franz Rassenberg<br />
1806 kam mein Urahn Fridericus Wilhelmus Rassenberg als Franzose mit Napoleon Bonaparte<br />
ins Königreich Westphalen und machte sich in Dülmen sesshaft.<br />
Er bewohnte damals das alte Torhaus in Dülmen. Seine Nachkommen blieben alle in<br />
dieser Region und gründeten ihre Familien.<br />
Ein Enkel von Fredericus hieß Franz, der Vater meiner Urgroßmutter. Mein Ururgroßvater<br />
Franz Rassenberg wurde am 26. Juni 1864 in Dülmen geboren. Er wuchs mit vielen<br />
Geschwistern auf und wurde nach der Schule Bäcker und Konditor.<br />
Ende 1893, mit 29 Jahren, heiratete er seine Frau Anna, die mit dem ersten gemeinsamen<br />
Kind schwanger war. Damals musste geheiratet werden, da ansonsten der Ruf<br />
ruiniert war. Franz zog mit seiner Frau nach Lette und gründete dort seine Existenz. Er<br />
kaufte ein Haus, in dem sich ein Lebensmittelgeschäft und eine Backstube befanden.<br />
Von 1894 bis 1902 bekamen meine Ururgroßeltern gemeinsam sieben Kinder, das fünfte<br />
Kind war meine Urgroßmutter Gertrud. Das siebte Kind starb nach der Geburt und meine<br />
Ururgroßmutter starb im Kindbett und hinterließ sechs Kinder im Alter von acht bis<br />
einem Jahr.<br />
Nun stand mein Ururopa da mit sechs kleinen Kindern, seinem Laden und der Backstube.<br />
Gut, dass er eine große Familie hatte, die ihm im Geschäft und bei den Kindern helfen<br />
konnte.<br />
Dies konnte Franz nur für eine bestimmte Zeit in Anspruch nehmen, er musste eine neue<br />
Frau finden und das schnell.<br />
Meine Großtante Anna, die Tochter meiner Urgroßmutter, erzählte mir, dass dies in der<br />
damaligen Zeit etwas einfacher war als heute. Frauen wurden verheiratet oder heirateten,<br />
um versorgt zu sein und um nicht als alte Jungfer zu verhärmen.<br />
Durch seinen Lebensmittelladen und die Bäckerei kam Franz viel herum und besuchte<br />
auch die Nachbardörfer, um seine Torten anzubieten. Diese waren auch in anderen<br />
Dörfern sehr beliebt, meine Großtante liebte seinen Fankfurter Kranz und aus dem Laden<br />
seine feine Leberwurst im Pergamentdarm. Zu Hause bekam sie nur grobe Leberwurst im<br />
Glas.<br />
Eines Tages kam Franz nach Holtwig in die dortige Gaststätte Vörding (die es übrigens<br />
auch heute noch gibt). Dort handelte er mit dem Wirt und bekam so einen Streit zwischen<br />
der Wirtsfrau und deren Tochter Maria mit.<br />
„Die Eltern hatten dem Mädel den Freund ausgespannt“, erzählte meine Großtante Anna,<br />
„und Maria war auf ihre Eltern nun ziemlich sauer. In ihrer Wut schrie sie die Eltern an<br />
und meinte, dass sie den nächstbesten Mann heiraten würde, der ihr über den Weg liefe.<br />
Diese Aussage machte sich Franz zu Nutze und meinte, dass er sie vom Fleck weg heiraten<br />
würde, da er eine Frau für sich und seine sechs Kinder bräuchte.“<br />
Maria Vörding machte ihre Drohung wahr und heiratete am 25. Januar 1904, 27- jährig,<br />
ihren Franz. Sie bekamen gemeinsam sechs Kinder.<br />
1913 zog Franz mit seiner großen Familie nach Velen, das Haus und der Laden waren zu<br />
klein geworden und in Velen konnte er ein größeres Haus erwerben. Dort erweiterte er<br />
sein Geschäft auf eine Gastwirtschaft mit einigen Fremdenzimmern und einer größeren<br />
Backstube.<br />
(Dieses Haus gibt es heute noch als Gaststätte mit Hotelbetrieb, es ist aber nicht mehr<br />
im Familienbesitz, sondern wurde 1940 verkauft).<br />
Lea<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
35
36<br />
Franz legte viel Wert auf die Erziehung seiner Kinder und wollte, dass vor allem seine<br />
Mädchen aus erster Ehe einen guten Beruf erlernten und sich selbst versorgen konnten.<br />
Er war sehr streng mit ihnen und die fünf Mädchen hatten es nicht immer leicht. Nach<br />
den Erzählungen meiner Großtante ging es dort manchmal zu wie bei Aschenputtel,<br />
die fünf mussten immer arbeiten und überall helfen und die Mädchen aus zweiter Ehe<br />
brauchten nichts zu tun und bekamen alles.<br />
Maria wollte gar nicht so viele Kinder und hätte nach dem dritten Kind am liebsten<br />
aufgehört. Als sie dann nach dem Umzug nach Velen schon wieder schwanger wurde,<br />
gefiel ihr das überhaupt nicht und sie musste in der Schwangerschaft sehr viel weinen.<br />
Dieses Kind war dann später auch ein eher unzufriedenes und sehr weinerliches Kind, so<br />
erzählte mir meine Großtante Anna. Als dann 1919 eine erneute Schwangerschaft festgestellt<br />
wurde, trug sie es mit Fassung. Sie war zeitgleich mit ihrer zweiten Stieftochter<br />
schwanger, und Tante und Neffe wuchsen wie Geschwister auf.<br />
Was ich bei den Erzählungen auch bemerkenswert fand, war, dass meine Urgroßtanten<br />
aus erster Ehe sowie auch meine Urgroßoma ihre Ehemänner ohne die Zustimmung<br />
ihrer Eltern heirateten. Sie hatten alle kleine Hochzeiten ohne die Eltern. Die Ehemänner<br />
waren für Maria nicht „würdig“ genug.<br />
Im Gegensatz dazu wurden die Hochzeiten der anderen Kinder sehr groß gefeiert und es<br />
gab auch keine Einwände bei der Partnerwahl.<br />
Aus allen Ehen gingen viele Kinder hervor, so dass die Ursprungsfamilie nun mittlerweile<br />
sehr groß wurde.<br />
Franz und Maria wurden älter. Der Sohn Franz aus zweiter Ehe übernahm die Bäckerei<br />
und wohnte mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester im Elternhaus.<br />
In den Wirren des Zweiten Weltkrieges veränderte sich viel: Franz jun. zog in den Krieg<br />
und auch sein Bruder musste mit. Die Backstube wurde geschlossen und das Haus verkauft,<br />
Franz und Maria zogen zu meiner Urgroßoma ins Haus und verbrachten dort ihren<br />
Lebensabend.<br />
Am 14. Oktober 1941 starb Franz im Kreise seiner Familie.<br />
Maria lebte noch bis 1959 und starb 83- jährig an Altersschwäche.<br />
Meine Großtante hätte noch sehr viel mehr erzählen können und dadurch, dass meine<br />
Mutter gerade auf Stammbaumforschung dieses Familienzweiges ist, bekomme ich weiterhin<br />
die Geschichten meiner Urahnen mit.
Mashiyah Baruchof Street<br />
Mashiyah Baruchof wurde 1876 in Buchara in Usbekistan geboren, in einer Familie<br />
wohlhabender Kaufleute. 1882 emigrierte er mit seiner Familie nach Israel und zog nach<br />
Jerusalem. 1895 reiste er nach Taschkent, damals das Zentrum des russischen Generalgouvernements<br />
Turkestan, und wurde Mitglied im Familienbetrieb der Brüder. Er wurde<br />
ein erfolgreicher Geschäftsmann. 1905 kaufte die Familie in Jerusalem ein Grundstück<br />
für ein Waisenhaus und baute es für 140.000 Francs auf, was damals eine enorme<br />
Summe war. Bis zum Ersten Weltkrieg machte er regelmäßig Geschäftsreisen nach<br />
Russland. Als der Krieg begann, war er gerade in Russland, und als er nach Jerusalem<br />
zurückreisen wollte, verbot ihm die türkische Behörde die Einreise. Während des Kriegs<br />
lebten er und sein Bruder Avraham vom Rest der Familie getrennt in Alexandria in<br />
Ägypten. Nach Kriegsende kehrte er nach Jerusalem zurück und widmete sich öffentlichen<br />
Angelegenheiten. 1946, zwei Jahre bevor der Staat Israel gegründet wurde, starb<br />
er in Jerusalem. Heute sind im Stadtzentrum eine Synagoge und eine Straße nach ihm<br />
benannt. Mashiyah hatte zwei Söhne und sieben Töchter. Eine von ihnen, Miriam, ist<br />
meine Urgroßmutter.<br />
„Wir erklären hiermit die Errichtung eines Jüdischen Staates im Lande Israel“, verkündete<br />
David Ben Gurion am 5. Ijar (hebräisches Datum) 1948. Dies war der Tag, auf den<br />
das jüdische Volk seit 2000 Jahren gewartet hatte. Die Gründung Israels war ein wahr<br />
gewordener Traum.<br />
Heute, 63 Jahre nach diesem historischen Tag, ist Israel eine Erfolgsstory. Obwohl noch<br />
so jung, ist Israel ein moderner Staat geworden und als Land führend auf vielen Gebieten.<br />
Die israelische Wirtschaft ist eine der stabilsten der Welt; viele israelische Forscher<br />
haben einen Nobelpreis gewonnen; israelische Künstler und Schauspieler sind rund um<br />
die Welt erfolgreich ... Die Liste ist zu lang, um sie weiterzuführen.<br />
Allerdings war die Sicherheitslage in Israel nie einfach. Israel ist von arabischen Ländern<br />
umgeben, die seine Existenz beenden wollen. Deshalb muss die israelische Armee sehr<br />
stark sein, um die Grenzen zu verteidigen und um das Eindringen von Terroristen zu<br />
verhindern. Heute wird Israel täglich mit Raketenbeschuss durch Terrororganisationen im<br />
Gazastreifen konfrontiert. Wir alle wünschen, dass dieses schreckliche Vorgehen endlich<br />
aufhört.<br />
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich stolz bin, Israeli zu sein. Trotz der Sicherheitsprobleme<br />
ist mein Land mit wunderbaren Landschaften, einer reichen Geschichte,<br />
modernen Städten, großartigen Leuten und vielem mehr gesegnet.<br />
Mashiyahs Haus in der Jaffa Street,<br />
Jerusalem<br />
Amir<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
Straßenschild der Mashiyahs Baruchof Street<br />
37
Charlotte<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
38<br />
Die starke Annie<br />
„Ich habe nie einen Streit mitbekommen. Nie nur ein lautes Wort, nie eine unfreundliche<br />
Bemerkung. Es existierten die gleichen Wertvorstellungen und sie respektierten sich vollkommen.<br />
Für beide war das die große Liebe“, erinnert sich mein Vater an die Beziehung<br />
meiner Großeltern.<br />
Annie kam am 6. Oktober 1927 in Vreden, einer Kleinstadt nahe der holländischen Grenze,<br />
zur Welt. Da sie rötliches Haar hatte, sprachen die Nachbarn von einem „Rotfuchs“.<br />
Doch durch ihre lustige und wohlwollende Art gewann sie jeden für sich. Auch heute ist<br />
es ein Vergnügen, ihren Geschichten zu lauschen und dabei etwas vom Leben zu lernen.<br />
Mit meiner Oma habe ich früher häufig über ihr Leben und ihre Erfahrungen gesprochen,<br />
doch nur selten über meinen Opa. Ich selbst habe ihn nie kennen gelernt, denn er starb<br />
schon vor 32 Jahren an Krebs. Als ich meine Oma für dieses Projekt interviewte, wollte<br />
ich zunächst wissen, ob sie sich noch an alles erinnern könne. Daraufhin sah sie mich<br />
verblüfft an und sagte: „Aber natürlich. Ich kann mich noch an jedes Detail erinnern“,<br />
und sie lächelte. Ich war mir nicht sicher, wie ich sie interviewen sollte, denn ich weiß,<br />
dass der Tod ihres Mannes, meines Opas, sehr schmerzhaft für sie war. Noch heute kommen<br />
ihr die Tränen, wenn sie daran zurückdenkt.<br />
Meine Oma hat in ihrem Leben schon sehr viel erlebt. Sie ist eine starke Frau, die sich<br />
nicht unterkriegen lässt. Schon früh verlor sie ihre beiden Brüder. Ihr ältester Bruder fiel<br />
mit achtzehn Jahren im Krieg, der andere trat nach dem Krieg auf eine Mine. Sie war<br />
dabei und hatte alles mit angesehen. Ihr erstes Kind, Franz, ertrank mit zwei Jahren im<br />
Fluss hinter dem Haus. Tony erkrankte mit drei Jahren an einer Hirnhautentzündung<br />
und leidet seitdem an einer geistigen Behinderung. Da ich wusste, wie schwierig dieses<br />
Thema für sie ist, war ich mir nicht sicher, was ich fragen durfte. Zudem hatte ich das<br />
Gefühl, dass das Aufnahmegerät dieses Gespräch unpersönlich wirken lassen würde. Es<br />
hatte viel von einem Journalisten, der auf der Suche nach einer Story ist und nicht wie<br />
eine Enkelin, die persönlich an den Geschichten der Oma interessiert ist.<br />
Meine Oma kochte uns also eine Tasse Kaffee, holte den Kuchen in das Kaminzimmer<br />
und wir machten es uns gemütlich. Ich begann mit der Frage, wie sie sich kennen gelernt<br />
hatten und meine Oma musste schmunzeln. „Ich war fünfzehn und auf dem Weg zur<br />
Vredener Volkskirmes. Da kam er mit der Fietze“, erzählte sie. Sie hatten sich zuvor noch<br />
nie gesehen und dennoch fragte er meine Oma, ob sie sich nicht auf den Gepäckträger<br />
setzen wolle. Also nahm er sie bis zu Kirmes mit, doch sie sahen sich lange Zeit nicht<br />
wieder.<br />
Erst nach zwei Jahren trafen sie sich auf der Vredener Kirmes wieder. Er hieß Anton und<br />
kam aus Ellewick, einem kleinen Dorf nicht weit von Vreden. Er machte gerade eine<br />
Ausbildung zum Bankkaufmann. Sie sahen sich seitdem häufiger, da beide regelmäßig in<br />
der Vredener Innenstadt zu tun hatten. „Er lächelte mir immer zu, aber sprach mich nicht<br />
an. Ich war zu schüchtern, um ihn anzusprechen. Eines Tages fragte er mich dann doch<br />
und wir hatten ein erstes Treffen“, erinnerte sich meine Oma. Schon während des ersten<br />
Treffens schien es gefunkt zu haben und kurze Zeit später wurden sie ein Paar. Es war<br />
die erste große Liebe meiner Oma und blieb es auch. „Wir unternahmen alles zusammen.<br />
Gemeinsam waren wir so stark, keiner konnte uns etwas anhaben.“<br />
Er war der gefühlvolle, emotionale Typ, sie eher pragmatisch und selbstbewusst.<br />
Nach ihrer Hochzeit übernahm Anton die Weberei meines Urgroßvaters, Franz Te Moller,<br />
und meine Oma blieb zu Hause bei den Kindern. Es herrschten die traditionellen Rollenverteilungen.<br />
Es war ihre Aufgabe als Mutter, sich um die Kinder zu kümmern und den<br />
Haushalt zu machen, ebenso wie es die Aufgabe des Mannes war, die Weberei zu leiten.<br />
Da mein Opa ein Geschäftsmann war, musste er auch häufig reisen. Doch das tat er<br />
nie ohne meine Oma, was damals sehr untypisch war. „Land und Leute lernt man nicht<br />
kennen, wenn man mit einer Reisegruppe fährt und in den großen Hotelanlagen übernachtet.<br />
Daher waren die Geschäftsreisen nett, aber viel interessanter waren unsere privaten<br />
Urlaube. Einmal waren wir zum Beispiel in Schottland und wir konnten beide kein<br />
Englisch und trotzdem haben wir diese Reise gewagt“, berichtete meine Oma strahlend.<br />
Sie waren ein eingespieltes Team. Auch die Schicksalsschläge erlitten sie gemeinsam.<br />
Ihr erster Sohn ertrank in der Berkel, dem Fluss, der direkt an dem Garten grenzte. Er<br />
war erst zwei Jahre alt und konnte noch nicht schwimmen. Noch heute fällt es meiner
Oma schwer, darüber zu reden. Ich denke, sie machte sich damals riesige Vorwürfe, dass<br />
sie nicht gut genug aufgepasst hatte. „ Ich weiß nicht, was ich alleine gemacht hätte,<br />
ohne euren Opa“, sagte sie. Doch meine Oma ist eine starke Frau, die es immer schafft,<br />
sich wieder aufzuraffen. Noch heute sagt meine Oma immer: „Was dich nicht umbringt,<br />
macht dich stark.“ Und so wurden sie auch stärker, genau wie ihre Beziehung.<br />
Sie brauchten sich mehr als je zuvor und taten alles, damit es der Familie besser ging.<br />
Eine weitere gemeinsame Basis war die Religion. Der Glaube gab ihnen Zusammenhalt<br />
und Sicherheit, gerade bei dem Tod ihres Kindes. „Man muss immer versuchen, das Beste<br />
daraus zu machen, mit allem, was Gott uns gegeben hat. Und Gott unterstützt uns<br />
dabei“, war der Grundsatz meiner Oma. Und der Glaube an Gott wurde gefestigt, auch<br />
wenn man sich manchmal die Frage stellte: „Warum lässt ein guter Gott so etwas zu?“<br />
Mein Opa sagte häufig, dass er nicht nach meiner Oma sterben wolle. Er hätte es nicht<br />
geschafft, das Leben ohne meine Oma zu meistern. Und schließlich starb er auch vor ihr.<br />
Er erkrankte mit 52 Jahren an Leberkrebs und starb kurze Zeit darauf. „Für Oma war das<br />
unglaublich schmerzhaft. Sie sagte einmal, dass der Tod von Opa das Schlimmste war,<br />
das ihr widerfahren ist“, erzählte mir mein Vater.<br />
Noch heute schwärmt mein Vater von der Liebe meiner Großeltern: „Beide waren große<br />
Vorbilder für mich. Sie waren von Grund auf verschieden und vielleicht war genau das<br />
ihr Rezept.“<br />
Die zweite Alijah<br />
Mein Urgroßvater Svi Shapira wurde 1895 in der Ukraine geboren. 1913 emigrierte er<br />
während der „zweiten Alija“ (Einwanderungsbewegung) nach Israel. Zu der Zeit war Israel<br />
kein unabhängiges Land und er gehörte zu den Menschen, die verschiedene ländliche<br />
Kollektivsiedlungen gründeten, die Kibbuzim. Er war auch am Bau des Wasserkraftwerks<br />
am Jordan beteiligt. Das Hauptziel der Menschen aus der „zweiten Alija“, die aus zionistischen<br />
Gründen nach Israel kamen, bestand darin, die Basis für einen jüdischen Staat<br />
auf dem Land von Israel zu schaffen.<br />
Während des Ersten Weltkriegs war er außerdem Mitglied des Jüdischen Bataillons, das<br />
den Briten in der Welt half und gegen das Osmanische Reich kämpfte. Zudem war er<br />
ein aktives Mitglied der Haganah, einer Organisation, die zur Gründung der IDF (Israel<br />
Defense Forces) beitrug. Ihre Mitglieder gehörten zu den Führern der jüdischen Gemeinschaft<br />
in Israel und zu den Führern des neuen Staates. Während des Zweiten Weltkriegs<br />
spielte diese Organisation eine wichtige Rolle bei der Immigration europäischer Juden,<br />
die nach Israel flohen.<br />
Mein Großvater Yehoshua Shapira wurde 1928 in Israel geboren. Er war Mitglied der<br />
Haganah und der „Jewish Settlement Police“, die ein Teil der englischen Polizei war. Vor<br />
1948 war Israel englisches Mandatsgebiet und die jüdischen Polizeimitglieder kamen so<br />
an Waffen, denn die Haganah hatte noch nicht genügend militärische Ausrüstung.<br />
Mein Großvater war in allen israelischen Kriegen aktiv. Als Israel im Jahr 1948 gegründet<br />
wurde, ging er zu den IDF und war Kommandant in der Giv‘ati-Brigade. Er kämpfte im<br />
Unabhängigkeitskrieg (1947 -1949), im Sinai-Krieg (Suezkrise, 1956), im Sechstagekrieg<br />
(1967) und im Jom-Kippur-Krieg (1973).<br />
Israel ist der Staat, in dem ich lebe, zur Schule gehe und so weiter, aber mehr noch ist<br />
Israel meine Heimat. Es bedeutet meine Herkunft, das Land, in dem die Juden die ersten<br />
Schritte als geeinte Nation gingen. Israel bedeutet mir aus verschiedenen Gründen sehr<br />
viel.<br />
Erstens hat meine Familie eine tiefe Verbindung mit Israel. Mein Urgroßvater immigrierte<br />
1913 während der „zweiten Alija“ aus der Ukraine nach Israel. Er tat das, während all<br />
seine Geschwister in die USA auswanderten. Trotzdem trat er dem jüdischen Bataillon<br />
bei, und mein Großvater folgte seinem Weg und ging zur Hagana. Deshalb finde ich es<br />
sehr wichtig, Israel zu beschützen, weil Israel mit viel Anstrengung, Schweiß und Blut<br />
gegründet wurde.<br />
Ori<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
39
40<br />
Zweitens hat das jüdische Volk durch die Geschichte hindurch viele schreckliche Dinge<br />
erleben müssen. Der Holocaust vor 66 Jahren zeigt, dass ein Staat für die Juden absolut<br />
notwendig ist. 6.000.000 Juden wurden während dieses Völkermords ermordet, aber es<br />
kann wieder geschehen. Deshalb brauchen wir ein Land, das die Juden beschützt und die<br />
Wiederholung solch einer schrecklichen Tat verhindert.<br />
Kurz gesagt ist Israel das Land, in dem ich lebe; es ist mein Heimatland, der Ursprung<br />
meiner Nation, der Ort, an dem ich glücklich und voller Vertrauen leben kann. Das ist der<br />
Grund, warum wir als junge Generation die Pflicht haben, Israel zu beschützen und der<br />
Welt die Bedeutung dieses Landes zu erklären, so gut wir können.
Von Breslau nach <strong>Münster</strong><br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand zwischen Polen und Deutschland wieder eine klare<br />
Grenze, die es vorher nicht gab. Man spürte immer noch die Nachfolgen des Krieges.<br />
Einige mussten von Polen nach Deutschland fliehen, so auch Roswitha Kemmann. Sie<br />
ist meine Oma und erzählt mir die Geschichte, wie sie nach <strong>Münster</strong> kam und hier ihre<br />
Familie gründete:<br />
„Als ich noch sehr klein war, so um die 6 Jahre alt, lebte ich an der Grenze zwischen<br />
Polen und Deutschland im damaligen Breslau, heute Wroclaw. Meine Mutter habe ich<br />
nie kennen gelernt, somit waren wir nur zu viert: mein Vater, meine Schwester, mein<br />
Bruder und ich. Ich habe nicht allzu viel von den schlimmen Folgen des Krieges damals<br />
mitbekommen, doch an einiges kann ich mich erinnern, was ich aber erst im späteren<br />
Alter richtig verstanden habe. Wir mussten aus Breslau fliehen, da wir wie viele andere<br />
Deutsche auch kein Haus und nichts zum Essen hatten wegen der starken Zerstörung<br />
durch Bomben. Wir wohnten vor der Zerstörung in meinem Elternhaus in Breslau und<br />
mein eigentlicher Name war damals Michalczyk. Auf der Flucht aus unserem Heimatort,<br />
und das weiß ich noch recht gut, hat uns unser Vater immer davon abgehalten, Polnisch<br />
zu sprechen. Unser Polnisch war zwar nicht besonders gut, aber wir waren ja auch erst<br />
zwischen fünf und sieben Jahre alt. Ich habe erst später verstanden, wieso wir nicht<br />
Polnisch reden durften. Hätte man an der Grenze bemerkt, dass wir Polnisch sprechen<br />
können, hätten wir nicht ausreisen dürfen. Weswegen das so war, weiß ich nicht, weil<br />
wir ja auch fließend Deutsch sprechen konnten.<br />
So kam es also, dass wir nach <strong>Münster</strong>-Albachten gezogen sind. Es war nicht allzu<br />
schwer, hier Fuß zu fassen, aber man wusste, dass wir aus Polen kamen und manche beschimpften<br />
uns als „ Polacken“. Wir fühlten uns dadurch ein wenig eingeschüchtert und<br />
wussten in dem Alter noch nicht so recht damit umzugehen. Doch wir gewöhnten uns<br />
daran und lernten damit umzugehen. Es hat uns nichts ausgemacht, da wir wussten, wir<br />
sind nicht anders als die, die uns beschimpften. Dass wir Deutsch sprachen, verschaffte<br />
uns natürlich einen großen Vorteil. Wir hatten eine Wohnung und das Wichtigste zum<br />
Leben. Als wir Geschwister alt genug waren, gingen wir selbstverständlich arbeiten,<br />
um ein wenig Geld dazu zu verdienen. Mein Vater starb plötzlich und sehr unerwartet,<br />
als ich 16 Jahre alt war. Dadurch standen wir Drei natürlich auf eigenen Füßen. Meine<br />
Schwester und ich haben keine Lehre gemacht und sind weiterhin arbeiten gegangen,<br />
um wenigstens unserem Bruder eine Lehre zu ermöglichen. Wir bekamen Hilfe von<br />
Freunden und Nachbarn. Unsere Vermieter haben ebenfalls viel für uns getan und auch<br />
unser Vormund, der uns vom zuständigen Amt zugewiesen wurde und damit verantwortlich<br />
für uns war, hat seine Pflichten erfüllt. Somit konnten wir ein relativ ruhiges<br />
Leben führen. Mit 19 lernte ich deinen Opa kennen und wir heirateten. Nach kurzer Zeit<br />
war ich mit deiner Mutter schwanger. Nach der Geburt hatte sie eine schwere Knochenkrankheit,<br />
von der sie sich ein Jahr später aber wieder erholte. In ihrer Jugend hatte<br />
sie es nicht leicht, da sie einen sehr starken Drang dazu hatte, alle zu verteidigen, die<br />
ungerecht behandelt wurden. Ob das jetzt nun ihre Geschwister, Klassenkameraden oder<br />
sie selbst war, der andere bekam „eins auf die Mütze“.<br />
Aber sie war immer ein liebes Kind, das von ihren Rechten Gebrauch gemacht hat. Sie<br />
lernte deinen Vater in einem Verein kennen, wo beide sehr aktiv waren. Nachdem auch<br />
sie verheiratet war, brachte sie dich als ihr erstes Kind auf die Welt. Da deine Mutter<br />
trotzdem weiter arbeiten wollte und dein Vater gerade in der Meisterprüfung steckte,<br />
warst du die ersten 1 ½ Jahre deines Lebens jeden Tag bei uns. Man konnte sehr gut mit<br />
dir umgehen, du warst immer ein sehr interessiertes Kind. Alles, was man machte, hast<br />
du versucht, dir abzugucken und nachzumachen. Was ich sehr verwunderlich fand, war,<br />
dass du nicht so schnell den Spaß an etwas verloren hast. Alles hast du bis zum Ende<br />
gemacht. Ich weiß noch, einmal hat Opa Holz gehackt und du hast dir einen kleinen<br />
Spielzeughammer genommen und hast ebenfalls versucht, den Holzklotz durchzuhauen.<br />
Und so bist du auch geblieben. So kam es also, dass du hier in <strong>Münster</strong> geboren wurdest<br />
und nicht irgendwo anders.“<br />
Aus der kleinen Familie aus Polen ist also eine große Familie in <strong>Münster</strong> geworden. Roswitha<br />
bekam drei Kinder, die alle selbst noch mal drei Kinder bekamen. Alle haben immer<br />
noch Kontakt zueinander und sehen sich regelmäßig.<br />
Nils<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
41
Lidor<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
Meine Großmutter Alya<br />
Mein Großvater Leaziz<br />
42<br />
Fremde in Casablanca<br />
Dies ist die Geschichte der „Alija“ (Einwanderung nach Israel) meiner Großeltern mütterlicherseits.<br />
Meine Großeltern wurden nicht in Israel geboren, also mussten sie vor ihrer<br />
Einwanderung einige Hindernisse überwinden.<br />
Meine Großmutter Alya wurde 1934 in Casablanca, Marokko, geboren. Sie lebte in der<br />
jüdischen Gemeinde, die eine der größten jüdischen Gemeinden in Marokko war. Casablanca<br />
gehörte damals zu Frankreich und deshalb war das Leben meiner Großmutter von<br />
französischer Kultur beeinflusst. Die Sprache, die im Haus meiner Großmutter gesprochen<br />
wurde, war marokkanisches Arabisch. Mein Großvater Leaziz wurde 1930 ebenfalls<br />
in Casablanca geboren. Er führte ein ähnliches Leben wie meine Großmutter. Im Alter<br />
von 16 Jahren wurde mein Großvater mit meiner Großmutter verkuppelt und sie heirateten<br />
in der örtlichen Synagoge. Das Leben als Juden in Marokko war für meine Großeltern<br />
schwer. Obwohl sie in einer jüdischen Gemeinschaft lebten, fühlten sie sich wie Fremde<br />
und spürten, dass ihre wahre Heimat Israel war. Trotzdem blieben sie in Casablanca und<br />
bekamen ihre ersten sechs Kinder. Es war für meinen Großvater schwierig, genug Geld<br />
für die Familie zu verdienen.<br />
Nach dem Holocaust in Europa wurden die Lebensbedingungen für die marokkanischen<br />
Juden noch schlechter. Die Bevölkerung vor Ort nahm eine feindselige Haltung ein und<br />
viele Juden beschlossen, Marokko zu verlassen und nach Israel zu gehen. 1966 entschied<br />
auch die Familie meiner Großeltern, „Alija“ zu machen. Sie reisten mit dem Schiff nach<br />
Israel mit all ihren Kindern, unter ihnen meine Mutter, die damals zwei Monate alt war.<br />
Meine Großeltern ließen sich in Jawne nieder, nachdem sie dort ein Haus gekauft hatten,<br />
in dem sie noch heute wohnen.<br />
Das Leben in Israel war nicht so glanzvoll, wie sie es erwartet hatten. Mein Großvater<br />
fand Arbeit in einer Kofferfabrik, aber das reichte nicht. Also mussten auch meine älteren<br />
Onkel eine Arbeit finden, obwohl sie noch Teenager waren. Meine Großeltern waren mit<br />
dem Leben in Israel nicht vertraut, alles war neu für sie, auch das Leben in einem Ort,<br />
den sie nicht kannten. Alle Nachbarn waren ihnen fremd und einige von ihnen kamen<br />
aus anderen Ländern. Über die Jahre hat Jawne sich entwickelt, die Menschen lernten<br />
einander kennen und so wurde das Leben in der Stadt einfacher für sie. Heute haben<br />
meine Großeltern zehn Kinder, viele Enkel und sogar Urenkel. Als ich meine Großeltern<br />
fragte, wie es kommt, dass sie den Ort, an dem sie aufgewachsen sind, nicht vermissen<br />
und ob sie Casablanca gern einmal besuchen würden, meinten sie, das brauchten sie<br />
nicht, denn ihre wahre Heimat sei hier in Israel. Israel ist ihr Heimatland.<br />
Wenn man die Weltkarte betrachtet, sieht man schnell, dass Israel kein großes Land<br />
ist. Da ich in diesem Land lebe, wird mir aber bewusst, dass die Größe überhaupt keine<br />
Rolle spielt. Das liegt daran, dass es mein Land ist, und meiner Meinung nach sollten die<br />
Israelis dankbar sein, dass sie es haben.<br />
Was mich betrifft, so gibt es viele charakteristische Merkmale von Israel. Erstens hat das<br />
Land, in dem wir leben, eine historische Bedeutung für das jüdische Volk. Zweitens sind<br />
die Israelis bunt und interessant. Noch wichtiger ist die israelische Kultur, die einzigartig<br />
ist. Wie ich es sehe, sollte das Leben in Israel nicht als selbstverständlich betrachtet werden.<br />
Das Land, auf dem wir jeden Tag gehen, wurde uns nicht so einfach gegeben. Die<br />
jüdische Geschichte ist lang und voller Mühsal, wenn wir nur 66 Jahre zurückblicken, auf<br />
die schrecklichen Zeiten des Holocaust in Europa (nur weil sie als Juden geboren waren).<br />
Die Geschichte unseres Volkes sagt viel darüber, wie wir unseren unabhängigen Staat<br />
bekamen. Für mich ist Israel auch ein schönes Reiseland. Auf dem „Israel National-Trail“<br />
kann man sehen, wie besonders die Landschaften in Israel sind, von der Wüste Negev bis<br />
zu den grünen Bergen im Norden.
Meine Patentante Anni<br />
Josepha Anna Katharina Wegmann, genannt Anni, wurde am 16. Dezember 1925 in<br />
Burgsteinfurt als zweite Tochter des Kraftwagenführer Karl Joseph Wegmann und der<br />
Bademeisterin Gertrud Maria Wegmann geboren. Mein Urgroßvater hatte sein eigenes<br />
erfolgreiches Busunternehmen, während meine an Diabetes erkrankte Urgroßmutter<br />
Bademeisterin im lokalen Schwimmbad war. In ihrer frühen Kindheit lebte Anni mit ihren<br />
drei Geschwistern, ihrer älteren Schwester Maria, den beiden kleineren Brüdern Joseph<br />
und Franz und ihren Eltern am Marktplatz in Burgsteinfurt, dem lokalen Zentrum des<br />
Ortes, an dem immer viel los war.<br />
Sie hat mir einmal von einem Spaziergang mit ihrer Schwester erzählt, bei dem ihre<br />
typische Eigenschaft, ihre Willensstärke, zum Ausdruck kam. Sie sollten den kleinen<br />
Joseph , meinen Großvater, im Kinderwagen spazieren führen. Maria, die von allen<br />
nur Mia genannt wurde, schob als Ältere, Verantwortungsbewusstere den Wagen. Das<br />
passte Anni jedoch nicht. Sie wollte den Wagen selber schieben und voller Stolz mit ihm<br />
herumfahren, nicht nur nebenherlaufen. Sie bequengelte ihre Schwester Mia so lange,<br />
bis die schließlich nachgab und Anni den Kinderwagen schieben ließ. Doch nachdem sie<br />
so wenige Meter gelaufen waren, sah Anni eine Freundin auf der anderen Straßenseite<br />
laufen. Zuerst hob sie den Arm und winkte ihr, doch dann ließ sie den Kinderwagen los<br />
und lief über die Straße zu ihrer Freundin, um mit ihr zu plaudern. Das Problem war, sie<br />
hatte durch ihre Hast den Kinderwagen umgeworfen. Nun lag der Kinderwagen halb auf<br />
der Straße und Joseph, mein Großvater, war herausgefallen. Meinem Großvater ist zum<br />
Glück nichts passiert, Mia ist ja auch noch da gewesen und hatte ihn und den Kinderwagen<br />
schnell von der Straße genommen und ihn wieder nach Hause gefahren. Dort bekam<br />
meine Patentante nicht nur Ärger von ihrer Schwester, sondern auch von ihren Eltern.<br />
Von da an durfte sie nie wieder die Kinderwagen ihrer kleinen Brüder schieben.<br />
Als 1939 die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg begannen, wurde mein Urgroßvater<br />
mit 40 Jahren an die Front gerufen und sein Unternehmen stand still. Er musste<br />
in Russland in kalten, verschneiten Schützengräben liegen. Da ihr Vater an der Front<br />
kämpfte und die Mutter durch ihre Diabetes immer kränker wurde, übernahmen nun<br />
Anni und Mia die häuslichen Pflichten. Anni hat uns einmal davon erzählt, dass es zu<br />
dieser Zeit in Burgsteinfurt verboten war, Schweine zu schlachten. Deshalb mussten<br />
Anni und Mia einmal im Monat nachts aufstehen, um heimlich im Hof ein Schwein zu<br />
schlachten. Sie schrubbten die ganze Nacht die Schlachtreste weg. Außerdem musste<br />
sich Anni auch um die Gartenpflege kümmern, woraus für sie eine lebenslange Leidenschaft<br />
wurde. Im Jahr 1943 trat Anni dem Deutschen Roten Kreuz bei und arbeitete<br />
dort als Helferin. Als sie einmal mit dem Fahrrad unterwegs zu ihrer Arbeit war, gab es<br />
einen Bombenangriff auf die Stadt. Sie war auf einer Landstraße unterwegs und konnte<br />
sich gerade noch rechtzeitig in den Straßengraben retten. Sie krabbelte den ganzen Weg<br />
bis in die Innenstadt im Graben entlang. Doch ihr Fahrrad hat sie nie wieder gesehen.<br />
Nachdem der Krieg 1945 vorbei war, wurde Burgsteinfurt von den Briten besetzt. Meine<br />
Urgroßmutter wurde immer kränker und Anni fühlte sich dazu verpflichtet, sich um<br />
ihre Mutter zu kümmern. Als mein Urgroßvater wieder zurück nach Hause kam, war er<br />
ein gezeichneter Mann und schwer krank, weil er sich schon während des Krieges beim<br />
Liegen in den Schützengräben im kalten Russland eine schlimme Lungenentzündung geholt<br />
hatte, an der er beinahe gestorben wäre. Die Folgen dieser Lungenentzündung trug<br />
er Zeit seines Lebens mit sich herum. Nun waren die Mutter und der Vater krank. Das<br />
Unternehmen des Vaters war durch das Nazi-Regime und den Krieg zerstört worden und<br />
während ihre anderen Geschwister in die Welt zogen, um eine Lehre zu beginnen , blieb<br />
Anni zu Hause und pflegte nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihren Vater. Nach dem<br />
Krieg organisierte Anni noch jahrelang erfolgreiche Blutspendenaktionen für das Rote<br />
Kreuz in Burgsteinfurt. Außerdem wurde sie in den Achtzigerjahren mehrmals zur Bereitschaftskrankenschwester<br />
gewählt. Ihre Mutter starb 1953 an den Folgen der Diabetes.<br />
Danach begann Anni eine Ausbildung als Näherin, pflegte aber noch elf Jahre ihren<br />
Vater, bis dieser 1964 starb. Mein eigener Vater war gerade zwei Jahre alt geworden, als<br />
mein Urgroßvater starb. Er war noch klein und als er wenige Tage nach der Beerdigung<br />
mit meinem Opa Joseph vor dem Grab meines Uropas stand, wollte er ihn bitterlich weinend<br />
wieder ausgraben. Mit zwei Jahren versteht man den Tod natürlich noch nicht.<br />
1955 wurde sie als einfache Näherin in der Wäschefabrik E. Döring eingestellt, wo sie<br />
sich innerhalb weniger Monate zur Betriebsleitung hocharbeitete. 1962 wechselte sie zur<br />
Bernhard Kappelhof Wirk- und Strickwarenfabrik, in der sie ebenfalls als Betriebsleiterin<br />
Rebecca<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
43
44<br />
arbeitete. Nachdem sie einen Abendkurs in <strong>Münster</strong> für Schreibmaschinenschreiben besucht<br />
hatte, wechselte sie ihren Beruf und wurde 1970 als Sekretärin an der Staatlichen<br />
Ingenieurschule für Maschinenwesen in Burgsteinfurt angestellt. Bald darauf wurde sie<br />
zur Dekanatsekretärin befördert und arbeitete von da an ausschließlich für den Fachbereich<br />
Versorgungstechnik. Als sie in den Ruhestand entlassen wurde, bezeichnete man sie<br />
als die „gute Seele“ der Fachhochschule. Anni war jedoch nicht nur beruflich sehr erfolgreich,<br />
sie war in ihrem Kegelclub „Kesse Mücken - Kesse Brummer“ zur Leiterin gewählt<br />
worden und engagierte sich in der Frauen- und Müttergemeinschaft in Burgsteinfurt.<br />
Als meine Oma, die Mutter von meinem Vater, schwer an Brustkrebs erkrankte und<br />
später auch daran starb, kümmerte Anni sich um meinen Vater und meine Tante. Jeden<br />
Mittag nach der Schule ging mein Vater zu ihr zum Essen und blieb dort, bis mein Großvater<br />
ihn abends abholte. Sie kümmerte sich um die ganze Familie, ihr Bruder lebte Zeit<br />
seines Lebens mit ihr in einer Wohnung, bis er 1983 an Lungenkrebs starb. Daraufhin zog<br />
ihre ältere Schwester Mia bei ihr ein, denn sie hatte Probleme mit starkem Asthma und<br />
brauchte jemanden, der sich um sie kümmerte. So pflegte Anni auch sie bis zu ihrem Tod<br />
am 5.12.2004.<br />
Mit meiner Geburt war sie meine Patentante geworden. Jeden Sonntagnachmittag kam<br />
sie vorbei, um Kuchen zu essen und im Kreise der Familie die Neuigkeiten der Woche zu<br />
besprechen. Außerdem besuchte ich sie mindestens einmal im Jahr in den Ferien für ein<br />
oder zwei Wochen. Vor ein paar Jahren haben meine kleine Schwester und ich sie in den<br />
Osterferien zusammen besucht. Unser Aufenthalt verlief über den ersten April. Morgens<br />
weckte sie uns immer schon um acht Uhr, was für einen Schüler in seinen Ferien nun<br />
wirklich keine angemessene Zeit ist. Sie war jedoch schon um sechs Uhr aufgestanden<br />
und hatte nur darauf gewartet, dass sie uns um acht Uhr wecken konnte. Nachdem wir<br />
uns fertig gemacht hatten, wollten wir zu ihr in die Küche gehen, um zu frühstücken.<br />
Ich hatte einen beigen Rock an, über den sie schon öfters ihr Missfallen geäußert hatte.<br />
Als wir nun in die Küche traten, kam Anni direkt auf mich zu, zeigte mit dem Finger<br />
auf meinen Rock und fragte, was ich da auf meinem Rock habe. Meine Schwester und<br />
ich waren völlig verwirrt. Also starrten wir sie einfach nur verdutzt an. Sie schaute auf,<br />
lächelte und meinte „April, April.“ Wir lachten alle. Diese Aufgewecktheit zeichnete Anni<br />
aus, dass sie es noch mit 85 Jahren schaffte, mich in den April zu schicken. Eine Sache,<br />
die sie noch auszeichnete, war ihre Eigenheit bezüglich ihres Essens. Während unseres<br />
Aufenthalts waren meine Schwester und ich einkaufen gewesen und hatten für uns<br />
Paprika mitgebracht. Als wir sie zum Essen schnitten, fragte Anni, was das denn sei. Ich<br />
sagte völlig erstaunt darüber, dass sie Paprika nicht kannte, dass dies rote Paprika seien.<br />
Zu Hause essen wir häufig Paprika, da wir sie alle gerne essen. Anni wollte die Paprika<br />
schon probieren, doch es brauchte noch etwas Überzeugungskraft von meiner Schwester<br />
und mir, bis sie endlich reinbiss. Plötzlich verzog sich ihr schon faltiges Gesicht zu<br />
einem angewiderten Ausdruck und sie rümpfte die Nase. Sie spuckte die Paprika aus und<br />
meinte nur, so etwas wolle sie nie wieder essen. Bis heute lachen meine Schwester und<br />
ich über diesen unvergesslich angewiderten Gesichtsausdruck.<br />
Trotz ihres hohen Alters überraschte sie uns immer wieder mit ihrer geistigen Klarheit<br />
und wie körperlich belastbar sie noch bis zum Ende war. Auch als Rentnerin arbeitete sie<br />
jeden Tag in ihrem Schrebergarten, in dem sie Bohnen, Kartoffeln, Erdbeeren, viele andere<br />
Gemüsesorten und natürlich auch ein paar Blumen angepflanzt hatte. Als ich noch<br />
kleiner war, fuhren mein Vater und ich häufig samstags morgens ganz früh zu ihr in den<br />
Garten, der hinter dem wunderschönen Schloss von Burgsteinfurt lag. Wir halfen ihr bei<br />
der Gartenarbeit und genossen die schönen sonnigen Tage zwischen dem Gemüse und<br />
den Blumen. Im Herbst und im Winter machte Anni viele Gemüsesorten wie rote Beete,<br />
Bohnen oder Rotkohl aus ihrem Garten ein.<br />
Sie kümmerte sich, für manche war sie der Mutterersatz, für andere war sie die „ gute<br />
Seele“, ein Mensch, der immer da ist, an dem man sich festhalten kann. Anni hat nie<br />
geheiratet, trotzdem glaube ich, dass sie ein Familienmensch war, der sich um viele<br />
Mitglieder aufopferungsvoll mit Hingabe über Jahre gekümmert hat, ohne dabei an<br />
sich selbst zu denken. Mein Vater nannte sie immer „Mutter der Nation“, da sie immer<br />
alles getan hat, damit es ihrer Familie und auch Freunden gut geht. Sie ist für mich ein<br />
Vorbild. Anni hat mir viel über die Gartenpflege oder andere Dinge beigebracht, doch was<br />
ich von ihr lernen konnte, war, dass die Familie das Wichtigste im Leben ist und man sich<br />
gut um sie kümmern sollte.
Türkisch-Syrische Juden<br />
Mein Großvater heißt Joseph Assis und er wurde am 9. November 1944 in Syrien geboren.<br />
Er ist der jüngste von acht Brüdern. Seine Eltern stammen ursprünglich aus der<br />
Türkei. Die Familie meines Großvaters zog nach Syrien und fünf seiner Brüder wurden<br />
dort geboren. Die Mutter meines Großvaters starb, als er sechs Monate alt war und drei<br />
Monate, bevor die Familie nach Israel ging. In Syrien mussten sie ums Überleben kämpfen,<br />
sie hatten Hunger und brauchten Geld, und das ist der Grund, weshalb die Familie<br />
nach Israel zog.<br />
Der Weg dorthin war hart. Die ganze Familie ritt auf Eseln in den Libanon und dann zur<br />
israelischen Grenze. Die Sprache, die dort gesprochen wurde, war Arabisch, aber mein<br />
Großvater und seine Brüder konnten auch Hebräisch. Das kam daher, weil mein Großvater<br />
als Junge in einer jüdischen Jugendgruppe war. Am 10. Februar 1963 trat mein<br />
Großvater der Armee bei und diente in Zerefin. Er kämpfte im Sechstagekrieg und im<br />
Jom-Kippur-Krieg. Während seiner Dienstzeit bei der Armee lernte mein Großvater meine<br />
Großmutter Dalia kennen und sie heirateten am 24. August 1966. Sie bekamen drei<br />
Kinder, eins davon ist meine Mutter. Mein Großvater war später 37 Jahre lang Busfahrer<br />
und verbrachte viel Zeit auf der Straße.<br />
Mein Israel ist ein ganz besonderes und buntes Land. Wie wir auf der Weltkarte sehen<br />
können, liegt es zwischen Asien und Europa. Es ist ein sehr kleines Land mit atemberaubenden<br />
Landschaften, etwa der Negev-Wüste im Süden, dem schneebedeckten Berg im<br />
Norden und einigen anderen spektakulären Landschaften in der Mitte.<br />
Die Bevölkerung von Israel besteht aus mehreren Gruppen, die sich in vielerlei Hinsicht<br />
unterscheiden, zum Beispiel in ihrer Kultur, Geschichte, Religion und in ihren Ansichten.<br />
Leider ist Israel auch heute noch der Mittelpunkt des andauernden Konflikts zwischen<br />
Israelis und Palästinensern. Es sind verschiedene Religionen vertreten und jede hat ihre<br />
eigenen heiligen Orte wie Synagogen, Kirchen und Moscheen. Aus diesem Grund gab und<br />
gibt es in diesem Land immer wieder Unstimmigkeiten. Israelis und Palästinenser leben<br />
auf demselben Gebiet und jede Seite beansprucht Israel für sich.<br />
Ich lebe seit meiner Geburt in Israel. Ich fühle mich hier beheimatet und sicher, und ich<br />
weiß, dass es das einzige Land für alle Juden ist. Ich hoffe, dass wir in Zukunft keine<br />
Kriege mehr haben werden, sondern nur noch Frieden.<br />
Die erste Öffnung des Eisernen Vorhangs<br />
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges 1945 wurde Deutschland in vier Besatzungszonen<br />
eingeteilt. Hierbei besaßen Russland, England, Frankreich und die USA jeweils eine<br />
der vier Zonen. 1949 entstanden die DDR aus der russischen Besatzungszone und die<br />
Bundesrepublik Deutschland aus den drei von den Alliierten besetzten Zonen. 1961<br />
versuchte die DDR ihre hohe Bevölkerungsflucht durch eine Betonmauer entlang der<br />
innerdeutschen Grenze in den Griff zu bekommen. Die Grenze wurde streng bewacht und<br />
Ostdeutsche, die flüchten wollten, mussten damit rechnen, erschossen zu werden. So<br />
entstand ein getrenntes Deutschland, welches 28 Jahre bestehen sollte. Meine Mutter<br />
ist 1989 Zeuge der ersten Öffnung des Eisernen Vorhangs und möchte diese Geschichte<br />
mir und anderen jungen Leuten erzählen, damit wir in Deutschland nie wieder solch eine<br />
Trennung in Kauf nehmen.<br />
„ Ich bin die Mutter von Johannes. Mein Name ist Andrea, geboren am 26.10.1965 in<br />
Laer/Westdeutschland (BRD ). In meiner Kindheit hatte ich keinen Bezug zur DDR, denn<br />
ich lebte immer schon in diesem Zweistaatensystem. Als ich älter wurde und anfing, die<br />
Vergangenheit unseres Landes zu erkunden und zu verstehen, konnte ich es nicht für<br />
möglich halten, dass es einmal das EINE Deutschland gegeben hat, geschweige denn,<br />
wieder geben könnte. Ich machte meinen Realschulabschluss und begann eine Ausbildung<br />
bei einer Versicherung, die ich dann auch erfolgreich abschloss. Ich lernte meinen<br />
Ehemann Christoph kennen und wir heirateten einige Zeit später. Natürlich darf man<br />
sich auch mal einen Urlaub gönnen, dachten mein Mann und ich uns. So begann eine<br />
Reise, bei der wir viel erleben sollten. Es war August 1989, ein heißer Sommer und wir<br />
Or<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
Johannes<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
45
46<br />
freuten uns auf den seit langem geplanten Urlaub in Ungarn am Plattensee, welcher<br />
uns auch einen Tag Aufenthalt in Dresden bei einer gemeinsamen Freundin einbrachte.<br />
Christophs Bruder Wilfried und seine damalige Freundin Bettina kamen mit uns und so<br />
fuhren wir zu viert in einem kleinen VW Käfer los.<br />
Das erste Gänsehautgefühl bekam ich an der Grenze zur DDR. Obwohl ich sie schon<br />
öfter überschritten hatte, überkam mich wieder dieses Gefühl. Die vielen Soldaten und<br />
ihre scharfen Kontrollen erzeugten in mir ein flaumiges, schon fast ängstliches Gefühl.<br />
Nachdem wir all die Unannehmlichkeiten hinter uns gelassen hatten, kamen wir nach<br />
Dresden. Als der Tag sich dann dem Ende neigte und wir aus Dresden in Richtung Ungarn<br />
abfuhren, waren alle voller Vorfreude auf den Urlaub am Plattensee. Nun, mitten in der<br />
Nacht, kamen wir an. Der Hotelmanager zeigte uns unsere Zimmer und wir schliefen erst<br />
einmal, um die Müdigkeit aus unseren Knochen zu vertreiben. Der Urlaub entwickelte<br />
sich zu der erwarteten Erholung, das Essen war ein Traum und die Landschaft einfach<br />
nur atemberaubend. Viele DDR-Bürger verbrachten damals ebenfalls ihren Urlaub am<br />
Plattensee. Man erkannte sie an ihren Fahrzeugen der Marke Trabi oder Wartburg und<br />
daran, dass sie häufig zelteten.<br />
Wir genossen unseren Urlaub gebührend, aber wir wollten auch ein bisschen das Land<br />
erkunden. So beschlossen wir einen kleinen Tagesausflug nach Budapest zu unternehmen.<br />
Am darauffolgenden Tag ging es mit dem Zug und ohne Komplikationen nach<br />
Budapest. Wir sahen uns die Altstadt an und waren erstaunt von der Schönheit, aber<br />
auch von der historischen Atmosphäre dieser Stadt. Mit diesen Eindrücken starteten wir<br />
die Rückreise.<br />
Doch wer nun glaubt, dass diese wie die Hinreise verlaufen würde, täuscht sich gewaltig.<br />
Auf der Hinfahrt hatten wir unser klares Ziel Budapest vor Augen, doch nun standen wir<br />
auf dem Bahnhof der Metropole und keiner konnte auch nur ein Wort Ungarisch. Auch<br />
das Fragen von Passanten war vergebens, da die englische Sprache nicht geläufig war im<br />
Ostblock. Doch nach langem Suchen und Nachfragen erreichten wir unseren Zug. Dieser<br />
Umstand, dass wir genau in den richtigen eingestiegen waren, ist mit Glück kaum zu<br />
beschreiben.<br />
Nach der Fahrt kehrten wir abends in unser Hotel zurück und berichteten unverzüglich<br />
unserem Hotelwirt von unserer recht kuriosen Fahrt. Ein Glücksfall, denn er machte zur<br />
Feier des Tages ein original ungarisches Kesselgulasch und dazu gab es selbst gebrannten<br />
Pflaumenschnaps. Der Abend entwickelte sich zu einem richtigen kleinem Fest. Es kamen<br />
immer mehr Leute und alle aßen, tranken, sangen und tanzten zusammen. Tief in der<br />
Nacht verließen wir die Feier und wollten uns zurückziehen. Als wir aufstanden und uns<br />
verabschiedeten, drückte uns der Gastgeber noch einen, in einer Wasserflasche abgefüllten<br />
Liter, von diesem grandiosen Schnaps in die Hand. Dieser landete natürlich direkt<br />
in unserem Kühlschrank, wo er aber nicht lange bleiben sollte. Ich wurde mitten in der<br />
Nacht von einem komischen Geräusch geweckt und begab mich auf Ursachenerkundung.<br />
Ich fand Christoph mit der Wasserflasche, in der der Schnaps war, vor dem Kühlschrank<br />
hockend und fluchend vor. Er hatte, auf der Suche nach Wasser, die Wasserflasche<br />
erwischt und einen großen Schluck genommen, der ihm aber sichtlich den Atem geraubt<br />
hatte.<br />
Nach diesem Abend und vielen weiteren schönen Abenden ging unser Urlaub zu Ende<br />
und wir fuhren wieder zu viert im Käfer Richtung Österreich. Irgendetwas stimmte nicht<br />
auf den Straßen, denn wir sahen fast nur Trabis und Wartburgs, die eigentlich nicht in<br />
diese Richtung hätten fahren sollen. Den ganzen restlichen Weg überlegten wir nun, was<br />
wohl passiert war.<br />
Nun merkten wir auch, dass wir in Ungarn völlig von der Außenwelt abgeschnitten<br />
waren und uns überkam ein komisches Gefühl von Unwissenheit. Dann endlich war die<br />
lange Fahrt geschafft und zu Hause schalteten wir den Fernseher ein. Es war wie ein<br />
Schock!<br />
Ungarn hatte zum ersten Mal in der Geschichte des Eisernen Vorhangs die Grenzen zu<br />
einem nichtkommunistischen Staat geöffnet. Tausende von DDR-Bürgern, die in Ungarn<br />
waren und es gehört hatten, waren an diesem Tag, an dem ja auch wir den Ostblock<br />
verlassen hatten, nach Österreich und somit in den Westen geflohen. Jetzt begriffen<br />
wir erst, dass wir Zeugen eines historischen Ereignisses geworden waren. Es war der<br />
Anfang vom Ende der DDR und auch der Sowjetunion. Dieses Ereignis blieb mir bis heute
genau im Gedächtnis und wird es auch in Zukunft bleiben. Dass diese Geschichte so eine<br />
Bedeutung für mich hat, können meines Erachtens nur die Menschen verstehen, die<br />
meiner Generation angehören und Deutschland nur als zwei Staaten kannten.“<br />
Die doch relativ spontane Flucht der DDR-Bürger während ihres Urlaubes in Ungarn<br />
nach Österreich war unter anderem der Beginn der Auflösung des Ostblockes und hatte<br />
letztendlich zur Folge, dass im November 1989 die Berliner Mauer fiel und Deutschland<br />
seit dem 2. Oktober 1990 ein wiedervereinigter Staat ist.<br />
In Polen verheiratet<br />
Meine Großmutter kam in den sechziger Jahren nach Israel. Während des Zweiten<br />
Weltkriegs waren sie und ihre Familie von Polen nach Sibirien geflohen. Nach Kriegsende<br />
gingen sie zurück nach Lodz in Polen, das kommunistisch regiert wurde. In diesen Jahren<br />
hatte sie und ihre Familie den Wunsch, in Israel zu leben. Man sagte ihnen, es sei<br />
einfacher, wenn meine Großmutter erst einmal als Touristin nach Israel ginge, also<br />
machte sie das.<br />
Bei ihrem Besuch lernte sie meinen Großvater kennen, der gleich nach dem Krieg mit<br />
seiner Familie hergekommen war. Sie verliebten sich und beschlossen zu heiraten. Wegen<br />
ihrer Familie musste meine Großmutter jedoch nach Polen zurückkehren.<br />
Schließlich wurden sie in Polen „verheiratet“ – ein Anwalt trat an die Stelle meines<br />
Großvaters und so wurde er mit meiner Großmutter verheiratet. Die Heirat machte es der<br />
Familie meiner Großmutter möglich, nach Israel zu gehen, und so kamen alle dorthin.<br />
Israel ist der Ort, wo ich mich am sichersten fühle, wo jeder um mich herum mich versteht.<br />
Es ist der Ort, wo jeder über alles mehrere Ansichten hat, aber trotzdem sind sich<br />
bei gewissen Themen alle einig; wo alle die ganze Zeit streiten, aber wenn jemand um<br />
Hilfe bittet, sind alle sofort zur Stelle.<br />
Es ist der Ort, wo meine ganze Familie und alle meine Freunde leben, wo alle um mich<br />
herum dieselbe Sprache sprechen, dieselben Ausdrücke benutzen und auf dieselbe Weise<br />
mit den Händen reden.<br />
Mein Israel ist meine Heimat, wo wir alle miteinander verbunden sein können.<br />
Opferschutz<br />
Ich möchte gerne etwas über meinen Vater und seine berufliche Tätigkeit erzählen. Er ist<br />
seit sieben Jahren im polizeilichen Opferschutz tätig und kümmert sich dort u.a. um die<br />
Überbringung von Todesbenachrichtigungen.<br />
Mein Vater hat nach seinem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung<br />
in Wuppertal zunächst als Kriminalkommissar beim Erkennungsdienst (Spurensicherung)<br />
in Krefeld gearbeitet. Danach hat er über viele Jahre hinweg Seminare im Bereich Stress-<br />
und Konfliktbewältigung sowie Führungskräftetraining für Polizeibeamte geleitet. Zurzeit<br />
ist er als Kriminalhauptkommissar bei der Polizei in Coesfeld (einer Stadt in der Nähe von<br />
<strong>Münster</strong>) tätig, wo er den Bereich Vorbeugung leitet. Diese befasst sich vor allen Dingen<br />
mit Präventionsaufgaben, hierzu gehört auch der Opferschutz. Speziell für den Bereich<br />
Verkehrsopferschutz wurde bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld im Jahr 2002 ein Projekt<br />
gestartet, bei dem es darum geht, Todesbenachrichtigungen der jeweiligen Situation angepasst<br />
und in der Regel in Zusammenarbeit mit Notfallseelsorgern zu überbringen. Die<br />
Erfahrung hat gezeigt, dass das Überbringen einer Todesnachricht viel Zeit beansprucht<br />
und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen erfordert.<br />
Um diese schwierige Aufgabe zu bewältigen, hat sich bei der Polizei in Coesfeld ein Team<br />
von 13 Polizeibeamten gebildet, die freiwillig als Opferschützer tätig sind. Diese Beamten<br />
erhielten die notwendigen Hintergrundinformationen bezüglich Trauerphänomenen,<br />
Noa<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
Monique<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
47
48<br />
Schockzuständen usw. und wurden entsprechend fortgebildet. Sie sind hauptsächlich<br />
im näheren Umkreis ihrer jeweiligen Wohnorte für die Überbringung von Todesbenachrichtigungen<br />
zuständig, auch außerhalb ihrer Regelarbeitszeit. Die Nachbereitung von<br />
Einsätzen ist für diese Polizeibeamtinnen und -beamten von großer Bedeutung. Dazu<br />
treffen sie sich regelmäßig und tauschen ihre Erfahrungen aus. Supervision wird für<br />
die Opferschützer durch das Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei seit 2011<br />
ebenfalls angeboten.<br />
Mein Vater hatte seinen ersten schwierigen Einsatz in diesem Bereich kurz nach Beginn<br />
seiner Tätigkeit. Mitten in der Nacht klingelte das Telefon. Die Einsatzleitstelle Coesfeld<br />
war am Apparat und teilte meinem Vater mit, dass eine Frau aus unserer weiteren<br />
Nachbarschaft bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Die Aufgabe meines<br />
Vaters bestand nun darin, sich zunächst einmal genauer über die Begleitumstände des<br />
Unfalls zu informieren und dann der Familie die Todesnachricht zu überbringen. Besonders<br />
schwierig wurde die Situation dadurch, dass er die Familie persönlich kannte. Ich<br />
hatte von diesem Vorfall nichts mitbekommen, aber meine Mutter war durch den nächtlichen<br />
Anruf ebenfalls geweckt worden. Nachdem sie erfahren hatte, was passiert war,<br />
war sie natürlich auch sehr betroffen. Sie konnte nicht weiter schlafen und wartete auf<br />
meinen Vater, der in den frühen Morgenstunden wieder nach Hause kam. Lange haben<br />
sie das Erlebte noch besprochen.<br />
Mir wurde am 1. Mai 2006 so richtig bewusst, welche schwierige Aufgabe mein Vater<br />
übernommen hatte. Wir kamen von einem Ausflug nach Hause, machten uns etwas zu<br />
essen und spielten anschließend Monopoly. Plötzlich klingelte das Telefon und da ich es<br />
am schnellsten erreichen konnte, nahm ich das Gespräch entgegen. Es war die Leitstelle<br />
Coesfeld, die meinen Vater sprechen wollte. Zunächst dachte ich an nichts Schlimmes<br />
und gab das Telefon weiter, denn ich wusste, dass mein Vater ab und zu auch außerhalb<br />
seiner Dienstzeiten zu Einsätzen gerufen wird. Wie sich dann herausstellte, hatte sich<br />
in der näheren Umgebung ein schrecklicher Unfall ereignet. Eine Autofahrerin war in<br />
eine Familie gefahren, die mit Inlinern und Fahrrädern unterwegs war. Die Mutter war<br />
sofort tot, eine Tochter starb später, der Vater und die zweite Tochter überlebten schwer<br />
verletzt. Zu Hause warteten jedoch noch eine Schwester und ein Bruder auf die Rückkehr<br />
ihrer Familie. Diese mussten nun von meinem Vater und einem weiteren Kollegen über<br />
diesen Unfall informiert werden. Wir waren alle schockiert und traurig.<br />
Für mich selbst war es ein bleibendes Erlebnis, das ich sehr schwer verarbeiten konnte,<br />
obwohl ich die Verstorbenen nicht persönlich kannte. Viele meiner Freunde sind mit den<br />
Töchtern auf eine Schule gegangen und erzählten von der Trauerfeier, die in der Schule<br />
mit allen Schülern stattgefunden hatte. Ich musste noch oft an diesen Unfall denken,<br />
auch weil ich jeden Tag mit dem Schulbus an der Stelle vorbeifahre. Wenn später das<br />
Telefon klingelte und ich die Worte „Leitstelle Coesfeld“ hörte, war mein erster Gedanke:<br />
Schon wieder ein schwerer Unfall, schon wieder sind Menschen gestorben.<br />
Neben dem Einsatz bei tödlichen Verkehrsunfällen gibt es auch andere Ereignisse, bei<br />
denen mein Vater zum Einsatz kommt. Dies können tödliche Arbeitsunfälle oder auch<br />
Selbstmorde sein. Je nach Situation ist es wichtig, dass die Opferschützer für diese Aufgabe<br />
gut ausgebildet und ausreichend vorbereitet sind. Für meinen Vater ist die Arbeit<br />
als Opferschützer eine sehr wichtige Aufgabe. Er muss zu jeder Tages- und Nachtzeit<br />
bereit sein, Menschen die schlimmsten Nachrichten zu übermitteln, eigene Probleme<br />
und Sorgen müssen ganz zurückgestellt werden. Er muss sich in alle möglichen Familiensituationen<br />
hineinversetzen können, Trost und Halt geben und dabei aber immer noch<br />
einen gewissen Abstand wahren. Ich bewundere es sehr, wie er das hinbekommt, denn<br />
es ist alles andere als einfach. Oft bin ich sehr geschockt, wenn er von einem Einsatz<br />
wiederkommt und dann erzählt, was passiert ist. Bei so vielen schrecklichen Unfällen, bei<br />
denen jeder durch die heutigen Medien alles mitbekommt, fragt man sich ständig, wie<br />
so etwas dann immer wieder passieren kann. Von der Polizei des Landes NRW läuft zur<br />
Zeit landesweit das Projekt „CRASH-Kurs NRW“, bei dem Opferschützer, Notfallseelsorger<br />
und teilweise sogar Überlebende von einem schweren Unfall ihren Erfahrungen und<br />
ihrem Erlebten berichten, in der Hoffnung, die Zuhörer, meist Schüler, zum Nachdenken<br />
anzuregen und ihr Bewusstsein für die Gefahr zu stärken, um so künftige Unfälle zu<br />
vermeiden.<br />
Dafür, dass mein Vater diese schwierige Aufgabe übernimmt, bewundere und schätze ich<br />
ihn sehr.
Persien und die Jewish Agency<br />
Die Geschichte meiner Großeltern spiegelt die Geschichte des Staates Israel wider. Damit<br />
ihr die Menschen, die sich hier niedergelassen und Israel aufgebaut haben, besser versteht,<br />
sollte ich euch die Geschichte meiner Großeltern erzählen.<br />
Mein Großvater und meine Großmutter, Ezra und Rachel Gosaz, stammen ursprünglich<br />
aus Persien. Lasst mich erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. 1952 kamen Abgesandte<br />
der Jewish Agency (u.a. für Immigration zuständige jüdische Organisation) nach<br />
Persien, um für die Einwanderung von Juden nach Israel zu werben.<br />
Mein Großvater Ezra, damals ein 23-jähriger Junggeselle, wollte sehr gern nach Israel<br />
auswandern. Sein Onkel, der bei der Jewish Agency arbeitete, erklärte ihm, dass die Aufnahme<br />
nach Israel als Verheirateter einfacher sei denn als Junggeselle. Und so beschloss<br />
mein Großvater, nach einer Braut zu suchen. Deshalb ging er zu einer Heiratsvermittlerin,<br />
die ihm mehrere Frauen vorstellte. Keine davon gefiel ihm. Er wurde ganz verzweifelt.<br />
Dann willigte er ein, noch eine weitere Frau, Rachel, zu treffen.<br />
Zum Glück mochten sie einander. Mein Großvater sagte ihr, er werde sie nur heiraten,<br />
wenn sie mit ihm nach Israel ginge. Da Rachel keine Eltern mehr hatte, bestand ihr<br />
älterer Bruder darauf, sich Ezra genauer anzusehen. Er fragte ihn gründlich aus und<br />
wollte wissen, welchen Ruf er in der Gemeinde hatte. Außerdem verlangte er, dass Ezra<br />
einige medizinische Untersuchungen machen ließ. Nachdem alles gut aussah und der<br />
Bruder seinen Segen gegeben hatte, beschlossen Rachel und Ezra, zu heiraten und nach<br />
Israel auszuwandern. Sie trugen sich auf die Einwanderungsliste ein. Aber sie mussten<br />
noch ein paar Monate warten. In dieser Zeit arbeitete mein Großvater in dem Lager, das<br />
für zukünftige Auswanderer eingerichtet wurde, und verdiente so etwas Geld. Außerdem<br />
überzeugte er seine Mutter und ihren jüngeren Bruder, ebenfalls nach Israel auszuwandern.<br />
Ironischerweise konnten sie dann viel früher auswandern als meine Großeltern.<br />
Ezras Mutter und sein Onkel emigrierten also nach Israel. Als sie dort ankamen, erhielten<br />
sie ein Zelt, das sie in einem Zeltlager in Pardes Hanah aufbauten. Einige Wochen später<br />
durften meine Großeltern ihnen folgen. Sie suchten eine Weile nach ihnen und fanden<br />
sie dann in Pardes Hanah, wo sie alle zusammen in dem Zelt lebten.<br />
Mein Großvater Ezra war ein fleißiger Mann, der viele verschiedene Jobs machte, um seine<br />
Familie zu versorgen. Deshalb konnte er nicht die ganze Zeit bei ihnen leben. Morgens<br />
arbeitete er auf Baustellen, abends als Träger auf dem Markt. An Wochenenden kehrte er<br />
zu seiner Familie zurück und brachte Obst und Gemüse mit. Auf diese Weise konnten sie<br />
Geld sparen. Nach zwei Jahren konnten sie sich ein Haus in Beit Eliezer in Hadera leisten.<br />
Das Leben meiner Großeltern war nicht leicht. Es war wirtschaftlich schwierig, über die<br />
Runden zu kommen, und trotzdem schafften sie es, kurz nacheinander fünf wohlgeratene<br />
Kinder großzuziehen. Eines von ihnen ist mein Vater, Haim. Leider bekam mein<br />
Großvater Krebs und verstarb vor zwei Jahren. Meine Großmutter, Gott segne sie, lebt in<br />
Bat Yam.<br />
Ich heiße Yarden und ich bin Schülerin der 12. Klasse. Wenn ihr mich fragt, was Israel<br />
für mich bedeutet, würde ich wahrscheinlich antworten: Natur. Wenn ihr Israel so<br />
kennen würdet wie ich, würde ihr dasselbe sagen. In Israel kann man die einfachsten<br />
Dinge genießen, ob es ein Ausflug mit der Familie ist oder ein Picknick oder einfach ein<br />
Spaziergang.<br />
Wenn ihr Israel so betrachtet wie ich, werdet ihr verstehen, warum ich den israelischen<br />
Traum lebe. Ich wohne in einem Moschaw (Genossenschaftssiedlung) und kann sagen,<br />
dass ich es jeden Morgen genieße, aufzuwachen und der Stille der Natur zu lauschen. Es<br />
ist überhaupt nicht wie in der Stadt. In der Stadt hört man die Geräusche des geschäftigen<br />
Lebens der Bewohner und des Verkehrs.<br />
Wenn ich an Israel denke, denke ich außerdem sofort an Jerusalem. Jerusalem ist anders<br />
als alle anderen Städte der Welt. Es liegt eine besondere Atmosphäre in der Luft, die aus<br />
der Kombination des Alten und Neuen besteht. Es ist sowohl historisch als auch modern.<br />
Menschen aus aller Welt kommen, um Jerusalem zu besuchen. Eine einzigartige<br />
Attraktion ist die Klagemauer. Sie hat religiöse Bedeutung für Juden, weil sie die einzige<br />
verbliebene Mauer des Tempels ist. Aber Menschen aus allen Kulturen und Religionen<br />
finden die Mauer faszinierend. Es ist Brauch, kleine Briefe an Gott zu schreiben und sie<br />
in die Ritzen und Spalten der Wand zu stecken in der Hoffnung, dass Gott die Wünsche<br />
und Gebete erhört.<br />
Yarden<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
49
Annika<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
50<br />
Nicht nur ein Urlaub<br />
Genau wie in den letzten 12 Jahren fuhren wir auch im vergangenen Jahr in den<br />
Sommerferien nach Dänemark. Ich weiß selbst nicht genau, was uns da immer wieder<br />
hinzieht, aber meine Eltern sagen stets, dass die Luft und die Idylle dort einfach unerreichbar<br />
seien. Fast jedes Jahr sind wir in demselben Ort, „Bjerregaard“, eine kleine<br />
Wohnhaus-Siedlung zwischen Fjord und Meer an der Westküste. Nur die Dünen trennten<br />
uns und unsere Nachbarn, mit denen wir zusammen in den Urlaub gefahren waren,<br />
im letzten Jahr vom kühlen Nass. Kristiane und Dieter Schneider haben zwei Kinder,<br />
den kleinen, frechen Jonas und die Grundschülerin Karolina. Jonas konnte mit seinen<br />
5 Jahren noch nicht richtig sprechen und ist allgemein eher ein Wirbelwind, der gerne<br />
Streiche spielt und auch mal das ein oder andere Wort überhört. Karolina ist hingegen<br />
ein aufgeschlossenes, liebes Mädchen, das zwar manchmal etwas zickig ist, sich aber<br />
schnell wieder einkriegt.<br />
Wir kennen die Familie Schneider schon seit ein paar Jahren und wussten von vornherein,<br />
dass wir uns gut mit ihnen verstehen würden.<br />
Die ersten Tage verliefen super, wir waren oft am Strand und haben „gesurft“, wobei das<br />
nur so aussah. Wir haben uns auf Plastikbretter geschmissen und sind dann auf winzigen<br />
Wellen in den Sand gerauscht. Trotzdem hatten wir viel Spaß dabei. Und wir waren<br />
Kerzen ziehen, das heißt, dass man einen Docht bekommt und den dann so oft in flüssiges<br />
Wachs tauchen muss, bis die Kerze dick ist. Töpfern waren wir diesmal leider nicht,<br />
doch die letzten Jahre hatte es immer tierisch Spaß gemacht, sich eigene Kerzenhalter<br />
zu formen und diese dann auch zu Hause zu verschenken. Auf jeden Fall ging die erste<br />
Woche unserer Reise schnell um.<br />
Die zweite Woche begann damit, dass uns Freunde aus Deutschland besuchten und wir<br />
zusammen nach „Hvide Sande“ fuhren, um das kleine Hafenstädtchen einmal genauer zu<br />
erkunden. Ich kannte den Ort bereits und fand es nicht sonderlich interessant dort.<br />
Nach dem Bummel durch die Lädchen und der Fischfrikadelle in der Fischerei fuhren<br />
wir an die Mole, ein aus Stein gepflasterter Weg, der in das Meer führt und von großen<br />
Steinen umringt ist. Mein Vater Dietmar und die anderen Männer wollten sich dort umschauen,<br />
weil sie sich am nächsten Tag zum Angeln treffen wollten. Die Kinder, unsere<br />
Bekannten, die Nachbarn und meine Eltern stapften also durch den Sand in Richtung<br />
Mole.<br />
Ich blieb im Auto sitzen, hörte Musik und blätterte in einem Katalog für Kleidung.<br />
Das Wetter wurde immer windiger und ich immer ungeduldiger, weil ich nach Hause<br />
wollte. Nach einiger Zeit fuhr ein Krankenwagen auf den Parkplatz, ein Sanitäter stieg<br />
aus und suchte etwas. Ich war innerlich am Lachen und dachte mir: „ Bestimmt ist jemand<br />
von uns in das Wasser gefallen.“ Es war zwar nicht gerade voll dort, aber die Möglichkeit,<br />
dass meiner Familie oder unseren Bekannten etwas passiert sei, erschien mir in<br />
diesem Moment sehr unwahrscheinlich. Als dann der Sanitäter wieder in seinen Wagen<br />
stieg und wegfuhr, bestätigte das meine Gedanken und ich drehte die Musik wieder auf.<br />
Nicht mehr als fünf Minuten vergingen, als Stefan, einer unsere Bekannten aus Deutschland,<br />
und sein Sohn Fabian mit geschockten Mienen an meine Scheibe klopften. Sie<br />
erklärten mir hastig, dass Kristiane sich das Bein gebrochen hätte, mein Vater fast<br />
kollabiert wäre und die Kinder weinten. Mein Magen zog sich zusammen, ich sprang aus<br />
dem Wagen und ging mit großen Schritten zur Mole. Hinter mir sah ich auch die Sanitäter<br />
herbeieilen; sie waren vorhin wohl doch an der richtigen Stelle gewesen. Noch vor<br />
ihnen erreichte ich mit Mühe und nach einer halben Ewigkeit die Mole. Ich sah Kristiane<br />
auf dem Boden liegen, das linke Bein gebrochen. Der Knochen ragte noch aus dem Bein<br />
hervor. Meine Mama Susanne erklärte ihr gerade, wie sie sich hinlegen müsse, damit die<br />
Schmerzen geringer würden. Als Krankenschwester kannte sie sich mit solchen Situationen<br />
gut aus. Vorher hatte sie meinen Papa auf den Boden und seine Beine auf einen<br />
Rucksack gelegt, weil er kreidebleich wurde, als er das alles sah und sich selbst nicht<br />
mehr auf den Beinen halten konnte. Der Anblick war grausig: Die Kleinen lagen bedrückt<br />
in den Armen unserer Bekannten, mein Papa auf dem Boden liegend wie auch Kristiane,<br />
der von ihrem Mann die Hand gehalten wurde. Die Sanitäter und der Notarzt trafen<br />
ein, verbanden das Bein, so gut es ging, und machten eine Luftpolsterung, damit es von<br />
schmerzhaften Bewegungen geschont würde. Während der Sanitäter einen Anästhesisten<br />
rief, ließ der Notarzt sich von meiner Mutter erklären, was geschehen war. Da der<br />
Notarzt nur wenig Deutsch konnte und meine Mama kein Dänisch, versuchten sie es auf
Englisch: „ Der Sohn ist auf die Felsen geklettert, die Frau ist hinterher, weil der Junge<br />
nicht gehört hat. Dann ist sie hinuntergesprungen, in der Rille stecken geblieben und<br />
dann plötzlich umgefallen.“ Der Arzt machte sich Notizen. Dann ging alles ganz schnell,<br />
die Anästhesistin kam, gab Kristiane eine Spritze, auf einer Liege wurde sie in den Krankenwagen<br />
getragen und schon fuhren sie ins nächste Krankenhaus.<br />
Der Rest unserer Gruppe musste sich erst einmal sammeln. Wir bedankten uns bei zwei<br />
Touristen, weil sie uns Kühlakkus für Kristianes Bein geliehen hatten, und gingen dann<br />
gemeinsam zurück zu den Autos.<br />
Der Rückweg zu unserem Haus verlief schweigsam. Wir aßen etwas und ich beschäftigte<br />
Jonas, Karolina und meine Schwester Judith, um sie etwas zu beruhigen.<br />
Es dauerte nicht lange, bis mein Papa mit Dieter in den Wagen stieg und zum Krankenhaus<br />
fuhr. Als sie dort ankamen, ging es Kristiane schon viel besser. Ihre Ärztin konnte<br />
relativ gut Deutsch und somit war die Kommunikation nicht so schwer. Sie beteuerte,<br />
dass es Kristiane nach der Operation wesentlich besser gehen würde. Außerdem schlug<br />
sie vor, Kristiane am nächsten Tag mit dem Hubschrauber nach Deutschland zu fliegen.<br />
Dieter willigte ein.<br />
Am nächsten Tag fuhren Dieter, seine Kinder, Judith und mein Vater erneut ins Krankenhaus,<br />
um Kristiane zu verabschieden. „Wir sehen uns nächste Woche, macht euch keine<br />
Sorgen“, rief sie noch, als sie in den Hubschrauber geschoben wurde.<br />
Die letzten Tage unseres Urlaubs brachen an. Mit gemischten Gefühlen versuchten wir<br />
alle, noch das Beste daraus zu machen. Zwar war das Wetter eher regnerisch und stürmisch,<br />
jedoch lenkten wir uns mit ein paar Gesellschaftsspielen und leckerem Essen ab.<br />
Als wir dann zu packen begannen, waren alle recht froh, wieder nach Hause zu kommen,<br />
obwohl wir trotzdem viel Spaß hatten.<br />
Dieser Urlaub hat unsere Familien noch ein bisschen enger zusammengeschweißt, weil<br />
wir wussten, dass sich jeder auf jeden verlassen kann und wir alle eine mehr oder weniger<br />
schöne Erinnerung teilen.<br />
.. und Schuld an dem ganzen Chaos war der kleine Jonas, der auf die Felsen geklettert<br />
war und nicht auf seine Mama hören wollte!<br />
51
Roy<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
52<br />
Alija aus Argentinien<br />
Die Eltern meines Vaters wurden in Argentinien geboren. Beide Familien pflegten zu<br />
Hause die jüdischen Traditionen und meine Großmutter ging sogar auf eine Jüdische<br />
Schule. Meine Großmutter studierte Jura und eines Tages ging sie auf die Geburtstagsfeier<br />
ihrer Freundin. Dort traf sie zum ersten Mal meinen Großvater, der der Cousin<br />
ihrer Freundin war. Es war Winter, also tranken sie heißen Tee und erzählten sich gegenseitig<br />
von Reisen, die sie in den Norden und Süden von Argentinien unternommen<br />
hatten. Meine Großmutter erzählte ihm von den wunderbaren Ausblicken auf Berge,<br />
Wälder, Seen und Wasserfälle und wie sie beim Wandern jeden Tag Beeren gepflückt<br />
hatten. Ich höre diese Geschichten noch heute und auch, wie sie auf solchen Wanderungen<br />
Geburtstage feierten und sich dann immer Schokolade teilten.<br />
Meine Großmutter und mein Großvater blieben in Kontakt und heirateten im Jahr<br />
1960. Mein Vater wurde 1961 geboren und sein jüngerer Bruder vier Jahre später.<br />
Beide gingen auf jüdische Schulen und bewahrten die Tradition und feierten zu Hause<br />
die jüdischen Feiertage. Sie lebten nicht in einem jüdischen Viertel, hatten aber viele<br />
Freunde und führten ein gutes Leben. Doch schon seit ihrer Hochzeit dachten sie immer<br />
wieder daran, „Alija“ zu machen: nach Israel zu gehen. Im Jahr 1971 schränkte die<br />
argentinische Regierung die Redefreiheit ein und viele Studenten begannen, dagegen<br />
zu protestieren. Die Regierung ging mit schweren Strafen gegen diese Studenten vor<br />
und es war auch auf den Highschools nicht mehr sicher. Meine Großeltern sorgten sich<br />
um meinen Vater, der im Jahr darauf zur Highschool gehen sollte. Sie beschlossen, dass<br />
nun die Zeit gekommen sei, mit der Familie nach Israel zu gehen, wo sie mit anderen<br />
Juden in Sicherheit leben könnten.<br />
Am 20. Juli 1972 erreichten sie Israel nach vier Wochen Schiffsreise, zusammen<br />
mit der Mutter meiner Großmutter. Sie bekamen Geld und eine Wohnung in einem<br />
Zentrum, wo sie Hebräisch und etwas über die Geschichte und Kultur Israels lernen<br />
konnten. In diesem Zentrum trafen sie Familien aus aller Welt. Nach ein paar Monaten<br />
zogen sie in eine andere Stadt. Die Kinder gingen zur Schule und lebten sich schnell<br />
in der neuen Umgebung ein, und meine Großeltern begannen zu arbeiten. Sie fühlten<br />
sich in Israel sehr wohl und waren sehr zufrieden, dass sie nun hier lebten. Mein Vater<br />
und sein Bruder beendeten die Highschool, besuchten die Universität und gründeten<br />
ihre eigenen Familien. Sie wurden Teil der israelischen Gesellschaft und führen ein<br />
großartiges Leben.<br />
Es gibt viele verschiedene Landschaften hier. Von den schneebedeckten Bergen im Norden<br />
bis hin zum tiefstgelegenen Punkt auf der Erde, dem Toten Meer, das bei Touristen<br />
aus aller Welt sehr beliebt ist, vor allem wegen seiner heilenden Wirkung.<br />
Was an Israel meiner Meinung nach einzigartig ist, sind die Menschen, die hier leben.<br />
Seit der Staat gegründet wurde, kommen die meisten der Bewohner von überall aus<br />
der Welt hierher, auch heute noch. Deshalb besteht die Gesellschaft in Israel aus vielen<br />
verschiedenen Menschen mit verschiedenen Traditionen und alle haben ihre eigenen<br />
besonderen Speisen, ihre eigene Musik, Mode und so weiter. Die Menschen in Israel<br />
gehen sehr herzlich und freundlich miteinander um.
Die Geburt meines Bruders<br />
Für mich hat die Familie eine große Bedeutung. Sie ist ein Teil meines Lebens, auf den<br />
ich in schlechten Zeiten immer zurückgreifen und auf Unterstützung hoffen kann. Doch<br />
auch in Zeiten der Freude weiß ich meine Familie sehr zu schätzen. Vor allem mit meinen<br />
Geschwistern kann ich viel Spaß haben. Meine Schwester und ich sind besonders wegen<br />
des geringen Altersunterschiedes meistens gleicher Meinung und verstehen uns gut.<br />
Zwischen meinem Bruder und mir liegen sieben Jahre Altersunterschied, doch erst durch<br />
seine Geburt wurde unsere Familie komplett und meine Vorstellungen von einer Familie<br />
erfüllt. Daher kann ich mich noch genau an diesen für mich sehr bedeutsamen Moment<br />
erinnern.<br />
Am 10. Juni 2000 war es endlich soweit, mein Bruder, den wir alle schon so lange erwartet<br />
hatten, erblickte endlich das Licht der Welt. Ich war damals sieben Jahre alt, meine<br />
Schwester Hannah fünf. Doch trotzdem kann ich mich noch genau an diesen besonderen<br />
Moment erinnern. Nachts, als meine Schwester und ich noch tief schliefen, weckte uns<br />
mein Vater Christoph plötzlich in heller Aufregung und sagte, es gehe nun los. Hannah<br />
und ich wussten sofort, worum es ging, denn auf diesen Moment hatten wir schon so<br />
lange gewartet. Mein Vater brachte Hannah und mich zusammen mit unserer schwangeren<br />
Mutter Cordula in unser Auto. Wir fuhren zu unserer Oma und unserem Opa, die<br />
mindestens genauso gespannt waren wie wir und sich unheimlich auf ein drittes Enkelkind<br />
freuten. Die beiden warteten bereits an der Haustür, damit meine Eltern möglichst<br />
schnell zum Krankenhaus fahren konnten. Hannah und ich gingen derweil bei unseren<br />
Großeltern schlafen. Um 5.15 Uhr wurde schließlich mein kleiner Bruder geboren. Die<br />
größte Überraschung für meine Eltern war es, nach zwei Töchtern nun einen Sohn<br />
bekommen zu haben, vor allem weil das Geschlecht des Kindes bis zur Geburt unbekannt<br />
war. Außerdem machte sich bei allen eine große Erleichterung breit, da mein Bruder<br />
schon zwei Wochen hatte auf sich warten lassen, umso größer war deshalb die Freude,<br />
dass auch die dritte Geburt ohne Komplikationen verlaufen war und sowohl mein Bruder<br />
als auch meine Mutter wohlauf waren. Die freudige Nachricht der Geburt erreichte uns<br />
jedoch erst am nächsten Morgen, als mein Vater mit einem Foto des Neugeborenen zu<br />
uns kam, während wir mit unseren Großeltern frühstückten. Mit dem Anblick des Fotos<br />
machte sich in mir eine große Freude breit, doch hauptsächlich war ich stolz, nochmals<br />
eine große Schwester sein zu dürfen. Ganz gegensätzlich zu meiner Reaktion verhielt<br />
sich allerdings meine Schwester. Anstatt sich wie alle anderen Familienmitglieder über<br />
die Geburt von Lennard zu freuen, vergoss sie Tränen, die keine Freude als Ursache hatten.<br />
Aus ihrer kindlichen Naivität heraus war sie nämlich davon überzeugt, dass meine<br />
Eltern unserem kleinen Bruder den Namen „Franz“ geben würden, der einzige Name, der<br />
für sie wegen ihrer Begeisterung für die Fernsehsendung „Sissi, die Prinzessin“ in Frage<br />
kam. Die Sendung, in der das Leben der österreichischen Prinzessin Sissi und ihres Gatten<br />
Franz als Zeichentrickfilm dargestellt worden war, sahen wir jeden Abend, bevor wir in<br />
unsere Betten gingen. Die Sendung hat uns einen Einblick in das Leben einer Prinzessin<br />
gegeben und brachte uns dazu, von einem solchen Leben zu träumen. In meiner Schwester<br />
kam so der Gedanke auf, zumindest den Namen „Franz“ aus ihrer Lieblingssendung in<br />
unser normales Leben zu übernehmen. Heute können wir zusammen über ihre Reaktion<br />
lachen und sind alle froh, dass mein Bruder Lennard nicht den Namen „Franz“ trägt.<br />
Meine Eltern jedoch hatten zunächst ganz andere Sorgen bezüglich unserer Reaktion auf<br />
unseren kleinen Bruder. Sie stellten sich Fragen, die für Eltern an erster Stelle stehen, wie<br />
z.B. „Werden sie ihn akzeptieren?“, „Werden sie vielleicht eifersüchtig sein?“, „Haben sie<br />
überhaupt Interesse an einem weiteren Geschwisterkind?“ Doch all ihre Befürchtungen<br />
waren schnell aus der Welt geschafft, denn was meinem Vater in guter Erinnerung geblieben<br />
ist, ist die Neugier, die wir schon zu Beginn aufwiesen, denn sobald wir das Foto<br />
meines Bruder erblickten, begannen wir unseren Vater mit Fragen nach dem Aussehen,<br />
der Größe und des Gewichtes (er wog fast 9 Pfund) zu löchern. Vor allem konnten wir es<br />
kaum erwarten, unsere Mutter und unseren kleinen Bruder im Krankenhaus zu besuchen,<br />
was wir in den nächsten Tagen dann auch machen konnten. Die zwei Wochen, die wir<br />
länger als ursprünglich vorhergesehen war, auf meinen Bruder gewartet hatten, haben<br />
sich also gelohnt und nach 11 Jahren ist er schließlich nicht mehr aus unserer Familie<br />
wegzudenken.<br />
Lisa<br />
<strong>Münster</strong><br />
Rishon LeZion<br />
53
May<br />
Rishon LeZion<br />
<strong>Münster</strong><br />
54<br />
Rabbi Korkidi - ein Gründer Tel Avivs<br />
Die Geschichte der Familie meines Großvaters Jacob Korkidi beginnt in Toledo, Spanien.<br />
Seine Vorfahren wurden aus Spanien vertrieben, lebten dann in der Türkei, und schließlich<br />
ging die Familie nach Israel.<br />
1478, während der spanischen Inquisition, wurden Juden gezwungen, zum Katholizismus<br />
überzutreten, oder sie wurden zu Tode gefoltert. Manche wurden mitten auf dem<br />
Marktplatz hingerichtet. Manche wählten im Namen ihrer Religion den Tod, andere<br />
wählten das Leben. Sie wurden Marranen genannt: Diese Juden gaben sich nach außen<br />
als Katholiken, ihre jüdischen Rituale übten sie jedoch heimlich weiter aus. Unter der<br />
Regierung von Fernando und Isabel wurden 1492 alle Juden aus Spanien vertrieben,<br />
kein einziger Jude blieb mehr dort. Sie wanderten in verschiedene Länder aus, etwa in<br />
die Türkei, nach Griechenland oder Bulgarien.<br />
Der Vorfahre meines Urgroßvaters, Rabbi David Korkidi, kam in der Türkei an einen Ort<br />
namens Korkidi. (Daher kommt auch mein Nachname) Mein Ururgroßvater Rabbi Abraham<br />
Korkidi wurde 1813 in Izmir geboren. Mit 43 Jahren zog er mit seiner Frau Sultana<br />
in das Dorf Birgma, wo er in der dortigen jüdischen Gemeinde als Rabbi arbeitete.<br />
Die beiden hatten zehn Kinder. Leider konnte ich nicht von allen die Namen erfahren:<br />
der Älteste war Haim Moses, dann kamen Raphael, Joseph – der mein Urgroßvater<br />
war – und später Nissim, der Jüngste. Rabbi Abraham Korkidi, ein sehr gläubiger Jude,<br />
beschloss, die Türkei zu verlassen und ins Heilige Land zu gehen. 1882 ließ er seine ältesten<br />
Kinder in Birgma zurück und zog mit seiner Frau Sultana und dem zehnjährigen<br />
Sohn Nissim nach Israel. Sie lebten erst in Jerusalem und später in Jaffa, wo er 1885<br />
mit 72 Jahren starb und beerdigt wurde.<br />
Nissim Korkidi studierte und wurde Rabbi. Er heiratete Rachel, die in Jerusalem geboren<br />
wurde und deren Familie aus Thessaloniki stammte – die Vorfahren waren ebenfalls<br />
Vertriebene aus Spanien. Rabbi Nissim Korkidi war unter den ersten fünf Gründern von<br />
Tel Aviv, die einen Schuldschein für ein Stück Land unterschrieben, das „Ahuzat Bait“<br />
genannt wurde. 1908 bauten Rabbi Nissim Korkidi und zwei andere Familien dort ihre<br />
Häuser. Meir Dizengoff wurde von 60 Familien zum ersten Bürgermeister gewählt und<br />
Nissim Korkidi zu einem Mitglied der Stadtrats von Tel Aviv-Jaffa. Er war ein erfolgreicher<br />
Kaufmann und eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, daher wurde er der<br />
erste Kantor von „Ahuzat Bait“.<br />
Tel Aviv wuchs weiter und wurde eine Großstadt, und um die 60 Familien zu ehren,<br />
die die Stadt gegründet hatten, und um ihrer zu gedenken, ließ die Stadt Tel Aviv ein<br />
Denkmal für Nissim und Rachel Korkidi errichten. Außerdem wurde eine Straße nach<br />
Nissim Korkidi benannt, sie liegt im Stadtteil Tel Kabir in Tel Aviv. Rabbi Nissim Korkidi<br />
starb 1938 in Tel-Aviv.<br />
Israel ist ein kleines Land, das alles hat. Es gibt alle Arten von Menschen, viele unterschiedliche<br />
und schöne Landschaften und viele Orte, die man besuchen kann. Die<br />
Hauptstadt von Israel ist Jerusalem mit vielen heiligen Orten wie der Klagemauer,<br />
dem Ölberg und so weiter. Außerdem gibt es „Yad Vashem“, eine Gedenkstätte für den<br />
Holocaust. Jerusalem ist eine erstaunliche Stadt, auf Bergen gebaut und umgeben von<br />
Bäumen und Häusern aus besonderen Steinen. Die israelische Regierung und das Parlament<br />
befinden sich ebenfalls in Jerusalem.<br />
Von Eliat im Süden bis Kiryat Shmona im Norden hat mein kleines Land alle Arten von<br />
Landschaften – es hat Wüsten, Wälder, einen See, Täler und Berge. Man kann tagelang<br />
wandern oder reisen und viele verschiedene Aussichten haben.<br />
Viele Menschen in der westlichen Welt stellen sich Israel als unentwickeltes Land vor,<br />
aber es ist tatsächlich modern und sehr fortschrittlich. Auch wenn die Medien normalerweise<br />
Terror und Probleme in Israel zeigen, ist das Leben hier fast genauso wie in jedem<br />
westlichen Land. Einfach und normal. Ich stehe jeden Morgen auf, gehe zur Schule,<br />
treffe Freunde, unternehme nachmittags etwas in der Gruppe, gehe ins Kino oder ins<br />
Einkaufszentrum und verbringe Zeit mit meiner Familie.
Echelmeyerstraße 19<br />
48163 <strong>Münster</strong><br />
Telefon: (02 51) 9 19 95-3<br />
www.friedensschule.de<br />
55