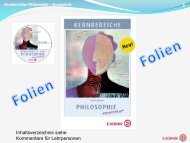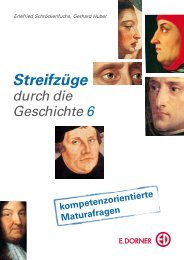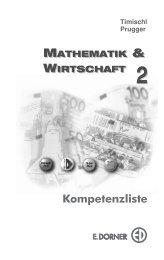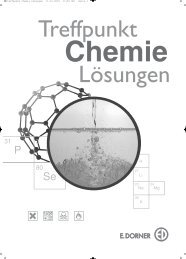Diercke 360° - files.dorner-verlag.at
Diercke 360° - files.dorner-verlag.at
Diercke 360° - files.dorner-verlag.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong><br />
zum Autor: Knut Heyden, R<strong>at</strong>zeburg<br />
Lauenburgische Gelehrtenschule R<strong>at</strong>zeburg<br />
Fächer: Geographie, M<strong>at</strong>hem<strong>at</strong>ik, Inform<strong>at</strong>ik<br />
<strong>Diercke</strong> Welt<strong>at</strong>las Magazin<br />
Landschaftswandel am Aralsee<br />
Der Aralsee war einst das viertgrößte Binnenmeer der Erde. Ein See solcher<br />
Größe ist aufgrund der kontinentalen Lage in einer abfl usslosen Senke in<br />
Zentralasien in einem Halbwüsten- und Wüstenklima überraschend.<br />
Verursacht durch Klimaschwankungen (Eiszeiten) unterlagen der Wasserspiegel<br />
und damit die Ausdehnung des Sees in jüngerer erdgeschichtlicher<br />
Zeit mehrmals großen n<strong>at</strong>ürlichen Schwankungen.<br />
Die Menschen griffen infolge der<br />
ehrgeizigen Pläne Stalins bzw. der UdSSR<br />
in den 1960er- und 70er-Jahren in den<br />
n<strong>at</strong>ürlichen Wasserhaushalt des Sees ein<br />
und veränderten die Landschaft und<br />
den See gravierend. Die kommunistischen<br />
Machthaber planten eine<br />
Umleitung der beiden Zuflüsse Amudarja<br />
im Süden und Syrdarja im Nordosten,<br />
so dass 95 % des Wassers den See nicht<br />
mehr erreichten. Das Wasser wurde dazu<br />
genutzt, im Süden und Nordosten des<br />
Sees auf riesigen Anbauflächen Baumwolle<br />
künstlich zu bewässern.<br />
Seit diesem massiven Eingriff in das<br />
Wassermanagement verlandet der<br />
Aralsee, d.h. die mit Wasser bedeckte<br />
Fläche h<strong>at</strong> sich etwa halbiert, was z. B.<br />
dazu führte, dass ehemals in Ufernähe<br />
gelegene Orte wie Kasalinsk oder<br />
Muinak nun bis zu 150 Kilometer vom<br />
Aralsee entfernt liegen. Diese Dimensionen<br />
sind kaum vorstellbar. Im<br />
Vergleich zu Deutschland hieße dies,<br />
dass vor 40 Jahren Hannover an der<br />
Nordsee oder Berlin an der Ostsee<br />
gelegen hätten. Das Volumen des<br />
Meeres ist um über 70 % zurückgegangen.<br />
Der See besteht nun aus mehreren<br />
Teilen, von denen der größte Großer<br />
Aralsee heißt. Gleichzeitig ist der<br />
Salzgehalt so stark gestiegen, dass die<br />
Flächen ökologisch tot sind. Der<br />
Salzgehalt ist in den verschiedenen<br />
Teilen des Sees sehr unterschiedlich und<br />
soll bei bis zu 150 g/Liter (15 %) im<br />
östlichen Becken liegen. Zum Vergleich:<br />
Süßwasser weist einen Salzgehalt von<br />
unter 0,1 % auf. Der durchschnittliche<br />
Salzgehalt der Ozeane liegt bei 3,5 %.<br />
Trotz der geringen Niederschläge von<br />
100 mm/a wird der See wohl nicht zur<br />
Gänze austrocknen, allerdings wird der<br />
östliche Teil des Großen Aralsees<br />
aufgrund seiner geringeren Tiefe weiter<br />
sehr schnell an Fläche verlieren.<br />
Die größte von Menschen verursachte<br />
Umweltk<strong>at</strong>astrophe<br />
Die Folgen für die Region sind sehr tief<br />
greifend. Zwar boomte anfangs die<br />
Wirtschaft durch den Bau der Bewässerungskanäle<br />
und die Ausweitung der<br />
landwirtschaftlichen Nutzfläche, doch<br />
mit dem Zusammenbruch des Ökosystems<br />
sind viele neg<strong>at</strong>ive Effekte zu<br />
beobachten:<br />
• Fischsterben als Folge der Versalzung<br />
und damit der Zusammenbruch der<br />
Fischerei.<br />
• Generell geringe Artendichte bei Flora<br />
und Fauna.<br />
• Desertifik<strong>at</strong>ion: Ausbreitung der Wüste<br />
und Dünen bis zum Ostufer.<br />
• Durch die Verlandung und Versalzung<br />
verbleiben Salz- und Staubwüsten, die<br />
Böden sind durch Reste von Herbiziden,<br />
Pestiziden und Kunstdünger<br />
gesundheitsgefährdend. U. a. wurde<br />
das aus dem Vietnamkrieg berüchtigte<br />
Mittel Agent Orange verwendet, das<br />
das Erbgut schädigen kann.<br />
• Die Insel des Aralsees wurde für<br />
Versuche mit biologischen Kampf-<br />
UNTERRICHTSEINHEIT<br />
SEKUNDARSTUFE II<br />
stoffen genutzt. Die abnehmende<br />
Luftfeuchtigkeit führt nun dazu, dass<br />
die Schadstoffe ausgeweht werden und<br />
ein zusätzliches Gesundheitsrisiko<br />
darstellen.<br />
• Durch die Verschmutzung des Wassers<br />
und der Luft steigen verschiedene<br />
Erkrankungen wie Atemwegserkrankungen,<br />
Erbkrankheiten und Magen-<br />
Darm-Erkrankungen an.<br />
• Die Versorgung der Bevölkerung mit<br />
sauberem Trinkwasser und auch<br />
Brennm<strong>at</strong>erial ist ein großes Problem.<br />
• Durch den wirtschaftlichen Niedergang<br />
in der Region aber auch den Zusammenbruch<br />
der Sowjetunion ist die<br />
Gesundheitsvorsorge kaum mehr<br />
gewährleistet.<br />
Lösungsansätze<br />
Da es sich bei dem Bewässerungsprojekt<br />
um ein Vorzeigeprojekt der Sowjetunion<br />
handelte, fühlt sich Russland angeblich<br />
in der Verantwortung zur Lösung<br />
beizutragen. Erste Ansätze in den<br />
1990er-Jahren gingen aber von Kasachstan<br />
aus, als hier ein erster einfacher<br />
Sanddamm gebaut wurde, der das<br />
Wasser des Kleinen Aralsees im Norden<br />
zurückhalten sollte. Dieser Damm wurde<br />
2003-2005 mit Mitteln der Weltbank<br />
durch einen höherwertigen Damm, den<br />
so genannten Kok-Aral-Damm ersetzt.<br />
Während sich die ökologische Situ<strong>at</strong>ion<br />
(Anstieg des Wasserspiegels, geringere<br />
Salz- und Schadstoffkonzentr<strong>at</strong>ion) für<br />
den Kleinen Aralsee verbesserte und es<br />
somit zur Wiederbelebung der Fischerei<br />
kommt, sind die Folgen für den Großen<br />
Aralsee, der hauptsächlich in Usbekistan<br />
liegt, entsprechend neg<strong>at</strong>iv. Hiermit wird<br />
deutlich, dass der See im Spannungsfeld<br />
mehrerer Sta<strong>at</strong>en steht. Alle Anrainersta<strong>at</strong>en<br />
möchten von den Zuflüssen<br />
1
2<br />
möglichst viel abzweigen und dennoch<br />
nicht am Tod des Aralsees schuld sein. In<br />
der Atlaskarte <strong>Diercke</strong> S. 105.1 findet man<br />
zudem Hinweise auf Waldschutzstreifen<br />
mit salzresistenten Saxaul Bäumen, die<br />
die Desertifik<strong>at</strong>ion verhindern sollen.<br />
Multimediale Anwendungsmöglichkeiten<br />
im Unterricht<br />
Im Zusammenspiel der unterschiedlichen<br />
M<strong>at</strong>erialien (Karten, S<strong>at</strong>ellitenaufnahmen,<br />
Texte und Filme) sind die<br />
Schüler gefordert, Inform<strong>at</strong>ionen zu<br />
sammeln und zu ordnen. Wegen der<br />
schnellen Umschaltmöglichkeit zwischen<br />
verschiedenen Karten- und<br />
Globusansichten (physische Karte/<br />
S<strong>at</strong>ellitenbild) bietet es sich an, den<br />
<strong>Diercke</strong> Globus Online in den Unterricht<br />
einzubinden.<br />
Karte auf dem <strong>Diercke</strong> Globus Online<br />
Bei den Erläuterungstexten zu den<br />
Atlaskarten unter www.diercke.<strong>at</strong><br />
können zusätzlich die in M6 und M7<br />
gedruckten S<strong>at</strong>ellitenbilder vom Aralsee<br />
heruntergeladen werden (vgl. Link). Mit<br />
dem Link wird der Globus – sofern<br />
installiert – aufgerufen und dann die<br />
S<strong>at</strong>ellitenbilder auf dem Globus gezeigt.<br />
Der Eins<strong>at</strong>z vom <strong>Diercke</strong> Globus Online<br />
in Kombin<strong>at</strong>ion mit einem Beamer ist als<br />
Ergänzung zum gedruckten Atlas dann<br />
sinnvoll, wenn Schüler ihre Ergebnisse<br />
der Kartenarbeit den Mitschülern<br />
präsentieren sollen. Dies kann den Fokus<br />
<strong>Diercke</strong> Welt<strong>at</strong>las Magazin<br />
einfacher auf bestimmte Details lenken.<br />
Dazu müssen die technischen Voraussetzungen<br />
wie ein Internetanschluss im<br />
Klassenraum/Geographie-Fachraum<br />
gegeben sein.<br />
Falls es Ihnen möglich ist, einen Film<br />
über den Aralsee zu besorgen (vgl.<br />
Filme), sollten Sie Ihre Schüler auffordern,<br />
den Film in Kapitel zu unterteilen<br />
und sich gezielt Notizen zu Wirkungsgefügen<br />
zu machen. Die Filme zeigen meist<br />
auch besonders gut und plastisch den<br />
Aralsee zu Sowjet-Zeiten.<br />
Die anschließende Kombin<strong>at</strong>ion der<br />
gefundenen Inform<strong>at</strong>ionen können die<br />
Schüler gut mit einer Bewertungsm<strong>at</strong>rix<br />
oder einer MindMap umsetzen.<br />
Was lernen wir daraus?<br />
Schüler erkennen am Beispiel des<br />
Aralsees die Notwendigkeit, komplexe<br />
Systeme genau zu untersuchen, bevor es<br />
zu einer grundlegenden Änderung im<br />
System durch einen Eingriff kommt. Sie<br />
lernen im Ans<strong>at</strong>z vernetztes Denken,<br />
indem sie versuchen, Voraussetzungen,<br />
Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen<br />
der Komponenten des Systems zu<br />
analysieren. In vielen Fällen denken Menschen<br />
zu kurzfristig und achten nur auf<br />
einfache „monokausale“ Verkettungen.<br />
Da sich solche Fehler in allen politischen<br />
Systemen wiederholen, sollten Schüler<br />
aber nicht vorschnell urteilen, sie selber<br />
hätten das besser gemacht, sondern sich<br />
das Ziel setzen, in ihrer beruflichen und<br />
priv<strong>at</strong>en Situ<strong>at</strong>ion sorgsam und nachhaltig<br />
zu handeln. Die persönliche Verantwortung<br />
des Einzelnen greift auch gut<br />
der Einstiegstext über den Fußballer<br />
Pfannenstiel auf, der auf den ersten Blick<br />
etwas abseits eines üblichen Einstiegs in<br />
die Them<strong>at</strong>ik liegt. Am Ende sollte der<br />
Lehrer einen Rückblick auf diesen Text<br />
fordern.<br />
<strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong><br />
Stundensequenz<br />
1. Stunde<br />
Einstieg: Die Angst des Torwarts vor<br />
dem Klimawandel<br />
Kartenanalyse: Lage, Klima, Wasserregime,<br />
wirtschaftliche Nutzung im<br />
Laufe der Jahre<br />
2. Stunde<br />
Ökologische Untersuchung, Auswertung<br />
der Falschfarbenaufnahmen,<br />
Versalzung<br />
Vergleich Karte – S<strong>at</strong>ellitenbild<br />
3. Stunde<br />
Maßnahmen in den 1960er-Jahren<br />
- Film über den Aralsee/Internetrecherche<br />
bei www.aralsee.org<br />
und Wikipedia<br />
4. Stunde<br />
Zukunftschancen des Aralsees<br />
Rückblick und Diskussion über die<br />
eigene Rolle in Umweltfragen<br />
Liter<strong>at</strong>ur:<br />
Conrad, C. und Schierer, A.: Wassernutzung in<br />
Zentralasien: Bewässerungsfeldbau im Amu Darja<br />
Delta. In: Praxis Geographie 11/2008, S. 26 ff.<br />
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt<br />
(DLR) (Hrsg): Globaler Wandel. Die Erde aus dem<br />
All 2008<br />
Merian „Unsere Erde“ Jubiläumsausgabe 12/2008,<br />
S. 80-81<br />
Westermann Wien (Hrsg.): <strong>Diercke</strong> Welt<strong>at</strong>las<br />
Österreich Handbuch, S. 170–171<br />
Filme:<br />
Aralsee – ein Meer stirbt. Arte „WunderWelten“,<br />
Dokument<strong>at</strong>ion, Frankreich 1999<br />
Das Geheimnis des Aralsees. Dokument<strong>at</strong>ion,<br />
Deutschland/Kasachstan/Usbekistan 2005<br />
Links:<br />
de.wikipedia.org/wiki/Aralsee<br />
www.aralsee.org<br />
www.diercke.<strong>at</strong>/diercke_karten.xtp<br />
(Erläuterungstext und S<strong>at</strong>ellitenbilder: bei<br />
„Auswahl Seitennummer” 105, bei „Auswahl<br />
Kartennummer” 1 eingeben)<br />
www.uni-bielefeld.de/biologie/Oekologie/<br />
aralsee.html
Autor: Knut Heyden <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> 2/2009<br />
M 1 Die Angst des Torwarts vor dem Klimawandel<br />
Beim Hallenturnier in Riesa h<strong>at</strong>ten sie ihren ersten Auftritt, die<br />
Retter des Erdballs. Das Team von Global United repräsentierte<br />
auf den ersten Blick eine Ansammlung in die Jahre gekommener<br />
Spieler, die quasi von Beruf Ex-Profi sind. (…) Die<br />
Mannschaft will auf die Klimaerwärmung aufmerksam machen<br />
und Geld sammeln, um gegen deren Folgen anzugehen. Geld,<br />
das Institutionen wie dem World Wildlife Fund und Forschungsprojekten<br />
zugutekommen soll. Die erstklassige Idee<br />
entspringt dem Kopf eines – mit Verlaub – zweitklassigen<br />
Torwarts, der es dennoch auf seine individuelle Weise geschafft<br />
h<strong>at</strong>, berühmt zu werden. Lutz Pfannenstiel (35) aus<br />
Zwiesel h<strong>at</strong> als erster Fußballprofi auf allen Kontinenten<br />
gespielt, für mittlerweile 27 Vereine, und ist in der ganzen Welt<br />
zu Hause. (…) Er war zunächst ein ganz normaler Profi: „Schnelle<br />
Autos, am Pool liegen und es krachen lassen“, sagt er, das<br />
war sein Motto. Als er 2000 in Singapur für 101 Tage zu Unrecht<br />
ins Gefängnis musste – ihm war Spielmanipul<strong>at</strong>ion vorgeworfen<br />
worden – und durchs Zellenfenster Hinrichtungen mit<br />
ansah, begriff er, dass es im Leben Wichtigeres gibt. Nach<br />
seiner Freilassung beschloss er, sich sozial zu engagieren. Da er<br />
bei seinen zahlreichen St<strong>at</strong>ionen Zeuge des Klimawandels<br />
wurde, auf den Malediven Inseln untergehen sah, „wenn es ein<br />
bisschen regnete oder stürmte“, und beim Anblick des beinahe<br />
ausgetrockneten Aralsees an „eine <strong>at</strong>omare Wüste“ denken<br />
musste, h<strong>at</strong>te er sein Thema gefunden: globaler Sport gegen<br />
das globale Problem. „Mit Fußball kann man die beste Öffentlichkeit<br />
erreichen“, ist er überzeugt. Nun plant Pfannenstiel<br />
Gestrandete Schiffe im ausgetrockneten Aralsee<br />
Aufgaben<br />
1. Beschreiben Sie kurz Ihre persönliche Einstellung zum Klimawandel<br />
und vergleichen Sie diese in der Klasse mit der von<br />
Lutz Pfannenstiel (M1).<br />
2. Beschreiben Sie mit der Atlaskarte Nordasien – physisch<br />
<strong>Diercke</strong> S. 100/101 die Lage des Aralsees (geographische und<br />
politische Lage, Höhe über NN).<br />
bearbeitet von:<br />
COPY<br />
zehn bis zwölf Spiele an besonders vom Klimawandel bedrohten<br />
Orten: in der Antarktis, in Australien und Tansania, wo am<br />
Kilimandscharo der Schnee schmilzt. Er h<strong>at</strong> bereits Verträge mit<br />
rund 50 früheren Spielern wie den Brasilianern Aldair und Cafu<br />
sowie Argentiniens WM-Torwart von 1978, Ubaldo Fillol,<br />
geschlossen. Deutsche sind auch dabei: die Ex-N<strong>at</strong>ionalspieler<br />
Fredi Bobic, Marko Rehmer und Jörg Heinrich. Sein Ziel sind 70<br />
Spieler „mit hoher Berühmtheit von allen Kontinenten“. In<br />
aussichtsreichen Verhandlungen für das erste Spiel zweier<br />
Teams von Global United, geplant für den 18. Dezember 2009<br />
auf einem Fluglandepl<strong>at</strong>z in der Antarktis, steht er mit Zinedine<br />
Zidane. Wobei über Geld nicht verhandelt wird – die Weltrettung<br />
erfolgt selbstverständlich ehrenamtlich. Pfannenstiel<br />
hofft pro Spiel auf Einnahmen von drei bis vier Millionen Euro<br />
durch Sponsoring, weniger durch Zuschauereinnahmen. Auf<br />
der King-George-Insel in der Antarktis werden mangels<br />
Infrastruktur gar keine Fans erwartet, Öffentlichkeit wird<br />
dennoch hergestellt. „Jedes Event bekommt einen 90-minütigen<br />
Film. Darin wird vor allem über die Klimaprobleme der<br />
Region, weniger über das Spiel berichtet“, sagt Pfannenstiel.<br />
(…) „Was man in Deutschland nur liest, habe ich selbst gesehen.<br />
Die meisten Menschen denken doch immer noch, da muss<br />
irgendein Gesetz her, und die Merkel macht das schon mit dem<br />
Obama.“ Er macht lieber selbst etwas.<br />
Quelle: DIE WELT, 7. 1.2009 (gekürzt)<br />
M 2 Klimadiagramm von Cimbaj (50 km nördlich<br />
von Nukus, Usbekistan)<br />
°C<br />
Cimbaj (Usbekistan)<br />
66m ü.M. 42°57`N/59°49`E<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
–40<br />
11,0°C 142 mm 774 mm<br />
J F M A M J J A S O N D<br />
mm<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Mon<strong>at</strong>smittelwerte<br />
Temper<strong>at</strong>ur<br />
Niederschlag<br />
potenzielle Landschaftsverdunstung<br />
(maximal mögliche Verdunstung)<br />
Jahresmittelwerte<br />
11,0°C Temper<strong>at</strong>ur<br />
145 mm Niederschlag<br />
774 mm<br />
potenzielle Landschaftsverdunstung<br />
(maximal mögliche Verdunstung)<br />
3. Orden Sie das Klimadiagramm aus M2 in die Klimaklassifik<strong>at</strong>ion<br />
nach Siegmund/Frankenberg ein (<strong>Diercke</strong> S. 172/173).<br />
3
4<br />
Autor: Knut Heyden <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> 2/2009<br />
M 3 Der verlandete Aralsee<br />
Noch vor 40 Jahren war das Umland des Aralsees eine fruchtbare,<br />
wald- und artenreiche Landschaft. Die Bevölkerung lebte<br />
überwiegend von Fischfang und Landwirtschaft. Heute prägen<br />
riesige Monokulturen das Landschaftsbild. Von Süden her<br />
erhält der Aralsee sein Wasser von dem nur noch spärlich<br />
einfließenden Fluss Amudarja. Da es sich bei dem zweiten<br />
einmündenden Fluss – dem von Norden kommenden<br />
Syrdarja – ebenfalls um einen Zufluss handelt, gilt der Aralsee<br />
als Endsee ohne Abfluss. Der n<strong>at</strong>ürliche Wasserverlust resultierte<br />
aus Versickerung und Verdunstung; im Laufe der<br />
Erdgeschichte h<strong>at</strong>te sich ein Gleichgewicht mit dem Schmelzund<br />
Regenwasserzufluss eingestellt. Die Störung dieses<br />
Gleichgewichts durch den immer geringeren Wasserzufluss<br />
führt nicht nur zu einer Wasserspiegelabsenkung, sondern<br />
auch zu einem deutlichen Anstieg des Salzgehaltes im Aralsee.<br />
Bislang h<strong>at</strong> das Volumen des Sees um zwei Drittel abgenommen,<br />
der Salzgehalt h<strong>at</strong> sich dagegen fast vervierfacht. Es<br />
kommt zu einem verstärkt kontinental geprägten Klima mit<br />
heißeren Sommern und kälteren Wintern, da die n<strong>at</strong>ürliche<br />
Mäßigung des Klimas durch die Wasserfläche immer schwächer<br />
wird.<br />
Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Hrsg.): Globaler Wandel.<br />
Die Erde aus dem All 2008, S. 241 (gekürzt)<br />
M 4 Entwicklung von Wasserfläche, Volumen und<br />
Salzgehalt des Aralsees<br />
Jahr Wasserfläche<br />
Aufgaben<br />
4. Untersuchen Sie das Wasserregime des Aralsees (Zufl uss-<br />
Abfl uss) anhand der Atlaskarte Nordasien – physisch<br />
(<strong>Diercke</strong> S. 100/101), M3 und M4.<br />
bearbeitet von:<br />
Wasservolumen<br />
Salzgehalt<br />
1960 100 % 100 % 0,9 % = 9 g/Liter<br />
1970 90 % 89 % 1,0 %<br />
1980 76 % 59 % 1,7 %<br />
1990 66 % 26 % 3,5 %<br />
2000 40 % 19 % 4,3 %<br />
2003 30 % 12 % Großer Aralsee:<br />
> 7,5 % im westlichen Teil<br />
> 15 % im östlichen Teil<br />
Kleiner Aralsee: 2 %<br />
Quelle: Uni Bielefeld<br />
M 5 Das Geheimnis des Aralsees<br />
COPY<br />
Der Aralsee liegt im Tiefland von Turan und gehört zu Kasachstan<br />
und Usbekistan. Um zu verstehen, was in der Region<br />
geschehen ist, muss man den Läufen der beiden Zuflüsse des<br />
Aralsees – Syrdarja und Amudarja – folgen. Der Aralsee, einst<br />
doppelt so groß wie die Niederlande, h<strong>at</strong> seit 1960 über zwei<br />
Drittel seiner Fläche eingebüßt.<br />
Stolze, sowjetische Kolchosen meldeten immer größere Ernten<br />
an Reis und Baumwolle. Doch unkontrollierte Wasserverschwendung<br />
ließ das salzige Grundwasser dicht an die<br />
Oberfläche steigen, und Salzkristalle machten den Boden für<br />
die Nutzpflanzen unfruchtbar. Eine rapide Verdunstung<br />
verwandelte das Süßwasser des Sees in eine Lake, deren<br />
Salzgehalt dreimal so hoch ist wie der des Meeres. Alle Fische<br />
starben. Durch Wind und Staubstürme gelangt das Salz in die<br />
Luft, gefährdet die anliegenden Felder und sogar Gletscher bis<br />
nach Skandinavien. Die sowjetische Fangflotte zog einst Netze<br />
voll mit Edelfisch an Bord, heute wirken die endlosen Dünenfelder<br />
auf dem ehemaligen Seeboden aus der Luft auch fast<br />
wie Wellen. Und sie bewegen sich t<strong>at</strong>sächlich. Einige Häuser im<br />
ehemaligen Fischerdorf sind schon zugeschüttet.<br />
Eines der größten Probleme der Aralregion ist das Trinkwasser.<br />
Die Quellen vor Ort sind nur bedingt genießbar, da ungehindert<br />
Herbizide, Pestizide und Dünger aus den Feldern in den<br />
Wasserkreislauf fließen. Ärzte in Aralsk beklagen eine der<br />
weltweit höchsten Kindersterblichkeit, während die UNO<br />
Destill<strong>at</strong>oren zur Wasseraufbereitung an die Haushalte verteilt.<br />
Für die N<strong>at</strong>ur ist das Phänomen des schwindenden Wassers<br />
nichts Neues. Auch der Mensch muss lernen, damit fertig zu<br />
werden. Doch die kasachische Regierung will den nördlichen<br />
Fluss Syrdarja nicht nach Süden zu den Usbeken abfließen<br />
lassen und baut für 80 Millionen Dollar einen Damm. Das<br />
Projekt ist nicht unumstritten, denn viele Wissenschaftler<br />
warnen, dass dadurch der übrige Teil des Sees noch schneller<br />
austrocknet. Im Jahr 2010 wird voraussichtlich nur ein Zehntel<br />
davon bleiben.<br />
Quelle: Paul Pfander: Das Geheimnis des Aralsees, Dokument<strong>at</strong>ion, Deutschland/<br />
Kasachstan/Usbekistan 2005, ZDF (16.11.2006) (verändert)<br />
5. Vergleichen und erläutern Sie anhand der Karten<br />
Nordasien – Wirtschaft (<strong>Diercke</strong> S. 102/103) und Aralsee – Landschaftswandel<br />
(<strong>Diercke</strong> S. 105.1) die wirtschaftliche Nutzung<br />
in der Großregion des Aralsees in den Jahren 1960 und 2007.<br />
Welche Maßnahmen wurden in sowjetischen Zeiten durchgeführt<br />
(M5)?<br />
Weitere Inform<strong>at</strong>ionen fi nden Sie z.B. unter www.aralsee.org<br />
oder bei Wikipedia.
Autor: Knut Heyden <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> 2/2009<br />
M 6 Der Aralsee 1973<br />
M 8 Ausbeutung der Armen<br />
1960 war der Aralsee das viertgrößte Binnengewässer der Erde<br />
und doppelt so groß wie Baden-Württemberg. In den 1960er-<br />
Jahren wollte die Sowjetunion mit einem gigantischen<br />
Bewässerungsprojekt die landwirtschaftliche Produktion in der<br />
Region steigern. Neue Devisenquellen sollten durch den<br />
Export von Baumwolle erschlossen werden. Die Abbildung aus<br />
dem Jahr 1973 ist eine Falschfarbendarstellung und hebt die<br />
Anbauflächen im Süden und Nordosten des Sees in Rot hervor.<br />
Die Zuflüsse Amudarja (im Süden) und Syrdarja (im Norden)<br />
wurden zu 95 Prozent in Landwirtschaftsprojekte umgeleitet,<br />
was seither zu einer kontinuierlichen Verlandung des Aralsees<br />
führte. Heute ist das Gewässer in den Kleinen und den Großen<br />
Aralsee geteilt. Die neue Küstenlinie von 2007 ist im zweiten<br />
Aufgaben<br />
6. Werten Sie die S<strong>at</strong>ellitenaufnahmen des Aralsees (M6+M7)<br />
und den beschreibenden Text M8 aus. Erörtern Sie dabei die<br />
Probleme der Wasserversorgung und den Prozess der Versalzung.<br />
Stimmen Sie der Behauptung zu, dass der Aralsee<br />
die größte, vom Menschen verursachte Umweltk<strong>at</strong>astrophe<br />
darstellt? Beziehen Sie für Ihre Begründung auch M5 ein.<br />
7. Vergleichen und bewerten Sie die Karten (<strong>Diercke</strong> S. 105.1) und<br />
bearbeitet von:<br />
M 7 Der Aralsee 2007<br />
COPY<br />
Bild gut entlang der weißen Salzschicht zu sehen. Hochauflösende<br />
S<strong>at</strong>ellitenbilder erlauben die Identifizierung gestrandeter<br />
Schiffe inmitten der neu entstandenen Wüste. Sie sind stille<br />
Zeugen des totalen Zusammenbruchs der Fischerei und des<br />
Wegfalls von 60 000 Arbeitsplätzen. Doch nicht nur das<br />
Aussterben aller Fischarten ist eine der k<strong>at</strong>astrophalen Folgen<br />
dieses Großprojekts. Durch verseuchtes Grundwasser gelangen<br />
Entlaubungsmittel und Pestizide in die Nahrungskette der<br />
50 Millionen Anwohner. Überdurchschnittlich häufig kommen<br />
Missbildungen bei Neugeborenen sowie Fehlgeburten vor.<br />
Die Folgen für Menschen und N<strong>at</strong>ur wurden von den Verantwortlichen<br />
nie evaluiert.<br />
Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Hrsg.): Globaler Wandel. Die<br />
Erde aus dem All 2008, S. 241 (gekürzt)<br />
S<strong>at</strong>ellitenbilder: Welche Inform<strong>at</strong>ionen können Sie auf den<br />
S<strong>at</strong>ellitenaufnahmen besser bzw. schlechter erkennen als in<br />
der Karte?<br />
8. Erörtern Sie die Zukunftschancen der Region. Welche Maßnahmen<br />
werden diskutiert? Welche Chance geben Sie dem<br />
russischen Versprechen einer „historischen Verantwortung“?<br />
Wird Ihrer Meinung nach der Fußballer Pfannenstiel der<br />
Entwicklung neue Impulse geben können?<br />
5
Autor: Knut Heyden <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> 2/2009<br />
zu 1:<br />
C O P Y<br />
„Landschaftswandel am Aralsee“ – Lösungen zur Unterrichtseinheit im <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> Magazin 2/2009<br />
M<strong>at</strong>erialseite 1<br />
Mögliche Einstellung eines<br />
Schülers<br />
- Gefahr des Klimawandels bewusst<br />
- möglichst energiesparendes Leben<br />
- Gesetze notwendig, sollten verschärft<br />
werden (Verbot von Glühbirnen)<br />
- Problem<strong>at</strong>ik Aralsee nur am Rande<br />
bekannt<br />
- Fußballer Pfannenstiel unbekannt, da<br />
kein aktueller Star (Vergänglichkeit<br />
von Ruhm?)<br />
zu 2:<br />
Kritik an der Einstellung von Pfannenstiel<br />
neg<strong>at</strong>iv positiv<br />
- alter Lebensstil sehr unbedarft, nun Sinneswandel<br />
(vgl. Paulus von Tarsus = Saulus)<br />
- unklar, welche Organis<strong>at</strong>ionen unterstützt werden<br />
- Vermarktung des Themas zum eigenen Vorteil (?)<br />
- gut gemeint, aber Kosten-Nutzen-Verhältnis un-<br />
günstig<br />
- Spiele in der Antarktis sind ebenfalls umweltschäd-<br />
lich<br />
- falsche Zielgruppe<br />
Politisch: Grenzgebiet zwischen Usbekistan und Kasachstan,<br />
gut 400 km südlich der Grenze zu Russland<br />
Geographisch: 45° Nord und 60° Ost<br />
Höhe ü. NN (bzw. ü. M.): -43 m<br />
Wassertiefe: 46 m<br />
zu 3:<br />
Erster Klimaschlüssel Klimazonen:<br />
142 mm Jahresniederschlag (also unter 250 mm)<br />
fi B Trockenklim<strong>at</strong>e<br />
Zweiter Klimaschlüssel Wasserhaushalt:<br />
etwa 5 humide Mon<strong>at</strong>e fi sa semiarid<br />
Dritter Klimaschlüssel Wärmehaushalt/Kontinentalität:<br />
außerhalb der Tropen, kontinentales Klima, hohe Jahresamplitude<br />
von 32 °C (d. h. Jahresschwankung zwischen 20 °C und 40 °C)<br />
fi 3 kontinental<br />
Fazit: Bsa3, ein kontinentales, semiarides Trockenklima, laut Karte<br />
Tendenz zu B3a<br />
Hinweis: Falls diese Klimaklassik<strong>at</strong>ion den Schülern noch unbekannt<br />
sein sollte, kann dazu auch der „Entscheidungsbaum“<br />
von Prof. Dr. Alexander Siegmund eingesetzt werden.<br />
- erreicht viele Menschen,<br />
die sonst nicht über das<br />
Thema nachgedacht hätten<br />
- Fußball verbindet unterschiedlicheGesellschaftsgruppen<br />
- Inform<strong>at</strong>ion der Gesellschaft<br />
1
Autor: Knut Heyden <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> 2/2009<br />
C O P Y<br />
„Landschaftswandel am Aralsee“ – Lösungen zur Unterrichtseinheit im <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> Magazin 2/2009<br />
M<strong>at</strong>erialseite 2<br />
zu 4:<br />
Es gibt zwei Zuüsse: Amudarja (von Süden) und Syrdarja<br />
(von Norden). Der Syrdarja entspringt im Bereich des Tian Shan-<br />
Gebirge. Der Amudarja entspringt im Hindukusch.<br />
Es gibt aber keinen Abuss, daher ein Endsee.<br />
Die Versickerung und Verdunstung entspricht dem Zuuss.<br />
Wird dieses Gleichgewicht gestört, muss zwangsläug der<br />
Wasserspiegel sinken und gleichzeitig der Salzgehalt steigen.<br />
DieWerte der Veränderung des Salzgehaltes lassen sich gut in<br />
-<br />
M4ablesen. Die unterschiedliche Entwicklung seit 2003 muss<br />
mitder Aufspaltung in den Kleinen und Großen Aralsee und<br />
derenUnterschiede im Wassermanagement erklärt werden.<br />
zu 5:<br />
Verortung der Gebiete z. B. in immer größer werdenden konzentrischen<br />
Kreisen:<br />
– Direkt am Aralsee: wirtschaftliches Ödland, Wüste/Halbwüste,<br />
kaum nutzbar<br />
– Im Bewässerungsland: Bewässerungslandwirtschaft, Baumwolle,<br />
Kleinindustrie wie Textilien/Bekleidung, Dienstleistungszentren<br />
mit regionaler Bedeutung<br />
– Großregion (ca. 1000 km um den Aralsee):<br />
Im Westen: Kaspisches Meer, chemische Industrie, Erdöl;<br />
Im Süden ca. 700 km (Usbekistan/Kirgistan): Erdgas, Textilindustrie,<br />
Industrieballungsraum, Verkehrsinfrastruktur;<br />
Im Osten (Kasachstan): Raumfahrtzentrum Bajkonyr, Kupfer, Buntmetallverhüttung<br />
– Lage der Hauptstädte: Usbekistan (Taschkent) und Kasachstan<br />
(Astana) sehr weit vom Aralsee entfernt<br />
Fazit: Der Aralsee h<strong>at</strong> kaum wirtschaftliche Bedeutung, ist politisch<br />
im Abseits.<br />
Veränderung 1960-2007:<br />
1960 2007<br />
- 67 m Tiefe<br />
- 45 m Tiefe<br />
- Seespiegel auf 53 m ü. M. - Seespiegel auf 31 m ü. M.<br />
- Flussdelta südlich vom - Fluss: nur noch periodisch<br />
Aralsee: Auenwald<br />
- Baumwolle/Reis<br />
- Fischereihafen/ Nahrungs- - Bodenversalzung<br />
mittelindustrie/Textilindus- - Bewässerungsland<br />
trie<br />
- Waldschutzstreifen mit<br />
- Baustondustrie<br />
salzresistenten Bäumen<br />
- Baumwolle<br />
- Salz- und Sandverwehungen<br />
Den Zuüssen werden seit der Stalin-Ära große Wassermengen<br />
für die künstliche Bewässerung riesiger Anbauächen für Baumwolle<br />
in Kasachstan und Usbekistan entnommen. Durch den<br />
geringeren Zuuss sank seitdem der Wasserspiegel des Sees<br />
kontinuierlich ab.<br />
Um zumindest den kleineren (nördlichen) Teil des Aralsees zu<br />
retten, wurde in den 1990er-Jahren von Kasachstan ein Deich<br />
gebaut, um das Wasser zurückzuhalten. Während seines Bestehens<br />
erhöhte sich der Wasserspiegel im Kleinen Aralsee, das<br />
Klima verbesserte sich, und es konnten wieder mehr Fische gefangen<br />
werden. Aufgrund der unzulänglichen Bauweise brach<br />
dieser Damm jedoch nach kurzer Zeit. Daraufhin wurde 2003<br />
erneut mit dem Bau eines Dammes begonnen. Da auch die Weltbank<br />
Mittel hierfür bereitstellte, konnte diesmal Beton als Baum<strong>at</strong>erial<br />
verwendet werden. Dieser neue Damm wird auch Kok -<br />
Aral-Damm genannt. Zusätzlich zu diesem Dammbau wurden<br />
auch Maßnahmen ergrien, um die Bewässerungssysteme des<br />
Syrdarja zu verbessern, welcher in den nördlichen Teil des Sees<br />
mündet. Dabei wurden Kanäle repariert und zum Teil auch ausbetoniert.<br />
Damit sollte zusätzliches Wasser in den See geleitet<br />
werden. 2005 wurde der Kok-Aral-Damm fertiggestellt.<br />
M<strong>at</strong>erialseite 3<br />
zu 6:<br />
Deutlich wird die Verkleinerung/Verlandung des Sees und Aufteilung<br />
in zwei Seen. Der gestiegene Salzgehalt ist durch die<br />
Falschfarbendarstellung ebenfalls gut sichtbar. Vergleicht man<br />
die Intensität der roten Farbe in den ehemaligen Auenwäldern<br />
und den Bewässerungsbereichen, fällt auf, dass die Veget<strong>at</strong>ion<br />
stark geschädigt sein muss. Wobei unklar ist, ob die Bilder zu<br />
ähnlichen Jahreszeiten aufgenommen wurden.<br />
Probleme bei der Wasserversorgung: Salzgehalt ist so hoch, dass<br />
das Seewasser nicht als Trinkwasser genutzt werden kann; auch<br />
das Grundwasser ist durch Herbizide, Pestizide sowie Dünger und<br />
das unterirdische Eindringen von Salz verseucht. Mit aufwendigen<br />
Anlagen muss Trinkwasser per Destill<strong>at</strong>ion/Solaranlagen gewonnen<br />
werden. Auch der Eins<strong>at</strong>z von UV-Entkeimungsgeräten ist<br />
notwendig. Da diese technischen Möglichkeiten der Bevölkerung<br />
vor Ort meist nicht zur Verfügung stehen bzw. aus Mangel an<br />
Altern<strong>at</strong>iven unbedarft mit dem verseuchten Wasser umgegangen<br />
wird, kommt es zu Missbildungen und Fehlgeburten.<br />
Die Folgen sind durch die Wechselwirkung und Verkettung der<br />
Faktoren immens.<br />
– Fischsterben als Folge der Versalzung und damit der Zusammenbruch<br />
der Fischerei. Generell geringe Artendichte bei Flora<br />
und Fauna.<br />
– Desertik<strong>at</strong>ion: Ausbreitung der Wüste und Dünen bis zum<br />
Ostufer.<br />
2
Autor: Knut Heyden <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> 2/2009<br />
C O P Y<br />
„Landschaftswandel am Aralsee“ – Lösungen zur Unterrichtseinheit im <strong>Diercke</strong> <strong>360°</strong> Magazin 2/2009<br />
– Durch die Verlandung und Versalzung verbleiben Salz- und<br />
Staubwüsten, die Böden sind durch Reste von Herbiziden, Pes-<br />
tiziden und Kunstdünger gesundheitsgefährdend.<br />
– Die Insel des Aralsees wurde für Versuche mit biologischen<br />
Kampfstoen genutzt. Die abnehmende Luftfeuchtigkeit führt<br />
nun dazu, dass die Schadstoe ausgeweht werden und ein<br />
zusätzliches Gesundheitsrisiko darstellen.<br />
– Durch die Verschmutzung des Wassers und der Luft steigen<br />
verschiedene Erkrankungen wie Atemwegserkrankungen, Erb-<br />
krankheiten und Magen-Darm-Erkrankungen an.<br />
– Die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser und<br />
auch Brennm<strong>at</strong>erial ist ein großes Problem.<br />
– Durch den wirtschaftlichen Niedergang in der Region aber auch<br />
den Zusammenbruch der Sowjetunion ist die Gesundheitsvor-<br />
sorge kaum mehr gewährleistet.<br />
Infolge des Wegfalls der wirtschaftlichen Nutzung des Aralsees<br />
fehlen der Region nun auch die nanziellen Mittel zur Erneue-<br />
rung. D. h. es ist eine langfristige Abhängigkeit von der Weltbank<br />
oder anderen Finanzquellen wahrscheinlich.<br />
Die Frage, ob es die größte, vom Menschen verursachte K<strong>at</strong>astro-<br />
phe sei, wird vermutlich von den Schülern aus mehreren Gründen<br />
verneint:<br />
Den Schülern fehlt ein „normierender“ Vergleich mit anderen<br />
K<strong>at</strong>astrophen; die globale Erwärmung ist bekannter und auch<br />
global bedeutend; die Region des Aralsees ist im Abseits der<br />
Weltpolitik und Weltöentlichkeit. Da zudem beim Kleinen Aral-<br />
see erste Rettungsversuche gefruchtet haben, ist denkbar, dass<br />
der Große Aralsee eine „Müllhalden-Funktion“ einnimmt. Nie-<br />
mand will eine Mülldeponie in der Nachbarschaft haben, hier<br />
dient der Große Aralsee dem Kleinen als Mülldeponie.<br />
zu 7:<br />
Die S<strong>at</strong>ellitenbilder wirken insbesondere hinsichtlich der Wasser-<br />
ächen meist echter und überzeugender – obwohl es sich ja um<br />
Falschfarbenaufnahmen handelt. Die erwähnten Abweichungen<br />
in den Rotwerten der Anbauächen im Süden und Nordosten<br />
mögen für Schüler auf den ersten Blick verwirrend sein, ohne den<br />
Text M8 würde sich die Aussage „rot = grün“ kaum erschließen.<br />
Um welche Panzen es sich in den intensiv roten Flächen handelt,<br />
kann anhand der S<strong>at</strong>ellitenaufnahmen nicht festgestellt werden.<br />
Gleichzeitig wird aber dadurch deutlich, dass die Atlaskarte „nur“<br />
über die angebauten Panzen und Ausdehnung der Bewässe-<br />
rungsgebiete informiert, aber nichts zu der Vitalität der Panzen<br />
aussagen kann. Die beiden Medien ergänzen sich daher sehr gut.<br />
Der Vergleich der Karten mit den S<strong>at</strong>ellitenbildern macht auch<br />
deutlich, wie die Karten entstanden sind: Die Karten sind das<br />
Ergebnis einer gezielten Auswertung von Luftbildern, die somit<br />
für „Nichtexperten“ in einfacher zugängliche Karten „übersetzt“<br />
wurden.<br />
zu 8:<br />
Maßnahmen: Bau des Kok-Aral-Dammes und Wiederbelebung<br />
der Fischerei-Industrie (im Norden), Verbesserung der Bewässe-<br />
rungssysteme, Panzungen von Waldschutzstreifen mit salzre-<br />
sistenten Saxaul Bäumen (im Norden und Süden).<br />
Das Versprechen einer „historischen Verantwortung“ Russlands<br />
kann aufgrund der geringen wirtschaftlichen Nutzung der Region<br />
angezweifelt werden. Russland interveniert zurzeit in den<br />
ehemaligen Sowjetrepubliken, wo es um eindeutig russische<br />
Interessen wie die Förderung oder den Transport von Erdöl oder<br />
Erdgas geht. Die Führung Kasachstans oder Usbekistans wird<br />
kaum genügend Einuss auf die russische Regierung haben,<br />
dieses Versprechen einzufordern.<br />
Möglicherweise wird Pfannenstiel viele Fußballfans mit den Spielen<br />
der Global United erreichen und sie klimapolitisch anregen.<br />
Welche Auswirkungen das konkret haben wird, ist oen. Die<br />
Auswirkungen für den Aralsee, der ja nur ein Teilaspekt des Projektes<br />
des ehemaligen Fußball-Pros ist, werden gering/kaum wahr -<br />
nehmbar sein. Neben dem Projekt von Pfannenstiel sind im Jahr<br />
2009 auch andere Projekte gestartet, z. B. der Dokumentarlm<br />
„Home“ des französischen Fotografen und Journalisten Yann Arthus-Bertrand.<br />
Jedoch ist dieses Projekt schnell aus den Nachrichten<br />
verdrängt worden. Pfannenstiel wird es vermutlich ähnlich<br />
ergehen. Sind dann nicht doch Obama oder Merkel gefordert?<br />
3