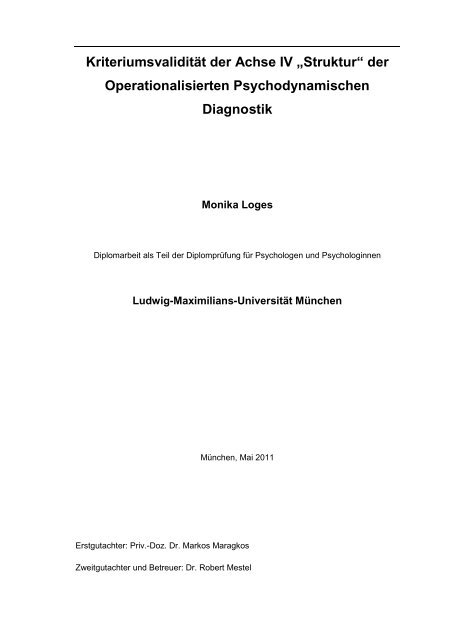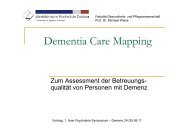Diplomarbeit Monika Loges - Helios Kliniken
Diplomarbeit Monika Loges - Helios Kliniken
Diplomarbeit Monika Loges - Helios Kliniken
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kriteriumsvalidität der Achse IV „Struktur“ der<br />
Operationalisierten Psychodynamischen<br />
Diagnostik<br />
<strong>Monika</strong> <strong>Loges</strong><br />
<strong>Diplomarbeit</strong> als Teil der Diplomprüfung für Psychologen und Psychologinnen<br />
Ludwig-Maximilians-Universität München<br />
München, Mai 2011<br />
Erstgutachter: Priv.-Doz. Dr. Markos Maragkos<br />
Zweitgutachter und Betreuer: Dr. Robert Mestel
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
0 ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................................ 6<br />
1 EINLEITUNG ........................................................................................................ 8<br />
2 THEORIE DER KRITERIUMSVALIDITÄT DER OPERATIONALISIERTEN<br />
PSYCHODYNAMISCHEN DIAGNOSTIK (OPD).......................................................... 9<br />
2.1 DIE OPERATIONALISIERTE PSYCHODYNAMISCHE DIAGNOSTIK ............................................ 9<br />
2.1.1 Entwicklung der OPD ................................................................................................ 9<br />
2.1.2 Achse IV „Struktur“ der OPD-1 ................................................................................ 10<br />
2.1.2.1 Dimensionen der „Struktur“ .......................................................................................... 11<br />
2.1.2.2 „Strukturniveau“ ........................................................................................................... 13<br />
2.1.3 Unterschiede zur OPD-2Strukturachse ................................................................... 14<br />
2.2 KRITERIUMSVALIDITÄT .................................................................................................... 16<br />
2.2.1 Validität .................................................................................................................... 16<br />
2.2.2 Prädiktoren .............................................................................................................. 17<br />
2.2.3 Kriterium „Therapieerfolg“ ....................................................................................... 18<br />
2.2.3.1 Einzelnes Multiples Ergebniskriterium (EMEK) ............................................................ 20<br />
2.3 FORSCHUNGSKONTEXT .................................................................................................. 20<br />
2.3.1 Reliabilität (Objektivität) ........................................................................................... 20<br />
2.3.2 Validität .................................................................................................................... 22<br />
2.3.2.1 Inhaltsvalidität .............................................................................................................. 22<br />
2.3.2.2 Konstruktvalidität ......................................................................................................... 22<br />
2.3.2.3 Kriteriumsvalidität ........................................................................................................ 24<br />
2.3.2.3.1 Übereinstimmungsvalidität ...................................................................................... 24<br />
2.3.2.3.2 Vorhersagevalidität .................................................................................................. 26<br />
2.3.3 Zusammenfassung .................................................................................................. 26<br />
3 FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN.......................................................27<br />
3.1 FRAGESTELLUNGEN UND ZIELE ...................................................................................... 27<br />
3.2 HYPOTHESEN ................................................................................................................ 29<br />
3.2.1 Hauptuntersuchung ................................................................................................. 29<br />
3.2.2 Nebenuntersuchung ................................................................................................ 31<br />
4 METHODEN ........................................................................................................32<br />
4.1 STICHPROBEN ............................................................................................................... 32<br />
4.1.1 Stichprobe 1 (Hauptstichprobe) .............................................................................. 32<br />
4.1.1.1 Soziodemografie .......................................................................................................... 33<br />
4.1.1.2 Krankheitsbezogene Merkmale ................................................................................... 34<br />
4.1.1.3 Behandlungsmerkmale ................................................................................................ 36<br />
4.1.1.4 Repräsentativität .......................................................................................................... 37<br />
4.1.2 Stichprobe 2 ............................................................................................................ 38<br />
4.1.3 Stichprobe 3 ............................................................................................................ 39<br />
2
Inhaltsverzeichnis<br />
4.2 KLINIKKONZEPT ............................................................................................................. 41<br />
4.2.1 Behandlungskonzept in Abteilung 1 und 2 .............................................................. 41<br />
4.3 ERHEBUNGSINSTRUMENTE ............................................................................................. 42<br />
4.3.1 Der Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS) ........................................................ 42<br />
4.3.2 Basisdokumentation für Psychotherapeutische Medizin (Psy-BaDo-PTM) ............ 43<br />
4.3.2.1 „TherapeutInnen Dokumentationsbogen“ .................................................................... 43<br />
4.3.2.2 Grönenbacher Nachbefragungsbogen (GNBB-2004) .................................................. 44<br />
4.3.3 Die „Symptom-Checkliste“ (SCL-90-R) ................................................................... 44<br />
4.3.4 Der Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens (VEV-K) ................... 46<br />
4.4 UNTERSUCHUNGSDESIGN UND DURCHFÜHRUNG ............................................................. 47<br />
4.5 STATISTIK ..................................................................................................................... 48<br />
4.5.1 Klinische Signifikanz ................................................................................................ 49<br />
4.5.1.1 Das Kriterium der statistischen Signifikanz .................................................................. 49<br />
4.5.1.2 Das Kriterium der klinischen Signifikanz ...................................................................... 49<br />
4.5.2 Effektgrößen ............................................................................................................ 51<br />
4.6 OPERATIONALISIERUNG DER HAUPTUNTERSUCHUNG ....................................................... 52<br />
4.6.1 Kriterium „Therapieerfolg“ ....................................................................................... 52<br />
4.6.1.1 Operationalisierung und Indexierung des EMEK ......................................................... 53<br />
4.6.1.1.1 Teilkriterien des EMEK ............................................................................................ 53<br />
4.6.1.1.2 Berechnung ............................................................................................................. 54<br />
4.6.1.1.3 Inhaltliche Bedeutung .............................................................................................. 54<br />
4.6.2 Prädiktor „Gesamtstrukturniveau“ und konkurrierende Prädiktoren........................ 55<br />
4.7 OPERATIONALISIERUNG DER NEBENUNTERSUCHUNG ....................................................... 56<br />
4.7.1 Kriterium „Therapieerfolg“ ....................................................................................... 56<br />
4.7.2 Operationalisierung des „Anteils strukturell beeinträchtigter Patientinnen einer<br />
therapeutischen Gruppe“..................................................................................................... 56<br />
4.7.3 Prädiktoren .............................................................................................................. 56<br />
5 ERGEBNISSE ......................................................................................................57<br />
5.1 EMEK .......................................................................................................................... 57<br />
5.1.1 Itemanalyse ............................................................................................................. 57<br />
5.1.2 Faktorenanalyse ...................................................................................................... 59<br />
5.2 THERAPIEERFOLG .......................................................................................................... 61<br />
5.2.1 Therapieerfolg gemessen mit dem GSI-Rohwert der SCL-90-R ............................ 61<br />
5.2.2 Therapieerfolg gemessen mit dem VEV-K .............................................................. 64<br />
5.2.3 Therapieerfolg gemessen mit der Einschätzung der Änderung des psychischen<br />
Befindens durch die Therapeutin zum Therapieende ......................................................... 65<br />
5.2.4 Therapieerfolg gemessen mit dem EMEK .............................................................. 66<br />
5.2.5 Zusammenfassung .................................................................................................. 67<br />
5.3 ZU DEN HYPOTHESEN 1 UND 2 ....................................................................................... 67<br />
5.3.1 Zu Hypothese 1 ....................................................................................................... 67<br />
5.3.2 Zu Hypothese 2 ....................................................................................................... 68<br />
3
Inhaltsverzeichnis<br />
5.4 ZU DEN HYPOTHESEN 3 UND 4 ....................................................................................... 69<br />
5.4.1 Zu Hypothese 3 ....................................................................................................... 69<br />
5.4.2 Zu Hypothese 4 ....................................................................................................... 70<br />
5.5 ZU DEN HYPOTHESEN 5 UND 6 ....................................................................................... 71<br />
5.5.1 Mittelwerte und Standardabweichungen der Prädiktoren ....................................... 71<br />
5.5.2 Korrelationen der Variablen..................................................................................... 72<br />
5.5.3 Regression auf den SCL-90-R-Wert zum Therapieende ........................................ 75<br />
5.5.4 Regression auf den SCL-90-R-Wert zum Nachuntersuchungszeitpunkt ................ 79<br />
5.6 ZU HYPOTHESE 7 .......................................................................................................... 81<br />
5.6.1 Untersuchung in SP2 .............................................................................................. 82<br />
5.6.2 Untersuchung in SP3 .............................................................................................. 82<br />
5.7 ZU HYPOTHESE 8 .......................................................................................................... 83<br />
5.7.1 Untersuchung in SP2 .............................................................................................. 83<br />
5.7.1.1 Mittelwerte, Standardabweichungen und Therapieerfolg in SP2 ................................. 83<br />
5.7.1.2 Korrelationen der Variablen in SP2 .............................................................................. 85<br />
5.7.1.3 Einfache Regressionen auf die Ergebniskriterien in SP2 ............................................. 86<br />
5.7.1.4 Multiple Regression auf den SCL-90-R-Post-Wert in SP2 ........................................... 86<br />
5.7.2 Untersuchung in SP3 .............................................................................................. 87<br />
5.7.2.1 Mittelwerte, Standardabweichungen und Therapieerfolg in SP3 ................................. 87<br />
5.7.2.2 Korrelationen der Variablen in SP3 .............................................................................. 89<br />
5.7.2.3 Einfache Regressionen auf die Ergebniskriterien in SP3 ............................................. 90<br />
5.7.2.4 Multiple Regression auf die BSS-Prä-Post-Differenz in SP3 ....................................... 91<br />
5.8 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE .......................................................................... 92<br />
5.8.1 Hauptuntersuchung ................................................................................................. 92<br />
5.8.1.1 Signifikante Korrelationen zwischen Gesamtstrukturniveau und den Kriterien des<br />
allgemeinen Therapieerfolgs ......................................................................................................... 92<br />
5.8.1.2 Signifikanter Einfluss des Gesamtstrukturniveaus auf die Vorhersage der Kriterien des<br />
allgemeinen Therapieerfolgs ......................................................................................................... 93<br />
5.8.1.3 Signifikante Korrelationen ausgewählter Prädiktoren mit den Kriterien des allgemeinen<br />
Therapieerfolgs ............................................................................................................................. 93<br />
5.8.1.4 Signifikante Korrelationen des Gesamtstrukturniveaus mit den ausgewählten<br />
Prädiktoren .................................................................................................................................... 94<br />
5.8.1.5 Signifikanter Einfluss der ausgewählten Prädiktoren und Relevanz des Einflusses des<br />
Gesamtstrukturniveaus auf die Vorhersage des Therapieerfolgs .................................................. 94<br />
5.8.2 Nebenuntersuchung ................................................................................................ 95<br />
6 DISKUSSION .......................................................................................................96<br />
6.1 METHODISCHE KRITIK .................................................................................................... 96<br />
6.1.1 Untersuchungsdesign .............................................................................................. 96<br />
6.1.2 Messinstrumente ..................................................................................................... 98<br />
6.1.3 Generalisierbarkeit der Ergebnisse ......................................................................... 99<br />
6.2 DISKUSSION DER ERGEBNISSE ..................................................................................... 101<br />
6.2.1 Analyse des einzelnen multiplen Ergebniskriteriums (EMEK) .............................. 101<br />
4
Inhaltsverzeichnis<br />
6.2.2 Therapieerfolg ....................................................................................................... 103<br />
6.2.3 Kriteriumsvalidität .................................................................................................. 106<br />
6.2.4 Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen in der therapeutischen Gruppe .... 112<br />
6.2.5 Zusammenfassung der Diskussion im Hinblick auf die Fragestellungen .............. 113<br />
6.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK ....................................................................... 114<br />
LITERATURVERZEICHNIS ...................................................................................... 116<br />
TABELLENVERZEICHNIS ....................................................................................... 122<br />
ANHANG A - ICD-10 DIAGNOSEN .......................................................................... 124<br />
ANHANG B - REPRÄSENTATIVITÄT ...................................................................... 127<br />
ANHANG C - ERHEBUNGSINSTRUMENTE ............................................................ 129<br />
ANHANG D - EMEK ................................................................................................. 140<br />
ANHANG E - MULTIPLE REGRESSIONEN ............................................................. 143<br />
5
Zusammenfassung<br />
0 Zusammenfassung<br />
An drei konsekutiven Stichproben von 196 (53, 49) Patientinnen 1 der methodenintegra-<br />
tiv arbeitenden HELIOS Klinik Bad Grönenbach für psychosomatische Medizin wurde<br />
in vorliegender Arbeit die Kriteriumsvalidität der Achse IV (Struktur) der Operationali-<br />
sierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD) erforscht. Zusätzlich wurde die Frage<br />
untersucht, ob ein höherer Anteil an strukturell beeinträchtigten Patientinnen innerhalb<br />
einer therapeutischen Gruppe sich negativ auf den Behandlungserfolg auswirkt.<br />
Die Daten wurden unter klinischer Routine zu drei Messzeitpunkten, bei Klinikaufnah-<br />
me (Prä), bei Entlassung (Post) und postalisch ein Jahr danach (Kat) erhoben (natura-<br />
listische Längsschnittstudie ohne Kontrollgruppe). Die Hauptstichprobe (N = 196) setz-<br />
te sich aus Patientinnen mit mehrheitlich mäßigem Strukturniveau der Abteilung 1 und<br />
2 zusammen und wurde in zwei Untergruppen unterteilt, Gruppe I (n = 31) mit Gesamt-<br />
strukturniveau 2.5 und 3.0, Gruppe II mit Gesamtstrukturniveau 1.5 und 2.0 (n = 165).<br />
Es wurden Zusammenhänge der Gesamtstruktureinschätzung (nach OPD-1) mit ande-<br />
ren Patientinnenvariablen geprüft, wie der „allgemeinen Symptombelastung“ (Symptom<br />
Checklist 90 in revidierter Form, SCL-90-R, Franke, 2002; Beeinträchtigungsschwere-<br />
score, BSS, Schepank, 1995) zu Behandlungsbeginn, der „Dauer der Arbeitsunfähig-<br />
keit im Jahr vor dem Klinikaufenthalt“, der „Anzahl an Diagnosen“, der „Dauer der Er-<br />
krankung“, einer „komorbiden Persönlichkeitsstörung“, der „Motivation“ zu Behand-<br />
lungsbeginn und den soziodemografischen Variablen „Alter“ und „Geschlecht“. Des<br />
Weiteren wurde die prognostische Validität der Einschätzung des Gesamtstrukturni-<br />
veaus auf mehrere Kriterien des globalen Therapieerfolgs ermittelt und untersucht, wie<br />
die ausgewählten Prädiktor- und Kriteriumsvariablen zusammenhängen und zur Vor-<br />
hersage optimal ausgewählt werden können (als Prädiktorvariablen wurden obige<br />
Patientinnenvariablen herangezogen). Die Auswahl der Prädiktoren erfolgte in Anleh-<br />
nung an die bisherige Forschung und war den Gegebenheiten des in der Klinik vor-<br />
handenen Datenmaterials unterworfen.<br />
Als Ergebniskriterien dienten der Status- und Differenzwert des „global severity index“<br />
(GSI) der SCL-90-R, die Kurzform des Veränderungsfragebogens des Erlebens und<br />
Verhaltens (VEV-K, Kriebel, Paar, Schmitz-Buhl & Raatz, 2001), die Einschätzung der<br />
psychischen Veränderung durch die Therapeutin am Therapieende und ein explorativ<br />
gebildetes einzelnes multiples Ergebniskriterium (EMEK, bestehend aus 15 Einzelkrite-<br />
1 Da sich die Untersuchungsstichproben aus überwiegend Frauen zusammensetzten, werden Personenbezeichnungen<br />
aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der weiblichen Form verwendet. Dies<br />
schließt das jeweils andere Geschlecht mit ein.<br />
6
Zusammenfassung<br />
rien). Das EMEK hat sich als ausreichend reliabel (Cronbach´s α = .84) erwiesen, fak-<br />
torenanalytisch lädt es auf einem Generalfaktor, und es korreliert hoch mit den singulä-<br />
ren Kriterien, insbesondere mit dem VEV-K (r = .80).<br />
Relevante Assoziationen fanden sich für das Gesamtstrukturniveau und die Beeint-<br />
rächtigungsschwere im BSS, die Anzahl der Diagnosen, die Erkrankungsdauer, die<br />
Motivation und für eine komorbide Persönlichkeitsstörung. Keine relevanten Zusam-<br />
menhänge fanden sich für das Alter und das Geschlecht, für die Gesamtsymptom-<br />
belastung zu Behandlungsbeginn (SCL-90-R) sowie für die Dauer der Arbeitsunfähig-<br />
keit vor dem Klinikaufenthalt.<br />
Auf die Vorhersage des Therapieerfolgs (SCL-90-R-Wert) bei Entlassung hat die Ein-<br />
schätzung des Gesamtstrukturniveaus einen hochsignifikanten Einfluss (p ≤ .000) und<br />
kann 6.7 % der Varianz dieses Kriteriums aufklären; auf den SCL-90-R-Wert zum Na-<br />
chuntersuchungszeitpunkt zeigt sich nur noch ein signifikanter Einfluss (p = .033) mit<br />
Varianzaufklärung von 2.3 %. Kurz- und mittelfristig zeigen sich für mäßig bis gering<br />
(Gruppe I) und gut bis mäßig integrierte (Gruppe II) Patientinnen parallele Verläufe. Die<br />
mäßig bis gering Integrierten sind sowohl zu Beginn als auch bei Entlassung und ein<br />
Jahr nach der Behandlung höher belastet (SCL-90-R-Wert). Am Therapieende berich-<br />
ten die geringer Strukturierten zudem über weniger Zugewinne an Optimismus, Gelas-<br />
senheit und Entspannung (VEV-K), die sich aber ein Jahr später den höher Strukturier-<br />
ten wieder angleichen (nur noch ein Trend p = .062). Auf breiter Basis (Thera-<br />
peutinneneinschätzung, EMEK) gibt es keine Zusammenhänge mit dem Gesamtstruk-<br />
turniveau, d.h. alle Patientinnen profitieren kurz- und mittelfristig gleichermaßen von<br />
der Behandlung. Unter den nach den Kriterien der klinischen Signifikanz „Verbesser-<br />
ten“ sind alle Patientinnen gleichermaßen vertreten, bei den signifikant „Verschlechter-<br />
ten“ und im Therapeutinnenrating „Unveränderten“ oder „Verschlechterten“ befanden<br />
sich jedoch überzufällig häufig geringer strukturierte Patientinnen. Diesem Ergebnis<br />
sollte in Zukunft besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.<br />
Die besten der ausgewählten Prädiktoren (stepwise Regression) zur Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs bei Entlassung (Ergebniskriterium: SCL-90-R-Wert) sind der SCL-90-<br />
R-Wert bei Aufnahme, das Gesamtstrukturniveau, das Geschlecht, der BSS-<br />
Aufnahmewert und die Arbeitsunfähigkeit vor dem Klinikaufenthalt. Auf den SCL-90-R-<br />
Wert zum Nachuntersuchungszeitpunkt haben der SCL-90-R- und der BSS-<br />
Aufnahmewert einen relevanten prognostischen Einfluss.<br />
Die Frage, ob eine größere Anzahl an strukturell beeinträchtigten Patientinnen (Ge-<br />
samtstrukturniveau ≥ 2.5) in einer Therapiegruppe sich negativ auf den Behandlungs-<br />
7
Zusammenfassung<br />
erfolg auswirkt, kann nicht abschließend beantwortet werden. Die Ergebnisse sprechen<br />
dafür, dass es keine Rolle spielt, wie viele geringer strukturierte Patientinnen gemein-<br />
sam in einer Gruppe behandelt werden (Ergebniskriterium: SCL-90-R-Post-Wert). Da<br />
der Einfluss aber mit anderen relevanten Variablen zusammenhängt und die statisti-<br />
sche Power aufgrund der Stichprobenzusammensetzung relativ gering ausfällt, kann<br />
dies nur eine vorläufige Einschätzung sein, die in weiteren Erhebungen repliziert wer-<br />
den muss. Möglicherweise hängt das Ergebnis auch mit dem besonderen Therapie-<br />
konzept der HELIOS Klinik Bad Grönenbach zusammen, das auch für diese<br />
Patientinnengruppe eine hilfreiche Behandlung darstellt.<br />
Die OPD-Strukturachse hat sich in vorliegender Untersuchung insgesamt als prädiktiv<br />
valide und übereinstimmend mit anderen Kriterien und Instrumenten erwiesen, so dass<br />
es sinnvoll und nutzbringend erscheint, sie im klinischen Alltag einzusetzen.<br />
1 Einleitung<br />
Das multiaxiale Diagnostiksystem „Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik“<br />
(OPD) hat sich in Forschung und Praxis in der ambulanten und stationären Psychothe-<br />
rapie sowie zur Qualitätssicherung (vgl. Heuft, Jakobson, Kriebel, Schneider & Rudolf,<br />
2005; Arbeitskreis OPD 2 , 2007) etabliert. Ursprünglich aus einer Unzufriedenheit mit<br />
den phänomenologisch orientierten Klassifikationen wie der ICD-10 oder dem DSM-IV<br />
entwickelt, hat die OPD sich als komplementäres, breit einsetzbares Instrument nicht<br />
nur in der Diagnostik und Evaluation bewährt, sondern auch bei der Therapieplanung<br />
als geeignet erwiesen. Das Ziel war, die inhaltlich oft unscharfen und zudem uneinheit-<br />
lichen psychodynamischen Konzepte, die nur schwer empirisch untersucht werden<br />
konnten, durch ein valides und reliables Instrument zu erfassen.<br />
In vorliegender Untersuchung wird die Kriteriumsvalidität der Achse IV „Struktur“ der<br />
OPD-1 in einer unter den Routinebedingungen der stationären psychosomatischen<br />
Rehabilitation erhobenen Stichprobe untersucht. Vorrangiges Ziel der OPD-Diagnostik<br />
(Struktur) ist, die Therapieplanung entsprechend den Defiziten oder Störungen auf<br />
struktureller Ebene auszurichten. In den Abteilungen 1 und 2 der HELIOS Klinik Bad<br />
Grönenbach werden immer mehr Patientinnen mit Einschränkungen auf struktureller<br />
Ebene behandelt (vgl. www.helios-kliniken.de). Das Integrationsniveau dieser Patien-<br />
tinnen ist als mäßig bis gering integriert (Gesamtstrukturniveau 2.5, siehe 2.1.2) einzu-<br />
2 Der Arbeitskreis OPD, 1996 und 2001, wird im Folgenden mit OPD-1, der Arbeitskreis OPD,<br />
2007, mit OPD-2 bezeichnet.<br />
8
Einleitung<br />
stufen und es stellt sich die Frage, ob die Therapie darauf ausgerichtet ist bzw. ob die<br />
Diagnostik sinnvolle und nutzbringende Handlungsanweisungen für die Behandlung<br />
bereitstellt. In vorliegender Arbeit wird zunächst der kurzfristige Therapieerfolg bei Ent-<br />
lassung und anschließend der mittelfristige Therapieerfolg ca. ein Jahr nach dem Kli-<br />
nikaufenthalt untersucht und darauf aufbauend die Gesamtstruktureinschätzung auf<br />
ihren prädiktiven Wert für das Kriterium Therapieerfolg untersucht. Eine weitere Frage-<br />
stellung aus der klinischen Praxis ist, ob sich ein höherer Anteil an Patientinnen mit<br />
strukturellen Einschränkungen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5) in den Therapiegruppen<br />
negativ auf den Behandlungserfolg auswirkt. Dieser Frage wird ebenfalls im Rahmen<br />
einer Pilotstudie nachgegangen.<br />
Im theoretischen Teil dieser Arbeit wird zunächst die OPD vorgestellt, auf wichtige Be-<br />
griffe und Definitionen eingegangen und die Fragestellungen in den Forschungskontext<br />
eingebettet, um dann anschließend zu den Hypothesen hinzuführen. Im methodischen<br />
Teil folgen nach der Beschreibung der Untersuchungsstichproben die Darstellungen<br />
der Institution der Erhebung, der Erhebungsinstrumente, des Designs und der Durch-<br />
führung, der statistischen Verfahren und der Operationalisierung der Untersuchung.<br />
Darauf aufbauend werden die Ergebnisse berichtet und abschließend diskutiert.<br />
2 Theorie der Kriteriumsvalidität der Operationalisierten<br />
Psychodynamischen Diagnostik (OPD)<br />
2.1 Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
2.1.1 Entwicklung der OPD<br />
Die OPD (OPD-1, 1996; Arbeitskreis gegründet 1992) hat sich im deutschsprachigen<br />
Raum zu einem Standardinstrument der psychodynamischen Diagnostik entwickelt.<br />
Das Instrument wird seit mittlerweile 15 Jahren erfolgreich in <strong>Kliniken</strong>, ambulanten Pra-<br />
xen, in Qualitätssicherung und Weiterbildung in Trainingsseminaren sowie in der wis-<br />
senschaftlichen Forschung eingesetzt. Der Arbeitskreis OPD (OPD-1, 1996; OPD-2,<br />
2007) verfolgte das Ziel, der psychodynamischen Psychotherapeutin nicht nur ein<br />
reliables, sondern auch ein valides Instrument an die Hand zu geben, das komplemen-<br />
tär zu den phänomenologischen Klassifikationsschemata wie ICD-10 und DSM-IV ein-<br />
gesetzt werden und die Übereinstimmung unter den Anwenderinnen verbessern kann<br />
(OPD-2, 2007, S. 32-34). „Die OPD dient sowohl der Status- als auch der Prozessdi-<br />
agnostik, [….] weil mit ihrer Hilfe psychodynamische Konstrukte messbar werden, die<br />
9
Theorie – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
therapie- und veränderungsrelevant sind“ (OPD-2, 2007, S. 47), so dass sie auch zur<br />
Therapieplanung und Evaluation verwendet werden kann. Um den Beurteilungspro-<br />
zess praktikabler und reliabler zu gestalten, wurden außerdem Checklisten für die ein-<br />
zelnen Achsen herausgegeben (Grande & Oberbracht, 2000; Rudolf et al., 1998,<br />
2000).<br />
Im Manual der OPD werden vier Achsen operationalisiert, die die psychodynamische<br />
Beurteilung einer Patientin im Hinblick auf ihr Krankheitserleben und ihre Behand-<br />
lungsvoraussetzungen (Achse I), ihre Beziehungen (Achse II), ihre Konflikte (Achse III)<br />
und ihre Struktur (Achse IV) ermöglichen. Zusätzlich erfasst Achse V deskriptiv-<br />
phänomenologisch die psychischen und psychosomatischen Störungen nach dem Ka-<br />
pitel V (F) der ICD-10 (OPD-1, 2001; OPD-2, 2007).<br />
2.1.2 Achse IV „Struktur“ der OPD-1<br />
Relevant für die vorliegende Arbeit ist die Achse IV – Struktur, da diese in besonderer<br />
Weise dazu beträgt, Handlungsanweisungen für eine differenzielle Indikationsstellung<br />
zu und für die Durchführung von psychodynamischen Therapien bereitzustellen<br />
(Schneider, Lange & Heuft, 2002) und somit zu den Kernelementen der OPD gehört.<br />
Psychische Struktur wird herbei verstanden als eine für den Einzelnen typische Dispo-<br />
sition des Erlebens und Verhaltens. Die grundlegenden strukturellen Muster manifes-<br />
tieren sich, für andere sichtbar im interaktionellen Handeln (gemessen in einem Zeit-<br />
raum von mindestens 1-2 Jahren), d.h. die Struktur umfasst die Gestaltung und die<br />
Funktionsweisen des Selbst in Beziehung zu Anderen. Das bedeutet für die Diagnostik,<br />
dass die Untersucherin etwas von der Struktur ihrer Patientin in der unmittelbaren In-<br />
teraktion erlebt, aber auch aus den Schilderungen der Beziehungen, des Alltagslebens<br />
und der Lebensgeschichte ein Bild von der Struktur gewinnen kann (OPD-2, 2007, S.<br />
120-121). Die Struktur bezieht sich auf die Vulnerabilität der Persönlichkeit, die Dispo-<br />
sition zur Krankheit und die Kapazität zur Verarbeitung von inneren Konflikten und äu-<br />
ßeren Belastungserfahrungen (OPD-2, 2007). Sie stellt gewissermaßen den Hinter-<br />
grund dar, auf welchem sich Konflikte mit ihren gut oder schlecht angepassten Lö-<br />
sungsmustern abspielen. Ausgeschlossen sind hierbei akute Krisen und Erkrankungen.<br />
Theoretisch stützt sich die Strukturachse vor allem auf objektbeziehungstheoretische 3 ,<br />
selbstpsychologische und ichpsychologische Ansätze, die in einem integrativen Modell<br />
zusammengefasst werden (OPD-1, 2001; OPD-2, 2007).<br />
3<br />
Der Begriff „Objekt“ wird (wie andere Begriffe auch) aus der psychodynamischen Terminologie<br />
übernommen und ist gleichbedeutend mit einem reagierenden Gegenüber, also einer Person,<br />
die auf die Äußerungen des „Subjekts“ eingeht.<br />
10
Theorie – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
2.1.2.1 Dimensionen der „Struktur“<br />
Das Konstrukt „Struktur“ wird durch sechs Dimensionen (jeweils drei auf das Subjekt<br />
und drei auf das Objekt bezogene) erfasst, die logisch voneinander abhängig sind:<br />
1. Die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung<br />
2. Die Fähigkeit zur Selbststeuerung<br />
3. Die Fähigkeit zur Abwehr<br />
4. Die Fähigkeit zur Objektwahrnehmung<br />
5. Die Fähigkeit zur Kommunikation<br />
6. Die Fähigkeit zur Bindung<br />
Diese strukturellen Dimensionen bilden das Konstrukt der „Struktur“ aus verschiedenen<br />
Perspektiven ab und erfassen die komplexen Funktionsmuster in verschiedenen Zu-<br />
sammenhängen. Es folgt eine kurze Charakterisierung der strukturellen Dimensionen<br />
(nach OPD-1, 1996):<br />
(1) Selbstwahrnehmung<br />
Die Dimension der Selbstwahrnehmung beschreibt die Fähigkeit, sich selbst reflektie-<br />
ren zu können und dadurch ein Bild des eigenen Selbst zu bekommen, sowie dieses<br />
Selbstbild hinsichtlich seiner psychosexuellen und sozialen Aspekte kohärent und über<br />
die Zeit konstant halten zu können (Identität). Außerdem bezieht sie sich auf die Fähig-<br />
keit, innerseelische Vorgänge, vor allem Affekte, bei sich selbst differenziert wahrneh-<br />
men zu können (Introspektion).<br />
(2) Selbststeuerung<br />
Die Dimension der Selbststeuerung bezieht sich auf die Fähigkeit, sich selbst zu orga-<br />
nisieren, d.h. steuernd mit den eigenen Triebimpulsen, Affekten und dem Selbstwertge-<br />
fühl umzugehen. Daraus resultiert die Fähigkeit, sich selbst verantwortlich als Urheber<br />
eigenen kompetenten Handelns zu erleben und dabei Selbstvertrauen zu empfinden.<br />
Es ist ein bipolares Konzept, das zu stark (Übersteuerung) oder zu schwach (Impulsivi-<br />
tät) ausgeprägt sein kann. Weiter gehören dazu Kreativität und Toleranz für die Varia-<br />
tionsbreite der Affekte, insbesondere für negative und widersprüchliche Affekte<br />
(Ambivalenztoleranz) sowie die Fähigkeit zur Antizipation von Affekten und die Regula-<br />
tion des Selbstwertgefühls. Die Selbststeuerung ist an die intrapsychische Konfliktver-<br />
arbeitung (Abwehr) gebunden.<br />
11
Theorie – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
(3) Abwehr<br />
Die Dimension der Abwehr bezieht sich darauf, dass die Person, ohne bewusste Ab-<br />
sicht, Aspekte der Wahrnehmung seiner selbst oder der Umwelt einengt (unterdrückt,<br />
ausklammert, ausblendet, entstellt, verzerrt oder gar zerstört), um so diese Wahrneh-<br />
mungsinhalte für seine Person akzeptabler zu gestalten und das seelische Gleichge-<br />
wicht in inneren und äußeren Belastungssituationen aufrechtzuerhalten oder wieder-<br />
herzustellen. „Es handelt sich dabei auch um einen Versuch des Selbstschutzes auf<br />
Kosten der Wahrnehmung der Realität mit Konsequenzen auf der Verhaltensebene“<br />
(Moore & Fine, 1990, zitiert in OPD-1, 1996, S. 168). Diese Dimension hat Beziehun-<br />
gen zu anderen Dimensionen der Struktur, wie der Selbststeuerung (s.o.) und Bindung.<br />
„Mit den sog. Abwehrmechanismen werden die einzelnen Regulationsfunktionen be-<br />
schrieben; sie lassen sich idealtypisch verschiedenen Abwehrniveaus zuordnen …“<br />
(vgl. Vaillant, 1972, 1976, zitiert in OPD-1, 1996, S. 169), bestimmen aber nicht gene-<br />
rell ein bestimmtes Strukturniveau. Kriterien für die Bestimmung des Abwehrniveaus<br />
sind:<br />
Der Gegenstand der Abwehr<br />
Der Erfolg der Abwehr<br />
Die Stabilität der Abwehr<br />
Die Flexibilität der Abwehr<br />
Die Form der Abwehr<br />
(4) Objektwahrnehmung<br />
Diese Dimension beschreibt die Fähigkeit, ein Bild vom Gegenüber zu entwickeln und<br />
dabei das Bild des Selbst von dem der anderen Person zu unterscheiden (Selbst-<br />
Objekt-Differenzierung). Dazu gehört auch eine ganzheitliche, kohärente und zeitstabi-<br />
le Objektwahrnehmung. Außerdem geht es darum, innerseelische Vorgänge des Ge-<br />
genübers, vor allem deren affektive Seite empathisch wahrnehmen und differenzieren<br />
zu können (Empathie, Intuition, Verstehen).<br />
(5) Kommunikation<br />
In dieser Dimension geht es einerseits um die Fähigkeit, sich emotional auf andere<br />
auszurichten und sich ihnen in eigenen Wünschen, Fantasien, Affekten und anderen<br />
Inhalten mitteilen zu können. Auf der anderen Seite geht es um die Fähigkeit, beim<br />
Gegenüber seelische Vorgänge wahrnehmen und differenzieren zu können, sowie<br />
dessen Mitteilungen entschlüsseln zu können. Dabei geht es neben der Empathie auch<br />
um die Fähigkeit, Nähe und Distanz regulieren zu können.<br />
12
Theorie – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
(6) Bindung<br />
Diese Dimension bezieht sich auf die Möglichkeit der Person, sich an wichtige Bezugs-<br />
personen zu binden. Bindung beschreibt die Intensität und Variabilität der Beziehungs-<br />
formen und ist eng mit der Objektwahrnehmung verknüpft. Gestörte Bindung ist eine<br />
bipolare Dimension: Vergebliches Bemühen um Bindung kann zu negativer, leidvoller<br />
Angewiesenheit und Abhängigkeit aber auch zu Isolierung und Einsamkeit führen. Zur<br />
Bindung gehören folgende Kategorien:<br />
Objektinternalisierung<br />
Objektkonstanz<br />
Variabilität der Objektbeziehungen<br />
Loslassen (Lösen und Trauern)<br />
Regeln der Interaktion zu entwickeln zu deren Schutz<br />
2.1.2.2 „Strukturniveau“<br />
Um das Ausmaß und die Qualität der strukturellen „Gestörtheit“ oder „Störbarkeit“ zu<br />
erfassen, werden vier Integrationsniveaus für die einzelnen Dimensionen unterschie-<br />
den: gut integriert, mäßig integriert, gering integriert und desintegriert (die von 1 = gut<br />
integriert bis 4 = desintegriert operationalisiert sind). Da es sich um ein Kontinuum zwi-<br />
schen den Extrempolen der reifen Struktur und der psychotischen Struktur handelt,<br />
kann jeweils noch eine Zwischenstufe gegeben werden, was somit eine siebenfache<br />
Stufung (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 und 4.0) erlaubt. Aus den Einschätzungen der Integ-<br />
rationsniveaus der einzelnen Dimensionen wird ein globaler Wert, das „Gesamtstruk-<br />
turniveau“, gebildet. Für die vorliegende Studie relevant ist diese siebenstufige Global-<br />
einschätzung nach OPD-1 (vgl. OPD-1, 2001).<br />
Es folgt eine kurze Charakteristik der einzelnen Integrationsniveaus:<br />
Niveau (1): Gute Integration<br />
Die intrapsychischen und interpersonell regulierenden Funktionen stehen der Person<br />
prinzipiell zur Verfügung, d.h. sie bleiben unabhängig von inneren oder äußeren Belas-<br />
tungssituationen erhalten oder können rasch wieder gewonnen werden. Die gut inte-<br />
grierte psychische Struktur stellt einen psychischen Innenraum zur Verfügung, in dem<br />
intrapsychische Konflikte ausgetragen werden können. Diese ereignen sich zwischen<br />
unterschiedlichen Bedürfnissen und Bedürfnisregungen und internalisierten Normen<br />
und Idealen. Die zentrale Angst gilt dem Verlust der Liebe des Objekts.<br />
13
Theorie – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
Niveau (2): Mäßige Integration<br />
Die Verfügbarkeit über die oben beschriebenen Fähigkeiten und Funktionen ist prinzi-<br />
piell erhalten aber situativ herabgesetzt. Auch hier herrschen intrapsychische Konflikte<br />
jedoch mit anderen Inhalten vor, die sich zwischen den Bedürfnissen von unbewusster,<br />
gieriger Bedürftigkeit, der Bemächtigung und Unterwerfung und der steuernden Ge-<br />
genseite durch strenge, rigide und strafende Normen sowie überzogene Ideale ereig-<br />
nen. Die zentrale Angst gilt dem Verlust oder der Zerstörung des stützenden, steuern-<br />
den Objekts.<br />
Niveau (3): Geringe Integration<br />
Die Verfügbarkeit über die oben beschriebenen Fähigkeiten und Funktionen ist entwe-<br />
der dauerhaft (im Sinne eines Entwicklungsdefizits) oder immer wieder im Zusammen-<br />
hang mit Belastungssituationen (im Sinne einer strukturellen Vulnerabilität) deutlich<br />
reduziert. Ausgeschlossen sind kurzfristige Desintegrationen, wie z.B. bei PTBS. Der<br />
seelische Binnenraum ist wenig entwickelt, die Idealstruktur wenig differenziert, die<br />
normative Struktur (Über-Ich) ist dissoziiert. Unbewusste Bedürfnisse werden interper-<br />
sonell ausagiert (in Partnerschaft, Beruf, sozialem Umfeld). Die zentrale Angst gilt der<br />
Vernichtung des Selbst durch das böse Objekt oder durch den Verlust des guten Ob-<br />
jekts.<br />
Niveau (4): Desintegration<br />
Die Person verfügt über keine kohärente Selbststruktur, so dass bei Belastungen die<br />
Gefahr der Desintegration oder Fragmentierung besteht. Stabilität der fragilen Struktur<br />
wird durch Abspaltung oder Verleugnung wesentlicher Triebimpulse und narzisstischer<br />
Bedürfnisse erreicht, so dass sie langfristig nicht bewusst wahrgenommen werden<br />
können. Wenn dieses labile Gleichgewicht zusammenbricht, kommt es im Rahmen der<br />
psychotischen Dekompensation zu einer projektiven Verarbeitung. Die unbewussten<br />
Bedürfnisse werden nun als von außen kommend und nicht der eigenen Person zuge-<br />
hörig erlebt. Falls überhaupt ein Konflikt zu erkennen ist, betrifft der die Gefahr der Fu-<br />
sion mit dem Objekt (Verschmelzung) versus einer isolierenden Abgrenzung oder die<br />
narzisstische Selbstüberhöhung als Kompensation schwerster Selbstzweifel.<br />
2.1.3 Unterschiede zur OPD-2Strukturachse<br />
Seit 2006 (OPD-2, 2007) gibt es eine aktualisierte, verbesserte Version der OPD, die<br />
aus den praktischen und empirischen Erfahrungen entwickelt wurde. In der OPD-2 wird<br />
die Diagnostik um die Therapieplanung ergänzt und es können neben den Therapiezie-<br />
14
Theorie – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
len entsprechende Schwerpunkte für die Therapie gesetzt werden. Anhand dessen<br />
kann der Prozess verfolgt und die Behandlung besser evaluiert werden. Inhaltlich wur-<br />
de jedoch das konzeptionelle Gerüst aufrechterhalten mit der multiaxialen psychody-<br />
namischen Diagnostik (5 Achsen). Die Veränderungen beziehen sich also darauf, dass<br />
die OPD-2 nicht nur auf die Diagnose (Querschnittuntersuchung), sondern mehr auf<br />
die therapeutischen Prozesse fokussiert. Der Arbeitskreis OPD versteht die OPD-2<br />
dabei keineswegs als Endergebnis, sondern als Zwischenschritt, der offen ist für eine<br />
Weiterentwicklung (OPD-2, 2007).<br />
Da in vorliegender Untersuchung die OPD-1 zur Anwendung kommt, werden im Fol-<br />
genden die Strukturachsen von OPD-1 und OPD-2 verglichen und Modifizierungen<br />
kurz diskutiert.<br />
Die OPD-1 differenziert sechs Dimensionen, von denen jeweils drei sich auf das Selbst<br />
und drei sich auf das Objekt beziehen. In der OPD-2 werden vier Dimensionen opera-<br />
tionalisiert, die sich jeweils auf das Selbst und Objekt beziehen und die Dimension der<br />
Abwehr wird herausgenommen und im Anhang operationalisiert. Alle strukturellen<br />
Funktionen beziehen sich somit sowohl auf das psychische Innen wie auf das soziale<br />
Außen, d.h. auf das Selbst und auf die Objekte (OPD-2, 2007).<br />
Die vier Dimensionen im Überblick:<br />
(1) Selbstwahrnehmung und Objektwahrnehmung<br />
Fähigkeit, sich selbstreflexiv wahrzunehmen<br />
Fähigkeit, andere ganzheitlich und realistisch wahrzunehmen<br />
(2) Steuerung des Selbst und der Beziehungen<br />
Fähigkeit, eigene Impulse, Affekte und den Selbstwert zu regulieren<br />
Fähigkeit, den Bezug zu Anderen regulieren zu können<br />
(3) Emotionale Kommunikation nach innen und außen<br />
Fähigkeit zur inneren Kommunikation mittels Affekten und Fantasien<br />
Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen<br />
(4) Innere Bindung und äußere Beziehung<br />
Fähigkeit, gute innere Objekte zur Selbstregulierung zu nutzen<br />
Fähigkeit, sich zu binden und zu lösen<br />
Grund für die Änderungen waren die praktischen Erfahrungen mit der Heidelberger<br />
Fokusliste (21 Items, den Dimensionen der OPD-1 zugeordnet) und die Erfahrungen<br />
15
Theorie – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
der fokusbezogenen Psychotherapie, die aufzeigten, dass der innere Zusammenhang<br />
der Items modifiziert werden musste (OPD-2, 2007). Da die Abwehr weniger verhal-<br />
tensnah und mehr theoriegeleitet eingeschätzt werden muss, findet sie sich jetzt als<br />
ergänzendes Modul im Anhang. Die Fokuspunkte der OPD-1 wurden ohne große<br />
Schwierigkeiten entsprechend modifiziert, so dass von einer grundlegenden Gemein-<br />
samkeit für die Interpretation ausgegangen werden kann. In vorliegender Untersu-<br />
chung dient die OPD-Einschätzung nicht der Prozessanalyse, sondern als Prädiktor in<br />
Form einer Statusdiagnose zu Beginn der Behandlung. Für das Gesamtstrukturniveau<br />
kann von einer hinreichenden Vergleichbarkeit beider Versionen ausgegangen werden<br />
(vgl. OPD-2, 2007; vgl. Schneider et al., 2008).<br />
2.2 Kriteriumsvalidität<br />
2.2.1 Validität<br />
Validität bezieht sich auf die Frage inwiefern tatsächlich das gemessen wird, was ge-<br />
messen werden soll und kann folgendermaßen definiert werden:<br />
„Validität ist ein integriertes bewertendes Urteil über das Ausmaß, in dem die<br />
Angemessenheit und die Güte von Interpretationen und Maßnahmen auf Basis<br />
von Testwerten oder anderen diagnostischen Verfahren durch empirische Belege<br />
und theoretische Argumente gestützt sind. (vgl. Messick, 1989, S. 13; Übersetzung<br />
J. H., zitiert in Moosbrugger, 2008, S. 136)“<br />
Nach Moosbrugger (2008) unterscheidet man in der psychologischen Diagnostik drei<br />
Arten von Validität:<br />
1. Die Inhaltsvalidität<br />
2. Die Konstruktvalidität<br />
Konvergente Validität<br />
Diskriminante Validität<br />
3. Die Kriteriumsvalidität<br />
Übereinstimmungsvalidität<br />
Vorhersagevalidität<br />
Die Inhaltsvalidität bezieht sich darauf, ob ein Test oder die Items, aus denen er sich<br />
zusammensetzt, tatsächlich das interessierende Merkmal inhaltlich abbilden. Unter<br />
Konstruktvalidität werden die empirischen Befunde und Argumente zusammengefasst,<br />
die dazu dienen die Testergebnisse und Zusammenhänge der Testwerte mit anderen<br />
Variablen vor dem Hintergrund theoretischer Konzepte zu interpretieren.<br />
„Kriteriumsvalidität bedeutet, dass von einem Testergebnis auf ein für diagnostische<br />
Entscheidungen praktisch relevantes Kriterium außerhalb der Testsi-<br />
16
Theorie – Kriteriumsvalidität<br />
tuation geschlossen werden kann. Kriteriumsvalidität kann durch empirische<br />
Zusammenhange zwischen dem Testwert und möglichen Außenkriterien belegt<br />
werden. Je enger diese Zusammenhänge, desto besser kann die<br />
Kriteriumsvalidität als belegt gelten.“ (a.a.O., S. 156)<br />
Die einzelnen Validitäten sind voneinander abhängig, bezogen auf die Fragestellungen<br />
der vorliegenden Arbeit verbessert eine gute inhaltliche Validität die Kriteriumsvalidität,<br />
d.h. wenn der Inhalt der Skalen und Kategorien die theoretischen Hintergründe hinrei-<br />
chend abbildet, kann auch eine gute Kriteriumsvalidität erreicht werden. Eine gute<br />
Konstruktvalidität folgt aus der inhaltlichen und kriteriumsbezogenen Validität und<br />
schließt somit beide Validitätsarten mit ein. In diesem Fall würden die Achsen und In-<br />
tegrationsniveaus die zugrunde gelegten psychodynamischen Konstrukte ausreichend<br />
repräsentieren.<br />
Wichtig bei der Beurteilung der Kriteriumsvalidität ist die Güte der diagnostischen Ent-<br />
scheidung für die Praxis. Übereinstimmungsvalidität kann geprüft werden, indem un-<br />
tersucht wird, ob das Instrument das Gleiche misst, wie inhaltlich ähnliche andere In-<br />
strumente. Vorhersagevalidität (prognostische oder prädiktive Validität) untersucht, ob<br />
sich das Instrument als Prädiktor für relevante Veränderungen verwenden lässt.<br />
Für die Qualität von Psychotherapie ist es von besonderer Bedeutung, dass gute Prä-<br />
diktoren für den Therapieerfolg und somit Handlungsanweisungen für die Therapiepla-<br />
nung gefunden werden. Aus diesem Grund soll in vorliegender Untersuchung die prog-<br />
nostische Validität der Strukturachse der OPD erforscht werden.<br />
Die ausgewählten Prädiktoren und Kriteriumsvariablen werden im Folgenden theore-<br />
tisch erläutert.<br />
2.2.2 Prädiktoren<br />
Die Einschätzung des Gesamtstrukturniveaus (siehe 2.1.2) dient als Prädiktor zur Vor-<br />
hersage des Kriteriums Therapieerfolg. Daneben wird der Einfluss eventuell wichtiger<br />
anderer Prädiktoren (vgl. Lambert, 2003; Spitzer et. al., 2002; siehe 2.3) untersucht,<br />
die erhoben werden konnten. Nach Lambert (2003) gehen 40% der Effekte von Psy-<br />
chotherapie auf das Konto von Patientinnenvariablen und außertherapeutischen Ein-<br />
flüssen, wobei die Interaktion der Patientinnenvariablen mit Therapeutinnen- und Be-<br />
handlungsvariablen entscheidend ist. Diese Interaktion kann jedoch aufgrund der zeitli-<br />
chen und Seitenbegrenzung der vorliegenden Arbeit nicht untersucht werden. Folgen-<br />
de Patientinnenvariablen können (aufgrund der Möglichkeit zur Erhebung unter klini-<br />
scher Routine und ihrer theoretischen Relevanz) auf einen Einfluss mit dem Therapie-<br />
erfolg geprüft werden:<br />
17
Theorie – Kriteriumsvalidität<br />
Arbeitsunfähigkeit<br />
Dauer der Erkrankung<br />
Schwere der Symptomatik<br />
Komorbidität: insbesondere Persönlichkeitsstörungen<br />
Motivation (starker Einsatz für die Therapie)<br />
Soziodemografische Variablen (beide Variablen werden geprüft):<br />
Geschlecht (widersprüchliche Ergebnisse in der Literatur, z.B. Lambert,<br />
2003)<br />
Alter (hat keinen Einfluss, Lambert, 2003)<br />
Auf die Operationalisierung dieser Variablen wird unter 4.6.2 eingegangen.<br />
2.2.3 Kriterium „Therapieerfolg“<br />
Zur Erfassung des Kriteriums „Therapieerfolg“ besteht in der Forschung Einigkeit über<br />
den breiten diagnostischen Zugang (Lambert, 2003) durch multiple Kriterien, auf meh-<br />
reren Dimensionen mittels verschiedener Methoden und unter Einbezug verschiedener<br />
Datenquellen. Leider haben sich bislang nur teilweise Standards bezüglich der ver-<br />
wendeten Instrumente durchgesetzt (Schulte, 1993). In vorliegender Arbeit soll ver-<br />
sucht werden eine möglichst große Vergleichbarkeit und Erfüllung dieser Kriterien zu<br />
erreichen, insoweit es in der klinischen Routineversorgung möglich ist (siehe 4.6).<br />
Für das Erfolgskriterium (Vergleich des Messwertes mit einem Bezugswert) muss der<br />
Grad der Veränderung (Ausgangs- und Endzustand) und der Grad der Zielerreichung<br />
(Endzustand und Normwert) gemessen werden. Dazu gibt es nach Schulte (1993) drei<br />
Möglichkeiten: die subjektive Schätzung, die Differenzbildung und der statistische Ver-<br />
gleich.<br />
Inhaltlich kann der Therapieerfolg (nach Schulte, 1993) auf drei verschiedenen Ebenen<br />
gemessen werden:<br />
1. Die Ebene der Ursache (Defektes) der Krankheit<br />
2. Die Ebene des Krankseins (Symptomatik)<br />
3. Die Ebene der Krankheitsfolgen<br />
Dieses Konzept soll der Erfassung des Therapieerfolgs zugrunde gelegt werden. Auf<br />
der ersten Ebene wird geprüft, inwieweit Veränderungen hinsichtlich Krankheitsursa-<br />
chen und -defekten zu verzeichnen sind. Da innerhalb der verschiedenen therapeuti-<br />
schen Richtungen für psychische Störungsbilder unterschiedliche Erklärungsmodelle<br />
herangezogen werden, sind auf dieser Ebene der Erfolgsmessung theoriespezifische<br />
18
Theorie – Kriteriumsvalidität<br />
Erfolgsmaße anzuwenden. Diese sollen im vorliegenden Setting einer integrativen,<br />
psychodynamischen Psychosomatik nicht untersucht werden. Therapieerfolg wird in<br />
der vorliegenden heterogenen Stichprobe auf der Ebene der Krankheitssymptomatik<br />
(Reduktion der Symptome) und der Ebene der Krankheitsfolgen durch allgemeine,<br />
schul- und störungsübergreifende Maße des Behandlungserfolgs (Veränderungen des<br />
Erlebens und Verhaltens, der sozialen Beziehungen und sozialen Aktivitäten u.a.) er-<br />
fasst.<br />
Um der Forderung nach unterschiedlichen Datenquellen (multiperspektivisch) zu ent-<br />
sprechen, wird neben der Selbstbeurteilung auch die Fremdbeurteilung durch die The-<br />
rapeutin herangezogen. Beide Maße müssen sich nicht entsprechen, beispielsweise<br />
muss ein aus Sicht der Therapeutin negatives Therapieergebnis nicht zwangsläufig<br />
dazu führen, dass auch die Patientin die Therapie negativ beurteilt (Michalak,<br />
Kosfelder, Meyer & Schulte, 2003).<br />
Die Veränderung kann entweder direkt (subjektive Schätzung) oder indirekt (über Diffe-<br />
renzbildung, statistischer Vergleich) gemessen werden. Die Maße der direkten Verän-<br />
derungsmessung zählen zu den retrospektiven Erfolgsmaßen, da hierbei das Ausmaß<br />
der Veränderung im Nachhinein (im Vergleich zum Zeitpunkt des Therapiebeginns) von<br />
der Beurteilerin (Therapeutin oder Patientin) eingeschätzt wird.<br />
Michalak et al. (2003) fanden in ihren Untersuchungen, dass die direkten und indirek-<br />
ten Maße nur gering miteinander korrelieren. Faktorenanalytisch konnten sie zeigen,<br />
dass die untersuchten Erfolgsmaße auf zwei Faktoren, den „Veränderungsmaßen“ und<br />
der „retrospektiven Erfolgsbeurteilung“, luden. Das berechnete Ausmaß der Verände-<br />
rung (Post-Wert im Vergleich zum Prä-Wert) und das erlebte Ausmaß der Zielerrei-<br />
chung (Post-Wert im Vergleich zum Ziel) unterscheiden sich hinsichtlich des zur Beur-<br />
teilung gewählten Kriteriums. Bei der direkten Veränderungsmessung wird „das Aus-<br />
maß der Veränderung weniger in Bezug auf die Ausgangslage, sondern auf den mehr<br />
oder minder befriedigenden Zustand zu Therapieende geschätzt“ (Michalak et al.,<br />
2003), d.h. die gegenwärtige Lage wird nach dem Zustand zum Ende der Behandlung<br />
beurteilt, egal wie ausgeprägt die Symptomatik zu Beginn war. Für die Verwendung der<br />
retrospektiven Erfolgsmaße spricht auch deren prognostische Bedeutung, die Michalak<br />
et al. (2003) in ihrer Untersuchung finden konnten.<br />
Auf die Operationalisierung der Kriterien der Krankheitssymptomatik und der Krank-<br />
heitsfolgen wird im Methodenteil unter 4.6.1 eingegangen. Eines der Kriterien ist ein<br />
explorativ gebildetes „einzelnes multiples Ergebniskriterium“. Da dies in der empiri-<br />
19
Theorie – Kriteriumsvalidität<br />
schen Forschung bisher noch nicht sehr weit verbreitet ist, wird es kurz theoretisch<br />
erläutert.<br />
2.2.3.1 Einzelnes Multiples Ergebniskriterium (EMEK)<br />
Um ein katamnestisches Gesamtbild zu bekommen und den globalen Therapieerfolg<br />
auf breiterer Basis darstellen zu können, wird neben den singulären Kriterien, die je-<br />
weils nur einen punktuellen Ausschnitt aus dem Gesamtbild darstellen, nach dem Vor-<br />
bild von Jürgen Schmidt (1991) ein einzelnes multiples Ergebniskriterium (im Folgen-<br />
den EMEK) zum Nachuntersuchungszeitpunkt explorativ zusammengestellt. Multiple<br />
Ergebniskriterien bestehen aus einer Vielzahl von Ergebniskriterien, die zu einem Ge-<br />
samtbild im Sinne einer mehr oder weniger erfolgreichen Therapie aggregiert werden<br />
(ähnlich wie bei einer Testkonstruktion wird ein Index gebildet).<br />
Dazu werden die ausgewählten Ergebniskriterien mit 0 = negativ oder neutral und<br />
1 = positiv dichotomisiert und anschließend ein Quotient gebildet, der prozentual aus-<br />
drücken soll, wie ausgeprägt der globale Therapieerfolg ist. Theoretisch konnte jede<br />
Patientin einen Wert zwischen 0 (= 0 % Erfolg, d.h. kein einziges Kriterium ist positiv<br />
erfüllt) und 1 (= 100 % Erfolg, d.h. alle Kriterien sind positiv bewertet) erreichen. Dieser<br />
Index von 0 - 1 soll neben den singulären Kriterien den Therapieerfolg auf breiter Basis<br />
erfassen.<br />
Die Auswahl der EMEK-Teilkriterien war einerseits inhaltlich begründet mit der Frage,<br />
welche Kriterien am besten den globalen Therapieerfolg widerspiegeln, und anderer-<br />
seits den praktischen Gegebenheiten der Klinik unterworfen und somit beschränkt in<br />
der Auswahl.<br />
2.3 Forschungskontext<br />
Im Folgenden werden bisherige Forschungsbefunde verschiedener Autoren, die rele-<br />
vant zur Untersuchung der Kriteriumsvalidität der Strukturachse der OPD sind, vorge-<br />
stellt.<br />
2.3.1 Reliabilität (Objektivität)<br />
Die Arbeitsgruppe OPD-1 (Grande et al., in Vorbereitung, zitiert in Cierpka et al., 2001)<br />
untersuchte in sieben Studien mit insgesamt 269 Patientinnen aus sechs psychosoma-<br />
tischen <strong>Kliniken</strong> die Reliabilität der Achsen I-IV und unter welchen Bedingungen sich<br />
diese verbessert oder verschlechtert. Es wurden drei Faktoren gefunden, die die Relia-<br />
20
Theorie – Forschungskontext<br />
bilität und damit auch die Objektivität 4 beeinflussen: die klinische Erfahrung der Beur-<br />
teilerinnen, die Erhebung unter klinischer Routine oder die Erhebung unter For-<br />
schungsbedingungen. In zwei Studien unter den Bedingungen der klinischen Routine<br />
wurde für die Gesamteinschätzung der Struktur eine Interrater-Reliabilität von gew.<br />
Kappa = .69/.40 gefunden.<br />
Deutlich besser sind die Werte unter Forschungsbedingungen allein zu diagnostischen<br />
Zwecken. Das Rating der Struktur erfolgte auf Basis von videoaufgezeichneten Inter-<br />
views, was aber mit Nachteilen für die externe Validität verbunden war, so dass die<br />
Ergebnisse nicht auf die Verhältnisse beispielsweise in einer Klinik übertragen werden<br />
können. Die besten Werte wurden für die Reliabilität der Gesamtstruktur gefunden:<br />
.71/.70 (zitiert in Cierpka et al., 2001).<br />
In einer weiteren Studie mit geschulten, aber unerfahrenen Studenten unter For-<br />
schungsbedingungen (zitiert in Cierpka et al., 2001) lagen die Werte für die Gesamt-<br />
einschätzung der Struktur bei gew. Kappa von .70 und damit deutlich über den Werten<br />
der anderen Achsen. Daraus lässt sich schließen, dass die Achse IV „Struktur“ relativ<br />
leicht erlernt werden kann.<br />
Freyberger, Heuft, Schauenburg, Schneider und Seidler (1998) prüften in zwei Studien<br />
die Interraterreliabiltät in Anlehnung an Untersuchungspläne der internationalen WHO-<br />
Studien zur Einführung der klinisch-diagnostischen Leitlinien der ICD-10. In Studie 1<br />
gaben 134 Beurteilerinnen insgesamt 311 Einschätzungen und in Studie 2 gaben 38<br />
Beurteilerinnen 102 Einschätzungen über 3 videobasierte Fälle ab. Der mittlere ICC lag<br />
bei .72 für die Achse „Struktur“. Zusätzlich wurden erfahrene (n = 20) und nicht erfah-<br />
rene Rater (n = 86) einander gegenübergestellt, wobei die Erfahrenen deutlich bessere<br />
Werte erreichten. Dies entspricht den Befunden obiger Studie mit den unerfahrenen<br />
Studenten, dass eine ausreichende klinische Erfahrung Voraussetzung für eine reliable<br />
Erfassung der OPD-Ratings ist. Wobei in dieser Studie auch die Werte für die Gesamt-<br />
einschätzung der Struktur durch die erfahrenen Einschätzerinnen unter den Werten der<br />
unerfahrenen Einschätzerinnen lagen (prozentuale Übereinstimmung: 57.7 zu 48.5 5 )<br />
Benecke et al. (2009) fanden in einer Stichprobe von 120 stationären Patientinnen und<br />
19 Kontrollprobandinnen befriedigende bis sehr gute Interrater-Reliabiltäten (mittleres<br />
gew. Kappa = .72) für das Gesamtstrukturniveau der OPD-2.<br />
4<br />
Beurteilerübereinstimmung (Cohens Kappa) als Maß für Objektivität (vgl. Wirtz & Caspar,<br />
2002).<br />
5<br />
Angegeben werden Werte zur prozentualen Übereinstimmung, wobei unklar bleibt, um welche<br />
Art der Berechnung es sich handelt.<br />
21
Theorie – Forschungskontext<br />
Insgesamt sind die Reliabilitäten für die Gesamteinschätzung der Struktur befriedigend,<br />
der Achse IV wird im Vergleich der Achsen die beste Interrater-Reliabilität bescheinigt<br />
(OPD-2, 2007). Die gefundenen Reliabilitäten sind durchaus vergleichbar mit denen<br />
anderer diagnostischer Instrumente wie etwa der ICD-10 (unter den Bedingungen der<br />
klinischen Routine), so dass eventuell auftretende Probleme eher unspezifisch sind.<br />
2.3.2 Validität<br />
2.3.2.1 Inhaltsvalidität<br />
Schwierig zu beurteilen ist die inhaltliche Validität der Achse Struktur, da in der Litera-<br />
tur (Cierpka et al., 2001) auf projektive Verfahren wie den z.B. den Rorschach-Test,<br />
TAT (thematischer Apperzeptionstest), oder tachistokopische Verfahren mit zweifelhaf-<br />
ten teststatistischen Kennwerten verwiesen wird. Die Unterscheidung in unterschiedli-<br />
che Integrationsniveaus ist jedoch nicht neu, bei Entwicklung der OPD konnte auf eine<br />
Reihe von existierenden Verfahren aus der psychodynamischen Diagnostik zurückge-<br />
griffen werden, beispielsweise auf etablierte Verfahren wie das strukturelle Interview<br />
von Kernberg (1977 und 1984, zitiert in Cierpka et al., 2001), oder Einteilungen von<br />
Lohmer et al. (1992), Engel et al. (1979) oder Weinryb und Rössel (KAPP, 1991). Die<br />
Unstrukturiertheit der Situation während des Interviews wurde ebenfalls genutzt. Für<br />
die Inhaltsvalidität spricht, dass eine große Bandbreite von sehr erfahrenen Forsche-<br />
rinnen und Therapeutinnen am Entstehungsprozess beteiligt waren und somit von ei-<br />
ner augenscheinlich guten inhaltlichen Validität ausgegangen werden kann.<br />
2.3.2.2 Konstruktvalidität<br />
Schauenburg (2000) stellte an einer Stichprobe von 49 konsekutiv erfassten stationä-<br />
ren Psychotherapiepatientinnen fest, dass eine sichere Bindung (nach Pilkonis,1988)<br />
(r = -.30, p = .05) sowie übermäßige Abhängigkeitsbestrebungen (r = -.29, p = .06) mit<br />
einem höher integrierten Strukturniveau einhergehen, während Borderline-Züge<br />
(r = .27, p = .08), übersteigerte Autonomiebestrebungen (r = .32, p = .03) und antiso-<br />
ziale Züge (r = .55, p = .00) mit einem geringer integrierten Strukturniveau zusammen-<br />
hängen. Des Weiteren fand Schauenburg zusammen mit Grütering (2000, zitiert in<br />
Cierpka et al., 2001) Korrelationen der Skalen des Karolinska Psychodynamic Profile<br />
(KAPP, Weinryb & Rössel, 1991) mit der Strukturachse: Die Fähigkeit zur Selbststeue-<br />
rung hing z.B. mit den Skalen Intimität und Frustrationstoleranz, aber auch mit dem<br />
fehlenden Erleben von Gebrauchtwerden und Zugehörigkeit zusammen.<br />
22
Theorie – Forschungskontext<br />
1999 korrelierten Rudolf und Grande in einer Studie mit 48 stationären Psychosomatik-<br />
Patientinnen die Struktureinschätzungen mit Beurteilungen auf der Grundlage der<br />
„Scales of Psychological Capacities“ (SPC, Wallerstein, 1988, zitiert in Cierpka et al.,<br />
2001). Hier zeigt sich u.a., dass die in den SPC beschriebenen pathologischen Verhal-<br />
tensweisen nur dann mit den Dimensionen der Strukturachse korrelieren, wenn tat-<br />
sächlich strukturell bedingte Einschränkungen erfasst wurden (z.B. r = .30, p ≤ .05,<br />
SPC-Skala „driveness“ und OPD-Dimension „Selbststeuerung“).<br />
In einer unveröffentlichten Heidelberger Studie (zitiert in Cierpka et al., 2001) erbrachte<br />
eine Faktorenanalyse für die Items der Strukturachse einen Hauptfaktor mit sehr ho-<br />
hem Eigenwert. Die interne Konsistenz liegt hier für die Strukturdimensionen bei .87<br />
und für die Strukturfoki bei .96, was ebenfalls für die Konstruktvalidität spricht. Ein Prä-<br />
Post Vergleich einer zwölfwöchigen stationären Psychotherapie erzielte eine Prä-Post-<br />
Übereinstimmung der Gesamtstruktureinschätzung von 84.4% (Grande, Rudolf &<br />
Oberbracht, 2000), was für die Stabilität des Merkmals spricht.<br />
Thomasius et al. (2001) prüften ebenfalls die faktorielle Validität bei 54 Drogenabhän-<br />
gigen im Alter von 14 - 25 Jahren (MW = 19.1 Jahre) mit insgesamt mäßigem Struktur-<br />
niveau. Für die Strukturachse ergab sich ebenfalls ein Hauptfaktor, der 46 % der Va-<br />
rianz aufklärte.<br />
Mestel, Klingelhöfer, Dahlbender und Schüßler (2004) stellten an einer Stichprobe von<br />
147 mehrheitlich strukturell beeinträchtigten stationären Psychosomatik-Patientinnen<br />
fest, dass Patientinnen mit geringer Struktur mehr interpersonelle Probleme (IIP, Ho-<br />
rowitz, Strauss u. Kordy, 1993, zitiert in Mestel et al., 2004) haben, sozial weniger re-<br />
sonant sind, mehr Symptome haben, depressiver und verschlossener sind, über weni-<br />
ger Selbstakzeptanz und Selbstliebe verfügen, dafür mehr Selbstkontrolle, Selbstab-<br />
wertung, Selbstvernichtung und Selbstvernachlässigung zeigen (GT, Beckmann, Bräh-<br />
ler & Richter, 1991; SASB, Introjektfragebogen, Tscheulin & Gossner, 2001; BDI,<br />
Hautzinger et al., 1995, zitiert in Mestel et al., 2004).<br />
In bereits erwähnter Studie von Benecke et al. (2009) zeigten sich hohe Korrelationen<br />
der OPD-Strukturratings mit dem Inventory of Personality Organisation (IPO, Clarkin et<br />
al., 2000, Dammann et al., 2000, zitiert in Benecke et al., 2009) und dem Borderline-<br />
Persönlichkeits-Inventar (BPI, Leichsenring, 1977, zitiert in Benecke et al., 2009). Kor-<br />
relationen der Strukturratings mit Achse II (Persönlichkeitsstörungen) zeigten sich<br />
durchwegs höher als Korrelationen mit Störungen der Achse I (Achse I r = .34, Achse II<br />
r = .63; IPO r = .54), was für eine befriedigende konvergente Konstrukt-Validität spricht.<br />
23
Theorie – Forschungskontext<br />
Insgesamt zeigt diese Zusammenstellung, dass von einer guten, zeitstabilen Eignung<br />
der OPD-Strukturachse zur Beschreibung der psychodynamisch konzeptionalisierten<br />
Persönlichkeitsstruktur und von einer Verknüpfung von Instrument und Konstrukt aus-<br />
gegangen werden kann.<br />
2.3.2.3 Kriteriumsvalidität<br />
2.3.2.3.1 Übereinstimmungsvalidität<br />
Rudolf, Grande, Oberbracht und Jakobsen (1996) konnten in ihrer Untersuchung keine<br />
signifikanten Zusammenhänge zwischen ICD-10-Diagnosen und Gesamtstrukturniveau<br />
ermitteln, ein geringeres Strukturniveau ging jedoch mit einer längeren Erkrankungs-<br />
dauer einher (zumindest als Trend; r = -.38, p = .06).<br />
Nitzgen und Brünger (2000) untersuchten an 71 männlichen Suchtkranken ebenfalls<br />
die Übereinstimmungsvalidität der OPD-Struktur mit ICD-Diagnosen. Patienten mit<br />
ICD-Diagnosen aus dem neurotischen Formenkreis erwiesen sich als höher integriert<br />
(MW Struktur = 1.97), als Patienten mit Persönlichkeitsstörungen (MW Struktur = 2.37,<br />
p ≤ .01). Diese zeigten zudem im Mittel (MW = 2.2 zu MW = 2.32) die schlechtesten<br />
Werte im Bereich der Selbststeuerung (OPD-2, 2007). Bestätigt wurden die Befunde<br />
zur Selbststeuerung von Reymann, Zbikowski, Martin, Tetzlaff und Janssen (2000) an<br />
22 alkoholabhängigen Männern einer offenen Entgiftungsstation.<br />
Spitzer, Michels-Lucht, Siebel und Freyberger zeigten 2002 an einer Stichprobe von<br />
156 stationären Psychiatriepatientinnen (erhoben 1999-2001), dass die Strukturachse<br />
Zusammenhänge mit dem höchsten erreichten Berufsabschluss, einer komorbiden<br />
Persönlichkeitsstörung, Suizidalität und Selbstverletzung aufweist. Eine geringe, je-<br />
doch signifikante Korrelation zeigte sich mit dem Alter, d.h. je jünger die Patientinnen<br />
waren, desto geringer das Strukturniveau. Keine Zusammenhänge fanden sich für das<br />
Geschlecht, den Schulabschluss, die aktuelle berufliche Situation und die Psychopa-<br />
thologie (geprüft mit SCL-90-R). Die Einschätzung des Strukturniveaus erfolgte retro-<br />
spektiv und die Diagnosen wurden nach ICD-10 erstellt. Der Anteil der gering integrier-<br />
ten Patientinnen lag bei 12.2 % (n = 19), das mäßige Niveau bei 64.1 % (n = 100).<br />
Schneider, Lange und Heuft (2002) prüften in einer Untersuchung u.a., ob die OPD zur<br />
Diagnostik im klinischen Alltag praktikabel ist und ob die in Erstuntersuchungen gestell-<br />
ten OPD-Diagnosen handlungsleitende Zusammenhänge zur Indikationsstellung zu<br />
einer Fachbehandlung (Psychiatrie vs. Psychosomatik) aufweisen. Hierzu untersuchten<br />
sie eine konsekutive Stichprobe von 591 Ambulanz- und Konsiliarpatienten der Klinik<br />
und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Müns-<br />
24
Theorie – Forschungskontext<br />
ter. Drei Untergruppen der Therapieindikation, psychiatrisch, psychotherapeutisch und<br />
keine bzw. andere Indikation wurden auf Zusammenhänge mit dem Strukturniveau<br />
untersucht. Erwartungsgemäß hatten die psychiatrisch Indizierten das geringste Integ-<br />
rationsniveau, die psychotherapeutisch indizierten ein mittleres und die Gruppe ohne<br />
bzw. andere Indikation das im Verhältnis höchste Integrationsniveau. Insgesamt stell-<br />
ten sie fest, dass eine systematische OPD-Diagnostik praktikabel und zudem nutzbrin-<br />
gend für die differenzielle Indikationsstellung ist.<br />
Schneider, Mendler, Heuft und Burgmer (2008) untersuchten an einer Stichprobe von<br />
105 stationären Psychotherapiepatientinnen die kriterienbezogene Validität des in der<br />
OPD-2 neu operationalisierten Lebensbereiches „Körper/Sexualität“ auf der Konflikt-<br />
achse und des „Körperselbst“ auf der Strukturachse auf Zusammenhänge von konflikt-<br />
spezifischen Themen und Strukturniveaus mit den Frankfurter Körperkonzeptskalen<br />
(FKKS, zitiert in Schneider et al., 2008). Für das Integrationsniveau der Struktur konn-<br />
ten Hinweise auf gleichsinnige Zusammenhänge für das Gesamtkörperkonzept der<br />
FKKS gefunden werden, d.h. ein höheres (im Wertebereich niedrigeres) Strukturniveau<br />
geht mit einem besseren Gesamtkörperkonzept und ein geringeres (im Wertebereich<br />
höheres) Strukturniveau mit einem schlechteren Gesamtkonzept einher. Ausreichend<br />
große Zahlen für die Auswertung konnten jedoch nur für die Gesamtstrukturniveaus<br />
von 1.5 – 2.5 erreicht werden (n = 15 für Gesamtstrukturniveau 2.5). Untersucht wur-<br />
den die Zusammenhänge anhand der OPD-1 Version und die Ergebnisse auf die OPD-<br />
2 Version übertragen.<br />
Benecke et al. (2009) fanden hohe Korrelationen der Gesamtstrukturniveaus mit dem<br />
Ausmaß der Komorbidität (Schwere der psychischen Störung) laut SKID-Diagnose<br />
(Strukturiertes klinisches Interview zur Diagnostik Psychischer Störungen, Wittchen,<br />
Zaudig & Fydrich, 1997) sowie mit dem GSI der Brief Symptom Checklist (BSI, Kurz-<br />
form der SCL-90-R, Franke, 2002). Die Befunde (s.o.) zeigen neben der konkurrenten<br />
Kriteriumsvalidität die hohe Praxisrelevanz der Strukturachse und dass mit „Struktur“<br />
die intendierte störungsübergreifende zentrale psychische Dimension erfasst wird.<br />
Bestätigt werden diese Befunde von Hörz und Rentrop (2009, zitiert in Zimmermann et<br />
al., 2010; vgl. Hörz, Rentrop, Fischer-Kern et al., 2010, zitiert in Zimmermann et al.,<br />
2010), die ebenfalls feststellten, dass Patientinnen mit schwererer Erkrankung ein ge-<br />
ringeres Strukturniveau aufwiesen (untersucht mit SKID und STIPO-D, Strukturiertes<br />
Interview der Persönlichkeitsorganisation, Clarkin et al., 2004, zitiert in Zimmermann et<br />
al., 2010). Im STIPO-D werden 6 Strukturniveaus von normal bis Borderline 3 unter-<br />
schieden. Die Korrelation zwischen STIPO-D Strukturniveau und OPD-2-<br />
Strukturniveau lag bei r = .75 (p ≤ .001).<br />
25
Theorie – Forschungskontext<br />
2.3.2.3.2 Vorhersagevalidität<br />
Die bereits erwähnte Studie von Rudolf et al. (1996) zeigte, dass die Struktureinschät-<br />
zung zu Beginn der stationären Behandlung sowohl für die Erfolgsbeurteilung der Pati-<br />
entin (r = .30) als auch die Erfolgsbeurteilung der Therapeutin (r = .40, p ≤ .05) ein sehr<br />
guter Prädiktor ist (Einschätzung drei Monate nach Therapiebeginn). Bei den einzelnen<br />
Dimensionen erweist sich die Bindungsfähigkeit als besonders relevant (Patientin<br />
r = .42, Therapeutin r = .46, p ≤ .01). Die angegebenen Werte sind jedoch ausschließ-<br />
lich Korrelationen. Strauß et al. (1997) konnte an 30 stationären Psychotherapiepatien-<br />
tinnen zeigen, dass gut strukturierte Patientinnen eher von der (Gruppen)-Therapie<br />
profitierten als geringer strukturierte Patientinnen.<br />
Thomasius et al. (2001) prüften ebenfalls die prognostische Validität an der bereits<br />
erwähnten Stichprobe von Drogenabhängigen. Sie fanden keine prognostische Bedeu-<br />
tung des Gesamtstrukturniveaus, was eventuell an der kleinen, relativ homogenen<br />
Stichprobe oder auch der Wahl der Außenkriterien gelegen haben könnte. Es wird da-<br />
rauf hingewiesen, weitere Studien mit anderen Außenkriterien durchzuführen.<br />
In einer ebenfalls bereits erwähnten Stichprobe fanden Mestel et al. (2004), dass Pati-<br />
entinnen mit geringerem Gesamtstrukturniveau geringere Werte im VEV bzw. VEV-K<br />
ab 1998 (Zielke & Kopf-Mehnert, 1979) im Vergleich zu höher integrierten Patientinnen<br />
aufweisen (prädiktive Validität). Für den GSI der SCL-90-R (Franke, 2002) ergaben<br />
sich für alle Gruppenvergleiche parallele Verläufe. Gering integrierte Patientinnen hat-<br />
ten zu Beginn und zum Ende eine höhere Symptombelastung im Vergleich zu mäßig<br />
strukturierten Patientinnen, keine Gruppe verbesserte sich über die Zeit deutlicher<br />
(keine Interaktionseffekte). Beide Ergebnisse sprechen für die Validität der Struktur-<br />
achse.<br />
2.3.3 Zusammenfassung<br />
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für die Achse IV „Struktur“ eine zu-<br />
friedenstellende Reliabilität gefunden werden konnte, insbesondere die Einschätzung<br />
des Gesamtstrukturniveaus erwies sich auch unter klinischer Routine als reliabel er-<br />
fasst. Diese Voraussetzung zur Prüfung der Kriteriumsvalidität kann als gegeben an-<br />
gesehen werden.<br />
Die Inhaltsvalidität ist augenscheinlich gegeben und von einer ausreichenden<br />
Konstruktvalidität kann ebenfalls ausgegangen werden (z.B. Mestel et al., 2004;<br />
Cierpka et al., 2001). Die Übereinstimmungsvalidität wurde anhand einer Reihe von<br />
26
Theorie – Forschungskontext<br />
Instrumenten bestätigt (z.B. Nitzgen & Brünger, 2000; Spitzer et al., 2002; Benecke et<br />
al., 2009).<br />
Die prädiktive Validität der Strukturachse wurde bisher von Rudolf et al. (1996), Strauß<br />
et al. (1997), Thomasius et al. (2001) und Mestel et al. (2004) untersucht. Mestel et al.<br />
(2004) konnten für eine Stichprobe mit mehrheitlich strukturell beeinträchtigten Patien-<br />
tinnen zeigen, dass die Struktur den Therapieerfolg vorhersagen kann. Rudolf et al.<br />
(1996) fanden bei stationären Psychotherapiepatientinnen ebenfalls eine prädiktive<br />
Validität (Korrelationen) und Strauß et al. (1997) stellten fest, dass höher integrierte<br />
Patientinnen eher von einer Gruppentherapie profitieren. Thomasius et al. (2001) konn-<br />
ten bei jungen Drogenabhängigen jedoch keine prognostische Bedeutung finden.<br />
3 Fragestellungen und Hypothesen<br />
3.1 Fragestellungen und Ziele<br />
Diese Arbeit verfolgt die Untersuchung zweier zentraler Fragen:<br />
Zum einen soll in Anlehnung an den bisherigen Forschungsstand der Frage nachge-<br />
gangen werden, ob sich für eine Stichprobe von stationären psychosomatischen Pati-<br />
entinnen eine prädiktive Validität für die Strukturachse zum Zeitpunkt des Therapieen-<br />
des (kurzfristiger Therapieerfolg) und ca. ein Jahr danach (mittelfristiger Therapieer-<br />
folg) finden lässt. Rudolf et al. (1996) untersuchten einen Zeitraum von drei Monaten<br />
nach Behandlungsbeginn und Mestel et al. (2004) untersuchten die Prognose zum<br />
Behandlungsende (ebenfalls ca. drei Monate nach Behandlungsbeginn) in einer nicht<br />
repräsentativen Stichprobe. Da sich insbesondere bei strukturell beeinträchtigten Pati-<br />
entinnen der Therapieerfolg erst langfristig zeigt, bzw. das Therapieende problematisch<br />
sein kann, (z.B. Monsen et al., 1995) sind katamnestische Untersuchungen angezeigt.<br />
Im Hintergrund steht die Frage, ob geringer strukturierte Patientinnen auf längere Sicht<br />
weniger von der Therapie profitieren (z.B. Rudolf et al., 1996; Mestel et al., 2004).<br />
Zum Anderen soll erstmals die Frage untersucht werden, ob sich ein größerer Anteil an<br />
strukturell beeinträchtigten Patientinnen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5) in einer Stich-<br />
probe mit hauptsächlich Patientinnen des Gesamtstrukturniveaus 1.5 und 2.0 negativ<br />
auf den Behandlungserfolg auswirkt. Dieser Frage soll in einer weiteren Erhebung mit<br />
Pilotcharakter nachgegangen werden.<br />
27
Fragestellungen und Ziele<br />
Wenn zu Beginn der Therapie prognostische Faktoren identifiziert werden, könnte<br />
dementsprechend in der Therapie darauf eingegangen werden, was zu einer Verbes-<br />
serung der Qualität der Behandlung führen könnte. Auch könnte die therapeutische<br />
Ausrichtung modifiziert oder die Frage der Zusammensetzung der Therapiegruppen<br />
neu diskutiert werden, was ebenfalls zu einer Verbesserung führen und somit auch der<br />
Qualitätssicherung in der stationären Rehabilitationsbehandlung dienen könnte (vgl.<br />
Heuft et al., 2005). Vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen in<br />
der stationären Psychotherapie (www.kliniken-groenenbach.de; Jubiläumsband 25<br />
Jahre Psychosomatische Klinik Bad Grönenbach, 2004) stellen sich diese Fragen auch<br />
immer wieder neu. So haben beispielsweise Depressionen deutlich zugenommen<br />
(1993: 37 %; 2003: 75 %), ebenso konnte im Zeitraum von 1993-2003 ein signifikanter<br />
Anstieg des Beeinträchtigungs-Schwere-Scores und ein zunehmend geringeres Struk-<br />
turniveau verzeichnet werden.<br />
Zusammenfassung der Fragestellungen:<br />
1. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Gesamtstrukturniveau und dem<br />
Therapieerfolg?<br />
2. Kann der Therapieerfolg durch das Gesamtstrukturniveau bei stationären<br />
psychosomatischen Patientinnen vorhergesagt werden?<br />
3. Welche Auswahl an Prädiktorvariablen ist im Verhältnis von Aufwand und<br />
Nutzen optimal zur Vorhersage des Therapieerfolgs und hat das Gesamt-<br />
strukturniveau einen relevanten Einfluss?<br />
4. Hat ein höherer Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstruk-<br />
turniveau ≥ 2.5) in einer therapeutischen Gruppe einen negativen Einfluss auf<br />
das Therapieergebnis und wenn dieser Zusammenhang besteht, gibt es eine<br />
prädiktive Bedeutung dieses Anteils?<br />
Aufgrund der Forschungslage werden gerichtete Hypothesen formuliert, auch für Fra-<br />
gestellung 4 kann davon ausgegangen werden, dass höher integrierte Patientinnen<br />
eher in der Lage sind von Gruppentherapie zu profitieren (Strauß et al., 1997). Nach T.<br />
Grande (persönliche Mitteilung, 18.10.2010) ist ebenfalls von einem negativen Einfluss<br />
einer höheren Anzahl an strukturell beeinträchtigten Patientinnen in einer Gruppe auf<br />
den Therapieerfolg auszugehen.<br />
28
Zusammenfassung<br />
3.2 Hypothesen<br />
Nachfolgend werden zunächst die aus den Fragestellungen entwickelten Forschungs-<br />
hypothesen der Hauptuntersuchung und anschließend die der Nebenuntersuchung<br />
dargestellt.<br />
3.2.1 Hauptuntersuchung<br />
Hypothese 1: Je höher (geringer integriert) der Wert für das Gesamtstrukturni-<br />
veau, desto geringer der kurzfristige Therapieerfolg.<br />
a. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau, desto geringer der Therapie-<br />
erfolg zum Behandlungsende, wie er mit der Prä-Post-Differenz des GSI der<br />
SCL-90-R operationalisiert wird.<br />
b. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau, desto geringer der Therapie-<br />
erfolg zum Behandlungsende, wie er mit dem Post-Wert des GSI der SCL-90-<br />
R operationalisiert wird.<br />
c. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau, desto geringer der Therapie-<br />
erfolg zum Behandlungsende, wie er mit dem VEV-K-Post-Wert operationali-<br />
siert wird.<br />
d. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau, desto geringer der Therapie-<br />
erfolg zum Behandlungsende, wie er mit dem Therapeutinnenrating (psychi-<br />
sche Veränderung) operationalisiert wird.<br />
Hypothese 2: Je höher (geringer integriert) der Wert für das Gesamtstrukturni-<br />
veau, desto geringer der mittelfristige Therapieerfolg.<br />
a. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau, desto geringer der Therapie-<br />
erfolg zum Katamnesezeitpunkt, wie er mit der Prä-Kat-Differenz des GSI der<br />
SCL-90-R operationalisiert wird.<br />
b. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau, desto geringer der Therapie-<br />
erfolg zum Katamnesezeitpunkt, wie er mit dem Kat-Wert des GSI der SCL-<br />
90-R operationalisiert wird.<br />
c. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau, desto geringer der Therapie-<br />
erfolg zum Katamnesezeitpunkt, wie er mit dem VEV-K-Kat-Wert operationali-<br />
siert wird.<br />
d. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau, desto geringer der Therapie-<br />
erfolg zum Katamnesezeitpunkt, wie er mit EMEK operationalisiert wird.<br />
29
Hypothesen<br />
Hypothese 3: Der Prädiktor Gesamtstrukturniveau hat einen signifikanten Ein-<br />
fluss auf die Vorhersage des Kriteriums „kurzfristiger Therapieerfolg“ zum The-<br />
rapieende.<br />
a. Das Gesamtstrukturniveau ist ein signifikanter Prädiktor für die Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs zum Behandlungsende, wie er mit der Prä-Post-Differenz des<br />
GSI der SCL-90-R operationalisiert wird.<br />
b. Das Gesamtstrukturniveau ist ein signifikanter Prädiktor für die Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs zum Behandlungsende, wie er mit dem Post-Wert des GSI der<br />
SCL-90-R operationalisiert wird.<br />
c. Das Gesamtstrukturniveau ist ein signifikanter Prädiktor für die Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs zum Behandlungsende, wie er mit dem VEV-K-Post-Wert ope-<br />
rationalisiert wird.<br />
d. Das Gesamtstrukturniveau ist ein signifikanter Prädiktor für die Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs zum Behandlungsende, wie er mit dem<br />
Therapeutinnnenrating (psychische Veränderung) operationalisiert wird.<br />
Hypothese 4: Der Prädiktor Gesamtstrukturniveau hat einen signifikanten Ein-<br />
fluss auf die Vorhersage des Kriteriums „mittelfristiger Therapieerfolg“ zum<br />
Katamnesezeitpunkt.<br />
a. Das Gesamtstrukturniveau ist ein signifikanter Prädiktor für die Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs zum Katamnesezeitpunkt, wie er mit der Prä-Kat-Differenz<br />
des GSI der SCL-90-R operationalisiert wird.<br />
b. Das Gesamtstrukturniveau ist ein signifikanter Prädiktor für die Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs zum Katamnesezeitpunkt, wie er mit dem Kat-Wert des GSI<br />
der SCL-90-R operationalisiert wird.<br />
c. Das Gesamtstrukturniveau ist ein signifikanter Prädiktor für die Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs zum Katamnesezeitpunkt, wie er mit dem VEV-K-Kat-Wert<br />
operationalisiert wird.<br />
d. Das Gesamtstrukturniveau ist ein signifikanter Prädiktor für die Vorhersage des<br />
Therapieerfolgs zum Katamnesezeitpunkt, wie er mit dem EMEK operationali-<br />
siert wird.<br />
Hypothese 5: Der Prädiktor Gesamtstrukturniveau bleibt bei gleichzeitiger Prü-<br />
fung konkurrierender Prädiktorvariablen als relevanter Prädiktor der Vorhersage<br />
des Therapieerfolgs zum Therapieende bestehen.<br />
30
Hypothesen<br />
Hypothese 6: Der Prädiktor Gesamtstrukturniveau bleibt bei gleichzeitiger Prü-<br />
fung konkurrierender Prädiktorvariablen als relevanter Prädiktor der Vorhersage<br />
des Therapieerfolgs zum Katamnesezeitpunkt bestehen.<br />
3.2.2 Nebenuntersuchung<br />
Hypothese 7: Je größer der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Ge-<br />
samtstrukturniveau ≥ 2.5) in einer therapeutischen Gruppe, desto geringer der<br />
Therapieerfolg.<br />
a. Je größer der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturni-<br />
veau ≥ 2.5) in einer therapeutischen Gruppe, desto geringer der Therapieerfolg,<br />
wie er mit der Prä-Post-Differenz des GSI der SCL-90-R operationalisiert wird.<br />
b. Je größer der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturni-<br />
veau ≥ 2.5) in einer therapeutischen Gruppe, desto geringer der Therapieerfolg,<br />
wie er mit dem Post-Wert des GSI der SCL-90-R operationalisiert wird.<br />
c. Je größer der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturni-<br />
veau ≥ 2.5) in einer therapeutischen Gruppe, desto geringer der Therapieerfolg,<br />
wie er mit dem VEV-K-Post-Wert operationalisiert wird.<br />
d. Je größer der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturni-<br />
veau ≥ 2.5) in einer therapeutischen Gruppe, desto geringer der Therapieerfolg,<br />
wie er mit der Prä-Post-Differenz der BSS-Summe operationalisiert wird.<br />
e. Je größer der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturni-<br />
veau ≥ 2.5) in einer therapeutischen Gruppe, desto geringer der Therapieerfolg,<br />
wie er mit dem Therapeutinnenrating (psychische Veränderung) operationa-<br />
lisiert wird.<br />
Hypothese 8: Der „Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen“ in einer the-<br />
rapeutischen Gruppe hat einen signifikanten Einfluss auf die Vorhersage des<br />
Kriteriums „kurzfristiger Therapieerfolg“.<br />
a. Der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5)<br />
hat einen signifikanten Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs zum<br />
Behandlungsende, wie er mit dem Post-Wert des GSI der SCL-90-R operatio-<br />
nalisiert wird.<br />
b. Der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5)<br />
hat einen signifikanten Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs zum<br />
Behandlungsende, wie er mit der Prä-Post-Differenz des GSI der SCL-90-R<br />
operationalisiert wird.<br />
31
Hypothesen<br />
c. Der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5)<br />
hat einen signifikanten Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs zum<br />
Behandlungsende, wie er mit dem VEV-K-Post-Wert operationalisiert wird.<br />
d. Der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5)<br />
hat einen signifikanten Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs zum<br />
Behandlungsende, wie er mit der Prä-Post-Differenz der BSS-Summe opera-<br />
tionalisiert wird.<br />
e. Der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5)<br />
hat einen signifikanten Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs zum<br />
Behandlungsende, wie er mit dem Therapeutinnenrating (psychische Ver-<br />
änderung) operationalisiert wird.<br />
4 Methoden<br />
4.1 Stichproben<br />
Die Hypothesen werden anhand von insgesamt drei Stichproben der Abteilungen 1 und<br />
2 der HELIOS Klinik Bad Grönenbach untersucht. Stichprobe 1 (Hauptstichprobe) wird<br />
zur Prüfung der Hypothesen 1 bis 6 herangezogen, die Stichproben 2 und 3 zur Prü-<br />
fung der Hypothesen 7 und 8. Die Zusammensetzung der Stichproben wird nachfol-<br />
gend dargestellt, für die Hauptstichprobe wird geprüft, ob sie als repräsentativ für die<br />
psychosomatische Klinik angesehen werden kann.<br />
4.1.1 Stichprobe 1 (Hauptstichprobe)<br />
Die Gesamtstichprobe 1 setzt sich aus insgesamt 341 Patientinnen zusammen, die im<br />
ersten Halbjahr des Jahres 2003 (alle Patientinnen mit Abreise: 08.01.2003 bis<br />
17.06.2003) in Abteilung 1 oder 2 stationär in der HELIOS Klinik Bad Grönenbach be-<br />
handelt wurden. Diese Patientinnen wurden im Zeitraum vom 01.01.2004 bis<br />
30.06.2004 postalisch zur Erhebung einer Katamnese angeschrieben (soweit Adressen<br />
verfügbar).<br />
Von den 341 angeschriebenen Patientinnen schickten 246 die Fragebögen regulär<br />
zurück, 60 (17.6 %) ehemalige Patientinnen antworteten nicht, 27 (7.9 %) waren unbe-<br />
kannt verzogen und 8 (2.3 %) explizite Verweigerer, was bedeutet, dass 95 Patientin-<br />
nen nicht berücksichtigt werden konnten. Dies entspricht einer Rücklaufquote von<br />
72.1 %. Von den 246 Teilnehmerinnen an der Nachuntersuchung mussten 4 wegen zu<br />
geringer Behandlungsdauer (Einschlusskriterium mindestens 28 Tage) ausgeschlos-<br />
32
Methoden - Stichproben<br />
sen werden, was den Umfang der Untersuchungsstichprobe auf 242 Patientinnen wei-<br />
ter reduzierte.<br />
Ein weiteres Kriterium zur Aufnahme in die Stichprobe war, dass mindestens die erho-<br />
benen Fragebogendaten (SCL-90-R, VEV-K) vollständig ausgefüllt worden waren und<br />
dass für die Patientin die Einschätzung des Gesamtstrukturniveaus vorlag.<br />
Ausgeschlossen wurden demzufolge 3 Patientinnen wegen fehlender Werte der SCL-<br />
90-R und des VEV-K zum Post-Zeitpunkt, weitere 36 wegen fehlender SCL-90-R und 1<br />
wegen fehlendem VEV-K zum Katamnesezeitpunkt und 6 mussten wegen fehlender<br />
Angaben zum Gesamtstrukturniveau ausgeschlossen werden. Somit setzt sich die<br />
Untersuchungsstichprobe (im Folgenden SP1) aus insgesamt 196 Patientinnen zu-<br />
sammen.<br />
4.1.1.1 Soziodemografie 6<br />
Geschlecht<br />
Die Untersuchungsstichprobe besteht zu 30.1 % (n = 59) aus Männern und zu 69.9 %<br />
(n = 137) aus Frauen.<br />
Alter<br />
Das mittlere Alter der Stichprobe liegt bei 39.4 Jahren (SD = 10.3 Jahre) mit einem<br />
Range von 45 Jahren, wobei die jüngste Patientin 19 Jahre und die älteste Patientin 64<br />
Jahre alt sind.<br />
Familienstand<br />
Ledig sind 49.0 % (n = 96) Patientinnen, verheiratet sind 28.1 % (n = 55), getrennt le-<br />
bend sind 7.1 % (n = 14), geschieden sind 11.2 % (n = 22) und wieder verheiratet sind<br />
4.6 % (n = 9). 49.5 % der Patientinnen (n = 97) haben keine eigenen Kinder, 13.3 %<br />
(n = 26) haben ein Kind, 23.5 % (n = 46) haben zwei Kinder, 10.7 % (n = 21) haben<br />
drei Kinder und 2.6 % (n = 5) haben vier und 0.5 % (n = 1) hat fünf Kinder.<br />
Partnersituation<br />
Hinsichtlich der Partnersituation zeigt sich, dass 57.1 % (n = 112) der Patientinnen ei-<br />
nen festen (Ehe-) Partner haben, 5.1 % (n = 10) wechselnde Partner, 23.5 % (n = 46)<br />
kurzfristig keinen Partner und 14.3 % (n = 28) langfristig keine Partnerschaft haben.<br />
6<br />
Die männlichen Bezeichungen wurden aus dem Erfassungsinstrument übernommen.<br />
33
Methoden - Stichproben<br />
Bildung und Beruf<br />
Als Schulabschluss geben 45.9 % (n = 90) der Patientinnen Abitur und 33.7 % (n = 66)<br />
Realschule, 19.4 % (n = 38) Haupt-/Volksschulabschluss und 1.0 % (n = 2) einen sons-<br />
tigen Abschluss an.<br />
Als höchsten Bildungsabschluss geben 51.5 % (n = 101) der Patientinnen Leh-<br />
re/Fachschule an, 28.6 % (n = 56) Fachhochschule/Universität, 4.1 % (n = 8) Meister,<br />
5.6 % (n = 11) sind noch in Ausbildung, 5.1 % (n = 10) haben einen sonstigen Ab-<br />
schluss und 5.1 % (n = 10) geben an keinen Abschluss absolviert zu haben.<br />
Als letzte Berufstätigkeit vor dem Klinikaufenthalt geben 70.9 % (n = 139) der Patien-<br />
tinnen an als Angestellte gearbeitet zu haben, 13.3 % (n = 26) als Arbeiter oder Fach-<br />
arbeiter, 6.7 % (n = 13) waren selbständig, 5.6 % (n = 11) waren nie erwerbstätig und<br />
bei 3.6 % (n = 7) ist die Situation unklar oder unbekannt. Der auffallend hohe Anteil<br />
Angestellter und Beamter hängt mit der Belegung durch die deutsche Rentenversiche-<br />
rung zusammen.<br />
Zur aktuellen beruflichen Situation geben 66.8 % (n = 130) der Patientinnen an, min-<br />
destens gelegentlich erwerbstätig zu sein, Hausfrau/-mann oder mithelfender Angehö-<br />
riger geben 7.1 % (n = 14) an, 14.8 % (n = 29) sind arbeitslos und 4.1 % (n = 8) befin-<br />
den sich noch in Ausbildung. 2 % (n = 4) beziehen Renten und 5.7 % (n = 11) geben<br />
„sonst ohne Beschäftigung“ oder „unklar/unbekannt“ an.<br />
Die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit wegen der Aufnahme in die Klinik liegt bei 7.7<br />
Wochen (SD = 11.2 Wochen) mit einem Minimum von 0 Wochen und einem Maximum<br />
von 52 Wochen. 167 (85.2 %) Patientinnen werden bei Entlassung als arbeitsfähig<br />
eingestuft, 3 (1.5 %) als nicht arbeitsfähig, für 26 Patientinnen fehlt diese Information<br />
oder ist „unzutreffend“.<br />
4.1.1.2 Krankheitsbezogene Merkmale<br />
Verteilung der Diagnosen<br />
Die Verteilung der ICD-10-Diagnosen in der Untersuchungsstichprobe zeigt Abbildung<br />
4.1. Eine detaillierte Auflistung aller Diagnosen ist in Tabelle A-1 In Anhang A zu fin-<br />
den.<br />
34
Methoden - Stichproben<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Abbildung 4.1<br />
160<br />
Verteilung der ICD-10-Diagnosen in SP 1<br />
Anmerkungen.<br />
Unter „Sonstige psychische Störungen“ sind Psychische und Verhaltenseinflüsse bei andernorts<br />
klassifizierten Krankheiten, Neurasthenie, Anpassungsstörung, akute Belastungsstörung, nicht<br />
näher bezeichnete nichtorganische Schlafstörung und nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung<br />
eingeordnet.<br />
Hauptdiagnosen nach ICD-10<br />
Substanzabhängigkeiten (Alkohol, Cannabis, multiple Substanzen) wiesen 3 Patientin-<br />
nen (1.5 %) und affektive Störungen 109 Patientinnen (55.6 %) als Hauptdiagnose auf.<br />
Angststörungen hatten 16 Patientinnen (8.2 %), PTBS hatten 6 Patientinnen (3.1 %),<br />
Somatoforme Störungen hatten 6 Patientinnen (3.1 %). 32 Patientinnen (16.3 %) be-<br />
kamen die Hauptdiagnose Essstörung, 17 Patientinnen (8.7 %) eine Persönlichkeits-<br />
störung und 7 Patientinnen (3.6 %) eine sonstige Hauptdiagnose.<br />
Anzahl der Diagnosen/Komorbiditäten<br />
Die Untersuchungsstichprobe weist eine mittlere Anzahl von 2.8 (SD = 1.4) Diagnosen<br />
pro Patientin auf. Es wurden zwischen einer und sieben Diagnosen vergeben, 36 Pati-<br />
entinnen (18.4 %) wiesen keine Komorbidität auf. Abbildung 4.2 gibt einen Überblick<br />
über die Häufigkeiten der Komorbiditäten.<br />
51<br />
73<br />
Häufigkeiten<br />
28<br />
35<br />
50<br />
39<br />
57<br />
36
Methoden - Stichproben<br />
Häufigkeiten<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Abbildung 4.2<br />
Anzahl der Diagnosen (Komorbiditäten) in SP1<br />
Gesamtstrukturniveau nach OPD-1<br />
Wie Tabelle 4.1 zeigt weist der größte Teil der Patientinnen (n = 141; 71.9 %) ein Ge-<br />
samtstrukturniveau von 2.0 auf, 24 Patientinnen (12.2 %) wurde mit 1.5 eingestuft und<br />
31 Patientinnen (15.8 %) mit 2.5 oder 3.0.<br />
Tabelle 4.1<br />
Verteilung des Gesamtstrukturniveaus in SP1<br />
Gesamtstrukturniveau Anzahl: N = 196 Prozent<br />
1.5<br />
2.0<br />
2.5<br />
3.0<br />
36<br />
4.1.1.3 Behandlungsmerkmale<br />
Behandlungsdauer<br />
58<br />
24<br />
141<br />
29<br />
2<br />
36<br />
12.2 %<br />
71.9 %<br />
14.8 %<br />
1.0 %<br />
Die durchschnittliche Behandlungsdauer liegt bei 54 Tagen mit einer Standardabwei-<br />
chung von 12 Tagen, einer Spannweite von 63 Tagen, einem Minimum von 28 und<br />
einem Maximum von 91 Tagen. Am häufigsten zeigt sich eine Behandlungsdauer von<br />
6 oder 8 Wochen (jeweils n = 54).<br />
Anzahl der Diagnosen pro Patientin<br />
49<br />
33<br />
Eine Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben<br />
10<br />
7<br />
3
Methoden - Stichproben<br />
Chronizität<br />
Die durchschnittliche Dauer der Erkrankung vor dem Klinikaufenthalt liegt bei 111.2<br />
Monaten (SD = 101.8 Monate) mit einem Modalwert von 120 Monaten und einer<br />
Spannweite von 477 Monaten (Min. 3, Max. 480 Monate). Eine Erkrankungsdauer von<br />
unter 1 Jahr zeigen 4.6 %, 1 - 2 Jahre 20.4 %, 2 - 5 Jahre 16.8 %, 5 - 10 Jahre 30.1 %<br />
und über 10 Jahre 28.1 %.<br />
4.1.1.4 Repräsentativität<br />
Da alle Patientinnen eines bestimmten Zeitraums erfasst wurden, kann davon ausge-<br />
gangen werden, dass die Gesamtstichprobe repräsentativ für die Klinik ist. Im Hinblick<br />
auf die Repräsentativität der Untersuchungsstichprobe stellt sich die Frage, inwieweit<br />
sich die ausgeschlossenen Patientinnen in der Ausprägung bestimmter Merkmale von<br />
denjenigen Patientinnen unterscheiden, die aufgenommen werden konnten. Um even-<br />
tuellen Unterschieden nachzugehen, wurden die Eingeschlossenen (N = 196; 57.5 %)<br />
mit den Ausgeschlossenen (N = 145; 42.5 %) hinsichtlich Alter, Geschlecht, Familien-<br />
stand, Beruf, Hauptdiagnosen, Anzahl der Diagnosen und des Gesamtstrukturniveaus,<br />
der Behandlungsdauer und der Werte im GSI der SCL-90-R zum Aufnahme- und zum<br />
Entlassungszeitpunkt verglichen (multivariate Tests und χ²-Tests).<br />
1. Hinsichtlich der soziodemografischen Variablen konnten weder beim Alter, der Ge-<br />
schlechterverteilung, noch beim Familienstand der Patientinnen signifikante Unter-<br />
schiede zwischen Eingeschlossenen und Ausgeschlossenen festgestellt werden. Le-<br />
diglich für den Berufsabschluss und die Berufstätigkeit vor dem Klinikaufenthalt wurden<br />
signifikante Unterschiede festgestellt. In der Gruppe der Ausgeschlossenen befanden<br />
sich mehr Patientinnen ohne Abschluss und noch in Ausbildung, sowie weniger Lehr-<br />
und Fachschulabsolventen, Meister und akademische Abschlüsse, d.h. insgesamt ein<br />
geringeres Bildungsniveau. Bei Betrachtung der Berufstätigkeit zeigte sich, dass die<br />
Gruppe der Eingeschlossenen insgesamt besser gestellte Beschäftigungsverhältnisse<br />
aufwies und auch weniger Arbeitslose. Ein Überblick über die prozentualen Häufigkei-<br />
ten des Berufsabschlusses und der Berufstätigkeit ist den Tabellen B-1 und B-2 in An-<br />
hang B zu entnehmen.<br />
2. In der Verteilung der Hauptdiagnosen, der Gesamtstrukturniveaueinschätzungen<br />
und der Anzahl der psychischen Diagnosen unterschieden sich die Eingeschlossenen<br />
nicht signifikant von den Ausgeschlossenen.<br />
3. Ebenso zeigte sich für die Behandlungsdauer kein relevanter Unterschied zwischen<br />
beiden Gruppen.<br />
37
Methoden - Stichproben<br />
4. Die Werte des GSI der SCL-90-R zum Aufnahme- und zum Entlassungszeitpunkt<br />
wiesen auch keine signifikanten Unterschiede zwischen Eingeschlossenen und Ausge-<br />
schlossenen auf. Es fanden sich darüber hinaus auch keine Interaktionseffekte, ob sich<br />
die Eingeschlossenen mehr oder weniger durch die Behandlung (zweifaktorielle Va-<br />
rianzanalyse) verbesserten.<br />
Da sich die Stichproben der Eingeschlossenen und Ausgeschlossenen in den unter-<br />
suchten Merkmalen nicht wesentlich unterscheiden, kann die Stichprobe als weitge-<br />
hend repräsentativ für die HELIOS Klinik Bad Grönenbach betrachtet werden, mit Aus-<br />
nahme des Berufsabschlusses und der Berufstätigkeit vor Aufnahme in die Klinik.<br />
4.1.2 Stichprobe 2<br />
Die Gesamtstichprobe 2 setzt sich aus 61 Patientinnen einer Therapeutin aus Abtei-<br />
lung 1 zusammen, die im Zeitraum vom 02.06.2004 bis 06.04.2005 konsekutiv erfasst<br />
wurden.<br />
In die Stichprobe aufgenommen wurden Patientinnen, die mindestens 28 Tage in der<br />
Klinik behandelt wurden, mindestens die erhobenen Fragebogendaten (SCL-90-R,<br />
VEV-K) vollständig ausgefüllt hatten und deren Einschätzung des Gesamtstrukturni-<br />
veaus vorlag.<br />
Ausgeschlossen werden mussten insgesamt 8 Patientinnen, davon 2 wegen fehlender<br />
Angaben zum Gesamtstrukturniveau und weitere 6 Patientinnen wegen fehlender Wer-<br />
te der SCL-90-R und des VEV-K zum Post-Zeitpunkt. Demnach konnten 53 Patientin-<br />
nen (im Folgenden SP2) in die Untersuchung aufgenommen werden.<br />
Da es sich bei dieser Untersuchung um eine Erhebung mit Pilotcharakter handelt, wer-<br />
den im Folgenden nur Angaben zum Geschlecht, zum Alter, zur Behandlungsdauer,<br />
zur Hauptdiagnose und zum Gesamtstrukturniveau vorgestellt.<br />
Geschlecht<br />
Die Untersuchungsstichprobe besteht zu 35.8 % (n = 19) aus Männern und zu 64.2 %<br />
(n = 34) aus Frauen.<br />
Alter<br />
Das mittlere Alter der Stichprobe liegt bei 40.2 Jahren (SD = 10.8 Jahre) mit einem<br />
Range von 40 Jahren, wobei die jüngste Patientin 20 Jahre und die älteste Patientin 60<br />
Jahre alt sind.<br />
38
Methoden - Stichproben<br />
Behandlungsdauer<br />
Die durchschnittliche Behandlungsdauer liegt bei 56 Tagen mit einer Standardabwei-<br />
chung von 12 Tagen, einem Minimum von 42 und einem Maximum von 91 Tagen. Am<br />
häufigsten dauerte die Behandlung 6 oder 8 Wochen.<br />
Hauptdiagnosen nach ICD-10<br />
Substanzabhängigkeiten (Alkohol, Cannabis, multiple Substanzen) wiesen 5 Patientin-<br />
nen (9.4 %) als Hauptdiagnose auf. Affektive Störungen (eine bipolare, sonst depressi-<br />
ve Störungen) wiesen 33 Patientinnen (62.3 %) auf und neurotische und Angststörun-<br />
gen (Angst-, Somatoforme Störung, PTBS, Neurasthenie) hatten 12 Patientinnen<br />
(22.6 %). 3 Patientinnen (5.7 %) bekamen die Hauptdiagnose Persönlichkeitsstörung<br />
(anankastisch, ängstlich-vermeidend). Eine detaillierte Auflistung ist in Tabelle A-2 in<br />
Anhang A einzusehen.<br />
Gesamtstrukturniveau nach OPD-1<br />
5 Patientinnen (9.4 %) bekamen die Diagnose Gesamtstrukturniveau 1.5, 37 Patientin-<br />
nen (69.8 %) bekamen Gesamtstrukturniveau 2.0 und 11 Patientinnen (20.8 %) Ge-<br />
samtstrukturniveau 2.5. Einen Überblick gibt Tabelle 4.2.<br />
Tabelle 4.2<br />
Verteilung des Gesamtstrukturniveaus in SP2<br />
Gesamtstrukturniveau Anzahl: N = 53 Prozent<br />
1.5<br />
2.0<br />
2.5<br />
4.1.3 Stichprobe 3<br />
5<br />
37<br />
11<br />
39<br />
9.4 %<br />
69.8 %<br />
20.8 %<br />
Die Gesamtstichprobe 3 setzt sich aus 61 Patientinnen einer Therapeutin aus Abtei-<br />
lung 1 zusammen, die zufällig ausgewählt und im Zeitraum vom 29.01.2005 bis<br />
26.10.2005 konsekutiv erfasst wurden.<br />
In die Stichprobe aufgenommen wurden Patientinnen, die mindestens 28 Tage in der<br />
Klinik behandelt wurden, mindestens die erhobenen Fragebogendaten (SCL-90-R,<br />
VEV-K) vollständig ausgefüllt hatten und deren Einschätzung des Gesamtstrukturni-<br />
veaus vorlag.
Methoden - Stichproben<br />
Ausgeschlossen werden mussten insgesamt 12 Patientinnen, davon 7 wegen fehlen-<br />
der Angaben zum Gesamtstrukturniveau und weitere 8 Patientinnen wegen fehlender<br />
Werte der SCL-90-R und VEV-K (teilweise mehrfache Missings). Aufgenommen in die<br />
Untersuchung wurden somit 49 Patientinnen (im Folgenden SP3).<br />
Da es sich bei dieser Untersuchung ebenfalls um eine Erhebung mit Pilotcharakter<br />
handelt, werden im Folgenden, wie in Stichprobe 2, nur Angaben zum Geschlecht, zum<br />
Alter, zur Behandlungsdauer, zum Gesamtstrukturniveau und zur Hauptdiagnose vor-<br />
gestellt.<br />
Geschlecht<br />
Die Untersuchungsstichprobe besteht zu 34.7 % (n = 17) aus Männern und zu 65.3 %<br />
(n = 32) aus Frauen.<br />
Alter<br />
Das mittlere Alter der Stichprobe liegt bei 41 Jahren (SD = 11.5 Jahre) mit einem Ran-<br />
ge von 49 Jahren, wobei die jüngste Patientin 21 und die älteste Patientin 70 Jahre alt<br />
sind.<br />
Behandlungsdauer<br />
Die durchschnittliche Behandlungsdauer liegt bei 53 Tagen mit einer Standardabwei-<br />
chung von 12 Tagen, einem Minimum von 28 und einem Maximum von 77 Tagen. Am<br />
häufigsten dauerte die Behandlung 6 oder 8 Wochen.<br />
Hauptdiagnosen nach ICD-10<br />
Substanzabhängigkeiten (Alkohol) wiesen 2 Patientinnen (4 %) als Hauptdiagnose auf.<br />
Affektive Störungen (depressive Störung) wiesen 33 Patientinnen (67 %) auf und neu-<br />
rotische und Angststörungen (Angst-, Zwangsstörung, PTBS, Anpassungsstörung)<br />
hatten 12 Patientinnen (25 %). 1 Patientin (2 %) bekam die Hauptdiagnose Essstörung<br />
und 1 weitere (2 %) Psychische Faktoren und Verhaltenseinflüsse bei andernorts klas-<br />
sifizierten Krankheiten (siehe Tabelle A-3 in Anhang A).<br />
Gesamtstrukturniveau<br />
1 Patientin (2 %) bekam die Diagnose Gesamtstrukturniveau 1.0, 5 Patientinnen<br />
(10.2 %) Gesamtstrukturniveau 1.5, 22 Patientinnen (44.9 %) bekamen Gesamtstruk-<br />
turniveau 2.0, 18 (36.7 %) Gesamtstrukturniveau 2.5 und 3 (6.1 %) Gesamtstrukturni-<br />
veau 3.0. Tabelle 4.3 gibt einen Überblick über die Verteilungen.<br />
40
Methoden - Stichproben<br />
Tabelle 4.3<br />
Verteilung des Gesamtstrukturniveaus in Stichprobe 3<br />
Gesamtstrukturniveau Anzahl: N = 49 Prozent<br />
1.0<br />
1.5<br />
2.0<br />
2.5<br />
3.0<br />
4.2 Klinikkonzept<br />
1<br />
5<br />
22<br />
18<br />
3<br />
2.0 %<br />
10.2 %<br />
44.9 %<br />
37.7 %<br />
6.1 %<br />
Die HELIOS Klinik Bad Grönenbach ist eine Akut- und Rehabilitationsklinik für psycho-<br />
somatische Medizin mit 155 Betten in vier Abteilungen. Das Behandlungskonzept ist<br />
tiefenpsychologisch fundiert und integrativ (methodenübergreifend) mit bewährten und<br />
evidenzbasierten Therapiekonzepten, die auf dem Hintergrund humanistischer Werte<br />
und einer ganzheitlichen biopsychosozialen Auffassung vom Menschen psychodyna-<br />
mische Therapie mit erlebnisaktivierenden Verfahren und störungsspezifisch mit Ele-<br />
menten der Verhaltenstherapie verbinden.<br />
4.2.1 Behandlungskonzept in Abteilung 1 und 2<br />
Neben der tiefenpsychologischen Gesprächsführung ist die Therapie überwiegend als<br />
Gruppentherapie konzipiert mit erlebnisaktivierenden Verfahren wie Gestalttherapie,<br />
Psychodrama, körperorientierte und kreativtherapeutische Methoden sowie mit üben-<br />
den Verfahren wie z.B. Progressiver Muskelrelaxation. Störungsspezifisch kommen<br />
verhaltenstherapeutische Verfahren, Nutzung der Ressourcen, schriftliche Therapie-<br />
verträge, Rückfallprophylaxe und spezifische Gruppenangebote hinzu. Neben einem<br />
Anamnese- und Abschlussgespräch finden einmal wöchentlich jeweils 30 Minuten Ein-<br />
zeltherapie (bedarfsweise mehr) als „roter Faden“ der Behandlung statt. Je nach indivi-<br />
duellem Behandlungsplan gibt es spezifische Gruppen wie eine Aktivierungsgruppe,<br />
Angstbewältigungsgruppe, Gruppen zum Training der emotionalen Kompetenz,<br />
Fertigkeitentraining, Frauengruppe (für missbrauchte Frauen), kognitive Gruppe, Stabi-<br />
lisierungsgruppe und eine Suchtgruppe. Ergänzt wird die Therapie durch eine Sozial-<br />
therapie, in der Themen der sozialen Nachsorge (Wohnen, Arbeit, Umgang mit Behör-<br />
den, Freizeit, Beziehungen etc.) im Anschluss an die stationäre Therapie behandelt<br />
werden, sowie Selbsthilfegruppen (nach dem 12-Schritte-Programm der Anonymen<br />
Alkoholiker), Klinikseelsorge, Bonding und Angebote aus der Sport- und Bewegungs-<br />
therapie. Wesentlicher Bestandteil der Therapie ist das Zusammenleben in einer the-<br />
rapeutischen Gemeinschaft, der sowohl die Patientinnen als auch die Mitarbeiterinnen<br />
41
Methoden – Klinikkonzept<br />
angehören und die aus dem Konzept der Teaching Learning Community von Dr. Wal-<br />
ter Lechler (Bad Herrenalber Modell) entwickelt wurde. In dieser Gemeinschaft sollen<br />
die Patientinnen die Möglichkeit haben, sich mitzuteilen, Kritik zu äußern und entge-<br />
genzunehmen und Schwierigkeiten anzusprechen, d.h. krankheitsförderndes Verhalten<br />
wird konfrontiert und gesundheitsförderndes unterstützt. Insgesamt kann das Konzept<br />
als tiefenpsychologisch fundierter, integrativer, begegnungsorientierter Therapieansatz<br />
charakterisiert werden.<br />
Die Klinik ist gegliedert in vier Abteilungen, in Abteilung 1 werden vor allem Depressio-<br />
nen, Angststörungen, Sucht-Problematiken und leichte Persönlichkeitsstörungen be-<br />
handelt, in Abteilung 2 eher Essstörungen und somatoforme Störungen und in Abtei-<br />
lung 3 strukturelle Störungen. Außerdem gibt es eine Akutabteilung, die als Depen-<br />
dance in der HELIOS Klinik „Am Stiftsberg“ untergebracht ist. Untersuchungsort ist die<br />
Abteilung 1 und 2 (Quelle: www.helios-kliniken.de; Jubiläumsband 25 Jahre Psycho-<br />
somatische Klinik Bad Grönenbach, 2004).<br />
4.3 Erhebungsinstrumente<br />
Zur Untersuchung der Fragestellungen kamen Selbsteinschätzungen und Fremdein-<br />
schätzungen zum Einsatz, die in Tabelle 4.4 dargestellt werden und im Folgenden nä-<br />
her erläutert werden.<br />
Tabelle 4.4<br />
Eingesetzte Untersuchungsinstrumente<br />
Prä Post Kat<br />
SCL-90-R SCL-90-R SCL-90-R<br />
Psy-BaDo-PTM: (Basisdokumentation)<br />
Therapeutin:<br />
Psy-BaDo-PTM mit OPD<br />
Gesamtstrukturniveau, Motivation,<br />
BSS, ICD-10 Diagno-<br />
sen psychisch<br />
VEV-K VEV-K<br />
Therapeutin:<br />
Psy-BaDo-PTM mit „Änderung<br />
des psychischen Befindens“<br />
42<br />
Psy-BaDo-PTM:<br />
(Grönenbacher Nachbefragungsbogen<br />
GNBB)<br />
Anmerkungen.<br />
Prä = Bei Aufnahme. Post = Bei Entlassung. Kat = Zum Katamnesezeitpunkt. ICD-10 = Internationale<br />
Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision. Wenn nicht anders vermerkt, handelt es<br />
sich um Selbsteinschätzungen.<br />
4.3.1 Der Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS)<br />
Der Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS) soll aus Expertensicht einschätzen, wie<br />
schwer ein Mensch durch seine psychogene Symptomatik insgesamt beeinträchtigt ist
Methoden – Erhebungsinstrumente<br />
und in welchem Bereich diese Beeinträchtigung bevorzugt vorliegt (Schepank, 1995).<br />
Dazu wird der „Körperliche Beeinträchtigungsgrad“, der „Psychische Beeinträchti-<br />
gungsgrad“ und der „Sozialkommunikative Beeinträchtigungsgrad“ auf einer fünfstufi-<br />
gen Skala von „0 = gar nicht“ bis „4 = extrem“ von der Therapeutin eingeschätzt und<br />
ein Summenwert gebildet, der dann einer Skala von „Optimaler Gesundheit“ bis<br />
„Schwerst gestört“ zugeordnet werden kann. Der BSS ist ein öffentlich zugänglicher<br />
Test und kann beim Hogrefe Verlag bezogen werden.<br />
4.3.2 Basisdokumentation für Psychotherapeutische Medizin (Psy-BaDo-<br />
PTM)<br />
Das Verfahren der Basisdokumentation für Psychotherapeutische Medizin (Psy-BaDo-<br />
PTM, Heymann, 1998, 2003) wurde mit dem Ziel des internen und externen Qualitäts-<br />
managements konzipiert und ermöglicht eine standardisierte, systematische Dokumen-<br />
tation, die auch Vergleiche unterschiedlicher <strong>Kliniken</strong> und Institutionen zulässt. Die in<br />
der Basisdokumentation erhobenen Daten betreffen zum Teil Selbsteinschätzungen<br />
der Patientinnen aus den entsprechenden Fragebögen, teils finden durch Therapeutin-<br />
nen und Ärztinnen Fremdbeurteilungen statt. Erhoben wird zum Zeitpunkt der Aufnah-<br />
me (Prä), zum Entlassungszeitpunkt (Post) sowie zum Katamnesezeitpunkt (Kat).<br />
Im Aufnahmebogen werden soziodemografische (z.B. Alter, Geschlecht, Partnersitua-<br />
tion, berufliche Situation), krankheitsbezogene (z.B. Arbeitsunfähigkeit) und behand-<br />
lungsbezogene (z.B. Dauer der Erkrankung) Merkmale der Patientin in Einzelitems<br />
erfasst. In Anhang C werden die für die Untersuchung herangezogenen Items der Psy-<br />
BaDo-PTM bei Aufnahme dargestellt.<br />
Zwei Erfassungsinstrumente der Psy-BaDo-PTM, der „TherapeutInnen Dokumentati-<br />
onsbogen“ (Fremdbeurteilung) und der „Grönenbacher Nachbefragungsbogen“<br />
(Selbstbeurteilung) werden anschließend näher erläutert.<br />
4.3.2.1 „TherapeutInnen Dokumentationsbogen“ 7<br />
Zu Behandlungsbeginn werden im „TherapeutInnen Dokumentationsbogen“, der von<br />
den Bezugstherapeutinnen der Patientin während der gesamten Aufenthaltszeit ge-<br />
führt wird, die Therapiemotivation von „1 = nicht motiviert“ bis „5 = sehr motiviert“, die<br />
Schwere der Beeinträchtigung (mithilfe des BSS, Schepank, 1995) und die OPD-<br />
Strukturachse für die sechs Dimensionen, deren Integrationsniveaus und das Gesamt-<br />
7<br />
Stellvertretend für alle Therapeutinnen der Klinik möchte ich Christa Garwers und Andrea<br />
Heinz für die Bereitstellung der Diagnosen und Einschätzungen danken.<br />
43
Methoden – Erhebungsinstrumente<br />
strukturniveau eingeschätzt. Daneben werden die tiefenpsychologischen Konflikte, ihre<br />
Wichtigkeit und ihr Modus (aktiv vs. passiv) eingeschätzt.<br />
Nach R. Mestel (persönliche Mitteilung, 12.11.2010) haben zum Untersuchungszeit-<br />
punkt 20 % der Therapeutinnen der Klinik 80 - 100 Stunden intensive OPD-Schulung<br />
erhalten, u.a. durch Dr. Tilmann Grande, Dr. Gerhard Schüßler und Dr. Rainer<br />
Dahlbender. Darunter befinden sich sämtliche ärztlichen und psychologischen Leitun-<br />
gen. Die übrigen 80 % der Therapeutinnen absolvierten einmal pro Jahr eine Schulung<br />
von zertifizierten OPD-Trainern und erhielten wöchentliche Intervision durch die klini-<br />
sche Leitung.<br />
Zum Therapieende schätzt die Therapeutin global ein, wie sich das körperliche und<br />
seelische Befinden der Patientin verändert hat (von „deutlich verschlechtert“ bis „deut-<br />
lich verbessert“) und welche Maßnahmen der Patientin für die Zeit nach der Behand-<br />
lung empfohlen wurden. Der BSS wird ein weiteres Mal eingeschätzt und Haupt- und<br />
Nebendiagnosen nach ICD-10 vergeben, sowie deren Dauer angegeben. In Anhang C<br />
befindet sich ein Muster dieses Erfassungsbogens (© Dr. Robert Mestel).<br />
4.3.2.2 Grönenbacher Nachbefragungsbogen (GNBB-2004)<br />
Der „Grönenbacher Nachbefragungsbogen“ (© Dr. Robert Mestel) erfasst die aktuellen<br />
soziodemografischen Daten, wie Arbeitsfähigkeit, nachfolgende Therapien und Arztbe-<br />
suche, eventuelle Klinikaufenthalte und sonstige Inanspruchnahme verschiedener<br />
Unterstützungen (z.B. Heilpraktiker, Selbsthilfegruppen, Pfarrer) zum Katamnesezeit-<br />
punkt. Erfragt werden Veränderungen des psychischen und körperlichen Befindens<br />
und weitere Variablen möglicher Veränderungen, wie z.B. das Selbstwerterleben oder<br />
Krankheitsverständnis. In Anhang C sind die verwendeten Items des GNBB aufgeführt.<br />
Mestel, Burger, von Consbruch, von Wahlert und Piesbergen (2010) fanden an einer<br />
Stichprobe von 72 stationären Psychotherapiepatientinnen eine Übereinstimmungsva-<br />
lidität (einmalige schriftliche Selbstauskunft und darauffolgendes Interview) von 80-<br />
100 % bei den meisten der Psy-BaDo-PTM-Items. Bei zehn Items war die Überein-<br />
stimmung < 80 %. Besonders schlecht (< 60 % Übereinstimmungen) waren die Werte<br />
für die Items „Empfehlung zur Psychotherapie“, „Chronifizierungsdauer der aktuellen<br />
Beschwerden“ und „Wartezeit auf einen Klinikplatz“.<br />
4.3.3 Die „Symptom-Checkliste“ (SCL-90-R)<br />
Die „Symptom Checklist“ von Derogatis (1977, deutsche Version von Franke, Neunor-<br />
mierung, 2002) ist ein Selbstbeurteilungsinstrument zur Erfassung der subjektiv emp-<br />
44
Methoden – Erhebungsinstrumente<br />
fundenen Beeinträchtigung durch 90 vorgegebene körperliche und psychische Symp-<br />
tome in einem Zeitfenster von sieben Tagen. Die Einschätzung erfolgt auf einer fünf-<br />
stufigen Likert-Skala von „0 = überhaupt“ nicht bis „4 = sehr stark“ beeinträchtigt oder<br />
belastet und kann dann neun Symptomskalen zugeordnet werden. Diese Skalen be-<br />
schreiben die Dimensionen Somatisierung (12 Items), Zwanghaftigkeit (10 Items), Un-<br />
sicherheit im Sozialkontakt (9 Items), Depressivität (13 Items), Ängstlichkeit (10 Items),<br />
Aggressivität/Feindseligkeit (6 Items), Phobische Angst (7 Items), Paranoides Denken<br />
(6 Items) und Psychotizismus (10 Items). Das Instrument soll die Lücke zwischen mo-<br />
mentaner Befindlichkeitsmessung (state) und zeitlich überdauernder Persönlichkeits-<br />
struktur (trait) füllen und eignet sich für Prä-Post-Messungen (Franke, 2002). Neben<br />
den neun Skalen können drei globale Kennwerte berechnet werden, die Auskunft über<br />
das generelle Antwortverhalten geben. Der „global severity index“ (GSI) misst die<br />
grundsätzliche psychische Belastung, der „positive symptom distress index“ (PSDI)<br />
misst die Intensität der Antworten und der „positive symptom total“ (PST) misst die An-<br />
zahl der Symptome, bei denen eine Belastung vorliegt.<br />
Relevant für die vorliegende Arbeit ist der „global severity index“ (GSI) der berechnet<br />
werden kann um eine globale Einschätzung der Belastung zu bekommen, indem man<br />
den Summenwert der Items durch die Anzahl der beantworteten Items teilt.<br />
Testtheoretisch ergibt sich bei Derogatis eine Lösung mit neun Faktoren und einer Va-<br />
rianzaufklärung von 53 % (Franke, 2002). Dies konnte zwar von anderen Autoren nicht<br />
repliziert werden, sollte aber aus inhaltlichen Gründen dennoch beibehalten werden.<br />
Da von einem generellen Faktor auszugehen ist, wird empfohlen insbesondere den<br />
GSI heranzuziehen (Cyr et al., Hessel et al., 2001, zitiert in Franke, 2002), der sich<br />
durch seine sehr gute Reliabilität auszeichnet. Die Retest-Reliabilitäten der einzelnen<br />
Skalen sind in einer Stichprobe von N = 80 Studierenden niedrig bis sehr gut (rtt = .69 -<br />
.92, Franke, 2002). Die internen Konsistenzen (Cronbach’s α) der neun Subskalen<br />
liegen in der Eichstichprobe (N = 2141 von Hessel et al., 2001, zitiert in Franke, 2002)<br />
zwischen α = .75 und .87 und in der Psychotherapiepatientinnenstichprobe (N = 5057,<br />
zitiert in Franke, 2002) zwischen α = .74 und .88. Die interne Konsistenz des GSIs für<br />
klinische Stichproben und die Eichstichprobe liegt bei α = .97. Die Reliabilität kann<br />
nach den Kriterien von Fisseni (1997, zitiert in Bühner, 2006) für klinische Gruppen als<br />
insgesamt gut, für den GSI als sehr gut bewertet werden. Die Ergebnisse zur konver-<br />
genten und divergenten Validität sprechen ebenfalls für die Anwendung des Verfah-<br />
rens. Die Interkorrelation der Skalen ist in den klinischen Stichproben recht hoch, was<br />
die Autoren jedoch durch das ganzheitliche Konzept der Symptombelastung rechtferti-<br />
gen. Daneben spricht die weite Verbreitung des Instruments ebenfalls für seinen Ein-<br />
45
Methoden – Erhebungsinstrumente<br />
satz, da so eine erhöhte Vergleichbarkeit der Untersuchung gegeben ist (vgl. Mestel et<br />
al., 2001).<br />
Zur Berechnung wird der SCL-90-R-GSI-Rohwert herangezogen, wobei eine signifikan-<br />
te Reduktion der Gesamtsymptombelastung hin zu Werten im Bereich des Normalen<br />
als positiver Erfolg operationalisiert wird. Zur Einsicht der SCL-90-R wird ebenfalls auf<br />
den Verlag Hogrefe verwiesen, bei dem dieser Test erhältlich ist.<br />
4.3.4 Der Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens (VEV-K)<br />
Der VEV-K (Kriebel, Paar, Schmitz-Buhl & Raatz, 2001) wurde als Kurzform des Ver-<br />
änderungsfragebogens des Erlebens und Verhaltens VEV (Zielke & Kopf-Mehnert,<br />
1978) konzipiert und unterscheidet sich von der Langform vor allem durch die von 42<br />
auf 25 reduzierte Anzahl der Items. In Form einer subjektiven Schätzung nimmt der<br />
VEV-K eine direkte Messung von Veränderungen des Erlebens und Verhaltens vor und<br />
umgeht auf diese Weise verschiedene statistisch-methodische Probleme wie etwa<br />
Regressionseffekte, die sich bei einer indirekten Differenzmessung ergeben. Diese<br />
direkte Messung erfolgt zu einem Messzeitpunkt retrospektiv, indem die Patientin ein-<br />
schätzt, in welchem Ausmaß sie sich im Vergleich zu einem früheren Zeitpunkt (bei<br />
Therapieerfolgsmessungen vor Therapiebeginn) in verschiedenen Bereichen als positiv<br />
oder negativ verändert erlebt. Die Beurteilungszeitspanne erstreckt sich über einen<br />
längeren Zeitraum, in der Regel ca. zwei Monate. Der VEV-K erfasst dementsprechend<br />
eher zeitstabile Merkmale und eignet sich so neben der Messung von unmittelbaren<br />
Therapieeffekten auch zur Erhebung von Langzeiteffekten (vgl. Zielke & Kopf-Mehnert,<br />
1978) und deren Stabilität. Der VEV-K hat einen Generalfaktor mit den beiden entge-<br />
gengesetzten Polen Entspannung, Gelassenheit und Optimismus als positiver Pol und<br />
Spannung, Pessimismus und Unsicherheit als negativer Pol. Nach Zielke und Kopf-<br />
Mehnert (2001) besitzt das Instrument auch eine ausreichende diagnostische Sensitivi-<br />
tät zur Unterscheidung von Gruppen und ist zur Differenzierung von erfolgreichen und<br />
nicht erfolgreichen Therapieverläufen geeignet.<br />
Der VEV-K beinhaltet 25 positiv gepolte Items, welche auf einer zweipoligen, sieben-<br />
fach abgestuften Schätzskala von „- 3 = stimmt nicht“ bis „+ 3 = stimmt“ (jeweils stark-<br />
mittel-schwach und weder-noch-Kategorie in der Mitte) eingeschätzt werden. Der Ge-<br />
samtwert des Tests bewegt sich im Bereich von 25 bis 175 Punkten. Hohe Punktzah-<br />
len entsprechen hierbei einer positiven Veränderung, eine theoretische „Nullverände-<br />
rung“ liegt bei 100 Punkten. Für ein Signifikanzniveau von α = 5 % gelten nach Kriebel<br />
et. al. (2001) Wertebereiche von unter 85 Punkten als Verschlechterung, bei Werten<br />
von 85 - 115 Punkten liegt keine bedeutsame Veränderung vor, Werte über 115 Punkte<br />
46
Methoden – Erhebungsinstrumente<br />
weisen auf eine Verbesserung hin. Eine Verbesserung auf einem Signifikanzniveau<br />
von α = 1 % liegt bei Werten > 120 vor. Tabelle 4.5 gibt einen Überblick über die Inter-<br />
pretation der Werte des VEV-K.<br />
Tabelle 4.5<br />
Interpretation der Werte im VEV-K<br />
Wert im VEV-K Grad der Veränderung<br />
25 - 84 Verschlechterung<br />
85 - 115 Keine Veränderung<br />
116 - 120 Verbesserung auf p ≤ .05<br />
121 - 175 Verbesserung auf p ≤ .01<br />
Anmerkungen.<br />
P ≤ .05 = Signifikanzniveau von 5 %. P ≤ .01 = Signifikanzniveau von 1 %.<br />
Aus testtheoretischer Sicht ergibt sich eine 4-Faktoren-Lösung mit einem Generalfak-<br />
tor, der Gesamtanteil der dadurch aufgeklärten Varianz beträgt laut Kriebel et al.<br />
(2001) 69.7 %. Da der VEV-K als Messinstrument für eine Veränderung ein fluktuie-<br />
rendes Merkmal erfassen will, ist die Retest-Reliabilität (rtt = .61, Kriebel et al., 2001)<br />
relativ gering. Die innere Konsistenz liegt bei α = .91, die Kriteriumsvalidität wurde über<br />
Korrelationen mit Außenkriterien belegt. Der VEV-K hält als Kurzform des VEV die gu-<br />
ten testtheoretischen Gütekriterien der Langform aufrecht, die Korrelation zwischen<br />
Lang- und Kurzform beträgt r = .92.<br />
In diese Untersuchung geht der VEV-K als retrospektives Erfolgsmaß des globalen<br />
Therapieerfolgs ein, wobei ein hoher Veränderungsindex als guter Therapieerfolg ope-<br />
rationalisiert wird. Auch dieses Verfahren ist ein öffentlich zugängliches, welches beim<br />
Beltz Verlag erhältlich ist.<br />
4.4 Untersuchungsdesign und Durchführung<br />
Bei dieser hier vorgestellten <strong>Diplomarbeit</strong> handelt es sich um eine naturalistische Stu-<br />
die im quasi-experimentellen, längsschnittlichen Design ohne kontrollierende Ver-<br />
gleichsgruppe, ein sogenanntes Single-group-Design. Dieses Design ohne un-<br />
behandelte Kontrollgruppe ist aus ethischen und praktischen Gründen typisch für Stu-<br />
dien in stationären Behandlungen (Bortz & Lienert, 1998). Anzustreben sind zur Prü-<br />
fung der OPD auch eher naturalistische Studien, deren Aussagekraft erheblich größer<br />
ist als die an experimentellen Designs orientierten (OPD-1, 2001). Die Datenerhebung<br />
erfolgte zu drei Messzeitpunkten: Bei Aufnahme in die Klinik (Prä), bei Entlassung<br />
(Post) und katamnestisch (Kat) ca. ein Jahr nach dem Klinikaufenthalt.<br />
47
Methoden – Untersuchungsdesign und Durchführung<br />
Die Diagnosestellung erfolgte mehrheitlich durch die Bezugstherapeutinnen der jewei-<br />
ligen Patientinnen im Rahmen der Anamnese, bei ca. 30 % der Patientinnen anhand<br />
der Internationalen Diagnosechecklisten (IDCL, Hiller, Zaudig & Mombour, 1995). Die<br />
übrigen Diagnosen wurden orientiert an den Forschungskriterien der ICD-10 erstellt.<br />
Die Prä- und Post-Daten der Selbstbeurteilungsinstrumente wurden im Rahmen der<br />
routinemäßigen Eingangs- und Ausgangsdiagnostik im Zeitraum vom 27.11.2002 bis<br />
08.07.2003 erfasst. Hierzu wurden eine Reihe von Fragebögen, die SCL-90-R, die<br />
Psy-BaDo-PTM und der VEV-K computergestützt mithilfe des Wiener Testsystems<br />
(Schuhfried GmbH) unter Anleitung von eingearbeiteten Fachkräften erhoben. Die<br />
Katamnesedaten wurden postalisch in Form eines Fragebogenpaketes, ca. ein Jahr<br />
nach dem Klinikaufenthalt erhoben. Bei Nichtantwort erfolgte eine schriftliche Nachfra-<br />
ge.<br />
4.5 Statistik<br />
Die statistische Auswertung wurde mithilfe der Computerprogramme Excel und PASW<br />
Statistics 18 (SPSS 18) durchgeführt.<br />
Zur Anwendung kamen verschiedene statistische Verfahren wie deskriptive Analysen<br />
(Häufigkeiten, Maße der zentralen Tendenz), T-Tests, χ²-Tests, Faktorenanalyse, Kor-<br />
relationsberechnungen, Varianz- und Regressionsanalysen. Wann immer möglich,<br />
wurden parametrische Verfahren eingesetzt. Diese Verfahren können als bekannt vo-<br />
rausgesetzt werden und bedürfen daher keiner weiteren Erläuterung. Die Art der Korre-<br />
lationen und die Auswahl der Verfahren richtet sich nach den Skalenniveaus der Vari-<br />
ablen, bei lediglich formalem Intervallskalenniveau erfolgt eine zusätzliche Darstellung<br />
auf Ordinalskalenniveau (jedoch nicht die Beurteilung). Auf eine Prüfung der Normal-<br />
verteilung kann aufgrund der Stichprobengröße von N = 196 verzichtet werden, da bei<br />
Vergleichen mit Stichprobengrößen von jeweils N ≥ 30 der zentrale Grenzwertsatz zum<br />
Tragen kommt (Bortz, 2005, S. 93-94). Bei multiplen Regressionen kann ebenfalls da-<br />
rauf verzichtet werden, da N > 40 und die Anzahl der Prädiktoren ≤ 10 ist (Bortz, 2005,<br />
S. 450).<br />
Das Signifikanzniveau liegt bei einem α von 5 %. Um das Ausmaß der Veränderung zu<br />
erfassen, werden Effektstärken berechnet. Da bei der reinen Effektstärke individuelle<br />
Unterschiede herausgemittelt werden, wird außerdem für jeden Einzelfall ein individuel-<br />
ler Vergleich der Messwertpaare nach dem Prinzip der klinischen Signifikanz berechnet<br />
(Jacobson et al., 1999; Schauenburg & Strack, 1998; Wittchen & Hoyer, 2006, S. 566-<br />
567).<br />
48
Methoden – Statistik<br />
4.5.1 Klinische Signifikanz<br />
Zur Beurteilung ob eine Veränderung klinisch signifikant ist, muss zunächst statistische<br />
Signifikanz (reliable Veränderung) vorliegen, die darüber hinaus klinisch bedeutsam ist<br />
(Jacobson & Truax, 1991; Steyer, Hannöver, Telser & Kriebel, 1997). Für jedes Mess-<br />
wertpaar (Prä-Post/Prä-Kat) wird einzeln entschieden, ob statistische oder klinische<br />
Signifikanz vorliegt. Die beiden Kriterien werden im Folgenden erläutert.<br />
4.5.1.1 Das Kriterium der statistischen Signifikanz<br />
Zur statistischen Absicherung der Frage wie groß die Unterschiede einer Patientin in<br />
zwei Tests sein müssen, kann nach Bühner (Vorlesung Testtheorie, 2006) folgende<br />
Formel verwendet werden, wenn die Reliabilitäten der Tests gleich sind (hier gegeben<br />
durch Testwiederholung):<br />
D = z ∙ SD ∙ √2 ∙ (1-rtt)<br />
Krit.intra<br />
D (krit. intra) = kritische Differenz zwischen zwei Testwerten einer Probandin (= RCI,<br />
reliabel change index)<br />
rtt = Reliabilität (hier: Interne Konsistenz)<br />
z 1-α/2 = Sicherheitsbereich bei zweiseitiger Testung<br />
SD = Standardabweichung des Tests<br />
Als Reliabilitätsschätzer wird die interne Konsistenz herangezogen. Diese ist bei einer<br />
Veränderungsmessung der geeignetere Index, weil hier nicht situative Änderungen<br />
abgebildet werden sollen, sondern intraindividuelle Traitveränderungen (Steyer et al.,<br />
1997, S. 297). Die Standardabweichungen und internen Konsistenzen sollten aus einer<br />
für die vorliegende Arbeit repräsentativen Stichprobe entnommen werden.<br />
Die Differenz des Messwertpaars muss die kritische Differenz überschreiten, dann<br />
kann auf dem jeweiligen Alphaniveau von einer statistischen Signifikanz ausgegangen<br />
werden.<br />
1- α/2<br />
4.5.1.2 Das Kriterium der klinischen Signifikanz<br />
Um klinische Signifikanz beurteilen zu können, kann ein „Cut-off-Wert“ nach inhaltli-<br />
chen Überlegungen bestimmt werden. Nach Jacobson und Truax (1991; Schauenburg<br />
& Strack, 1998) kann dieser auf drei Arten operationalisiert werden und führt zu unter-<br />
schiedlichen Aussagen:<br />
49
Methoden – Statistik<br />
1. Eine klinisch relevante Besserung liegt vor, wenn der Messwert nach der Be-<br />
handlung mindestens zwei Standardabweichungen außerhalb des Mittelwerts<br />
einer „klinischen“ (dysfunktionalen) Population in Richtung Funktionalität liegt.<br />
2. Eine klinisch relevante Besserung liegt vor, wenn der Messwert nach der Be-<br />
handlung innerhalb von zwei Standardabweichungen einer „gesunden“ (funkti-<br />
onalen) Population liegt.<br />
3. Eine klinisch relevante Besserung liegt vor, wenn der Messwert nach der Be-<br />
handlung näher am Mittelwert der „gesunden“ Population als am Mittelwert der<br />
„klinischen“ Population liegt.<br />
Die Messwertpaare (Prä-Post und Prä-Kat) werden nach den Kriterien der statistischen<br />
und klinischen Signifikanz in Anlehnung an Jacobson (Jacobson & Truax, 1991;<br />
Schauenburg & Strack, 1998) folgendermaßen eingeteilt:<br />
Testnormal: Diese Kategorie ist den anderen übergeordnet. Prä- und Post- oder<br />
Kat-Wert liegen im gesunden Normbereich, signifikante Veränderungen, falls<br />
vorhanden, werden nicht berichtet.<br />
Unverändert: Es liegt keine statistisch signifikante Veränderung der<br />
Prä/Post/Kat-Messwertpaare vor.<br />
Verbessert: Es besteht eine statistisch signifikante Veränderung in Richtung<br />
gesunder Normbereich, jedoch nicht innerhalb desselben, d.h. keine klinische<br />
Relevanz.<br />
Geheilt: Es besteht sowohl statistische Signifikanz als auch klinische Relevanz.<br />
Verschlechtert: Es besteht eine statistisch signifikante Veränderung in Richtung<br />
Dysfunktionalität.<br />
In vorliegender Untersuchung geht die Berechnung der klinischen Signifikanz für den<br />
GSI der SCL-90-R und für weitere Kriterien des EMEKs ein. Die Berechnungen für das<br />
EMEK sind in Anhang D dargestellt.<br />
Die Normwerte der SCL-90-R werden aus der Eichstichprobe (N = 2141) von Hessel et<br />
al. (2001, zitiert in Franke, 2002) verwendet und die klinische Norm (N = 5057) aus<br />
einer Stichprobe mit stationären Psychotherapiepatientinnen (<strong>Kliniken</strong> Bad<br />
Grönenbach und Schwedenstein-Pulsnitz, Wittgensteiner <strong>Kliniken</strong> AG, zitiert in Franke,<br />
2002), die in der Geschlechterverteilung und dem Alter in etwa der Untersuchungs-<br />
stichprobe entspricht.<br />
Tabelle 4.6 gibt einen Überblick über die Mittelwerte, Standardabweichungen und in-<br />
ternen Konsistenzen der Normstichprobe und Patientinnenstichprobe.<br />
50
Methoden – Statistik<br />
Tabelle 4.6<br />
Gesunde und klinische Normwerte der SCL-90-R sowie Interne Konsistenzen<br />
MW Gesund SD Gesund MW Klinisch SD Klinisch<br />
51<br />
Interne Konsistenz*<br />
GSI 0.38 0.39 1.20 0.62 .97<br />
Anmerkungen.<br />
GSI = SCL-90-R-GSI-Rohwert. Gesund = Eichstichprobe von Hessel, N = 2141. Klinisch<br />
= Stationäre Psychotherapieklientinnen, N = 5057.<br />
* = Interne Konsistenz liegt für beide Stichproben bei Cronbach´s α = .97 (aus Franke, 2002).<br />
Zur Berechnung der klinischen Signifikanz des GSI wird das cut-off-Kriterium der Re-<br />
duktion der Symptomatik hin zur Symptomfreiheit von c = .70 aus dem Manual von<br />
Franke für stationäre Psychotherapieklientinnen herangezogen (vgl. Franke, 2002).<br />
Dieses Kriterium berücksichtigt den Geschlechtseffekt und entspricht einem T-Wert<br />
von 60. Als kritische Differenz wird der RCI für stationäre Psychotherapiepatientinnen<br />
von ± .30 verwendet (Franke, 2002; Begründung siehe Manual).<br />
Die Kriterien für die Einteilung des GSI-Rohwertes im Überblick:<br />
RCI = ± .30<br />
Cut-off-Wert nach Jacobson: c = .70<br />
Klinisch unauffälliger Bereich: 0-0.69<br />
4.5.2 Effektgrößen<br />
Um die Größe der Veränderung unabhängig von der Stichprobe oder deren Größe<br />
quantifizieren zu können, werden standardisierte Effektstärken (ES) berechnet. Bei<br />
Effektstärkeberechnungen von Gruppenunterschieden wird die Differenz der Mittelwer-<br />
te entweder durch die gemeinsame Standardabweichung der beiden Stichproben oder<br />
die Standardabweichung einer der beiden Stichproben geteilt (Bühner, Vorlesung Test-<br />
theorie, 2006). Da es um einen Vorher-Nachher Effekt geht, wird die ESprä herange-<br />
zogen, bei der durch die Standardabweichung des Prä-Wertes dividiert wird. Diese hat<br />
den Vorteil, dass sie eher konservativer und strenger prüft, da es zum Post-Zeitpunkt<br />
häufig zu einer Streuungsverengung kommt (vgl. Wittchen & Hoyer, 2006, S. 566-567;<br />
Mestel & Lutz, 2002, 11).<br />
ESprä = ä<br />
ä<br />
Um den Spontanremissionseffekt von d = .10 zu berücksichtigen, da keine Kontroll-<br />
gruppe vorliegt, werden die Ergebnisse dementsprechend nach unten korrigiert (vgl.
Methoden – Statistik<br />
Grawe et al., 1994; Hartmann & Herzog, 1995). Somit ergeben sich folgende Richtli-<br />
nien (nach Cohen, 1988):<br />
Mittelwertunterschiede:<br />
d ≥ .30 kleiner Effekt<br />
d ≥ .60 mittlerer Effekt<br />
d ≥ .90 großer Effekt<br />
Für Effektgrößen von Korrelationen und Regressionen werden nachfolgende Richtli-<br />
nien angewandt (Bortz, 2005; Cohen, 1988):<br />
Korrelation:<br />
r = ± .10 schwacher Zusammenhangseffekt<br />
r = ± .30 mittlerer Zusammenhangseffekt<br />
r = ± .50 großer Zusammenhangseffekt<br />
Regression (multiple Korrelationskoeffizienten):<br />
R² = .02 kleiner Effekt<br />
R² = .13 moderater Effekt<br />
R² = .26 starker Effekt.<br />
4.6 Operationalisierung der Hauptuntersuchung<br />
Ziel der Arbeit ist die Untersuchung der Kriteriumsvalidität der Strukturachse der OPD,<br />
d.h. die Prüfung inwieweit das Gesamtstrukturniveau Einfluss auf die Vorhersage des<br />
Kriteriums Therapieerfolg hat und ob der Beitrag des Prädiktors wirklich relevant ist<br />
(Hypothesen 1-6). Dazu wird zunächst geprüft, ob ein Therapieerfolg zum Post- und<br />
Katamnesezeitpunkt vorliegt, anschließend werden die Zusammenhänge von Prädiktor<br />
und Therapieerfolgskriterien untersucht und danach eine Regression mit dem Prädiktor<br />
auf die Kriterien durchgeführt und ermittelt, wie viel Varianz durch den Prädiktor aufge-<br />
klärt werden kann. Abschließend wird geprüft, ob der Beitrag auch bei Prüfung konkur-<br />
rierender Prädiktoren erhalten bleibt und wie die Prädiktoren optimal ausgewählt wer-<br />
den können. Zunächst wird die Operationalisierung der Kriterien und anschließend die<br />
der Prädiktoren vorgestellt.<br />
4.6.1 Kriterium „Therapieerfolg“<br />
In vorliegender Untersuchung findet eine Messung des Therapieerfolgs aufgrund der<br />
Heterogenität der Stichprobe hinsichtlich der Störungsbilder und Diagnosen aus-<br />
52
Methoden – Operationalisierung<br />
schließlich auf der Ebene der allgemeinen störungsübergreifenden Symptomatik und<br />
der Krankheitsfolgen statt (vgl. 4.6.1). Nach den Befunden von Michalak et al. (2003)<br />
erscheint es sowohl für die Forschung als auch für die Praxis unabdingbar, direkte und<br />
indirekte Erfolgsmaße zu erheben. Als indirektes Erfolgsmaß dient der Prä-Post-<br />
Differenzwert bzw. Prä-Kat-Differenzwert des GSI der SCL-90-R und als direktes Maß<br />
der VEV-K zum Post- bzw. Kat-Zeitpunkt. Zusätzlich geht der Statuswert des GSI der<br />
SCL-90-R zum Therapieende und Nachuntersuchungszeitpunkt ein. Beide Instrumente<br />
sind Selbstbeurteilungsinstrumente. Als Fremdbeurteilung geht die Therapeutinnenein-<br />
schätzung der Veränderung des psychischen Befindens ein. Neben diesen singulären<br />
Erfolgsmaßen geht zum Nachuntersuchungszeitpunkt das EMEK als multiples Ergeb-<br />
niskriterium ein. Tabelle 4.7 gibt einen Überblick über die erfassten Erfolgsmaße.<br />
Tabelle 4.7<br />
Therapieerfolgsmaße<br />
Selbstbeurteilung SCL-90-R-<br />
Prä-Post-Differenz<br />
SCL-90-R-Post<br />
Post Katamnese<br />
VEV-K SCL-90-R-<br />
Prä-Kat-Diff.<br />
SCL-90-R-Kat<br />
53<br />
VEV-K EMEK<br />
Fremdbeurteilung Therapeutinnen-<br />
rating<br />
Anmerkungen.<br />
VEV-K = Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens (siehe 4.3.4). SCL-90-<br />
R = GSI, Global Severity Index der Symptom Checklist (siehe 4.3.3). Therapeutinnenrating =<br />
Einschätzung der psychischen Veränderung durch die Therapeutin. EMEK = Einzelnes multiples<br />
Ergebniskriterium (siehe 2.2.3.1).<br />
4.6.1.1 Operationalisierung und Indexierung des EMEK<br />
Um den globalen Therapieerfolg auf breiterer Basis messen zu können, wird neben<br />
den singulären Kriterien zum Nachuntersuchungszeitpunkt explorativ ein EMEK zu-<br />
sammengestellt (siehe 2.2.3.1). Dazu werden 15 Einzelkriterien herangezogen, die mit<br />
„0 = negativ oder neutral“ (Verschlechterung oder keine Veränderung) und „1 = positiv“<br />
(Verbesserung) kodiert werden und aus deren Summe anschließend ein Erfolgsquoti-<br />
ent berechnet wird. Ziel ist die Aggregation einer Vielzahl bewertbarer Einzelaspekte<br />
zu einem Gesamtindex.<br />
4.6.1.1.1 Teilkriterien des EMEK<br />
Folgende Kriterien auf der Ebene des Krankseins und der Krankheitsfolgen (siehe<br />
2.2.3) gehen in die Berechnung ein. Die genaue Beschreibung der Dichotomisierung<br />
der einzelnen Variablen ist Anhang D zu entnehmen.
Methoden – Operationalisierung<br />
(1) Arbeitsunfähigkeit (AU, geht zweifach ein)<br />
(2) Medikamentenverbrauch<br />
(3) GSI der SCL-90-R (geht zweifach ein)<br />
(4) VEV-K<br />
4.6.1.1.2 Berechnung<br />
(5) Änderungen des körperlichen Befindens<br />
(6) Änderungen des psychischen Befindens<br />
(7) Änderungen des Selbstwerterlebens<br />
(8) Änderungen im sozialen Bereich<br />
(9) Änderungen im privaten Bereich<br />
(10) Änderungen in der Eigenaktivität<br />
(11) Änderungen in der Einstellung zur Zukunft<br />
(12) Änderungen im seelischen Wohlbefinden<br />
(13) Änderungen in der Bewältigung von Alltagsanforderungen<br />
Um die Katamnesedaten möglichst gut auszuschöpfen wird aufgrund der großen An-<br />
zahl fehlender Werte 8 ein Quotient der positiven und gültigen Werte (im Folgenden<br />
EMEK-Quotient) errechnet, der prozentual ausdrücken soll, wie ausgeprägt der globale<br />
Therapieerfolg ist. Dazu werden alle positiv bewerteten und relevanten Kriterien aus-<br />
gezählt und aufsummiert und die Summe der positiven durch die gültigen Kriterien ge-<br />
teilt. Für die Berechnung der Reliabilität und einer explorativen Faktorenanalyse wer-<br />
den die fehlenden Werte konservativ mit „0 = keine Veränderung“ (positives Kriterium<br />
ist nicht erfüllt) kodiert.<br />
4.6.1.1.3 Inhaltliche Bedeutung<br />
Bedingt durch die Konstruktion kann jede Patientin theoretisch einen Wert zwischen 0<br />
(0 % Erfolg = kein einziges Kriterium ist positiv bewertet) und 1 (100 % Erfolg = alle<br />
Kriterien sind positiv bewertet) erreichen.<br />
8<br />
Werte, die nicht relevant oder nicht vorliegend für einzelne Patientinnen waren, d.h. wenn z.B.<br />
weder vor noch nach der Behandlung Arbeitsunfähigkeit bestand.<br />
54
Methoden – Operationalisierung<br />
Hohe Skalenwerte stehen für:<br />
eine positive Veränderung im Erleben und Verhalten, d.h. einen Zugewinn an<br />
Entspannung, Gelassenheit und Optimismus<br />
weniger Medikamentenverbrauch<br />
weniger Arbeitsunfähigkeitstage<br />
eine Verbesserung:<br />
der Symptombelastung<br />
des körperlichen und psychischen Befindens<br />
des Selbstwertgefühls<br />
im sozialen und privaten Bereich (Beziehungen)<br />
der Bewältigung der Alltagsanforderungen<br />
der Eigenaktivität<br />
der Einstellung zur Zukunft<br />
des seelischen Wohlbefindens<br />
4.6.2 Prädiktor „Gesamtstrukturniveau“ und konkurrierende Prädiktoren<br />
Als Prädiktor zur Vorhersage dient die Einschätzung des Gesamtstrukturniveaus nach<br />
OPD-1. Erhoben wird dies im Rahmen der Eingangsdiagnostik mehrheitlich durch die<br />
jeweilige Bezugstherapeutin (siehe 4.3.2.1)<br />
Zusätzlich wird der Einfluss konkurrierender Prädiktoren untersucht, die sowohl das<br />
Therapieergebnis als auch die Vorhersage beeinflussen könnten. Den theoretischen<br />
und praktischen Prämissen aus 2.2.2 werden folgende Variablen zugeordnet:<br />
Arbeitsunfähigkeit Dauer Arbeitsunfähigkeit im Jahr vor der Behandlung<br />
Dauer der Erkrankung Dauer der Erkrankung in Monaten<br />
Schwere der Symptomatik<br />
GSI der SCL-90-R zu Behandlungsbeginn<br />
Summe des BSS zu Behandlungsbeginn<br />
Anzahl der Diagnosen<br />
Komorbidität: insbesondere Persönlichkeitsstörung komorbide Persön-<br />
lichkeitsstörung<br />
Motivation (starker Einsatz für die Therapie) Motivation zur Behandlung<br />
eingeschätzt von der Therapeutin<br />
Soziodemografische Variablen<br />
Geschlecht<br />
Alter<br />
55
Methoden – Operationalisierung Nebenuntersuchung<br />
4.7 Operationalisierung der Nebenuntersuchung<br />
Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Frage, ob der Anteil<br />
strukturell beeinträchtigter Patientinnen in einer therapeutischen Gruppe sich negativ<br />
auf den Therapieerfolg auswirkt (Hypothesen 7 und 8).<br />
4.7.1 Kriterium „Therapieerfolg“<br />
Als Kriterien für den Therapieerfolg dienen in der Nebenuntersuchung der SCL-90-R-<br />
Post-Wert und Prä-Post-Differenzwert, der VEV-K-Wert zum Therapieende, die Prä-<br />
Post-Differenz des BSS (siehe 4.3.1) und die Einschätzung der psychischen Verände-<br />
rung durch die Therapeutin zum Entlasszeitpunkt.<br />
4.7.2 Operationalisierung des „Anteils strukturell beeinträchtigter Patien-<br />
tinnen einer therapeutischen Gruppe“<br />
Die therapeutischen Gruppen sind halboffen, was bedeutet, dass sich die Zusammen-<br />
setzung wöchentlich durch An- und Abreisen der Patientinnen verändert. Um für jede<br />
Patientin zu berechnen, wie groß der Anteil geringer strukturierter Patientinnen (Ge-<br />
samtstrukturniveau ≥ 2.5) in ihrer Therapiegruppe während des Aufenthaltes ist, wird<br />
wochenweise der prozentuale Anteil dafür bestimmt. Dazu wurden aus den<br />
Patientinnenakten die Gruppenzusammensetzungen ausgezählt, d.h. bestimmt wie<br />
viele Patientinnen einer Gruppe während einer Woche Aufenthalt ein Gesamtstruktur-<br />
niveau von ≥ 2.5 oder < 2.5 aufwiesen.<br />
Der Anteil der geringer strukturierten Patientinnen wurde dann ins Verhältnis gesetzt<br />
zum Anteil der strukturell weniger beeinträchtigten Patientinnen. Beispielsweise hatten<br />
drei Patientinnen ein Gesamtstrukturniveau von ≥ 2.5 und insgesamt waren elf Patien-<br />
tinnen in dieser Woche in der Gruppe, das entspricht einem Anteil von 27.3 % geringer<br />
strukturierter Patientinnen (3 von 11). Diese Prozentwerte wurden für jede Woche der<br />
Gesamtaufenthaltsdauer der jeweiligen Patientin berechnet und anschließend für jede<br />
Patientin einzeln gemittelt. Dieser Gesamtmittelwert wird dann zur Berechnung als „An-<br />
teil strukturell beeinträchtigter Patientinnen einer therapeutischen Gruppe“ herangezo-<br />
gen.<br />
4.7.3 Prädiktoren<br />
Als Prädiktor zur Vorhersage dient „der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen<br />
einer therapeutischen Gruppe“ (im Folgenden: MW/Wochen). Zusätzlich wird der Ein-<br />
fluss konkurrierender Prädiktoren untersucht, die sowohl das Therapieergebnis als<br />
56
Methoden – Operationalisierung Nebenuntersuchung<br />
auch die Vorhersage beeinflussen könnten. Nach den theoretischen und praktischen<br />
Prämissen aus 2.2.2 werden folgende Variablen ausgewählt:<br />
Schwere der Symptomatik<br />
GSI der SCL-90-R zu Behandlungsbeginn<br />
Summe des BSS zu Behandlungsbeginn<br />
Gesamtstrukturniveau<br />
Soziodemografische Variablen<br />
Geschlecht<br />
Alter<br />
5 Ergebnisse<br />
Im Ergebnisteil werden zunächst die item- und faktorenanalytischen Untersuchungen<br />
des EMEK vorgestellt.<br />
Anschließend wird der Therapieerfolg, gemessen mit dem GSI der SCL-90-R und dem<br />
VEV-K zum Therapieende und zum Katamnesezeitpunkt berichtet, der als Vorausset-<br />
zung zur Prüfung der Kriteriumsvalidität dient. Dabei wird getrennt für gut bis mäßig<br />
strukturierte Patientinnen (Gesamtstrukturniveau ≤ 2.0) und für mäßig bis gering struk-<br />
turierte Patientinnen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5) untersucht, ob eine signifikante Ver-<br />
besserung stattgefunden hat, wie groß die gefundenen Effekte sind, wie diese einzu-<br />
ordnen sind und ob klinische Signifikanz für den Einzelfall vorliegt. Zum Therapieende<br />
werden als weitere Ergebniskriterien die Werte des Therapeutinnenratings einer psy-<br />
chischen Veränderung und zum Katamnesezeitpunkt die Werte des EMEKs berichtet<br />
(siehe 4.6.1).<br />
Darauf aufbauend werden die Ergebnisse in der Reihenfolge der Hypothesen (siehe<br />
3.2) berichtet, zunächst die der Hauptuntersuchung und abschließend die der Neben-<br />
untersuchung.<br />
5.1 EMEK<br />
5.1.1 Itemanalyse<br />
Das EMEK zeigt eine gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .84), die Trennschärfen<br />
der Einzelkriterien liegen zwischen .15 für Arbeitsunfähigkeit und .71 für Wohlbefinden<br />
(siehe Tabelle 5.1) und die mittlere Inter-Item-Korrelation liegt bei .26 (konservative<br />
Kodierung der fehlenden Werte mit 0, siehe 4.6.1.1.2). Nach Kodierung mit fehlenden<br />
57
Ergebnisse - EMEK<br />
Werten (nach welcher die Berechnung des EMEK-Quotienten erfolgt) ergibt sich ein<br />
mittlerer Wert der Mittelwerte der Einzelkriterien von .63 mit einer mittleren Standard-<br />
abweichung von .47 (siehe Tabelle 5.3).<br />
Tabelle 5.1<br />
Trennschärfen der Kriterien des EMEK und Werte für Cronbach´s α, wenn dieses Kriterium<br />
weggelassen wird<br />
TS<br />
58<br />
Cronbach´s α,<br />
wenn Kriterium weggelassen<br />
EMEK AU gesund .159 .846<br />
EMEK AU stat. besser .146 .848<br />
EMEK Mehr Medikamente .215 .846<br />
EMEK Änd. körperlich .440 .834<br />
EMEK Änd. psychisch .686 .820<br />
EMEK Änd. Selbstwert .574 .826<br />
EMEK Änd. sozial .434 .834<br />
EMEK Änd. privat .390 .837<br />
EMEK Änd. Eigenaktiv. .466 .832<br />
EMEK Einst. Zukunft .563 .826<br />
EMEK Wohlbefinden .709 .818<br />
EMEK Alltagsbewältig. .679 .819<br />
EMEK SCL gesund .433 .834<br />
EMEK SCL stat. besser .421 .835<br />
EMEK VEV-K-Kat .660 .820<br />
Anmerkungen.<br />
TS = Trennschärfe. Beschriftung und Kodierung der Einzelkriterien siehe 4.6.1.1.1.58 SCL gesund<br />
= Innerhalb des Normbereichs (0 - 0.69). SCL stat. besser = statistisch signifikante Verbesserung<br />
(- 0.30).<br />
Tabelle 5.2 gibt einen Überblick über die Werte aus der Analyse der Teilkriterien, die<br />
ins EMEK eingehen (konservative Kodierung).<br />
Tabelle 5.2<br />
Kennwerte der Einzelkriterien des EMEK<br />
Mittelwert Min Max<br />
EMEK-Quotient .66 0 1<br />
Kriterien-Mittelwerte .52 .15 .77<br />
Inter-Kriterien-Korr. .26 -.05 .78<br />
Kriterien-Skala-Korr. (TS) .47 .17 .71<br />
Anmerkungen.<br />
TS = Trennschärfe. Kriterien-Mittelwerte = Mittelwerte der Einzelkriterien. Kriterien-Varianzen =<br />
Varianzen der Einzelkriterien. Inter-Kriterien-Korr. = Inter-Einzelkriterien-Korrelationen.
Ergebnisse - EMEK<br />
Tabelle 5.3 sind die Anzahl an Fällen, für die die Kriterien relevant sind, die Mittelwerte<br />
und Standardabweichungen, die in den EMEK-Quotienten eingehen, zu entnehmen<br />
(Kodierung mit fehlenden Werten siehe 4.6.1.1.2).<br />
Tabelle 5.3<br />
N, Mittelwerte und Standardabweichungen der Einzelkriterien des EMEK-Quotienten<br />
N Mittelwert Standardabweichung<br />
EMEK AU gesund 57 .51 .50<br />
EMEK AU stat. besser 59 .64 .48<br />
EMEK Mehr Medik. 122 .44 .50<br />
EMEK Änd. körperlich 158 .66 .47<br />
EMEK Änd. psychisch 193 .78 .42<br />
EMEK Änd. Selbstwert 189 .73 .45<br />
EMEK Änd. sozial 137 .48 .50<br />
EMEK Änd. privat 182 .65 .48<br />
EMEK Änd. Eigenaktiv. 177 .71 .45<br />
EMEK Einst. Zukunft 175 .69 .46<br />
EMEK Wohlbefinden 194 .74 .44<br />
EMEK Alltagsbewältig. 180 .69 .46<br />
EMEK SCL gesund 196 .63 .48<br />
EMEK SCL stat. besser 149 .50 .50<br />
EMEK VEV-K-Kat 196 .61 .49<br />
Alle Kriterien relevant 22<br />
MW .63 .47<br />
Range .44-.78 .42-.50<br />
Anmerkungen.<br />
Beschriftung siehe 4.6.1.1.1.<br />
5.1.2 Faktorenanalyse<br />
Um zu untersuchen welche Kriterien eventuell gemeinsame Ergebnisaspekte abbilden<br />
und wie sich die Variablen einordnen und strukturieren lassen, wird zu rein deskriptiven<br />
Zwecken eine Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Promax-Rotation be-<br />
rechnet. Die Kriterienauswahl orientierte sich, wie in Operationalisierung und Indexie-<br />
rung des EMEK erläutert, an rein inhaltlichen und praktischen Erfordernissen, die sta-<br />
tistische Überprüfung erfolgte im Nachhinein.<br />
Der Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient liegt bei .85 und damit im akzeptablen Bereich. Der<br />
Bartlett-Test auf Sphärizität (χ² ~ 1020.7) wird signifikant.<br />
Die Faktorenextraktion erfolgte nach dem Eigenwertkriterium (Kaiser-Guttman-<br />
Kriterium), Screetest (siehe Abbildung D-1 in Anhang D) und MAP-Test. Es ergibt sich<br />
59
Ergebnisse - EMEK<br />
eine 3 Faktoren Lösung, der 1. Faktor erklärt 34.0 %, der 2. Faktor 12.2 % und der 3.<br />
Faktor 7.1 % der Varianz.<br />
Tabelle 5.4<br />
Strukturmatrix, Mustermatrix und Kommunalitäten einer Hauptkomponentenanalyse mit<br />
Promax-Rotation des EMEK<br />
Mustermatrix Strukturmatrix<br />
Faktoren Faktoren Kommu-<br />
nalitäten<br />
1 2 3 1 2 3<br />
Kriterien r²* r²* r²* r# r# r#<br />
EMEK AU gesund .928 .930 .864<br />
EMEK AU stat. besser .929 .928 .866<br />
EMEK Mehr Medik. .273 .227 .248 .132 .228 .114<br />
EMEK Änd. körperlich .785 -.238 .637 .244 .446<br />
EMEK Änd. psychisch .522 .357 .742 .677 .630<br />
EMEK Änd. Selbstwert .468 .313 -.126 .660 .598 -.113 .510<br />
EMEK Änd. sozial .781 -.266 .617 .217 .427<br />
EMEK Änd. privat .314 .200 .438 .396 .222<br />
EMEK Änd. Eigenaktiv. .707 -.126 .630 .310 .407<br />
EMEK Einst. Zukunft .617 .125 .622 .455 .132 .457<br />
EMEK Wohlbefinden .625 .282 .798 .665 .689<br />
EMEK Alltagsbewältig. .676 .139 .107 .762 .559 .116 .605<br />
EMEK SCL gesund -.234 .901 .322 .758 .609<br />
EMEK SCL stat. besser -.188 .840 .330 .725 .549<br />
EMEK VEV-K-Kat .344 .523 .667 .734 .615<br />
Eigenwert nach Rotation (6.534) (4.185) (2.442) 7.513 6.470 2.447 ##<br />
Varianzaufklärung nach<br />
Rotation<br />
Anmerkungen.<br />
34.0% 12.2% 7.2% 34.0% 12.2% 7.2% ##<br />
*Partielle standardisierte Regressionsgewichte der Einzelkriterien mit den rotierten Faktoren<br />
(aus Mustermatrix).# = Korrelation zwischen Einzelkriterium und rotiertem Faktor (aus Strukturmatrix).##<br />
= Da die Faktoren korreliert sind, kann die Gesamtvarianz nicht durch die Summe<br />
angegeben werden.<br />
Wie Tabelle 5.4 zu entnehmen ist, kann der erste Faktor als eine Art Generalfaktor<br />
bezeichnet werden, auf dem alle Kriterien bis auf „Arbeitsunfähigkeit“ mehr oder weni-<br />
ger laden, neun Faktoren laden über .50. Eher höhere Ladungen zeigen sich für die<br />
einzelnen Selbsteinschätzungen, die Fragebögen laden deutlich höher auf dem zwei-<br />
ten Faktor, wenn dieser auch nicht unabhängig vom 1. Faktor ist, insbesondere zeigt<br />
sich das für den VEV-K. Der 3. Faktor lädt besonders hoch auf der Arbeitsunfähigkeit,<br />
welche auf den anderen Faktoren nur sehr gering oder gar nicht lädt und somit eine<br />
Einfachstruktur aufweist.<br />
Alle Einzeleinschätzungen (außer AU) wie „Mehr Medikamente“, „Änderungen des kör-<br />
perlichen Befindens“, „Änderungen des psychischen Befindens“ (psychische Störung),<br />
„Änderungen im Selbstwert“, „Änderungen im sozialen und privaten Bereich“, „Ände-<br />
rungen der Eigenaktivität und Einstellung zur Zukunft“, „Änderungen im Wohlbefinden<br />
60
Ergebnisse - EMEK<br />
und der Alltagsbewältigung“ laden auf mindestens zwei Faktoren und können keinem<br />
der Faktoren eindeutig zugeordnet werden.<br />
Der Eigenwert des 1. Faktors liegt nach der Rotation bei 6.53, für den 2. Faktor liegt<br />
dieser bei 4.19 und für den 3. Faktor bei 2.44.<br />
Die Kommunalitäten zeigen, dass die Kriterien bis auf „Mehr Medikamente“ und „Ände-<br />
rung privat“ durch die Faktoren ausreichend repräsentiert werden.<br />
5.2 Therapieerfolg<br />
Der Therapieerfolg zum Therapieende und Katamnesezeitpunkt wird gemessen mit<br />
dem Rohwert des GSI der SCL-90-R (signifikante Reduktion) und dem VEV-K (rele-<br />
vante Veränderung). Für den GSI werden die Ergebnisse der Einzelfalltestung hinsicht-<br />
lich klinischer Signifikanz berichtet. Zum Therapieende wird zusätzlich eine Einschät-<br />
zung der Therapeutin bezüglich der Veränderung des psychischen Befindens berichtet.<br />
Alle Ergebnisse werden für die SP1 und getrennt für die beiden Gruppen Gesamtstruk-<br />
turniveau ≥ 2.5 und Gesamtstrukturniveau < 2.5 dargestellt. Die Untergruppe mit Ge-<br />
samtstrukturniveau ≥ 2.5 (geringer integriert) wird im Folgenden mit Gruppe I bezeich-<br />
net, die Untergruppe mit Gesamtstrukturniveau < 2.5 (höher integriert) mit Gruppe II.<br />
5.2.1 Therapieerfolg gemessen mit dem GSI-Rohwert der SCL-90-R<br />
Tabelle 5.5 gibt die Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) für SP1 und die<br />
beiden Gruppen I und II zu den drei Messzeitpunkten, zu Behandlungsbeginn (Prä),<br />
zum Entlasszeitpunkt (Post) und ca. ein Jahr danach (Kat) und die Signifikanz der Mit-<br />
telwertunterschiede aus der Varianzanalyse der GSI-Rohwerte der SCL-90-R wieder.<br />
Tabelle 5.5<br />
Therapieerfolg gemessen mit dem GSI-Rohwert der SCL-90-R in SP1<br />
Therapieerfolg (Testkriterium: GSI-Rohwert der SCL-90-R)<br />
M-Prä SD-Prä M-Post SD-Post M-Kat SD-Kat Signifikanz N<br />
I 1.25 0.63 0.90 0.70 0.89 0.57 .000 31<br />
II 1.13 0.56 0.57 0.36 0.63 0.51 .000 165<br />
SP1 1.15 0.57 0.62 0.44 0.67 0.53 .000 196<br />
Der Mittelwert der SCL-90-R reduzierte sich für alle Patientinnen von 1.15 zu Thera-<br />
piebeginn auf 0.62 zu Therapieende. Sowohl für die Stichprobe insgesamt als auch für<br />
die jeweiligen Gruppen wird das Ergebnis des Tests auf Mittelwertunterschiede hoch-<br />
signifikant (p ≤ .000). Zum Katamnesezeitpunkt wird eine leichte Erhöhung der<br />
Symptombelastung von 0.62 auf durchschnittlich 0.67 verzeichnet. Für die Gruppe der<br />
61
Ergebnisse - Therapieerfolg<br />
geringer Integrierten zeigt sich dies jedoch nicht, sondern diese verbessern sich mini-<br />
mal um 0.01 Punkte. Für beide Gruppen ergibt sich von der Entlassung bis zum<br />
Katamnesezeitpunkt jedoch keine signifikante Änderung. Der Test auf Gruppenunter-<br />
schiede wird signifikant (p = .002), der entscheidende Faktor der Wechselwirkung zwi-<br />
schen Gruppe und Zeit jedoch nicht, was bedeutet, dass sich die Gruppen zwar signifi-<br />
kant unterscheiden, aber in beiden Gruppen von einem Therapieerfolg zum Therapie-<br />
ende und zum Katamnesezeitpunkt ausgegangen werden kann.<br />
Tabelle 5.6<br />
Effektgrößen im Verlauf Prä/Post, Post/Kat und Prä/Kat in SP1<br />
Effektgrößen*<br />
Prä/Post Post/Kat Prä/Kat N<br />
I 0.56 0.01 0.57 31<br />
II 1.00 - 0.17 0.89 165<br />
SP1 0.93 - 0.11 0.84 196<br />
Anmerkungen.<br />
*Effektgrößen berechnet mit ESPrä (siehe 4.5.2), bei Post/Kat wird der zweite Messzeitpunkt<br />
zum 1. Zeitpunkt des Vergleichs, d.h. die Berechnung erfolgte mit SD-Post.<br />
Für Gruppe II ergibt sich ein großer Effekt zum Behandlungsende, der zum<br />
Katamnesezeitpunkt leicht absinkt und ein fast großer Effekt wird. In Gruppe I ist ein<br />
kleiner bis mittlerer Effekt sowohl zum Therapieende als auch ein Jahr danach festzu-<br />
stellen. Der Effekt ist kleiner als in Gruppe II, steigt jedoch leicht an und ist insgesamt<br />
stabiler. Für die gesamte SP1 zeigt sich zur Entlassung ein großer Effekt, der danach<br />
etwas absinkt und ein Jahr später als mittlerer bis großer Effekt einzustufen ist (siehe<br />
Tabelle 5.6).<br />
In Tabelle 5.7 sind zuerst die Ergebnisse zur klinischen Signifikanz bei Therapieende<br />
aufgeführt, anschließend in Tabelle 5.8 die klinische Signifikanz zum<br />
Katamnesezeitpunkt. Daraus lässt sich erkennen, ob, gemessen mit der SCL-90-R,<br />
auch auf Einzelfallebene statistische oder klinische Bedeutsamkeit vorliegt (siehe<br />
4.5.1).<br />
62
Ergebnisse - Therapieerfolg<br />
Tabelle 5.7<br />
Klinische Signifikanz von Prä nach Post gemessen mit dem GSI der SCL-90-R in SP1<br />
Testnormal Unverändert Verschlechtert Verbessert Geheilt<br />
I# 10.0 % 25.8 % 12.9 %* 12.9 % 38.7 %<br />
II# 22.4 % 17.0 % 1.8 %* 18.8 % 40.0 %<br />
SP1 20.4 % 18.4 % 3.6 % 17.9 % 39.8 %<br />
Anmerkungen.<br />
#Prozente innerhalb der Untergruppen.<br />
*Signifikante Unterschiede zwischen den Untergruppen (p ≤ .01).<br />
20.4 % der Patientinnen waren sowohl vor als auch nach der Behandlung hinsichtlich<br />
des GSI der SCL-90-R klinisch unauffällig, d.h. im Bereich der Gesundennorm. 18.4 %<br />
sind als unverändert einzuordnen, 3.6 % haben sich statistisch signifikant verschlech-<br />
tert, d.h. bei Entlassung eine größere Symptombelastung als vor der Behandlung. Sta-<br />
tistisch verbessert haben sich 17.9 % und sowohl statistisch signifikant als auch kli-<br />
nisch relevant verbessert haben sich 39.8 %. In den Untergruppen zeigt sich ein insge-<br />
samt ähnliches Bild, in der Gruppe der geringer Integrierten gibt es mehr „Verschlech-<br />
terte“ oder „Unveränderte“ sowie weniger Patientinnen, die keine relevante psychische<br />
Belastung angeben und statistisch signifikant verbessert sind. Die Erfolgsrate bei den<br />
„Geheilten“ liegt in einem ähnlichen Bereich bei 38.7 %. Signifikante Unterschiede zwi-<br />
schen den Gruppen zeigen sich nur für den Prozentsatz der „Verschlechterten“.<br />
Tabelle 5.8<br />
Klinische Signifikanz von Prä nach Kat gemessen mit dem GSI der SCL-90-R in SP1<br />
Testnormal Unverändert Verschlechtert Verbessert Geheilt<br />
I# 12.9 % 16.1 % 16.1 %* 19.4 % 35.5 %<br />
II# 21.8 % 18.8 % 4.8 %* 13.3 % 41.2 %<br />
SP1 20.4 % 18.4 % 6.6 % 14.5 % 40.3 %<br />
Anmerkungen.<br />
#Prozente innerhalb der Untergruppen.<br />
*Signifikante Unterschiede zwischen den Untergruppen (p ≤ .05).<br />
Im Vergleich zum Therapieende ergeben sich geringe Veränderungen bei den „Ver-<br />
schlechterten“, hier steigt der Prozentsatz von 3.6 % auf 6.6 %. Der Anteil der statis-<br />
tisch signifikant „Verbesserten“ sinkt leicht auf 14.5 %, der Anteil der „Geheilten“ steigt<br />
geringfügig auf 40.3 % und der Anteil der „Unveränderten“ bleibt mit 18.4 % konstant.<br />
Für die Untergruppen sind die Ergebnisse ähnlich wie zum Therapieende, allerdings<br />
sinkt der Anteil der als „Geheilt“ eingestuften Patientinnen bei den geringer Integrierten,<br />
während er für die strukturell weniger Beeinträchtigten ansteigt. Signifikante Unter-<br />
schiede zwischen den Gruppen zeigen sich auch zum Nachuntersuchungszeitpunkt<br />
nur für den Prozentsatz der „Verschlechterten“.<br />
63
Ergebnisse - Therapieerfolg<br />
Insgesamt kann nach den Maßstäben der klinischen Signifikanz und den Effektstärken<br />
sowohl zum Zeitpunkt des Therapieendes als auch zum Katamnesezeitpunkt von ei-<br />
nem Therapieerfolg für die Mehrzahl der Patientinnen ausgegangen werden.<br />
5.2.2 Therapieerfolg gemessen mit dem VEV-K<br />
Als Therapieerfolg, gemessen mit dem VEV-K, wird eine statistisch bedeutsame positi-<br />
ve Veränderung im Erleben und Verhalten zum Therapieende und zum<br />
Katamnesezeitpunkt im Vergleich zum Therapiebeginn gewertet. Tabelle 5.9 gibt die<br />
Mittelwerte und die Standardabweichungen des VEV-K zum Therapieende sowie die<br />
prozentualen und absoluten Häufigkeiten der Veränderungen wieder. Anschließend<br />
werden in Tabelle 5.10 die Ergebnisse für den Katamnesezeitpunkt berichtet. Von ei-<br />
nem Therapieerfolg kann ausgegangen werden, wenn der Gesamtmittelwert des VEV-<br />
K den kritischen Wert von 115 überschreitet, von einer Verschlechterung, wenn der<br />
Wert unter 85 liegt, zwischen 85 und 115 von keiner Veränderung und eine sehr signi-<br />
fikante Verbesserung (p ≤ .01) bei einem Wert > 120 (siehe 4.3.4).<br />
Tabelle 5.9<br />
Therapieerfolg zum Therapieende gemessen mit dem VEV-K in SP1<br />
M-Post SD-<br />
Post<br />
Post-Therapieerfolg (Testkriterium: VEV-K)<br />
Verschlech-<br />
terung<br />
I 126.32* 32.51 9.7 %<br />
(n = 3)<br />
II 137.27* 22.37 3.0 %<br />
(n = 5)<br />
SP1 135,54 24.48 4.1 %<br />
(n = 8)<br />
Keine Veränderung<br />
12.9 %<br />
(n = 4)<br />
13.9 %<br />
(n = 23)<br />
13.8 %<br />
(n = 27)<br />
Anmerkungen.<br />
* Signifikante Unterschiede zwischen den Untergruppen (p ≤ .05).<br />
64<br />
Verbesserung<br />
auf p ≤ .05<br />
12.9 %<br />
(n = 4)*<br />
3.0 %<br />
(n = 5)*<br />
4.6 %<br />
(n = 9)<br />
Verbesserung<br />
auf p ≤ .01<br />
64.5 %<br />
(n = 20)*<br />
80.0 %<br />
(n = 132)*<br />
77.6%<br />
(n = 152)<br />
Für 82.2% der Patientinnen ergibt sich eine Verbesserung gemessen mit dem VEV-K,<br />
für 77.6 % sogar eine sehr signifikante Verbesserung. Bei den geringer Integrierten ist<br />
der Mittelwert kleiner, aber mit größerer Varianz, insgesamt ergibt sich in dieser Grup-<br />
pe für 77.4 % eine Verbesserung. In Gruppe II zeigt sich insgesamt eine Verbesserung<br />
für 83 % der Patientinnen. Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen ergeben<br />
sich sowohl für den Mittelwertvergleich als auch innerhalb der Verteilungen. Die „Ver-<br />
besserten“ und „sehr signifikant Verbesserten“ unterscheiden sich signifikant, die „Ver-<br />
schlechterten“ und „nicht Veränderten“ nicht.
Ergebnisse - Therapieerfolg<br />
Tabelle 5.10<br />
Therapieerfolg zum Nachuntersuchungszeitpunkt gemessen mit dem VEV-K in SP1<br />
M-Kat SD- Verschlech-<br />
Kat terung<br />
I 112.19 30.57 16.1 %<br />
(n = 5)<br />
II 122.67 28.07 9.1 %<br />
(n = 15)<br />
SP1 121.02 28.66 10.2 %<br />
(n = 20)<br />
Kat-Therapieerfolg (Testkriterium: VEV-K)<br />
Keine Veränderung<br />
35.5 %<br />
(n = 11)<br />
27.9 %<br />
(n = 46)<br />
29.1 %<br />
(n = 57)<br />
65<br />
Verbesserung<br />
auf p ≤ .05<br />
6.5 %<br />
(n = 2)<br />
7.3 %<br />
(n = 12)<br />
7.1 %<br />
(n = 14)<br />
Verbesserung<br />
auf p ≤ .01<br />
41.9 %<br />
(n = 13)<br />
55.8 %<br />
(n = 92)<br />
53.6 %<br />
(n = 105)<br />
Zum Katamnesezeitpunkt ergibt sich für 60.7 % der Patientinnen eine Verbesserung im<br />
Erleben und Verhalten, für 53.6 % sogar eine sehr signifikante Verbesserung. In Grup-<br />
pe I geben 48.4 % eine Verbesserung an, in Gruppe II 63.1 %. Eine Verschlechterung<br />
zeigt sich insgesamt nur für 10.2 % der Patientinnen. Die Gesamtmittelwerte liegen<br />
jeweils über dem kritischen Wert, mit Ausnahme von Gruppe I zum Nachuntersu-<br />
chungszeitpunkt. Zwischen den beiden Gruppen bestehen sowohl für die Mittelwerte<br />
als auch die Verteilungen keine signifikanten Unterschiede, für die Mittelwerte ist ein<br />
Trend (p = .062) zu verzeichnen.<br />
Zusammenfassend kann sowohl für das Therapieende als auch zum<br />
Katamnesezeitpunkt für SP1 von einem Therapieerfolg, gemessen mit dem VEV-K,<br />
ausgegangen werden.<br />
5.2.3 Therapieerfolg gemessen mit der Einschätzung der Änderung des<br />
psychischen Befindens durch die Therapeutin zum Therapieende<br />
Die „Einschätzung der Änderungen im psychischen Befinden der Patientinnen“ seitens<br />
der Therapeutinnen bewegt sich auf einer 5-stufigen Skala von „1 = deutlich<br />
verschlechtert“, „2 = etwas verschlechtert“, „3 = nicht verändert“, „4 = etwas gebessert“<br />
und „5 = deutlich gebessert“. Der Mittelwert liegt bei 4.72, die Standardabweichung bei<br />
0.56. Die Einschätzung „etwas verschlechtert“ wurde nicht vergeben.<br />
Abbildung 5.1 sind die Häufigkeiten der Einschätzungen zu entnehmen, jeweils für die<br />
Gruppen I und II und für die SP1. Für 183 von 189 (96.8 % von 189) vorhandenen Ein-<br />
schätzungen kann von einer Verbesserung ausgegangen werden. 0.5 % haben sich<br />
deutlich verschlechtert, 2.6 % nicht verändert. Die Ausfälle bewirken eine Verringerung<br />
der Stichprobengröße um 3.2 %. Zwischen den Gruppen bestehen hinsichtlich der<br />
Einschätzung der psychischen Veränderung signifikante Unterschiede und zwar
Ergebnisse - Therapieerfolg<br />
hinsichtlich der „deutlich Verschlechterten“ (p = .021) und der „Unveränderten“<br />
(p = .006).<br />
80,0%<br />
70,0%<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
Abbildung 5.1<br />
Häufigkeiten der „Einschätzung der Veränderungen im psychischen Befinden der Patientinnen“<br />
durch ihre Therapeutin am Ende der Therapie. Fehlende Werte: N = 7<br />
(3.6 %) in SP1; N = 6 in Gruppe I; N = 1 in Gruppe II<br />
5.2.4 Therapieerfolg gemessen mit dem EMEK<br />
Theoretisch liegt die Verteilung des EMEK zwischen 0 und 1, es wird ein mittlerer Wert<br />
in SP1 von 0.66 (SD = 0.32) erreicht. In Gruppe I ergibt sich ein Mittelwert von 0.57<br />
(SD = 0.33) und in Gruppe II ein Mittelwert von 0.68 (SD = 0.31). Der Test auf Grup-<br />
penunterschiede wird nicht signifikant, nur tendenziell (p = .08). In Anhang D wird die<br />
Verteilung der einzelnen Patientinnenwerte in Abbildung D-2 grafisch veranschaulicht.<br />
Daraus lässt sich für die Mehrheit der Patientinnen ein eher günstiges katamnestisches<br />
Gesamtbild erkennen. Bei Einteilung der Werte des EMEK-Quotienten in Viertel (0-<br />
0.25; 0.26-0.50; 0.51-0.75; 0.76-1.00; Begründung: Vergleichbarkeit mit der Studie von<br />
Schmidt, 1991) liegen die Werte für Gruppe I unter den Werten für Gruppe II. Im<br />
EMEK-Bereich von 0.76 - 1.00, d.h. im obersten Viertel, liegen in Gruppe I nur 32.3 %<br />
im Vergleich zu 53.9 % für Gruppe II. Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen<br />
bestehen ebenfalls nur für diesen EMEK-Bereich von 0.76 - 1.00 (p = .027). Es folgt in<br />
Abbildung 5.2 die Darstellung dieser Einteilung der Werte des EMEK für die SP1 und<br />
Gruppe I und II.<br />
Änderung psychisches Befinden (Therapeutin)<br />
3%<br />
0,5% 0%<br />
Deutlich<br />
verschlechtert<br />
2,6%<br />
10%<br />
1%<br />
66<br />
19% 20%<br />
16%<br />
74%<br />
68%<br />
75%<br />
Nicht verändert Etwas gebessert Deutlich gebessert<br />
SP1<br />
Gruppe I<br />
Gruppe II
Ergebnisse - Therapieerfolg<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
Abbildung 5.2<br />
Häufigkeiten des EMEK-Quotienten (in Viertel des Wertebereichs unterteilt) für SP1,<br />
Gruppe I und Gruppe II<br />
5.2.5 Zusammenfassung<br />
Sowohl zum Therapieende als auch und zum Nachuntersuchungszeitpunkt kann die<br />
Voraussetzung des Therapieerfolgs zur Prüfung der Kriteriumsvalidität als gegeben<br />
angesehen werden. Zur Interpretation der Ergebnisse wird auf das Kapitel 6 verwiesen.<br />
5.3 Zu den Hypothesen 1 und 2<br />
Entsprechend der Fragestellungen 1 und 2 (Hypothesen 1 und 2) wird ein Zusammen-<br />
hang zwischen der Einschätzung des Gesamtstrukturniveaus und dem Therapieerfolg<br />
angenommen, d.h. je höher (geringer integriert) das Gesamtstrukturniveau, desto ge-<br />
ringer sollte der Therapieerfolg ausfallen. In Hypothese 1 wird dieser Zusammenhang<br />
zum Zeitpunkt der Entlassung und in Hypothese 2 zum Nachuntersuchungszeitpunkt<br />
angenommen.<br />
18,9%<br />
16,3%<br />
14,3%<br />
5.3.1 Zu Hypothese 1<br />
EMEK Häufigkeiten<br />
50,5%<br />
25,8%<br />
22,6%<br />
19,3%<br />
32,3%<br />
17,6%<br />
15,3%<br />
13,3%<br />
SP1 Gruppe I Gruppe II<br />
0-0.25 0.26-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00<br />
53,9%<br />
In den Hypothesen 1a-d wird ein Zusammenhang zwischen dem Gesamtstrukturni-<br />
veau und dem Therapieerfolg gemessen mit der Prä-Post-Differenz der SCL-90-R, mit<br />
dem Post-Wert der SCL-90-R, dem VEV-K-Post-Wert und dem Therapeutinnenrating,<br />
erwartet. Je höher der Wert für das Gesamtstrukturniveau ist, desto geringer sollte der<br />
Therapieerfolg ausfallen, daher erfolgt die Überprüfung der Hypothesen gerichtet. Zur<br />
67
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Absicherung werden neben den Pearson-Korrelationen auch die Korrelationen nach<br />
Spearman berichtet, die Entscheidung erfolgt anhand der Pearson-Korrelation (siehe<br />
4.5) Die Zusammenhänge werden in Tabelle 5.11 dargestellt.<br />
Tabelle 5.11<br />
Korrelationen des Gesamtstrukturniveaus mit der Prä-Post-Differenz der SCL-90-R,<br />
dem Post-Wert der SCL-90-R, dem VEV-K-Post und dem Therapeutinnenrating der<br />
Veränderung des psychischen Befindens in SP1<br />
Gesamtstrukturniveau Gesamtstrukturniveau<br />
(Pearson-Korrelation) (Spearman-Korrelation)<br />
SCL-Prä-Post-Differenz -.127* -.120*<br />
SCL-Post-Wert .259** .213**<br />
VEV-K-Post-Wert -.149* -.145*<br />
Therapeutinnenrating<br />
Anmerkungen.<br />
-.062 ns .020 ns<br />
*= signifikant auf dem Niveau von .05. **= signifikant auf dem Niveau von .01. ns = nicht signifikant.<br />
Für die Gesamtsymptombelastung bei Entlassung ergibt sich ein sehr signifikanter Zu-<br />
sammenhang, der in die richtige Richtung weist, d.h. strukturell mehr beeinträchtigte<br />
Patientinnen sind auch höher belastet. Ein höheres Gesamtstrukturniveau hängt mit<br />
einer geringeren Reduzierung der Symptombelastung und einer geringeren Verände-<br />
rung im VEV-K zusammen, d.h. weniger Zugewinne an Entspannung, Optimismus und<br />
Gelassenheit, was insgesamt für die Annahme der Hypothesen 1a-c spricht. Das<br />
Therapeutinnenrating der Veränderung des psychischen Befindens zeigt keinen Zu-<br />
sammenhang mit dem Gesamtstrukturniveau, hierfür muss Hypothese 1d verworfen<br />
werden.<br />
5.3.2 Zu Hypothese 2<br />
Analog zu Hypothese 1 wird in den Hypothesen 2a-d ein Zusammenhang von<br />
Gesamtstrukturniveau und Therapieerfolg zum Katamnesezeitpunkt, gemessen mit der<br />
Prä-Kat-Differenz und dem Kat-Wert der SCL-90-R, dem VEV-K-Kat-Wert und dem<br />
EMEK-Quotienten angenommen, der in Tabelle 5.12 dargestellt ist.<br />
68
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.12<br />
Korrelationen des Gesamtstrukturniveaus mit der Prä-Kat-Differenz der SCL-90-R,<br />
dem Kat-Wert der SCL-90-R, dem VEV-K-Kat-Wert und dem EMEK-Quotienten in SP1<br />
Gesamtstrukturniveau Gesamtstrukturniveau<br />
(Pearson-Korrelation) (Spearman-Korrelation)<br />
SCL-Prä-Kat-Differenz -.060 ns -.120*<br />
SCL-Kat-Wert .152* .213**<br />
VEV-K-Kat-Wert -.119* -.097 ns<br />
EMEK-Quotient<br />
Anmerkungen.<br />
-.084 ns -.058 ns<br />
*= signifikant auf dem Niveau von .05. **=signifikant auf dem Niveau von .01. ns = nicht signifikant.<br />
Für die Symptombelastung ein Jahr nach dem Klinikaufenthalt und die Veränderung im<br />
VEV-K ergibt sich nach Pearson ein signifikanter Zusammenhang in die richtige Rich-<br />
tung, was für die Hypothesen 2b und 2c spricht. Auch zum Nachuntersuchungszeit-<br />
punkt sind strukturell beeinträchtigte Patientinnen mehr belastet und verfügen über<br />
weniger Zugewinne an Entspannung, Optimismus und Gelassenheit. Die Reduzierung<br />
der Symptombelastung und der EMEK-Quotient zeigen keinen Zusammenhang mit<br />
dem Gesamtstrukturniveau, weshalb die Hypothesen 2a und 2d verworfen werden<br />
müssen. Nach Spearman zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang mit der Prä-Kat-<br />
Differenz der SCL-90-R und dem Kat-Wert der SCL-90-R.<br />
5.4 Zu den Hypothesen 3 und 4<br />
In den Hypothesen 3a-d und 4a-d wird erwartet, dass das Gesamtstrukturniveau ei-<br />
nen signifikanten Beitrag zur Vorhersage des Therapieerfolgs zum Therapieende und<br />
Nachuntersuchungszeitpunkt leistet.<br />
5.4.1 Zu Hypothese 3<br />
Hypothese 3d kann aufgrund der nicht signifikanten Korrelation beider Werte verworfen<br />
werden. Tabelle 5.13 zeigt die Ergebnisse der Regressionsanalysen mit dem Prädiktor<br />
„Gesamtstrukturniveau“ und den Kriterien SCL-90-R-Prä-Post-Differenz bzw. -Post-<br />
Wert und dem VEV-K-Post-Wert.<br />
69
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.13<br />
Regressionsanalysen mit dem Prädiktor „Gesamtstrukturniveau“ und den Kriterien Prä-<br />
Post-Differenz und Post-Wert der SCL-90-R und dem VEV-K-Post-Wert in SP1<br />
Kriterium R-Quadrat Beta Signifikanz<br />
SCL-Prä-Post-Differenz .016 -.127 .076°<br />
SCL-Post-Wert .067 .259 .000***<br />
VEV-K-Post-Wert .022 -.149 .037*<br />
Anmerkungen.<br />
° = Trend auf dem Niveau von .10. * = signifikant auf dem Niveau von .05. *** = signifikant auf<br />
dem Niveau von .001.<br />
Den größten Beitrag erbringt das Gesamtstrukturniveau zur Vorhersage des SCL-Post-<br />
Wertes mit einem R-Quadrat von .067 und einem Beta-Wert von .259, was einer Va-<br />
rianzaufklärung von 6.7 % entspricht und einem kleinen Effekt. Sowohl zum Kriterium<br />
SCL-Post-Wert als auch zum VEV-K-Post-Wert ist der Beitrag signifikant, was für die<br />
Hypothesen 3b und 3c spricht, die Hypothesen 3a und 3d müssen dagegen verworfen<br />
werden. Ein Trend ist jedoch auch für die SCL-90-R-Differenz zu verzeichnen.<br />
5.4.2 Zu Hypothese 4<br />
In den Hypothesen 4a-d wird analog zu Hypothese 3 erwartet, dass der Prädiktor<br />
„Gesamtstrukturniveau“ einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage des „Therapieer-<br />
folgs“ zum Katamnesezeitpunkt leistet. Aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse der<br />
Signifikanzprüfung der Korrelationen in 5.3.2 wird eine Regression für alle signifikant<br />
gewordenen Ergebnisse berechnet. Hypothese 4d kann aufgrund der nicht signifikan-<br />
ten Korrelation beider Werte verworfen werden.<br />
Tabelle 5.14 stellt die Ergebnisse der Regressionsanalysen des Prädiktors „Gesamt-<br />
strukturniveau“ mit den Kriterien SCL-90-R-Prä-Kat-Differenz bzw. -Kat-Wert und dem<br />
VEV-K-Kat-Wert dar.<br />
Tabelle 5.14<br />
Regressionsanalysen mit dem Prädiktor „Gesamtstrukturniveau“ und den Kriterien Prä-<br />
Kat-Differenz und Kat-Wert der SCL-90-R und dem VEV-K-Kat-Wert in SP1<br />
Kriterium R-Quadrat Beta Signifikanz<br />
SCL-Prä-Kat-Differenz .004 .066 .427 ns<br />
SCL-Kat-Wert .023 .152 .033*<br />
VEV-K-Kat-Wert .014 -.119 .097°<br />
Anmerkungen.<br />
° = Trend auf dem Niveau von .10. *= signifikant auf dem Niveau von .05. ns = nicht signifikant.<br />
Hier zeigt sich, dass lediglich zur Vorhersage des SCL-90-R-Kat-Wertes ein signifikan-<br />
ter Beitrag von 0.23 geleistet wird, was einer Varianzaufklärung von 2.3 % entspricht<br />
70
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
und einem kleinen Effekt, der zudem kleiner ausfällt als zum Entlasszeitpunkt. Für den<br />
VEV-K-Kat-Wert zeigt sich zusätzlich ein Trend eines Einflusses auf die Vorhersage.<br />
Somit kann nur Hypothese 4b angenommen werden, die Hypothesen 4a und 4c müs-<br />
sen, ebenso wie Hypothese 4d, verworfen werden.<br />
5.5 Zu den Hypothesen 5 und 6<br />
Mithilfe der Hypothesen 5 und 6 soll geprüft werden, ob sich der Beitrag des Prädik-<br />
tors „Gesamtstrukturniveau“ bei gleichzeitiger Regression konkurrierender Prädiktoren<br />
(siehe 4.6.2) verändert und wie die Prädiktoren zur Vorhersage optimal ausgewählt<br />
werden können. Dazu werden zunächst die Mittelwerte und Standardabweichungen<br />
der Prädiktoren, dann die Interkorrelationen der Prädiktoren und Kriterien und die Kor-<br />
relationen der relevanten Prädiktoren mit den Kriterien berichtet und anschließend mul-<br />
tiple Regressionsanalysen mit Einschluss- und schrittweisem Verfahren berechnet.<br />
Aufgrund der bisher verworfenen Hypothesen und Ergebnisse in 5.3 und 5.4 wird eine<br />
multiple Regression auf die Kriterien SCL-90-R-Post-Wert und SCL-90-R-Kat-Wert<br />
berechnet. Für den in der einfachen Regression ebenfalls signifikanten VEV-K-Post-<br />
Wert wird auf die Berechnung einer multiplen Regression verzichtet, da dieser eine<br />
große Korrelation (r = -.65) mit dem SCL-90-R-Post-Wert und ein deutlich geringeres<br />
R² aufweist. 9<br />
5.5.1 Mittelwerte und Standardabweichungen der Prädiktoren<br />
In Tabelle 5.15 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen und der Range der Prädik-<br />
toren im Überblick dargestellt. Die Werte der Ergebniskriterien sind den obigen Ausfüh-<br />
rungen (siehe 5.2) zu entnehmen.<br />
9<br />
Aus Gründen der Vollständigkeit werden multiple Regressionen für alle weiteren Kriterien berechnet,<br />
die Ergebnisse sind in Anhang E dargestellt.<br />
71
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.15<br />
Mittelwerte, Standardabweichungen und Range der Prädiktoren in SP1<br />
Prädiktoren Mittelwert Standardabweichung Min Max<br />
Gesamtstrukturniveau 2.02 0.28 1.5 3.0<br />
SCL-90-R-Prä-Wert 1.15 0.57 0.18 3.40<br />
BSS-Summe 7.35 0.83 4 10<br />
Arbeitsunfähigkeit 8.69 11.69 0 52<br />
Anzahl Diagnosen 2.78 1.34 1 7<br />
Geschlecht 1.70 0.46 1 2<br />
Erkrankungsdauer 111.20 101.83 3 480<br />
Motivation 3.06 0.66 1 4<br />
PS liegt vor 0.24 0.43 0 1<br />
Alter 39.36 10.33 19 64<br />
Anmerkungen.<br />
Gesamtstrukturniveau, SCL-90-R, BSS siehe 2.1.2 und 4.3. Arbeitsunfähigkeit in Wochen im<br />
Jahr vor dem Klinikaufenthalt. Anzahl der Diagnosen = Summe aller körperlichen und psychischen<br />
Diagnosen. Geschlecht: 1 = männlich, 2 = weiblich. Erkrankungsdauer = Gesamtdauer<br />
der Erkrankung in Monaten bis zum Klinikaufenthalt. Motivation: 1 = kaum motiviert, 2 = etwas<br />
motiviert, 3 = motiviert, 4 = sehr motiviert. PS liegt vor: 0 = liegt nicht vor, 1 = liegt vor. Alter: In<br />
Jahren angegeben.<br />
5.5.2 Korrelationen der Variablen<br />
In Tabelle 5.16 - Tabelle 5.18 sind die Interkorrelationen der konkurrierenden Prädikto-<br />
ren, die Interkorrelationen der Kriterien und die Prädiktor-Kriteriums-Korrelationen be-<br />
richtet.<br />
72
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.16<br />
Interkorrelationen der Prädiktoren in SP1<br />
Prädiktor-Korrelationen<br />
Prädiktor<br />
Struktur<br />
SCL-<br />
Prä<br />
BSS<br />
#<br />
AU<br />
Anz.<br />
Dia.#<br />
Geschl.<br />
Erk.-<br />
Dau.<br />
Mot.<br />
#<br />
PS<br />
Struktur 1<br />
SCL-Prä .08 1<br />
BSS# .27** .25** 1<br />
AU .05 .09 .17* 1<br />
Anz.Dia.# .15* .26** .13 .06 1<br />
Geschlecht .01 .18* -.04 -.13 -.06 1<br />
Erk.-Dau. .19* -.09 .04 -.20** .07 -.02 1<br />
Motivation# -.37** -.05 -.06 -.05 -.10 .09 -.06 1<br />
PS liegt vor .27** .02 .10 -.06 .34** -.09 .23** -.14 1<br />
Alter<br />
Anmerkungen.<br />
.01 -.09 -.05 .11 -.04 -.18* .19** -.04 -.02<br />
PS = Persönlichkeitsstörung. AU = Arbeitsunfähigkeit. Erk.-Dau = Erkrankungsdauer, in Monaten<br />
gemessen. Mot.= Motivation = Motivationseinschätzung der Therapeutin zu Behandlungsbeginn<br />
s.o. SCL-Prä = GSI der SCL-90-R zu Behandlungsbeginn. BSS = BSS-Summe zu Behandlungsbeginn.<br />
Anz.Dia = Summe aller körperlichen und psychischen Diagnosen. Geschl.<br />
= Geschlecht.<br />
* = signifikant auf dem Niveau von .05. ** = signifikant auf dem Niveau von .01 (2-seitig). Alle<br />
signifikanten Korrelationen sind fett markiert. 10<br />
Art der Korrelationen je nach Skalenniveau. # = Spearman-Korrelation.<br />
Signifikante Zusammenhänge zeigen sich zwischen der Beeinträchtigungsschwere<br />
(Summe im BSS), dem Gesamtstrukturniveau, der Symptombelastung in der SCL-90-R<br />
und der Arbeitsunfähigkeit im Jahr vor der Behandlung, d.h. schwerer belastete Patien-<br />
tinnen waren auch strukturell eher beeinträchtigt und länger arbeitsunfähig. Weibliche<br />
Patientinnen haben eine höhere Symptombelastung und sind zudem jünger als ihre<br />
männlichen Kollegen, wobei Ältere eine insgesamt längere Erkrankungsdauer aufwei-<br />
sen. Je geringer das Integrationsniveau, desto länger die Erkrankungsdauer, desto<br />
mehr Diagnosen wurden vergeben, desto größer die Gesamtsymptombelastung (SCL-<br />
90-R), desto mehr komorbide Persönlichkeitsstörungen und desto geringer die Motiva-<br />
tion. Je länger die Erkrankung schon dauerte, desto weniger (!) Wochen Arbeitsunfä-<br />
higkeit hatten die Patientinnen im Jahr vor dem Klinikaufenthalt. Mittlere Zusammen-<br />
hangseffekte zeigen sich für Motivation/Gesamtstrukturniveau und für Anzahl der Di-<br />
agnosen/komorbide Persönlichkeitsstörung. Die Höhe der übrigen Korrelationen ist<br />
schwach und ebenso wie die Signifikanzen der Tabelle 5.16 zu entnehmen. Eine struk-<br />
turelle Beeinträchtigung geht übereinstimmend mit dem Instrument mit einer höheren<br />
Symptombelastung, mehr Diagnosen, längerer Erkrankungsdauer, weniger Motivation<br />
und häufiger mit einer komorbiden Persönlichkeitsstörung einher. Keine Assoziationen<br />
10<br />
Die Höhe der Korrelationen bewegt sich je nach Darstellung in unterschiedlichen Bereichen,<br />
so dass unterschiedliche Markierungen vorgenommen werden. Die Auswahl ist den jeweiligen<br />
Tabellen zu entnehmen.<br />
73
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
ergeben sich für die Symptombelastung, die Arbeitsunfähigkeit im Jahr vor dem Klinik-<br />
aufenthalt sowie für Geschlecht und Alter.<br />
Tabelle 5.17<br />
Interkorrelation der Kriterien in SP1<br />
SCL-<br />
Post<br />
SCL<br />
Prä/Post<br />
Änd.<br />
Psy<br />
VEV-<br />
K-Post<br />
SCL-<br />
Kat<br />
SCL-<br />
Prä/Kat<br />
VEV-<br />
K-Kat EMEK<br />
SCL-Post 1<br />
SCL-Prä/Post -.35** 1<br />
Änd.Psy. -.40** .44** 1<br />
VEV-K-Post -.65** .50** .44** 1<br />
SCL-Kat .34** .22** .03 -.10 1<br />
SCL-Prä/Kat .14 .49** .08 .06 -.46** 1<br />
VEV-K-Kat -.12 .02 .01 .27** -.62** .50** 1<br />
EMEK<br />
Anmerkungen.<br />
-.13 .07 .11 .22** -.65** .56** .80** 1<br />
SCL = GSI der SCL-90-R. Änd.psy = Therapeutinnenrating der Veränderung des psychischen<br />
Befindens zum Therapieende. EMEK = EMEK Quotient.<br />
** = signifikant auf dem Niveau von .01 (2-seitig). Große und fast große Korrelationen sind fett<br />
markiert. Mittlere Korrelationen kursiv.<br />
Bei den Kriterien ergibt sich die höchste Korrelation von .80 zwischen dem EMEK-<br />
Quotienten und dem VEV-K-Wert zum Katamnesezeitpunkt. Des Weiteren korreliert<br />
der EMEK-Quotient stark mit dem SCL-90-R-Kat-Wert und -Prä-Kat-Differenzwert und<br />
schwach mit dem VEV-K-Wert zum Therapieende. Weitere große Zusammenhangsef-<br />
fekte sind zwischen dem Kat-Wert des VEV-K und dem Kat-Wert bzw. der Prä-Kat-<br />
Differenz der SCL-90-R zu verzeichnen. Ebenso für den VEV-K-Wert zum Therapieen-<br />
de und dem SCL-90-R-Wert zum Therapieende. Der Post-Wert der SCL-90-R korreliert<br />
mit .49 mit dem Wert der SCL-90-R zum Katamnesezeitpunkt. Alle Werte und die übri-<br />
gen signifikanten Korrelationen sind Tabelle 5.17 zu entnehmen. Die Ergebnisse zei-<br />
gen, dass die Kriterien relevant zusammenhängen, dass die Dimension „Therapieer-<br />
folg“ erfolgreich aus verschiedenen Perspektiven erfasst wird, d.h. dass die Korrelatio-<br />
nen ausreichend groß, aber nicht so hoch sind, dass sie nur identische Informationen<br />
abbilden.<br />
In Tabelle 5.18 werden die Korrelationen der Prädiktoren mit dem jeweiligen Kriterium<br />
dargestellt. Bis auf „komorbide Persönlichkeitsstörungen“ und „Erkrankungsdauer“ zei-<br />
gen sich für alle Prädiktoren mit mindestens einem der Kriterien signifikante Korrelatio-<br />
nen. Große Zusammenhänge zeigen sich für den Prä-Wert der SCL-90-R und der Prä-<br />
Post-Differenz der SCL-90-R bzw. der Prä-Kat-Differenz der SCL-90-R, die übrigen<br />
Zusammenhänge sind überwiegend schwach und Tabelle 5.18 zu entnehmen.<br />
74
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.18<br />
Prädiktor-Kriteriums-Korrelationen in SP1<br />
Prädiktor<br />
Art der<br />
Korr.<br />
Korrelation mit dem jeweiligen Kriterium<br />
SCL-<br />
Prä/<br />
Post<br />
SCL-<br />
Post<br />
SCL-<br />
Prä/<br />
Kat<br />
75<br />
SCL-<br />
Kat<br />
VEV-<br />
K-<br />
Post<br />
VEV-K-<br />
Kat<br />
Änd.<br />
psy EMEK<br />
Struktur Pearson -.13* .26** -.06 .15* -.15* -.12* -.06 -.08<br />
SCL-Prä Pearson .68** .45** .57** .47** -.04 -.08 .11 -.04<br />
BSS Spearm. -.01 .33** -.07 .34** -.18** -.18** -.12 -.20**<br />
AU Pearson -.09 .22** .01 .09 -.10 -.04 .13 -.04<br />
Anz.Dia. Spearm. .08 .25** .15* .12* .00 -.01 .01 .00<br />
Geschl. Punktbis .01 .22** -.11 .08 -.12 .01 .03 .01<br />
Erkr.dau. Pearson -.02 -.10 .00 -.10 .03 .01 .02 .04<br />
Mot. Spearm. .10 -.18* .03 -.08 .16* .03 .26** .08<br />
PS Punktbis -.01 .07 -.09 -.02 .03 .01 -.06 .03<br />
Alter Pearson .06 -.18* .04 -.03 .15* .12 .07 -.01<br />
Anmerkungen.<br />
PS = Persönlichkeitsstörung. AU = Arbeitsunfähigkeit. Erkr.dau. = Erkrankungsdauer, in Monaten<br />
gemessen. BSS = BSS-Summe zu Behandlungsbeginn. Anz.Dia = Summe aller körperlichen<br />
und psychischen Diagnosen. Geschl. = Geschlecht. Mot.= Motivation (s.o.). SCL = GSI<br />
der SCL-90-R. SCL-Prä/Post = Differenz des GSI Prä und Post-Rohwertes. SCL-Prä/Kat = Differenz<br />
des GSI Prä und Kat-Rohwertes. Änd.psy = Therapeutinnenrating der Veränderung des<br />
psychischen Befindens zum Therapieende. EMEK = EMEK Quotient.<br />
Punktbis = Punktbiseriale Korrelation. Spearm. = Spearman Korrelation. Pearson = Pearson<br />
Korrelation.<br />
* = signifikant auf dem Niveau von .05. ** = signifikant auf dem Niveau von .01 (2-seitig). Alle<br />
signifikanten Korrelationen sind fett markiert.<br />
Im Folgenden werden die multiplen Regressionsanalysen zur Prüfung einer optimalen<br />
Variablenauswahl vorgestellt.<br />
5.5.3 Regression auf den SCL-90-R-Wert zum Therapieende<br />
Zunächst werden alle spezifizierten Prädiktoren nach der Einschluss-Methode analy-<br />
siert. Anschließend wird eine Regression mit Merkmalsselektion nach der Schrittwei-<br />
sen-Methode berechnet. Die Variablen „Alter“ und „Geschlecht“ werden vor der Analy-<br />
se daraufhin getestet (siehe 2.2.2), ob die Hinzunahme einen positiven Effekt auf die<br />
Güte der Vorhersage hat. Das Ergebnis ist, dass sich die Vorhersage durch die<br />
Hinzunahme von Alter nicht verbessert, durch Geschlecht hingegen schon, so dass nur<br />
Geschlecht als Prädiktor aufgenommen wird. Die Ergebnisse sind Tabelle 5.19 –<br />
Tabelle 5.21 zu entnehmen.
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.19<br />
Multiple Regression mit Einschluss aller Prädiktoren auf den SCL-90-R-Post-Wert in<br />
SP1<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
76<br />
Standardisierte<br />
Koeffiz.<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) .967 .372 2.600 .010<br />
SCL-Prä-Wert .259 .055 .322 4.689 .000<br />
Geschlecht -.161 .065 -.136 -2.468 .015<br />
BSS-Summe -.086 .038 -.160 -2.295 .023<br />
Gesamtstruktur -.257 .117 -.158 -2.198 .029<br />
AU letztes Jahr -.005 .003 .123 -1.818 .071<br />
Motivation -.066 .047 -.096 1.392 .166<br />
Erkrankungsd. .000 .000 -.083 1.236 .218<br />
Anz.Diagnosen -.020 .024 .062 .851 .396<br />
PS .010 .078 .009 .129 .898<br />
F = 9.530; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .37683<br />
R² = .300<br />
Der Test zur Prüfung der Unabhängigkeit der Residuen, die Durbin-Watson-Statistik<br />
nimmt einen Wert von 2.136 an, so dass davon ausgegangen werden kann, dass keine<br />
störenden Autokorrelationen bestehen. Die Kollinearitätsdiagnose ergibt Zusammen-<br />
hänge zwischen Motivation, Gesamtstrukturniveau und Summe im BSS. Bei einem<br />
Konditionsindex von > 10 laden diese drei Variablen auf zwei gemeinsamen Faktoren.<br />
Motivation und Gesamtstrukturniveau laden zusätzlich gemeinsam auf einem weiteren<br />
Faktor.<br />
Das Modell ist hochsignifikant, aus den auf p ≤ .05 signifikanten Prädiktoren ergibt sich<br />
folgende Regressionsgleichung:<br />
SCL-90-R-Post-Wert =<br />
0.967 + 0.259 ∙ SCL-Prä - 0.161 ∙ Geschlecht - 0.086 ∙ BSS - 0.257 ∙ Gesamtstruktur
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.20<br />
Ergebnisse der Multiplen Regression auf den SCL-90-R-Post-Wert mit schrittweisem<br />
Verfahren in SP1<br />
Modell R² Änderung in R² Änderung in F Signifikanz<br />
1 .193 .197 43.803 .000<br />
2 .243 .054 12.773 .000<br />
3 .268 .029 7.095 .008<br />
4 .282 .018 4.389 .038<br />
5 .300 .021 5.465 .021<br />
Tabelle 5.21<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
77<br />
Standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) -1.250 .310 -4.036 .000<br />
SCL-Prä-Wert .280 .054 .348 5.214 .000<br />
Gesamtstruktur .310 .109 .190 2.935 .004<br />
Geschlecht .153 .064 .156 2.397 .018<br />
BSS-Summe .083 .037 .153 2.218 .028<br />
AU .006 .003 .152 2.338 .021<br />
F = 16.338; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .37689<br />
R² = .300<br />
Das Modell ist hochsignifikant, die Prädiktoren „SCL-90-R-Prä-Wert“, „Gesamtstruktur-<br />
niveau“, „Geschlecht“, „BSS-Summe“ und „Arbeitsunfähigkeit“ werden in das Regressi-<br />
onsmodell aufgenommen.<br />
Durch die Variable „SCL-90-R-Prä-Wert“ werden 19.3 %, durch das „Gesamtstrukturni-<br />
veau“ 5.4 %, durch das „Geschlecht“ 2.9 %, durch die „BSS-Summe“ 1.8 % und durch<br />
die „Arbeitsunfähigkeit im Jahr vor der Behandlung“ 2.1 % und insgesamt durch alle<br />
Prädiktoren 30.0 % der Varianz des Kriteriums „SCL-90-R-Post-Wert“ aufgeklärt. Die<br />
Variable „SCL-90-R-Prä-Wert“ hat einen starken Effekt, die anderen Variablen erbrin-<br />
gen einen kleinen Effekt, wobei die BSS-Summe knapp unter dem Grenzwert von<br />
R² = .02 liegt. Der Beitrag des Gesamtstrukturniveaus zur Vorhersage bleibt sehr signi-<br />
fikant.<br />
Aus den Berechnungen ergibt sich folgende Regressionsgleichung für den allgemeinen<br />
Therapieerfolg zum Therapieende:
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
SCL-90-R-Post-Wert =<br />
-1.250 + 0.280 ∙ SCL-Prä + 0.310 ∙ Gesamtstruktur + 0.153 ∙ Geschlecht + 0.083 ∙<br />
BSS + 0.006 ∙ AU letztes Jahr<br />
Aufgrund des hohen Wertes der ersten aufgenommenen Variable und den<br />
Multikollinearitäten wird eine weitere schrittweise Regression ohne die Variablen „SCL-<br />
90-R-Prä-Wert“ und „BSS-Summe“ berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.22 -<br />
Tabelle 5.23 dargestellt.<br />
Tabelle 5.22<br />
Ergebnisse der Multiplen Regression auf den SCL-90-R-Post-Wert mit schrittweisem<br />
Verfahren in SP1 ohne SCL-90-R-Prä und BSS-Prä<br />
Modell R² Änderung in R² Änderung in F Signifikanz<br />
1 .070 .075 14.379 .000<br />
2 .111 .046 9.319 .003<br />
3 .148 .041 8.680 .004<br />
4 .167 .023 4.971 .027<br />
Tabelle 5.23<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
78<br />
Standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) -.757 .254 -2.982 .003<br />
Gesamtstruktur .385 .113 .236 3.420 .001<br />
Geschlecht .226 .068 .229 3.322 .001<br />
AU .008 .003 .197 2.858 .005<br />
Anzahl Dia. .051 .023 .155 2.230 .027<br />
F = 9.962; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .41115<br />
R² = .167<br />
Es werden vier Variablen aufgenommen, das „Gesamtstrukturniveau“, das „Ge-<br />
schlecht“, die „Arbeitsunfähigkeit im Jahr vor der Behandlung“ und die „Anzahl der Di-<br />
agnosen“. Das Gesamtstrukturniveau kann 7.5 % der Varianz, das Geschlecht 4.6 %,<br />
die Arbeitsunfähigkeit 4.1 % und die Anzahl der Diagnosen 2.3 % zur Varianzaufklä-<br />
rung beitragen, was jeweils als kleiner Effekt einzustufen ist und zusammen 18.5 % der<br />
Varianz des Therapieerfolgs aufklären kann. Aus den neuen Berechnungen ergibt sich<br />
folgende Regressionsgleichung für den allgemeinen Therapieerfolg zum Therapieende:<br />
SCL-90-R-Post-Wert =
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
-.757 + 0.385 ∙ Gesamtstruktur + 0.226 ∙ Geschlecht + 0.008 ∙ AU letztes Jahr +<br />
.051 Anzahl Diagnosen<br />
Insgesamt sprechen die Ergebnisse für Hypothese 5, der Prädiktor „Gesamtstrukturni-<br />
veau“ hat einen relevanten Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs, gemessen<br />
mit dem SCL-90-R-Wert, zum Therapieende.<br />
5.5.4 Regression auf den SCL-90-R-Wert zum Nachuntersuchungszeit-<br />
punkt<br />
In Tabelle 5.24 – Tabelle 5.27 werden die Ergebnisse der multiplen Regressionen auf<br />
den SCL-90-R-Wert zum Nachuntersuchungszeitpunkt dargestellt, zuerst nach der<br />
Einschluss- und anschließend nach der schrittweisen Methode.<br />
Tabelle 5.24<br />
Multiple Regression mit Einschluss aller Prädiktoren auf den SCL-90-R-Kat-Wert in<br />
SP1<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
79<br />
Standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) -.634 .445 -1.446 .150<br />
SCL-Prä-Wert .301 .066 .336 4.552 .000<br />
BSS-Summe .119 .045 .198 2.646 .009<br />
Erk.dau. -.001 .000 -.105 -1.454 .148<br />
PS -.100 .093 -.085 -1.073 .285<br />
Gesamtstruktur .116 .140 .064 .832 .406<br />
Motivation -.048 .056 -.064 -.860 .391<br />
AU letztes Jahr -.002 .003 -.056 -.769 .443<br />
Geschlecht .039 .078 .036 .501 .617<br />
Anz.Diagn. .008 .029 .022 .279 .780<br />
F = 5.590; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .45082<br />
R² = .188<br />
Es bestehen ebenfalls keine störenden Autokorrelationen (Durbin-Watson-<br />
Statistik = 1.881). Das Modell ist hochsignifikant, aus den auf p < .05 signifikanten Prä-<br />
diktoren ergibt sich folgende Regressionsgleichung:<br />
SCL-90-R-Kat-Wert =<br />
- 0.634 + 0.301 ∙ SCL-Prä + 0.119 ∙ BSS<br />
Die Kollinearitätsdiagnose ergibt ebenfalls Zusammenhänge zwischen Motivation, Ge-<br />
samtstrukturniveau und Summe im BSS. Bei einem Konditionsindex von > 10 laden
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
diese drei Variablen auf zwei gemeinsamen Faktoren. Motivation und Gesamtstruktur-<br />
niveau laden zusätzlich gemeinsam auf einem weiteren Faktor. Besonders hoch sind<br />
die gemeinsamen Varianzanteile für die BSS-Summe und das Gesamtstrukturniveau.<br />
Tabelle 5.25<br />
Ergebnisse der Multiplen Regression auf den SCL-90-R-Kat-Wert mit schrittweisem<br />
Verfahren in SP1<br />
Modell R² Änderung in R² Änderung in F Signifikanz<br />
1 .163 .168 35.918 .000<br />
2 .193 .034 7.608 .006<br />
Tabelle 5.26<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
80<br />
Standardi-<br />
sierte<br />
Koeffiz.<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) -.564 .298 -1.893 .060<br />
SCL-Prä-Wert .322 .062 .361 5.193 .000<br />
BSS .115 .042 .192 2.758 .006<br />
F = 22.430; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .44925<br />
R² = .193<br />
Das Modell ist hochsignifikant, die Prädiktoren „SCL-90-R-Prä-Wert“ und „BSS-<br />
Summe“ werden in das Regressionsmodell aufgenommen.<br />
Der SCL-90-R-Prä-Wert kann 16.3 % und die BSS-Summe weitere 3.4 % der Varianz<br />
des Kriteriums SCL-90-R-Kat-Wert aufklären. Das Gesamtstrukturniveau wird nicht in<br />
das Modell aufgenommen und hat keinen Einfluss auf die Vorhersage des Therapieer-<br />
gebnisses zum Nachuntersuchungszeitpunkt.<br />
Aus den Berechnungen ergibt sich folgende Regressionsgleichung:<br />
SCL-90-R-Kat-Wert =<br />
- 0.564 + 0.322 ∙ SCL-Prä + 0.115 ∙ BSS<br />
Aufgrund der Multikollinearitäten von Gesamtstrukturniveau, Motivation und BSS wird<br />
eine weitere Regression mit den Prädiktoren „SCL-90-R-Prä-Wert“ und „Gesamtstruk-<br />
turniveau“ gerechnet, um einen eventuellen signifikanten Beitrag dieses Prädiktors zu<br />
erkennen.
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.27<br />
Ergebnisse der Multiplen Regression von SCL-90-R-Prä-Wert und Gesamtstrukturniveau<br />
auf den SCL-90-R-Kat-Wert in SP1<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
81<br />
Standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) -.258 .247 -1.041 .299<br />
SCL-Prä-Wert .424 .058 .460 7.269 .000<br />
Gesamtstruktur .217 .119 .115 1.819 .070<br />
F = 29.327; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .46255<br />
R² = .225<br />
Es ergibt sich auch hier für das Gesamtstrukturniveau kein signifikanter Beitrag, ledig-<br />
lich ein Trend.<br />
Eine einfache Regression mit dem Prädiktor „SCL-90-R-Prä-Wert“ ergibt ein R² von<br />
.220 (korrigiert R² = .216), mit einem Standardschätzfehler von 0.46530, einem F-Wert<br />
von 54.694 (p ≤ .001) und einem Beta von 0.469. Diese Variable kann allein 22.0 %<br />
der Varianz aufklären. Hypothese 6 muss verworfen werden, das Gesamtstrukturni-<br />
veau hat keinen relevanten Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs zum Na-<br />
chuntersuchungszeitpunkt, gemessen mit dem SCL-90-R-Kat-Wert.<br />
5.6 Zu Hypothese 7<br />
In den Hypothesen 7a-e wird ein Zusammenhang zwischen dem „MW/Wochen“ und<br />
dem „Therapieerfolg“ zum Therapieende, gemessen mit der SCL-90-R-Prä-Post-<br />
Differenz bzw. -Post-Wert, dem VEV-K-Post-Wert, der BSS-Prä-Post-Differenz und<br />
dem Therapeutinnenrating, erwartet. Je höher der Wert für den „MW/Wochen“, desto<br />
geringer der erwartete „Therapieerfolg“, daher erfolgt die Überprüfung der Hypothesen<br />
gerichtet. Zuerst werden die Ergebnisse für SP2, anschließend die Ergebnisse für SP3<br />
berichtet.
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
5.6.1 Untersuchung in SP2<br />
Tabelle 5.28<br />
Korrelationen von MW/Wochen, SCL-90-R-Prä-Post-Differenz, SCL-90-R-Post-Wert,<br />
VEV-K-Post-Wert, BSS-Prä-Post-Differenz und Therapeutinnenrating der psychischen<br />
Veränderung (Post) in SP2<br />
MW/Wochen<br />
MW/Wochen<br />
(Pearson-Korrelation) (Spearman-Korrelation)<br />
SCL-Prä-Post-Differenz .038 ns .058 ns<br />
SCL-Post-Wert -.152 ns -.253*<br />
VEV-K-Post-Wert .094 ns .074 ns<br />
BSS-Prä-Post-Diff. -.066 ns -.038 ns<br />
Therapeutinnenrating<br />
Anmerkungen.<br />
.050 ns .188° (p = .091)<br />
° = Trend auf dem Niveau von .10. * = signifikant auf dem Niveau von .05. ns = nicht signifikant.<br />
Wie Tabelle 5.28 zeigt, sind die Zusammenhänge nicht signifikant, die Hypothesen<br />
7a-e müssen verworfen werden. Der SCL-90-R-Post-Wert zeigt einen kleinen und der<br />
VEV-K-Post-Wert einen fast kleinen Zusammenhang. Die Spearman-Korrelation des<br />
MW/Wochen und des SCL-90-R-Post-Wertes ist signifikant und für das<br />
Therapeutinnenrating ist nach dieser Berechnung ein Zusammenhangs-Trend zu ver-<br />
zeichnen, d.h. nach dieser Berechnung haben Patientinnen mit einer größeren Anzahl<br />
strukturell beeinträchtigter Patientinnen in ihrer Gruppe einen geringeren Therapieer-<br />
folg im SCL-90-R-Post-Wert und trendmäßig in der Therapeutinneneinschätzung.<br />
5.6.2 Untersuchung in SP3<br />
Die Ergebnisse der Korrelationsberechnungen in SP3 sind in nachfolgender Tabelle<br />
5.29 dargestellt.<br />
Tabelle 5.29<br />
Korrelationen von MW/Wochen, SCL-90-R-Prä-Post-Differenz, SCL-90-R-Post-Wert,<br />
VEV-K-Post-Wert, BSS-Prä-Post-Differenz und Therapeutinnnenrating der psychischen<br />
Veränderung (Post) in SP3<br />
MW/Wochen<br />
MW/Wochen<br />
(Pearson-Korrelation) (Spearman-Korrelation)<br />
SCL-Prä-Post-Differenz .189° (p = .097) .133 ns<br />
SCL-Post-Wert -.059 ns .004 ns<br />
VEV-K-Post-Wert -165 ns -.181° (p = .107)<br />
BSS-Prä-Post-Diff. -.331* -.371**<br />
Therapeutinnenrating<br />
Anmerkungen.<br />
.150 ns .198° (p = .086)<br />
° = Trend auf dem Niveau von .10. * = signifikant auf dem Niveau von .05. ns = nicht signifikant.<br />
In dieser Stichprobe zeigt sich ein mittlerer (signifikanter) Zusammenhang für die BSS-<br />
Prä-Post-Differenz und den MW/Wochen. Je größer der MW/Wochen, desto geringer<br />
82
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
die Differenz im BSS, was bedeutet, dass die Schwere der Beeinträchtigung für Patien-<br />
tinnen in Gruppen mit mehr strukturell beeinträchtigten Patientinnen weniger reduziert<br />
werden konnte und die Ergebnisse somit für Hypothese 7d und trendmäßig auch für<br />
Hypothese 7a sprechen. Die Hypothesen 7b, 7c und 7e müssen verworfen werden. Für<br />
die SCL-90-R-Prä-Post-Differenz, den VEV-K-Post-Wert und das Therapeutinnenrating<br />
sind die Zusammenhänge klein und nicht signifikant. Die Spearman-Korrelation kann<br />
das Ergebnis der Pearson-Korrelation für Hypothese 7d bestätigen, hier zeigen sich<br />
jedoch Trends für die Hypothesen 7c und 7e.<br />
5.7 Zu Hypothese 8<br />
In Hypothese 8 soll geprüft werden, ob der Prädiktor „Anteil strukturell beeinträchtigter<br />
Patientinnen“ einen signifikanten Einfluss auf die Vorhersage des Therapieergebnisses<br />
hat. Des Weiteren soll untersucht werden, ob sich dieser Beitrag bei gleichzeitiger Re-<br />
gression konkurrierender Prädiktoren (siehe 2.2.2) verändert und wie die Prädiktoren<br />
zur Vorhersage optimal ausgewählt werden können. Dazu werden für die SP2 und SP3<br />
zunächst der allgemeine Therapieerfolg, die Interkorrelationen der Prädiktoren und die<br />
Korrelationen der ausgewählten Prädiktoren mit den Kriterien berichtet und anschlie-<br />
ßend die einfachen Regressionen und multiplen Regressionsanalysen mit Einschluss-<br />
und teilweise schrittweisem Verfahren dargestellt.<br />
5.7.1 Untersuchung in SP2<br />
5.7.1.1 Mittelwerte, Standardabweichungen und Therapieerfolg in SP2<br />
Zunächst werden die Mittelwerte und Standardabweichungen für alle relevanten Prä-<br />
diktoren und Kriterien dargestellt. Anschließend wird aufgrund der zeitlichen und seitli-<br />
chen Begrenzung dieser Arbeit nur anhand der SCL-90-R, dem BSS und dem cut-off-<br />
Wert des VEV-K, geprüft, ob ein allgemeiner Therapieerfolg vorliegt. Alle Ergebnisse<br />
sind folgender Tabelle 5.30 zu entnehmen.<br />
83
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.30<br />
Mittelwerte, Standardabweichungen (Signifikanzen der T-Tests) aller relevanter Prädiktoren<br />
und Kriterien in SP2<br />
Mittelwert Standardabweichung Signifikanz (T-Test)<br />
Prädiktoren<br />
MW/Wochen .20 .13<br />
Gesamtstrukturniveau 2.06 0.27<br />
SCL-Prä-Wert 1.15 0.50<br />
BSS-Prä-Summe 6.96 0.71<br />
Geschlecht 1.64 0.48<br />
Alter 40.21 10.77<br />
Kriterien<br />
SCL-Post-Wert 0.73 0.42<br />
SCL-Prä-Post-Diff. 0.42 0.46 .000<br />
BSS-Prä-Post-Diff. 2.09 0.97 .000<br />
VEV-K-Post 124.79 25.62<br />
Therapeutinnenrating 1.38 0.60<br />
Anmerkungen.<br />
Geschlecht Kodierung: 1 = männlich, 2 = weiblich. Therapeutinnenrating Kodierung: 1 = deutlich<br />
gebessert, 2 = etwas gebessert, 3 = nicht verändert, 4 = etwas verschlechtert, 5 = deutlich verschlechtert.<br />
Der Mittelwert des GSI-Rohwertes der SCL-90-R reduzierte sich um 0.42 Punkte von<br />
1.15 zu Therapiebeginn auf 0.73 am Therapieende. Der Test auf Mittelwertunterschie-<br />
de von Behandlungsbeginn zu Behandlungsende wird sowohl für die SCL-90-R als<br />
auch für den BSS hochsignifikant (p ≤ .000). Die Effektstärke (ESprä) für die SCL-90-R<br />
liegt bei 0.84 und damit im mittleren- bis großen Bereich. Der Mittelwert des VEV-K<br />
liegt mit 125 über dem cut-off-Wert für eine signifikante Veränderung auf p ≤ .01 von<br />
120. Dies kann als allgemeiner Therapieerfolg, gemessen mit den Ergebniskriterien<br />
SCL-90-R, VEV-K und BSS, eingestuft werden.<br />
84
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
5.7.1.2 Korrelationen der Variablen in SP2<br />
Tabelle 5.31<br />
Interkorrelationen der Prädiktoren in SP2<br />
Prädiktor-Korrelationen<br />
Prädiktor MW/Wo SCL-Prä BSS# Struktur Geschl. Alter<br />
MW/Wochen 1<br />
SCL-Prä .09 1<br />
BSS# .21 .23 1<br />
Struktur .42** .29* .32* 1<br />
Geschlecht .23 -.31* .06 .16 1<br />
Alter -.03 -.03 .05 -.05 -.04 1<br />
Anmerkungen.<br />
* = signifikant auf dem Niveau von .05. ** = signifikant auf dem Niveau von .01 (2-seitig). Alle<br />
signifikanten Korrelationen sind fett markiert. # = Spearman-Korrelation.<br />
Wie Tabelle 5.31 zu entnehmen ist, hängt ein höherer MW/Wochen signifikant mit ei-<br />
nem höheren (geringer integrierten) Gesamtstrukturniveau zusammen, ein Teil dieser<br />
Korrelation ist jedoch bedingt durch die Konstruktion der Variable. Je höher das Ge-<br />
samtstrukturniveau, desto größer die Gesamtsymptombelastung (SCL-90-R und BSS)<br />
zu Behandlungsbeginn. Zwischen Geschlecht und SCL-90-R-Prä-Wert gibt es eben-<br />
falls signifikante Zusammenhänge, (weibliche) Patientinnen haben eine geringere (!)<br />
Symptombelastung. Die Größe der Zusammenhänge ist mittel bis groß und im Einzel-<br />
nen Tabelle 5.31 zu entnehmen.<br />
Tabelle 5.32<br />
Prädiktor-Kriteriums-Korrelationen in SP2<br />
Kriterium<br />
Prädiktor Art der Korrelation<br />
SCL-<br />
Prä/Post<br />
SCL-<br />
Post<br />
VEV-K-<br />
Post<br />
BSS-Prä-<br />
Post-Diff.<br />
Änd.psy<br />
MW/Wo Pearson .04 -.15 .09 -.07 -.05<br />
SCL-Prä Pearson .63** .52** -.05 -.07 -.16<br />
BSS-Prä Spearman .10 .17 -.12 .34* .26<br />
Struktur Pearson .14 .20 -.02 -.27 -.12<br />
Geschlecht Punktbis. -.19 -.17 -.12 -.11 .27<br />
Alter Pearson -.01 -.03 -.06 .04 .18<br />
Anmerkungen.<br />
Punktbis. = Punktbiseriale Korrelation.<br />
* = signifikant auf dem Niveau von .05. ** = signifikant auf dem Niveau von .01 (2-seitig). Alle<br />
signifikanten Korrelationen sind fett markiert.<br />
Wie in Tabelle 5.32 dargestellt, gehen hohe Ausgangswerte in der Symptombelastung<br />
(SCL-90-R-Prä-Wert) einher mit einer größeren Reduzierung dieser Belastung (SCL-<br />
85
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
90-R-Prä-Post-Differenz) und gleichzeitig auch höher bleibender Belastung zum Klinik-<br />
austritt. Je höher die Beeinträchtigung (BSS-Summe) zu Behandlungsbeginn desto<br />
höher auch deren Reduktion (BSS-Prä-Post-Differenz). Der MW/Wochen, das Ge-<br />
samtstrukturniveau, das Geschlecht und das Alter korrelieren nicht signifikant mit den<br />
Ergebniskriterien, die Zusammenhänge sind jedoch teilweise als mittelgroß einzustu-<br />
fen. Große Zusammenhänge sind für die SCL-90-R zu verzeichnen, die übrigen Zu-<br />
sammenhänge sind schwach bis mittel und im Einzelnen der Tabelle 5.32 zu entneh-<br />
men. Im Folgenden soll dennoch der in Hypothese 8 postulierte prädiktive Wert der<br />
Variable „MW/Wochen“ geprüft werden. Möglicherweise sind Tendenzen oder über-<br />
deckte Effekte zu erkennen, da die Prädiktoren „MW/Wochen“, „Gesamtstrukturniveau“<br />
und „BSS“ signifikant zusammenhängen.<br />
5.7.1.3 Einfache Regressionen auf die Ergebniskriterien in SP2<br />
Es folgen in Tabelle 5.33 die einfachen Regressionen des Prädiktors „MW/Wochen“<br />
auf die Ergebniskriterien aus den Hypothesen 8a-e in SP2.<br />
Tabelle 5.33<br />
Einfache Regressionen des Prädiktors „MW/Wochen“ auf die SCL-90-R-Prä-Post-<br />
Differenz, den VEV-K-Post-Wert, die BSS-Prä-Post-Differenz und die Einschätzung der<br />
psychischen Veränderung durch den Therapeutin in SP2<br />
Kriterium Beta R² F Signifikanz<br />
SCL-90-R-Post-Wert -.152 .023 1.202 .278<br />
SCL-90-R-Prä-Post .038 .001 .072 .789<br />
VEV-K-Post-Wert .094 .009 .455 .503<br />
BSS-Prä-Post -.066 .004 .194 .662<br />
Therapeutinnenrating .050 .002 .123 .727<br />
Der Prädiktor „MW/Wochen“ hat auf die Vorhersage keines der Ergebniskriterien einen<br />
signifikanten Einfluss, somit müssen nach diesen Ergebnissen die Hypothesen 8a-e<br />
verworfen werden. Anschließend wird dargestellt, wie sich die gleichzeitige Vorhersage<br />
durch die ausgewählten Prädiktoren auswirkt und wie diese sich eventuell gegenseitig<br />
beeinflussen.<br />
5.7.1.4 Multiple Regression auf den SCL-90-R-Post-Wert in SP2<br />
Aufgrund der höchsten Korrelation des Prädiktors „MW/Wochen“ mit dem Kriterium<br />
„SCL-90-R-Post“ und der erhöhten Vergleichbarkeit mit der Hauptuntersuchung wird<br />
eine multiple Regression auf dieses Kriterium berechnet. Die Ergebnisse mit Ein-<br />
schluss aller Prädiktoren sind in Tabelle 5.34 dargestellt.<br />
86
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Tabelle 5.34<br />
Multiple Regression mit Einschluss aller Prädiktoren auf den SCL-90-R-Post-Wert in<br />
SP2<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
Regressions- Standard-<br />
koeffizient B<br />
fehler<br />
87<br />
Standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) -.236 .3604 -.390 .698<br />
SCL-Prä-Wert .373 .119 .450 3.137 .003<br />
MW/Wochen -.560 .462 -.172 -1.214 .231<br />
Gesamtstruktur .169 .236 .110 .715 .478<br />
BSS-Summe .050 .080 .085 .628 .533<br />
Alter -.001 .005 -.025 -.069 .945<br />
Geschlecht -.008 .117 -.009 1.392 .166<br />
F = 3.259; p = .009<br />
Standardschätzfehler = .37121<br />
R² = .207<br />
Der Test zur Prüfung der Unabhängigkeit der Residuen, die Durbin-Watson-Statistik<br />
nimmt einen Wert von 2.205 an, so dass davon ausgegangen werden kann, dass keine<br />
störenden Autokorrelationen bestehen. Den einzigen signifikanten Beitrag zur Vorher-<br />
sage des SCL-90-R-Post-Wertes liefert der SCL-90-R-Prä-Wert und auch bei schritt-<br />
weiser Regression wird nur dieser Prädiktor in das Modell aufgenommen. Die<br />
Kollinearitätsdiagnose ergibt gemeinsame Varianzanteile zwischen dem MW/Wochen,<br />
dem Gesamtstrukturniveau und der Summe im BSS sowie zwischen der SCL-90-R,<br />
dem Geschlecht und dem Alter. Somit kann ausgeschlossen werden, dass der Prädik-<br />
tor „MW/Wochen“ mit dem relevanten Prädiktor verknüpft ist. Das Modell ist sehr signi-<br />
fikant (p ≤ .01), aus den auf p ≤ .05 signifikanten Prädiktoren ergibt sich folgende Reg-<br />
ressionsgleichung:<br />
SCL-90-R-Post-Wert = -.236 + 0.373 ∙ SCL-90-R-Prä–Wert<br />
Für die SCL-90-R als alleinigen Prädiktor (einfache Regression) ergibt sich ein R²<br />
von .268 (p ≤ .000), d.h. es werden 26.8 % der Varianz des Kriteriums SCL-90-R-Post-<br />
Wert durch den SCL-90-R-Prä-Wert aufgeklärt, was als starker Effekt einzustufen ist.<br />
5.7.2 Untersuchung in SP3<br />
5.7.2.1 Mittelwerte, Standardabweichungen und Therapieerfolg in SP3<br />
Analog zu SP2 werden im Folgenden die Mittelwerte und Standardabweichungen für<br />
alle relevanten Prädiktoren und Kriterien in SP3 berechnet und anhand der SCL-90-R,
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
dem VEV-K und dem BSS geprüft, ob ein allgemeiner Therapieerfolg vorliegt. Alle Er-<br />
gebnisse werden in Tabelle 5.35 berichtet.<br />
Tabelle 5.35<br />
Mittelwerte, Standardabweichungen (Signifikanzen der T-Tests) aller relevanter Prädiktoren<br />
und Kriterien in SP3<br />
Mittelwert Standardabweichung Signifikanz (T-Test)<br />
Prädiktoren<br />
MW/Wochen .42 .22<br />
Gesamtstrukturniveau 2.17 0.42<br />
SCL-Prä-Wert 1.11 0.67<br />
BSS-Prä-Summe 6.76 1.01<br />
Geschlecht 1.65 0.48<br />
Alter<br />
Kriterien<br />
41.02 11.49<br />
SCL-Post-Wert 0.60 0.49<br />
SCL-Prä-Post-Diff. 0.51 0.52 .000<br />
BSS-Prä-Post-Diff. 1.69 1.40 .000<br />
VEV-K-Post 142.37 17.52<br />
Therapeutinnenrating<br />
Anmerkungen.<br />
1.57 0.58<br />
Geschlecht Kodierung: 1 = männlich, 2 = weiblich. Therapeutinnenrating Kodierung: 1 = deutlich<br />
gebessert, 2 = etwas gebessert, 3 = nicht verändert, 4 = etwas verschlechtert, 5 = deutlich verschlechtert.<br />
Der Mittelwert des GSI-Rohwertes der SCL-90-R reduzierte sich von 1.11 zu Therapie-<br />
beginn auf 0.60 am Therapieende. Der Test auf Mittelwertunterschiede von Behand-<br />
lungsbeginn und Behandlungsende wird sowohl für die SCL-90-R als auch für den BSS<br />
hochsignifikant (p ≤ .000). Die Effektstärke (ESprä) für die SCL-90-R liegt bei 0.76 und<br />
kann als mittelgroß bezeichnet werden. Der Mittelwert des VEV-K liegt mit 142 weit<br />
über dem cut-off-Wert für eine signifikante Veränderung auf p ≤ .01 von 120. Diese<br />
Ergebnisse können als allgemeiner Therapieerfolg, gemessen mit den Ergebniskriteri-<br />
en SCL-90-R, VEV-K und BSS, eingestuft werden. Im Folgenden werden analog zu<br />
SP2 zunächst die Korrelationen der Variablen und anschließend die Prüfung dieser auf<br />
prädiktive Validität dargestellt.<br />
88
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
5.7.2.2 Korrelationen der Variablen in SP3<br />
Tabelle 5.36<br />
Interkorrelationen der Prädiktoren in SP3<br />
Prädiktor-Korrelationen<br />
Prädiktor MW/Wo SCL-Prä BSS# Struktur Geschlecht Alter<br />
MW/Wochen 1<br />
SCL-Prä .10 1<br />
BSS# .21 .34** 1<br />
Struktur .44** .06 .38** 1<br />
Geschlecht -.11 .06 .08 .09 1<br />
Alter -.22 -.31* -.20 -.35** -.19 1<br />
Anmerkungen.<br />
* = signifikant auf dem Niveau von .05. ** = signifikant auf dem Niveau von .01 (2-seitig). Alle<br />
signifikanten Korrelationen sind fett markiert. # = Spearman-Korrelation.<br />
Wie Tabelle 5.36 zu entnehmen ist, korreliert in SP3 der MW/Wochen signifikant mit<br />
dem Gesamtstrukturniveau, ein Teil dieser Korrelation ist wiederum bedingt durch die<br />
Konstruktion der Variable. Je höher das Gesamtstrukturniveau, desto größer die Sum-<br />
me im BSS zu Behandlungsbeginn, d.h desto größer die Beeinträchtigung. Die<br />
Gesamtsymptombelastung (SCL-90-R-Prä-Wert) hängt ebenfalls mit großer Beein-<br />
trächtigung im BSS zusammen. Im Unterschied zur SP2 korreliert das Gesamtstruktur-<br />
niveau nicht mit dem SCL-90-R Ausgangswert und dem Geschlecht, dafür aber mit<br />
dem Alter, d.h. je jünger, desto eher strukturell beeinträchtigt und daneben auch mehr<br />
belastet mit Symptomen. Das Geschlecht weist keine signifikanten Zusammenhänge<br />
mit anderen Prädiktoren auf. Die Größe der Zusammenhänge ist als mittelgroß einzu-<br />
stufen und im Einzelnen in der Tabelle 5.36 dargestellt.<br />
Tabelle 5.37<br />
Prädiktor-Kriteriums-Korrelationen in SP3<br />
Prädiktor<br />
Art der Korrelation<br />
SCL-<br />
Prä/Post<br />
SCL-Post<br />
89<br />
Kriterium<br />
VEV-K-<br />
Post<br />
BSS-Prä-<br />
Post-Diff.<br />
Änd.psy<br />
MW/Wo Pearson .19 -.06 .17 -.33* .23<br />
SCL-Prä Pearson .69** .64** -.23 .11 .05<br />
BSS-Prä Spearman .16 .30* -.34* .17 .06<br />
Struktur Pearson -.15 .25 -.38** -.29 .23<br />
Geschlecht Punktbis. .06 .15 -.06 .01 .20<br />
Alter Pearson .02 -.44** -.49** .06 -.12<br />
Anmerkungen.<br />
Punktbis. = Punktbiseriale Korrelation.<br />
* = signifikant auf dem Niveau von .05. ** = signifikant auf dem Niveau von .01 (2-seitig). Alle<br />
signifikanten Korrelationen sind fett markiert.
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
Die Ergebnisse in Tabelle 5.37 zeigen, dass eine große Symptombelastung zu Thera-<br />
piebeginn (SCL-90-R-Prä-Wert) mit einer höheren Symptombelastung zum Therapie-<br />
ende (SCL-90-R-Post-Wert) und einer größeren Reduzierung der Symptombelastung<br />
(SCL-90-R-Prä-Post-Differenz) zusammenhängt. Je höher die Beeinträchtigung zu<br />
Therapiebeginn (BSS-Summe), desto höher auch die Symptombelastung zum Thera-<br />
pieende (SCL-90-R-Post-Wert) und desto weniger Zugewinne an Entspannung, Gelas-<br />
senheit und Optimismus (VEV-K-Post-Wert). Je höher der Anteil an strukturell beein-<br />
trächtigten Patientinnen in der Gruppe (MW/Wochen), desto geringer die Reduzierung<br />
der Beeinträchtigung im BSS, tendenziell fällt auch die Symptomreduktion und die Ver-<br />
änderungen im VEV-K etwas größer aus und die Therapeutinnen schätzen die Verbes-<br />
serungen im psychischen Bereich etwas geringer ein (! Kodierung: 1 = deutlich gebes-<br />
sert). Mehr strukturelle Beeinträchtigungen gehen einher mit mehr Spannung, Pessi-<br />
mismus und Unsicherheit zum Therapieende, wobei ein höheres Gesamtstrukturniveau<br />
auch mit einer geringeren Reduzierung der Symptombelastung, einem höheren Post-<br />
Wert der Symptombelastung, mit einer geringeren Reduzierung der Beeinträchtigungs-<br />
schwere sowie geringerer psychischer Verbesserung zusammenhängt, wenn auch<br />
nicht signifikant. Ältere Patientinnen haben eine geringere Symptombelastung aber<br />
auch weniger Zugewinne an Entspannung, Gelassenheit und Optimismus zum<br />
Entlasszeitpunkt. Die Höhe der Zusammenhänge ist für die SCL-90-R als groß einzu-<br />
stufen, die übrigen Zusammenhänge sind mittelgroß. Alle weiteren schwachen (nicht<br />
signifikanten) Korrelationen sind der Tabelle 5.37 zu entnehmen.<br />
5.7.2.3 Einfache Regressionen auf die Ergebniskriterien in SP3<br />
Es folgt Tabelle 5.38 mit den einfachen Regressionen des Prädiktors „MW/Wochen“<br />
auf die Ergebniskriterien aus den Hypothesen 8a-e.<br />
Tabelle 5.38<br />
Einfache Regressionen des Prädiktors „MW/Wochen“ auf die SCL-90-R-Prä-Post-<br />
Differenz, den VEV-K-Post-Wert, die BSS-Prä-Post-Differenz und die Einschätzung der<br />
psychischen Veränderung durch die Therapeutin in SP3<br />
Kriterium Beta R² F Signifikanz<br />
SCL-90-R-Post-Wert -.059 .003 .164 .687<br />
SCL-90-R-Prä-Post .189 .036 1.735 .194<br />
VEV-K-Post-Wert -.165 .027 1.321 .256<br />
BSS-Prä-Post -.331 .109 5.285 .026<br />
Therapeutinnenrating .150 .022 1.082 .304<br />
Der Prädiktor „MW/Wochen“ hat auf die Vorhersage der BSS-Prä-Post-Differenz einen<br />
signifikanten Einfluss, was für Hypothese 8d spricht, die Hypothesen 8a, 8b, 8c und 8e<br />
90
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
müssen dagegen verworfen werden. Auf die Vorhersage der Gesamtsymptombe-<br />
lastung zum Entlasszeitpunkt hat der „Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen in<br />
der Gruppe“ keinen Einfluss. 10.9 % der Varianz der BSS-Prä-Post-Differenz können<br />
durch diese Variable jedoch erklärt werden. Anschließend soll geprüft werden, ob der<br />
Prädiktor „MW/Wochen“ einen relevanten (eigenen) Beitrag zur Vorhersage leisten<br />
kann.<br />
5.7.2.4 Multiple Regression auf die BSS-Prä-Post-Differenz in SP3<br />
Da der Prädiktor „MW/Wochen“ in SP3 keine relevante Assoziation zum SCL-90-R-<br />
Post-Wert aufweist, wird die multiple Regression auf die signifikant korrelierende BSS-<br />
Prä-Post-Differenz berechnet. Die Ergebnisse mit Einschluss aller Prädiktoren sind in<br />
Tabelle 5.39 dargestellt.<br />
Tabelle 5.39<br />
Multiple Regression mit Einschluss aller Prädiktoren auf die BSS-Prä-Post-Differenz<br />
in SP3<br />
Nicht standardisierte Koef- Standardisierte<br />
fizienten<br />
Koeffizienten<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) 1.884 1.942 .970 .338<br />
BSS-Summe .518 .231 .375 2.240 .031<br />
Gesamtstruktur -1.221 .630 -.354 -1.937 .060<br />
MW/Wochen -1.756 1.065 -.259 -1.648 .108<br />
Alter -.008 .019 -.064 -.400 .691<br />
SCL-Prä-Wert -.033 .344 -.015 -.095 .924<br />
Geschlecht .038 .430 .013 .087 .931<br />
F = 2.124; p = .073<br />
Standardschätzfehler = 1.29915<br />
R² = .133 (unkorr. R² = .251)<br />
Der Beitrag des Prädiktors „MW/Wochen“ zur Vorhersage bleibt nicht erhalten (nur<br />
noch ein Trend p = .073), lediglich die BSS-Summe zu Behandlungsbeginn hat einen<br />
relevanten Einfluss auf die Vorhersage der BSS-Prä-Post-Differenz.<br />
Die Indizes „Toleranz“ und „VIF“ geben Hinweise auf identische Beiträge zur Vorhersa-<br />
ge mehrerer Prädiktoren. Gemeinsame Varianzanteile weisen das Gesamtstrukturni-<br />
veau, der MW/Wochen, das Geschlecht und das Alter auf. Das Gesamtstrukturniveau<br />
hat weitere gemeinsame Varianzanteile mit dem SCL-90-R- und BSS-Ausgangswert<br />
sowie mit dem Alter.<br />
Mittels hierarchischer Regression wurde geprüft, ob es für die beiden Prädiktoren<br />
„MW/Wochen“ und „Gesamtstrukturniveau“ einen eigenen oder über den jeweils ande-<br />
91
Ergebnisse – Hypothesen Kriteriumsvalidität<br />
ren Prädiktor hinausgehenden Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs gibt.<br />
Auf das Kriterium „VEV-K-Post“ hat das Gesamtstrukturniveau einen signifikanten Ein-<br />
fluss, jedoch nicht der MW/Wochen. Auf die Vorhersage des SCL-90-R-Post-Wertes<br />
hat der MW/Wochen lediglich einen Suppressoreffekt, das Gesamtstrukturniveau hat<br />
keinen Einfluss. Auf die Vorhersage der übrigen Kriterien haben beide Prädiktoren kei-<br />
nen Einfluss.<br />
5.8 Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
5.8.1 Hauptuntersuchung<br />
Insgesamt kann von einem allgemeinen Therapieerfolg für SP1 und beide Untergrup-<br />
pen (Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5 und Gesamtstrukturniveau < 2.5), gemessen mit der<br />
SCL-90-R, dem VEV-K, dem EMEK und dem Therapeutinnenrating, sowohl zum The-<br />
rapieende als auch zum Nachuntersuchungszeitpunkt ausgegangen werden. Das<br />
EMEK bildet den Erfolg auf breiter Basis ab, sowohl die Item- als auch die Faktoren-<br />
analyse sprechen für seine Verwendung.<br />
5.8.1.1 Signifikante Korrelationen zwischen Gesamtstrukturniveau und den Kri-<br />
terien des allgemeinen Therapieerfolgs<br />
Statistisch bedeutsame Zusammenhänge fanden sich zwischen Gesamtstrukturniveau<br />
und folgenden Ergebniskriterien:<br />
Je höher (geringer integriert) das Gesamtstrukturniveau desto<br />
kleiner die SCL-90-R-Prä-Post-Differenz, d.h. desto geringer die Reduzierung<br />
der Symptombelastung<br />
höher der SCL-90-R-Post-Wert, d.h. desto höher die Symptombelastung zum<br />
Therapieende<br />
kleiner der VEV-K-Post-Wert, d.h. desto geringer die Zugewinne an Optimis-<br />
mus, Gelassenheit und Entspannung<br />
höher der SCL-90-R-Kat-Wert, d.h. desto höher die Symptombelastung zum<br />
Nachuntersuchungszeitpunkt<br />
kleiner der VEV-K-Kat-Wert, d.h. desto geringer die Zugewinne an Optimismus,<br />
Gelassenheit und Entspannung zum Nachuntersuchungszeitpunkt<br />
Nach diesen Ergebnissen können die Hypothesen 1a, 1b, 1c und 2b, 2c angenom-<br />
men, die Hypothesen 1d, 2a und 2d müssen verworfen werden.<br />
92
Ergebnisse – Zusammenfassung<br />
5.8.1.2 Signifikanter Einfluss des Gesamtstrukturniveaus auf die Vorhersage<br />
der Kriterien des allgemeinen Therapieerfolgs<br />
Das Gesamtstrukturniveau hat einen Einfluss auf die Vorhersage folgender Kriterien:<br />
SCL-90-R-Post-Wert<br />
VEV-K-Post-Wert<br />
SCL-90-R-Kat-Wert<br />
Auf die Vorhersage der Ergebniskriterien SCL-90-R-Prä-Post-Differenz,<br />
Therapeutinnenrating, SCL-90-R-Prä-Kat-Differenz, VEV-K-Kat und EMEK hat der<br />
Prädiktor „Gesamtstrukturniveau“ keinen statistisch bedeutsamen Einfluss. Die Hypo-<br />
thesen 3b, 3c und 4b können angenommen, die Hypothesen 3a, 3d, 4a, 4c und 4d<br />
müssen verworfen werden.<br />
5.8.1.3 Signifikante Korrelationen ausgewählter Prädiktoren mit den Kriterien<br />
des allgemeinen Therapieerfolgs<br />
Zusammenhänge mit dem allgemeinen Therapieerfolg konnten für folgende Variablen<br />
gefunden werden (Gesamtstrukturniveau siehe 5.8.1.1):<br />
Je höher der SCL-90-R-Prä-Wert, desto größer die Reduzierung der<br />
Symptombelastung in der SCL-90-R und desto höher der SCL-90-R-Wert zum<br />
Therapieende und Nachuntersuchungszeitpunkt.<br />
Je höher die Belastung im BSS, desto höher die Symptombelastung in der<br />
SCL-90-R, desto geringer die Zugewinne an Optimismus, Entspannung und<br />
Gelassenheit (VEV-K) zum Klinikaustritt und Katamnesezeitpunkt und desto<br />
niedriger der EMEK-Quotient (geringerer Therapieerfolg). Die Reduzierung der<br />
Symptombelastung (SCL-90-R-Prä-Post) hängt jedoch nicht damit zusammen.<br />
Je länger die Arbeitsunfähigkeit im Jahr vor der Behandlung, desto höher die<br />
allgemeine Symptombelastung zum Therapieende, gemessen mit der SCL-90-<br />
R.<br />
Je mehr körperliche und psychische Diagnosen, desto höher die<br />
Symptombelastung zum Therapieende und Nachuntersuchungszeitpunkt und<br />
desto größer die Reduzierung dieser Belastung zum Nachuntersuchungszeit-<br />
punkt (SCL-90-R-Prä-Kat-Differenz).<br />
Patientinnen sind schwerer belastet als Patienten.<br />
Stärker motivierte Patientinnen haben eine geringere Symptombelastung zum<br />
Therapieende (SCL-90-R-Post), größere Zugewinne an Optimismus, Gelas-<br />
93
Ergebnisse – Zusammenfassung<br />
senheit und Entspannung zur Entlassung (VEV-K-Post) und nach Einschätzung<br />
der Therapeutinnen eine größere psychische Verbesserung.<br />
Je älter die Patientinnen, desto geringer die Symptombelastung zum Therapie-<br />
ende (SCL-90-R-Post) und desto größer die Zugewinne an Optimismus, Gelas-<br />
senheit und Entspannung zum Therapieende.<br />
Keine Zusammenhänge fanden sich für die Dauer der Erkrankung und eine komorbide<br />
Persönlichkeitsstörung.<br />
5.8.1.4 Signifikante Korrelationen des Gesamtstrukturniveaus mit den ausge-<br />
wählten Prädiktoren<br />
Relevante Assoziationen fanden sich für folgende Variablen:<br />
Je höher (geringer integriert) das Gesamtstrukturniveau, desto höher auch die<br />
Schwere der Beeinträchtigung im BSS.<br />
Je höher (geringer integriert) das Gesamtstrukturniveau, desto mehr Diagnosen<br />
wurden vergeben.<br />
Je höher (geringer integriert) das Gesamtstrukturniveau, desto länger dauerte<br />
die Erkrankung bereits.<br />
Je höher (geringer integriert) das Gesamtstrukturniveau, desto eher lag eine<br />
komorbide Persönlichkeitsstörung vor.<br />
Je höher (geringer integriert) das Gesamtstrukturniveau, desto geringer die Mo-<br />
tivation zu Behandlungsbeginn.<br />
5.8.1.5 Signifikanter Einfluss der ausgewählten Prädiktoren und Relevanz des<br />
Einflusses des Gesamtstrukturniveaus auf die Vorhersage des Thera-<br />
pieerfolgs<br />
Bei gleichzeitiger Prüfung ausgewählter Prädiktoren (stepwise Regression) haben fol-<br />
gende Variablen einen Einfluss auf die Vorhersage des SCL-90-R-Wertes zum Thera-<br />
pieende:<br />
SCL-90-R-Prä-Wert<br />
Geschlecht<br />
BSS-Prä-Summe<br />
Gesamtstrukturniveau<br />
Arbeitsunfähigkeit<br />
94
Ergebnisse – Zusammenfassung<br />
Bei gleichzeitiger Prüfung ausgewählter Prädiktoren (stepwise Regression) haben fol-<br />
gende Variablen einen Einfluss auf die Vorhersage des SCL-90-R-Wertes zum Na-<br />
chuntersuchungszeitpunkt:<br />
SCL-90-R-Prä-Wert<br />
BSS-Prä-Summe<br />
Hypothese 5 kann für den SCL-90-R-Post-Wert angenommen werden, das Gesamt-<br />
strukturniveau leistet einen relevanten Beitrag zur Vorhersage zum Therapieende. Hy-<br />
pothese 6 muss verworfen werden, auf die Vorhersage des Therapieerfolgs zum Na-<br />
chuntersuchungszeitpunkt hat das Gesamtstrukturniveau keinen Einfluss.<br />
5.8.2 Nebenuntersuchung<br />
Sowohl in SP2 als auch in SP3 kann von einem allgemeinen Therapieerfolg (gemes-<br />
sen mit SCL-90-R, VEV-K und BSS) ausgegangen werden. Statistisch bedeutsame<br />
Zusammenhänge zwischen dem „Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen“ und<br />
dem „Therapieerfolg“ bestehen in SP2 nicht. In SP3 hängt ein höherer „Anteil struktu-<br />
rell beeinträchtigter Patientinnen in einer Gruppe“ mit einer geringeren Reduzierung<br />
der Beeinträchtigung im BSS zum Therapieende zusammen. Hypothese 7d kann da-<br />
her in einer Stichprobe (SP3) angenommen, die Hypothesen 7a-c und 7e müssen<br />
verworfen werden.<br />
Einen auffallenden Zusammenhang weist das Alter in SP3 mit mehreren Variablen auf.<br />
Je älter, desto niedriger der SCL-90-R-Prä- und Post-Wert, was einer geringeren<br />
Symptombelastung entspricht, aber auch desto geringer die Zugewinne an Optimis-<br />
mus, Entspannung und Gelassenheit im VEV-K zum Therapieende. Außerdem haben<br />
Ältere niedrigere Werte im Strukturniveau als Jüngere, d.h. weniger strukturelle Beein-<br />
trächtigungen.<br />
Einen Einfluss auf die Vorhersage des Therapieerfolgs hat der „Anteil strukturell beein-<br />
trächtigter Patientinnen“ in SP2 für keines der gemessenen Kriterien, in SP3 nur bei<br />
einfacher Regression auf das Kriterium „BSS-Prä-Post-Differenz“. Hierfür kann Hypo-<br />
these 8d in SP3 angenommen, die Hypothesen 8a-c und 8e müssen verworfen<br />
werden. Bei gleichzeitiger Prüfung konkurrierender Prädiktoren kann jedoch keine<br />
prognostische Bedeutung mehr festgestellt werden (nur noch ein Trend). Es zeigen<br />
sich außerdem gemeinsame Varianzanteile bei der Vorhersage zwischen dem<br />
MW/Wochen, Geschlecht, Alter und Gesamtstruktur sowie zwischen SCL-90-R, BSS<br />
und Gesamtstruktur und zwischen Gesamtstruktur und Alter.<br />
95
Ergebnisse – Zusammenfassung<br />
Insgesamt muss zur Beantwortung der Forschungsfragen auf Kapitel 6 verwiesen wer-<br />
den, da die Ergebnisse differenziert betrachtet und diskutiert werden müssen.<br />
6 Diskussion<br />
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Prüfung der Kriteriumsvalidität der OPD und die<br />
Untersuchung der Frage, ob ein höherer Anteil an Patientinnen mit strukturellen Defizi-<br />
ten (mäßig bis gering integriert) in einer therapeutischen Gruppe sich negativ auf den<br />
Therapieerfolg auswirkt. Im Diskussionsteil werden zunächst einige methodische As-<br />
pekte der vorliegenden Untersuchung betrachtet, die bei der Bewertung und Interpreta-<br />
tion der Ergebnisse sowie im Hinblick auf ihre Generalisierbarkeit auf andere Patientin-<br />
nen zu beachten sind. Es lassen sich folgende Problembereiche skizzieren: Das ge-<br />
wählte Untersuchungsdesign und die eingesetzten Messinstrumente, die Auswahl der<br />
Prädiktoren, die Erfassung des Therapieerfolgs sowie eventuell aufgetretene Stichpro-<br />
benselektionseffekte. Des Weiteren werden in diesem Kapitel die Ergebnisse entlang<br />
der Fragestellungen und auf dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes disku-<br />
tiert und kritisch beleuchtet. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse dieser<br />
Untersuchung noch einmal zusammengefasst, ein Resümee gezogen und ein Ausblick<br />
auf mögliche weitere Forschungen gegeben.<br />
6.1 Methodische Kritik<br />
6.1.1 Untersuchungsdesign<br />
Zur Untersuchung der Fragestellungen wurde auf die vorliegenden, routinemäßig in der<br />
HELIOS Klinik Bad Grönenbach erfassten Daten zurückgegriffen. Dadurch konnte ein<br />
breites Spektrum an Variablen in die Untersuchung einfließen, die Auswahl war jedoch<br />
darauf begrenzt. So konnten beispielsweise Persönlichkeits-Variablen wie Erwartungs-<br />
haltung, Ich-Stärke, psychologisches Denken (psychological mindedness), Attributions-<br />
oder Coping-Stile sowie soziale Unterstützung, die nach Lambert (2003) ebenfalls ent-<br />
scheidende Patientinnenvariablen sind, nicht in die Untersuchung einfließen. Des Wei-<br />
teren ist nach Lambert (2003) die Interaktion von Patientinnen-, Therapeutinnen- und<br />
Behandlungsvariablen entscheidend, auf die in vorliegender Untersuchung aus zeitli-<br />
chen und Seitenbegrenzungen ebenfalls nicht eingegangen werden konnte.<br />
Auch die Erfassung des Therapieerfolgs unterliegt diesen Beschränkungen. Diese er-<br />
folgte einerseits durch singuläre Ergebniskriterien (direkt und indirekt gemessen), an-<br />
dererseits durch ein multiples Ergebniskriterium auf mehreren Ebenen durch Selbst-<br />
96
Diskussion – Methodische Kritik<br />
und Fremdeinschätzung, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie den<br />
methodischen Mindestanforderungen entspricht. Es findet jedoch keine Untersuchung<br />
mit störungsspezifischen Instrumenten statt, sondern nur durch allgemeine, schul- und<br />
störungsübergreifende Maße. Aus diesem Grund beziehen sich die Ergebnisse aus<br />
dieser Arbeit nur auf den allgemeinen, globalen Therapieerfolg.<br />
Ein großer Teil der Untersuchung basiert auf Selbstaussagen der Patientinnen, bei<br />
denen immer die Gefahr von Verzerrungen, Ungenauigkeiten und Unzuverlässigkeiten<br />
besteht. Bei den Einschätzungen seitens der Therapeutinnen ergibt sich zudem das<br />
Problem, dass diese nicht einheitlich von der gleichen Person vorgenommen wurden,<br />
sondern von den jeweiligen Gruppentherapeutinnen, was die Vergleichbarkeit und so-<br />
mit die Objektivität einschränkt.<br />
Durch unterschiedliche Datenausfälle kann zudem nicht für alle Untersuchungen von<br />
der gleichen Stichprobengröße ausgegangen werden, was zu weiteren Verzerrungen<br />
geführt haben könnte. Fragebogendaten lagen für die gesamte Untersuchungsstich-<br />
probe vor (Auswahlkriterium), die Einschätzung des psychischen Befindens zum The-<br />
rapieende für 189 von 196 Patientinnen, was den Gesamtstichprobenwert jedoch nicht<br />
wesentlich verkleinert (nur 3.2 % kleinere Stichprobe), so dass insgesamt davon aus-<br />
gegangen werden kann, dass es aufgrund der Datenausfälle nur zu sehr geringen Ver-<br />
zerrungen gekommen sein dürfte. Die Anzahl der Fälle, für die EMEK-Teilkriterien rele-<br />
vant waren, sind Tabelle 5.3 zu entnehmen und die Auswirkungen daraus werden un-<br />
ter 6.2.1 diskutiert.<br />
Ein weiterer Nachteil der Untersuchung ist das Fehlen einer Kontrollgruppe. So ist es<br />
möglich, dass die gefundenen statistisch signifikanten Veränderungen auf Regressi-<br />
onseffekten beruhen (Bortz & Döring, 1995), was die Aussagekraft der Untersuchung<br />
einschränkt und den kausalen Wirkmechanismus in Zweifel zieht. Ein solches Single-<br />
group-Design ist zwar nach Bortz und Lienert (1998) typisch für diese Art von Studien<br />
und auch nach Meinung des Arbeitskreises OPD (OPD-1, 2001) sind naturalistische<br />
Studien dieser Art anzustreben, es wäre jedoch durchaus denkbar, aus den Patientin-<br />
nen der Warteliste auf den Klinikaufenthalt eine nicht behandelte Kontrollgruppe zu<br />
erheben. Dies war jedoch im Rahmen der Routinediagnostik der HELIOS Klinik Bad<br />
Grönenbach nicht realisierbar. So wäre beispielsweise eine zusätzliche Erhebung zwi-<br />
schen Erstkontakt und Aufnahme aus methodischen Gründen wünschenswert. Des<br />
Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Therapieergebnisse im Behand-<br />
lungs- und insbesondere im Katamnesezeitraum durch weitere intervenierende Variab-<br />
len und Störvariablen (z.B. anschließende ambulante Therapie, Medikamentenein-<br />
97
Diskussion – Methodische Kritik<br />
nahme, private oder berufliche Veränderungen) verursacht oder beeinflusst wurden,<br />
was bei der Interpretation mit beachtet werden muss.<br />
6.1.2 Messinstrumente<br />
Die zur Erfassung des Therapieerfolgs und der Prädiktoren verwendeten Messinstru-<br />
mente können als allgemein verbreitet und gut vergleichbar eingestuft werden. Der<br />
Forderung nach unterschiedlichen Datenquellen entsprechen die Selbsteinschätzun-<br />
gen in den Fragebögen einerseits und die Einschätzungen durch die Therapeutinnen<br />
andererseits.<br />
Die Psy-BaDo-PTM wird in der stationären Versorgung standardmäßig erfasst, die Gü-<br />
tekriterien sind jedoch noch schwer beurteilbar, da lediglich eine Untersuchung zur<br />
Reliabilität vorliegt. Die Chronifizierungsdauer der Beschwerden wurde in dieser Unter-<br />
suchung als besonders schlecht erfasst beurteilt. Die Patientinnen unterschätzten die<br />
Dauer ihrer Erkrankung, für die übrigen Einschätzungen kann davon ausgegangen<br />
werden, dass sie ausreichend genau erfasst worden sind (vgl. Mestel et al., 2010; sie-<br />
he 4.3.2). Über die Reliabilität der Items aus dem Grönenbacher Nachbefragungsbo-<br />
gen, der zur Erstellung des EMEK herangezogen wurde, lassen sich keine Aussagen<br />
machen.<br />
Der GSI der SCL-90-R zeichnet sich durch eine sehr gute Reliabilität (α = .97, siehe<br />
4.3.3) aus und ist eines der am häufigsten verwendeten Instrumente zur Messung von<br />
Therapieerfolg (Lambert & Hill, 1994). Aus diesem Grund und der daraus resultieren-<br />
den großen Vergleichbarkeit mit anderen Studien wird er von mehreren Autoren zur<br />
Messung des Therapieerfolgs empfohlen, sofern dieser über die störungsübergreifende<br />
Gesamtsymptombelastung operationalisiert ist (z.B. Baumann et al., 1990; Mestel et<br />
al., 2001).<br />
Der VEV-K erfasst subjektiv empfundene Veränderungen aus inhaltlich verschiedenen<br />
Bereichen und weist zuverlässige, an mehreren Stichproben geprüfte testtheoretische<br />
Kennwerte auf. Die gleichzeitige Erfassung des Kriteriums auf direktem und indirektem<br />
Wege wird in der Literatur empfohlen (z.B. Michalak et al., 2003) und dem wird durch<br />
die Verwendung des VEV-K, der Differenz des SCL-90-R-GSIs und der BSS-Summe<br />
entsprochen. Da es das Ziel war, das Ergebniskriterium durch unterschiedliche Arten<br />
der Konstrukterfassung abzubilden (direkt vs. indirekt), erscheint die Verwendung die-<br />
ser Instrumente sinnvoll und gerechtfertigt.<br />
98
Diskussion – Methodische Kritik<br />
Der BSS fließt als zusätzliche Fremdeinschätzung ein, um neben den Selbstaussagen<br />
eine weitere Sichtweise abzubilden und die Objektivität der Einschätzungen zu verbes-<br />
sern.<br />
Über die Reliabilität und Validität der Einschätzung der „Psychischen Veränderung“<br />
durch die Therapeutinnen kann keine Aussage gemacht werden. Nach Befunden von<br />
Mestel, Klingelhöfer und Stauss (1999) schätzen diese den Erfolg häufig günstiger ein<br />
als die Patientinnen selbst. Um den Therapieerfolg multiperspektivisch abzubilden er-<br />
scheint dieses Kriterium dennoch sinnvoll. Die OPD-Einschätzungen und anderen Ein-<br />
schätzungen aus Expertensicht können als ausreichend reliabel bezeichnet werden<br />
(siehe 4.3 und 2.3.1).<br />
6.1.3 Generalisierbarkeit der Ergebnisse<br />
Die Rücklaufquote lag bei 72 %, die Aufnahmequote in die Untersuchungsstichprobe<br />
bei 57.5 %, was eine Prüfung auf systematische Unterschiede der in die Untersu-<br />
chungsstichprobe (SP1) Eingeschlossenen und Ausgeschlossenen nötig machte.<br />
Dieser Vergleich der Eingeschlossenen und Ausgeschlossenen hinsichtlich mehrerer<br />
relevanter Variablen ergab, dass die Untersuchungsstichprobe als weitgehend reprä-<br />
sentativ für die Gesamtstichprobe gelten kann, wobei jedoch nicht auszuschließen ist,<br />
dass die Eingeschlossenen sich in anderen, nicht erhobenen Variablen von den Aus-<br />
geschlossenen unterscheiden. Die Eingeschlossenen haben ein signifikant höheres<br />
Bildungsniveau und signifikant höher gestellte Beschäftigungsverhältnisse. Die Ausge-<br />
schlossenen befanden sich zudem häufiger noch in Ausbildung oder waren ohne Ab-<br />
schluss. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Menschen in Ausbildung öfter ihren<br />
Wohnort wechseln und daher schwerer erreichbar waren und dass Menschen mit hö-<br />
herer Bildung generell pflichtbewusster sind und den Nutzen einer Evaluation höher<br />
einschätzen und somit eher bereit sind die Mühen dafür auf sich zu nehmen.<br />
Im Hinblick auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse kann zudem festgestellt werden,<br />
dass die Patientinnen der Untersuchungsstichprobe stationär in einer psychosomati-<br />
schen Reha-Klinik behandelt wurden, was in vergleichbaren Untersuchungen (z.B.<br />
Mestel et al., 2004; Cierpka et al., 2001) ebenfalls meist der Fall war und somit die<br />
Vergleichbarkeit der Ergebnisse erhöht.<br />
Was die Berufstätigkeit angeht, waren im Vergleich zum Jahr 2008 weniger Angestellte<br />
in Behandlung. Der Anteil hierfür betrug 70.9 % (2008: 91 %) in der HELIOS Klinik Bad<br />
Grönenbach, der Durchschnitt vergleichbarer <strong>Kliniken</strong> lag in 2008 bei 56 %. Somit nä-<br />
99
Diskussion – Methodische Kritik<br />
hert sich der Wert für die Untersuchungsstichprobe dem Durchschnittswert anderer<br />
<strong>Kliniken</strong> an (Angaben aus der Rehabilitandenbefragung der DRV, 2009).<br />
Das Geschlechterverhältnis liegt bei 69.9 % Frauen und 30.1 % Männern mit einem<br />
mittleren Alter von 39.4 Jahren. Im Vergleich dazu waren nach Angaben der Deut-<br />
schen Rentenversicherung im Jahr 2008 83 % Frauen und nur 17 % Männer in der<br />
HELIOS Klinik Bad Grönenbach, der Durchschnitt aller DRV-<strong>Kliniken</strong> mit ähnlicher<br />
Ausrichtung lag bei 68 % Frauen und 32 % Männern und damit ist die Untersuchungs-<br />
stichprobe hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses mit anderen <strong>Kliniken</strong> vergleich-<br />
bar. Vom Alter her sind die Patientinnen eher jünger als in vergleichbaren Einrichtun-<br />
gen. Das Bildungsniveau ist relativ hoch, 45.9 % der Patientinnen hatten Abitur, aber<br />
vergleichbar mit anderen Untersuchungen derselben Klinik (z.B. Wittmann, Held, Ru-<br />
dolf & Schulze, 1996). In vergleichbaren anderen Einrichtungen geben durchschnittlich<br />
20 % an, mindestens ein Fachabitur abgelegt zu haben (DRV, 2009).<br />
Hinsichtlich der Hauptdiagnosen zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Jahr 2008 in der<br />
HELIOS Klinik Bad Grönenbach, andere Psychosomatische Reha-<strong>Kliniken</strong> unterschei-<br />
den sich jedoch dahingehend (DRV, 2009). In der Untersuchungsstichprobe wiesen<br />
55.6 % eine „Affektive Störung“ (HELIOS Klinik 2008: 61 %), 14.4 % (2008: 16 %) eine<br />
„Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störung“ und 16.3 % (2008: 12 %) eine<br />
„Essstörung“ auf. Vergleichbare <strong>Kliniken</strong> diagnostizieren im Durchschnitt 50 % „Affekti-<br />
ve Störungen“, 42 % „Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen“ und 1 %<br />
„Essstörungen“ (DRV, 2009). Insgesamt wurden etwas mehr affektive Störungen, we-<br />
niger Belastungsstörungen und mehr Essstörungen als in anderen <strong>Kliniken</strong> behandelt.<br />
Über die Auswirkungen dieser Zusammensetzung kann in vorliegender Untersuchung<br />
keine Aussage gemacht werden.<br />
Selektionseffekte vor Beginn der psychotherapeutischen Behandlung sind ebenfalls<br />
nicht auszuschließen: So mussten die Patientinnen eine Reihe von Auflagen erfüllen,<br />
beispielsweise mussten Personen mit Suchterkrankungen vor ihrer Aufnahme in die<br />
Klinik mindestens drei Monate abstinent sein und regelmäßig Selbsthilfegruppen be-<br />
sucht haben. Hinzu kommt, dass Patientinnen mit akuten Psychosen und suizidale<br />
Patientinnen nicht aufgenommen wurden.<br />
Insgesamt dürfte es sich bei den genannten Problemen jedoch nicht um Besonderhei-<br />
ten der vorliegenden Untersuchung handeln, sondern vielmehr um Schwierigkeiten, die<br />
in vielen vergleichbaren Studien auftreten. Die erhaltenen Befunde können daher mit<br />
denen ähnlicher Studien verglichen und auf andere Patientinnen im stationären psy-<br />
100
Diskussion – Methodische Kritik<br />
chosomatischen Setting übertragen werden, wenn die geringfügigen Abweichungen<br />
und Besonderheiten bei der Interpretation beachtet werden.<br />
6.2 Diskussion der Ergebnisse<br />
Insgesamt betrachtet kann aus den Ergebnissen in Kapitel 5 geschlossen werden,<br />
dass das Ziel der Arbeit, die Bestätigung der Kriteriumsvalidität als erreicht angesehen<br />
werden kann. Dies soll im Folgenden differenziert betrachtet werden. Dazu werden<br />
zunächst die Ergebnisse für das EMEK diskutiert und anschließend der allgemeine<br />
Therapieerfolg beleuchtet, da dieser eine Voraussetzung zur Prüfung der<br />
Kriteriumsvalidität ist. Darauf aufbauend wird auf die gefundenen Zusammenhänge<br />
und signifikanten Prädiktoren sowie die Ergebnisse aus den Regressionsanalysen ein-<br />
gegangen (Hypothesen 1 - 8). Dabei werden die Fragestellungen der Arbeit vor dem<br />
Hintergrund der bisherigen Forschungen diskutiert.<br />
6.2.1 Analyse des einzelnen multiplen Ergebniskriteriums (EMEK)<br />
Um den Therapieerfolg nicht nur durch singuläre Kriterien zu erfassen, wurde ein „ein-<br />
zelnes multiples Ergebniskriterium“ zum Nachuntersuchungszeitpunkt gebildet. Aus<br />
testtheoretischer Sicht kann dieses Kriterium als reliabler und valider Index bezeichnet<br />
werden, der eine Art Generalfaktor aufweist und die unterschiedlichen Dimensionen,<br />
die erfasst werden sollen, gut abbildet (mittlere Trennschärfe von .47, Cronbach´s<br />
α = .84).<br />
Die Mittelwerte der Einzelkriterien liegen durchschnittlich bei .63 (mittlere SD = .47) mit<br />
einer Spannweite von .44 bis .78, nach konservativer Kodierung bei einem Mittelwert<br />
von .52 und einem Range von .15 - .77. Die große Spannweite lässt sich aus den vie-<br />
len fehlenden Werten erklären. Aus methodischen Gründen konnte die Berechnung der<br />
Item- und Faktorenanalyse nur mit konservativer Kodierung durchgeführt werden, da<br />
andernfalls nur n = 22 Fälle in die Analyse hätten eingehen können (siehe Tabelle 5.3).<br />
Im Vergleich zur Studie von Schmidt (1991) liegen die Reliabilität und der Mittelwert<br />
etwas unter dem Wert von α = .86 und dem Mittelwert von .66.<br />
Aus faktorenanalytischer Sicht (siehe 5.1.2) betrachtet, laden die Einzelkriterien (parti-<br />
elle standardisierte Regressionsgewichte; siehe Mustermatrix in Tabelle 5.4) auf min-<br />
destens 2 Faktoren (außer AU) und teilweise auch ähnlich hoch, so dass sie inhaltlich<br />
nicht ganz eindeutig interpretiert werden können. Dies könnte auf das Einwirken zu-<br />
sätzlicher nicht erfasster Außenfaktoren in der Zeit nach der Behandlung zurückzufüh-<br />
ren sein oder darauf, dass beispielsweise Änderungen im sozialen Bereich (angesto-<br />
ßen durch die Behandlung oder auch nicht) wie eine neue Beziehung auch Verbesse-<br />
101
Diskussion - Ergebnisse<br />
rungen im körperlichen und psychischen Befinden bewirken können oder umgekehrt.<br />
Ähnliche Zusammenhänge sind für andere Einzelkriterien auch vorstellbar. Die Unter-<br />
schiede zwischen den partiellen standardisierten Regressionsgewichten (Mustermatrix)<br />
und den Korrelationen von Kriterium und Faktor (Strukturmatrix) zeigen auch, dass die<br />
Faktoren miteinander korreliert sind, was vorher vermutet worden ist und weshalb eine<br />
Promax-Rotation durchgeführt wurde.<br />
Das Kriterium Medikamentenverbrauch hat eine geringe Trennschärfe, einen geringen<br />
Mittelwert und eine kleine Kommunalität. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein<br />
hoher Medikamentenverbrauch weder als Therapieerfolg noch als –misserfolg interpre-<br />
tiert werden kann. Einerseits kann es ein Fortschritt sein, weniger Medikamente neh-<br />
men zu müssen, weil eine Symptombesserung eingetreten ist, andererseits kann es<br />
auch ein Erfolg sein, die nötigen Medikamente, die vielleicht vor der Therapie verwei-<br />
gert worden sind, im Anschluss an die Behandlung einzunehmen. Da sich die Reliabili-<br />
tät ohne dieses Kriterium nicht verschlechtert (Cronbach´s α = .85) und es inhaltlich<br />
nicht eindeutig interpretierbar ist, erscheint es sinnvoll, dieses Kriterium künftig nicht<br />
mehr aufzunehmen.<br />
Die beiden Kriterien zur Arbeitsunfähigkeit weisen ebenfalls geringe Trennschärfen auf,<br />
laden aber hoch auf einem Faktor (hohe Kommunalitäten mit Einfachstruktur), so dass<br />
vermutet werden kann, dass diese eine eigene wichtige Dimension darstellen und<br />
deswegen mit dem Gesamtindex nicht stark zusammenhängen. Die Reliabilität würde<br />
sich ohne diese Kriterien zwar nicht verschlechtern (Cronbach´s α = .85), so dass aus<br />
dieser Sicht auf diese beiden Kriterien verzichtet werden könnte, aus inhaltlicher Sicht<br />
erscheint es dennoch sinnvoll sie beizubehalten.<br />
Insgesamt weist die Faktorenstruktur einen Hauptfaktor mit hauptsächlich Einzelein-<br />
schätzungen bezüglich verschiedener Veränderungen auf, einen Faktor mit den Fra-<br />
gebogeneinschätzungen (SCL-90-R und VEV-K) und einen Faktor, der sich auf die<br />
Arbeitsunfähigkeit zurückführen lässt, so dass man den 3 Faktoren grob die Einzelfra-<br />
gen, die Fragebögen und schließlich die Arbeitsunfähigkeit zuordnen kann. Ein Gene-<br />
ralfaktor, auf dem 9 der 15 Einzelkriterien mit ≥ .50 laden, wurde bei Schmidt (1991)<br />
ebenfalls gefunden.<br />
Im Hinblick auf Zusammenhänge mit den weiteren erfassten Ergebniskriterien zum<br />
Nachuntersuchungszeitpunkt (gleicher Messzeitpunkt) zeigt das EMEK, dass es mit<br />
allen Kriterien signifikant korreliert (p ≤ .01), besonders hoch mit dem VEV-K (r = .80),<br />
was für die Verwendung des Kriteriums spricht. Ein weiterer signifikanter Zusammen-<br />
102
Diskussion - Ergebnisse<br />
hang besteht sogar zur Einschätzung der Veränderung des Erlebens und Verhaltens<br />
zum Therapieende (VEV-K-Post).<br />
6.2.2 Therapieerfolg<br />
Alle in dieser Arbeit erfassten Ergebniskriterien, der SCL-90-R-GSI, der VEV-K, die<br />
Therapeutinneneinschätzung und das EMEK zeigen für die Mehrheit der Patientinnen<br />
einen Therapieerfolg zum Therapieende und ein Jahr danach. Nach den Cohen-<br />
Kriterien und Grawe-Korrektur sind die Effektstärken, berechnet aus dem GSI der SCL-<br />
90-R, zum Therapieende groß (d = 0.93) und zum Nachuntersuchungszeitpunkt fast<br />
groß (d = 0.84) und liegen im Vergleich zu anderen Studien (z.B. Metaanalyse von<br />
Grawe et al., 1994; Mestel et al., 2000; Mestel et al., 2004) in einem mittleren Bereich.<br />
Die Höhe der Effektstärke ist jedoch von der Streuung in der Stichprobe stark abhängig<br />
und diese ist in naturalistischen Studien naturgemäß höher als in kontrollierten Studien<br />
mit homogenen Patientinnenstichproben, vergleichbar sind somit nur Studien mit ähnli-<br />
chen Selektionskriterien. Auch die Art der Berechnung (welches Kriterium und welche<br />
Streuung im Nenner herangezogen werden) hat einen Einfluss auf die Höhe des Er-<br />
gebnisses (vgl. 4.5.2). Des Weiteren werden bei dieser Art der Berechnung individuelle<br />
Unterschiede herausgemittelt. Aus diesem Grund wurden Einzelfallanalysen nach dem<br />
Kriterium der klinischen Signifikanz berechnet, die zeigen, dass für 39.8 % der Patien-<br />
tinnen zum Entlasszeitpunkt eine klinisch relevante Verbesserung eintrat und für weite-<br />
re 17.9 % zumindest eine reliable, d.h. statistisch signifikante Verbesserung. Auch ein<br />
Jahr später waren 40.3 % klinisch relevant verbessert und 14.5 % reliabel verbessert.<br />
Bei Mestel et al. (2004) waren 25.5 % der Patientinnen klinisch relevant gebessert,<br />
dafür war dort der Anteil der reliabel Verbesserten mit 34.5 % deutlich größer als der<br />
hier gefundene Wert. Dies könnte mit dem höheren Ausgangsniveau bei Mestel (GSI-<br />
Prä = 1.36 zu 1.15 in SP1) zusammenhängen, der eine klinisch relevante Verbesse-<br />
rung in Richtung Symptomfreiheit erschwert. Bei Mestel et al. (2000) sind in der Grup-<br />
pe der 1-Jahres-Katamnese keine Testnormalen vertreten, wesentlich mehr Patientin-<br />
nen unverändert (32.5 %), deutlich mehr Verschlechterte (13.7 %), mehr reliabel Ver-<br />
besserte (28.7 %) und weniger klinisch relevant gebesserte Patientinnen (25 %). Auch<br />
hier liegt der Ausgangs-Mittelwert der SCL-90-R deutlich höher (GSI-Prä = 1.32; SD =<br />
0.53).<br />
Betrachtet man den Verlauf der Effektstärken fallen diese zum Nachuntersuchungs-<br />
zeitpunkt insgesamt leicht ab, die Mittelwerte unterscheiden sich zwischen diesen zwei<br />
Messzeitpunkten jedoch nicht signifikant. Ein signifikanter Rebound-Effekt wie er bei-<br />
spielsweise von Mestel et al. (2000) gefunden wurde, konnte folglich nicht festgestellt<br />
103
Diskussion - Ergebnisse<br />
werden. Die Stichprobenselektion unterscheidet sich in dieser Arbeit jedoch grundle-<br />
gend von der dortigen Auswahl (ausschließlich depressive Patientinnen). Eine hoch-<br />
signifikante Reduktion (mittlerer Effekt) der Gesamtsymptombelastung im Vergleich<br />
zum Therapiebeginn bleibt auch zum Nachuntersuchungszeitpunkt bestehen. Bei<br />
Nachuntersuchungen einige Zeit nach dem Klinikaufenthalt können immer auch andere<br />
Faktoren (z.B. erneute Behandlung, Scham oder Antriebslosigkeit, die zur Nichtteil-<br />
nahme führen) eine Rolle spielen, die in vorliegender Untersuchung nicht erfasst wur-<br />
den, so dass keine Aussagen über solche eventuellen Störvariablen gemacht werden<br />
können.<br />
Vergleicht man die beiden Untergruppen der gut bis mäßig strukturierten Patientinnen<br />
und der mäßig bis gering strukturierten Patientinnen zeigen sich im Mittelwertvergleich<br />
der SCL-90-R zwar signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, jedoch nicht für<br />
die Interaktion mit der Zeit. Beide Gruppen profitieren, mäßig bis gering strukturierte<br />
Patientinnen hatten zu Behandlungsbeginn, Klinikaustritt und Nachuntersuchungszeit-<br />
punkt eine höhere Symptombelastung. Dies entspricht den Befunden von Mestel et al.<br />
(2004). Die Effektstärken fallen jedoch für die mäßig bis gering Strukturierten deutlich<br />
kleiner als für die gut bis mäßig Strukturierten aus (Post d = 0.56 zu 1.00 und Kat<br />
d = 0.57 zu 0.89), was einerseits an der größeren Streuung innerhalb dieser Gruppe<br />
und der kleineren Teilstichprobe liegen könnte, aber auch an dem tatsächlich geringe-<br />
ren (wenn auch nicht signifikant) Therapieerfolg, der sich auch auf Einzelfallebene für<br />
diese Gruppe zeigt. Im Vergleich zur Untersuchung von Mestel et al. (2004) für eine<br />
der Gruppe I ähnliche Stichprobe (MW Gesamtstruktur = 2.42, SD = 0.56 zu Gruppe I:<br />
MW = 2.53, SD = 0.13) liegt die Effektstärke für diese Untergruppe mit d = 0.56 deut-<br />
lich unter dem dort gefundenen Wert von ES = 0.74 (ebenfalls ESprä zum<br />
Entlasszeitpunkt). Die Standardabweichungen (SCL-90-R) zu Behandlungsbeginn lie-<br />
gen in beiden Stichproben nah beieinander (Mestel: SD = 0.66, Gruppe I: SD = 0.63)<br />
und der Post-Wert der SCL-90-R liegt in vorliegender Arbeit auch nur gering (0.03<br />
Punkte) über dem Wert bei Mestel et al. (2004). Hier könnte ebenfalls das geringere<br />
Ausgangsniveau (1.36 zu 1.25) im Vergleich zu Mestel et al. (2004) eine Rolle spielen,<br />
eine höhere Belastung kann mehr reduziert werden als eine weniger hohe Belastung<br />
und ergibt demzufolge rechnerisch eine größere Differenz. Des Weiteren wurden die<br />
Patientinnen bei Mestel et al. (2004) deutlich länger (Mestel: MW = 81.5 Tage,<br />
SD = 39.3: vorliegende Arbeit: MW = 54 Tage, SD = 12 Tage) und im für die Mehrheit<br />
der Patientinnen speziell auf strukturelle Defizite ausgerichteten Konzept behandelt<br />
(deutlich mehr Patientinnen mit Gesamtstrukturniveau 3.0), was ein weiterer Grund für<br />
den größeren Therapieerfolg sein könnte. Die Effektstärken beziehen sich bei Mestel et<br />
al. (2004) zudem auf die Gesamtstichprobe, in der auch die Patientinnen mit höher<br />
104
Diskussion - Ergebnisse<br />
integriertem Gesamtstrukturniveau enthalten sind, während sich die Werte für Gruppe I<br />
ausschließlich auf Patientinnen mit Gesamtstrukturniveau 2.5 oder 3.0 beziehen. Im<br />
Vergleich zu einer Untersuchung von 80 depressiven Patientinnen einer Nachuntersu-<br />
chung ebenfalls ein Jahr nach Ende der Behandlung (Mestel et al., 2000) liegen die<br />
Effektstärken der SCL-90-R für die Gesamtstichprobe am Therapieende etwas über<br />
dem dortigen Wert (d = 0.91; SP1: d = 0.93) und zum 1-Jahres-Katamnesezeitpunkt<br />
mit 0.84 deutlich über dem dortigen Wert von 0.64.<br />
Im VEV-K gibt die Patientinnengruppe der mäßig bis gering Strukturierten auch signifi-<br />
kant weniger Zugewinne an Optimismus, Gelassenheit und Entspannung zum Thera-<br />
pieende an (p ≤ .05), die zwar ein Jahr später immer noch unter den Werten der Grup-<br />
pe I liegen, sich aber nicht mehr signifikant unterscheiden (nur noch ein Trend:<br />
p = .062).<br />
Die Einschätzung der psychischen Veränderung durch die Therapeutinnen fällt deutlich<br />
positiver aus als die Selbsteinschätzungen, 74 % der Patientinnen wurden als deutlich<br />
gebessert und 19 % als etwas gebessert einschätzt, was insgesamt einer Verbesse-<br />
rung von 93 % aller Patientinnen entspricht. Über die Reliabilität dieser Einschätzun-<br />
gen kann leider keine Aussage gemacht werden, sie gehen jedoch konform mit dem<br />
Befund, dass Therapeutinnen die Erfolge häufig günstiger einschätzen als Patientinnen<br />
(Mestel, Klingelhöfer & Stauss, 1999). Eventuell gehen diese Einschätzungen auch<br />
deutlich über das in den Fragebögen erfasste Material hinaus, Besserungen könnten<br />
z.B. auch Fähigkeiten wie mehr emotionale Offenheit, bessere Introspektion und<br />
Selbstreflexion oder ähnliches sein. Zur Prüfung der Kriteriumsvalidität kann diese Ein-<br />
schätzung dennoch als Erfolgskriterium herangezogen werden, um ein umfassenderes<br />
Bild (multiperspektivisch) zu erhalten.<br />
Die Verteilung des EMEK-Quotienten zeigt ebenfalls für die Mehrheit der Patientinnen<br />
ein eher günstiges katamnestisches Gesamtbild, signifikante Unterschiede zwischen<br />
den beiden Gruppen bestehen für den gesamten Wertebereich nicht (Trend von<br />
p = .08), im oberen Viertel des Quotienten befinden sich jedoch signifikant mehr gut bis<br />
mäßig strukturierte als mäßig bis gering strukturierte Patientinnen. Im Vergleich zu<br />
Schmidt (1991) zeigen sich nur geringe Unterschiede, der Wert im obersten Viertel der<br />
Verteilung ist annähernd gleich (49.3 % bei Schmidt zu 50.5 % in SP1), im untersten<br />
Viertel sind in vorliegender Arbeit jedoch etwas mehr Patientinnen (9 % bei Schmidt zu<br />
16.3 % in SP1). Die Einteilung der Wertebereiche in Viertel wurde analog zu Schmidt<br />
(1991) vorgenommen, um die Vergleichbarkeit zu verbessern.<br />
105
Diskussion - Ergebnisse<br />
Nach dieser Analyse eignen sich alle Kriterien zur Prüfung der Kriteriumsvalidität und<br />
damit zur Untersuchung der Fragestellungen und Hypothesen, die im Folgenden disku-<br />
tiert werden. Auf weitere Vergleiche mit der Literatur wird hier aus Gründen des Um-<br />
fangs und inhaltlichen Vorgaben der Arbeit selbst (keine Hypothesen) verzichtet.<br />
6.2.3 Kriteriumsvalidität<br />
Da bereits ähnliche Untersuchungen existieren wurde aus Zeitgründen und Seitenbe-<br />
grenzungen der vorliegenden Arbeit auf eine Kreuzvalidierung verzichtet. Für die Ne-<br />
benfragestellung wäre dies wünschenswert gewesen, jedoch aufgrund der Ergebnisse<br />
nicht durchführbar.<br />
Der in Hypothese 1 und 2 postulierte Zusammenhang des Gesamtstrukturniveaus mit<br />
dem Therapieerfolg wurde zum Entlasszeitpunkt für 3 von 4 (Hypothesen 1a-c) und<br />
zum Nachuntersuchungszeitpunkt für 2 von 4 Ergebniskriterien (Hypothesen 2b und<br />
2c) gefunden. Im VEV-K zeigt sich, dass je höher der Wert des Gesamtstrukturniveaus,<br />
desto geringer die Zugewinne an Optimismus, Gelassenheit und Entspannung bei Ent-<br />
lassung und ein Jahr danach. Ein geringeres Strukturniveau hängt besonders stark mit<br />
einer persistierenden höheren Symptombelastung zusammen, die Zusammenhänge<br />
mit der Reduktion der Symptombelastung und den Veränderungen des Erlebens und<br />
Verhaltens sind deutlich geringer. Ein Jahr nach der Therapie sinkt der Zusammen-<br />
hang mit der Symptombelastung und die Differenz derselben zeigt sich ebenso wie das<br />
EMEK nicht zusammenhängend mit dem Gesamtstrukturniveau. Die Einschätzung der<br />
„Veränderung des psychischen Befindens“ durch die Therapeutinnen zeigt sich eben-<br />
falls unabhängig vom Gesamtstrukturniveau. Diese Befunde gehen tendenziell in die-<br />
selbe Richtung wie in der Untersuchung von Mestel et al. (2004), d.h. dass alle Patien-<br />
tinnen von der Behandlung profitieren, die mäßig bis gering Strukturierten auf höherem<br />
Niveau (höhere Belastung).<br />
Zum VEV-K ist anzumerken, dass dieses Kriterium auch in anderen Untersuchungen<br />
deutlich höher mit dem SCL-90-R-Post-Wert als mit dem der Differenz zusammen-<br />
hängt. Für die Gesamtstichprobe der HELIOS Klinik Bad Grönenbach von 1996-2008<br />
hängt beispielsweise der VEV-K mit r = -.63 mit dem SCL-90-R-Post-Wert und mit<br />
r = .44 mit der SCL-90-R-Prä-Post-Differenz zusammen (persönliche Mitteilung R.<br />
Mestel, 24.02.2011). Die retrospektive Einschätzung der Veränderung seitens der Pa-<br />
tientinnen ist dem Statuswert der SCL-90-R also ähnlicher als der Differenz zwischen<br />
den zwei Messzeitpunkten (vgl. Michalak et al., 2003).<br />
106
Diskussion - Ergebnisse<br />
Betrachtet man die Beiträge des Gesamtstrukturniveaus zu den Vorhersagen des The-<br />
rapieerfolgs (Hypothesen 3 und 4) kann dieses zum Therapieende 6.7 % der Varianz<br />
des Kriteriums SCL-90-R-Post-Wert aufklären (Hypothese 3b) und 2.2 % des VEV-K-<br />
Wertes (Hypothese 3c). Für die Vorhersage der Differenz im GSI zeigt sich immerhin<br />
ein Trend, der jedoch ein Jahr später nicht mehr verzeichnet werden kann. Zu diesem<br />
Zeitpunkt kann das Gesamtstrukturniveau nur noch 2.3 % der Varianz des GSI aufklä-<br />
ren (Hypothese 4b) und zum VEV-K-Wert trendmäßig 1.4 % beitragen. Die Therapieer-<br />
folgsergebnisse sind also auf längere Sicht immer weniger durch das Gesamtstruktur-<br />
niveau vorhersagbar.<br />
Auffallend an den Ergebnissen ist, dass vor allem ein Einfluss auf die Vorhersage des<br />
Statuswertes (siehe Korrelation von VEV-K und SCL-90-R) festgestellt wurde, jedoch<br />
weniger auf den Differenzwert. Auf den mit multiplen Kriterien erfassten Therapieerfolg<br />
(EMEK) und das Therapeutinnenrating hat das Gesamtstrukturniveau keinen Einfluss<br />
(nur ein Trend beim EMEK). Dies geht konform mit den Ergebnissen der Mittelwertver-<br />
gleiche, die einen Therapieerfolg für alle Patientinnen, für die geringer integrierten Pa-<br />
tientinnen jedoch auf höherem Niveau (mehr Belastungen) berichten.<br />
Der in Hypothese 5 und 6 erwartete relevante Beitrag des Gesamtstrukturniveaus zur<br />
Vorhersage des Therapieerfolgs wurde in vorliegender Untersuchung teilweise gefun-<br />
den und wird nachfolgend diskutiert.<br />
Zunächst ist anzumerken, dass die von Michalak et al. (2003) gefundene relative Un-<br />
abhängigkeit der direkten Veränderungsmessung des VEV-K und der indirekten Ver-<br />
änderungsmessung über eine Prä-Post-Differenz (SCL-90-R) in vorliegender Stichpro-<br />
be fraglich ist. Beide Kriterien korrelieren zum Therapieende mit r = .50 (p ≤ .01) und<br />
zum Nachuntersuchungszeitpunkt ebenfalls mit r = .50 (p ≤ .01), was einer sehr signifi-<br />
kanten Korrelation mittlerer Größe entspricht. Die unterschiedlichen Ergebnisse für<br />
Differenz- und Statuswerte zeigen dennoch, dass unterschiedliche Dimensionen er-<br />
fasst werden. Die Werte liegen jedoch mit r = .50 über dem von Mestel (s.o.) errechne-<br />
ten Wert von r = .44.<br />
Bei der Interpretation von Signifikanztests ist stets zu beachten, dass es aufgrund der<br />
Stichprobengröße zu unterschiedlichen Ergebnissen der Signifikanzprüfungen kommt.<br />
In SP1 werden Zusammenhänge von .12 signifikant, während in SP2 der MW/Wochen<br />
beispielsweise mit -.15 mit dem SCL-90-R-Post-Wert zusammenhängt, die Korrelation<br />
aber nicht signifikant wird. Sogar Zusammenhänge von -.27 von Gesamtstruktur und<br />
BSS-Prä-Post-Differenz werden nicht signifikant. Mit steigendem Umfang der Stichpro-<br />
be steigt zwar die Teststärke, die Signifikanz wird jedoch auch immer wahrscheinlicher<br />
107
Diskussion - Ergebnisse<br />
(Bortz, 2005). Die optimalen Stichprobenumfänge bei multipler Regression sind ab-<br />
hängig von der Anzahl an Prädiktoren und der Größe des Effekts (R²). Für einen<br />
schwachen Effekt (R² = 0.02) bräuchte es bei sechs Prädiktoren eine Stichprobengrö-<br />
ße von N = 700, für einen mittleren Effekt (R² = 0.13) eine Stichprobe von N = 96. Bei<br />
zehn Prädiktoren bräuchte es für einen schwachen Effekt 825 Personen und für einen<br />
mittleren Effekt 116 Personen. Für einen starken Effekt wären bei zehn Prädiktoren 50<br />
Personen optimal, bei sechs Prädiktoren 41 Personen (Bortz, 2005, S. 463-464). Der<br />
Anteil der geringer strukturierten Patientinnen liegt in allen drei Stichproben unter die-<br />
sen Werten.<br />
Die bei Nitzgen & Brünger (2000), Spitzer et al. (2002) und Benecke et al. (2009) ge-<br />
fundenen Zusammenhänge mit einer komorbiden Persönlichkeitsstörung können in<br />
vorliegender Untersuchung bestätigt werden (r = .27**, SP1), die Zusammenhänge mit<br />
dem Alter (Spitzer et al., 2002) in der Hauptstichprobe jedoch nicht. In einer der beiden<br />
Stichproben der Nebenuntersuchung (SP3), wurde jedoch der dort gefundene Zusam-<br />
menhang mit dem Alter bestätigt, d.h. je jünger die Patientinnen waren, desto mehr<br />
strukturelle Defizite hatten sie. Der Mittelwert und die Standardabweichung des Alters<br />
unterscheiden sich in allen drei Stichproben nur wenig. SP1 hat die jüngsten Patientin-<br />
nen (MW = 39 Jahre, SD = 10.33) und SP3 hat die ältesten Patientinnen mit der größ-<br />
ten Streuung (MW = 41 Jahre, SD = 11.49). In dieser Stichprobe hat jedoch auch das<br />
Gesamtstrukturniveau den höchsten MW und die größte Streuung (2.17, SD = 0.42) im<br />
Vergleich zur SP1 (MW = 2.02, SD = 0.28) und SP2 (MW = 2.06, SD = 0.27). Mögli-<br />
cherweise hängt dieser Effekt mit der besonderen Zusammensetzung der Stichprobe,<br />
älteste Patientinnen, im Mittel geringstes Strukturniveau und mehr Varianz desselben,<br />
zusammen. Der Anteil der geringer strukturierten Patientinnen muss offensichtlich aus-<br />
reichend groß sein um entsprechende Effekte aufzudecken. In SP1 beträgt der Anteil<br />
(Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5) 14.8 % (N = 31 von 196), in SP2 beträgt der Anteil<br />
20.8 % (N = 11 von 53) und in SP3 43.8 % (N = 21 von 49). Dies bedeutet, dass der<br />
Anteil in SP3 fast dreimal höher ist als in SP1. Über die Gründe dafür können keine<br />
Aussagen gemacht werden, entweder wurde unterschiedlich diagnostiziert oder die<br />
Zuteilung war tatsächlich so unterschiedlich, dass die Therapeutin in SP3 überdurch-<br />
schnittlich viele strukturell beeinträchtigte Patientinnen in Behandlung hatte. Beim Ver-<br />
gleich der Mittelwerte der Prädiktoren und Kriterien kann festgestellt werden, dass sich<br />
diese nicht wesentlich unterscheiden, aber die Verteilung in SP3 deutlich breiter ist<br />
(größere Standardabweichungen). Bei allen Vergleichen der drei Stichproben sollte<br />
auch beachtet werden, dass sie sich hinsichtlich der Zusammensetzung, d.h. der Häu-<br />
figkeiten der Hauptdiagnosen unterscheiden. In SP1 gab es etwas weniger Affektive<br />
Störungen und Angststörungen, dafür wesentlich mehr Essstörungen, in SP3 dafür<br />
108
Diskussion - Ergebnisse<br />
keinerlei Persönlichkeitsstörungen (siehe 4.1). Der deutlich höhere Anteil an Angststö-<br />
rungen in SP2 und SP3 könnte sich auch auf den Therapieerfolg ausgewirkt haben,<br />
was in vorliegender Arbeit jedoch nicht Gegenstand ist und daher nicht untersucht<br />
wurde.<br />
Der bei Benecke et al. (2009) gefundene Zusammenhang mit dem Ausmaß an<br />
Komorbidität zeigt sich in vorliegender Untersuchung ebenfalls, die Anzahl der Diagno-<br />
sen hängt signifikant mit dem Gesamtstrukturniveau (r = .15) zusammen. Nimmt man<br />
das Ausmaß an Komorbiditäten als Schweregradmarker, bestätigt dies sinnvoll die<br />
Kritierumsvalidität der Strukturachse. Zusammenhänge des Gesamtstrukturniveaus mit<br />
dem Geschlecht wurden wie bei Spitzer et al. (2002) in keiner der untersuchten Stich-<br />
proben gefunden.<br />
Vergleicht man die signifikanten Korrelationen des Gesamtstrukturniveaus mit den Er-<br />
gebnissen von Rudolf et al. (1996), zeigt sich, dass die Erfolgsbeurteilung der Patien-<br />
tinnen (r = .26) ähnlich hoch korreliert wie in dortiger Untersuchung (r = .30; p ≤ .05).<br />
Die Erfolgsbeurteilung der Therapeutinnen korreliert dort jedoch mit r = .40 (p ≤ .05)<br />
und in vorliegender Untersuchung nur mit r = -.06 (n.s.). In SP3 korreliert die Therapeu-<br />
teneinschätzung immerhin mit r = .23 (n.s.) mit dem Gesamtstrukturniveau und mit r =<br />
.23 (n.s.) mit der mittleren Anzahl an geringer strukturierten Patientinnen in der Thera-<br />
piegruppe. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Therapeutin einen Zusam-<br />
menhang zwischen der strukturellen Beeinträchtigung einer Patientin, einer größeren<br />
Zahl von strukturell beeinträchtigten Patientinnen in der Gruppe und einem geringeren<br />
Therapieerfolg sieht und dieser auch tatsächlich besteht. Möglicherweise kann dies in<br />
einer größeren Stichprobe mit mehr mäßig bis gering integrierten Patientinnen (Ge-<br />
samtstrukturniveau ≥ 2.5: SP1 n = 31, SP2 n = 11, SP3 n = 21) auch als relevanter<br />
Zusammenhang gefunden werden. Nach Bortz (2005, S. 218) wäre ein optimaler<br />
Stichprobenumfang für einen mittleren Effekt (r = .30) bei 68 Personen, für einen<br />
schwachen Effekt (r = .10) wären 618 Personen und für einen starken Effekt (r = .50)<br />
22 Personen nötig. Für den gefundenen Zusammenhang wären 153 Personen optimal.<br />
Die Befunde zu Zusammenhängen mit der Schwere der Symptombelastung sind in der<br />
Literatur bisher uneinheitlich. Dass Patientinnen mit geringer Struktur mehr Symptome<br />
haben, wie von Mestel et al. (2004) und Benecke et al. (2009) festgestellt, kann hier<br />
nur teilweise bestätigt werden. Zu Benecke muss einschränkend erwähnt werden, dass<br />
aus der Literatur nicht klar wird, zu welchem Zeitpunkt der Behandlung die SCL-90-R<br />
bei den Probandinnen der klinischen Gruppe erhoben wurde. Die Selbsteinschätzung<br />
der Symptombelastung zu Behandlungsbeginn hängt in vorliegender Arbeit nicht mit<br />
dem Gesamtstrukturniveau zusammen, die Fremdeinschätzung der Beeinträchtigung<br />
109
Diskussion - Ergebnisse<br />
(BSS) hingegen schon (r = .27**). Anzumerken ist hierbei, dass der Mittelwert der<br />
Symptombelastung zu Behandlungsbeginn in vorliegender Arbeit deutlich unter dem<br />
Wert von Mestel et al. (2004) für die gering integrierte Gruppe liegt (Mestel: MW = 1.61<br />
zu hier: MW = 1.25). Wobei die Werte bei Mestel sich auf eine Untergruppe mit aus-<br />
schließlich gering integrierten Patientinnen (Gesamtstrukturniveau 3.0) beziehen, wäh-<br />
rend in vorliegender Arbeit 29 Patientinnen mit Gesamtstrukturniveau 2.5 und nur 2<br />
Patientinnen mit 3.0 eingehen. Die strukturellen Einschränkungen der Patientinnen<br />
waren in vorliegender Arbeit wahrscheinlich nicht so gravierend, wobei die Einteilung in<br />
Zwischenratings bei Mestel et al. (2004) noch nicht vorgenommen wurde. In SP2 war<br />
ein hoher Ausgangswert in der Symptombelastung mit einem geringeren Gesamtstruk-<br />
turniveau assoziiert, in SP3 wiederum nicht. Daneben hatten Patientinnen (weibliche)<br />
in SP2 eine geringere (!) Symptombelastung zu Behandlungsbeginn, in SP3 wiesen<br />
dies hingegen die Älteren auf, d.h. je älter, desto weniger belastet. Spitzer et al. (2002)<br />
fanden ebenfalls keine Zusammenhänge der Strukturachse mit der SCL-90-R zu The-<br />
rapiebeginn. Möglicherweise hängt dies auch dort mit der zu geringen statistischen<br />
Power aufgrund der zu geringen Anzahl an gering strukturierten Patientinnen (n = 19)<br />
zusammen.<br />
Relevante Assoziationen des Gesamtstrukturniveaus wurden für die Anzahl an Diag-<br />
nosen, die Erkrankungsdauer, die Motivation und eine komorbide Persönlichkeitsstö-<br />
rung festgestellt. Eine längere Erkrankungsdauer ging bei Rudolf et al. (1996) ebenfalls<br />
mit einem geringeren Gesamtstrukturniveau einher (r = -.38, p = .06).<br />
Die Variablen „Gesamtstrukturniveau“, „BSS“ und „Motivation“ wurden alle von der<br />
Therapeutin eingeschätzt, wodurch die Zusammenhänge mit bedingt sein können. Da<br />
die geringer strukturierten Patientinnen selbst (in der Hauptstichprobe) keine höhere<br />
Symptombelastung angeben, liegt dieser Verdacht nahe. Auch die später noch disku-<br />
tierten Multikollinearitäten weisen in eine ähnliche Richtung. Dass eine längere Erkran-<br />
kungsdauer und eine höhere Anzahl an Diagnosen sowie eine geringere Motivation zu<br />
Behandlungsbeginn mit einem geringeren Strukturniveau einhergehen, spricht für die<br />
Kriteriumsvalidität und ist inhaltlich plausibel.<br />
Zu beachten ist beim Vergleich der Befunde zur prädiktiven Validität, dass in keiner<br />
vergleichbaren Studie die Beiträge zur Vorhersage berichtet werden.<br />
Bei Mestel et al. (2004, in Dahlbender et al., 2004, S. 242) „… profitieren sowohl gering<br />
wie mäßig strukturierte Patienten entsprechend ihres Ausgangsniveaus von der Thera-<br />
pie“ [….] “Patienten mit geringerem Strukturniveau zeigten weniger Zuwachs an Opti-<br />
mismus, Gelassenheit und Entspannung im Vergleich zu den Patienten mit mäßiger<br />
110
Diskussion - Ergebnisse<br />
Struktur“. Im Mittelwertvergleich der Symptombelastung zeigen sich auch in vorliegen-<br />
der Arbeit keine Interaktionseffekte, auf die Vorhersage der Reduzierung der<br />
Symptombelastung zum Klinikaustritt hat das Gesamtstrukturniveau jedoch einen Ein-<br />
fluss, d.h. geringer strukturierte Patientinnen können ihre Symptombelastung weniger<br />
reduzieren. Dieser Effekt verliert sich jedoch zum Nachuntersuchungszeitpunkt. In der<br />
Literatur (z.B. Monsen et al., 1995) haben geringer strukturierte Patientinnen mehr<br />
Probleme zum Therapieende. In vorliegender Arbeit kann dies jedoch nicht klar in die-<br />
se Richtung interpretiert werden. Geringer strukturierte Patientinnen haben zu Beginn<br />
eine höhere Symptombelastung, können diese bis zum Therapieende weniger reduzie-<br />
ren (Differenz Gruppe I = 0.35 zu 0.56 in Gruppe II) und bleiben zum Nachuntersu-<br />
chungszeitpunkt fast konstant (MW SCL-90-R: Post = 0.90, Kat = 0.89), während die<br />
gut bis mäßig Strukturierten einen leichten Symptomanstieg vom Therapieende zum<br />
Nachuntersuchungszeitpunkt zu verzeichnen haben (MW SCL-90-R: Post = 0.57,<br />
Kat = 0.63). Diese Unterschiede werden jedoch trotz der großen Stichprobe nicht signi-<br />
fikant, was bedeutet, dass insgesamt alle Patientinnen gleichermaßen von der Behand-<br />
lung profitieren. Kurzfristig kann das Gesamtstrukturniveau einen hochsignifikanten<br />
Betrag zur Vorhersage der Symptombelastung leisten (R² = .067, p ≤ .000), mittelfristig<br />
jedoch nur wenig beitragen (R² = 2.3 %, p = .033). Mäßig bis gering strukturierte Pati-<br />
entinnen zeigen zudem kurzfristig weniger Zugewinne an Optimismus, Gelassenheit<br />
und Entspannung als gut bis mäßig strukturierte Patientinnen, langfristig jedoch nicht.<br />
Bei Prüfung aller ausgewählten Prädiktoren zum Therapieende bleibt der Einfluss des<br />
Gesamtstrukturniveaus erhalten, nach dem stärksten Prädiktor, dem SCL-90-R-<br />
Ausgangswert (19.3 % Varianzaufklärung), kann das Gesamtstrukturniveau als zweit-<br />
wichtigster Prädiktor weitere 5.4 % der Varianz aufklären, das Geschlecht 2.9 %, die<br />
BSS-Summe 1.8 % und die Arbeitsunfähigkeit 2.1 %. Das Verfahren der schrittweisen<br />
Merkmalsselektion ist jedoch stark davon abhängig, ob Multikollinearitäten vorliegen<br />
und in welcher Reihenfolge die Prädiktoren geprüft werden. Nach Bortz (2005, S. 462)<br />
sind oft nur geringfügige Nützlichkeitsunterschiede dafür verantwortlich, welche Prädik-<br />
toren ins Modell aufgenommen werden, des Weiteren müssten alle möglichen Abfol-<br />
gen von Prädiktorvariablen sequenziell getestet werden, und nach Thompson (1995a,<br />
zitiert in Bortz, 2005, S.462) operieren die meisten Statistikprogramme mit falschen<br />
Freiheitsgraden. Aus diesen Gründen eignet sich dieses Verfahren nur bedingt zur<br />
Hypothesentestung und die Prädiktoren wurden auch nach dem Einschluss-Verfahren<br />
analysiert und teilweise wurden hierarchische Regressionen berechnet. Nach Ein-<br />
schluss aller Prädiktoren hat das Gesamtstrukturniveau das drittgrößte Beta-Gewicht<br />
mit einem p = .029 und bestätigt auch hier, dass es einen relevanten Beitrag zur Vor-<br />
hersage leisten kann. Mittelfristig kann das Gesamtstrukturniveau jedoch keinen eige-<br />
111
Diskussion - Ergebnisse<br />
nen Betrag mehr zur Vorhersage leisten. Die Prädiktoren „Motivation“, „Gesamtstruk-<br />
turniveau“ und „Summe im BSS“ tragen identische Informationen zum Ergebnis bei, so<br />
dass eine Interpretation der inkrementellen Beiträge schwierig ist. Bei Untersuchung<br />
aller Prädiktoren auf die übrigen Ergebniskriterien (siehe Anhang E) hat das Gesamt-<br />
strukturniveau nur auf den Differenzwert der SCL-90-R zum Therapieende einen rele-<br />
vanten Einfluss. Nach Ausschaltung der Suppressoren können 3.8 % (p ≤ .000) der<br />
Varianz der Reduzierung der Symptombelastung durch das Gesamtstrukturniveau vor-<br />
hergesagt werden. In der einfachen Regression zeigte sich schon ein Trend, eventuell<br />
unterdrücken die anderen Prädiktoren weitere unerwünschte Varianzanteile, so dass<br />
der Einfluss auf die Vorhersage dadurch signifikant wird. Auf längere Sicht spielt das<br />
Gesamtstrukturniveau jedoch sowieso keine Rolle für die Reduzierung der<br />
Symptombelastung. Es finden sich in diesen Analysen ebenfalls Multikollinearitäten<br />
von Gesamtstruktur, BSS und Motivation. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass diese<br />
inhaltlich sinnvoll verknüpft sind, ein geringeres Strukturniveau auch ein Zeichen grö-<br />
ßerer Belastung und geringerer Motivation ist. Der Effekt könnte aber auch durch die<br />
gleichzeitige Einschätzung aller drei Prädiktoren durch die Therapeutin mitverursacht<br />
sein.<br />
6.2.4 Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen in der therapeuti-<br />
schen Gruppe<br />
Die Ergebnisse bezüglich des Einflusses des „Anteils strukturell beeinträchtigter Pati-<br />
entinnen in einer therapeutischen Gruppe“ (Hypothesen 7-8) auf die Vorhersage des<br />
Therapieergebnisses sind für die beiden untersuchten Stichproben uneinheitlich und<br />
schwer zu interpretieren. In SP2 hat der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen<br />
keine Zusammenhänge mit den Therapieerfolgskriterien und folglich auf die Vorhersa-<br />
ge auch keinen Einfluss.<br />
In SP3 hängt dieser Anteil (MW/Wochen) mit der BSS-Differenz zusammen (Hypothe-<br />
se 7d). Dabei ist jedoch anzumerken, dass teilweise ähnlich hohe Korrelationen mit<br />
den Ergebniskriterien wie in der Hauptstichprobe erzielt werden, diese jedoch aufgrund<br />
der Stichprobengröße nicht signifikant werden (s.o.). Einen Einfluss auf die Vorhersage<br />
des Therapieergebnisses hat der Anteil der strukturell beeinträchtigten Patientinnen<br />
nur bei einfacher linearer Regression. Durch diesen Anteil können demnach 10.9 %<br />
der Varianz des BSS-Prä-Post-Differenzwertes erklärt werden (Hypothese 8d) was<br />
schon fast ein mittlerer Effekt ist. Bei multipler Regression konkurrierender Prädiktoren<br />
verschwindet jedoch dieser Einfluss. Auf die Vorhersage des SCL-90-R-Post-Wertes<br />
hat der Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen in SP3 bei multipler Regression<br />
112
Diskussion - Ergebnisse<br />
zwar zunächst einen Einfluss, der sich jedoch als Suppressions-Effekt herausstellt.<br />
Entscheidend für die Ergebnisse scheint generell die Wahl des Kriteriums und der Prä-<br />
diktoren zu sein. Zusätzlich erschwert wird die Interpretation durch eine Reihe von<br />
Multikollinearitäten. Der Einfluss des Anteils strukturell beeinträchtigter Patientinnen ist<br />
nicht von anderen Bedingungen und Variablen zu trennen. Möglicherweise hat aber<br />
auch die Zusammensetzung und Größe der Stichprobe einen Einfluss auf die Ergeb-<br />
nisse, der Effekt könnte bei größeren Stichproben mit breiterer Merkmalsstreuung<br />
(mehr Patientinnen mit Gesamtstrukturniveau ≥ 2.5 im Verhältnis zu Gesamtstrukturni-<br />
veau < 2.5) eventuell klarer zu beurteilen sein. Aufgrund der mehrheitlich negativen<br />
Ergebnisse bezüglich eines Einflusses kann in dieser Untersuchung davon ausgegan-<br />
gen werden, dass es keine Rolle spielt, wie viele geringer strukturierte Patientinnen<br />
gemeinsam in einer Therapiegruppe behandelt werden.<br />
6.2.5 Zusammenfassung der Diskussion im Hinblick auf die Fragestel-<br />
lungen<br />
Insgesamt kann festgestellt werden, dass mäßig bis gering strukturierte Patientinnen<br />
mittelfristig gleichermaßen von der Therapie profitieren wie gut bis mäßig strukturierte<br />
Patientinnen, jedoch auf höherem (Belastung-) Niveau. Zum Therapieende ist die Re-<br />
duzierung der Symptombelastung zwar etwas geringer als bei den höher Integrierten,<br />
ein Jahr danach unterscheiden sich die Patientinnen dahingehend jedoch nicht mehr<br />
wesentlich. Auf Einzelfallebene unterscheiden sich bei den „klinisch relevant Gebesser-<br />
ten“ unterschiedlich integrierte Patientinnen zu beiden Messzeitpunkten nicht, aber bei<br />
den „Verschlechterten“ sind überzufällig häufig geringer strukturierte Patientinnen ver-<br />
treten.<br />
Der Zugewinn an Optimismus, Gelassenheit und Entspannung ist bei den geringer<br />
Strukturierten zum Behandlungsende und ein Jahr später ebenfalls geringer (Trend für<br />
die Mittelwertunterschiede, signifikante Korrelation), was dafür spricht, dass diese Ein-<br />
schätzung eher den Zustand im Moment (Post/Kat) einschätzt, egal wie ausgeprägt die<br />
Symptomatik zu Beginn war. Im Therapeutinnenurteil profitieren beide Gruppen auf<br />
globaler Ebene gleichermaßen, die „Verschlechterten“ sind allerdings wieder überzufäl-<br />
lig häufig unter den mäßig bis gering Strukturierten anzutreffen. Einen besonders aus-<br />
geprägten Therapieerfolg verzeichnen im EMEK dagegen die gut bis mäßig Strukturier-<br />
ten, insgesamt unterscheiden sich die Werte jedoch nicht relevant (nur ein Trend).<br />
Zusammenhänge des Gesamtstrukturniveaus mit dem Therapieerfolg bestehen mit<br />
mehreren Ergebniskriterien, insbesondere mit den Statuswerten zum Behandlungsen-<br />
de und ein Jahr danach. Ein Teil des Therapieerfolgs kann durch das Gesamtstruktur-<br />
113
Diskussion - Ergebnisse<br />
niveau vorhergesagt werden, dieser Einfluss auf die Vorhersage wird jedoch auf länge-<br />
re Sicht immer geringer. Auch hier zeigt sich wieder, dass die Verläufe parallel sind,<br />
d.h. mäßig bis gering strukturierte Patientinnen haben schlechtere Post- und Kat-<br />
Werte, die Differenz vom Anfang zum Ende der Therapie und follow up lässt sich durch<br />
das Gesamtstrukturniveau nicht vorhersagen.<br />
Zur optimalen Vorhersage des kurzfristigen Therapieerfolgs können die Variablen<br />
„SCL-90-R-Prä-Wert“, „Gesamtstrukturniveau“, „Geschlecht“, „BSS-Prä-Summe“ und<br />
„Arbeitsunfähigkeit im Jahr vor dem Klinikaufenthalt“ herangezogen werden. Mittelfris-<br />
tig sinnvoll sind nur der SCL-90-R-Ausgangswert und die BSS-Prä-Summe. Einen ein-<br />
zigartigen Beitrag zur Vorhersage kann das Gesamtstrukturniveau nur kurzfristig leis-<br />
ten.<br />
Die Frage, ob ein höherer Anteil strukturell beeinträchtigter Patientinnen in einer thera-<br />
peutischen Gruppe sich auf das Therapieergebnis negativ auswirkt, kann vorläufig so<br />
beantwortet werden, dass es keine Rolle spielt, wie viele geringer strukturierte Patien-<br />
tinnen gemeinsam in einer Therapiegruppe behandelt werden, bzw. dass die Therapie<br />
für alle Patientinnen gleichermaßen geeignet und erfolgreich ist. Eine eindeutige prä-<br />
diktive Bedeutung dieser Variable ließ sich nicht finden, die abschließende Beurteilung<br />
dieser Frage steht jedoch noch aus.<br />
6.3 Schlussfolgerungen und Ausblick<br />
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Prüfung der Kriteriumsvalidität der OPD-<br />
Strukturachse, wobei es das vorrangige Ziel der Struktureinschätzungen der OPD ist,<br />
Handlungsanweisungen für entsprechend dem Strukturniveau angepasste Behandlun-<br />
gen zu geben. Die Untersuchung von prognostischen Variablen für relevante Verände-<br />
rungen hat eine große Bedeutung für die Qualität von Psychotherapie. Diese können,<br />
wenn sie einen Einfluss auf das Kriterium zeigen, zu entsprechenden Modifikationen in<br />
der Behandlung führen, bzw. es kann in der Therapie gezielt darauf eingegangen wer-<br />
den. Auch für die Beantwortung der Frage, ob es sinnvoll ist, ein diagnostisches In-<br />
strument im Klinikalltag einzusetzen, kann deren Relevanz für den Behandlungserfolg<br />
entscheidende Hinweise geben. Generell zeigt sich auch in dieser Untersuchung, dass<br />
die Möglichkeit das Therapieergebnis durch Patientinnenvariablen vorherzusagen, ins-<br />
gesamt begrenzt ist.<br />
Die gefundenen Ergebnisse sprechen für den Einsatz der OPD-Strukturachse im Kli-<br />
nikalltag, für die Kriteriumsvalidität des Instrumentes und dafür, dass die Therapie in<br />
der HELIOS Klinik Bad Grönenbach auch für die zunehmende Anzahl an teilweise<br />
114
Diskussion – Schlussfolgerungen und Ausblick<br />
strukturell beeinträchtigten Patientinnen erfolgreich ist. Besonderes Augenmerk sollte<br />
dennoch auf die verschlechterten Patientinnen gerichtet werden, da diese besonders<br />
häufig strukturell beeinträchtigt sind. Da sich die Bedingungen in der stationären Psy-<br />
chosomatik immer wieder ändern (im Moment mehr schwerer belastete und mehr<br />
strukturell beeinträchtigte Patientinnen, immer kürzere Behandlungszeiten) und das<br />
Behandlungskonzept in der HELIOS Klinik Bad Grönenbach fortlaufend modifiziert<br />
wird, bedürfen die Ergebnisse auch in Zukunft weiterer Replikation.<br />
Ebenfalls wären Untersuchungen zur Interaktion von Patientinnen-, Therapeutinnen-<br />
und Behandlungsvariablen interessant sowie die Einbeziehung einer Kontrollgruppe,<br />
die aus den auf den Klinikaufenthalt wartenden Patientinnen gebildet werden könnte.<br />
Die Befunde der Untersuchung, die sich auf die Auswirkung eines größeren Anteils<br />
strukturell beeinträchtigter Patientinnen in einer Therapiegruppe beziehen, zeigen,<br />
dass sich dies nicht nachweisbar negativ auf den Therapieerfolg auswirkt. Da es sich<br />
dabei jedoch um eine Pilotstudie und vorläufige Interpretationen handelt, bleibt abzu-<br />
warten, ob die Ergebnisse zukünftig bestätigt werden können.<br />
115
Literaturverzeichnis<br />
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Arbeitskreis OPD (Hrsg.). (1996). Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
OPD. Grundlagen und Manual (1. Aufl.). Bern: Huber.<br />
Arbeitskreis OPD (Hrsg.). (2001). Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
OPD. Grundlagen und Manual (3. Korrigierte und aktualisierte Aufl.). Bern: Huber.<br />
Arbeitskreis OPD (Hrsg.). (2007). Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik<br />
OPD-2. Das Manual für Diagnostik und Therapieplanung (2. Überarbeitete Aufl.).<br />
Bern: Huber.<br />
Baumann, U., Fähndrich, E., Stieglitz, R.-D. & Woggon, B. (1990). Probleme der Veränderungsmessung<br />
in Psychiatrie und klinischer Psychologie. In: Baumann, U.,<br />
Fähndrich, E., Stieglitz, R.-D. & Woggon, B. (Hrsg.). Veränderungsmessung in<br />
Psychiatrie und klinischer Psychologie. München: Profil.<br />
Benecke, C., Koschier, A., Peham, D., Bock, A., Dahlbender, R.W., Biebl, W. & Doering,<br />
S. (2009). Erste Ergebnisse zu Reliabilität und Validität der OPD-2 Strukturachse.<br />
Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 55, 84–96.<br />
Bortz, J. & Döring, N. (1995). Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissenschaftler.<br />
Berlin: Springer.<br />
Bortz, J. (2005). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler (6.Aufl.) Heidelberg:<br />
Springer-Medizin-Verlag.<br />
Bortz, J. & Lienert, G. A. (1998). Kurzgefasste Statistik für die klinische Forschung. Ein<br />
praktischer Leitfaden für die Analyse kleiner Stichproben. Berlin: Springer.<br />
Bühner, M. (2006). Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion (2. Aktualisierte<br />
Aufl.). München: Pearson.<br />
Bühner, M. (2006). Vorlesung Testtheorie SS 2006. LMU München<br />
Cierpka, M., Grande, T., Stasch, M., Oberbracht, C., Schneider, W., Schüßler, G.,<br />
Heuft, G., Dahlbender, R., Schauenburg, H. & Schneider, G. (2001). Zur Validität<br />
der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD). Psychotherapeut,<br />
46, 122-133.<br />
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (rev.ed.). New<br />
York: Academic Press.<br />
Dahlbender, R., Buchheim, P. & Schüssler, G. (Hrsg.). (2004). Lernen in der Praxis.<br />
OPD und Qualitätssicherung in der Psychodynamischen Psychotherapie. Bern:<br />
Huber.<br />
Deutsche Rentenversicherung (2009). Rehabilitandenbefragung der DRV.<br />
Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. & Schulte-Markwort, E. (Hrsg.). (2008). Internationale<br />
Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V(F) Diagnostische<br />
Kriterien für Forschung und Praxis. (4. Überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.<br />
Engel, K., Haas, E., von Rad, M., Senf, W. & Becker, H. (1979). Zur Einschätzung von<br />
Behandlungen mit Hilfe psychoanalytischer Konzepte. (Heidelberger Rating).<br />
Medizinische Psychologie, 5, 253-268.<br />
116
Literaturverzeichnis<br />
Franke, G.H. (2002). Symptom-Checkliste von L.R. Derogatis – Deutsche Version.<br />
Manual (2. Vollständig überarbeitete und neu normierte Aufl.). Göttingen: Beltz.<br />
Freyberger, H.J., Heuft, G., Seidler, G.H, Schauenburg, H. & Schneider, W. (1998).<br />
Zur Anwendbarkeit, Praktikabilität, Reliabilität und zukünftigen Forschungsfragestellungen<br />
der OPD. In: Schauenburg, H., Freyberger, H.J., Cierpka, M. &<br />
Buchheim, P. (Hrsg.). OPD in der Praxis. Konzepte, Anwendungen, Ergebnisse<br />
der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik. Bern: Huber.<br />
Grande, T. & Oberbracht, C. (2000). Die Konflikt-Checkliste. Ein anwenderfreundliches<br />
Hilfsmittel für die Konfliktdiagnostik nach OPD. In: Schneider, W. & Freyberger H.<br />
(Hrsg.): Was leistet die OPD? Empirische Befunde und klinische Erfahrungen mit<br />
der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik. Huber: Bern.<br />
Grande, T., Rudolf, G. & Oberbracht, C. (2000). Veränderungsmessung auf OPD-<br />
Basis: Schwierigkeiten und ein neues Konzept. In: Schneider, W. & Freyberger<br />
H. (Hrsg.): Was leistet die OPD? Empirische Befunde und klinische Erfahrungen<br />
mit der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik. Huber: Bern.<br />
Grawe, K., Donati, R., & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession<br />
zur Profession. Göttingen: Hogrefe.<br />
Hartmann, A. & Herzog, T. (1995). Varianten der Effektstärkeberechnung in Meta-<br />
Analysen: Kommt es zu variablen Ergebnissen? Zeitschrift für klinische Psychologie,<br />
24 (4), 337-343.<br />
Heuft, G., Jakobson, T., Kriebel, R., Schneider, W. & Rudolf, G. (2005). Potenzial der<br />
Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD) für die Qualitätssicherung.<br />
Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 51, 261-276.<br />
Heymann, F. von (1998). Basisdokumentation Psychotherapeutische Medizin –<br />
PTMBaDo. Version 2.1b. Unveröffentlichtes Manuskript.<br />
Heymann, F. von, Zaudig, M. & Tritt, K. (2003). Die diagnosebezogene Behandlungsdauer<br />
in der Psychosomatischen und Psychotherapeutischen Medizin: Eine homogene<br />
Grösse? Erste Ergebnisse der Multicenter-Basisdokumentation (Psy-<br />
BaDo-PTM) als Grundlage qualitätssichernder Maßnahmen in der stationären<br />
Psychosomatik. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 62, 209-<br />
221.<br />
Hiller, W. Zaudig, M. & Mombour, W. (1995). IDCL. Internationale Diagnosen Checklisten<br />
für ICD-10. Bern: Huber.<br />
Jacobson, N.S., Roberts, L.J., Berns, S.B. & McGlinchey, J.B. (1999). Methods for defining<br />
and determining the clinical significants of treatment effects: Description,<br />
applications and alternatives. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67<br />
(3), 300-307.<br />
Jacobson, N.S. & Truax P. (1991). Clinical Significance: A statistical approach to defining<br />
meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical<br />
Psychology, 59, 12-19.<br />
Jubiläumsband 25 Jahre Psychosomatische Klinik Bad Grönenbach (2004). HELIOS<br />
Klinik Bad Grönenbach.<br />
Kriebel, R., Paar, G.H., Schmitz-Buhl, S.M. & Raatz, U. (2001). Veränderungsmessung<br />
mit dem Veränderungsfragebogen (VEV): Entwicklung einer Kurzform und deren<br />
117
Literaturverzeichnis<br />
Anwendung in der Psychosomatischen Rehabilitation. Praxis Klinische Verhaltensmedizin<br />
und Rehabilitation, 53, 20-23.<br />
Lambert, M.J. (Ed.) (2003). Bergin and Garfields handbook of psychotherapy and<br />
behaviour change (5th ed.) New York: Wiley.<br />
Lambert, M.J., & Hill, C. (1994). Assessing Psychotherapy Outcomes and Processes.<br />
In: A.E. Bergin & S.L. Garfield (Eds.), Handbook of Psychotherapy and Behaviour<br />
Change (4th ed., pp. 72-113). New York: Wiley.<br />
Lienert, G. A. 1969. Testaufbau und Testanalyse. Beltz: Weinheim.<br />
Lohmer, M., Klug, G., Herrmann, B., Pouget, D. & Rauch, M. (1992). Zur Diagnostik<br />
der Frühstörung. Versuch einer Standortbestimmung zwischen neurotischem Niveau<br />
und Borderline-Störung. Praxis der Psychotherapie, Psychosomatik, 37,<br />
243-255.<br />
Mestel, R., Burger, S., Consbruch, K. von, Wahlert, J. von. & Piesbergen, C. (2010).<br />
Validität und Reliabilität von Basisdokumentationsangaben. HELIOS Klinik Bad<br />
Grönenbach, LMU München, Department Klinische Psychologie.<br />
Mestel, R., Erdmann, A., Schmid, M., Klingelhöfer, J., Stauss, K. & Hautzinger, M.<br />
(2000). 1-3 Jahres Katamnese bei 800 stationär behandelten depressiven Patienten.<br />
In Bassler, M. (Hrsg.): Leitlinien zur stationären Psychotherapie: Pro und<br />
Kontra. Gießen: Psychosozial Verlag.<br />
Mestel, R., Klingelhöfer, J., Dahlbender, R.W. & Schüßler, G. (2004). Validität der<br />
OPD-Achsen Konflikt und Struktur in der klinischen Praxis. In Dahlbender, R.W.,<br />
Buchheim, P., Schüßler, G. (Hrsg.). Lernen an der Praxis. OPD und Qualitätssicherung<br />
in der Psychodynamischen Therapie Bern: Huber<br />
Mestel, R., Klingelhöfer, J., & Stauss, K. (1999). Abhängigkeit des Therapieerfolgs von<br />
der Art des Instrumentes und der Art der Erfolgsmessung bei depressiven Patienten.<br />
Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie, 67 (Sonderheft 1).<br />
Mestel, R. & Lutz, R. (2002, November). Sinn und Unsinn von Effektstärkemaßen. Tagungsbeitrag<br />
auf der 15. Mainzer Werkstatt.<br />
Mestel, R., Vogler, J. & Klingelhöfer, J. (2001). Rückmeldung der testpsychologisch<br />
ermittelten Ergebnisqualität in der stationären Psychosomatik. In Bassler, M.<br />
(Hrsg.). Störungsspezifische Ansätze in der stationären Psychosomatik. Giessen:<br />
Psychosozial.<br />
Michalak, J., Kosfelder, J., Meyer, F. & Schulte, D. (2003). Messung des Therapieerfolgs.<br />
Veränderungsmaße oder retrospektive Erfolgsbeurteilung. Zeitschrift für<br />
klinische Psychologie und Psychotherapie, 32 (2), 94-103.<br />
Monsen, J.T., Odland, T. Faugil, A., Daae, E. & Eilertsen, D. E. (1995). Personality<br />
disorders: Changes and stability after intense psychotherapy focusing on affect<br />
consciousness. Psychotherapy Research, 5, 33-48.<br />
Moosbrugger, H., Kelava, A. (Hrsg.). (2008). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion.<br />
Springer: Berlin. Onlineversion: http://www.springerlink.com/content/978-3-540-<br />
71634-1#section=299444&page=10&locus=4, abgerufen 2010-11-01.<br />
Nitzgen, D. & Brünger, M. (2000). Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik in<br />
der Rehabilitationsklinik Birkenbuck: Einsatz und Befunde. In: Schneider, W. &<br />
Freyberger H. (Hrsg.): Was leistet die OPD? Empirische Befunde und klinische<br />
118
Literaturverzeichnis<br />
Erfahrungen mit der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik. Huber:<br />
Bern.<br />
Pilkonis, P.A. (1988). Personality prototypes among depressives: themes of dependency<br />
and autonomy. Journal of Personality Disorders, 2, 144-152<br />
Reymann, G., Zbikowski, A., Martin, K., Tetzlaff, M. & Janssen, P.L. (2000). Erfahrungen<br />
mit der Anwendung von Operationalisierter Psychodynamischer Diagnostik<br />
bei Alkoholkranken. In: Schneider, W. & Freyberger H. (Hrsg.): Was leistet die<br />
OPD? Empirische Befunde und klinische Erfahrungen mit der Operationalisierten<br />
Psychodynamischen Diagnostik. Huber: Bern.<br />
Rudolf, G., Buchheim, P., Ehlers, W., Küchenhoff, J., Muhs, A., Pouget-Schors, D.,<br />
Rüger, U., Seidler, G.H. & Schwarz, F. (1995). Struktur und strukturelle Störung.<br />
Zeitschrift für psychosomatische Medizin, 4, 197-212.<br />
Rudolf, G. & Grande, T. (1999). Vergleich und Validierung zweier Instrumente zur Einschätzung<br />
von Struktur und struktureller Veränderung. The Scales of Psychological<br />
Capacities (RS Wallerstein) und Operationalized Psychodynamic Diagnosis<br />
(Arbeitsgruppe OPD). Psychosomatische Universitätsklinik, Heidelberg.<br />
Rudolf, G., Grande, T., Oberbracht, C. & Jakobsen, T. (1996). Erste empirische Untersuchungen<br />
zu einem neuen diagnostischen System: Die Operationalisierte<br />
Psychodynamische Diagnostik (OPD). Zeitschrift für psychosomatische Medizin,<br />
42, 343-357.<br />
Rudolf, G., Grande, T. & Oberbracht, C. (1998). Die Struktur-Checkliste. Ein anwenderfreundliches<br />
Hilfsmittel für die Strukturdiagnostik nach OPD. In: Schauenburg, H.,<br />
Freyberger, H.J., Cierpka, M. & Buchheim, P. (Hrsg.). OPD in der Praxis. Konzepte,<br />
Anwendungen, Ergebnisse der Operationalisierten Psychodynamischen<br />
Diagnostik. Bern: Hans Huber.<br />
Rudolf, G., Grande, T. & Oberbracht, C. (2000). Die Heidelberger Umstrukturierungsskala.<br />
Ein Modell der Veränderung in psychoanalytischen Therapien und seine<br />
Operationalisierung in einer Schätzskala. Psychotherapeut, 45, 237-246.<br />
Schauenburg, H. (2000). Zum Verhältnis zwischen Bindungsdiagnostik und psychodynamischer<br />
Diagnostik. In: Schneider, W. & Freyberger, H. (Hrsg.): Was leistet die<br />
OPD? Empirische Befunde und klinische Erfahrungen mit der Operationalisierten<br />
Psychodynamischen Diagnostik. Huber: Bern.<br />
Schauenburg, H. & Strack, M. (1998). Die Symptom Checklist 90 R (SCL-90-R) zur<br />
Darstellung von statistisch- und klinisch-signifikanten Psychotherapieergebnissen.<br />
Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 47, 257-264.<br />
Schepank, H. (1995). Der Beeinträchtigungs-Schwere-Score. Testmanual. Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Schmidt, J. (1991). Evaluation einer psychosomatischen Klinik. Frankfurt/Main: VAS –<br />
Verlag für Akademische Schriften.<br />
Schneider, G., Lange, C & Heuft, G. (2002). Operationalized Psychodynamic Diagnostics<br />
and differential therapy indication in routine diagnostics at a psychodynamic<br />
outpatient department. Psychotherapy Research, 12, 149-178.<br />
Schneider, G., Mendler, T., Heuft, G., & Burgmer, M. (2008). Der Körper in der Konflikt-<br />
und Strukturdiagnostik der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik –-<br />
119
Literaturverzeichnis<br />
Bezug zu Körperkonzepten in der Selbstauskunft. Zeitschrift für Psychosomatische<br />
Medizin und Psychotherapie, 54, 132-149.<br />
Schuhfried GmbH. Wiener Testsystem. [Computer Software].<br />
Schulte, D. (1993). Wie soll Therapieerfolg gemessen werden? Zeitschrift für Klinische<br />
Psychologie, 22 (4), 374-393.<br />
Spitzer C., Michels-Lucht, F., Siebel U. & Freyberger H.J. (2002). Die Strukturachse<br />
der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik (OPD): Zusammenhänge<br />
mit soziodemografischen, klinischen und psychopathologischen Merkmalen sowie<br />
kategorialen Diagnosen. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie,<br />
52, 392-397.<br />
Steyer, R., Hannöver, W., Telser, C. & Kriebel, R. (1997). Zur Evaluation<br />
intraindividueller Veränderung. Zeitschrift für klinische Psychologie, 26, 291-299.<br />
Strauß, B, Hüttmann, B. & Schulz, N. (1997): Kategorienhäufigkeit und prognostische<br />
Bedeutung einer operationalisierten psychodynamischen Diagnostik. Psychotherapie,<br />
Psychosomatik, medizinische Psychologie, 47, 58–63.<br />
Thomasius, R.,Weiler, D., Sack, P.-M., Schindler, A., Gemeinhardt, B., Schuhbert, C. &<br />
Küstner, U. (2001). Validität der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik<br />
(OPD) bei familientherapeutisch behandelten Drogenabhängigen im adoleszenten<br />
und jungen Erwachsenenalter. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische<br />
Psychologie, 51, 365–372.<br />
Website der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes. http://www.gbe-bund.de; Zugriff<br />
2010-10-30.<br />
Website der HELIOS Klinik Bad Grönenbach. http://www.helios-kliniken.de/klinik/badgroenenbach-psychosomatik.html.www.kliniken-groenenbach.de;<br />
Zugriff im Zeitraum<br />
2010-10-01 bis 2011-03-30.<br />
Weinryb, R.M. & Rössel, R.J. (1991). Karolinska Psychodynamic Profile KAPP. Acta<br />
Psychiatrica Scandinavia, 83, 1-23.<br />
Wittmann, W. W., Held, M., Rudolf, A. & Schulze, R. (1996). Gutachten über die Programmevaluationsstudie<br />
der Klinik für Psychosomatische Medizin in Bad<br />
Grönenbach. Unveröffentlichter Bericht, Wittgensteiner <strong>Kliniken</strong> Allianz.<br />
Wittchen, H.-U. & Hoyer, J. (Hrsg.). (2006). Klinische Psychologie & Psychotherapie.<br />
Heidelberg: Springer Medizin.<br />
Wittchen, H.-U., Zaudig, M. & Fydrich, T. (1997). Strukturiertes Klinisches Interview für<br />
DSM-IV. Göttingen: Hogrefe.<br />
Zielke, M. & Kopf-Mehnert, C. (1978). Veränderungsfragebogen des Erlebens und<br />
Verhaltens (VEV). Manual. Weinheim: Beltz.<br />
Zielke, M. & Kopf-Mehnert, C. (2001). 22 Jahre wissenschaftliche und klinische Erfahrung<br />
mit dem Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens VEV. Praxis<br />
Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 53, 3-6.<br />
Zimmermann, J., Ehrental, J. C., Hörz, S., Rentrop, M., Rost, R., Schauenburg, H.,<br />
Schneider, W., Waage, M. & Cierpka, M. (2010). Neue Validierungsstudien zur<br />
Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD-2). Psychotherapeut,<br />
55, 69-73. Online publiziert: 18.12.2009. Abruf: 29.09.2010. Springer: Berlin.<br />
120
Literaturverzeichnis<br />
Hintergrundliteratur:<br />
Grande T., Oberbracht C. & Rudolf G. (1998). Die Strukturachse der Operationalisierten<br />
Psychodynamischen Diagnostik (OPD): Forschungsergebnisse zum Konzept<br />
und zur klinischen Anwendung. Persönlichkeitsstörungen, 2, 173-182.<br />
Grawe, K. (2004). Psychoneurotherapie. Göttingen: Hogrefe.<br />
Rudolf, G. (2004).Strukturbezogene Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.<br />
Rudolf, M. & Müller, J. (2004). Multivariate Verfahren. Göttingen: Hogrefe.<br />
Schneider, W. (2004). Überlegungen zum wissenschaftlichen Stand und zur Entwicklung<br />
der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD). In:<br />
Dahlbender R., W., Buchheim, P., Schüßler, G. (Hrsg.). Lernen an der Praxis.<br />
OPD und die Qualitätssicherung in der psychodynamischen Psychotherapie.<br />
Bern: Huber.<br />
Website der Weltgesundheitsorganisation. www. VDR. De. Zugriff im Zeitraum 2010-<br />
10-01 bis 2010-11-30.<br />
Wirtz, M. & Caspar, F. (2002). Beurteilerübereinstimmung und Beurteilerreliabilität.<br />
Göttingen: Hogrefe.<br />
121
Tabellenverzeichnis<br />
TABELLENVERZEICHNIS<br />
Tabelle 4.1 ..................................................................................................................36<br />
Tabelle 4.2 ..................................................................................................................39<br />
Tabelle 4.3 ..................................................................................................................41<br />
Tabelle 4.4 ..................................................................................................................42<br />
Tabelle 4.5 ..................................................................................................................47<br />
Tabelle 4.6 ..................................................................................................................51<br />
Tabelle 4.7 ..................................................................................................................53<br />
Tabelle 5.1 ..................................................................................................................58<br />
Tabelle 5.2 ..................................................................................................................58<br />
Tabelle 5.3 ..................................................................................................................59<br />
Tabelle 5.4 ..................................................................................................................60<br />
Tabelle 5.5 ..................................................................................................................61<br />
Tabelle 5.6 ..................................................................................................................62<br />
Tabelle 5.7 ..................................................................................................................63<br />
Tabelle 5.8 ..................................................................................................................63<br />
Tabelle 5.9 ..................................................................................................................64<br />
Tabelle 5.10 ................................................................................................................65<br />
Tabelle 5.11 ................................................................................................................68<br />
Tabelle 5.12 ................................................................................................................69<br />
Tabelle 5.13 ................................................................................................................70<br />
Tabelle 5.14 ................................................................................................................70<br />
Tabelle 5.15 ................................................................................................................72<br />
Tabelle 5.16 ................................................................................................................73<br />
Tabelle 5.17 ................................................................................................................74<br />
Tabelle 5.18 ................................................................................................................75<br />
Tabelle 5.19 ................................................................................................................76<br />
Tabelle 5.20 ................................................................................................................77<br />
Tabelle 5.21 ................................................................................................................77<br />
Tabelle 5.22 ................................................................................................................78<br />
Tabelle 5.23 ................................................................................................................78<br />
Tabelle 5.24 ................................................................................................................79<br />
Tabelle 5.25 ................................................................................................................80<br />
Tabelle 5.26 ................................................................................................................80<br />
Tabelle 5.27 ................................................................................................................81<br />
Tabelle 5.28 ................................................................................................................82<br />
122
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 5.29 ................................................................................................................82<br />
Tabelle 5.30 ................................................................................................................84<br />
Tabelle 5.31 ................................................................................................................85<br />
Tabelle 5.32 ................................................................................................................85<br />
Tabelle 5.33 ................................................................................................................86<br />
Tabelle 5.34 ................................................................................................................87<br />
Tabelle 5.35 ................................................................................................................88<br />
Tabelle 5.36 ................................................................................................................89<br />
Tabelle 5.37 ................................................................................................................89<br />
Tabelle 5.38 ................................................................................................................90<br />
Tabelle 5.39 ................................................................................................................91<br />
Tabelle A-1 ................................................................................................................ 124<br />
Tabelle A-2 ................................................................................................................ 125<br />
Tabelle A-3 ................................................................................................................ 126<br />
Tabelle B-1 ................................................................................................................ 127<br />
Tabelle B-2 ................................................................................................................ 127<br />
Tabelle E-1 ................................................................................................................ 143<br />
Tabelle E-2 ................................................................................................................ 144<br />
Tabelle E-3 ................................................................................................................ 144<br />
Tabelle E-4 ................................................................................................................ 145<br />
Tabelle E-5 ................................................................................................................ 146<br />
Tabelle E-6 ................................................................................................................ 147<br />
Tabelle E-7 ................................................................................................................ 147<br />
123
Anhang A<br />
Anhang A - ICD-10 Diagnosen<br />
Tabelle A-1<br />
ICD-10 Diagnosen in SP1<br />
ICD-10 Diagnosen SP1<br />
F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope<br />
Substanzen<br />
Anzahl<br />
N<br />
Prozent<br />
F 10.1 Schädlicher Gebrauch von Alkohol<br />
9 1.8%<br />
F 10.2 Alkoholabhängigkeit<br />
10 2.0%<br />
F 12.1 Schädlicher Gebrauch von Cannabinoiden<br />
1
Anhang A<br />
ICD-10 Diagnosen SP1 Fortsetzung Anzahl<br />
N<br />
F 61 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen<br />
F 62 Andauernde Persönlichkeitsänderung<br />
F 63.9 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle<br />
Gesamt<br />
F7 Intelligenzminderung<br />
F79 Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung<br />
Gesamt<br />
125<br />
18<br />
1<br />
1<br />
57<br />
Prozent<br />
3.6%<br />
Anhang A<br />
Tabelle A-3<br />
ICD-10 Hauptdiagnosen von Stichprobe 3<br />
ICD-10 Haupt-Diagnosen SP3 Anzahl<br />
N<br />
F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope<br />
Substanzen<br />
F 10.2 Alkoholabhängigkeit<br />
2<br />
Gesamt<br />
2<br />
F3 Affektive Störungen<br />
F 32.1 Mittelgradige depressive Episode<br />
F 33.1 Rezidivierende depressive Störung<br />
Gesamt<br />
F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen<br />
F 40.1 Soziale Phobien<br />
F 40.9 Nicht näher bezeichnete phobische Störung<br />
F 41.0 Panikstörung<br />
F 42.2 Zwangsstörung (Gedanken/Handlungen gemischt)<br />
F 43.1 Posttraumatische Belastungsstörung<br />
F 43.2 Anpassungsstörung<br />
Gesamt<br />
F5 Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung mit körperlichen<br />
Störungen und Faktoren<br />
F 50.9 Nicht näher bezeichnete Essstörung<br />
F 54 Psychische Faktoren und Verhaltensweisen bei andernorts<br />
klassifizierten Krankheiten<br />
Gesamt<br />
126<br />
6<br />
27<br />
33<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
5<br />
12<br />
1<br />
1<br />
Prozent<br />
4.1%<br />
4.1%<br />
12.2%<br />
55.1%<br />
67.3%<br />
4.1%<br />
2.0%<br />
2.0%<br />
4.1%<br />
2.0%<br />
10.2%<br />
24.4%<br />
2.0%<br />
2.0%<br />
2 4.0%<br />
ICD-10 Haupt-Diagnosen insgesamt 49 100%
Anhang B<br />
Anhang B - Repräsentativität<br />
Prüfung der Repräsentativität in Stichprobe 1.<br />
Tabelle B-1<br />
Unterschiede im Berufsabschluss der in die Hauptstichprobe ein- bzw. ausgeschlossen<br />
Patientinnen<br />
In<br />
Ausbildung<br />
11<br />
5.6 %<br />
19<br />
13.3 %<br />
30<br />
8.8 %<br />
Lehre/<br />
Fachschule<br />
Berufsabschluss<br />
Meister FH/Uni<br />
127<br />
Ohne<br />
Abschluss<br />
Sonstiger<br />
Abschluss Gesamt<br />
Ein<br />
Anzahl<br />
%<br />
101<br />
51.1 %<br />
8<br />
4.1 %<br />
56<br />
28.6 %<br />
10<br />
5.1 %<br />
10<br />
5.1 %<br />
196<br />
100 %<br />
Aus Anzahl<br />
%<br />
69<br />
48.3 %<br />
4<br />
2.8 %<br />
29<br />
20.3 %<br />
15<br />
10.5 %<br />
7<br />
4.9 %<br />
143<br />
100 %<br />
Ges. Anzahl<br />
%<br />
170<br />
50.1 %<br />
12<br />
3.5 %<br />
85<br />
25.1 %<br />
25<br />
7.4 %<br />
17<br />
5.0 %<br />
339<br />
100 %<br />
Anmerkungen.<br />
FH = Fachhochschule. Uni = Universität. Ein = In die Stichprobe eingeschlossene Patientinnen.<br />
Aus = Aus der Stichprobe ausgeschlossene Patientinnen. % = Prozentanteil der Ein- und Ausgeschlossenen.<br />
Tabelle B-2<br />
Unterschiede in der Berufstätigkeit vor dem Klinikaufenthalt der in die Hauptstichprobe<br />
ein- bzw. ausgeschlossen Patientinnen<br />
Letzte Berufstätigkeit<br />
Ungelernter Facharbeiter Einfacher Mittlerer Höherer Leitender<br />
Arbeiter<br />
Angestellt. Angestellt. Angestellt. Angestellt.<br />
Ein Anzahl 10<br />
16<br />
42 45 39 13<br />
% 5.1 % 8.2 % 21.4 % 23.0 % 19.9 % 6.6. %<br />
Aus Anzahl 16<br />
7<br />
35 31 14<br />
4<br />
% 11.2 % 4.9 % 24.5 % 21.7 % 9.8 % 2.8 %<br />
Ges. Anzahl 26<br />
23<br />
77 76 53 17<br />
% 7.7 % 6.8 % 22.7 % 22.4 % 15.6 % 5.0 %<br />
Anmerkungen.<br />
Ein = In die Stichprobe eingeschlossene Patientinnen. Aus = Aus der Stichprobe ausgeschlossene<br />
Patientinnen. % = Prozentanteil der Ein- und Ausgeschlossenen. Angestellt. = Angestellte.
Anhang B<br />
Fortsetzung von Tabelle B-2<br />
Ein<br />
Aus<br />
Gesamt<br />
Anzahl<br />
%<br />
Anzahl<br />
%<br />
Anzahl<br />
%<br />
Selbst.<br />
klein<br />
5<br />
2.6 %<br />
4<br />
2.8 %<br />
9<br />
2.7 %<br />
Selbst.<br />
mittel<br />
5<br />
2.6 %<br />
2<br />
1.4 %<br />
7<br />
2.1 %<br />
Selbst..<br />
groß<br />
3<br />
1.5 %<br />
4<br />
2.8 %<br />
7<br />
2.1 %<br />
Letzte Berufstätigkeit<br />
128<br />
Nie erwerbstätig<br />
11<br />
5.6 %<br />
16<br />
11.2 %<br />
27<br />
8.0 %<br />
Unbek.<br />
unklar<br />
7<br />
3.6 %<br />
10<br />
7.0 %<br />
17<br />
5.0 %<br />
Gesamt<br />
196<br />
100 %<br />
143<br />
100 %<br />
339<br />
100 %<br />
Anmerkungen.<br />
Ein = In die Stichprobe eingeschlossene Patientinnen. Aus = Aus der Stichprobe ausgeschlossene<br />
Patientinnen. % = Prozentanteil der Ein- und Ausgeschlossenen. Selbst. = Selbständig.<br />
Unbek. = Unbekannt.
Anhang C<br />
Anhang C - Erhebungsinstrumente<br />
Verwendete Items der Psy-BaDo-PTM (TherapeutInnen Dokumentationsbogen voll-<br />
ständig dargestellt).<br />
1. Verwendete Items der Psy-BaDo-PTM bei Aufnahme:<br />
v006<br />
= sex<br />
1<br />
2<br />
129<br />
männlich<br />
weiblich<br />
gebdat Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)<br />
v009 Bitte geben Sie hier Ihren aktuellen Familien-<br />
stand an.<br />
Gemeint ist der zeitlich zuletzt eingetretene<br />
Familienstand.<br />
Nur eine Angabe ist möglich.<br />
v010 Wie ist Ihre aktuelle Partnersituation? Nur<br />
eine Angabe ist möglich.<br />
v016 Was ist Ihr höchster Schulabschluss?<br />
Nur eine Angabe ist möglich.<br />
v017 Was ist Ihr höchster Berufsabschluss?<br />
Nur eine Angabe ist möglich.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
9<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
9<br />
ledig (hierunter fallen alleinstehende Personen ebenso<br />
wie<br />
Paare in nicht-ehelicher Lebensgemeinschaft)<br />
verheiratet<br />
getrennt lebend (Verheiratete, die nicht mehr als Paar<br />
dern<br />
zusammenleben; dies ist nicht im räumlichen, son-<br />
im sozialen Sinne gemeint)<br />
geschieden<br />
verwitwet<br />
wieder verheiratet<br />
kurzfristig kein Partner (bis zu drei Jahre)<br />
langfristig, dauerhaft kein Partner (über drei Jahre)<br />
wechselnde Partner (unverbindliche Beziehungen, die<br />
keinen echten sozialen Rückhalt bieten)<br />
fester Ehe-Partner<br />
fester Nicht-Ehe-Partner<br />
gehe noch zur Schule<br />
kein Schulabschluss (Abbruch der Schullaufbahn)<br />
Sonderschulabschluss<br />
Haupt-/ Volksschulabschluss<br />
Realschulabschluss/ Mittlere Reife/ polytechnische<br />
Oberschule<br />
Abitur oder Fachabitur<br />
sonstiger Abschluss (z. B. ausländischer Abschluss, der<br />
sich nicht klar einem deutschen Abschluss zuordnen<br />
lässt)<br />
befinde mich noch in Berufsausbildung, bin Student/in<br />
habe Lehre oder Fachschule abgeschlossen<br />
bin Meister<br />
abgeschlossene Fachhochschule oder Universität<br />
ohne Abschluss einer Berufsausbildung<br />
sonstiger Abschluss (z. B. unklar, ob es sich um einen<br />
Berufsabschluss handelt)
Anhang C<br />
v018 Welches war Ihre zuletzt ausgeübte Berufstä-<br />
tigkeit?<br />
Bei mehreren Tätigkeiten bitte die zeitlich<br />
überwiegende angeben.<br />
Nur eine Angabe ist möglich.<br />
v020 Wie ist Ihre jetzige berufliche Situation bezo-<br />
gen auf Ihre Erwerbstätigkeit?<br />
Entscheiden Sie sich bei mehreren Tätigkei-<br />
ten für die zeitlich überwiegende.<br />
Sind Sie in mehreren Bereichen berufstätig<br />
(erste drei Antwortkategorien), dann summie-<br />
ren sie die Arbeitszeiten.<br />
Nur eine Angabe ist möglich.<br />
v023 Wie viele Wochen sind Sie in den letzten<br />
zwölf Monaten insgesamt arbeitsunfähig<br />
krank gewesen?<br />
Es geht darum, wie lange Sie unfähig waren,<br />
Ihrer vorrangigen Beschäftigung / Tätigkeit /<br />
Arbeit nachzugehen.<br />
Bitte addieren Sie die Krankschreibungszei-<br />
ten gegebenenfalls.<br />
p026 Vor wie viel Monaten oder Jahren sind die<br />
heutigen Beschwerden, wegen denen Sie<br />
hauptsächlich in unsere Klinik gekommen<br />
sind, zum ersten Mal deutlich aufgetreten?<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
0-<br />
52<br />
130<br />
ungelernter/ angelernter Arbeiter<br />
Facharbeiter, nicht selbständiger Handwerker<br />
einfacher Angestellter (BAT X-IX),<br />
einfacher Beamter (A 1-4, Kr 1-3)<br />
mittlerer Angestellter (BAT VIII-Vc),<br />
Beamter mittlerer Dienst (A 5-8, Kr 4-6)<br />
höherer Angestellter (BAT V-III),<br />
Beamter gehobener Dienst (A 9-13, Kr 7-12)<br />
hochqualifizierter oder leitender Angestellter (BAT II-I),<br />
Beamter höherer Dienst (A 13-16)<br />
Selbständig (kleiner Handwerks-, Landwirt-,<br />
Gewerbebetrieb)<br />
Selbständig (mittlerer Handwerks-, Landwirt-,<br />
Gewerbebetrieb)<br />
Selbständig (Akademiker, Freiberufler, Unternehmer<br />
(größerer Betrieb)<br />
nie erwerbstätig<br />
unbekannt/ unklar<br />
berufstätig, Vollzeit (ca. 40 Wochenstunden)<br />
berufstätig, Teilzeit (regelmäßige, aber nicht vollschichti-<br />
ge<br />
Arbeit)<br />
berufstätig, gelegentlich (unregelmäßige Arbeit)<br />
mithelfender Familienangehöriger, nicht berufstätig<br />
(in keinem rechtlich gesicherten Arbeitsverhältnis)<br />
Hausfrau oder Hausmann, nicht berufstätig<br />
Ausbildung oder Umschulung (z. B. Studium, Lehre)<br />
Wehr-/ Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr<br />
beschützt beschäftigt (z. B. betreute Wohngruppe)<br />
arbeitslos gemeldet<br />
L: Erwerbs-/ Berufsunfähigkeitsrente auf Dauer bewilligt<br />
L: Erwerbs-/ Berufsunfähigkeitsrente auf Zeit bewilligt<br />
Frührente oder Altersrente oder Pension<br />
Witwen-/ Witwer-Rente<br />
anderweitig ohne berufliche Beschäftigung<br />
unbekannt/ unklar<br />
(in Wochen)<br />
in Monaten
Anhang C<br />
2. Verwendete Items aus dem Grönenbacher Nachbefragungsbogen<br />
(GNNB, © Dr. Robert Mestel)<br />
Die Fragen beziehen sich zumeist auf Ihren Zustand nach der Klinik, also auf die<br />
letzten 12 Monate.<br />
06<br />
36<br />
37<br />
38<br />
39<br />
40<br />
Wie viele Wochen sind Sie in den letzten<br />
zwölf Monaten insgesamt arbeitsunfähig<br />
krank gewesen ?<br />
Es geht darum, wie lange Sie nicht in der<br />
Lage waren, Ihrer vorrangigen Beschäftigung<br />
oder Arbeit nachzugehen (z.B. als<br />
Angestellter, Hausfrau, Studentin, Rentner).<br />
Wochen ggf. addieren und auf Ganze<br />
runden.<br />
Nehmen Sie aktuell im Vergleich zur Zeit<br />
vor Ihrer Aufnahme bei uns - mehr oder<br />
weniger Medikamente ein ?<br />
Wie hat sich die Störung Ihres körperlichen<br />
Befindens (körperliche Symptomatik)<br />
seit Ihrer Entlassung verändert ?<br />
Wie hat sich die Störung Ihres psychischen<br />
Befindens (psychische Symptomatik)<br />
seit Ihrer Entlassung verändert ?<br />
Wie hat sich Ihr Selbstwerterleben, Ihre<br />
Selbstannahme seit Ihrer Entlassung<br />
verändert? Mögen Sie sich jetzt mehr<br />
oder eher weniger ?<br />
Wie haben sich Ihre sozialen Probleme<br />
(wie z.B. Arbeitsplatzprobleme, Wohnungsprobleme,<br />
finanzielle Probleme)<br />
seit Ihrer Entlassung verändert ?<br />
131<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
__________________ (Wochen)<br />
ich war stets arbeitsfähig<br />
ich nahm weder vorher noch nachher Medikamente<br />
ich nehme mehr Medikamente<br />
ich nehme weniger Medikamente<br />
ich nehme genauso viele Medikamente<br />
ich weiß nicht<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert<br />
nicht zu beurteilen
Anhang C<br />
41<br />
43<br />
45<br />
46<br />
47<br />
Wie haben sich Ihre Beziehungen zu<br />
Personen im privaten Bereich, die Ihnen<br />
sehr wichtig sind, seit Ihrer Entlassung<br />
verändert (Eltern, Partner, Kinder, Freunde<br />
etc.) ?<br />
Wie hat sich die Möglichkeit zur Eigenaktivität<br />
und zur Übernahme von Verantwortung<br />
für Ihr Leben seit Ihrer Entlassung<br />
verändert (z.B. Kontaktfähigkeit,<br />
Durchsetzungsvermögen) ?<br />
Wie hat sich Ihre Einstellung gegenüber<br />
Ihrer Zukunft seit Ihrer Entlassung verändert?<br />
(bezüglich grundsätzlich durchführbaren<br />
Zukunftsplänen) ?<br />
Wie hat sich Ihr allgemeines seelisches<br />
Wohlbefinden seit Ihrer Entlassung<br />
verändert ?<br />
Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach Ihre<br />
Fähigkeit, den Anforderungen des Alltags<br />
wieder gewachsen zu sein, seit Ihrer<br />
Entlassung verändert ?<br />
132<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert<br />
war nicht mein Problem<br />
deutlich verschlechtert<br />
etwas verschlechtert<br />
nicht verändert<br />
etwas gebessert<br />
deutlich gebessert
Anhang C<br />
3. TherapeutInnenDokumentationsbogen (© Dr. Robert Mestel)<br />
TherapeutInnen Dokumentationsbogen – „Psyche“ – Kodierbogen<br />
(Variablen rot markiert)<br />
(ab 1.5.2004) – Psychosomatische Klinik Bad Grönenbach – Abt. 1 - 5<br />
________ Code Pat. Name: _____________________________ Therapeu-<br />
tInnen: ______________<br />
Einschätzung: Therapiebeginn !<br />
Motivation des Patienten zur Therapie (bitte eine Zahl ankreuzen):<br />
133<br />
(Kürzel reichen aus; bitte alle BehandlerInnen eintragen!)<br />
1 2 3 4 5<br />
nicht motiviert kaum motiviert etwas moti-<br />
viert<br />
Beeinträchtigungs-Beschwerde-Score (BSS): prä<br />
motiviert sehr motiviert<br />
Beurteilungszeitraum: Die letzten sieben Tage vor Therapiebeginn: BSS Sum-<br />
menscore (0-12): _____<br />
Gar nicht<br />
(0)<br />
Geringfügig<br />
(1)<br />
Deutlich<br />
1. Körperlicher Beeinträchtigungsgrad (0-4): <br />
2. Psychischer Beeinträchtigungsgrad (0-<br />
4):<br />
(2)<br />
Stark<br />
(3)<br />
Extrem<br />
(4)<br />
<br />
3. Sozialkommunikativer Beeinträcht. (0-4):
Anhang C<br />
Ich- und Selbststruktur (OPD Strukturachse): Integ-<br />
ration: <br />
Selbstwahrneh-<br />
mung<br />
Gut<br />
(1)<br />
Gut<br />
bis<br />
mäßig<br />
(1,5)<br />
Mäßig<br />
(2)<br />
134<br />
Mäßig<br />
bis<br />
gering<br />
(2,5)<br />
Gering<br />
(3)<br />
Gering<br />
bis de-<br />
sintegri<br />
ert<br />
(3,5)<br />
Desint<br />
e-<br />
griert<br />
(4)<br />
nicht<br />
beur-<br />
<br />
Selbststeuerung <br />
Abwehr <br />
Objektwahrneh-<br />
mung<br />
<br />
Kommunikation <br />
Bindung <br />
Gesamtein-<br />
schätzung<br />
<br />
Tiefenpsychologische Konflikte (OPD) Bitte die Nummern beachten:<br />
1. Abhängigkeit vs. Autonomie 2. Unterwerfung vs. Kontrolle 3. Versor-<br />
gung vs. Autarkie<br />
4. Selbstwertkonflikte (Selbst- vs. Objektwert)5. Über-Ich- und Schuldkonflikte 6. Ödipal-sexuelle<br />
Konflikte<br />
7. Identitätskonflikte 8. Fehl. Konflikt-/Gefühlswahrnehmung 9. Konflikthafte<br />
äußere Lebensbeding.<br />
teil-<br />
bar
Anhang C<br />
Wichtigster Konflikt: Nr.: _____ (Modus Nr. ___ ) Zweitwichtigster Konflikt: Nr.:<br />
____ (Modus Nr. __ )<br />
Modus: 1. vorwiegend aktiv 2. gemischt eher aktiv 3. gemischt eher passiv 4. vorwiegend passiv<br />
5. nicht beurteilbar<br />
Einschätzung: Therapieende !<br />
Art der Therapiebeendigung:<br />
1 regulär 2 vorzeitig durch Patient 3 vorzeitig durch Therapeut/Klinik 4<br />
vorzeitig mit beidseitigem Einverständnis<br />
5 Verlegung mit geplanter Wiederaufnahme 6 Verleg. ohne gepl. Wied. 7 sonstiges 8 vorzeitige<br />
Beendigung durch Kostenträger<br />
Wie hat sich das körperliche Befinden des/der Patienten/in verändert?<br />
1 deutlich gebessert 2 etwas gebessert 3 nicht verändert 4 etwas verschlechtert 5 deutlich ver-<br />
schlechtert 0 kein relevanter Problembereich<br />
Wie hat sich das seelische Befinden des/der Patienten/in verändert?<br />
1 deutlich gebessert 2 etwas gebessert 3 nicht verändert 4 etwas verschlechtert 5 deutlich ver-<br />
schlechtert 0 kein relevanter Problembereich<br />
Prinzipielle Arbeitsfähigkeit bei Entlassung? 1 ja 2 nein 3<br />
trifft nicht zu (z.B. da keine Informationen)<br />
135
Anhang C<br />
Welche Maßnahmen wurden dem Pat. für die Zeit nach der Behandlung ausdrücklich<br />
empfohlen?<br />
Mehrfachantworten möglich! 1=Maßnahme empfohlen, sonst leer lassen<br />
1 hausärztliche Behandlung<br />
4 stationäre Behandlung<br />
7 ambulante Psy-<br />
chotherapie<br />
2 Psychosozialer<br />
Dienst<br />
136<br />
3 andere berufsfördernde Maß-<br />
nahmen<br />
5 Beratungsstelle 6 Rentenantrag<br />
8 Arbeitsplatzwechsel 9 gestufte Wiedereingliederung<br />
10 Selbsthilfegruppe 11 Umschulung/ Be-<br />
rufswechsel<br />
in Arbeitsprozess<br />
12 Intervallbehandlung (ambul. und<br />
stat. Therapie)<br />
13 ambulante psychiatrische Behandlung 14 ambulante Therapie in Klinik<br />
Grönenbach<br />
15 Therapeutische Wohngemeinschaft 16 Tagesklinik<br />
Beeinträchtigungs-Beschwerde-Score (BSS): post<br />
Beurteilungszeitraum: Die letzten sieben Tage vor Therapieende: Summenscore (0-12): _____<br />
Gar nicht<br />
(0)<br />
Geringfügig<br />
(1)<br />
Deutlich<br />
1. Körperlicher Beeinträchtigungsgrad (0-4): <br />
2. Psychischer Beeinträchtigungsgrad (0-<br />
4):<br />
3. Sozialkommunikativer Beeinträcht. (0-<br />
4):<br />
(2)<br />
Stark<br />
(3)<br />
Extrem<br />
(4)<br />
<br />
<br />
Vollständige ICD-10 Psycho-Diagnosen (ggf. IDCL-Checklisten verwenden und an diesen Bogen anheften)<br />
Die Diagnose bezieht sich auf das Beschwerdebild zu Therapiebeginn, ergänzt durch Informationen aus dem<br />
Therapieprozess<br />
Eine Hauptdiagnose (= diejenige, der aktuell bei Therapiebeginn oder im Lebenslauf die größte Bedeutung zu-<br />
kommt):<br />
__________________________________________________________ (bitte ausschreiben oder exakte ICD-10 Nr.)<br />
Falls eine Körperdiagnose die Hauptdiagnose ist: Hier unbedingt benennen !
Anhang C<br />
Dauer der Beschwerden in bezug auf die Hauptdiagnose: ______ Jahre (Dauerhau!) weitere Diagnosen (ohne die<br />
Hauptdiagnose!) Bitte ankreuzen:<br />
Depressionen<br />
Depressive Episode, rezidivierend (F33.0 –<br />
F33.4)<br />
Depressive Episode, eine Episode<br />
(F32.0 – F32.4)<br />
Essstörungen<br />
Bulimia Nervosa (auch atypische)<br />
(F50.2, F50.3)<br />
Essstörung nnb (F50.8, F50.9)<br />
Persönlichkeitsstörungen (PS)<br />
Ängstlich-vermeidende/selbstunsichere<br />
PS (SPS) (F60.6)<br />
Abhängige, Dependente PS (DPS)<br />
(F60.7)<br />
Borderline/emotional instabile PS<br />
(BPS) (F60.3)<br />
Narzisstische PS (NPS)<br />
(F60.8=andere)<br />
137<br />
Dysthymia (F34.1)<br />
Depression nnb (F32.8/9, F33.8/9,<br />
F34.8/9, F39)<br />
Anorexia Nervosa (auch atypische)<br />
(F50.0, F50.1)<br />
Zwanghafte PS (ZPS) (F60.5)<br />
Passiv-aggressive PS (PAPS)<br />
(F60.8=andere)<br />
Histrionische PS (HPS) (F60.4)<br />
Dissoziale/antisoziale PS (APS)<br />
(F60.2)<br />
Paranoide PS (PPS) (F60.0) Schizoide PS (SCPS) (F60.1)<br />
Schizotype PS (STY) (F21)<br />
PS nnb/komb.(F60.9/F61)Züge: SPS, ZPS, DPS, PAPS, BPS, HPS,<br />
NPS, APS, PPS, SCPS, STY<br />
Angststörungen (PS)<br />
Agoraphobie mit Panikstörung (F40.01) Soziale Phobie (F40.1)<br />
Agoraphobie ohne Panikstörung Spezifische Phobie (F40.2)
Anhang C<br />
(F40.00)<br />
Panikstörung (F41) Zwangsstörung (F42)<br />
Generalisierte Angststörung (F41.1) Angststörung nnb. (F41.3, F41.8,<br />
Posttraumatische Belastungsstörung<br />
(F43.1)<br />
138<br />
F41.9)<br />
Anpassungsstörung (F43.2)<br />
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen<br />
Abhängigkeit (*.24) Schädlicher Ge-<br />
brauch (*.1)<br />
Remission (*.20,<br />
*.200-202)<br />
Alkohol (F10.*) Alkohol (F10.*) Alkohol (F10.*)<br />
Sedativa/Hypnotika<br />
(F13.*)<br />
Drogen<br />
(F11/12/14/16/18/19.*)<br />
Nikotin (F17.*)<br />
Somatoforme Störungen<br />
Sedativa/Hypnotika<br />
(F13.*)<br />
Drogen<br />
(F11/12/14/16/18/19.*)<br />
Sedativa/Hypnotika<br />
(F13.*)<br />
Drogen<br />
(F11/12/14/16/18/19.*)<br />
Somatisierungsstörung (F45.0) Somatoforme autonome Funktionsstö-<br />
Anhaltende somatoforme Schmerzstö-<br />
rung (F45.4)<br />
rung (F45.3)<br />
Andere somatoforme Stör.<br />
(F45.1/45.2/45.8/45.9)<br />
Körperdiagnosen und Medikamente werden von der medizinischen Abt. dokumentiert !<br />
F60.8<br />
1 Narzißtische PS F60.92 schizoide PS, Züge bzw. Verdacht<br />
F60.8<br />
2 Passiv aggressive PS F60.93 paranoide Züge bzw. Verdacht<br />
F60.8<br />
3 Andere PS (z.B. depressive PS...) F60.94 zwanghafte PS, Züge bzw. Verdacht<br />
F60.9<br />
8<br />
F60.9<br />
passiv-aggressive, negativistische Züge<br />
bzw. Verdacht<br />
9 selbstschädigende PS, Züge bzw. Verdacht<br />
F61.0<br />
1 antisoziale PS, Züge bzw. Verdacht
Anhang C<br />
F60.8<br />
4 Selbstschädigende PS (DSM-III-R) F60.95<br />
F60.9<br />
0 Borderline PS, Züge bzw. Verdacht F60.96<br />
F60.9<br />
dependente/abhängige Züge bzw.<br />
Verdacht<br />
selbstunsichere/ängstlich-vermeidende<br />
PS, Züge bzw. Verdacht<br />
1 Narzißtische PS, Züge bzw. Verdacht F60.97 histrionische Züge bzw. Verdacht<br />
139<br />
F61.0<br />
2 Schizotype PS, Züge/Verdacht<br />
F61.0<br />
3 Anteile einer anderen PS (von F60.8)
Anhang D<br />
Anhang D - EMEK<br />
1 Teilkriterien<br />
1. Arbeitsunfähigkeit (AU):<br />
Verbesserung = 1: Vorher außerhalb und nachher innerhalb der funktionalen<br />
Population (innerhalb ≤ 14 Tage AU) und die statistisch signifikante Verkür-<br />
zung der Arbeitsunfähigkeit nach der Behandlung im Vergleich zu vorher<br />
(RCI 11 : 10 Tage AU, vorher > 14 Tage AU; Quelle: http://www.gbe-bund.de;<br />
Mestel et al., 2010); geht 2-fach ein<br />
Verschlechterung oder keine Veränderung = 0: Vorher innerhalb der funktio-<br />
nalen Population und hinterher außerhalb und vorher außerhalb und nachher<br />
außerhalb<br />
Missing: Sowohl vorher als auch nachher innerhalb der funktionalen Popula-<br />
tion<br />
2. Medikamentenverbrauch<br />
Verbesserung = 1: Weniger Medikamente im Vergleich zu vor der Behand-<br />
lung<br />
Verschlechterung oder keine Veränderung = 0: Gleiche Menge oder mehr<br />
Medikamente im Vergleich zu vor der Behandlung<br />
Missing: Problem nicht vorhanden<br />
3. GSI der SCL-90-R<br />
Zur Einteilung des Therapieerfolgs anhand der Werte im GSI der SCL-90-R werden die<br />
Kriterien aus 4.5.1.2 herangezogen:<br />
RCI (Psychotherapiepatienten) = ± 0.30<br />
Cut-off-Wert für Reduktion hin zur Symptomfreiheit nach Jacobson (Psycho-<br />
therapiepatienten) c = .70<br />
Klinisch unauffälliger Bereich: 0-0.69<br />
Die Messwertpaare (Prä-Kat) werden nach den Kriterien der statistischen und klini-<br />
schen Signifikanz in Anlehnung an Jacobson eingeteilt und folgendermaßen kodiert:<br />
11<br />
Zur Berechnung wurde mangels anderer verfügbarer Werte die Standardabweichung einer<br />
großen, vergleichbaren klinischen Stichprobe von 950 Patientinnen der HELIOS Klinik Bad<br />
Grönenbach (2004/2005) herangezogen, die einen normativen Wert darstellt.<br />
140
Anhang D<br />
Kodierung:<br />
4. VEV-K<br />
Verbesserung = 1: Personen innerhalb der Gesundennorm, d.h. SCL-90-R-<br />
Kat-Wert < .70 und reliabel Verbesserte, d.h. die Prä-Kat-Differenz ist ≥ 0.30;<br />
geht 2-fach ein<br />
Verschlechterung oder neutral = 0: Reliabel Verschlechterte (RCI = - 0.30)<br />
und Unveränderte<br />
Missing: Testnormale (vorher und nachher im Normbereich)<br />
Verbesserung = 1: Wert > 115<br />
Verschlechterung oder neutral = 0: Wert ≤ 85<br />
Missing: Testnormale mit Wert zwischen 85 und 115 (theoretische Nullver-<br />
änderung, siehe Ziehlke & Kopf-Mehnert, 1978) oder nicht erhoben<br />
5. Änderungen körperliches Befinden<br />
Verbesserung = 1: Etwas gebessert oder deutlich gebessert<br />
Verschlechterung oder neutral = 0: Neutral oder verschlechtert<br />
Missing: Problem nicht vorhanden oder nicht erhoben<br />
Analog zu 5. wurden folgende Kriterien kodiert:<br />
6. Änderungen psychisch<br />
7. Änderungen Selbstwerterleben<br />
8. Änderungen sozial<br />
9. Änderungen privat<br />
10. Änderungen Eigenaktivität<br />
11. Änderungen Einstellung zur Zukunft<br />
12. Änderungen seelisches Wohlbefinden<br />
13. Änderungen Alltagsanforderungen<br />
141
Anhang D<br />
2 Abbildung D-1: Screeplot der Faktorenanalyse des EMEK<br />
Abbildung D-1<br />
3 Ergebnisse EMEK<br />
Abbildung D-2<br />
EMEK-Verteilung. EMEKQuot = EMEK-Quotient (Quotient der positiven zu den gültigen<br />
Werten, siehe 4.6.1.1.2)<br />
142
Anhang E - Multiple Regressionen<br />
Multiple Regressionen auf alle weiteren Ergebnis-Kriterien nach Einschluss-<br />
Methode in SP1<br />
Im Folgenden werden alle spezifizierten Prädiktoren (siehe 4.6.2) mit den übrigen Kri-<br />
terien nach der Einschluss-Methode untersucht. Das Signifikanzniveau wird dafür in-<br />
strumentenbezogen angepasst und für die SCL-90-R, den VEV-K, das Therapeu-<br />
tinnenrating und das EMEK durch 4 geteilt (Bortz, 2005), was einem α von .0125 ent-<br />
spricht.<br />
1. Multiple Regression auf die SCL-90-R-Prä-Post-Differenz<br />
Tabelle E-1<br />
Multiple Regression mit Einschluss aller Prädiktoren auf SCL-90-R-Prä-Post-Differenz<br />
in SP1<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
143<br />
Standardi-<br />
sierte Koeffizient. <br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) .967 .372 2.600 .010<br />
SCL-Prä-Wert .741 .055 .767 13.422 .000<br />
Geschlecht -.161 .065 -.136 -2.468 .015<br />
BSS-Summe -.086 .038 -.133 -2.295 .023<br />
Gesamtstrukt. -.257 .117 -.132 -2.198 .029<br />
AU letztes Jahr -.005 .003 -.102 -1.818 .071<br />
Motivation .066 .047 .080 1.392 .166<br />
Erkrankungsd. .000 .000 .069 1.236 .218<br />
Anz. Diagn. -.020 .024 -.051 -.851 .396<br />
PS -.010 .078 -.008 -.129 .898<br />
F = 22.006; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .37683<br />
R² = .514<br />
Die Kollinearitätsdiagnose zeigt mögliche Zusammenhänge zwischen Gesamtstruktur<br />
und Summe im BSS auf. Bei einem Konditionsindex von > 10 laden diese beiden Vari-<br />
ablen auf einem Faktor. Die Variablen „Geschlecht“ und „BSS-Summe“ zeigten keine<br />
relevante Korrelation mit dem Kriterium (r = .01 und r = -.01) aber ein signifikantes Be-<br />
ta-Gewicht. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass es sich um klassische<br />
Suppressoren handelt. Aus diesem Grund wird eine Regression ohne diese beiden<br />
Variablen berechnet.<br />
Es lassen sich folgende signifikante Prädiktoren finden:
Tabelle E-2<br />
Signifikante Prädiktoren der Multiplen Regression mit Einschluss der ausgewählten<br />
Prädiktoren auf die SCL-90-R-Prä-Post-Differenz in SP1<br />
Regressions- Standard- Beta T Signifikanz<br />
koeffizient B fehler<br />
(Konstante) .387 .324 1.194 .234<br />
SCL-90-R-Prä-Wert .684 .054 .708 12.723 .000<br />
Gesamtstruktur -.340 .116 -.174 -2.927 .004<br />
Eine schrittweise Regressionsanalyse ergibt folgende Werte:<br />
Tabelle E-3<br />
Schrittweise Regression aller ausgewählter Prädiktoren auf die SCL-90-R-Prä-Post-<br />
Differenz in SP1<br />
Modell R² Änderung in R² Änderung in F Signifikanz<br />
1 .439 .442 141.179 .000<br />
2 .474 .038 12.773 .000<br />
Anmerkungen.<br />
Einflussvariablen: SCL-90-R-Prä, Gesamtstrukturniveau<br />
AV: SCL-90-R-Prä-Post-Differenz.<br />
Durch die Variable „SCL-90-R-Prä“ werden 44.2 % der Varianz und durch die Variable<br />
„Gesamtstrukturniveau“ weitere 3.8 % der Varianz des Kriteriums „SCL-90-R-Prä-Post-<br />
Differenz“ aufgeklärt.<br />
Die Regressionsgleichung lautet wie folgt:<br />
SCL-90-R-Prä-Post-Differenz = 0.387 + 0.684 ∙ SCL-Prä - 0.340 ∙ Gesamtstruktur<br />
144
2. Multiple Regression auf den VEV-K-Post<br />
Tabelle E-4<br />
Multiple Regression mit Einschluss aller Prädiktoren auf VEV-K-Post in SP1<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
145<br />
Standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) 181.429 23.823 7.616 .000<br />
BSS-Summe -5.060 2.408 -.171 -2.102 .037<br />
Motivation 4.836 3.021 .129 1.601 .111<br />
Geschlecht -6.487 4.182 -.121 -1.551 .123<br />
Gesamtstruktur -8.590 7.495 -.097 -1.146 .253<br />
Anz. Diagnosen 1.376 1.528 .076 .901 .369<br />
AU letztes Jahr -.069 .167 -.033 -.411 .682<br />
SCL-Prä-Wert 1.052 3.538 .024 .297 .767<br />
Persönlichkeitsst. 1.372 5.004 .024 .274 .784<br />
Erkrankungsdau. .002 .020 .007 .085 .933<br />
F = 1.746; p = .082<br />
Standardschätzfehler = 24.147<br />
R² = .036<br />
Das Modell ist nicht signifikant, der Standardschätzfehler ist sehr groß. Die Variablen<br />
„Motivation“, „BSS-Summe“ und „Gesamtstrukturniveau“ korrelieren signifikant mitei-<br />
nander und laden in der Kollinearitätsdiagnose auf gemeinsamen Faktoren.
3. Multiple Regression auf das Therapeutinnenrating der Psychischen Verände-<br />
rung zum Therapieende<br />
Tabelle E-5<br />
Multiple Regression mit Einschluss aller Prädiktoren auf das Therapeutinnenrating der<br />
Psychischen Veränderung in SP1<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
Standardi-<br />
sierte Koeffizienten <br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) 4.285 .588 7.290 .000<br />
Motivation .245 .071 .278 3.458 .001<br />
SCL-Prä-Wert .163 .083 .158 1.957 .052<br />
BSS-Summe -.105 .060 -.145 -1.740 .084<br />
Persönlichkeitsst. -.129 .120 -.093 -1.069 .287<br />
Gesamtstruktur .158 .185 .073 .858 .392<br />
AU letztes Jahr -.003 .004 -.066 -.824 .411<br />
Anz. Diagnosen .021 .036 .051 .589 .557<br />
Geschlecht -.047 .100 -.037 -.473 .637<br />
Erkrankungsdau. .000 .000 .026 .326 .745<br />
F = 2.393; p = .014<br />
Standardschätzfehler = .560<br />
R² = .068<br />
Das Modell ist nicht signifikant (α ≤ .0125). Eine signifikante Korrelation mit dem Krite-<br />
rium ergibt sich nur für die Variable „Motivation“. Die einfache Regression von Motivati-<br />
on auf das Therapeutinnenrating ergibt ein R² von .069 12 (p ≤ .000), d.h. 6.9 % der Va-<br />
rianz im Kriterium „Therapeutinnenrating psychische Veränderung“ zum Therapieende<br />
können durch die Variable „Motivation“ vorhergesagt werden.<br />
Folgende Regressionsgleichung (α ≤ .0125) lässt sich aus den Ergebnissen (einfache<br />
Regression) aufstellen:<br />
Therapeutinnenrating = 3.994 + 0.232 ∙ Motivation<br />
12<br />
Bei einfacher Regression wird das unkorrigierte R² berichtet, was bedeutet, dass der Wert<br />
größer sein kann als bei der multiplen Berechnung.<br />
146
4. Multiple Regression auf die SCL-90-R-Prä-Kat-Differenz<br />
Tabelle E-6<br />
Multiple Regression mit Einschluss aller Prädiktoren auf SCL-90-R-Prä-Kat-Differenz in<br />
SP1<br />
Nicht standardisierte Koeffizienten<br />
147<br />
Standardi-<br />
sierte Koeffizient. <br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) -.179 .583 -.308 .759<br />
SCL-Prä-Wert -.691 .093 -.589 -7.423 .000<br />
BSS-Summe .135 .061 .179 2.238 .027<br />
Erkrankungsdau. -.001 .001 -.100 -1.224 .223<br />
Motivation -.076 .068 -.090 -1.122 .264<br />
Persönlichkeitsst. -.103 .124 -.076 -.832 .407<br />
AU letztes Jahr -.004 .004 -.073 -.937 .351<br />
Gesamtstruktur .052 .175 .025 .297 .767<br />
Geschlecht .011 .101 .008 .107 .915<br />
Anz. Diagnosen .001 .036 .004 .041 .968<br />
F = 7.181; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .48929<br />
R² = .293<br />
Die Kollinearitätsdiagnose zeigt mögliche Zusammenhänge zwischen Gesamtstruktur,<br />
Summe im BSS und Motivation auf. Die Variable „BSS-Summe“ zeigt keine relevante<br />
Korrelation mit dem Kriterium aber ein signifikantes Beta-Gewicht. Deshalb kann davon<br />
ausgegangen werden, dass es sich um klassische Suppression handelt. Aus diesem<br />
Grund wird eine Regression ohne diese Variable mit schrittweiser Merkmalsselektion<br />
berechnet.<br />
Es lassen sich folgende signifikante Prädiktoren finden (Tabelle E-7):<br />
Tabelle E-7<br />
Multiple Regression aller auswählten Prädiktoren mit schrittweiser Merkmalsselektion<br />
auf SCL-90-R-Prä-Kat-Differenz in SP1<br />
Regressionskoeffizient<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta T Signifikanz<br />
(Konstante) .520 .122 4.251 .000<br />
SCL-90-R-Prä-Wert -.631 .086 -.538 -7.354 .000<br />
F = 54.074; p ≤ .000<br />
Standardschätzfehler = .49262<br />
R² = .289<br />
Durch die Variable „SCL-90-R-Prä“ werden 28.9 % der Varianz des Kriteriums „SCL-<br />
90-R-Prä-Kat-Differenz“ aufgeklärt.
Die Regressionsgleichung lautet wie folgt:<br />
SCL-90-R-Prä-Kat = 0.520 - 0.631 ∙ SCL-Prä<br />
5. Multiple Regression auf den VEV-K-Katamnesewert<br />
Das Modell ist nicht signifikant, deshalb wird auf die Darstellung verzichtet. Lediglich<br />
die BSS-Summe und das Gesamtstrukturniveau weisen eine signifikante Korrelation<br />
mit dem Kriterium auf und können 3.0 % der Varianz aufklären (p = .020). Die BSS-<br />
Summe allein kann ebenfalls 3.0 % der Varianz (p = .009) des Kriteriums „VEV-K-<br />
Katamnesewert“ aufklären, so dass die Variable „Gesamtstrukturniveau“ keinen zu-<br />
sätzlichen Gewinn bringt.<br />
Die Regressionsgleichung lautet wie folgt:<br />
6. Multiple Regression auf das EMEK<br />
VEV-K-Kat = 168.961 – 6.511 ∙ BSS-Summe<br />
Das Modell ist nicht signifikant, deshalb wird auf die Darstellung ebenfalls verzichtet.<br />
Das Gesamtstrukturniveau und die BSS-Summe korrelieren relevant miteinander, die<br />
BSS-Summe zeigt eine signifikante Korrelation mit dem Kriterium. Struktur, Motivation<br />
und BSS-Summe laden in der Kollinearitätsdiagnose wieder auf gemeinsamen Fakto-<br />
ren. Die BSS-Summe allein kann 2.7 % der Varianz des EMEKS aufklären (p = .023)<br />
somit jedoch auf α ≤ .0125 keinen signifikanten Beitrag zur Vorhersage leisten. Die<br />
beiden anderen Prädiktoren leisten ebenfalls keinen einzelnen Beitrag.<br />
148
Erklärung<br />
Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Dip-<br />
lomarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von<br />
mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.<br />
_______________________ __________________________<br />
Ort, Datum <strong>Monika</strong> <strong>Loges</strong><br />
149