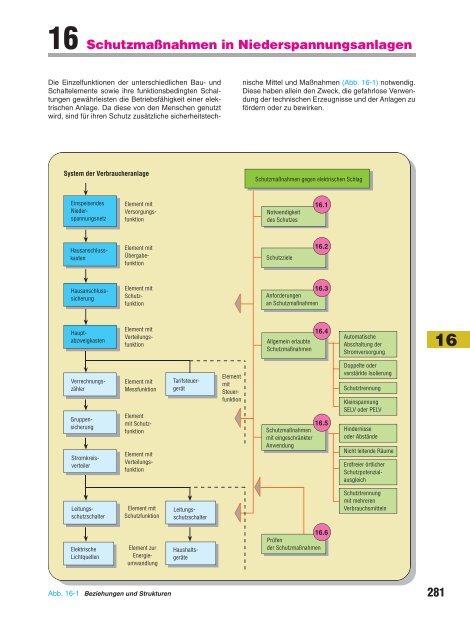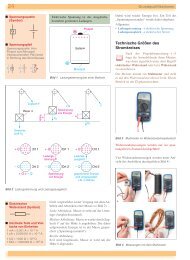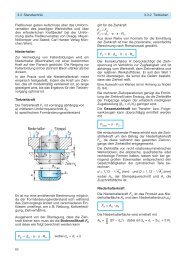16 Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen
16 Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen
16 Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>16</strong> <strong>Schutzmaßnahmen</strong> <strong>in</strong> <strong>Niederspannungsanlagen</strong><br />
Die E<strong>in</strong>zelfunktionen der unterschiedlichen Bau- und<br />
Schaltelemente sowie ihre funktionsbed<strong>in</strong>gten Schaltungen<br />
gewährleisten die Betriebsfähigkeit e<strong>in</strong>er elektrischen<br />
Anlage. Da diese von den Menschen genutzt<br />
wird, s<strong>in</strong>d für ihren Schutz zusätzliche sicherheitstech-<br />
System der Verbraucheranlage<br />
E<strong>in</strong>speisendes<br />
Niederspannungsnetz<br />
Hausanschlusskasten<br />
Hausanschlusssicherung<br />
Hauptabzweigkasten<br />
Verrechnungszähler<br />
Gruppensicherung<br />
Stromkreisverteiler<br />
Leitungsschutzschalter<br />
Elektrische<br />
Lichtquellen<br />
Element mit<br />
Versorgungsfunktion<br />
Element mit<br />
Übergabefunktion<br />
Element mit<br />
Schutzfunktion<br />
Element mit<br />
Verteilungsfunktion<br />
Element mit<br />
Messfunktion<br />
Element<br />
mit Schutzfunktion<br />
Element mit<br />
Verteilungsfunktion<br />
Element mit<br />
Schutzfunktion<br />
Element zur<br />
Energieumwandlung<br />
Abb. <strong>16</strong>-1 Beziehungen und Strukturen<br />
Tarifsteuergerät<br />
Leitungsschutzschalter<br />
Haushaltsgeräte<br />
Element<br />
mit<br />
Steuerfunktion<br />
nische Mittel und Maßnahmen (Abb. <strong>16</strong>-1) notwendig.<br />
Diese haben alle<strong>in</strong> den Zweck, die gefahrlose Verwendung<br />
der technischen Erzeugnisse und der Anlagen zu<br />
fördern oder zu bewirken.<br />
<strong>Schutzmaßnahmen</strong> gegen elektrischen Schlag<br />
Notwendigkeit<br />
des Schutzes<br />
Schutzziele<br />
<strong>16</strong>.1<br />
<strong>16</strong>.2<br />
<strong>16</strong>.3<br />
Anforderungen<br />
an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
Allgeme<strong>in</strong> erlaubte<br />
<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
<strong>16</strong>.4<br />
<strong>16</strong>.5<br />
<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
mit e<strong>in</strong>geschränkter<br />
Anwendung<br />
<strong>16</strong>.6<br />
Prüfen<br />
der <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
Automatische<br />
Abschaltung der<br />
Stromversorgung<br />
Doppelte oder<br />
verstärkte Isolierung<br />
Schutztrennung<br />
Kle<strong>in</strong>spannung<br />
SELV oder PELV<br />
H<strong>in</strong>dernisse<br />
oder Abstände<br />
Nicht leitende Räume<br />
Erdfreier örtlicher<br />
Schutzpotenzialausgleich<br />
Schutztrennung<br />
mit mehreren<br />
Verbrauchsmitteln<br />
<strong>16</strong><br />
281
<strong>16</strong><br />
282<br />
<strong>16</strong>.1 Notwendigkeit des Schutzes gegen elektrischen Schlag<br />
<strong>16</strong>.1 Notwendigkeit des Schutzes<br />
gegen elektrischen Schlag<br />
Alle Wahrnehmungen und motorischen Aktivitäten der<br />
Menschen und Nutztiere werden über elektrische Impulse<br />
gesteuert. Diese schwachen Impulse werden<br />
von vergleichsweise starken elektrischen Strömen<br />
überlagert, wenn die Lebewesen Teil e<strong>in</strong>es Stromkreises<br />
werden.<br />
Bei üblichen<br />
● Spannungswerten<br />
<strong>in</strong> <strong>Niederspannungsanlagen</strong><br />
von<br />
und<br />
● e<strong>in</strong>em Widerstand des<br />
menschlichen Körpers<br />
von<br />
● nach e<strong>in</strong>er Wirkungszeit<br />
des elektrischen<br />
Stromes bis zu<br />
fließen<br />
● Körperströme von<br />
Im Vergleich zu den<br />
Wirkungsbereichen des<br />
50-Hz-Wechselstromes<br />
liegt die Stromstärke<br />
(Abb. 5-10)<br />
etwas unterhalb<br />
der<br />
Loslassschwelle,<br />
die nach<br />
1/10 s<br />
≈ 100 mA<br />
beträgt.<br />
Dadurch reagiert der<br />
menschliche Körper<br />
mit leichter<br />
Muskelverkrampfung<br />
und starker<br />
Schreckreaktion.<br />
230 V<br />
3 kΩ oder 1,3 kΩ<br />
1/10 s 1 s<br />
76,7 mA 176,9 mA<br />
weit oberhalb<br />
der<br />
Flimmerschwelle,<br />
die nach<br />
1 s<br />
≈ 70 mA<br />
beträgt.<br />
starker<br />
Muskelverkrampfung,Herzkammerflimmern,<br />
äußeren<br />
und <strong>in</strong>neren<br />
Verbrennungen.<br />
Unfallstatistiken zeigen, dass die Zahl der Unfälle<br />
durch gefährliche Körperströme im Vergleich zu anderen<br />
ger<strong>in</strong>g ist. Im Gegensatz dazu ist jedoch der Anteil<br />
der tödlichen Unfälle relativ hoch.<br />
Der E<strong>in</strong>fluss der ebenfalls <strong>in</strong> den elektrischen Anlagen<br />
auftretenden elektrischen und magnetischen Felder<br />
auf den menschlichen Organismus ist sehr unterschiedlich.<br />
Im Wesentlichen kann davon ausgegangen<br />
werden, dass das elektrische Feld auf den Menschen<br />
mit se<strong>in</strong>er verhältnismäßig leitenden Körperoberfläche<br />
trifft und somit kaum <strong>in</strong> den Körper e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen kann.<br />
Bei den <strong>in</strong> der Praxis vorkommenden elektrischen<br />
Feldstärken wird nicht e<strong>in</strong>mal die Wahrnehmbarkeitsschwelle<br />
erreicht.<br />
Gefährlich können jedoch elektrische Aufladungen<br />
werden.<br />
Elektrostatische Aufladungen s<strong>in</strong>d Ansammlungen positiver<br />
oder negativer elektrischer Ladungen durch<br />
– mechanische<br />
Vorgänge<br />
sowie<br />
– Influenzvorgänge<br />
Berühren und Trennen von<br />
Körpern unterschiedlicher<br />
Oberflächen (Reibungsvorgänge),<br />
Zerstäuben fester und Versprühen<br />
flüssiger Stoffe,<br />
Verschieben von Ladungen<br />
<strong>in</strong> Leitern durch den E<strong>in</strong>fluss<br />
e<strong>in</strong>es elektrischen Feldes.<br />
Der menschliche Körper ist elektrostatisch leitfähig und<br />
hat gegenüber Erde e<strong>in</strong>e Kapazität von annähernd<br />
150 pF. Bestehen die Schuhe oder der Fußboden aus<br />
e<strong>in</strong>em Isolierstoff, können die gespeicherten Ladungen<br />
nicht abfließen. Nur beim Berühren e<strong>in</strong>es leitfähigen,<br />
ungeladenen Teils (Türkl<strong>in</strong>ke, metallene Rohre) oder<br />
e<strong>in</strong>es ungeladenen Menschen erfolgt e<strong>in</strong> Ladungsaustausch.<br />
In wenigen Millisekunden fließen e<strong>in</strong>ige Milliampere<br />
ab. Bei großem Potenzialunterschied kann<br />
der Ladungsausgleich auch als Funkenüberschlag erfolgen.<br />
Der Ladungsausgleich ist bei e<strong>in</strong>em Potenzialunterschied<br />
von 2 kV spürbar und bereits bei 10 kV<br />
schmerzhaft. Direkte gesundheitliche Schädigungen<br />
entstehen nicht. Schmerzhafte Muskelkontraktionen<br />
können Fehlhandlungen auslösen, die zu Unfällen<br />
führen. Gefahren entstehen bei zündfähigen Gas-Luftgemischen.<br />
Messergebnisse können verfälscht werden.<br />
Arbeitspunkte elektronischer Bauelemente können<br />
sich ändern.<br />
Wirkungen von Magnetfeldern auf den menschlichen<br />
Körper können zurzeit wissenschaftlich nicht e<strong>in</strong>deutig<br />
bestimmt werden. Studien zur Krebshäufigkeit, die den<br />
Zusammenhang zwischen k<strong>in</strong>dlicher Leukämie und<br />
Magnetfeldern nicht ausschließen, zeigen e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>heitliches<br />
Bild. In unabhängig vone<strong>in</strong>ander durchgeführten<br />
Versuchen konnte e<strong>in</strong>deutig nachgewiesen<br />
werden, dass e<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>reichende elektromagnetische<br />
Verträglichkeit von Herzschrittmachern bei den relativ<br />
schwachen niederfrequenten elektrischen und magnetischen<br />
Feldern <strong>in</strong> den Bereichen des alltäglichen Lebens<br />
besteht.<br />
Die von den Verteilungsnetzbetreibern ermittelten maximalen<br />
magnetischen Flussdichten und elektrischen<br />
Feldstärken <strong>in</strong> elektrischen Anlagen und typischen<br />
Haushaltsgeräten liegen weit unter den def<strong>in</strong>ierten<br />
Sicherheitsgrenzwerten (Abb. <strong>16</strong>-2, Abb. <strong>16</strong>-3). Da die<br />
Feldstärkewerte bei Zunahme des Abstandes rasch<br />
abnehmen, liegen die tatsächlich auftretenden Werte<br />
der Haushaltsgeräte weit unter den Sicherheitsgrenzwerten.<br />
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale<br />
Vere<strong>in</strong>igung für Strahlenschutz (IRPA) empfehlen<br />
abgestufte Richtwerte, je nach Dauer und Art<br />
der E<strong>in</strong>wirkung:
Vorsorge Sicherheit<br />
Vorsorgegrenzwert<br />
WHO/ IRPA 5 kV/m<br />
VDE 0848 7 kV/m<br />
Sicherheitsgrenzwert<br />
20 kV/m<br />
Transformatoren<br />
380-kV-Leitungen<br />
110-kV-Leitungen<br />
Mittelspannungsleitungen<br />
In Wohnungen und Gebäuden<br />
Haushaltsgeräte<br />
1 10 100 1000 10000 100000 1 Mio V/m 100 Mio<br />
<strong>16</strong>.1 Notwendigkeit des Schutzes gegen elektrischen Schlag<br />
DIN VDE 0848,<br />
30 kV/m bis 2 Std./Tag<br />
20 kV/m 5000 mT<br />
Teil 4, Okt. 89 7 500 mT bis 5 M<strong>in</strong>./Std.<br />
DIN VDE 0848,<br />
Teil 4, A2, Dez. 92<br />
Individuelle Wahrnehmungsschwellen<br />
Störschwellen für<br />
Herzschrittmacher<br />
Schwellen für<br />
Herzkammerflimmern<br />
elektrische Feldstärke<br />
Abb. <strong>16</strong>-2 Gesundheitliche Bedeutsamkeit elektrischer<br />
50-Hz-Felder<br />
Vorsorgegrenzwert<br />
WHO/ IRPA 100 mT<br />
VDE 0848 400 mT<br />
Sicherheitsgrenzwert<br />
5000 mT<br />
Transformatoren<br />
380-kV-Leitungen<br />
110-kV-Leitungen<br />
Mittelspannungsleitungen<br />
In Wohnungen und Gebäuden<br />
Haushaltsgeräte<br />
Individuelle<br />
Wahrnehmungsschwellen<br />
Störschwellen für<br />
Herzschrittmacher<br />
Schwellen für<br />
Herzkammerflimmern<br />
0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000 mT 10 Mio<br />
magnetische Flussdichte<br />
Abb. <strong>16</strong>-3 Gesundheitliche Bedeutsamkeit magnetischer<br />
50-Hz-Felder<br />
Dauere<strong>in</strong>wirkung Kurzzeite<strong>in</strong>wirkung<br />
20 kV/m 5000 mT<br />
7 kV/m 400 mT<br />
30 kV/m bis 2 Std./Tag<br />
12 500 mT bis 5 M<strong>in</strong>./Std.<br />
10 kV/m 1000 mT<br />
bis 6 Std./Tag<br />
IRPA/WHO<br />
10 kV/m 1000 mT<br />
5 kV/m 100 mT<br />
Empfehlung wenige Std./Tag<br />
Tab. <strong>16</strong>-1 Grenzwerte für das elektrische und magnetische Feld (50/60 Hz)<br />
● e<strong>in</strong>en Sicherheitswert, der berücksichtigt, dass sich<br />
Menschen bei beruflichen Tätigkeiten begrenzte<br />
Zeit <strong>in</strong> Feldern aufhalten können,<br />
und<br />
● e<strong>in</strong>en Vorsorgewert für die Allgeme<strong>in</strong>heit. Diese Werte<br />
bildeten zunächst die Grundlage für die im Oktober<br />
1989 veröffentlichte und im Dezember 1992 angepasste<br />
Norm DIN VDE 0848 (Tab. <strong>16</strong>-1).<br />
Gefahren durch elektrische Körperströme, durch elektromagnetische<br />
Felder oder durch elektrisch gezündete<br />
Brände schränken die Sicherheit des Menschen e<strong>in</strong>.<br />
Steigende Sicherheit verr<strong>in</strong>gert die Gefahr. Das Risiko<br />
s<strong>in</strong>kt (Abb. <strong>16</strong>-4).<br />
Das allgeme<strong>in</strong>e Ziel der <strong>Schutzmaßnahmen</strong> besteht<br />
dar<strong>in</strong>, das Risiko durch den elektrischen<br />
Strom zu verr<strong>in</strong>gern.<br />
H<strong>in</strong>reichende Sicherheit <strong>in</strong> den unterschiedlichen elektrischen<br />
Anlagen kann nicht durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche<br />
Schutzmaßnahme erreicht werden.<br />
Gefahr<br />
Risiko ist höher als<br />
höchstes vertretbares<br />
Risiko<br />
hoch<br />
höchstes<br />
vertretbares<br />
Risiko<br />
Sicherheit<br />
Risiko ist niedriger als<br />
höchstes vertretbares<br />
Risiko<br />
Risiko niedrig<br />
Risiko ohne <strong>Schutzmaßnahmen</strong> Restrisiko<br />
Abb. <strong>16</strong>-4 Sicherheitsgrundsätze<br />
<strong>16</strong><br />
283
<strong>16</strong><br />
284<br />
<strong>16</strong>.2 Schutzziele<br />
<strong>16</strong>.2 Schutzziele<br />
<strong>16</strong>.2.1 Rangfolge der Mittel und<br />
Maßnahmen<br />
Die Gefahren des elektrischen Stromes können vermieden<br />
oder verr<strong>in</strong>gert werden, wenn die <strong>in</strong> den Normen<br />
aufgeführten sicherheitstechnischen Maßnahmen<br />
berücksichtigt werden.<br />
Sicherheitstechnische Maßnahmen s<strong>in</strong>d alle gestalterischen<br />
und beschreibenden Maßnahmen, die zur<br />
Vermeidung von Gefahren getroffen werden.<br />
Die Ziele der Sicherheitstechnik s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> nachstehender<br />
Rangfolge zu verwirklichen (Abb. <strong>16</strong>-5):<br />
Rangfolge<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Technische<br />
Erzeugnisse<br />
s<strong>in</strong>d so zu<br />
gestalten, dass<br />
ke<strong>in</strong>e Gefahren<br />
vorhanden<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Ist e<strong>in</strong>e Gefährdung<br />
durch die<br />
unmittelbare<br />
Sicherheitstechnik<br />
nicht<br />
oder nur teilweiseauszuschließen,<br />
s<strong>in</strong>d<br />
„besondere<br />
sicherheitstechnische<br />
Mittel“<br />
anzuwenden.<br />
Führen die<br />
Maßnahmen<br />
nach 1. und 2.<br />
nicht oder nur<br />
unvollständig<br />
zum Ziel, s<strong>in</strong>d die<br />
Bed<strong>in</strong>gungen<br />
e<strong>in</strong>er gefahrlosen<br />
Verwendung <strong>in</strong><br />
Gebrauchs- und<br />
Betriebsanleitungen(Verhaltensregeln<br />
für den<br />
Nutzer)<br />
anzugeben.<br />
Unmittelbare<br />
Sicherheitstechnik<br />
Mittelbare<br />
Sicherheitstechnik<br />
Besondere sicherheitstechnische<br />
Mittel s<strong>in</strong>d alle E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong><br />
oder an technischen Erzeugnissen,<br />
die ohne zusätzliche Funktion alle<strong>in</strong><br />
den Zweck haben, deren gefahrlose<br />
Verwendung zu fördern oder zu<br />
bewirken.<br />
H<strong>in</strong>weisende<br />
Sicherheitstechnik<br />
Abb. <strong>16</strong>-5 Ziele der Sicherheitstechnik<br />
Beispiel<br />
Spannungsführende<br />
Wicklungen<br />
e<strong>in</strong>es Motors<br />
durch das<br />
Gehäuse<br />
abdecken.<br />
Verb<strong>in</strong>dung des<br />
Motorgehäuses<br />
mit dem<br />
Schutzleiter des<br />
Netzes, um das<br />
Bestehenbleiben<br />
e<strong>in</strong>er durch e<strong>in</strong>en<br />
Körperschluss<br />
entstandenen<br />
gefährlichen<br />
Berürungsspannung<br />
zu<br />
verh<strong>in</strong>dern.<br />
5 Regeln zum<br />
Herstellen und<br />
Sichern des<br />
spannungsfreien<br />
Zustandes bei<br />
Instandhaltungsarbeiten<br />
am<br />
elektromotorischen<br />
Antrieb:<br />
1. Allpolig und<br />
allseitig<br />
abschalten<br />
2. Gegen<br />
Wiedere<strong>in</strong>schalten<br />
sichern<br />
3. Spannungsfreiheit<br />
feststellen<br />
4. Erden und<br />
Kurzschließen<br />
5. Gegen benachbarte,<br />
unter<br />
Spannung<br />
stehende Teile<br />
schützen<br />
<strong>16</strong>.2.2 Vorschriften und Bestimmungen<br />
Relativ früh wurden die Vorteile e<strong>in</strong>er nationalen Normung<br />
sowohl bei der Herstellung und bei dem Vertrieb<br />
elektrischer Betriebsmittel als auch bei der Festlegung<br />
von Sicherheitsanforderungen für das Errichten und<br />
Betreiben elektrischer Anlagen erkannt. Bereits am<br />
1. 1. 1896 s<strong>in</strong>d die „Sicherheitsvorschriften für elektrische<br />
Starkstromanlagen mit Spannungen bis 250 V<br />
zwischen zwei beliebigen Leitungen oder e<strong>in</strong>er Leitung<br />
und Erde“ vom Verband Deutscher Elektrotechniker<br />
als allgeme<strong>in</strong>e Vorschriften erklärt worden. Die fortschreitende<br />
Zusammenarbeit der Länder führte bald<br />
zur <strong>in</strong>ternationalen Normung, <strong>in</strong>sbesondere im grenzüberschreitenden<br />
Warenverkehr.<br />
In der Tabelle <strong>16</strong>-2 s<strong>in</strong>d die wichtigsten <strong>in</strong>ternationalen<br />
und nationalen Organisationen auf dem Gebiet der<br />
Normung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen zusammengefasst.<br />
Das VDE-Vorschriftenwerk<br />
ist e<strong>in</strong>e Sammlung von Festlegungen,<br />
die vom Verband Deutscher Elektrotechniker<br />
herausgegeben wird. Die Festlegungen<br />
ersche<strong>in</strong>en als<br />
VDE-Bestimmungen, auch als deutsche Fassungen<br />
der Europanorm<br />
(EN) und der Harmonisierungsdokumente<br />
(HD)<br />
Sieenthalten sicherheitstechnische Festlegungen<br />
für<br />
– das Errichten und Betreiben elektrischer<br />
Anlagen<br />
– das Herstellen und Betreiben elektrischer<br />
Betriebsmittel und über<br />
– Eigenschaften, Bemessung, Prüfung,<br />
Schutz und Instandhaltung der Betriebsmittel<br />
und Anlagen.<br />
VDE-Leitl<strong>in</strong>ien<br />
Sieenthalten sicherheitstechnische Festlegungen<br />
als Beispielsammlung mit wesentlich<br />
erweitertem Entscheidungsspielraum<br />
für eigenverantwortliches Handeln<br />
des Anwenders.<br />
Beiblätter<br />
Sie enthalten zusätzliche Informationen<br />
zu den Bestimmungen und Leitl<strong>in</strong>ien ohne<br />
zusätzliche Festlegungen mit normativem<br />
Charakter.<br />
Die vom Verband Deutscher Elektrotechniker e. V. und<br />
vom Deutschen Institut für Normung e. V. als privatwirtschaftliche<br />
Organisationen <strong>in</strong> freier Selbstverwaltung<br />
herausgegebenen und zur Anwendung empfohlenen<br />
Bestimmungen und Regeln haben für sich alle<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e<br />
Gesetzeskraft. Aus rechtlicher Sicht haben sie nur<br />
Rechtsnormqualität.
Internationale Organisationen<br />
Bezeichnungen Bemerkungen<br />
IEC<br />
International Electrotechnical Commission;<br />
Internationale Elektrotechnische Kommission<br />
ISO<br />
International Organization for Standardization;<br />
Internationale Organisation für Normung<br />
CENELEC<br />
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique;<br />
Europäisches Komitee für elektrotechnische<br />
Normung<br />
CEN<br />
Comité Européen de Normalisation;<br />
Europäisches Komitee für Normung<br />
Nationale Organisationen<br />
Bezeichnungen Bemerkungen<br />
DIN<br />
Deutsches Institut für Normung e. V.<br />
VDE<br />
Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.<br />
DKE<br />
Deutsche Elektrotechnische Kommission<br />
im DIN und VDE<br />
<strong>16</strong>.2 Schutzziele<br />
1906 gegründet; Mitglieder s<strong>in</strong>d die Nationalen<br />
Komitees von 44 Ländern; Sitz ist Genf<br />
Nichtelektrische Normung; Sitz ist Genf<br />
Nationale Normen und Vorschriften der Europäischen<br />
Geme<strong>in</strong>schaft (EG) vere<strong>in</strong>heitlichen oder<br />
durch „harmonisierte Normen“ ersetzen; Sitz ist Genf<br />
Nichtelektrische Normung der EG;<br />
Sitz ist Genf<br />
Herausgabe „Deutscher Normen“ für fast alle<br />
technischen und naturwissenschaftlichen<br />
Bereiche<br />
Gründung am 22. 1. 1893 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />
Herausgabe von Bestimmungen und Leitl<strong>in</strong>ien<br />
für das Herstellen elektrischer Betriebsmittel,<br />
Errichten und Betreiben elektrischer Anlagen, Festlegungen<br />
über Eigenschaften, Bemessung, Prüfung<br />
und Schutz elektrischer Anlagen; Prüfen von Erzeugnissen<br />
durch VDE-Prüfstelle, die bereits 1920<br />
gegründet wurde.<br />
Gründung 1970 zur Harmonisierung der<br />
nationalen Normen mit den <strong>in</strong>ternationalen Bestimmungen.<br />
Tab. <strong>16</strong>-2 Organisationen für die Normung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen<br />
Das heißt:<br />
Die Norm<br />
● ist ke<strong>in</strong>e zw<strong>in</strong>gende Verpflichtung, sondern e<strong>in</strong>e<br />
Empfehlung<br />
● kennzeichnet den Stand der Technik zum Zeitpunkt<br />
der Herausgabe und<br />
● kann durch gesetzliche Regelungen verb<strong>in</strong>dlich<br />
werden, z. B. durch<br />
– das Energiewirtschaftsgesetz<br />
(2. DVO zum EnWG)<br />
– die Unfallverhütungsvorschriften BGV A2, „Elektrische<br />
Anlagen und Betriebsmittel“<br />
– das Gerätesicherheitsgesetz.<br />
Grundlage der Aussagen <strong>in</strong> diesem Abschnitt ist<br />
DIN VDE 0100-410: 2007-06<br />
Errichten von <strong>Niederspannungsanlagen</strong><br />
Teil 4 – 41: <strong>Schutzmaßnahmen</strong> – Schutz gegen<br />
elektrischen Schlag<br />
Diese Sicherheitsgrundnorm behandelt geme<strong>in</strong>same<br />
Bestimmungen für elektrische Anlagen und Betriebsmittel<br />
zum Schutz von Personen und Nutztieren.<br />
H<strong>in</strong>weis: Für den Anwender e<strong>in</strong>er Norm ist nur die<br />
Norm selbst <strong>in</strong> ihrer neuesten Ausgabe maßgebend.<br />
<strong>16</strong><br />
285
<strong>16</strong><br />
286<br />
<strong>16</strong>.2 Schutzziele<br />
Für die Tätigkeiten im Berufsfeld Elektrotechnik s<strong>in</strong>d<br />
somit folgende grundlegende Vorschriften zu beachten<br />
(Abb. <strong>16</strong>-6):<br />
Basisvorschriften<br />
zum Fertigen<br />
elektrischer<br />
Betriebsmittel<br />
zum Errichten und<br />
Betreiben<br />
elektrischer Anlagen<br />
<strong>in</strong>sbesondere für<br />
Anlagen der Energietechnik,<br />
sog.<br />
Starkstromanlagen<br />
und speziell zur<br />
Gewährleistung des<br />
Schutzes der<br />
Anlagenbetreiber<br />
(meist Laien)<br />
Zusatzvorschriften<br />
für den<br />
Anschluss der<br />
elektrischen Anlagen<br />
an das öffentliche<br />
Versorgungsnetz<br />
und für den<br />
Errichter und Instandhalter<br />
der elektrischen<br />
Anlagen<br />
Abb. <strong>16</strong>-6 Vorschriften der Elektrotechnik<br />
DIN/VDE-Vorschriften<br />
VDE-Vorschriften<br />
der Gruppe 1<br />
– Energieanlagen<br />
VDE 0100-410<br />
Errichten von <strong>Niederspannungsanlagen</strong><br />
<strong>Schutzmaßnahmen</strong>;<br />
Schutz gegen elektrischen<br />
Schlag<br />
Technische<br />
Anschlussbed<strong>in</strong>gungen<br />
der<br />
Verteilungsnetzbetreiber<br />
TAB der VNB<br />
Unfallverhütungsvorschriften<br />
– Elektrische<br />
Anlagen und Betriebsmittel<br />
der<br />
Berufsgenossenschaft<br />
Fe<strong>in</strong>mechanik und<br />
Elektrotechnik<br />
UVV der BGVE<br />
<strong>16</strong>.2.3 Schutzebenen<br />
Beim Berühren z. B. von Außenleitern,<br />
des Neutralleiters,<br />
e<strong>in</strong>er Motorwicklung, also von<br />
Teilen, die betriebsmäßig unter<br />
Spannung stehen, fließen<br />
durch den Menschen gefährliche<br />
Körperströme (Abb. <strong>16</strong>-<br />
7a). Deshalb muss das Berühren<br />
aktiver Teile z. B. durch<br />
Isolierung oder Abdeckung<br />
aktive<br />
Teile<br />
verh<strong>in</strong>dert werden – Basisschutz –<br />
Bei e<strong>in</strong>em Isolationsfehler<br />
können<br />
– berührbare, leitfähige Teile<br />
e<strong>in</strong>es elektrischen Betriebsmittels,<br />
die nicht zum<br />
Betriebsstromkreis<br />
gehören, z. B. e<strong>in</strong>e Metallabdeckung<br />
oder<br />
– Teile, die nicht zur elektrischen<br />
Anlage gehören, jedoch<br />
e<strong>in</strong> elektrisches Potenzial<br />
übertragen können,<br />
z. B. metallene Rohrsysteme<br />
(Abb. <strong>16</strong>-7b), ebenfalls<br />
beim Berühren zu gefährlichen<br />
Körperströmen führen.<br />
Da die sog. Körper und<br />
fremden leitfähigen Teile<br />
berührbar s<strong>in</strong>d, müssen<br />
entsprechende <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
beim Berühren wirksam<br />
werden, z. B. Schutz<br />
durch Abschalten und der<br />
Schutzpotenzialausgleich.<br />
Außenleiter<br />
Motorwicklung<br />
L1 L2 L3<br />
L1 L2 L3<br />
Metallrohr<br />
Isolierung<br />
I T<br />
leitfähige<br />
Abdeckung<br />
I T<br />
Schutz gegen<br />
direktes Berühren<br />
Körper<br />
fremde<br />
leitfähige<br />
Teile<br />
– Fehlerschutz –<br />
Schutz beim<br />
<strong>in</strong>direkten<br />
Berühren<br />
Abb. <strong>16</strong>-7a<br />
Gefährdung<br />
beim direkten<br />
Berühren<br />
Abb. <strong>16</strong>-7b<br />
Gefährdung<br />
beim <strong>in</strong>direkten<br />
Berühren
Die genannten Maßnahmen zum Verh<strong>in</strong>dern gefährlicher<br />
Berührungsströme werden den Schutzebenen<br />
Basis- und Fehlerschutz zugeordnet (Abb. <strong>16</strong>-8). Bei<br />
e<strong>in</strong>er erhöhten Gefährdung wird zusätzlich für bestimmte<br />
Bereiche sogar e<strong>in</strong> Schutz beim direkten<br />
Berühren gefordert.<br />
Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass sowohl für<br />
den Fachmann als auch für den Laien der oberste<br />
Grundsatz gelten muss:<br />
Arbeite an elektrischen Anlagen nur im spannungsfreien<br />
Zustand!<br />
Für das Herstellen und Sichern des spannungsfreien<br />
Zustandes gelten folgende Grundforderungen als<br />
sicherheitstechnische Regeln <strong>in</strong> zw<strong>in</strong>gender Reihenfolge:<br />
1. Allpolig und allseitig abschalten<br />
d. h. es s<strong>in</strong>d alle Leiter L1, L2, L3 und N bzw. L+<br />
und L– der Netze zu trennen. Bei e<strong>in</strong>er zweiseitigen<br />
E<strong>in</strong>speisung ist jeder Anschluss zu trennen.<br />
Deshalb<br />
– Öffnen des Schalters, <strong>in</strong> Hochspannungsanlagen<br />
ist e<strong>in</strong>e sichtbare Trennstrecke herzustellen<br />
oder<br />
– Ziehen des Netzsteckers oder<br />
– Entladen von Kondensatoren.<br />
2. Gegen Wiedere<strong>in</strong>schalten sichern<br />
d. h. e<strong>in</strong> Zuschalten der Spannung aus Unkenntnis<br />
der Situation muss verh<strong>in</strong>dert werden. Deshalb<br />
– sicheres Verwahren der Schmelze<strong>in</strong>sätze oder<br />
– Arretieren von Schalterantrieben oder<br />
– Anbr<strong>in</strong>gen von Warnschildern <strong>in</strong> Hochspannungsanlagen<br />
(U > 1 kV).<br />
3. Spannungsfreiheit feststellen<br />
d. h. am Arbeitsort ist die Potenzialfreiheit festzustellen.<br />
Deshalb<br />
– optische Kontrolle, dass die Geräte vom Netz<br />
getrennt s<strong>in</strong>d, oder<br />
– Feststellen mit Spannungssucher oder Multimeter,<br />
deren e<strong>in</strong>wandfreie Funktion unmittelbar<br />
vor und nach der Nutzung geprüft werden muss,<br />
oder<br />
– <strong>in</strong> Hochspannungsanlagen Feststellen mit berührungslosem<br />
Spannungsanzeiger.<br />
Zusätzlich ist <strong>in</strong> Hochspannungsanlagen<br />
U > 1 kV erforderlich:<br />
4. Erden und Kurzschließen<br />
d. h. an der Schaltstelle und am Arbeitsort s<strong>in</strong>d die<br />
aktiven Leiter zu erden und untere<strong>in</strong>ander nahezu<br />
widerstandslos zu verb<strong>in</strong>den.<br />
5. Gegen benachbarte, unter Spannung stehende<br />
Teile schützen<br />
d. h. e<strong>in</strong> zufälliges Berühren der im Arbeitsbereich<br />
bef<strong>in</strong>dlichen spannungsführenden Teile anderer<br />
Stromkreise ist zu verh<strong>in</strong>dern.<br />
<strong>16</strong>.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
Schutzebene Maßnahmen Anwendung<br />
Basisschutz<br />
Fehlerschutz<br />
Zusatzschutz<br />
zum<br />
Schutz gegen<br />
direktes Berühren<br />
Schutz beim<br />
<strong>in</strong>direkten Berühren<br />
Verstärkung des<br />
Basisschutzes<br />
oder<br />
Ergänzung des<br />
Fehlerschutzes<br />
Pflicht<br />
Pflicht<br />
Teil e<strong>in</strong>er Schutzmaßnahme<br />
unter<br />
• besonderen äußeren<br />
E<strong>in</strong>flüssen und<br />
• <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen speziellen<br />
Bereichen<br />
Abb. <strong>16</strong>-8 Schutzebenen zum Verh<strong>in</strong>dern gefährlicher<br />
Körperströme<br />
<strong>16</strong>.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen<br />
an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
<strong>16</strong>.3.1 Anwendung und Ausnahmen<br />
Die Grundregel des Schutzes gegen elektrischen<br />
Schlag lautet:<br />
– Gefährliche aktive Teile dürfen nicht erreichbar,<br />
d. h. nicht berührbar se<strong>in</strong> und<br />
– erreichbare leitfähige Teile, die nicht zum Betriebsstromkreis<br />
gehören, dürfen weder unter normalen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen noch unter E<strong>in</strong>fehlerbed<strong>in</strong>gungen<br />
aktiv, damit gefährlich spannungsführend<br />
werden.<br />
Der Schutz unter normalen Bed<strong>in</strong>gungen wird durch<br />
die Vorkehrungen des Basisschutzes gewährleistet,<br />
bisher als Schutz gegen direktes Berühren bezeichnet.<br />
Der Schutz unter E<strong>in</strong>fehlerbed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d die Maßnahmen<br />
des Fehlerschutzes, bekannt als Schutz bei<br />
<strong>in</strong>direktem Berühren. Alternativ zu beiden Vorkehrungen<br />
kann der Schutz gegen elektrischen Schlag auch<br />
durch e<strong>in</strong>e verstärkte Schutzvorkehrung hergestellt<br />
werden (Abb.<strong>16</strong>-9).<br />
Basisschutz<br />
Schutz gegen elektrischen Schlag<br />
als<br />
Schutz unter normalen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen<br />
durch<br />
und<br />
alternativ<br />
durch<br />
verstärkte<br />
Schutzvorkehrungen<br />
Fehlerschutz<br />
als<br />
Schutz unter E<strong>in</strong>fehlerbed<strong>in</strong>gungen<br />
Abb. <strong>16</strong>-9 Schutz gegen elektrischen Schlag<br />
<strong>16</strong><br />
287
<strong>16</strong><br />
288<br />
<strong>16</strong>.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
E<strong>in</strong>e Schutzmaßnahme muss stets<br />
– aus e<strong>in</strong>er geeigneten Komb<strong>in</strong>ation e<strong>in</strong>er Basisschutzvorkehrung<br />
und e<strong>in</strong>er unabhängigen Vorkehrung<br />
des Fehlerschutzes<br />
oder<br />
– e<strong>in</strong>er verstärkten Schutzvorkehrung bestehen, die<br />
gleichzeitig den Basis- und den Fehlerschutz gewährleistet.<br />
Als Teil e<strong>in</strong>er Schutzmaßnahme wird unter bestimmten<br />
Bed<strong>in</strong>gungen der äußeren E<strong>in</strong>flüsse und <strong>in</strong> besonderen<br />
Räumen e<strong>in</strong> zusätzlicher Schutz gefordert.<br />
In jedem Teil e<strong>in</strong>er elektrischen Anlage müssen e<strong>in</strong>e<br />
oder mehrere <strong>Schutzmaßnahmen</strong> angewendet werden.<br />
Sie s<strong>in</strong>d mitbestimmend für die Auswahl und die<br />
Installation der Betriebsmittel. Werden <strong>in</strong> derselben<br />
Anlage oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Raum mehrere <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
angewendet, dürfen sie sich gegenseitig <strong>in</strong> ihrer<br />
Schutzwirkung nicht nachteilig bee<strong>in</strong>flussen.<br />
Von den neun <strong>Schutzmaßnahmen</strong> s<strong>in</strong>d vier allgeme<strong>in</strong><br />
sowohl <strong>in</strong> elektrischen Anlagen der Industrie, des Gewerbes<br />
und auch des Wohnungsbaus erlaubt, die restlichen<br />
dagegen nur e<strong>in</strong>geschränkt.<br />
So dürfen Anlagen mit oder ohne Fehlerschutz mit<br />
Vorkehrungen des Basisschutzes unter besonderen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen nur zugänglich se<strong>in</strong> durch<br />
Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene<br />
Personen bzw. solche, die beaufsichtigt werden.<br />
In den Anlagen mit Basisschutz unter normalen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen, die ausschließlich durch Elektrofachkräfte<br />
oder elektrotechnisch unterwiesene Personen<br />
überwacht werden, dürfen spezielle Vorkehrungen<br />
des Fehlerschutzes angewendet werden<br />
(Abb. <strong>16</strong>-10).<br />
Damit soll ausgeschlossen werden, dass unbefugte<br />
Änderungen <strong>in</strong> der elektrischen Anlage vorgenommen<br />
werden.<br />
Allgeme<strong>in</strong> erlaubte <strong>Schutzmaßnahmen</strong> können auch<br />
unter den Gesichtspunkten der Netzsystemabhängigkeit,<br />
den Schutzzielen und dem Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es<br />
Schutzleiters geordnet werden (Abb. <strong>16</strong>-11).<br />
Können bestimmte e<strong>in</strong>zelne Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>er<br />
Schutzmaßnahme nicht erfüllt werden, müssen zusätzliche<br />
Maßnahmen so angewendet werden, dass<br />
mit den vorhandenen Basisschutz- und Fehlerschutzvorkehrungen<br />
derselbe Sicherheitsgrad erreicht wird.<br />
Dies trifft zum Beispiel bei der Funktionskle<strong>in</strong>spannung<br />
FELV zu.<br />
In Ausnahmefällen kann e<strong>in</strong> Bestandteil e<strong>in</strong>er Schutzmaßnahme<br />
entfallen.<br />
Vorkehrungen des Basisschutzes s<strong>in</strong>d im Allgeme<strong>in</strong>en<br />
<strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>spannungssystemen nicht erforderlich<br />
– bei SELV- und PELV-Systemen, deren Nennspannungen<br />
AC 12 V oder DC 30 V nicht überschreiten<br />
und<br />
– bei normalen, trockenen Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen<br />
für<br />
• SELV-Stromkreise, deren Nennspannung AC 25 V<br />
oder DC 60 V nicht überschreitet sowie<br />
• PELV-Stromkreise, deren Nennspannung AC 25 V<br />
oder DC 60 V nicht überschreitet und deren Körper<br />
und/oder aktiven Teilen durch e<strong>in</strong>en Schutzleiter<br />
mit der Haupterdungsschiene verbunden s<strong>in</strong>d.<br />
System des<br />
Verteilungsnetzbetreibers<br />
Netzsystemabhängige<br />
Maßnahme<br />
NetzsystemunabhängigeMaßnahme<br />
Schutz durch automatische<br />
Abschaltung<br />
der Stromversorgung<br />
Schutz durch<br />
doppelte oder verstärkte<br />
Isolierung<br />
Schutz durch<br />
Schutztrennung zur<br />
Versorgung e<strong>in</strong>es<br />
Verbrauchsmittels<br />
Schutz durch<br />
Kle<strong>in</strong>spannung<br />
SELV und PELV<br />
Schutzziel<br />
Abb. <strong>16</strong>-11 Ordnung der allgeme<strong>in</strong> erlaubten<br />
<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
<strong>Schutzmaßnahmen</strong> gegen elektrischen Schlag<br />
Allgeme<strong>in</strong> erlaubte<br />
<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
<strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
mit e<strong>in</strong>geschränkter<br />
Anwendung<br />
Maßnahme verh<strong>in</strong>dert<br />
das Bestehenbleiben<br />
e<strong>in</strong>er zu hohen<br />
Berührungsspannung<br />
Maßnahme verh<strong>in</strong>dert<br />
das Entstehen e<strong>in</strong>er<br />
zu hohen Berührungsspannung<br />
Schutz<br />
durch automatische<br />
Abschaltung der Stromversorgung<br />
Schutz<br />
durch doppelte oder<br />
verstärkte Isolierung<br />
Schutz<br />
durch Schutztrennung zur<br />
Versorgung e<strong>in</strong>es<br />
Verbrauchsmittels<br />
Schutz<br />
durch Kle<strong>in</strong>spannung<br />
SELV und PELV<br />
Anlagen, die ausschließlich<br />
durch ausgewählte Personen<br />
zugänglich s<strong>in</strong>d<br />
Schutz<br />
durch H<strong>in</strong>dernisse<br />
Schutz<br />
durch Anordnung<br />
außerhalb des Handbereichs<br />
Anlagen, die ausschließlich<br />
durch Elektrofachkräfte<br />
betrieben und überwacht<br />
werden<br />
Schutz<br />
durch nicht leitende<br />
Umgebung<br />
Schutz<br />
durch erdfreien örtlichen<br />
Schutzpotenzialausgleich<br />
Schutz<br />
durch Schutztrennung<br />
mehrerer Verbrauchsmittel<br />
Abb. <strong>16</strong>-10 Systematik der <strong>Schutzmaßnahmen</strong>
Vorkehrungen des Fehlerschutzes dürfen bei folgenden<br />
Betriebsmitteln entfallen:<br />
– Betriebsmittel, die so kle<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d (etwa 50 x 50 mm),<br />
dass sie <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em nennenswerten Kontakt mit dem<br />
menschlichen Körper kommen und der Anschluss e<strong>in</strong>es<br />
Schutzleiters kaum möglich und unzuverlässig<br />
wäre, z. B. Bolzen, Niete, Kabelschellen<br />
– Metallrohre oder andere Metallgehäuse zum Schutz<br />
von Betriebsmitteln mit doppelter oder verstärkter<br />
Isolierung<br />
– Nicht erreichbare Stahlbewehrung von Betonmasten<br />
für Freileitungen<br />
– Metallene Stützen von Freileitungsisolatoren, die<br />
außerhalb des Handbereiches am Gebäude befestigt<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
<strong>16</strong>.3.2 Netzsysteme<br />
Netzsysteme s<strong>in</strong>d hier im S<strong>in</strong>ne des Schutzes gegen<br />
elektrischen Schlag die Versorgungsnetze (regionale<br />
Verteilungsnetze) mit ihren Verbraucheranlagen.<br />
Art und Anzahl der<br />
aktiven Leiter des<br />
Versorgungsnetzes<br />
– Gleichstrom oder<br />
Wechselstrom<br />
– Zweileiter-, Dreileiteroder<br />
Vierleiternetz<br />
Merkmale der Netzsysteme<br />
Art der<br />
Erdverb<strong>in</strong>dungen<br />
– der e<strong>in</strong>speisenden<br />
Stromquelle,<br />
z.B. Sekundärwicklung<br />
des Netztransformators<br />
– der Körper der<br />
Betriebsmittel <strong>in</strong> der<br />
elektrischen Anlage<br />
Für die gebräuchlichen Drehstromnetze ergeben sich<br />
nach der Art der Erdverb<strong>in</strong>dungen die <strong>in</strong> der Tab. <strong>16</strong>-3<br />
aufgeführten Möglichkeiten.<br />
Elemente des<br />
Netzsystems<br />
Merkmale<br />
des<br />
Netzsystems<br />
Stromquelle und Versorgungsnetz<br />
Sekundärwicklung<br />
des Transformators<br />
– alle Netzpunkte s<strong>in</strong>d von Erde isoliert (I)<br />
– Dreileiternetz L1, L2, L3<br />
Vierleiternetz L1, L2, L3, N<br />
Netzpunkt, meist<br />
Sternpunkt des<br />
Transformators<br />
über Betriebserder<br />
geerdet (T)<br />
Tab. <strong>16</strong>-3 Merkmale der Netzsysteme<br />
Drehstromnetz<br />
– Dreileiternetz<br />
oder<br />
– Vierleiternetz<br />
mit Neutralleiter<br />
– Vierleiternetz<br />
mit PEN-Leiter<br />
<strong>16</strong>.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen an <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
– Fünfleiternetzmit<br />
getrenntem Schutzund<br />
Neutralleiter<br />
In den <strong>in</strong>ternational genormten Bezeichnungen der<br />
Netzsysteme bedeutet<br />
● Erster Buchstabe<br />
– Erdungsverhältnisse des Netzes mit Stromquelle<br />
T franz. terre, direkte Erdung e<strong>in</strong>es Punktes<br />
(niederohmiger Betriebserder)<br />
I engl. isolation, Isolierung aller aktiven Leiter<br />
von Erde oder Verb<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>es Punktes mit<br />
Erde über e<strong>in</strong>e Impedanz (hochohmiger Erdungswiderstand)<br />
● Zweiter Buchstabe<br />
– Erdungsverhältnisse der Körper der elektrischen<br />
Betriebsmittel<br />
T Körper direkt geerdet (Anlagenerder, Schutzerder),<br />
unabhängig von e<strong>in</strong>er möglichen Erdung<br />
e<strong>in</strong>es Netzpunktes<br />
N Körper direkt über e<strong>in</strong>en Netzleiter mit dem<br />
Betriebserder verbunden, im Allgeme<strong>in</strong>en der<br />
Sternpunkt der Transformatorenwicklung<br />
● Zusätzliche Buchstaben des TN-Systems<br />
– Anordnung des Neutralleiters und des Schutzleiters<br />
S engl. separated, Realisierung der Neutralleiterfunktion<br />
(Rückleiter) und der Schutzleiterfunktion<br />
durch getrennte Leiter<br />
C engl. comb<strong>in</strong>ed, Neutralleiter- und Schutzleiterfunktion<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Leiter (PEN-Leiter) komb<strong>in</strong>iert.<br />
H<strong>in</strong>weis:<br />
P E N - Leiter<br />
engl. neutral, Neutralleiterfunktion<br />
engl. earth, geerdeter Leiter<br />
engl. protection, Schutzleiterfunktion<br />
In den Netzsystemen der Abb. <strong>16</strong>-12 s<strong>in</strong>d die Leiter<br />
ihrem Verwendungszweck entsprechend nach DIN gekennzeichnet:<br />
PE<br />
Schutzleiter<br />
PEN<br />
N<br />
Verbraucheranlage<br />
e<strong>in</strong>phasige und<br />
dreiphasige Verbrauchsmittel<br />
Körper der<br />
Betriebsmittel s<strong>in</strong>d<br />
geerdet (T)<br />
Körper der<br />
Betriebsmittel s<strong>in</strong>d<br />
geerdet (T)<br />
Körper der<br />
Betriebsmittel s<strong>in</strong>d<br />
über Netzleiter (N)<br />
direkt mit Betriebserder<br />
verbunden<br />
PEN-Leiter<br />
Neutralleiter<br />
Bezeichnung<br />
IT-System<br />
TT-System<br />
TN-C-System<br />
TN-S-System<br />
<strong>16</strong><br />
289
<strong>16</strong><br />
<strong>16</strong>.4 Allgeme<strong>in</strong> erlaubte <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
Betriebserder<br />
Betriebserder<br />
Betriebserder<br />
Körper<br />
Körper<br />
IT-System<br />
290 Abb. <strong>16</strong>-12 Systeme und Erdverb<strong>in</strong>dungen<br />
PE<br />
TT-System<br />
TN-System<br />
Körper<br />
PE<br />
TN-C-S-System<br />
TN-C-System TN-S-System<br />
A<br />
B<br />
Betriebserder<br />
Körper<br />
TN-C-System<br />
TN-S-System<br />
Körper<br />
Anlagenerder<br />
Anlagenerder<br />
A<br />
B<br />
L1<br />
L2<br />
L3<br />
L1<br />
L2<br />
L3<br />
N<br />
L1<br />
L2<br />
L3<br />
PE<br />
N<br />
L1<br />
L2<br />
L3<br />
PEN<br />
L1<br />
L2<br />
L3<br />
N<br />
PE<br />
<strong>16</strong>.4 Allgeme<strong>in</strong> erlaubte <strong>Schutzmaßnahmen</strong><br />
<strong>16</strong>.4.1 Vorkehrungen des Basisschutzes<br />
unter normalen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
Maßnahmen des Basisschutzes sollen das unbeabsichtigte<br />
oder beabsichtigte Berühren aktiver Teile<br />
durch Personen und Nutztiere verh<strong>in</strong>dern.<br />
Aktive Teile s<strong>in</strong>d solche, die bei e<strong>in</strong>em ungestörten Betrieb<br />
unter Spannung stehen, also<br />
– im Drehstromnetz die Außenleiter L1; L2; L3 und der<br />
Neutralleiter N,<br />
H<strong>in</strong>weis:<br />
Vere<strong>in</strong>barungsgemäß nicht der PEN-Leiter!<br />
– Im Gleichstromnetz der Plusleiter L+ , der M<strong>in</strong>usleiter<br />
L– und der Mittelleiter M.<br />
– In den Betriebsmitteln alle leitfähigen Teile, die<br />
zum Betriebsstromkreis gehören, z. B. die Klemmen<br />
der Abzweigdosen, die Wicklungen der Transformatoren<br />
und Motoren, die Kabelschuhe <strong>in</strong> den<br />
Endverschlüssen.<br />
Die folgenden Maßnahmen sehen den Schutz unter<br />
normalen Bed<strong>in</strong>gungen vor und s<strong>in</strong>d dort zu verwenden,<br />
wo sie als e<strong>in</strong> Teil der gewählten Schutzmaßnahme<br />
festgelegt s<strong>in</strong>d.<br />
Maßnahmen des Basisschutzes<br />
Basisisolierung<br />
aktiver Teile<br />
Abdeckungen oder<br />
Umhüllungen<br />
Vollständiger Schutz gegen absichtliches und unabsichtliches<br />
Berühren aktiver Teile<br />
Die Realisierung dieser Maßnahmen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regel<br />
nicht Aufgabe des Anlagenerrichters, d. h. den Basisschutz<br />
vor Ort herzustellen. Vielmehr s<strong>in</strong>d diese Vorkehrungen<br />
überwiegend herstellerseitig bei den zu<br />
<strong>in</strong>stallierenden Betriebsmitteln <strong>in</strong> ihrer konstruktiven<br />
Ausführung <strong>in</strong>tegriert.<br />
Basisisolierung aktiver Teile<br />
Grundlegende Forderungen:<br />
– Die Isolierung muss die aktiven Teile vollständig abdecken.<br />
– Sie darf nur durch Zerstörung entfernt werden können.<br />
– Die Isolierung von Betriebsmitteln muss mit der für<br />
sie zuständigen Norm übere<strong>in</strong>stimmen.<br />
Beachte: Farben und Lacke s<strong>in</strong>d für sich alle<strong>in</strong> ke<strong>in</strong><br />
ausreichender Schutz gegen direktes Berühren.<br />
Der Isolierlack e<strong>in</strong>es Spulendrahtes ist deshalb nur e<strong>in</strong>e<br />
Betriebsisolierung<br />
, die e<strong>in</strong>en W<strong>in</strong>dungsschluss<br />
verh<strong>in</strong>dert, damit den ungestörten<br />
Betrieb ermöglichen<br />
soll.
17<br />
330<br />
17 Installationsanlagen<br />
unter<br />
„normalen“ Bed<strong>in</strong>gungen<br />
17.1<br />
Elektro<strong>in</strong>stallation<br />
<strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
• Hausanschluss<br />
• Schutzpotenzialausgleich<br />
• Hauptstromversorgung<br />
• Zählerplatz<br />
• Stromkreisverteiler<br />
• Wohnungs<strong>in</strong>stallation<br />
Abb. 17-1 Beziehungen und Strukturen<br />
Anforderungsgerechte Verteilung<br />
sowie exakte Messung und Verrechnung<br />
der Elektroenergie <strong>in</strong> der Verbraucheranlage<br />
Automatisierung<br />
von Funktionsabläufen<br />
17.3<br />
Busvernetzte<br />
Installationssysteme<br />
• Hausleittechnik<br />
• Gebäudesystemtechnik (EIB)<br />
17.4<br />
Auswahl und Bemessung<br />
der Installationsleitungen<br />
• Mechanische Festigkeit<br />
• Strombelastbarkeit<br />
• Spannungsfall<br />
• Überstromschutz<br />
unter Berücksichtigung<br />
zusätzlicher Bed<strong>in</strong>gungen<br />
17.2<br />
Elektro<strong>in</strong>stallation<br />
<strong>in</strong> Räumen und Anlagen<br />
besonderer Art<br />
• Landwirtschaftliche Betriebsstätten<br />
• Mediz<strong>in</strong>isch genutzte Bereiche<br />
• Feuergefährdete Betriebsstätten<br />
• Baustellen<br />
• Camp<strong>in</strong>gplätze
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong><br />
Wohngebäuden<br />
17.1.1 Hausanschluss<br />
und Hausanschlussraum<br />
Die elektrische Verb<strong>in</strong>dung zwischen dem Niederspannungs-Verteilungsnetz<br />
und der Anlage des<br />
Abnehmers (Kunden) wird als Hausanschluss bezeichnet.<br />
Hausanschlüsse können aus e<strong>in</strong>em Kabel- oder e<strong>in</strong>em<br />
Freileitungsnetz gespeist werden. Jeder Hausanschluss<br />
endet am Hausanschlusskasten (HAK). In ihm<br />
s<strong>in</strong>d die Hausanschlusssicherungen untergebracht.<br />
Die Art des Hausanschlusses und die Anordnung des<br />
Hausanschlusskastens legt der zuständige Netzbetreiber<br />
fest.<br />
Freileitungsnetz Kabelnetz<br />
Freileitungsanschluss Kabelanschluss<br />
Dachständer-<br />
Anschluss<br />
Montagefläche<br />
für Zählerschrank<br />
bei<br />
zentraler<br />
Zählanlage<br />
Wand-Anschluss<br />
Hausanschlusskasten<br />
Hauptleitung<br />
Heizungsvorlauf<br />
Heizungsrücklauf<br />
Gas<strong>in</strong>nenleitung<br />
Fernmeldeleitung<br />
m<strong>in</strong>d. 1800<br />
m<strong>in</strong>destens 2000<br />
Hausanschlusskasten<br />
≥ 500<br />
m<strong>in</strong>d. 2000<br />
Gebäudeaußenwand<br />
Abb. 17-2 Hausanschlussraum<br />
Erdgleiche<br />
Haupterdungsschiene<br />
Frischwasserleitung<br />
Gas-, Wasser- und<br />
Heizungs<strong>in</strong>stallation<br />
Elektro<strong>in</strong>stallation<br />
Fernmeldeleitung<br />
Isolierstück<br />
Fundamenterder<br />
Abwasserleitung<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
In Neuanlagen wird der Kabelanschluss bevorzugt. Die<br />
Wünsche des Projektanten (bzw. des Bauherrn) oder<br />
auch die des Elektro-Fachbetriebes, der die nachfolgende<br />
Abnehmeranlage errichtet, werden nach Möglichkeit<br />
berücksichtigt. Der Hausanschluss wird vom<br />
Netzbetreiber selbst oder <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Auftrag errichtet.<br />
Der HAK gehört zur Anlage des Netzbetreibers. An den<br />
abgehenden Anschlussstellen beg<strong>in</strong>nt die Abnehmeranlage.<br />
Der Netzbetreiber stellt e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>usförmige Dreiphasen-<br />
Wechselspannung mit der Frequenz f = 50 Hz und den<br />
Nennspannungen 400 V (zwischen den Außenleitern)<br />
und 230 V (zwischen e<strong>in</strong>em Außenleiter und dem Neutralleiter<br />
bzw. PEN-Leiter) zur Verfügung. Die tatsächliche<br />
Betriebsspannung am Übergabepunkt darf von der<br />
Nennspannung <strong>in</strong> den zulässigen Grenzen (±10 %)<br />
abweichen.<br />
Hausanschlussraum<br />
Für größere Wohngebäude (und Gebäude mit anderer<br />
Nutzung) wird e<strong>in</strong> Hausanschlussraum gefordert, <strong>in</strong><br />
dem der Hausanschlusskasten angeordnet werden<br />
kann. Der Bauherr hat dafür die baulichen Voraussetzungen<br />
zu schaffen. Bei Gebäuden bis zu vier<br />
Wohne<strong>in</strong>heiten besteht diese Forderung nicht.<br />
Die Netzbetreiber verlangen bei Gebäuden mit<br />
mehreren Wohne<strong>in</strong>heiten (bzw. bei Gebäuden vergleichbarer<br />
Größe, die nicht Wohnzwecken dienen)<br />
meist e<strong>in</strong>en gesonderten Hausanschlussraum.<br />
E<strong>in</strong> solcher Raum muss an der Gebäudeaußenwand<br />
liegen. Durch diese werden neben dem Elektroanschluss<br />
auch alle anderen Anschlussleitungen<br />
(Wasser, Gas, Fernwärme, …) geführt. Bef<strong>in</strong>den sich<br />
im Hausanschlussraum Anschlüsse anderer Versorgungsträger,<br />
sollte er e<strong>in</strong>e wirksame Entwässerung besitzen<br />
und belüftbar se<strong>in</strong>. Temperaturen unter 0 °C dürfen<br />
nicht auftreten.<br />
Für die Raumgröße gelten M<strong>in</strong>destmaße (Abb. 17-2).<br />
Hausanschlussräume sollen m<strong>in</strong>destens 2m lang,<br />
2 m hoch und 1,80 m breit se<strong>in</strong>.<br />
Im Raum müssen nach der Installation aller für den Betrieb<br />
erforderlichen E<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>e Bedienungsund<br />
Arbeitsfläche von m<strong>in</strong>destens 1,20 m Breite und<br />
e<strong>in</strong>e Durchgangshöhe von wenigstens 1,80 m erhalten<br />
bleiben.<br />
Der Hausanschlussraum darf nicht für andere Zwecke<br />
zusätzlich genutzt werden, er muss über allgeme<strong>in</strong> zugängliche<br />
Räume erreicht werden können und verschließbar<br />
se<strong>in</strong>. Im Raum müssen e<strong>in</strong>e Leuchte mit<br />
Schalter an der Tür und für Wartungsarbeiten e<strong>in</strong>e<br />
Steckdose vorhanden se<strong>in</strong>. Bei nicht unterkellerten<br />
Gebäuden darf sich der Hausanschlussraum im Erdgeschoss<br />
bef<strong>in</strong>den.<br />
Kabelanschluss<br />
Das Kabel wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Tiefe von 0,60 m … 0,80 m unterhalb<br />
der Geländeoberfläche <strong>in</strong> den Hausanschlussraum<br />
e<strong>in</strong>geführt. Durch die Gebäudeaußenwand wird<br />
das Kabel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Schutzrohr geführt, das wasser-<br />
17<br />
331
17<br />
332<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
dicht abgeschlossen wird und e<strong>in</strong> Gefälle nach außen<br />
hat (Abb. 17-3).<br />
Der Leiterquerschnitt des Kabels, die Größe des Hausanschlusskastens<br />
und die für den Hausanschluss zu<br />
wählenden NH-Sicherungen werden durch die Zahl<br />
der zu versorgenden Wohnungen und durch die Art ihrer<br />
Versorgung (mit oder ohne elektrische Warmwasserzubereitung,<br />
mit oder ohne elektrische Speicherheizung)<br />
bestimmt. Die Festlegung hierzu trifft der<br />
VNB <strong>in</strong> Absprache mit der verantwortlichen Fachkraft<br />
des Elektro<strong>in</strong>stallationsbetriebes, der die Abnehmeranlage<br />
errichtet.<br />
Freileitungsanschluss<br />
Die Gebäudee<strong>in</strong>führung kann durch das Dach (Dachständere<strong>in</strong>führung)<br />
oder durch die Wand (Wande<strong>in</strong>führung)<br />
erfolgen. Die Anschlüsse müssen stets so<br />
ausgeführt werden, dass e<strong>in</strong> möglicher Lichtbogen-<br />
Kurzschluss ke<strong>in</strong>e Gefahr für das Entstehen e<strong>in</strong>es<br />
Brandes am Gebäude darstellt. Mantelleitungen und<br />
Kabel können ohne besonderen Schutz durch nichtbrennbare<br />
Wände geführt werden. Bei brennbaren<br />
Wänden muss die Verlegung <strong>in</strong> bzw. auf lichtbogenfesten<br />
Materialien erfolgen.<br />
Dachständer belasten das Dachgebälk. Es muss e<strong>in</strong>e<br />
genügend hohe Festigkeit besitzen, um den Leitungszug<br />
aufnehmen zu können. Über den Standort des<br />
Dachständers entscheidet der Netzbetreiber. Die E<strong>in</strong>führungsleitung<br />
<strong>in</strong> das Gebäude wird durch das Dachständerrohr<br />
geführt. Der Hausanschlusskasten wird<br />
unmittelbar an oder unter dem Rohr angebracht. Dachständer<br />
<strong>in</strong> Normalausführung dürfen nur <strong>in</strong> nicht feuergefährdeten<br />
und trockenen Räumen enden.<br />
Dachständer dürfen nicht direkt geerdet werden, um<br />
bei Berühren e<strong>in</strong>es Außenleiters mit dem Ständer Erdschlussströme<br />
und damit verbundene Brandgefahren<br />
auszuschließen.<br />
Dachständer dürfen wegen der Gefahr e<strong>in</strong>es Brandes<br />
durch Erdschluss weder geerdet noch mit dem<br />
Schutzleiter des versorgenden Netzes verbunden<br />
werden.<br />
700<br />
Erdgleiche<br />
Mauerdurchführung<br />
Schutzrohr<br />
Gefälle nach außen<br />
Kabelgrabensohle<br />
Abb. 17-3 Wasserdichte Kabele<strong>in</strong>führung<br />
Keller<br />
Hausanschlussraum<br />
Abdichtr<strong>in</strong>g<br />
7 500<br />
Zementmörtel-<br />
Abdichtung<br />
Als Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag <strong>in</strong><br />
Standrohrnähe sollte der Standort ausreichend isoliert<br />
werden (Schutz durch nicht leitende Räume). Bei e<strong>in</strong>er<br />
vorhandenen Anlage für den äußeren Blitzschutz muss<br />
das Dachständerrohr über e<strong>in</strong>e Schutzfunkenstrecke<br />
<strong>in</strong> diese Anlage e<strong>in</strong>bezogen werden (vgl. dazu Abschnitt<br />
24.2). Alle Hausanschlüsse mit Freileitungsanschluss<br />
müssen so gestaltet werden, dass e<strong>in</strong>e spätere<br />
Umstellung auf e<strong>in</strong>en Kabelanschluss e<strong>in</strong>fach vorzunehmen<br />
ist. Es wird empfohlen, vom Zählerplatz <strong>in</strong><br />
den Keller e<strong>in</strong> Leerrohr mit m<strong>in</strong>destens 36 mm lichter<br />
Weite zu verlegen. Dieses kann (vorläufig) den Potenzialausgleichsleiter<br />
(TN-System) bzw. den Hauptschutzleiter<br />
(TT-System) aufnehmen, der den Zählerplatz<br />
mit der Haupterdungschiene verb<strong>in</strong>det.<br />
17.1.2 Schutzpotenzialausgleich über die<br />
Haupterdungsschiene<br />
Die elektrische Anlage bildet <strong>in</strong> den Gebäuden geme<strong>in</strong>sam<br />
mit den Wasser-, Gas- und Heizungssystemen<br />
e<strong>in</strong> verzweigtes Netz leitfähiger Teile. Diese bestehen<br />
teils unabhängig nebene<strong>in</strong>ander, teils s<strong>in</strong>d sie<br />
mite<strong>in</strong>ander verbunden. Fehler und Mängel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Leitungssystem können sich ungünstig auf e<strong>in</strong> anderes<br />
System auswirken. Dies gilt ganz besonders wegen<br />
der Möglichkeit des Verschleppens elektrischer Spannungen.<br />
Um beim Auftreten solcher Mängel e<strong>in</strong>e Schutzwirkung<br />
gegen Berührungsspannungen zu erzielen, wird e<strong>in</strong><br />
Schutzpotenzialausgleich zwischen allen metallenen<br />
Systemen gefordert. Durch e<strong>in</strong>e widerstandsarme<br />
Verb<strong>in</strong>dung aller dieser Teile wird ihnen e<strong>in</strong> (annähernd)<br />
gleiches Potenzial vermittelt. Die Spannungen,<br />
die im Fehlerfall zwischen verschiedenen Rohrsystemen<br />
auftreten können, werden durch den Schutzpotenzialausgleich<br />
stark herabgesetzt oder ganz vermieden<br />
(Abb. 17-4).<br />
Der Schutzpotenzialausgleich über die Haupterdungsschiene<br />
(früher: Hauptpotenzialausgleich) soll an zentraler<br />
Stelle nahe dem Hausanschlusskasten (meist im<br />
Hausanschlussraum) vorgenommen werden. Durch<br />
Anschluss an e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> das Gebäudefundament e<strong>in</strong>gelegten<br />
Erder wird das Potenzial vorgegeben und gleich<br />
bleibend festgelegt. Alle Rohrleitungssysteme werden<br />
über die Schutzpotenzialausgleichsleitungen untere<strong>in</strong>ander<br />
und durch den Schutzleiter auch mit den Körpern<br />
der Verbrauchsmittel verbunden.<br />
Durch den Schutzpotenzialausgleich über die<br />
Haupterdungsschiene (früher: Hauptpotenzialausgleich)<br />
werden Potenzialunterschiede zwischen leitfähigen<br />
Rohrsystemen untere<strong>in</strong>ander und zwischen<br />
diesen und den Körpern der elektrischen Verbrauchsmittel<br />
weitgehend vermieden.<br />
Fundamenterder<br />
Der <strong>in</strong> das Gebäudefundament e<strong>in</strong>gelegte Erder<br />
besteht meist aus verz<strong>in</strong>ktem Rund- oder Bandstahl.<br />
Der Durchmesser muss wenigstens 10 mm betragen<br />
(Abb. 17-5). Beim Bandstahl s<strong>in</strong>d die Abmessungen<br />
25 mm x 4 mm bzw. 30 mm x 3,5 mm.
a)<br />
Fehlerstelle<br />
b)<br />
z. B. NYM-Leitung<br />
Fehlerstelle<br />
z. B. NYM-Leitung<br />
Rohrsystem 1<br />
Rohrsystem 1<br />
z. B. U B > 50 V<br />
Rohrsystem 2<br />
Rohrsystem 2<br />
Abb. 17-4 Berührungsspannung zwischen benachbarten<br />
metallenen Systemen<br />
a) ohne Schutzpotenzialausgleich<br />
b) mit Schutzpotenzialausgleich<br />
Anschlussfahne<br />
Hausanschlussraum<br />
U B = 0 V<br />
Schutzpotenzialausgleichsleiter<br />
Fundamenterder<br />
Abb. 17-5 Fundamenterder, Anordnung im E<strong>in</strong>zelhaus<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
Der Fundamenterder ist als geschlossener R<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />
die Fundamente der äußeren Gebäudemauern unterhalb<br />
der Sperrschicht e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen.<br />
Durch Abstandhalter ist beim E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen des Betons <strong>in</strong><br />
das Fundament der Stahl so zu positionieren, dass er<br />
allseitig von Beton umhüllt wird. Verb<strong>in</strong>dungen <strong>in</strong>nerhalb<br />
des Erders und für Anschlussfahnen s<strong>in</strong>d durch<br />
Schweiß-, Schraub- oder Keilverb<strong>in</strong>dung herzustellen<br />
(Abb. 17-6).<br />
E<strong>in</strong>e Anschlussfahne des Fundamenterders wird <strong>in</strong><br />
den Hausanschlussraum geführt. Ihre Länge ist so zu<br />
bemessen, dass e<strong>in</strong> direkter Anschluss an die Haupterdungsschiene<br />
erfolgen kann. An der Austrittsstelle<br />
der Anschlussfahne aus dem Beton muss diese gegen<br />
Korrosion geschützt se<strong>in</strong>. Das kann durch e<strong>in</strong>e Korrosionsschutzb<strong>in</strong>de<br />
oder durch Kunststoffummantelung<br />
erfolgen (Abb. 17-7).<br />
S<strong>in</strong>d z. B. für die Anlage des äußeren Blitzschutzes zusätzliche<br />
Anschlüsse an den Fundamenterder erforderlich,<br />
so s<strong>in</strong>d weitere Anschlussfahnen an den vorgesehenen<br />
Stellen anzubr<strong>in</strong>gen (vgl. auch Abb. 17-5).<br />
Erdreich<br />
m<strong>in</strong>d. 300<br />
Mauerwerk<br />
Keilverb<strong>in</strong>dung<br />
Keilverb<strong>in</strong>dung<br />
Schraubverb<strong>in</strong>dung<br />
HE-Schiene<br />
Anschlussfahne<br />
Kellerboden<br />
Gebäudefundament<br />
Fundamenterder<br />
Abb. 17-6<br />
Herstellen<br />
von<br />
Abzweigungen<br />
und Verb<strong>in</strong>dungen<br />
Abb. 17-7<br />
Fundamenterder<br />
mit Anschlussfahne<br />
17<br />
333
17<br />
334<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
Schutzpotenzialausgleichsleitungen<br />
Über der Ausführungsstelle des Fundamenterders <strong>in</strong><br />
den Hausanschlussraum wird die Haupterdungsschiene<br />
montiert. Sie ist das Zentrum des Schutzpotenzialausgleichs.<br />
An diese Schiene werden angeschlossen<br />
und damit untere<strong>in</strong>ander elektrisch verbunden (Abb.<br />
17-8):<br />
– die Anschlussfahne des Fundamenterders (Haupterdungsleiter),<br />
– alle fremden leitfähigen Teile, d.h. die verschiedenen<br />
Rohrsysteme, aber auch metallenen Gebäude-<br />
Konstruktionsteile (über Potenzialausgleichsleiter),<br />
– (bei vorhandenem TN-System) der aus dem Netz<br />
des Netzbetreibers ankommende PEN-Leiter,<br />
– (im TT-System) der <strong>in</strong> die Abnehmeranlage weiterführende<br />
Hauptschutzleiter.<br />
Der Anschluss der jeweiligen Rohrsysteme erfolgt, <strong>in</strong><br />
Fließrichtung gesehen, nach der ersten Trennstelle<br />
(Wasserzähler, Isolierzwischenstück im Gasrohr). Es<br />
ist zweckmäßig und auch zulässig, mehrere Rohrsysteme<br />
unterbrechungsfrei zu verb<strong>in</strong>den und diese<br />
über e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Schutzpotenzialausgleichsleitung<br />
an die Haupterdungsschiene anzuschließen.<br />
Der Querschnitt der Schutzpotenzialausgleichsleitungen<br />
im Bereich der Haupterdungsschiene richtet sich<br />
nach dem Querschnitt des größten Schutzleiters der<br />
elektrischen Anlage. In Tab. 17-1 s<strong>in</strong>d die Zusammenhänge<br />
dargestellt (vgl. dazu auch Abschnitt <strong>16</strong>.6).<br />
Der Querschnitt der Potenzialausgleichsleitungen<br />
im Bereich der Haupterdungsschiene muss m<strong>in</strong>destens<br />
halb so groß se<strong>in</strong> wie der Querschnitt des<br />
größten Schutzleiters der Anlage; 6 mm 2 dürfen<br />
nicht unterschritten, 25 mm 2 brauchen nicht überschritten<br />
zu werden.<br />
Schutzpotenzialausgleichsleiter werden grün-gelb gekennzeichnet.<br />
Wenn e<strong>in</strong>adrige Mantelleitungen (NYM)<br />
verlegt werden, genügt es, die Enden der Leitungen<br />
dauerhaft grün-gelb zu kennzeichnen.<br />
Metallene Wasser- und Gasrohrsysteme dürfen nicht<br />
mehr als Erder benutzt werden. Immer muss der gebäudeeigene<br />
Fundamenterder alle<strong>in</strong> die erforderliche<br />
Erderwirkung erbr<strong>in</strong>gen. Die Verb<strong>in</strong>dung metallener<br />
Rohrsysteme über Schutzpotenzialausgleichsleiter bedeutet<br />
jedoch nicht deren verbotene Benutzung als<br />
Erder. Die Erderwirkung ist hierbei zwangsläufig und<br />
nicht zu vermeiden.<br />
Leiterquerschnitt<br />
<strong>in</strong> mm 2 Cu<br />
Außenleiter 10 <strong>16</strong> 25 35 50 70 95<br />
größter Schutzleiter 10 <strong>16</strong> <strong>16</strong> <strong>16</strong> 25 35 50<br />
Schutzpotenzialausgleichsleiter<br />
6 10 10 10 <strong>16</strong> 25 25<br />
Tab. 17-1 Querschnitt für Schutzpotenzialausgleichsleiter<br />
Die ständig leitfähige Überbrückung des Wasserzählers<br />
ist bei Verwendung metallener Wasserrohre nicht<br />
erforderlich. Die Überbrückung wäre nur dann notwendig,<br />
wenn auch bei Ausbau des Zählers die Erderwirkung<br />
des Wasserrohres fortbestehen sollte. Und<br />
genau das ist unzulässig.<br />
Das Gasrohrnetz darf auf ke<strong>in</strong>en Fall <strong>in</strong> die Erdung e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden; es ist aus diesem Grund von der<br />
Gasleitung im Gebäude<strong>in</strong>neren durch e<strong>in</strong> Isolierstück<br />
elektrisch getrennt. E<strong>in</strong>e Überbrückung des Isolierstückes<br />
ist verboten. Die bei e<strong>in</strong>em möglichen Fehlerfall<br />
kurzzeitig über dem Isolierstück liegende Spannung<br />
dürfte nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Gefahr darstellen, zumal<br />
der vom Potenzialausgleichssystem isolierte Abschnitt<br />
des Gasrohrnetzes nur sehr selten berührt wird.<br />
Wird das Gebäude mit e<strong>in</strong>er Anlage für den äußeren<br />
Blitzschutz oder auch nur mit e<strong>in</strong>em geerdeten Antennenstandrohr<br />
versehen, so muss dem Isolierstück<br />
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Am<br />
Isolierstück könnte bei Blitze<strong>in</strong>wirkung e<strong>in</strong>e Überspannung<br />
anstehen, die zum Überspr<strong>in</strong>gen des Blitzstromes<br />
führen kann. Zu diesem Zweck wird das Isolierstück<br />
mit e<strong>in</strong>er blitzstromtragfähigen Überspannungsschutze<strong>in</strong>richtung,<br />
meist e<strong>in</strong>er Funkenstrecke,<br />
überbrückt (vgl. auch Abschnitt 24.2). Die Planung und<br />
Ausführung dieser Maßnahme ist Bestandteil des<br />
Schutzes vor Blitze<strong>in</strong>wirkungen.<br />
Verb<strong>in</strong>dung 1)<br />
bei Freileitungsanschluss<br />
1)<br />
Hausanschlusskasten<br />
zur<br />
Antenne<br />
Heizungsvorlauf<br />
Heizungsrücklauf<br />
Gas<strong>in</strong>nenleitung<br />
Gebäudeaußenwand<br />
Erdgleiche<br />
leitfähige<br />
Gebäudeteile,<br />
z. B. Stahlkonstruktionen<br />
Frischwasserleitung<br />
Anschlussfahne<br />
Fundamenterder<br />
1) Je nach Schutzmaßnahme zum PE- oder PEN-Leiter<br />
Abwasserleitung<br />
Abb. 17-8 Schutzpotenzialausgleich über die Haupterdungsschiene<br />
im Hausanschlussraum
17.1.3 Hauptstromversorgung<br />
Die elektrische Verb<strong>in</strong>dung zwischen dem Hausanschlusskasten<br />
(Übergabestelle des Netzbetreibers)<br />
und dem Zählerplatz wird als Hauptleitung bezeichnet.<br />
In diesem Leitungsabschnitt wird elektrische Energie<br />
transportiert, die noch nicht messtechnisch erfasst ist.<br />
Hauptstromversorgungssysteme umfassen alle<br />
Hauptleitungen und andere Betriebsmittel nach der<br />
Übergabestelle des Netzbetreibers, die nicht gemessene<br />
elektrische Energie führen.<br />
Diese Anlagenteile müssen e<strong>in</strong>em unberechtigten Zugang<br />
entzogen werden, sie werden plombiert. Plombenverschlüsse<br />
dürfen nur vom Elektro-Fachbetrieb<br />
mit Zustimmung des Netzbetreibers geöffnet werden.<br />
Dies darf nur im Gefahrenfall umgangen werden, wobei<br />
der Netzbetreiber danach unverzüglich <strong>in</strong> Kenntnis<br />
zu setzen ist.<br />
Die Hauptleitungen s<strong>in</strong>d so zu führen, dass sie leicht<br />
zugänglich s<strong>in</strong>d (Kellerflure, Treppenhäuser). Im Kellergeschoss<br />
dürfen die Hauptleitungen auf der Wandoberfläche<br />
verlegt werden. Ab Kellerdecke aufwärts erfolgt<br />
die Legung <strong>in</strong> Schächten, Rohren, Kanälen oder<br />
auch unter Putz. Aussparungen dafür sollten bereits<br />
bei der Gebäudeplanung berücksichtigt werden.<br />
Hauptleitungen dürfen jedoch nicht geme<strong>in</strong>sam <strong>in</strong><br />
Kanälen oder Schächten mit Rohrleitungen, z. B. Wasser-<br />
oder Heizungsleitungen, verlegt werden.<br />
Hauptleitungen s<strong>in</strong>d grundsätzlich als Drehstromleitungen<br />
auszuführen.<br />
Ihr Leiterquerschnitt ist so zu bemessen, dass er<br />
mit der <strong>in</strong> Abb. 17-9 ersichtlichen Nennstromstärke belastet<br />
werden kann.<br />
Für Wohnungen, <strong>in</strong> denen das Wasser für Bade- und<br />
Duschzwecke mit elektrischer Energie erwärmt wird,<br />
müssen Hauptleitungen e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>destbelastbarkeit<br />
Abb. 17-9<br />
M<strong>in</strong>destbelastbarkeit<br />
von<br />
Hauptleitungen<br />
Sche<strong>in</strong>leistung S<br />
150<br />
kVA<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
I n<br />
<strong>16</strong>0<br />
A<br />
125<br />
100<br />
80<br />
63*<br />
Nennstrom der Überstrom-Schutze<strong>in</strong>richtung<br />
A: mit elektrischer Warmwasserbereitung<br />
für Bade- oder<br />
Duschzwecke<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
nach Kennl<strong>in</strong>ie A besitzen. Nach Kennl<strong>in</strong>ie B ist bei<br />
Wohnungen ohne elektrische Warmwasserzubereitung<br />
zu verfahren. In Gebäuden mit elektrischer Raumheizung<br />
s<strong>in</strong>d die Hauptleitungen <strong>in</strong> Absprache mit dem<br />
zuständigen Netzbetreiber zu dimensionieren.<br />
Hauptleitungen müssen e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>destbelastbarkeit<br />
von 63 A haben, ihr M<strong>in</strong>destquerschnitt beträgt<br />
10 mm 2 Cu.<br />
In elektrischen Anlagen des gewerblichen Bereiches<br />
werden die Belastbarkeit und der Querschnitt der<br />
Hauptleitung meist aus der Leistung der e<strong>in</strong>zelnen Verbraucher<br />
ermittelt. Dabei ist es wichtig, über die<br />
Gleichzeitigkeit ihres Betreibens unterrichtet zu se<strong>in</strong>.<br />
Das ist umso notwendiger, je umfangreicher e<strong>in</strong>e Anlage<br />
ist und je mehr Verbrauchsmittel <strong>in</strong> ihr arbeiten. Man<br />
bezieht <strong>in</strong> solchen Fällen e<strong>in</strong>en Gleichzeitigkeitsfaktor g<br />
e<strong>in</strong>. Dieser berücksichtigt, dass nicht alle Verbrauchsmittel<br />
gleichzeitig e<strong>in</strong>geschaltet oder mit Volllast betrieben<br />
werden. Er ist e<strong>in</strong> Erfahrungswert und gibt an, welcher<br />
Teil der Verbraucherleistungen als Dauerbelastung<br />
zu erwarten ist.<br />
Art des Energie- Gleichzeitigkeitsbezuges<br />
faktor g<br />
Beleuchtungsmittel 0,9 … 1<br />
Küchengeräte 0,6<br />
Heizung, Lüftung 0,8<br />
elektrische Masch<strong>in</strong>en 0,6<br />
Aufzüge 0,9<br />
Schulen, K<strong>in</strong>dergärten 0,6 … 0,9<br />
Gaststätten, Hotels 0,4 … 0,7<br />
Kaufhäuser, Supermärkte 0,7 … 0,9<br />
Büros 0,4 … 0,8<br />
Holz verarbeitende Betriebe 0,2 … 0,6<br />
Metall verarbeitende Betriebe 0,2 … 0,4<br />
Baustellen 0,2 … 0,5<br />
Tab. 17-2 Gleichzeitigkeitsfaktoren<br />
B: ohne elektrische Warmwasserbereitung<br />
für Bade- oder Duschzwecke<br />
* M<strong>in</strong>destabsicherung I n = 63 A zur Sicherstellung<br />
der Selektivität zu den Stromkreissicherungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40<br />
Anzahl der Wohnungen<br />
17<br />
335
17<br />
336<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der<br />
E<strong>in</strong>zelleistungen der e<strong>in</strong>zelnen Verbraucher, multipliziert<br />
mit dem ihnen zugeordneten Gleichzeitigkeitsfaktor.<br />
Pges = g · P<strong>in</strong>st<br />
I 17–1<br />
g Gleichzeitigkeitsfaktor (0 < g ≤ 1)<br />
P<strong>in</strong>st <strong>in</strong>stallierte Leistung, Summe aller Anschlusswerte<br />
Pges gleichzeitig <strong>in</strong> Anspruch genommene Leistung, Leistungsbedarf<br />
Damit lässt sich für die spezielle elektrische Anlage die<br />
gesamte Anschlussleistung, die zu erwartende Stromstärke<br />
und folglich der Querschnitt der Hauptleitung<br />
sowie der Wert für die vorzuschaltenden Überstromschutze<strong>in</strong>richtungen<br />
ermitteln. In TN-Systemen dürfen<br />
bei ortsfester Verlegung der Neutral- und der Schutzleiter<br />
geme<strong>in</strong>sam als PEN-Leiter geführt werden, wenn<br />
der Leiterquerschnitt 10 mm 2 Cu (oder <strong>16</strong> mm 2 Al)<br />
nicht unterschreitet. Der Schutzleiter darf aber auch<br />
getrennt vom Neutralleiter verlegt werden.<br />
Die Hauptstromversorgung kann folglich vier- oder<br />
fünfadrig erfolgen (Abb. 17-10):<br />
Ausführung 1<br />
+ +<br />
z. B. NYM-J<br />
PEN<br />
PEN<br />
Ausführung 2 z. B. NYM-J<br />
Ausführung 3<br />
+ +<br />
+ +<br />
PE<br />
N<br />
PEN<br />
z. B. NYM-J<br />
PE<br />
Ausführung 4 z. B. NYM-O<br />
+ +<br />
N<br />
N<br />
N<br />
N<br />
PA<br />
PA<br />
PE<br />
PE<br />
TN- ankom- TN-C vieradrig mit<br />
System mender<br />
grün-gelber<br />
PEN mit<br />
Ader (PEN)<br />
HES<br />
verbunden<br />
TN-S fünfadrig mit<br />
grün-gelber Ader<br />
(PE ab HAK)<br />
TT- fünfadrig mit<br />
System grün-gelber Ader<br />
(PE ab HAK)<br />
(Schutzleiter <strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>samer<br />
Umhüllung)<br />
Abb. 17-10<br />
vieradrig ohne<br />
grün-gelbe Ader<br />
(Schutzleiter als<br />
separate Leitung<br />
geführt)<br />
Für Gebäude mit umfangreichen <strong>in</strong>formationstechnischen<br />
Anlagen wird aus Sicht des störungsfreien Betriebes<br />
dieser Anlagen empfohlen, ab dem Hausanschlusskasten<br />
das TN-S-System mit getrennt geführtem<br />
Schutzleiter anzuwenden. Aus wirtschaftlichen<br />
Gründen verlangen dennoch viele Netzbetreiber, für<br />
die Hauptstromversorgung das TN-C-System beizubehalten.<br />
17.1.4 Zählerplatz<br />
Der Zählerplatz ist der Ort <strong>in</strong> der elektrischen Anlage,<br />
an dem die Mess- und Steuere<strong>in</strong>richtungen angeordnet<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Für Zählerplätze s<strong>in</strong>d leicht zugängliche Stellen bzw.<br />
Räume zu wählen, wie z. B. der Hausanschlussraum<br />
oder Treppenflure. In Wohnungen von Mehrfamilienhäusern,<br />
<strong>in</strong> Lagerräumen, an Orten mit dauernd erhöhter<br />
Temperatur (größer 25 °C) sowie an feuergefährdeten<br />
Stellen dürfen Zählerplätze nicht errichtet werden.<br />
Zähler s<strong>in</strong>d vor Feuchtigkeit, Erschütterung und Verschmutzung<br />
zu schützen. Sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Zählerschränke<br />
e<strong>in</strong>zubauen. Der Abstand vom Fußboden bis zur<br />
Zählermitte muss m<strong>in</strong>destens 1,10 m und darf höchstens<br />
1,85 m betragen. Messe<strong>in</strong>richtungen und Steuergeräte<br />
s<strong>in</strong>d dauerhaft und e<strong>in</strong>deutig zu kennzeichnen,<br />
so dass die Zuordnung zum jeweiligen Abnehmer unverwechselbar<br />
ist (Abb. 17-11).<br />
Zählerplätze s<strong>in</strong>d so zu wählen, dass Mess- und<br />
Steuere<strong>in</strong>richtungen leicht zugänglich s<strong>in</strong>d und<br />
ohne besondere Hilfsmittel abgelesen werden können.<br />
Verschiedene Ausführungen der Hauptstromversorgung<br />
Ausführung 1: TN-C-System<br />
Ausführung 2: TN-C-S-System<br />
Ausführung 3: TT-System,<br />
Schutzleiter <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samer Umhüllung<br />
Ausführung 4: TT-System,<br />
Schutzleiter als separate Leitung
Die Zählerplatzfläche wird <strong>in</strong> drei Funktionsbereiche<br />
unterteilt: unterer Anschlussraum, Zählerfeld und oberer<br />
Anschlussraum. Zählerplatzflächen s<strong>in</strong>d 250 mm<br />
breit und <strong>in</strong> der „e<strong>in</strong>stöckigen“ Bauweise (e<strong>in</strong> Zähler<br />
pro Zählerfeld) meist 900 mm hoch.<br />
Der untere und der obere Anschlussraum werden nach<br />
den Vorschriften des örtlichen Netzbetreibers beschaltet.<br />
Im unteren Anschlussraum bef<strong>in</strong>det sich e<strong>in</strong>e selektiv<br />
wirkende Überstromschutze<strong>in</strong>richtung, die sperrund<br />
plombierbar se<strong>in</strong> muss.<br />
Sie hat folgende Funktionen:<br />
– zentrale Überstromschutze<strong>in</strong>richtung für die Kundenanlage,<br />
– Freischalte<strong>in</strong>richtung für die Mess- und Steuere<strong>in</strong>richtungen,<br />
– Trennvorrichtung für die nachgeordnete Anlage.<br />
Im oberen Anschlussraum bef<strong>in</strong>den sich die Hauptleitungs-Abzweigklemmen.<br />
E<strong>in</strong>zelne Betriebsmittel, wie<br />
900<br />
750<br />
300<br />
oberer Anschlussraum<br />
Zählerfeld Tarifschaltgerätefeld<br />
unterer Anschlussraum<br />
750<br />
Stromkreisverteilerfeld<br />
Abb. 17-11 Zählerplatz<br />
a) Zählerschrank mit e<strong>in</strong>gebautem<br />
Stromkreisverteiler<br />
b) Zählerplatzmaße<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
Treppenhaus-Zeitschalter und Kl<strong>in</strong>geltransformator,<br />
dürfen im oberen Anschlussraum angeordnet werden.<br />
Um unzulässige Erwärmung auszuschließen, gilt jedoch:<br />
Die oberen Anschlussräume dürfen nicht als Stromkreisverteiler<br />
verwendet werden.<br />
Das Zählerfeld nimmt nur den Zähler auf. Mehrtarifzähler<br />
werden mithilfe e<strong>in</strong>es Tarifschaltgerätes geschaltet.<br />
Dieses wird auf dem benachbarten Tarifschaltgerätefeld<br />
<strong>in</strong>stalliert. Dieses Feld ist auch dann<br />
vorzusehen, wenn beim Errichten der Anlage noch<br />
ke<strong>in</strong> Mehrtarifzähler angebracht wird. Vom Zählerplatz<br />
ist e<strong>in</strong>e siebenadrige Steuerleitung, meist als Mantelleitung<br />
NYM-O 7 x 1,5 mm 2 Cu, bis zum Stromkreisverteiler<br />
zu führen. Wenn die Steuerleitung noch nicht<br />
benötigt wird, ist zunächst e<strong>in</strong> Leerrohr mit e<strong>in</strong>er lichten<br />
Weite von m<strong>in</strong>destens 29 mm zu verlegen. In Mehrfamilienhäusern<br />
werden die Messe<strong>in</strong>richtungen für die<br />
Wohnungen meist an zentraler Stelle (z. B. im Hausanschlussraum)<br />
zusammengefasst. Dezentrale Anordnungen,<br />
z. B. auf jeder Etage, s<strong>in</strong>d ebenfalls zulässig<br />
(Abb. 17-12).<br />
a)<br />
b)<br />
EG<br />
S<br />
Wh<br />
zu den Kundenanlagen<br />
S<br />
EG 1.OG 2.OG<br />
S<br />
Wh<br />
S<br />
Wh<br />
Hauptleitung<br />
Hausanschlusskasten<br />
1.OG<br />
Wh<br />
2.OG<br />
S<br />
Wh<br />
Abb. 17-12 Zähleranordnung (Pr<strong>in</strong>zipdarstellung)<br />
a) zentral<br />
b) dezentral<br />
S<br />
Wh<br />
17<br />
337
17<br />
338<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
Induktionszähler<br />
Die Verrechnung der vom Elektrizitätsversorgungsunternehmen<br />
gelieferten und vom Kunden verbrauchten<br />
Elektroenergie erfordert genaue Messergebnisse.<br />
Dafür werden Induktionszähler verwendet. Der Induktionszähler<br />
ist <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Wirkungsweise dem E<strong>in</strong>phasen-Asynchronmotor<br />
sehr ähnlich (vgl. Abschnitt 18.2).<br />
Im Luftspalt zwischen den Polen zweier Magnetsysteme<br />
(„Ständer“) ist e<strong>in</strong>e Alum<strong>in</strong>iumscheibe („Läufer“)<br />
drehbar gelagert. Diese Scheibe ist als e<strong>in</strong> sehr kurzer<br />
und damit trägheitsarmer Kurzschlussläufer aufzufassen<br />
(Abb. 17-13).<br />
Das untere, zweischenklige Magnetsystem trägt die<br />
„Stromspule“. Auf dem oberen Magnetsystem ist die<br />
„Spannungsspule“ angeordnet; durch se<strong>in</strong>e Konstruktion<br />
besitzt es e<strong>in</strong>e große Induktivität. Bei Wirklast s<strong>in</strong>d<br />
deshalb die Ströme <strong>in</strong> den beiden Spulen und folglich<br />
deren Magnetflüsse um fast 90° gegene<strong>in</strong>ander phasenverschoben.<br />
Durch Überlagerung der beiden Magnetflüsse<br />
entsteht e<strong>in</strong> bewegtes Magnetfeld. Dieses <strong>in</strong>duziert<br />
im Läufer, der Alum<strong>in</strong>iumscheibe, Ströme. Die<br />
Läuferscheibe folgt der Feldbewegung und dreht sich.<br />
Das Drehmoment ist umso größer, je größer die Leistung<br />
ist, die über den Zähler geführt wird.<br />
Weicht die Belastung von der Wirklast ab, so verr<strong>in</strong>gert<br />
sich die Phasenverschiebung der beiden Ströme und<br />
ihrer Magnetflüsse. Das Drehmoment s<strong>in</strong>kt. Der Zähler<br />
zählt folglich nur Wirkarbeit.<br />
Durch die Drehung der Läuferscheibe zwischen dem<br />
Bremsmagneten entstehen <strong>in</strong> ihr Wirbelströme. Diese<br />
bewirken e<strong>in</strong> bremsendes Moment, so dass die Drehzahl<br />
der Scheibe nicht größer wird, als es der Zählerbelastung<br />
entspricht. E<strong>in</strong> Nachlaufen der Zählerscheibe<br />
wird verh<strong>in</strong>dert.<br />
Bremsmagnet<br />
L1<br />
N<br />
I 2 ∼ U I 1<br />
Abb. 17-13 Induktionszähler<br />
Spannungsspule<br />
Stromspule<br />
Läuferscheibe<br />
1 2 3 4 6<br />
Die Anzahl der Scheibenumdrehungen wird auf e<strong>in</strong><br />
mechanisches Zählwerk übertragen. Die Zählerkonstante<br />
gibt die Anzahl der Umdrehungen pro kWh an.<br />
Mit ihrer Hilfe lässt sich die elektrische Leistung bestimmen.<br />
Man ermittelt die Zählerumdrehungen <strong>in</strong> –<br />
beispielsweise – e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>ute und rechnet diese auf e<strong>in</strong>e<br />
Stunde um.<br />
Dann gilt<br />
P = n<br />
Cz<br />
I 17–2<br />
n Zählerumdrehungen je Stunde<br />
Cz Zählerkonstante <strong>in</strong> Umdrehungen<br />
je kWh<br />
P Leistung <strong>in</strong> kW<br />
Zähler unterliegen besonderen Prüfbed<strong>in</strong>gungen. Nach<br />
e<strong>in</strong>er angemessenen Frist, z. B. nach e<strong>in</strong>em <strong>16</strong>-jährigen<br />
E<strong>in</strong>satz, werden die Zähler e<strong>in</strong>er erneuten E<strong>in</strong>zelprüfung<br />
oder auch e<strong>in</strong>er Stichprobenprüfung unterzogen.<br />
Dies erfolgt <strong>in</strong> der Prüfstelle des Netzbetreibers.<br />
Nach bestandener Prüfung werden die Zähler für e<strong>in</strong>en<br />
weiteren Nutzungszeitraum beglaubigt.<br />
Die Schaltung e<strong>in</strong>es Zählers entspricht der e<strong>in</strong>es Leistungsmessers<br />
(vgl. Abb. 17-14).<br />
Die Schaltungen der Wechsel- und Drehstromzähler<br />
werden durch e<strong>in</strong>e vierstellige Schaltungsnummer erfasst.<br />
Die Bedeutung der Ziffern ist der Abb. 17-15 zu<br />
entnehmen.<br />
a)<br />
b)<br />
zum Netz<br />
L1<br />
N<br />
L1<br />
L2<br />
L3<br />
N<br />
1 3 4 6<br />
zum<br />
Verbraucher<br />
1 3 4 6 7 9 10 12<br />
Abb. 17-14 Zählerschaltungen<br />
a) Wechselstromzähler-Schaltung, e<strong>in</strong>polig,<br />
Schaltungsnummer 1000<br />
b) Drehstromzähler-Schaltung, Vierleiteranschluss,<br />
Schaltungsnummer 4000
1 2 3 4<br />
Zahlenstelle<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
0<br />
1<br />
2<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
L1<br />
L2<br />
L3 N<br />
Zählerausführung<br />
Grundart des Zählers:<br />
E<strong>in</strong>poliger Wechselstrom-Wirkverbrauchzähler<br />
Zweipoliger Wechselstrom-Wirkverbrauchzähler<br />
Dreileiter-Drehstrom-Wirkverbrauchzähler<br />
Vierleiter-Drehstrom-Wirkverbrauchzähler<br />
Dreileiter-Drehstrom-Bl<strong>in</strong>dverbrauchzähler<br />
mit 60°-Abgleich<br />
Dreileiter-Drehstrom-Bl<strong>in</strong>dverbrauchzähler<br />
mit 90°-Abgleich<br />
Vierleiter-Drehstrom-Bl<strong>in</strong>dverbrauchzähler<br />
mit 90°-Abgleich<br />
Zusatze<strong>in</strong>richtungen:<br />
Ohne Zusatze<strong>in</strong>richtung<br />
Mit Zweitarife<strong>in</strong>richtung<br />
Mit Maximume<strong>in</strong>richtung<br />
Mit Zweitarif- und Maximume<strong>in</strong>richtung<br />
Mit Maximume<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>schließlich<br />
elektrischer Rückstellung<br />
Mit Zweitarif- und Maximume<strong>in</strong>richtung<br />
e<strong>in</strong>schließlich elektrischer Rückstellung<br />
Impulsgabee<strong>in</strong>richtung<br />
Impulsgabee<strong>in</strong>richtung und Zweitarife<strong>in</strong>richtung<br />
Äußerer Anschluss der Grundart:<br />
Für unmittelbaren Anschluss<br />
Für Anschluss an Stromwandler<br />
Für Anschluss an Strom- und Spannungswandler<br />
Schaltungen der Zusatze<strong>in</strong>richtungen:<br />
Ohne äußeren Anschluss<br />
Mit e<strong>in</strong>poligem <strong>in</strong>neren Anschluss der<br />
Zweitarife<strong>in</strong>richtung und/oder der<br />
elektrischen Maximum-Rückstellung<br />
Mit äußerem Anschluss der<br />
Zweitarife<strong>in</strong>richtung und/oder der<br />
elektrischen Maximum-Rückstellung<br />
Mit e<strong>in</strong>poligem <strong>in</strong>neren Anschluss der<br />
Zusatze<strong>in</strong>richtungen und Maximumauslöser<br />
<strong>in</strong> Öffnungsschaltung<br />
Mit e<strong>in</strong>poligem <strong>in</strong>neren Anschluss der<br />
Zusatze<strong>in</strong>richtungen und Maximumauslöser<br />
<strong>in</strong> Kurzschließschaltung<br />
Mit äußerem Anschluss der Zusatze<strong>in</strong>richtungen<br />
und Maximumauslöser<br />
<strong>in</strong> Öffnungsschaltung<br />
Mit äußerem Anschluss der Zusatze<strong>in</strong>richtungen<br />
und Maximumauslöser<br />
<strong>in</strong> Kurzschließschaltung<br />
Abb. 17-15 Nummern für Elektrizitätszähler-<br />
Schaltungen<br />
1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13<br />
17.1 Elektro<strong>in</strong>stallation <strong>in</strong> Wohngebäuden<br />
4101<br />
M<br />
1 2 3 4<br />
Ziffernfolge Ausführung der Tarifschaltuhr<br />
01 Mit Tagesschalter<br />
02 Mit Maximumschalter<br />
03 Mit Tages- und Maximumschalter<br />
04 Mit Tages- und Wochenschalter<br />
05 Mit Maximum- und Wochenschalter<br />
06<br />
Mit Tages-, Maximum- und Wochenschalter<br />
07 Mit Wochenschalter<br />
Ziffernfolge Ausführung des Rundsteuerempfängers<br />
11 Mit e<strong>in</strong>em Umschalter<br />
12 Mit zwei Umschaltern<br />
13<br />
Mit drei Umschaltern<br />
14 Mit vier Umschaltern<br />
Bei Zählern s<strong>in</strong>d der Nennstrom und der so genannte<br />
Grenzstrom bedeutsam. Bis zur Grenzstromstärke<br />
kann der Zähler thermisch dauernd belastet werden.<br />
Zähler, deren Grenzstrom mehr als das 1,25fache des<br />
Nennstromes beträgt, nennt man Großbereichszähler.<br />
Bei modernen Zählern dieser Art kann der Grenzstrom<br />
e<strong>in</strong> Mehrfaches des Nennstromes betragen. Beide,<br />
Nennstrom und Grenzstrom, s<strong>in</strong>d Bestandteil der Leistungsschildangabe<br />
des Zählers (Abb. 17-<strong>16</strong>).<br />
Drehstrom<br />
Schaltungs-<br />
Nummer<br />
Zählwerk<br />
01<br />
Zählerscheibe<br />
mit Markierung<br />
Abb. 17-<strong>16</strong> Leistungsschild e<strong>in</strong>es Zählers<br />
Gattungsnummer<br />
Zulassungsnummer<br />
Fabriknummer<br />
Nennfrequenz<br />
Großbereichszähler<br />
Zähler-<br />
konstante Cz<br />
17<br />
339