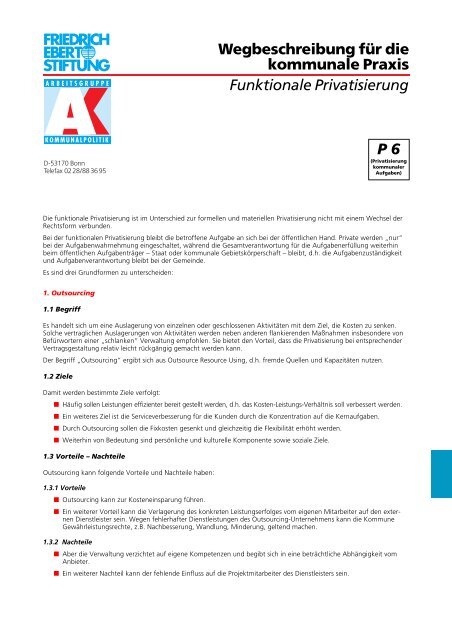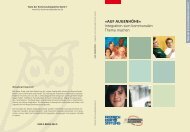Funktionale Privatisierung - KommunalAkademie der Friedrich-Ebert ...
Funktionale Privatisierung - KommunalAkademie der Friedrich-Ebert ...
Funktionale Privatisierung - KommunalAkademie der Friedrich-Ebert ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FRIEDRICH<br />
EBERT<br />
STIFTUNG<br />
RBEITSGRUPPE<br />
KAA<br />
KOMMUNALPOLITIK<br />
D-53170 Bonn<br />
Telefax 0228/88 36 95<br />
Wegbeschreibung für die<br />
kommunale Praxis<br />
<strong>Funktionale</strong> <strong>Privatisierung</strong><br />
P 6<br />
(<strong>Privatisierung</strong><br />
kommunaler<br />
Aufgaben)<br />
Die funktionale <strong>Privatisierung</strong> ist im Unterschied zur formellen und materiellen <strong>Privatisierung</strong> nicht mit einem Wechsel <strong>der</strong><br />
Rechtsform verbunden.<br />
Bei <strong>der</strong> funktionalen <strong>Privatisierung</strong> bleibt die betroffene Aufgabe an sich bei <strong>der</strong> öffentlichen Hand. Private werden „nur“<br />
bei <strong>der</strong> Aufgabenwahrnehmung eingeschaltet, während die Gesamtverantwortung für die Aufgabenerfüllung weiterhin<br />
beim öffentlichen Aufgabenträger – Staat o<strong>der</strong> kommunale Gebietskörperschaft – bleibt, d.h. die Aufgabenzuständigkeit<br />
und Aufgabenverantwortung bleibt bei <strong>der</strong> Gemeinde.<br />
Es sind drei Grundformen zu unterscheiden:<br />
1. Outsourcing<br />
1.1 Begriff<br />
Es handelt sich um eine Auslagerung von einzelnen o<strong>der</strong> geschlossenen Aktivitäten mit dem Ziel, die Kosten zu senken.<br />
Solche vertraglichen Auslagerungen von Aktivitäten werden neben an<strong>der</strong>en flankierenden Maßnahmen insbeson<strong>der</strong>e von<br />
Befürwortern einer „schlanken“ Verwaltung empfohlen. Sie bietet den Vorteil, dass die <strong>Privatisierung</strong> bei entsprechen<strong>der</strong><br />
Vertragsgestaltung relativ leicht rückgängig gemacht werden kann.<br />
Der Begriff „Outsourcing“ ergibt sich aus Outsource Resource Using, d.h. fremde Quellen und Kapazitäten nutzen.<br />
1.2 Ziele<br />
Damit werden bestimmte Ziele verfolgt:<br />
■ Häufig sollen Leistungen effizienter bereit gestellt werden, d.h. das Kosten-Leistungs-Verhältnis soll verbessert werden.<br />
■ Ein weiteres Ziel ist die Serviceverbesserung für die Kunden durch die Konzentration auf die Kernaufgaben.<br />
■ Durch Outsourcing sollen die Fixkosten gesenkt und gleichzeitig die Flexibilität erhöht werden.<br />
■ Weiterhin von Bedeutung sind persönliche und kulturelle Komponente sowie soziale Ziele.<br />
1.3 Vorteile – Nachteile<br />
Outsourcing kann folgende Vorteile und Nachteile haben:<br />
1.3.1 Vorteile<br />
■ Outsourcing kann zur Kosteneinsparung führen.<br />
■ Ein weiterer Vorteil kann die Verlagerung des konkreten Leistungserfolges vom eigenen Mitarbeiter auf den externen<br />
Dienstleister sein. Wegen fehlerhafter Dienstleistungen des Outsourcing-Unternehmens kann die Kommune<br />
Gewährleistungsrechte, z.B. Nachbesserung, Wandlung, Min<strong>der</strong>ung, geltend machen.<br />
1.3.2 Nachteile<br />
■ Aber die Verwaltung verzichtet auf eigene Kompetenzen und begibt sich in eine beträchtliche Abhängigkeit vom<br />
Anbieter.<br />
■ Ein weiterer Nachteil kann <strong>der</strong> fehlende Einfluss auf die Projektmitarbeiter des Dienstleisters sein.
2. Einschaltung eines Verwaltungshelfers<br />
2.1 Begriff<br />
Der Verwaltungshelfer ist als Erfüllungsgehilfe in eine öffentlich-rechtlich zu erledigende Aufgabe eingeschaltet. Er arbeitet<br />
rechtlich nicht selbstständig, son<strong>der</strong>n er ist „Werkzeug“ <strong>der</strong> Behörde; er nimmt Hilfstätigkeiten im Auftrag und nach Weisung<br />
<strong>der</strong> Behörden wahr.<br />
Deshalb sind mit Blick auf ihn<br />
■ Außenrechtsbeziehung und<br />
■ Innenrechtsbeziehung<br />
scharf zu unterscheiden.<br />
Das Außenrechtsverhältnis betrifft die Beziehung zwischen Bürger und <strong>der</strong> Behörde (2.2.1), die Innenrechtsbeziehung<br />
betrifft das Rechtsverhältnis zwischen <strong>der</strong> beauftragenden Gebietskörperschaft und dem Verwaltungshelfer (2.1.2).<br />
2.1.1 Aus dem Blickwinkel des Bürgers betrachtet handelt <strong>der</strong> Private für die Behörde; <strong>der</strong> Bürger tritt zum Privaten nicht in<br />
eine Rechtsbeziehung.<br />
Nach herrschen<strong>der</strong> Meinung bedarf es einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für die Einschaltung eines Verwaltungshelfers<br />
nicht. Es muss lediglich das Direktionsrecht des für die Aufgabenerfüllung Zuständigen gesichert bleiben. Die Entscheidung,<br />
ob und, wenn ja, welches Unternehmen als Verwaltungshelfer eingeschaltet wird, ist öffentlich-rechtlicher Natur.<br />
2.1.2 Zwischen <strong>der</strong> Behörde und dem Verwaltungshelfer besteht regelmäßig ein Auftrags- und Werkvertragsverhältnis. Die<br />
Rechtsbeziehung ist privatrechtlich. Die Leistungen sich auszuschreiben. Eine Einschaltung Privater als kommunale Erfüllungsgehilfen<br />
o<strong>der</strong> Verwaltungshelfer liegt dann vor, wenn dem privaten Dritten lediglich die Durchführung einer öffentlichen<br />
Aufgabe übertragen wird, im Übrigen aber die grundsätzliche Zuständigkeit, Aufgabenverantwortung, Weisungsbefugnis<br />
und Garantenstellung bei <strong>der</strong> beauftragenden Gemeinde verbleibt.<br />
Wird ein Verwaltungshelfer eingeschaltet, muss er die Gewähr dafür bieten, dass er für die Aufgabenerfüllung qualifiziert<br />
ist. Er muss die notwendige Sach- und Fachkunde besitzen.<br />
Auf die Qualifikation des Verwaltungshelfers zu achten ist für die Behörde schon zwingend, weil sie für schadensersatzpflichtige<br />
Handlungen des Verwaltungshelfers nach § 899 BGB/Art. 34 GG haftet. Daraus folgt zumindest die Verpflichtung<br />
<strong>der</strong> Behörde, den Verwaltungshelfer sorgfältig auszusuchen. Es folgt daraus aber auch die Pflicht, den Verwaltungshelfer<br />
zu überwachen.<br />
Als Verwaltungshelfer kommen natürliche und juristische Personen in Betracht.<br />
2.2 Modelle<br />
Für öffentliche Versorgungs- und Entsorgungsaufgaben sind insbeson<strong>der</strong>e drei Modelle von Bedeutung: Das Betreibermodell<br />
(2.2.1), das Betriebsführungsmodell (2.2.2) und das Kooperationsmodell (2.2.3).<br />
2.2.1 Betreibermodell<br />
Das bekannteste Beispiel für das Modell eines kommunalen Erfüllungsgehilfen o<strong>der</strong> Verwaltungshelfers ist das in einigen<br />
Gemeinden praktizierte sog. „Betreibermodell“ im Bereich <strong>der</strong> Abwasserbeseitigung.<br />
Das Betreibermodell wurde in den 80er Jahren in Nie<strong>der</strong>sachsen entwickelt. Die Leistung Abwasserbeseitigung wurde langfristig<br />
in die Hände eines privaten Unternehmens gelegt. Dieses erhält von <strong>der</strong> Kommune für seine Leistung ein Entgelt, das<br />
die Kommune wie<strong>der</strong>um durch Gebühren und Beiträge <strong>der</strong> Bürger refinanziert. Dem Betreibermodell wird immer wie<strong>der</strong><br />
als Nachteil angelastet, dass die Kommune zu wenig Einflussmöglichkeiten auf die Durchführung <strong>der</strong> Abwasserbeseitigung<br />
nehmen kann, insbeson<strong>der</strong>e weil es sich hier um äußerst langfristige, über Jahrzehnte währende Verträge handelt. Eine<br />
entsprechende Vertragsgestaltung wirkt diesen Gefahren jedoch entgegen. So ist z.B. die Festlegung eines sog. Heimfallrechtes<br />
zugunsten <strong>der</strong> Kommunen von Bedeutung. Diese Regelung sichert dann <strong>der</strong> Gemeinde für den Fall <strong>der</strong> Kündigung<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Insolvenz des Betreibers das Recht an den Anlagen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Abwasserbeseitigungsanlage<br />
auf dem Grundstück <strong>der</strong> Gemeinde errichtet und dieses per Erbbaurecht dem Betreiber zur Verfügung gestellt<br />
wurde ( zu den Einzelheiten vgl. Wegbeschreibung P 7).<br />
2.2.2 Betriebsführungsmodell<br />
Ein weiteres Modell ist das Betriebsführungsmodell.<br />
Beim Betriebsführungsmodell betreibt ein Dritter Anlagen <strong>der</strong> Gemeinde. Die kommunale Gebietskörperschaft bleibt Eigentümer<br />
<strong>der</strong> Anlage (zu den Einzelheiten vgl. Wegbeschreibung P 8).<br />
2.2.3 Kooperationsmodell<br />
Schließlich ist noch das Kooperationsmodell zu nennen.<br />
Bei dem Kooperationsmodell wird zur Erfüllung <strong>der</strong> entsprechenden Pflicht zwischen dem privaten Unternehmen und <strong>der</strong><br />
Kommune eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft gegründet, an <strong>der</strong> die Kommune im Regelfall zu 51 Prozent mehrheitlich<br />
beteiligt ist. Der zentrale Unterschied zum Betreibermodell liegt darin, dass die Kommune durch ihre Anteile an dem<br />
Gemeinschaftsprojekt direkten Einfluss auf die Leistungserbringung nehmen kann (zu den Einzelheiten vgl. Wegbeschreibung<br />
P 9).
2.3 Rechtliche Maßgaben<br />
In rechtsgrundsätzlicher Hinsicht ist geklärt, dass das Grundgesetz einer Heranziehung privater Verwaltungshelfer dem Grunde<br />
nach nicht entgegensteht. Damit ist indes nicht zum Ausdruck gebracht, welchen Umfang die funktionale <strong>Privatisierung</strong><br />
haben darf. Jedenfalls darf einem Verwaltungshelfer die Befugnis zur Letztentscheidung ohne gesetzliche Grundlage nicht<br />
übertragen werden. Die sachliche Zuständigkeit bedarf in Anbetracht des Rechtsstaatsprinzips, des Demokratieprinzips und<br />
des Gewaltenteilungsgrundsatzes immer einer ausdrücklichen Regelung durch Gesetz o<strong>der</strong> Verordnung bzw. Satzung aufgrund<br />
einer gesetzlichen Regelung. Im Falle <strong>der</strong> Einschaltung privater Verwaltungshelfer ist die demokratische Legitimation<br />
nur gegeben, wenn eine Ausglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Entscheidungskompetenz auf einem entsprechenden Willensakt des Rates beruht<br />
und die Letztentscheidungsbefugnis des unmittelbaren Repräsentativorgans gewährleistet ist.<br />
Da durch die Einschaltung eines privaten Verwaltungshelfers die Verantwortung <strong>der</strong> kommunalen Gebietskörperschaft unberührt<br />
bleibt, ergibt sich aus den Grundprinzipien des parlamentarisch-demokratischen Rechtsstaates eine Einwirkungso<strong>der</strong><br />
Ingerenzpflicht <strong>der</strong> jeweiligen Kommune. Die Pflicht folgt vor allem aus dem Gedanken, dass die Verwendung und<br />
Zuhilfenahme Privater den Staat bzw. die Kommunen nicht aller öffentlicher Bindungen entledigt, son<strong>der</strong>n sie nur insoweit<br />
aus <strong>der</strong> Pflicht entlässt, als dies zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks unerheblich ist und dabei keine staatlichen Schutzfunktionen<br />
entfallen. Der Einwirkungspflicht liegt dabei <strong>der</strong> Grundgedanke zugrunde, dass sich <strong>der</strong> Staat <strong>der</strong> Verantwortung<br />
für das Handeln seiner am Verwaltungsvollzug Beteiligten nicht entziehen darf. Um <strong>der</strong> Einwirkungspflicht genüge zu<br />
tun, bedarf es regelmäßig neben dem Vorbehalt geeigneter Einwirkungsmöglichkeiten in den Verträgen vor allem laufen<strong>der</strong><br />
Aufsicht und Kontrolle sowie korrigieren<strong>der</strong> Eingriffsmaßnahmen im Verletzungsfall. Beson<strong>der</strong>es Augenmerk ist auf<br />
den Datenschutz zu legen. Insbeson<strong>der</strong>e beim Umgang mit personenbezogenen Daten sind beson<strong>der</strong>e Schutz- und Sicherungsmaßnahmen<br />
geboten.<br />
2.4 Zweckmäßigkeit des Einsatzes<br />
Verwaltungshelfer benötigen umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Verwaltungen und <strong>der</strong>en Strukturen.<br />
Diese Voraussetzungen sind beim Einsatz qualifizierter Verwaltungsmitarbeiter möglicherweise besser erfüllt als bei einem<br />
Außenstehenden. Hinzu kommt, dass bei <strong>der</strong> Übertragung nicht <strong>der</strong> gesamten Aufgabe, son<strong>der</strong>n bei einer nur teilweise<br />
möglichen Aufgabenverlagerung die Einheit <strong>der</strong> Verwaltung verloren gehen kann und die Zuständigkeiten, Kompetenzen<br />
und Befugnisse gegenüber <strong>der</strong> Öffentlichkeit verwischt werden können.<br />
Diesen möglichen Nachteilen stehen einige Vorteile gegenüber. Ein Kriterium ist dabei die bei vielen Kommunalverwaltungen<br />
eingeschränkte Möglichkeit, eine entsprechende personelle und technische Ausstattung bereitzuhalten. Hinzu kommt<br />
die Aktivierung und Nutzung privaten Sachverstands (Stober, NJW 1984 S. 449 ff.). Die Einschaltung eines Verwaltungshelfers<br />
kann auch zu Zeitgewinnen führen (Böckel, DÖV 1995 S. 102 ff.). Schließlich kann es für die Verwaltung durchaus<br />
sinnvoll sein, wenn sie sich auf wesentliche Verfahrensteile beschränkt. Nicht unterschätzt werden dürfen auch mögliche<br />
Kostenvorteile durch eine Aufgabenübertragung auf Dritte.<br />
3. Beleihung<br />
3.1 Begriff<br />
Die nur durch Gesetz o<strong>der</strong> auf Grund Gesetzes durch Verwaltungsakt mögliche Beleihung gibt dem Beliehenen das Recht,<br />
bestimmte hoheitliche Aufgaben im eigenen Namen wahrzunehmen. Beliehene können natürliche Personen o<strong>der</strong> juristische<br />
Personen des Privatrechts sein. Die Beleihung einer Privatperson mit <strong>der</strong> Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erfreut<br />
sich zunehmen<strong>der</strong> Beliebtheit.<br />
Der Staat verfolgt mit dieser Variante von <strong>Privatisierung</strong> regelmäßig folgende Zwecke:<br />
Die Initiative, die Sachkunde, die technischen und betrieblichen Möglichkeiten von natürlichen Personen sowie von privaten<br />
Unternehmen sollen dem Staat nutzbar gemacht werden.<br />
Mit <strong>der</strong> Inbetriebnahme Privater entlastet <strong>der</strong> Staat zugleich den eigenen Verwaltungsapparat. Als Motive des Staates, die<br />
Rechtsfigur „Beleihung“ zu nutzen, lassen sich folgende als vorteilhaft betrachtete Umstände herausstellen: Die Überwindung<br />
<strong>der</strong> durch bürokratische und hierarchische Strukturen <strong>der</strong> öffentlichen Verwaltung verlangsamten und gehemmten<br />
Entscheidungsprozesse sowie die als störend empfundenen haushalts-, finanz- und personalrechtlichen Bindungen.<br />
Rationalisierung und Ökonomie <strong>der</strong> Aufgabenerfüllung sind somit entscheidend.<br />
Der Beliehene deckt die ihm entstehenden Kosten durch die Erhebung von Gebühren. Denn <strong>der</strong> Beliehene ist Behörde i.S.<br />
von § 1 Abs. 4 VwVfG.<br />
Ob eine Gesellschaft, an <strong>der</strong> <strong>der</strong> Staat mit mehr als 50 % des Kapitals beteiligt ist o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en „Geschick“ <strong>der</strong> Staat bestimmt,<br />
beliehen werden kann, ist umstritten. Peine, DÖV 1997 S. 253 ff., Stuible-Tre<strong>der</strong>, Der Beliehene im Verwaltungsrecht, Dissertation<br />
1986 S. 124 und Steiner, Öffentliche Verwaltung durch Private Allgemeine Lehren, Hamburg, 1975 S. 212, vertreten<br />
die Auffassung, die Beleihung sei als Übertragung von Staatsaufgaben auf Private zu verstehen, es handele sich nicht um<br />
die Erfüllung von Staatsaufgaben auf privatrechtlicher Basis. Beleihung bedeute nicht Tätigkeit eines privatrechtlichen Subjekts<br />
für den Staat, son<strong>der</strong>n eines Privatsubjekts. Demzufolge würden als mögliche Adressaten einer Beleihung alle juristischen<br />
Personen und sonstigen Personenvereinigungen des Privatrechts ausscheiden, bei denen <strong>der</strong> Staat in den für den<br />
jeweiligen privatrechtlichen Organisationstyp maßgeblichen Organen überwiegend repräsentiert sei.
3.2 Finanzierung<br />
Im Falle <strong>der</strong> Beleihung bestehen die Leistungsbeziehungen ausschließlich zwischen dem Beliehenen und den Kunden. Da<br />
kein öffentlicher Auftrag mit <strong>der</strong> Gebietskörperschaft vorliegt, spielen die Grundsätze des öffentlichen Preisrechts keine<br />
Rolle. Ebenso bestehen keine umsatzsteuerlichen Leistungsbeziehungen mehr zwischen dem beliehenen Unternehmen und<br />
<strong>der</strong> Kommune.<br />
Der Beliehene erhebt entwe<strong>der</strong> Gebühren o<strong>der</strong> privatrechtliche Entgelte. In jedem Fall bleibt <strong>der</strong> Beliehene an die<br />
Grundsätze gebunden, die auch für die Entgeltgestaltung <strong>der</strong> Kommune gelten.<br />
3.3 Abgrenzung<br />
Die Einschaltung externer Verwaltungshelfer ist gegenüber dem Beliehenen abzugrenzen.<br />
Beliehene sind Privatpersonen (natürliche Personen o<strong>der</strong> juristische Personen des Privatrechts), die mit <strong>der</strong> hoheitlichen Wahrnehmung<br />
bestimmter Verwaltungsaufgaben im eigenen Namen betraut sind. Mit Verwaltungshelfern haben sie zwar den<br />
Beweggrund ihrer Verwendung gemeinsam: In beiden Fällen geht es darum, dass sich <strong>der</strong> Staat (Bund, Län<strong>der</strong>, Gemeinden<br />
und Gemeindeverbände) die Sachkunde, die Initiative und die Interessen von Privaten nutzbar machen und damit zugleich<br />
den eigenen Verwaltungsapparat entlasten will. Jedoch weist die Beleihung zum Einsatz eines Verwaltungshelfers einige<br />
Unterschiede auf:<br />
■ Als Übertragung von Hoheitsrechten darf die Beleihung nur durch Gesetz o<strong>der</strong> aufgrund eines Gesetzes erfolgen; sie<br />
bedarf mithin einer gesetzlichen Ermächtigung.<br />
■ Der Beliehene ist Hoheitsträger. Er ist Behörde iSd § 1 Abs. 4 VwVfG und kann im Rahmen seiner Zuständigkeit<br />
Verwaltungsakte erlassen, Gebühren erheben und sonstige hoheitliche Maßnahmen treffen.<br />
Damit unterscheidet sich die Beleihung von <strong>der</strong> Heranziehung externer Verwaltungshelfer dadurch, dass <strong>der</strong> Verwaltungshelfer<br />
nur in vorbereiten<strong>der</strong> und unterstützen<strong>der</strong> Funktion herangezogen wird, während dem Beliehenen Verwaltungsaufgaben<br />
zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung in eigener Kompetenz und in eigenem Namen übertragen sind.<br />
4. Anfor<strong>der</strong>ungen an die vertragliche Übertragung auf Dritte<br />
Wenn die Kommune die Durchführung einer öffentlichen Aufgabe auf Private überträgt, dann sind konkrete Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an die vertragliche Übertragung auf Dritte zu stellen.<br />
Erfor<strong>der</strong>lich sind:<br />
a) Klare Abgrenzung von Leistung und Gegenleistung:<br />
Eine vertragliche Festlegung <strong>der</strong> Aufgabenwahrnehmung durch Dritte über Jahre hinaus entzieht den Vertragsgegenstand<br />
<strong>der</strong> direkten Einflussnahme <strong>der</strong> Gemeinde. Aus diesem Grunde kommt <strong>der</strong> akribischen Abgrenzung des<br />
Leistungsumfangs, <strong>der</strong> Einflussmöglichkeiten <strong>der</strong> Gemeinde durch Abstimmungen während <strong>der</strong> Laufzeit, <strong>der</strong> Kündigungsmodalitäten<br />
bei Nichterfüllung des Vertrages und <strong>der</strong> Preisabsprache, insbeson<strong>der</strong>e wenn Preisanpassungen<br />
vereinbart werden, höchste Bedeutung zu.<br />
b) Kontrolle durch Ausschreibung <strong>der</strong> Leistungen:<br />
Wenn die Gemeinde eine durch sie wahrzunehmende Aufgabe per Vertrag überträgt, muss sie sicherstellen, dass die<br />
Flexibilität bei <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong> Aufgabe erhalten bleibt. Die Vertragsdauer muss daher so überschaubar sein,<br />
dass sich än<strong>der</strong>nde Umweltbedingungen Berücksichtigung finden können. Hierbei sind sowohl eigene Rahmenbedingungen,<br />
z.B. die Entwicklung <strong>der</strong> finanziellen Situation <strong>der</strong> Gemeinde, als auch äußere Einflüsse, z.B. Prognose<br />
<strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ungszahlen für den Bereich <strong>der</strong> Unterbringung von Spätaussiedlern o<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen<br />
bei den Nachfragegewohnheiten <strong>der</strong> Bürger in Bezug auf bestimmte kommunale Dienstleistungen, zu berücksichtigen.<br />
Zum zweiten sichern kürzere Vertragslaufzeiten die Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Aufgabenwahrnehmung, weil eine<br />
Überprüfung am Markt durchgeführt wird.<br />
Vertragslaufzeiten sollten daher den planbaren Zeitraum (etwa Zeitraum des mittelfristigen Investitionsprogramms)<br />
nicht überschreiten und in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Aufgabe nach Möglichkeit kürzer sein.<br />
Das lässt sich beim Betriebsführungsmodell zwar verwirklichen, beim Betreiber- bzw. Kooperationsmodell dagegen<br />
nicht. Hier sind 20-jährige Verträge die Regel.<br />
c) Sicherung <strong>der</strong> Kontinuität <strong>der</strong> Aufgabenwahrnehmung:<br />
Wenn eine Aufgabe auf Dritte übertragen wird, kann die Gemeinde in <strong>der</strong> Regel personelle Kapazitäten für Notfälle<br />
nicht vorhalten. Im Interesse <strong>der</strong> Bürgerschaft muss daher bei bestimmten Leistungen beson<strong>der</strong>es Gewicht auf die<br />
Sicherheit bei <strong>der</strong> Erledigung gelegt werden. Diese Grundgedanken, die auch in den Vergabevorschriften von VOB<br />
und VOL ihren Nie<strong>der</strong>schlag finden, können umgesetzt werden durch die Vereinbarung von Sicherheitsleistungen für<br />
den Fall <strong>der</strong> Nichterfüllung des Vertrages o<strong>der</strong> durch eine angemessene personelle Einflussnahme.<br />
5. Ausschreibungspflicht <strong>der</strong> Gebietskörperschaft bei <strong>der</strong> Beauftragung Dritter<br />
5.1 Ausschreibungspflicht bei Beauftragung<br />
Es besteht grundsätzlich die Ausschreibungspflicht bei Beauftragung eines Dritten nach VOL/A.
5.2 Keine Ausschreibungspflicht bei <strong>der</strong> Beauftragung<br />
■ eines Eigenbetriebs, denn dieser besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit und ist somit mit <strong>der</strong> Gebietskörperschaft<br />
rechtlich identisch;<br />
■ einer Eigengesellschaft (kommunale Anteile 100 %). Es handelt sich um ein sog. Inhouse-Geschäft. Ob die Auftragsvergabe<br />
an eine Beteiligungsgesellschaft ein sog. Inhause-Geschäft darstellt, ist umstritten.<br />
5.3 Auswahl eines Mitgesellschafters<br />
Die Auswahl des privaten Mitgesellschafters sollte im Wettbewerb erfolgen. Auszuschreiben ist <strong>der</strong> Leistungsbereich <strong>der</strong><br />
von <strong>der</strong> Gesellschaft zu erledigenden Aufgaben sowie die Leistungen, die <strong>der</strong> Private einzubringen hat.<br />
6. Probleme bei einer funktionalen <strong>Privatisierung</strong><br />
Es hat sich häufig gezeigt, dass bei <strong>der</strong> Übertragung öffentlicher Dienstleistungen auf Private, bei Fortbestand <strong>der</strong> staatlichen<br />
Aufgabenhoheit, <strong>der</strong> öffentliche Auftraggeber im Laufe <strong>der</strong> privaten Leistungserstellung immer stärker in Abhängigkeit von<br />
diesem gerät. Der private Auftragnehmer hingegen wird in eine vor Konkurrenz weitgehend geschützte Position versetzt<br />
und erlangt so die Position eines regionalen Monopols. Dies kann sich als wettbewerbshemmend erweisen. Je länger die<br />
Vertragsdauer ist, je seltener also eine Neuausschreibung <strong>der</strong> Dienstleistung erfolgt, desto weniger kann das Vertragsverhältnis<br />
als Ausdruck aktueller Marktverhältnisse dienen. Dieser Mangel an Wettbewerb während <strong>der</strong> Laufzeit eines Vertrages<br />
führt nun entwe<strong>der</strong> dazu, dass kostensparende Verfahren erst gar nicht angewendet werden o<strong>der</strong> diese nicht zu Preissenkungen<br />
führen, da die Preise ja vertraglich festgelegt sind. Aufgrund dieser über viele Jahre gegebenen Preisgarantie<br />
muss <strong>der</strong> öffentliche Auftraggeber zusehen, wie die Rationalisierungseffekte einseitig den privaten Unternehmen zugute<br />
kommen.<br />
Weiter kann man festhalten, dass die Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten <strong>der</strong> Kommunen bei vielen <strong>Privatisierung</strong>smodellen<br />
unzureichend sind und die Risiken für Investitionen und Preisgestaltung kaum abschätzbar sind. Das kann dazu führen,<br />
dass sich letztlich die Qualität <strong>der</strong> Leistung verschlechtert und die Gebühren steigen. Bedenklich ist dies vor allem deshalb,<br />
weil die Kommunen gegenüber dem Bürger und Gebührenzahler weiterhin verantwortlich sind. Das gilt sowohl für<br />
die ordnungsgemäße als auch für die wirtschaftliche Erfüllung <strong>der</strong> öffentlichen Aufgabe.<br />
Daneben ist zu beachten, dass, sofern <strong>der</strong> Privatunternehmer in Insolvenz geht, die Kommune die von diesem bis dahin<br />
erbrachten Leistungen wie<strong>der</strong> übernehmen muss, gleichgültig, ob sie finanziell o<strong>der</strong> personell zu diesem Zeitpunkt darauf<br />
eingerichtet ist o<strong>der</strong> nicht. Die öffentliche Hand muss die Entsorgungssicherheit in jedem Fall sicherstellen.<br />
Das vorliegende Faltblatt ist Teil einer Loseblattsammlung, die laufend ergänzt wird. Die systematische Übersicht und weitere Faltblätter erhalten Sie auf Anfrage.<br />
Stand: Juli 2004