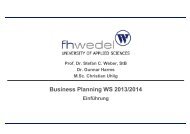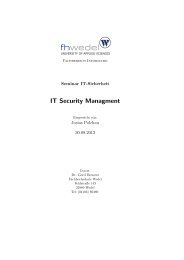Aktuelles (PDF) - FH Wedel
Aktuelles (PDF) - FH Wedel
Aktuelles (PDF) - FH Wedel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Aktuelles</strong><br />
Studium light?<br />
Duale Studienmodelle<br />
Mit dem Wechsel auf ein gestuftes<br />
Studiensystem und die Abschlüsse<br />
Bachelor und Master hat sich das<br />
Hochschulangebot in Deutschland<br />
weiter differenziert. Aber nicht nur<br />
das fachliche Angebot hat sich erweitert<br />
und ist spezieller geworden,<br />
auch die Vielfalt der Studienmodelle<br />
wächst.<br />
Neben dem klassischen Vollzeit- und Teilzeitstudium<br />
gibt es inzwischen diverse<br />
Angebote, die stärker auf die Anforderungen<br />
bestimmter Lebenslagen eingehen<br />
- seien es Berufstätige, Rentner oder<br />
Reisende. Obwohl die Nachteile dualer<br />
Studienmodelle offensichtlich sind, verzeichnen<br />
sie den größten Zuwachs.<br />
Während Vollzeitstudierende nach ihren<br />
lästigen Schulpflichten trotz hoher Studienanforderungen<br />
die erlangte Freiheit<br />
genießen, unterwerfen sich dual Studierende<br />
den geregelten Arbeits- und<br />
Urlaubszeiten, definierten Geschäftsabläufen<br />
und Hierarchien eines Unternehmens.<br />
Anstatt den Eltern schulden sie<br />
nun dem Abteilungsleiter Rechenschaft.<br />
Als Hochschule sieht man sich den fachlichen<br />
Wünschen und mitunter auch dem<br />
Druck der Wirtschaft ausgesetzt. Wenn<br />
nach sieben Semestern plötzlich der<br />
Abschluss des zukünftigen Mitarbeiters<br />
in Gefahr ist, kommt der Anruf des Geschäftsführers<br />
an die Hochschulleitung<br />
prompt. Auch gibt es keine Garantie,<br />
dass der auserwählte Schüler statt Wirtschaftsinformatik<br />
nicht plötzlich doch<br />
Medizin oder Jura studieren möchte. Der<br />
Anspruch auf die Rückzahlung der Studiengebühren<br />
ist dann vor Gericht kaum<br />
durchsetzbar.<br />
Was also ist an einem dualen Modell so<br />
attraktiv? Warum werden duale Studienmodelle<br />
von einer stetig wachsenden<br />
Anzahl von Hochschulen angeboten?<br />
Neben den genannten Nachteilen gibt es<br />
auch Vorteile. Während Vollzeitstudie-<br />
42<br />
rende mitunter einen Studienkredit aufnehmen<br />
müssen, können Studierende<br />
eines dualen Studienganges schon während<br />
des Studiums Geld verdienen.<br />
Manchmal erlangen sie neben dem Bachelor-<br />
noch einen anerkannten Berufsabschluss.<br />
Bewerber, die noch zwischen<br />
Ausbildung und Studium schwanken,<br />
schlagen dann zwei Fliegen mit einer Klappe.<br />
Die Interessenslage der Bewerber bietet<br />
den Hochschulen wiederum die Möglichkeit,<br />
Kunden zu gewinnen. Für private<br />
Hochschulen ist dies wichtig und so finden<br />
sich unter den Anbietern dualer<br />
Studiengänge besonders viele private<br />
Hochschulen. Dass zahlungsfähige Unternehmen<br />
für die Studiengebühren aufkommen,<br />
macht das Modell noch attraktiver.<br />
Unternehmen können sich der Konkurrenz<br />
im Kampf um den besten Absolventen<br />
entziehen. Nicht erst der Studierende<br />
sondern schon der Schüler wird<br />
an das Unternehmen gebunden.<br />
In Zeiten des Fachkräftemangels erscheint<br />
der Druck auf die Unternehmen so groß,<br />
dass die Vorteile die Nachteile überwiegen.<br />
Die Unternehmen nehmen das<br />
duale Studienmodell an. Die angebotene<br />
Vergütung und Praxiserfahrung ist für<br />
viele Studieninteressierte sehr attraktiv,<br />
so dass die Unternehmen aus vielen Bewerbungen<br />
auswählen können. Daher<br />
ist auch die <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> dem Ruf der Wirtschaft<br />
gefolgt und hat ein eigenes duales<br />
Studienmodell aufgesetzt. Wir haben<br />
versucht, die bestehenden Nachteile<br />
dadurch zu reduzieren, dass wir das Studium<br />
strecken und Raum für eine studienbegleitende<br />
Werkstudententätigkeit<br />
schaffen. Dies bringt einige Vorteile mit<br />
sich.<br />
Durch die studienbegleitende Tätigkeit ist<br />
der Studierende im Unternehmen konstant<br />
verfügbar. Aufgaben bleiben nicht<br />
unvollendet liegen. Zudem ist der Studierende<br />
dann verfügbar, wenn er be-<br />
reits mehr leisten kann - also in den<br />
höheren Semestern. Für die Unternehmen<br />
haben wir das Risiko einer Fehlinvestition<br />
verringert, indem die Gebühren<br />
wachsen. Je verlässlicher und wertvoller<br />
der Studierende für das Unternehmen<br />
wird, desto teurer wird er auch. Der<br />
Studierende profitiert bereits dadurch,<br />
dass die <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> ein Vollzeitstudium<br />
anbietet. Wenn der Studierende doch<br />
nicht ins Unternehmen passt, so kann<br />
der Studierende problemlos in das Vollzeitstudium<br />
wechseln.<br />
Mit der Verschränkung von dualem Studienmodell<br />
und Vollzeitmodell schwindet<br />
gleichzeitig der Druck, welchen Unternehmen<br />
auf die Hochschule ausüben<br />
könnten. Dual Studierende sind für die<br />
Lehrenden nicht von den Vollzeitstudierenden<br />
zu unterscheiden. Das Abschlussniveau<br />
wird für dual Studierende<br />
nicht abgesenkt. Allerdings schulden die<br />
Studierenden dem Unternehmen weiterhin<br />
Rechenschaft. Vielleicht sogar<br />
mehr als in anderen Modellen. Unser<br />
Modell kommt nicht ohne einen intensiven<br />
Dialog und Abstimmung aus.<br />
Schlecht finden wir aber auch das nicht.<br />
Mit der Einführung des dualen Studienmodells<br />
haben wir auf die differenzierten<br />
Anforderungen der Studieninteressierten<br />
und der Wirtschaft reagiert. Sicherlich<br />
erfüllt auch unser Modell nicht<br />
die Wünsche aller und wahrscheinlich<br />
werden wir unser Modell weiterentwikkeln<br />
und um andere Studienmodelle ergänzen<br />
müssen. Unsere ersten Erfahrungen<br />
belegen jedoch, dass unser Modell<br />
gut angenommen wird und die Vorteile<br />
des Modells anerkannt werden. Die ersten<br />
Absolventen des dualen Modells<br />
werden wir wohl in drei Jahren feiern<br />
können.<br />
Prof. Dr. Eike Harms
Das ist Deine Chance<br />
Erlebe die Praxis hautnah. Beim Trial Day „SAP Development“.<br />
Erlebe einen typischen Tag in der SAP-Produktentwicklung. Du hast Kontakt zu anderen Spezialisten, lernst die<br />
Werkzeuge kennen und wirst eine einfache Web-Anwendung entwickeln. Zusätzlich können wir gerne über Deine<br />
Karrieremöglichkeiten bei Implico sprechen.<br />
Wir bieten Studenten und Absolventen der Softwaretechnik und Wirtschaftsinformatik Top-Perspektiven als Entwickler<br />
im ABAP OO und WebDynpro-Umfeld. Für den Trial Day brauchst Du keine Vorkenntnisse in SAP oder ABAP! Du<br />
solltest aber gutes Verständnis für objektorientierte Programmierung und Erfahrung mit Datenbanken und SQL haben.<br />
Lerne unverbindlich das Berufsbild eines SAP-Entwicklers kennen – informell und praxisnah.<br />
Baue Kontakt auf zu einem innovativen, erfolgreichen und internationalen Beratungs- und Softwarehaus in Hamburg.<br />
Und erhalte eine aussagekräftige Teilnahmebescheinigung, die Dir auch bei späteren Bewerbungen hilft.<br />
Interesse? Jetzt Termin vereinbaren. Deine Ansprechpartnerin ist Elisabeth Machel, trial_day@implico.com.<br />
Oder telefonisch unter 040/27 09 36-0. Weitere Informationen unter www.implico.de/trial_day<br />
www.implico.com
<strong>Aktuelles</strong><br />
Stipendienprogramm der Otto Group an der <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong>:<br />
Erfahrungen, Erlebnisse, Erfolge<br />
Seit 2009 bietet die Otto Group an<br />
der Fachhochschule <strong>Wedel</strong> bis zu<br />
acht Kandidaten pro Jahr die Möglichkeit,<br />
in einem Stipendienprogramm<br />
eine gezielte und intensive<br />
Förderung zu erhalten.<br />
Nachdem der erste Teilnehmer im Frühjahr<br />
2012 seinen Bachelor-Abschluss in<br />
der Tasche hatte, befanden sich die restlichen<br />
Kandidaten der ersten Stunde in<br />
ihrem letzten Semester bei der Otto<br />
Group und konnten von ihren Erfahrungen<br />
mit dem Stipendienprogramm berichten.<br />
Den besonderen Reiz des Stipendienprogramms<br />
bilden über das Studium hinausgehende<br />
Praxis-Angebote. In der Hamburger<br />
Konzernzentrale der Otto Group<br />
werden neben zwei Praktikumssemestern<br />
zum Beispiel Fallstudien, Seminare<br />
und Diskussionsrunden mit Führungskräften<br />
angeboten. 123 wesentliche Unternehmen<br />
der Otto Group in 20 Ländern<br />
Europas, Nordamerikas und Asiens bilden<br />
ein spannendes Netzwerk für Innovationen<br />
in den Bereichen IT- und E-Commerce.<br />
Die Stipendiaten Marcel Portofoé,<br />
Janina Baran, Fabian Hoffmann und<br />
Benjamin Böge blicken positiv auf ihre<br />
Praxis-Erfahrungen im Konzern zurück.<br />
Marcel Portofoé, 23, Otto Group - Stipendiat<br />
der Medieninformatik, schrieb<br />
an seiner Thesis zum Thema Customer-<br />
Journey Analyse. Er möchte später beruflich<br />
genau die innovativen E-Commerce<br />
Konzepte umsetzen, die er im Rahmen<br />
seiner Arbeit entwickelt hat. Den<br />
Einstieg bei der Otto Group nach Beendigung<br />
des Studiums konnte er sich<br />
daher sehr gut vorstellen. „Ich hatte<br />
schon frühzeitig das Gefühl, dass man<br />
als Absolvent der <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> am Arbeitsmarkt<br />
sehr gefragt ist. Daher habe ich<br />
keine Angst nach dem Studium keinen<br />
Anschluss an das Berufsleben zu finden“,<br />
erzählte Portofoé. Besonders beeindruckt<br />
hat ihn, dass er trotz seiner individuellen<br />
44<br />
Vorstellungen einen thematisch passenden<br />
Fachbereich für seine Praxisphase<br />
gefunden hat. „Das spricht auf jeden Fall<br />
für die vielen Karriere-Möglichkeiten, die<br />
man in einem Konzern wie der Otto<br />
Group hat. Sich dabei ein wenig selbst<br />
auszuprobieren gehört auch dazu und<br />
ist kein Problem. Besser kann ein Übergang<br />
in das Berufsleben nicht aussehen“,<br />
ist er sich sicher.<br />
Daher empfiehlt Portofoé das Stipendienprogramm<br />
auch uneingeschränkt weiter:<br />
„Studenten beziehungsweise angehende<br />
Studenten haben häufig eine sehr<br />
straffe finanzielle Situation zu meistern.<br />
Unternehmenskooperationen wie diese<br />
helfen dann dabei, sich ein wenig mehr<br />
auf das Wesentliche zu konzentrieren.<br />
Zugleich ist es ein gutes Gefühl, das Gelernte<br />
in die Praxisphasen einbringen und<br />
anwenden zu können. Das gibt mir eine<br />
völlig andere Form von Bestätigung bzw.<br />
Motivation als es reine Klausurnoten können.<br />
Nicht zu vergessen sind auch das<br />
sehr angenehme Arbeitsklima und die<br />
vielen netten Kollegen – ich habe mich<br />
schnell wohl gefühlt und habe viel Spaß<br />
bei der Arbeit gehabt.“<br />
Unterstützung: Fachlich und<br />
finanziell<br />
Janina Baran, 22, Otto Group Stipendiatin<br />
der Wirtschaftsinformatik, empfindet<br />
vor allem den Mix aus fachlicher und<br />
finanzieller Unterstützung während des<br />
Studiums als besonderes Highlight. Im<br />
Rahmen des Stipendien-Programms<br />
übernimmt die Otto Group für ihre Stipendiaten<br />
die Studiengebühren ab dem<br />
Semester der Bewerbung und vergütet<br />
die beiden sechsmonatigen Praxisphasen<br />
in der Hamburger Konzernzentrale mit<br />
einem monatlichen Entgelt. „Im Praxiseinsatz<br />
konnte ich wichtige Kontakte für<br />
das Arbeitsleben knüpfen und habe gemerkt,<br />
dass die Arbeit bei Otto riesig<br />
Spaß macht. Das klingt abgedroschen,<br />
stimmt aber wirklich. Denn durch die extra<br />
Praxisphase von 6 Monaten habe ich<br />
die wahre Arbeitswelt erst so richtig kennen<br />
gelernt.“<br />
Neben den Praxisphasen kennzeichnet<br />
das Stipendienprogramm die inhaltliche<br />
Unterstützung durch spezielle Seminarangebote<br />
wie zum Beispiel die Vermittlung<br />
von Methodenkompetenzen. Baran<br />
schwärmt von den Fachvorträgen,<br />
die speziell für Praktikanten angeboten<br />
werden. Auch das Thema Netzwerk hat<br />
bei ihr einen wichtigen Stellenwert. „Womit<br />
ich wirklich nicht gerechnet hätte<br />
ist der Zusammenhalt und die Organisation<br />
der Praktikanten bei Otto. Regelmäßig<br />
gibt es After-Work-Events und<br />
Praktikanten-Essen.“<br />
Fabian Hoffmann, 23, Otto Group Stipendiat<br />
der Informatik, ist ein echter Fan der<br />
Verknüpfung von Fachwissen und Praxis:<br />
„Das Besondere daran ist, dass neben der<br />
fundierten theoretischen Ausbildung an<br />
der <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> der zweite wichtige Bereich<br />
der Praxis einen höheren Stellenwert im<br />
Studium bekommt und so erste Erfahrung<br />
im Berufsleben gesammelt werden<br />
können.“<br />
Während seiner Praxisphase fühlte sich<br />
Hoffmann dann auch bestens in seinen<br />
Bereich integriert und hatte das Gefühl,<br />
nicht nur oberflächliche Tagesthemen zu<br />
bearbeiten, sondern als vollwertiges<br />
Teammitglied einen tiefen Einblick in Pro-
jekte, Aufgabenstellungen und interne<br />
Abläufe zu erhalten. „Ich würde diese<br />
Kooperation mit der Otto Group empfehlen,<br />
weil Einblicke in große Konzerne<br />
wie Otto schon während des Studiums<br />
einen erheblichen Erfahrungsgewinn ermöglichen.<br />
So kann man beispielsweise<br />
schon für später den Boden für den<br />
Berufseinstieg bereiten. Zudem ist die<br />
Unterstützung seitens des Unternehmens<br />
sehr gut!“<br />
Benjamin Böge, 23, Stipendiat der<br />
Medieninformatik, sieht seine berufliche<br />
Perspektive auf jeden Fall im Bereich E-<br />
Commerce: „Durch den Praktikumseinsatz<br />
bei Otto habe ich zum ersten Mal<br />
Kontakt zum E-Commerce bekommen<br />
und festgestellt, dass in diesem Bereich<br />
meine Fähigkeiten als Medieninformatiker<br />
sehr gut einsetzbar sind. Im Masterstudium<br />
möchte ich deshalb meinen<br />
Schwerpunkt auf E-Commerce legen<br />
und sehe dort auch längerfristig meine<br />
berufliche Zukunft.“<br />
Besonders beeindruckt hat Böge, wie<br />
viel Vertrauen Otto den ausgewählten<br />
Studenten entgegenbringt: „Otto investiert<br />
sehr viel in die Stipendiaten, geht<br />
auf individuelle Wünsche ein und versucht<br />
immer eine Lösung im Sinne des<br />
Stipendiaten zu finden. Dabei verzichtet<br />
Otto aber auf eine verpflichtende längere<br />
Bindung der Stipendiaten an das<br />
Unternehmen über das Studium hinaus,<br />
sondern überzeugt durch die angebotenen<br />
Leistungen von seinen Qualitäten<br />
als Arbeitgeber.“<br />
Für ihn liegen die Kooperationsvorteile<br />
auf der Hand: „Otto übernimmt die Studiengebühren<br />
und ich brauche mir keine<br />
Gedanken mehr über die Finanzierung<br />
des Studiums oder über Studiengebührenerhöhungen<br />
zu machen. So kann ich<br />
gegebenenfalls auch auf Nebenjobs verzichten<br />
und mich voll auf das Studium<br />
konzentrieren. Darüber hinaus kann ich<br />
schon während des Studiums praktische<br />
Erfahrungen sammeln und mich im Ausblick<br />
auf meine berufliche Zukunft orientieren.<br />
Otto bietet dabei so viele verschiedene,<br />
spannende Abteilungen, dass<br />
jeder einen für sich passenden Einsatzbereich<br />
finden müsste.“<br />
Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer/<br />
innen des Otto Group Stipendienprogramms<br />
Unterstützung durch eine Personalmarketing-Referentin,<br />
die während<br />
des Studiums ihre persönliche Ansprechpartnerin<br />
ist.<br />
Foto: Stehend v.l.n.r die Stipendiaten: Janina Baran, Johannes Behr, Thiemo<br />
Alldieck, Fabian Hoffmann, Alexander Schwank, Marcel Portofoé, Benjamin Böge<br />
und sitzend Lena Schiwek, Personalmarketing<br />
<strong>Aktuelles</strong><br />
<strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong>: Interesse von<br />
Firmen groß<br />
2010 erkannten die Firmen innovas und<br />
Bit-Serv das Potential derartiger Kooperationen<br />
und nehmen seitdem wie die<br />
Otto Group jährlich Kandidaten in ein Stipendienprogramm<br />
auf. Schon vor den<br />
Praxisphasen haben hier mehrere Teilnehmer<br />
die Chance genutzt, in der vorlesungsfreien<br />
Zeit oder auch studienbegleitend<br />
als Werkstudent in der Firma<br />
tätig zu sein und so praktische Erfahrungen<br />
zu sammeln. Die ersten von innovas<br />
aufgenommenen Stipendiaten sind bereits<br />
in ihr Arbeitsleben bei innovas gestartet.<br />
2011 stieg als weiterer Stipendiengeber<br />
Hapag-Lloyd ein, 2012 kam<br />
die ICANS GmbH dazu. Hapag-Lloyd verzichtet<br />
auf eine sechsmonatige Praxisphase<br />
vor der Thesis, sondern bindet die<br />
Stipendiaten von der Aufnahme in das<br />
Stipendienprogramm an als Werkstudenten<br />
in ihr Unternehmen ein.<br />
Im vergangenen Jahr wurden 21 Studenten<br />
in ein Stipendienprogramm aufgenommen.<br />
Alle wurden sehr warmherzig<br />
in ihrer Firma empfangen, so dass sie<br />
sich nach den allseitig positiven Erfahrungen<br />
ihrer Vorgänger auf ihre Praxiseinsätze<br />
freuen.<br />
45
<strong>Aktuelles</strong><br />
LüttIng-Projekt:<br />
Wir bauen einen 3-D-Drucker<br />
An der Fachhochschule <strong>Wedel</strong> wurde<br />
ein von der Innovationsstiftung<br />
Schleswig-Holstein (ISH) und der<br />
Stiftung Nordmetall gefördertes Projekt<br />
durchgeführt, in dessen Rahmen<br />
Schüler für Technik begeistert werden<br />
sollen. Nachdem das Projekt erfolgreich<br />
zu Ende ging, ist es an der<br />
Zeit, eine Bilanz zu ziehen.<br />
Vorgeschichte<br />
Im Frühjahr 2010 schrieb die ISH zum<br />
zweiten Mal mehrere LüttIng-Schüler-Akademien<br />
aus. „LüttIng“ steht für „kleine<br />
Ingenieure“ und ist gleichzeitig eine Fördermaßnahme<br />
mit dem Ziel, Schüler durch<br />
Mitarbeit an einem möglichst realitätsnahen<br />
Entwicklungsprojekt für technische<br />
Problemstellungen und eventuell ein anschließendes<br />
Studium einer technischen<br />
Disziplin oder Ausbildung in einem technischen<br />
Beruf zu begeistern. Voraussetzung<br />
für die Förderung ist eine Projektdurchführung<br />
in Kooperation zwischen einer<br />
Schule (Berufsschule, Realschule oder<br />
Gymnasium), einer Hochschule und einem<br />
Unternehmen aus der Region.<br />
Bezuschusst wurden dabei Sach-, Personal-<br />
und Reisekosten. Die Fachhochschule<br />
<strong>Wedel</strong> hat sich um eine Akademie<br />
beworben und nach einer Projektvorstellung<br />
in Kiel gegen andere Mitbewerber<br />
durchsetzen können (von zehn<br />
Anträgen wurden fünf ausgewählt und<br />
bewilligt) und im Mai 2010 eine Zusage<br />
erhalten. Seit Beginn des Schuljahres<br />
2010/2011 war die LüttIng-Schüler-Akademie<br />
„3D-Drucker“ an der <strong>FH</strong> beheimatet.<br />
Projektpartner<br />
Als Projektpartner standen der Fachhochschule<br />
das Johann-Rist-Gymnasium (JRG)<br />
und die tematik GmbH zur Seite. Mit beiden<br />
Einrichtungen ist die <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> durch<br />
bestehende langjährige Kooperationen<br />
verbunden. Weiterhin lässt sich der Kommunikationsaufwand<br />
durch die örtliche<br />
Nähe minimal halten. Elf Oberstufen-Schü-<br />
46<br />
ler (Physik-Profil) haben fast jeden Freitag<br />
gemeinsam mit den Mitarbeitern der<br />
<strong>FH</strong> und tematik GmbH an dem Projekt<br />
gearbeitet. Von der Seite der Fachhochschule<br />
hat Dieter Opitz die Hauptlast bei<br />
der Betreuung der Teilnehmer, aber auch<br />
bei der Bestellabwicklung und sonstigen<br />
dazugehörenden Alltagsaufgaben getragen.<br />
<strong>FH</strong>-Mitarbeiter Timm Bostelmann steuerte<br />
häufig Software-Know-How und<br />
Betreuungskapazitäten bei. Die Konstruktionsarbeiten<br />
wurden weitestgehend<br />
vom Geschäftsführer der tematik GmbH<br />
Jörg Völker überwacht. Fast jeden Freitagnachmittag<br />
war er bei den Projekt-<br />
Treffen dabei und hat oft Komponenten<br />
auf Rechnung von tematik besorgt<br />
und Fertigungsinfrastruktur zur Verfügung<br />
gestellt. Die Dokumentation und<br />
Präsentation des Projektes begleitete<br />
unterstützend Yasmin Kötter von der<br />
Pressestelle der <strong>FH</strong> (auch Fotos zu diesem<br />
Beitrag stammen von ihr). Die Ver-<br />
mittlung theoretischer Grundlagen aus<br />
dem Bereich Maschinenbau - die von den<br />
Schülern im Übrigen mit großer Begeisterung<br />
aufgenommen wurden - übernahm<br />
<strong>FH</strong>-Dozent Prof. Dr. Frank Bargel<br />
[1].<br />
Projektgegenstand<br />
Das ehrgeizige Projektziel bestand in der<br />
Entwicklung eines funktionsfähigen 3D-<br />
Druckers. Abhängig von der eingesetzten<br />
Technologie werden solche Geräte<br />
Ein Teil des LüttIng-Teams beim Jahrestreffen 2011 in Lübeck<br />
auch als 3D-Plotter, Digital Fabricator oder<br />
Fabber bezeichnet. Im Bereich Rapid Prototyping<br />
kommen über ein Dutzend verschiedene<br />
Verfahren zum Einsatz, die sowohl<br />
unterschiedliche technologische<br />
Grundlagen haben als auch sehr unterschiedliche<br />
Ausgangsstoffe verwenden:<br />
Die Palette reicht von Beton über Kunststoff<br />
und Keramik bis hin zum Kunstharz<br />
[2,3]. Preislich bewegen sich die meisten<br />
industriell erhältlichen Geräte im<br />
fünf- bis sechsstelligen Bereich. Der in-
zwischen deutlich wahrzunehmende<br />
Trend liegt jedoch in der Öffnung des<br />
Marktes für Kleinunternehmen und sogar<br />
Privatpersonen, den einige Fachleute<br />
als ebenso revolutionär wie den einstigen<br />
Übergang von Großrechnern zu<br />
PCs erachten [4]. So gab es in den letzten<br />
vier Jahren einige Unternehmensgründungen,<br />
die mit wesentlich weniger<br />
kostenintensiven Fabbern werben<br />
[5,6]. Diese werden dann als Bausätze<br />
für „nur“ 1500 bis 2000 Euro vertrieben.<br />
Vor der Inbetriebnahme muss das entsprechende<br />
Gerät in mühsamer Kleinarbeit<br />
zusammengebaut werden, was einiges<br />
an technisch-handwerklichem Geschick<br />
voraussetzt. Dennoch sind die<br />
meisten Anwender hellauf begeistert,<br />
wenn sie ihren ersten selbstgefertigten<br />
Gegenstand in den Händen halten. Das<br />
ist Grund genug, einmal zu schauen, ob<br />
man mit einem motivierten Team und<br />
preiswerten Hilfsmitteln nicht auch selbst<br />
in der Lage wäre, einen Fabber zu bauen.<br />
„Rapid Prototyping in a<br />
Nutshell“ oder:<br />
Technologische Grundlagen<br />
Viele Prototyping-Verfahren schieden<br />
bereits in der Projekt-Planungsphase aus<br />
Kosten- oder Kapazitätsgründen aus. So<br />
kann man mit Lasersintern oder Stereolithographie<br />
(Verfahren zum Verschmelzen<br />
von pulverförmigem Ausgangsmaterial<br />
beziehungsweise zum Aushärten eines<br />
lichtempfindlichen flüssigen Kunststoffes<br />
mit Hilfe eines Laserstrahls) zwar<br />
sehr feinstrukturierte und eindrucksvolle<br />
Objekte erzeugen, jedoch erschien es<br />
aussichtslos, ein solches Verfahren im Rahmen<br />
eines Schülerprojektes umzusetzen.<br />
Letztendlich kamen zwei der preiswerteren<br />
Technologien in Betracht, die unter<br />
den Bezeichnungen FDM (fused deposition<br />
modelling, Schmelzschichtung)<br />
und LOM (laminated object modelling,<br />
Klebeschichttechnik) bekannt sind [2].<br />
Beide Verfahren basieren auf dem Prinzip<br />
des schrittweisen Aufbaus eines dreidimensionalen<br />
Objektes aus dünnen<br />
Scheiben, die Schicht für Schicht aufeinander<br />
gestapelt werden.<br />
Bei FDM dient als Ausgangsmaterial ein<br />
durch Erhitzen verflüssigter Kunststoff,<br />
der durch eine Düse auf eine Grundlage<br />
(Arbeitsfläche oder bereits erzeugtes<br />
Teil des Modells) aufgetragen wird und<br />
anschließend schnell erhärtet. Bei LOM<br />
werden die Schichten aus Papier geschnitten<br />
und zusammengeklebt, wobei<br />
es auch Variationen des Verfahrens gibt,<br />
die mit Kunststoff oder Metall arbeiten.<br />
Beide Technologien haben ihre Vor- und<br />
Nachteile, maßgebend für die Entscheidung<br />
zugunsten der Papierklebetechnik<br />
war jedoch die Tatsache, dass man ohne<br />
Temperaturen von 150-200 Grad auskommt<br />
und mit Papier einen preislich<br />
schwer zu unterbietenden Ausgangsstoff<br />
hat.<br />
Aufbau:<br />
Probleme und Lösungen<br />
Grundlegendes Funktionsprinzip des <strong>Wedel</strong>er<br />
Plotters besteht in linearer Ansteuerung<br />
eines Schlittens, der zunächst<br />
in zwei Dimensionen bewegt werden<br />
kann (sogenannte X-Y-Ansteuerung).<br />
Auf dem Schlitten ist ein Schleppmesser<br />
befestigt, das sich automatisch entsprechend<br />
der Bewegungsrichtung ausrichtet<br />
und eine Eindringtiefe hat, die<br />
der Dicke einer Papierschicht entspricht.<br />
Um Verunreinigungen durch den Klebstoff<br />
zu vermeiden, kommt anstelle eines<br />
einfachen Papiers eine Rolle mit<br />
Der 2. Meilenstein des Projekts<br />
selbstklebenden Etiketten zum Einsatz.<br />
Somit ist die Klebekomponente bereits<br />
im Ausgangsmaterial in gebundener Form<br />
enthalten. Die Etiketten werden durch<br />
einen automatischen Vorschub einzeln<br />
abgelöst und gleiten auf einen mechanischen<br />
Ansaugarm, der sie anschließend<br />
auf den Arbeitstisch überträgt, das heißt<br />
auf einen Stapel mit bereits geschnittenen<br />
Konturen aufklebt. Nach dem<br />
Schneiden einer Kontur kann der nächste<br />
Aufkleber abgelöst werden und der<br />
Prozess beginnt von vorn. Hat der Sta-<br />
<strong>Aktuelles</strong><br />
pel eine bestimmte Höhe erreicht, wird<br />
der Arbeitstisch vor dem Aufkleben der<br />
nächsten Schicht durch Herausschieben<br />
einer Platte um einige Millimeter abgesenkt,<br />
das Modell wächst also in dritter<br />
Dimension nach unten.<br />
So komplex das Vorhaben auf den ersten<br />
Blick erscheinen mag, lassen sich<br />
mehrere gut handhabbare Teilprobleme<br />
definieren, die dann mehr oder weniger<br />
unabhängig voneinander gelöst werden<br />
können. Zunächst mussten jedoch einige<br />
Grundsatzfragen geklärt werden:<br />
• Auf welcher Basis soll das Chassis<br />
entstehen?<br />
• Welche Software-Infrastruktur ist<br />
erforderlich und was davon muss<br />
selbst entwickelt werden?<br />
• Wie soll der Linearantrieb realisiert<br />
werden?<br />
• Wie sieht die Steuerungselektronik<br />
aus?<br />
Die Beantwortung dieser Fragen musste<br />
mit viel Kreativität angegangen werden<br />
und von einigen Lösungen sind die<br />
Beteiligten im Rückblick selbst überrascht.<br />
Der Linearantrieb wurde mit Hilfe<br />
von Schrittmotoren, die einen auf<br />
Metallschienen befestigten Schlitten<br />
antreiben, realisiert. Gleiche Schienen<br />
kommen bei der Befestigung von Schubfächern<br />
in einem Möbelstück zum Einsatz.<br />
Erstaunlich ist dabei, dass das mechanische<br />
Spiel dieser Anordnung deutlich<br />
unter der als Projektziel angestrebten<br />
Auflösung von 0,5 mm liegt. Der Arbeitstisch<br />
ist aus lasergeschnittenem Sperrholz<br />
aufgebaut, die Konstruktion der einzelnen<br />
Teile erledigte das Schüler-Konstruktionsteam<br />
mit Hilfe einer CAD-Software<br />
nach einer kurzen Einarbeitungsphase<br />
vollkommen eigenständig. Die Fertigung<br />
von Einzelteilen erfolgte bei der<br />
tematik GmbH.<br />
Der zuvor beschriebene Ablauf wird<br />
durch zwei Arduino-Uno-Mikrocontroller-<br />
Boards gesteuert, die sich mittlerweile<br />
als äußerst beliebte Plattform im Open-<br />
Source-Bereich etabliert haben [7]. Um<br />
die Programmierung der Controller kümmerte<br />
sich das Software-Team. Da die<br />
als Ergänzung zum Arduino-Board von der<br />
47
<strong>Aktuelles</strong><br />
Stange erhältlichen Aufsteckkarten zur<br />
Motoransteuerung den Anforderungen<br />
des Projektes nur zum Teil genügten,<br />
mussten LüttIngs auch mit dem Lötkolben<br />
arbeiten, um so die fehlenden Anschlussmöglichkeiten<br />
zu schaffen (vorher<br />
stand natürlich ein sorgfältiges Studium<br />
der Schaltpläne auf dem Programm).<br />
Größere Teile des Chassis konstruierten<br />
die LüttIngs mit Hilfe von Metallbaukästen<br />
- so wie sie in vielen Kinderzimmern<br />
zu finden sind. Gerade in der Konzeptionsphase<br />
hat sich dieser Ansatz als äußerst<br />
produktiv erwiesen, da man relativ<br />
flexibel beim Ausprobieren verschiedener<br />
konstruktiver Lösungen bleibt.<br />
Nach Fertigstellung eines voll funktionsfähigen<br />
Prototyps können diese Teile<br />
durch andere, in industrieüblicher Bauweise<br />
hergestellte, ersetzt werden.<br />
Vorläufige Ergebnisse<br />
Die einzelnen Komponenten - Arbeitstisch<br />
mit Schneidevorrichtung, Papiervorschub<br />
sowie Klebe- und Hebevorrichtung<br />
– sind inzwischen spezifikationsgemäß<br />
zusammengefügt worden. Der entstandene<br />
Prototyp ist in der Lage, mehrere<br />
Papierschichten übereinander zu kleben<br />
und vorgegebene Konturen auszuschneiden.<br />
Über den aktuellen Stand sowie<br />
einige weitere Hintergründe kann man<br />
sich unter www.luetting-wedel.de/<br />
sowie auf Facebook informieren [8].<br />
Durch einige auf diesen Websites eingebundene<br />
Kurzfilme bekommt man einen<br />
Eindruck, wie das Endprodukt einmal<br />
funktionieren wird. Die Materialkosten<br />
für einen Drucker halten sich momentan<br />
unter 200 Euro (eine Etikettenrolle<br />
inklusive), eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz.<br />
Immerhin waren niedrige<br />
Herstellungskosten eine der Hauptzielsetzungen<br />
des Projektes.<br />
Und zu guter Letzt...<br />
Das LüttIng-Programm ist mit der Auflösung<br />
der ISH durch das Land Schleswig-<br />
48<br />
Holstein inzwischen leider eingestellt. Diese<br />
Entscheidung ist ein Teil des gleichen<br />
Sparpakets, dem auch die Landeszuwendung<br />
an die <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> scheibchenweise<br />
zum Opfer fällt. Glücklicherweise wurden<br />
genehmigte LüttIng-Akademien bis zum<br />
Abschluss finanziert, eine erneute Antragstellung<br />
ist jedoch nicht möglich. Das<br />
ist umso bedauerlicher, als eine unabhängige<br />
Studie der Universität Flensburg, die<br />
unter allen aktiven LüttIng-Schüler-Akademien<br />
durchgeführt wurde, eine nahezu<br />
einstimmige positive Bilanz seitens<br />
der Projektbeteiligten dokumentiert [9].<br />
Für die Teilnehmer und Betreuer ist die<br />
<strong>Wedel</strong>er LüttIng-Akademie insgesamt<br />
eine sehr positive und lehrreiche Erfahrung,<br />
auch wenn man aus heutiger Sicht<br />
einige Dinge sicherlich anders geplant<br />
oder umgesetzt haben könnte. Ein großer<br />
Nutzeffekt des Projektes liegt in den<br />
Erfahrungen, auf die bei der Planung und<br />
Durchführung ähnlicher Aktivitäten in<br />
der Zukunft - auch ohne Landeszuwendung<br />
- zurückgegriffen werden kann.<br />
Eine weitere positive Bilanz des Projektes<br />
ist, dass die Fachhochschule drei LüttIngs<br />
zum Wintersemester 2012/2013<br />
als Studenten begrüßen wird. Auch bei<br />
einigen noch nicht entschlossenen Kandidaten<br />
steht die <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> nun auf der<br />
Liste der potentiellen Studienorte. Die<br />
ehemaligen LüttIngs und nunmehr angehenden<br />
Studenten der Technischen<br />
Informatik und des Wirtschaftsingenieurwesens<br />
haben bereits angekündigt, den<br />
Prototypen während des Studiums weiter<br />
entwickeln zu wollen.<br />
Übrigens: Die Teilnahme an der LüttIng-<br />
Akademie wurde den Schülern nicht auf<br />
reguläre Unterrichtsbelastung oder AG-<br />
Beteiligung angerechnet. Die Tatsache,<br />
dass die überwiegende Mehrheit 2 Jahre<br />
„durchgehalten“ hat, spricht eindeutig<br />
für das Projekt und ist ganz maßgeblich<br />
auf das beispiellose Engagement der<br />
<strong>FH</strong>-Mitarbeiter und der tematik GmbH<br />
zurückzuführen. An technischen Details<br />
oder einer Besichtigung des Objekts interessierte<br />
Leser können sich mit dem<br />
Autor in Verbindung setzen oder dem<br />
Bereich Technische Informatik einen<br />
unverbindlichen Besuch abstatten.<br />
Prof. Dr. Sergei Sawitzki<br />
Literatur:<br />
[1] Bargel, Frank: „Unterlagen zur Vorlesung<br />
Wirtschaftliches Fertigen“, Fachhochschule<br />
<strong>Wedel</strong>, Wintersemester<br />
2011/2012<br />
[2] Gebhardt, Andreas: „Generative Fertigungsverfahren<br />
- Rapid Prototyping, Rapid<br />
Tooling, Rapid Manufacturing“, 3. Auflage.<br />
Hanser Verlag, 2007<br />
[3] Elektor: „D-Shape: Gebäude aus dem<br />
3D-Drucker“, www.elektor.de, Nachrichten<br />
vom 23.02.2012<br />
[4] Gershenfeld, Neil: „Fab: The Coming<br />
Revolution on Your Desktop - From Personal<br />
Computers to Personal Fabrication“.<br />
Basic Books, 2007<br />
[5] Lipson, Hod: „Homemade: The Future<br />
of Functional Rapid<br />
Prototyping“. IEEE Spectrum, Mai 2005<br />
[6] Wallich, Paul: „3-D Printers Proliferate“.<br />
IEEE Spectrum, September 2010<br />
[7] Arduino: „Arduino HomePage“. URL:<br />
www.arduino.cc<br />
[8] LüttIng <strong>Wedel</strong> auf Facebook. URL:<br />
www.facebook.com/pages/Lütting-<br />
<strong>Wedel</strong>/269123449805997<br />
[9] Heering, Peter und Kiupel, Michael:<br />
„LüttIng. Ein Förderprogramm von Innovationsstiftung<br />
Schleswig-Holstein und<br />
Nordmetall-Stiftung. Untersuchungen zu<br />
Wirksamkeit und Potenzialen“. Universität<br />
Flensburg, Institut für Physik und<br />
Chemie und ihre Didaktik, 2011
Sommerfest 2011:<br />
Meet and Greek<br />
Ein roter Teppich am Eingang der Fachhochschule,<br />
der sich durch die Gänge bis<br />
in den Innenhof erstreckt. Ein Mann mit<br />
einem Kranz aus Lorbeerblättern auf seinem<br />
Haupt, gehüllt in ein schwarzes Gewand,<br />
wird von vier herkulischen jungen<br />
Männern auf einer Sänfte in den Garten<br />
getragen. Die Menge im Garten jubelt,<br />
einige reiben sich erstaunt die Augen:<br />
Feierlich eröffnet der <strong>FH</strong>-Präsident Prof.<br />
Dr. Eike Harms mit dem Entzünden eines<br />
olympischen Feuers ein rauschendes Sommerfest<br />
2011.<br />
Ein Motto im<br />
Zeichen der Antike<br />
Unter der Leitung von Christian Krug,<br />
langjährigem <strong>FH</strong>-Mitarbeiter mit immer<br />
wieder großartigen Ideen, fand am 28.<br />
Juni 2011 ein Sommerfest der besonderen<br />
Art statt. Zum ersten Mal wurde<br />
das Fest - mit Unterstützung des AStA<br />
e.V., des <strong>Wedel</strong>er Hochschulbund e.V.<br />
und des Hochschulsport <strong>Wedel</strong>-PTL-<br />
Bund e.V. – unter ein besonderes Motto<br />
gestellt: Meet and Greek. Die Feier<br />
sollte ganz im Zeichen des antiken Griechenlands<br />
stehen, fern ab aller aktuellen<br />
Probleme, in dem Kommunikation und<br />
ein fröhliches Miteinander im Vordergrund<br />
stehen.<br />
Sommerfest:<br />
Projektmanagement in der<br />
Praxis<br />
Um dies zu realisieren, startete das Projektteam<br />
bereits zu Beginn des Semesters<br />
mit der Planung. Mit tatkräftiger<br />
Unterstützung einiger Studierender, die<br />
damit gleichzeitig ihre Assistenz ableisteten,<br />
bildeten sich Anfang April drei<br />
Arbeitsgruppen unter der Leitung von<br />
Susanna Bechzidis (Dekoration), Julia<br />
Woiwode (Werbung) und Daniela Fendt<br />
(Einkauf). In wöchentlich stattfindenden<br />
Treffen sammelten die Teams Ideen,<br />
schmiedeten Pläne und setzten diese in<br />
der persönlichen Freizeit um. Neben Treffen<br />
in den jeweiligen Teams setzten sich<br />
der Hauptverantwortliche Christian Krug<br />
und die drei Gruppenleiterinnen regelmäßig<br />
zusammen, um den Status Quo<br />
zu besprechen, aktuelle Probleme zu diskutieren<br />
und am Ende eine gemeinsame<br />
Entscheidung zu treffen. „Im Grunde<br />
haben wir ein Semester lang Projektmanagement<br />
in der Praxis gemacht. In<br />
Arbeitsgruppen von jeweils 10 Personen<br />
ist es manchmal gar nicht so einfach, alle<br />
auf einen Nenner zu bringen und dabei<br />
stets kein Detail aus den Augen zu verlieren“,<br />
sagt Susanna Bechzidis, seit zwei<br />
Jahren ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende<br />
des Hochschulsport <strong>Wedel</strong>-PTL-<br />
Bund e.V..<br />
Nachdem die Studierenden bereits am<br />
Tag vor dem Fest mit dem Aufbau der<br />
Bühne, der Verpflegungsstände und der<br />
Dekoration begonnen hatten, ging es<br />
am großen Tag der Feier früh morgens<br />
weiter. „Häufig wird unterschätzt, wie<br />
viel Arbeit in dem Auf- und Abbau einer<br />
solchen Veranstaltung steckt. Umso willkommener<br />
ist bei einem solchen Fest<br />
jede zusätzlich helfende Hand, die spontan<br />
unterstützt“, berichtet Christian<br />
Krug.<br />
Getreu dem Motto 'Meet and Greek' sollte<br />
die Feier unter der Moderation von<br />
Prof. Dr. Michael Ceyp, Dozent im Fachbereich<br />
Betriebswirtschaftslehre, auch als<br />
lockerer Treffpunkt für Firmenvertreter<br />
und Studierende dienen. Vor dem Fest<br />
konnten sich Firmenvertreter aus dem<br />
Förderverein der Hochschule und Studierende<br />
auf einer Plattform online für<br />
die Feier verabreden und so in lockerer<br />
Atmosphäre ins Gespräch kommen.<br />
Intelligenter Humor als Key<br />
Performance Indicator<br />
Für Stimmung sorgte vor allem der Kostümwettbewerb,<br />
den Prof. Dr. Michael<br />
Ceyp mit intelligentem Humor moderier-<br />
Mit einfallsreichen Kostümen wollten die Studierenden die Jury<br />
beim Sommerfest von sich überzeugen.<br />
<strong>Aktuelles</strong><br />
te und zu einem besonderen Highlight<br />
des Sommerfests machte. Gekürt wurde<br />
das beste Kostüm des Abends: Über<br />
20 Studierende nahmen an dem Wettbewerb<br />
teil und verwandelten sich mit<br />
Omas alten Bettlaken und Efeuranken<br />
aus Nachbars Garten in Griechen aus der<br />
Antike.<br />
Die strenge, vierköpfige Jury bestand<br />
aus der Buchhalterin Gaby Schümann,<br />
dem Rechtsanwalt und Lehrbeauftragten<br />
Markus Meyer-Chory und den Dozenten<br />
Prof. Dr. Ulrich Raubach und Prof.<br />
Dr. Andreas Häuslein. Im Rahmen einer<br />
49
<strong>Aktuelles</strong><br />
individuellen Präsentation der Kostüme<br />
hatte die Jury die Qual der Wahl. Neben<br />
einem ausgefallenen Kostüm konnten die<br />
Wettbewerber auch durch eine interessante<br />
Darbietung ihrer Verkleidung<br />
punkten. So beispielsweise der Sieger ,<br />
der als Spartakus, bewaffnet mit Speer<br />
und Schild, einen Angst einflößenden<br />
Kampfschrei vortrug und so die Jury von<br />
sich überzeugte. Die Zweitplatzierte<br />
punktete mit einem Kostüm in goldener<br />
Eleganz und überzeugte die Jury mit<br />
edlen Verzierungen auf Haut und Haar.<br />
Eine Verwandlung, die sich lohnte.<br />
Mit einer überzeugenden Verkleidung gewannen<br />
die Studierenden Geld für ihr<br />
Studium, denn die ersten drei Sieger<br />
bekamen jeweils einen Teil ihrer Studiengebühren<br />
für das nächste Semester<br />
erlassen. Der 1. Platz war mit 200 Euro,<br />
der 2. Platz mit 100 Euro und der 3.<br />
Platz mit 50 Euro dotiert.<br />
Neben dem Kostümwettbewerb stand<br />
ein Tischkicker-Turnier auf dem Programmplan.<br />
Dabei spielten jeweils zwei<br />
der insgesamt 12 Teams gegeneinander.<br />
Nach einer Gruppenphase folgte die K.O.-<br />
Runde. Mit kleinen Extraaufgaben<br />
während der Spiele hielten die Organisatoren<br />
das Turnier spannend: So musste<br />
ein Teilnehmer beispielsweise zwi-<br />
50<br />
Prof. Dr. Michael Ceyp moderierte charmant das Sommerfest 2011.<br />
schendurch ein Bier für den Schiedsrichter<br />
holen oder 2 Minuten mit verbundenen<br />
Augen spielen. Bis spät in die Nacht<br />
wurde auch nach dem Turnier noch bei<br />
Flutlicht weiter gekickert und dabei die<br />
ein oder andere Revanche ausgetragen.<br />
Auch einige Professoren ließen sich ein<br />
Messen mit ihren Studierenden nicht<br />
nehmen und hatten kein Erbarmen,<br />
wenn es um das Erzielen von Toren ging.<br />
Anders als in mancher Vorlesung, in der<br />
die Professoren eher Gnade walten lassen.<br />
Nicht nur den Spaß am Tischkicker hat-<br />
ten Studierende und Lehrende an diesem<br />
Tag gemeinsam. Die meisten Professoren<br />
nahmen das Motto genauso<br />
ernst wie die Studierenden und hatten<br />
sich mit luftigen Gewändern im Toga-Stil<br />
und passendem Kopfschmuck in Schale<br />
geworfen. Ein DJ sorgte für die passende<br />
musikalische Begleitung des Abends.<br />
Viele tanzten und feierten im Anschluss<br />
an das offizielle Programm bis spät in die<br />
Nacht hinein, bis das Aufräumkommando<br />
irgendwann seine Pflicht zu erfüllen<br />
hatte.<br />
Daniela Fendt
Virtuelle Realität:<br />
Renommierter Workshop erstmals an<br />
der <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong><br />
Manch einer zuckte kurz zusammen, als<br />
der dunkle Nachthimmel einem tosenden<br />
Meer wich und ein imposantes Schiff<br />
auf die Zuschauer zustürzte. Wer den<br />
Tag mit einem kurzen Nickerchen unter<br />
dem kreisrunden Sternenhimmel ausklingen<br />
lassen wollte, war spätestens jetzt<br />
wieder wach und schwebte durch die<br />
virtuellen Welten, die auf die Kuppel des<br />
Hamburger Planetariums projiziert wurden.<br />
Diese Vorführung neuster Entwicklungen<br />
der dreidimensionalen Animationstechnik<br />
bildete den Höhepunkt des VRAR 2011,<br />
dem Workshop „Virtuelle & Erweiterte<br />
Realität 2011“ (VR/AR). Der Workshop ist<br />
seit sieben Jahren ein fester Bestandteil<br />
der Virtuellen Realität, kurz VR, in<br />
Deutschland.<br />
Die zweitägige Veranstaltung ist seit<br />
2004 eine Plattform für Wissenschaft,<br />
Industrie und Lehre zum Austausch über<br />
Ideen und Trends in der Virtuellen Realität.<br />
Vom 15. bis 16. September 2011<br />
fand er mit 70 Teilnehmern erstmals in<br />
der Fachhochschule <strong>Wedel</strong> statt. Die <strong>FH</strong><br />
<strong>Wedel</strong> ist seit Jahren in der VR präsent<br />
durch Kooperationen mit der Luftfahrtindustrie<br />
und durch ihren auf die VR ausgerichteten<br />
Studienfokus in der Informatik.<br />
Abtauchen in virtuelle<br />
Welten: Von der Simulation<br />
zur Illusion<br />
Prof. Dr. Christian-Arved Bohn, Veranstalter<br />
des Workshops und Dozent an der<br />
<strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> erklärt, was sich hinter dem<br />
Begriff Virtuelle Realität verbirgt: „Computerspiele<br />
sind Virtuelle Realität. Sie<br />
spiegeln dem Anwender eine Welt vor,<br />
die eigentlich nicht existiert. Diese Welt<br />
erlebt der Anwender am Computerdisplay<br />
wie durch ein Fenster. Er fühlt sich<br />
in diese Welt hineinversetzt und kann<br />
so für einen Moment Rennfahrer, Ritter<br />
oder Soldat werden.“ Für eine Virtuelle<br />
Realität simuliere der Computer Reize, die<br />
der Mensch über seine Sinnesorgane<br />
wahrnehmen kann. Je perfekter diese<br />
Simulation desto überzeugender die Illusion,<br />
so Bohn. Das Thema Virtuelle<br />
Realität beschränke sich dabei nicht ausschließlich<br />
auf Computerspiele. Virtuelle<br />
Realität bilde die Grundlage für Simulatoren,<br />
in denen sich beispielsweise neue<br />
Automobilmodelle oder Flugzeuge bereits<br />
vor dem ersten Testfahrzeug detailgenau<br />
erfahren lassen.<br />
Zur VRAR 2011 an der <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> wählte<br />
ein Komitee von Wissenschaftlern insgesamt<br />
16 Vorträge aus eingereichten Forschungsarbeiten<br />
aus. Die Veranstaltung<br />
begann mit Sessions zu Interaktion und<br />
Rendering, mit Vorträgen über neue Benutzerinterfaces<br />
und Bedienelemente,<br />
sowie neuen Techniken der Beleuchtung<br />
und des Renderns physikalisch korrekter<br />
Szenen.<br />
Ein Problem in der VR stellt beispielsweise<br />
ein begehbarer virtueller Raum dar,<br />
der viel größer und komplexer ist als der<br />
reale Raum, indem sich der Anwender<br />
bewegt. In einem solchen Fall muss dem<br />
Anwender bei jedem Schritt eine leicht<br />
abweichende Bewegung vorgetäuscht<br />
werden, so dass er in der virtuellen Welt<br />
eine gerade Strecke zurücklegt, sich in<br />
der realen Welt allerdings im Kreis bewegt.<br />
Evolution lernen:<br />
Von der Zelle zum 3D-Objekt<br />
Der zweite Workshop-Tag begann mit<br />
einer Keynote von Prof. Dr. Yves Duthen<br />
von der Universität Toulouse mit dem<br />
Titel „The Bio-Logic of Artificial Creatures“.<br />
Duthen referierte über animierte,<br />
dreidimensionale Objekte, die einen<br />
algorithmusgesteuerten, evolutionären<br />
Entwicklungsprozess durchlaufen, um<br />
schließlich zu komplexen Objekten zusammenzuwachsen.<br />
Am Anfang der Entwicklung<br />
existieren wie im realen Evolutionsprozess<br />
einige Zellen, die sich weiterentwickeln<br />
und passend zu ihrer vir-<br />
<strong>Aktuelles</strong><br />
tuellen Aufgabe charakteristische Eigenschaften<br />
ausprägen. Anwendung findet<br />
dieses Konzept etwa in der evolutionären<br />
Robotik, in der eine Maschine nicht<br />
von Ingenieuren zusammengebaut wird,<br />
sondern gemäß den Regeln der Evolution,<br />
Mutation und Selektion an ihren<br />
Aufgaben wächst und sich auf ihre Arbeit<br />
spezialisiert - ohne bei der Programmierung<br />
der Unvollkommenheit des Menschen<br />
ausgesetzt zu sein.<br />
In weiteren Sessions ging es unter anderem<br />
um neue Datenstrukturen für dreidimensionale<br />
Modelle, die etwa besonders<br />
schnelles Speichern ermöglichen,<br />
zudem um die Möglichkeiten von dreidimensionalen<br />
Audiosystemen und Softwaresysteme<br />
für Anwendungen in der<br />
Virtuellen Realität.<br />
Veranstalter Bohn zeigte sich zufrieden<br />
mit dem Workshop: „Dass selbst in das<br />
relativ entlegene <strong>Wedel</strong> so viele Gäste<br />
kamen freut mich ganz besonders“, sagte<br />
Bohn. „Das spricht einerseits für den<br />
Ruf der Fachhochschule <strong>Wedel</strong>, zeigt andererseits<br />
aber auch, dass diese Veranstaltung<br />
über die vergangenen Jahre hinweg<br />
zu einer der etabliertesten wissenschaftlichen<br />
Veranstaltungen im Bereich<br />
der Virtuellen Realität in Deutschland geworden<br />
ist.“<br />
Malte Hübner und Marcus Riemer<br />
51
Virtuelle Realität:<br />
Renommierter Workshop erstmals an<br />
der <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong><br />
Manch einer zuckte kurz zusammen, als<br />
der dunkle Nachthimmel einem tosenden<br />
Meer wich und ein imposantes Schiff<br />
auf die Zuschauer zustürzte. Wer den<br />
Tag mit einem kurzen Nickerchen unter<br />
dem kreisrunden Sternenhimmel ausklingen<br />
lassen wollte, war spätestens jetzt<br />
wieder wach und schwebte durch die<br />
virtuellen Welten, die auf die Kuppel des<br />
Hamburger Planetariums projiziert wurden.<br />
Diese Vorführung neuster Entwicklungen<br />
der dreidimensionalen Animationstechnik<br />
bildete den Höhepunkt des VRAR 2011,<br />
dem Workshop „Virtuelle & Erweiterte<br />
Realität 2011“ (VR/AR). Der Workshop ist<br />
seit sieben Jahren ein fester Bestandteil<br />
der Virtuellen Realität, kurz VR, in<br />
Deutschland.<br />
Die zweitägige Veranstaltung ist seit<br />
2004 eine Plattform für Wissenschaft,<br />
Industrie und Lehre zum Austausch über<br />
Ideen und Trends in der Virtuellen Realität.<br />
Vom 15. bis 16. September 2011<br />
fand er mit 70 Teilnehmern erstmals in<br />
der Fachhochschule <strong>Wedel</strong> statt. Die <strong>FH</strong><br />
<strong>Wedel</strong> ist seit Jahren in der VR präsent<br />
durch Kooperationen mit der Luftfahrtindustrie<br />
und durch ihren auf die VR ausgerichteten<br />
Studienfokus in der Informatik.<br />
Abtauchen in virtuelle<br />
Welten: Von der Simulation<br />
zur Illusion<br />
Prof. Dr. Christian-Arved Bohn, Veranstalter<br />
des Workshops und Dozent an der<br />
<strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> erklärt, was sich hinter dem<br />
Begriff Virtuelle Realität verbirgt: „Computerspiele<br />
sind Virtuelle Realität. Sie<br />
spiegeln dem Anwender eine Welt vor,<br />
die eigentlich nicht existiert. Diese Welt<br />
erlebt der Anwender am Computerdisplay<br />
wie durch ein Fenster. Er fühlt sich<br />
in diese Welt hineinversetzt und kann<br />
so für einen Moment Rennfahrer, Ritter<br />
oder Soldat werden.“ Für eine Virtuelle<br />
Realität simuliere der Computer Reize, die<br />
der Mensch über seine Sinnesorgane<br />
wahrnehmen kann. Je perfekter diese<br />
Simulation desto überzeugender die Illusion,<br />
so Bohn. Das Thema Virtuelle<br />
Realität beschränke sich dabei nicht ausschließlich<br />
auf Computerspiele. Virtuelle<br />
Realität bilde die Grundlage für Simulatoren,<br />
in denen sich beispielsweise neue<br />
Automobilmodelle oder Flugzeuge bereits<br />
vor dem ersten Testfahrzeug detailgenau<br />
erfahren lassen.<br />
Zur VRAR 2011 an der <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> wählte<br />
ein Komitee von Wissenschaftlern insgesamt<br />
16 Vorträge aus eingereichten Forschungsarbeiten<br />
aus. Die Veranstaltung<br />
begann mit Sessions zu Interaktion und<br />
Rendering, mit Vorträgen über neue Benutzerinterfaces<br />
und Bedienelemente,<br />
sowie neuen Techniken der Beleuchtung<br />
und des Renderns physikalisch korrekter<br />
Szenen.<br />
Ein Problem in der VR stellt beispielsweise<br />
ein begehbarer virtueller Raum dar,<br />
der viel größer und komplexer ist als der<br />
reale Raum, indem sich der Anwender<br />
bewegt. In einem solchen Fall muss dem<br />
Anwender bei jedem Schritt eine leicht<br />
abweichende Bewegung vorgetäuscht<br />
werden, so dass er in der virtuellen Welt<br />
eine gerade Strecke zurücklegt, sich in<br />
der realen Welt allerdings im Kreis bewegt.<br />
Evolution lernen:<br />
Von der Zelle zum 3D-Objekt<br />
Der zweite Workshop-Tag begann mit<br />
einer Keynote von Prof. Dr. Yves Duthen<br />
von der Universität Toulouse mit dem<br />
Titel „The Bio-Logic of Artificial Creatures“.<br />
Duthen referierte über animierte,<br />
dreidimensionale Objekte, die einen<br />
algorithmusgesteuerten, evolutionären<br />
Entwicklungsprozess durchlaufen, um<br />
schließlich zu komplexen Objekten zusammenzuwachsen.<br />
Am Anfang der Entwicklung<br />
existieren wie im realen Evolutionsprozess<br />
einige Zellen, die sich weiterentwickeln<br />
und passend zu ihrer vir-<br />
<strong>Aktuelles</strong><br />
tuellen Aufgabe charakteristische Eigenschaften<br />
ausprägen. Anwendung findet<br />
dieses Konzept etwa in der evolutionären<br />
Robotik, in der eine Maschine nicht<br />
von Ingenieuren zusammengebaut wird,<br />
sondern gemäß den Regeln der Evolution,<br />
Mutation und Selektion an ihren<br />
Aufgaben wächst und sich auf ihre Arbeit<br />
spezialisiert - ohne bei der Programmierung<br />
der Unvollkommenheit des Menschen<br />
ausgesetzt zu sein.<br />
In weiteren Sessions ging es unter anderem<br />
um neue Datenstrukturen für dreidimensionale<br />
Modelle, die etwa besonders<br />
schnelles Speichern ermöglichen,<br />
zudem um die Möglichkeiten von dreidimensionalen<br />
Audiosystemen und Softwaresysteme<br />
für Anwendungen in der<br />
Virtuellen Realität.<br />
Veranstalter Bohn zeigte sich zufrieden<br />
mit dem Workshop: „Dass selbst in das<br />
relativ entlegene <strong>Wedel</strong> so viele Gäste<br />
kamen freut mich ganz besonders“, sagte<br />
Bohn. „Das spricht einerseits für den<br />
Ruf der Fachhochschule <strong>Wedel</strong>, zeigt andererseits<br />
aber auch, dass diese Veranstaltung<br />
über die vergangenen Jahre hinweg<br />
zu einer der etabliertesten wissenschaftlichen<br />
Veranstaltungen im Bereich<br />
der Virtuellen Realität in Deutschland geworden<br />
ist.“<br />
Malte Hübner und Marcus Riemer<br />
51
<strong>Aktuelles</strong><br />
Messeteilnahmen:<br />
Bildung und Technik hautnah<br />
Die Teilnahme an Bildungsmessen<br />
und Infotagen ist fester Bestandteil<br />
des Beratungsangebots der<br />
Fachhochschule und der Berufsfachschule<br />
PTL <strong>Wedel</strong>. Schüler und Schülerinnen<br />
können sich persönlich über<br />
die Studien- und Ausbildungsgänge<br />
informieren, sei es auf der Messe<br />
Einstieg in Hamburg, der nordjob in<br />
Lübeck oder der Study World in Berlin.<br />
„Das Messeangebot wird immer spezieller,<br />
jedes Jahr kommen neue Messen hinzu,<br />
bei denen wir uns als Aussteller präsentieren.<br />
2012 fand beispielsweise zum<br />
ersten Mal die Messe karriere:dual statt,<br />
initiiert von der Agentur für Arbeit Hamburg.<br />
Auf dieser Messe können sich Studieninteressierte<br />
über duale Studiengänge<br />
informieren“, erläutert Yasmin Kötter,<br />
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Auf über 20 Messen und Infotagen präsentieren<br />
sich die <strong>FH</strong> und die PTL <strong>Wedel</strong><br />
jedes Jahr, je nach Zielgruppe mal im<br />
Doppelpack, mal alleine. Neben klassischen<br />
Bildungsmessen, bei denen die<br />
54<br />
Aussteller ihre Studien- und Ausbildungsgänge<br />
vorstellen, nehmen die Schwester-Institutionen<br />
an Veranstaltungen<br />
teil, die in erster Linie die Begeisterung<br />
an technischen Berufen wecken soll.<br />
Im Raum Schleswig-Holstein ist dies zum<br />
Beispiel der jährliche MINT-Aktionstag im<br />
Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie<br />
(ISIT) in Itzehoe. MINT steht für<br />
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften<br />
und Technik – Fächer, die auf<br />
der Wunschliste junger Mädchen meist<br />
nicht an erster Stelle stehen. Ziel des<br />
Aktionstages ist, junge Mädchen und<br />
Frauen für technische Berufe zu begeistern.<br />
Dafür erläutern Wissenschaftlerinnen<br />
in Gesprächsrunden mit Schülerinnen,<br />
warum MINT-Berufe Frauenberufe<br />
sind und zeigen anhand mitgebrachter<br />
Ausstellungsstücke und Experimente,<br />
wie spannend Technik sein kann.<br />
Auch bei der Hamburger Nacht des Wissens<br />
lautet das Motto: Technik erleben.<br />
Etwa 50 wissenschaftliche Einrichtungen<br />
aus der Metropolregion Hamburg und<br />
Norddeutschland veranstalten einmal im<br />
Jahr eine lange Nacht mit Wissenschaft<br />
und Forschung für die ganze Familie. Am<br />
Stand der <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong> im Ostflügel der Universität<br />
Hamburg durften die Besucher<br />
2011 Hand anlegen: Am berührungssensitiven<br />
Tisch erlebten die Besucher auf<br />
spielerische Art physikalische Phänomene.<br />
Der Egg-Bot, eine Demonstration der<br />
Technischen Informatik, erledigte seine<br />
Arbeit dagegen ganz von selbst. Er bemalte<br />
Eier mit filigranen Mustern.<br />
„Für Schüler und Schülerinnen sind Messen<br />
und Infotage eine gute Möglichkeit,<br />
sich einen Überblick über alle Studiengänge,<br />
Ausbildungsgänge und deren Anbieter<br />
zu verschaffen. Meist ist der Eintritt<br />
zu solchen Messen für Schüler frei.<br />
Wir freuen uns über jeden interessierten<br />
Besucher - also einfach mal vorbeikommen,<br />
wenn wir mit <strong>FH</strong> oder PTL auf<br />
der nächsten Messe vertreten sind“, rät<br />
Yasmin Kötter. Anstehende Messetermine<br />
veröffentlichen die <strong>FH</strong> und die PTL<br />
<strong>Wedel</strong> regelmäßig im Newsbereich auf<br />
ihren Internetseiten.<br />
Fest eingeplant ist in jedem Jahr die Teilnahme<br />
an folgenden Messen:<br />
• Einstieg Hamburg (ab 2013 auch<br />
in Köln und Frankfurt)<br />
• MINT-Aktionstag Itzehoe<br />
• karriere:dual<br />
• Study World Berlin<br />
• Studieren im Norden<br />
• Vocatium Hamburg<br />
• Nordjob Lübeck<br />
• Nordjob Unterelbe<br />
• Junge Messe Norderstedt<br />
• Berufe Live Elmshorn
Girls'Day 2012:<br />
Ermutigen für MINT-Berufe<br />
22 Mädchen hatten sich am 26.<br />
April 2012 zum Girls'Day an der<br />
Fachhochschule <strong>Wedel</strong> angemeldet,<br />
um Technik hautnah zu erleben. Bei<br />
diversen Versuchen und Projekten<br />
in den Laboren konnten die Mädchen<br />
im Alter von 12 bis 14 ihr technisches<br />
Talent erproben.<br />
„Ich habe heute gelernt, dass eine LED<br />
ganz viel Strom zieht. Daher muss man<br />
einen Widerstand vorschalten.“„Und ich<br />
fand ganz besonders toll, dass wir hier<br />
so viel selber machen durften“, fassen<br />
Mayte und Johanna ihre Erlebnisse beim<br />
Mädchen-Zukunftstag an der Fachhochschule<br />
<strong>Wedel</strong> zusammen.<br />
Naturwissenschaft und<br />
Technik zum Anfassen<br />
Im Chemie-Labor der Hochschule stand<br />
unter anderem die Herstellung von Wunderkerzen<br />
auf dem Programm. Die Ergebnisse<br />
ließen die Mädchen im Innenhof<br />
der Fachhochschule in Flammen aufgehen.<br />
Auch eine Probe der selbst hergestellten<br />
Kernseife nahmen die Besucherinnen<br />
mit nach Hause.<br />
Eine knifflige Aufgabe stellten die Mitarbeiter<br />
der Fachhochschule <strong>Wedel</strong> den<br />
Mädchen beim Projekt Nachtlicht. Aus<br />
zuvor mit dem Laser ausgeschnittenen<br />
Holzteilen und Acrylaufsätzen, Widerständen,<br />
Dioden und einer Batterie bauten<br />
die Mädchen ihr eigenes Nachtlicht.<br />
Wer wollte, durfte mit der Handschleifmaschine<br />
noch eine eigene Botschaft in<br />
die vorgefertigten Acrylplatten fräsen.<br />
„Zurückhaltung war den Mädchen ein<br />
Fremdwort, mit Begeisterung haben Sie<br />
sich auf die Projekte gestürzt und hoffentlich<br />
nehmen Sie diese Begeisterung<br />
für MINT-Fächer auch mit nach Hause“,<br />
wünscht sich Diplom-Ingenieur (<strong>FH</strong>)<br />
Timm Bostelmann, Mitarbeiter der <strong>FH</strong><br />
<strong>Wedel</strong> im Bereich Technische Informatik.<br />
Ziel des jährlichen, deutschlandweiten<br />
Aktionstages ist es, speziell Mädchen und<br />
Frauen für technische und naturwissenschaftliche<br />
Berufe in MINT-Fächern zu<br />
begeistern. MINT steht dabei für: Mathematik,<br />
Informatik, Naturwissenschaft<br />
und Technik. Fachbereiche, die die Fach-<br />
Mit der Handschleifmaschine machten sich die Mädchen an das Verzieren ihrer<br />
selbstgebauten Nachtlichter (Ergebnis siehe oben rechts).<br />
<strong>Aktuelles</strong><br />
hochschule <strong>Wedel</strong> mit Studiengängen<br />
wie E-Commerce, Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen<br />
abdeckt. An jedem<br />
vierten Donnerstag im April können<br />
Schülerinnen am Girls'Day Einblick in Berufsfelder<br />
erhalten, die Mädchen im<br />
Prozess der Berufsorientierung nur selten<br />
in Betracht ziehen.<br />
In erster Linie bieten technische Unternehmen,<br />
Hochschulen wie die <strong>FH</strong> <strong>Wedel</strong>,<br />
Forschungszentren und ähnliche Einrichtungen<br />
am Girls'Day Veranstaltungen<br />
für Mädchen an und tragen diese im Vorfeld<br />
online auf der Aktionslandkarte unter<br />
www.girls-day.de ein. Anhand von<br />
praktischen Beispielen erleben die Teilnehmerinnen<br />
in Laboren, Büros und<br />
Werkstätten, wie interessant und spannend<br />
die Arbeit dort sein kann.<br />
Initiative für mehr Frauen<br />
in MINT-Berufen<br />
Besonders wichtig ist den Mitarbeitern<br />
der Fachhochschule <strong>Wedel</strong>, dass die Mädchen<br />
am Girls'Day selbst anpacken. Materialien<br />
und Geräte benutzen, mit denen<br />
Sie im normalen Alltag keine Berührung<br />
haben. Der Funke für MINT soll<br />
überspringen, wenn die Teilnehmerinnen<br />
hautnah erleben, wie spannend die Arbeit<br />
in MINT-Berufen sein kann.<br />
Auch im kommenden Jahr wird sich die<br />
Fachhochschule wieder am Girls'Day beteiligen,<br />
in 2013 fällt dieser auf den 25.<br />
April. Die Hochschule setzt sich mit der<br />
Teilnahme dafür ein, langfristig den Beschäftigungsanteil<br />
von Frauen in Technik,<br />
IT und Naturwissenschaften zu erhöhen.<br />
55
<strong>Aktuelles</strong><br />
Kooperation mit der Berufsfachschule:<br />
Drei PTLer an der Bundesanstalt<br />
für Wasserbau<br />
Um Schulabsolventen für technische<br />
Berufe zu gewinnen, rief die Private Berufsfachschule<br />
PTL <strong>Wedel</strong> im Wintersemester<br />
2010/11 ein kooperatives Modell<br />
ins Leben.<br />
Dieses Modell sieht vor: Die Schüler unterschreiben<br />
einen Ausbildungsvertrag<br />
bei der PTL - mit dem Ziel, Technischer<br />
Assistent zu werden. Einen zweiten Vertrag<br />
gehen sie mit einer Firma ein, in der<br />
sie Praktika absolvieren sowie die Abschlussarbeit<br />
anfertigen. Die Abschlussarbeit<br />
umfasst den Zeitraum von sechs Monaten<br />
und stellt den Schwerpunkt in der<br />
Endphase der Ausbildung dar. Im Gegenzug<br />
übernimmt die Firma die Schulgebühren.<br />
Eine der in diesem Modell kooperierenden<br />
Firmen ist die Bundesanstalt für<br />
Wasserbau (BAW). Sie ist für die Unterstützung<br />
des technisch-wissenschaftlichen<br />
Bereichs des Bundesministeriums<br />
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung<br />
des Bundes tätig. Die BAW trägt<br />
Jörg Sanmann (l.) und Felix Vietor (r.)<br />
56<br />
wesentlich dazu bei, dass Deutschlands<br />
Wasserstraßen den wachsenden technischen,<br />
wirtschaftlichen und ökologischen<br />
Anforderungen gerecht werden.<br />
Bereits drei PTL-Schüler durften in der<br />
BAW Praxiserfahrung sammeln: Jörg Sanmann,<br />
Christian Struß und Felix Vietor.<br />
Die Abteilung Geotechnik Nord beschäftigt<br />
sich mit der Beurteilung des Baugrunds<br />
und der Grundwasserverhältnisse.<br />
Ebenso werden Fragen über Uferschutz<br />
bei baugrund-dynamischen Problemen<br />
beantwortet. Dazu gehört die<br />
Untersuchung der Wechselwirkung zwischen<br />
Bauwerk, Baugrund und dem<br />
Grundwasser.<br />
Nachdem Bodenproben entnommen<br />
wurden, werden diese zunächst in der<br />
„Bodenansprache“ gesichtet und klassifiziert.<br />
Je nach Klassifizierung werden<br />
dann mit den Bodenproben verschiedene<br />
Versuche durchgeführt. Einer dieser<br />
Versuche wird am anisotropen Triaxialversuchsstand<br />
durchgeführt. Hier werden<br />
das Scherverhalten sowie das Spannungs-Verformungs-<br />
und das Volumen-<br />
Dehnungsverhalten des Bodens bestimmt.<br />
Daraus werden die Scher- und<br />
Verformungsparameter abgeleitet. Die<br />
Scherfestigkeit eines Bodens ist eine der<br />
wichtigsten Kenngrößen zur Beurteilung<br />
der Tragfähigkeit des Baugrunds.<br />
Nach Jörg Sanmann und Christian Struß<br />
ist Felix Vietor der dritte PTLer, der sich<br />
mit der weiteren Automatisierung der<br />
verschiedenen Messabläufe sowie der<br />
Darstellung und Auswertung der Messergebnisse<br />
am Triaxialversuchsstand<br />
verdient gemacht hat.<br />
Jörg Sanmann studiert mittlerweile in<br />
Coburg und ist wenige Semester vom<br />
Diplom-Physik-Ingenieur entfernt. Vorlesungsfreie<br />
Zeiten bzw. geforderte Praktika<br />
führen ihn immer wieder zur BAW<br />
an die Elbe. Neben physikalischen sind<br />
sehr gute CAD-Kenntnisse für die Wei-<br />
terentwicklung des Labors von großer<br />
Bedeutung.<br />
Christian Struß im Labor der<br />
Geotechnik Nord<br />
Christian Struß hat Komponenten der<br />
Hardware den neuen Herausforderungen<br />
angepasst. Neben dem Mikrocontroller,<br />
dem Herzstück auf der Platine, hat er<br />
ein Leistungsinterface entwickelt, welches<br />
die bisherigen Relaiskarten ersetzt.<br />
Für Felix Vietor stand die Netzwerkkommunikation<br />
im Vordergrund. Schließlich<br />
müssen alle gemessenen physikalischen<br />
Größen wie Weg, Kraft, Volumen, Temperatur<br />
sowie verschiedene Drücke auf<br />
einem PC zusammenlaufen. Andererseits<br />
auch Steuersignale an den Versuchsstand<br />
ausgegeben werden.<br />
Statt fünf hat Felix Vietor sechs Semester<br />
zum Technischen Assistenten für<br />
Elektronik und Datentechnik benötigt.<br />
Allerdings hat er parallel die Deutsch- und<br />
Englischkurse besucht, sodass er jetzt<br />
auch die Fachhochschulreife besitzt. Mit<br />
einem Informatikstudium an der Fachhochschule<br />
<strong>Wedel</strong> wird er seine Ausbildung<br />
fortsetzen. An dieser Stelle möchte<br />
ich ein herzliches Dankeschön an die<br />
Chefs des Labors, Peter Schulze und Dirk<br />
Augner, richten. Sie haben die Abschlussarbeiten<br />
der drei PTLer ermöglicht.<br />
Bernd Albrecht
BUILDING<br />
ONLINE<br />
EDUCATION<br />
COMMUNITIES* *<br />
Making the world a smarter place<br />
* We are always looking for<br />
great software engineers!<br />
www.icans-gmbh.com