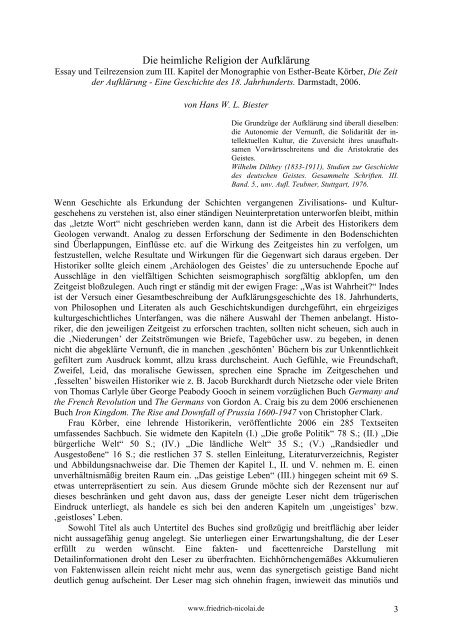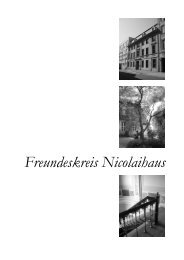Die heimliche Religion der Aufklärung - Forum Nicolai
Die heimliche Religion der Aufklärung - Forum Nicolai
Die heimliche Religion der Aufklärung - Forum Nicolai
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>heimliche</strong> <strong>Religion</strong> <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong><br />
Essay und Teilrezension zum III. Kapitel <strong>der</strong> Monographie von Esther-Beate Körber, <strong>Die</strong> Zeit<br />
<strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong> - Eine Geschichte des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts. Darmstadt, 2006.<br />
von Hans W. L. Biester<br />
<strong>Die</strong> Grundzüge <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong> sind überall dieselben:<br />
die Autonomie <strong>der</strong> Vernunft, die Solidarität <strong>der</strong> intellektuellen<br />
Kultur, die Zuversicht ihres unaufhaltsamen<br />
Vorwärtsschreitens und die Aristokratie des<br />
Geistes.<br />
Wilhelm Dilthey (1833-1911), Studien zur Geschichte<br />
des deutschen Geistes. Gesammelte Schriften. III.<br />
Band. 5., unv. Aufl. Teubner, Stuttgart, 1976.<br />
Wenn Geschichte als Erkundung <strong>der</strong> Schichten vergangenen Zivilisations- und Kulturgeschehens<br />
zu verstehen ist, also einer ständigen Neuinterpretation unterworfen bleibt, mithin<br />
das „letzte Wort“ nicht geschrieben werden kann, dann ist die Arbeit des Historikers dem<br />
Geologen verwandt. Analog zu dessen Erforschung <strong>der</strong> Sedimente in den Bodenschichten<br />
sind Überlappungen, Einflüsse etc. auf die Wirkung des Zeitgeistes hin zu verfolgen, um<br />
festzustellen, welche Resultate und Wirkungen für die Gegenwart sich daraus ergeben. Der<br />
Historiker sollte gleich einem ‚Archäologen des Geistes’ die zu untersuchende Epoche auf<br />
Ausschläge in den vielfältigen Schichten seismographisch sorgfältig abklopfen, um den<br />
Zeitgeist bloßzulegen. Auch ringt er ständig mit <strong>der</strong> ewigen Frage: „Was ist Wahrheit?“ Indes<br />
ist <strong>der</strong> Versuch einer Gesamtbeschreibung <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>sgeschichte des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts,<br />
von Philosophen und Literaten als auch Geschichtskundigen durchgeführt, ein ehrgeiziges<br />
kulturgeschichtliches Unterfangen, was die nähere Auswahl <strong>der</strong> Themen anbelangt. Historiker,<br />
die den jeweiligen Zeitgeist zu erforschen trachten, sollten nicht scheuen, sich auch in<br />
die ‚Nie<strong>der</strong>ungen’ <strong>der</strong> Zeitströmungen wie Briefe, Tagebücher usw. zu begeben, in denen<br />
nicht die abgeklärte Vernunft, die in manchen ‚geschönten’ Büchern bis zur Unkenntlichkeit<br />
gefiltert zum Ausdruck kommt, allzu krass durchscheint. Auch Gefühle, wie Freundschaft,<br />
Zweifel, Leid, das moralische Gewissen, sprechen eine Sprache im Zeitgeschehen und<br />
‚fesselten’ bisweilen Historiker wie z. B. Jacob Burckhardt durch Nietzsche o<strong>der</strong> viele Briten<br />
von Thomas Carlyle über George Peabody Gooch in seinem vorzüglichen Buch Germany and<br />
the French Revolution und The Germans von Gordon A. Craig bis zu dem 2006 erschienenen<br />
Buch Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947 von Christopher Clark.<br />
Frau Körber, eine lehrende Historikerin, veröffentlichte 2006 ein 285 Textseiten<br />
umfassendes Sachbuch. Sie widmete den Kapiteln (I.) „<strong>Die</strong> große Politik“ 78 S.; (II.) „<strong>Die</strong><br />
bürgerliche Welt“ 50 S.; (IV.) „<strong>Die</strong> ländliche Welt“ 35 S.; (V.) „Randsiedler und<br />
Ausgestoßene“ 16 S.; die restlichen 37 S. stellen Einleitung, Literaturverzeichnis, Register<br />
und Abbildungsnachweise dar. <strong>Die</strong> Themen <strong>der</strong> Kapitel I., II. und V. nehmen m. E. einen<br />
unverhältnismäßig breiten Raum ein. „Das geistige Leben“ (III.) hingegen scheint mit 69 S.<br />
etwas unterrepräsentiert zu sein. Aus diesem Grunde möchte sich <strong>der</strong> Rezensent nur auf<br />
dieses beschränken und geht davon aus, dass <strong>der</strong> geneigte Leser nicht dem trügerischen<br />
Eindruck unterliegt, als handele es sich bei den an<strong>der</strong>en Kapiteln um ‚ungeistiges’ bzw.<br />
‚geistloses’ Leben.<br />
Sowohl Titel als auch Untertitel des Buches sind großzügig und breitflächig aber lei<strong>der</strong><br />
nicht aussagefähig genug angelegt. Sie unterliegen einer Erwartungshaltung, die <strong>der</strong> Leser<br />
erfüllt zu werden wünscht. Eine fakten- und facettenreiche Darstellung mit<br />
Detailinformationen droht den Leser zu überfrachten. Eichhörnchengemäßes Akkumulieren<br />
von Faktenwissen allein reicht nicht mehr aus, wenn das synergetisch geistige Band nicht<br />
deutlich genug aufscheint. Der Leser mag sich ohnehin fragen, inwieweit das minutiös und<br />
www.friedrich-nicolai.de 3
H. W. L. Biester<br />
kompilatorisch Geschil<strong>der</strong>te bedeutungsvoll und konform zur <strong>Aufklärung</strong> steht. Das Buch<br />
beschreibt vieles und lässt manches wichtige unerwähnt. Z. B. findet <strong>der</strong> Leser we<strong>der</strong><br />
Hinweise über die Differenz zwischen Früh- und Spätaufklärung, noch tritt die<br />
Popularphilosophie gebührend in Erscheinung. Es wird auf die ‚Lunar Society’, in England<br />
hingewiesen, nicht aber darauf, dass nahezu alle Mitglie<strong>der</strong>, von Joseph Priestley über die<br />
Wedgwoods bis zu den Darwins und Huxleys, dem Glauben <strong>der</strong> Unitarians (Nachfolger <strong>der</strong><br />
Sozinianer), <strong>der</strong> <strong>heimliche</strong>n <strong>Religion</strong> <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>, anhingen, zumindest mit ihr<br />
sympathisierten. Der geographische Rahmen ist m. E. zu breit gefächert. Der Leser wird<br />
durch viele <strong>Aufklärung</strong>sströme Europas wie Österreich, Schweden, Spanien geführt und<br />
ausgiebig informiert; es hätte nicht überrascht, wenn auch die heutigen, sonnen- und<br />
meerbadenden Touristen Kenntnis davon erlangt hätten, dass selbst im 18. Jahrhun<strong>der</strong>t auf<br />
den Kanarischen Inseln <strong>Aufklärung</strong>sbestrebungen im Gange waren, die sich durch den<br />
Außenhandel verstärkt ergaben. „Insbeson<strong>der</strong>e hatten sich die kanarischen Hafenstädte mit<br />
starkem Überseeverkehr dem Gedanken <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong> geöffnet.“, wie über die Geschichte<br />
<strong>der</strong> Kanarischen Inseln geschrieben wurde – „Wichtigster Ort <strong>der</strong> Verbreitung aufklärerischer<br />
Ideen waren Debattierzirkel (‚tertulias’) Dort wurden die neuen Ideen diskutiert und die von<br />
Hand zu Hand weitergereichten, verbotenen Schriften gelesen. [...] <strong>Die</strong> Vorstellungen <strong>der</strong><br />
<strong>Aufklärung</strong> verbinden sich dann mit <strong>der</strong> Idee des Liberalismus, die allmählich im Laufe des<br />
19. Jahrhun<strong>der</strong>ts entwickelt wurde und die sich direkt mit dem Absolutismus des Ancient<br />
Regime auseinan<strong>der</strong> setzte“. (Vgl. Jose M. Castellano Gil/ Francisco J. Macias Martin, <strong>Die</strong><br />
Geschichte <strong>der</strong> Kanarischen Inseln (Übers. J. Zinsel), 5. Aufl., S. 70ff.).<br />
Von den Kernlän<strong>der</strong>n <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>, Frankreich, Großbritannien, Preußen vernehmen<br />
wir viel Bekanntes. Lei<strong>der</strong> gibt es keinerlei Hinweise auf Rousseau, <strong>der</strong> als Pendant zu<br />
Voltaire zu sehen ist und durchaus in die Riege <strong>der</strong> wenn auch unkonventionellen Aufklärer<br />
gehört. Ebenso wurden <strong>der</strong> Brite Samuel Johnson, die deutschen Schriftsteller und<br />
Popularphilosophen wie Reimarus, Wieland, Herausgeber und Autor des Deutschen Merkurs,<br />
Möser, Garve, J. J. Engel, Bahrdt, Rebmann, Erhard und an<strong>der</strong>e ‚Dissenter’ nicht genannt.<br />
Salzmann, v. Rochow und Gedike treten als Pädagogen nicht in Erscheinung. Immerhin,<br />
Lessing, „<strong>der</strong> Prediger <strong>der</strong> religiösen Toleranz“, findet auf einigen Seiten Erwähnung.<br />
Genannt werden einmal Her<strong>der</strong> und „Friedrich <strong>Nicolai</strong>, <strong>der</strong> Berliner Verleger und kritische<br />
Deutschlandreisende“ (ohne Nennung seines grundlegenden <strong>Aufklärung</strong>sromans Sebaldus<br />
Nothanker). Auch von seiner Lebensleistung, die Herausgabe <strong>der</strong> Allgemeinen Deutschen<br />
Bibliothek mit über 250 Bänden, die Deutschland literarisch und popularphilosophisch<br />
aufklärte und die allgemeine Rezeption aufklärerischer Literaturkritik möglich machte, erfährt<br />
<strong>der</strong> Leser nichts. Erwähnt wird auch die Berlinische Monatsschrift nicht, in die Kant seine<br />
kleinen <strong>Aufklärung</strong>saufsätze einrücken ließ, <strong>der</strong>en Einfluss auf die <strong>Aufklärung</strong>szeit noch<br />
Eduard Spranger und Werner Krauss würdigten. Immerhin darf man zufrieden sein, dass<br />
keine offensichtlichen und weitverbreiteten Irrtümer wie<strong>der</strong>holt wurden, wie bspw. Johann<br />
Georg Hamann und Friedrich Heinrich Jacobi in die Reihe <strong>der</strong> Aufklärer zu stellen.<br />
Was immer dem <strong>Aufklärung</strong>sstreben för<strong>der</strong>lich ist, es sogar beflügelt, verdient<br />
Anerkennung! So auch dieses Buch, dessen Arbeit <strong>der</strong>jenige würdigen kann, <strong>der</strong> selbst<br />
ungezählte Stunden damit zugebracht hat, ein historisches Sachbuch zu verfassen. Dass man<br />
solchen Büchern eine weite Verbreitung wünscht, ist daher nur verständlich. Nun besteht die<br />
Tätigkeit eines Rezensenten vornehmlich darin, Werke kritisch zu beleuchten; die Meriten als<br />
auch Schwächen aufzuzeichnen, zu ermutigen und zu tadeln, gemäß <strong>der</strong> auf uns gekommenen<br />
Tradition <strong>der</strong> Allgemeinen Deutschen Bibliothek des Popularphilosophen Friedrich <strong>Nicolai</strong>.<br />
<strong>Die</strong> Autorin behandelte überwiegend die Frühaufklärung, so dass sich <strong>der</strong> Rezensent<br />
erlaubt, sich nur über „das geistige Leben“ <strong>der</strong> Spätaufklärung zu äußern. Das geistige Leben<br />
<strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>szeit zu beschreiben, kann bedeuten, dass infolgedessen ein Mehr an Quantität,<br />
zur Qualitätsmin<strong>der</strong>ung führt. Alle Aspekte <strong>der</strong> Zeit einzubeziehen, ist daher ein<br />
4<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> 4 (2008)
<strong>Die</strong> <strong>heimliche</strong> <strong>Religion</strong> <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong><br />
anspruchsvolles Unterfangen. <strong>Die</strong> Historikerin verbreitete sich über soziologische und<br />
beson<strong>der</strong>s kirchliche Aspekte <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>szeit, so dass den philosophischen<br />
Bedenkenträgern <strong>der</strong> Epoche nicht Genüge getan wurde. Zu recht wies sie darauf hin (S.174),<br />
dass nach Immanuel Kant (1724-1804) die Beantwortung <strong>der</strong> Frage: Was ist <strong>Aufklärung</strong>?<br />
(erschienen im Dezemberheft, 1784, <strong>der</strong> Berlinischen Monatsschrift herausgegeben von Fr.<br />
Gedike und J.E. Biester, S. 516 ff.), im „Ausgang des Menschen aus seiner<br />
selbstverschuldeten Unmündigkeit“ zu suchen sei, und macht somit den „Geist <strong>der</strong><br />
<strong>Aufklärung</strong>“ daran fest, damit verknüpfend die For<strong>der</strong>ung nach dem „sapere aude“ (Habe Mut<br />
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen). <strong>Die</strong>se Abhandlung gilt seither in <strong>der</strong> „gelehrten<br />
Welt“ als Vademecum, Kompendium und Kurzprogramm <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong> und wird für<br />
allgemeingültig akzeptiert. Der vom Pflichtethos erfüllte Prof. Kant setzte ex cathedra voraus,<br />
dass es wohl nolens volens erwiesen sei, was „selbstverschuldet“ bedeute. Daher entbehrt die<br />
Kritik Johann Georg Hamanns (1730-1788) nicht einer gewissen Logik, wenn dieser an den<br />
Kant-Schüler und Freund <strong>der</strong> Berliner Aufklärer, dem Königsberger Professor <strong>der</strong><br />
Wirtschaftswissenschaft, Christian Jakob Kraus (1753-1807), am 18. Dezember 1784 schrieb:<br />
Freylich kommt es darauf an die beyden Naturen eines U n m ü n d i g e n u .<br />
V o r m u n d s zu vereinigen, aber beyde zu sich selbst wi<strong>der</strong>sprechenden Hypokriten<br />
zu machen, ist kein arcanum das erst gepredigt werden darf; son<strong>der</strong>n hier liegt eben<br />
<strong>der</strong> Knoten <strong>der</strong> ganzen politischen Aufgabe. Was hilft mir das F e y e r k l e i d <strong>der</strong><br />
Freyheit, wenn ich daheim im Sclavenkittel.<br />
Indes liegen im ‚Dissidententum’, den nonkonformistischen Abweichlern, die Wurzeln <strong>der</strong><br />
<strong>Aufklärung</strong>. Ihre Vertreter treten für das freie Denken und Handeln ein, sie sind keine „blind<br />
gehorsamen Ja- und Amen-Sager“ mehr. Mit Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen<br />
verschaffen sie sich in „geheimen“ Gesellschaften, in Lesesalons und in Journalen,<br />
Monatsschriften Gehör um das Verlangen des Volkes nach relativer Freiheit und<br />
Gerechtigkeit, dem die „Obrigkeit“ – Unterdrückung und Ausbeutung sind langlebig – in nur<br />
unzureichendem Maße nachkommt, durchzusetzen. Es bleibt die Wahl zwischen Reformen<br />
o<strong>der</strong> Revolutionen. Noch bis in das letzte Drittel des 20. Jh. bewegte diese philosophische<br />
Frage die Gemüter in den Auseinan<strong>der</strong>setzungen des ‚Positivismusstreits’ u. a. zwischen dem<br />
revolutionären Impetus des Herbert Marcuse und den graduellen Reformbestrebungen des<br />
„last leggard of the Enlightenment“ (‚Nachhumpler’ o<strong>der</strong> ‚Nachhinker’ <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>), wie<br />
sich Karl Popper selbst bezeichnete. Wie sehr ein ‚aufgeklärter’ Geist fähig ist, seinen<br />
Einfluss im Volke geltend zu machen, lässt sich an seiner Einsichtsfähigkeit für Kritik, wenn<br />
sie sich selbstaufklärend hinterfragt, ermessen. Daher ist die nachstehend zitierte Briefstelle<br />
ein Beleg, <strong>der</strong> würdig ist, den Lesern nicht vorenthalten zu werden. So berichtete Kant an<br />
Johann Erich Biester, dem Herausgeber <strong>der</strong> Berlinischen Monatsschrift, am 31. Dezember<br />
1784 u. a:<br />
Beiliegende zwey Stücke überliefere ich würdigster Freund zu beliebigen Gebrauche.<br />
Gelegentlich wünschte ich wohl zu vernehmen, nicht sowohl was das Publikum daran<br />
beifallswürdig, son<strong>der</strong>n noch zu desi<strong>der</strong>iren finden möchte. Denn in <strong>der</strong>gleichen<br />
Aufsätzen habe ich zwar mein Thema je<strong>der</strong>zeit vollständig durchdacht, aber in <strong>der</strong><br />
Ausführung habe ich immer mit einem gewissen Hange zur Weitläufigkeit zu<br />
kämpfen, o<strong>der</strong> ich bin so zu sagen durch die Menge <strong>der</strong> Dinge, die sich <strong>der</strong><br />
vollständigen Entwicklung darbieten, so belästigt, dass über dem Weglassen manches<br />
Benöthigten die Vollendung <strong>der</strong> Idee, die ich doch in meiner Gewalt habe, zu fehlen<br />
scheint. Man versteht sich alsdann wohl selbst hinreichend aber man wird An<strong>der</strong>n<br />
nicht verständlich und befriedigend genug. Der Wink eines einsehenden und<br />
aufrichtigen Freundes kann hiebey nützlich werden. Auch möchte ich mannigmal<br />
wohl wissen, welche Fragen das Publikum am liebsten aufgelöset sehen möchte. [...]<br />
Da ich beständig über Ideen brüte, so fehlt’s mir nicht an Vorrath, wohl aber an einem<br />
www.friedrich-nicolai.de 5
6<br />
H. W. L. Biester<br />
bestimmten Grunde <strong>der</strong> Auswahl, ingleichen an Zeit, mich abgebrochenen<br />
Beschäftigungen zu widmen, da ich mit einem ziemlich ausgedehnten Entwurfe, den<br />
ich gern vor dem herannahenden Unvermögen des Alters ausgeführt haben möchte,<br />
beschäftigt bin. *)<br />
*) Es handelte sich vermutlich um Kants „Kritik <strong>der</strong> praktischen Vernunft“ von 1788<br />
und <strong>der</strong> gleichzeitig erschienenen 2. verän<strong>der</strong>ten Auflage <strong>der</strong> K. d. r. V, 1787.<br />
– <strong>Die</strong>s aus <strong>der</strong> Gedankenwerkstadt eines Professors, <strong>der</strong> nicht nur zurückgezogen in<br />
Königsberg in Pr. sein Lehramt verrichtete. Hier artikulierte sich ein Mensch, <strong>der</strong> um genuine<br />
Wirksamkeit nicht nur für die ‚Gelehrtenrepublik’ tätig war son<strong>der</strong>n zusätzlich als<br />
Popularphilosoph für das breitere Publikum aufklärend wirkte, indem er neben seinen großen<br />
systematischen Kritiken am Zeitgeschehen teilzuhaben gedachte. Das ist, formalistisch<br />
betrachtet, <strong>Aufklärung</strong> pur. Hier ging es nicht um „wahre“ o<strong>der</strong> „falsche“ <strong>Aufklärung</strong>, wie W.<br />
Schnei<strong>der</strong>s u. a. es nennen, son<strong>der</strong>n einzig um die Wirksamkeit <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>. Vier<br />
Schwerpunkte bestimmten zu allen Zeiten das Wesen <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong> (insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Spätaufklärung). <strong>Die</strong>se waren: Politik, Pädagogik, <strong>Religion</strong> und Justiz. Sie alle bemühten<br />
sich, um Einhaltung sowohl von Menschenrechten als auch Menschenpflichten im<br />
moralischen Sinne zu sorgen. Frau Körber mag an<strong>der</strong>e Schwerpunkte bei <strong>der</strong> Wahl <strong>der</strong><br />
einzelnen Kapitel für die „Zeit <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>“ setzen. Kein geringerer als Immanuel Kant<br />
schrieb bereits, wenn auch lei<strong>der</strong> nur in <strong>der</strong> ersten Auflage <strong>der</strong> „Kritik <strong>der</strong> reinen Vernunft“<br />
1781:<br />
Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter <strong>der</strong> K r i t i k , <strong>der</strong> sich alles unterwerfen<br />
muss. R e l i g i o n , durch ihre H e i l i g k e i t , und G e s e t z g e b u n g , durch ihre<br />
M a j e s t ä t , wollen sich gemeiniglich <strong>der</strong>selben entziehen. Aber alsdann erregen sie<br />
Gerechten verdacht wi<strong>der</strong> sich, und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch<br />
machen, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche<br />
Prüfung hat aushalten können.<br />
Wollte man ein zweites Motto <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong> anbringen, so ließe sich das von<br />
Isaiah Berlin (1909-1987) aus <strong>der</strong> Einleitung zu seiner Anthologie The Age of Enlightenment<br />
(1956) zusammenfassend verwenden:<br />
The intellectual power, honesty, lucidity, courage, and disinterested love of the truth<br />
of the most gifted thinkers of the eighteenth century remain to this day without<br />
parallel. Their age is one of the best and most hopeful episodes in the life of mankind.<br />
The Age of Enlightenment – The Eighteenth-Century Philosophers (1979).<br />
Introduction, p. 29.<br />
<strong>Die</strong> intellektuelle Kraft, Ehrlichkeit, Klarheit des Verstandes, Mut und uneigennützige<br />
Liebe zur Wahrheit <strong>der</strong> meist begabten Denker des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts bleibt bis zum<br />
heutigen Tag ohne Parallele. Ihr Zeitalter ist eines <strong>der</strong> Besten und höchst<br />
hoffnungsvollen Episoden im Leben <strong>der</strong> Menschheit. Übers. aus dem Engl./ H. W. L.<br />
B.<br />
Begleitet wurde diese Ansicht Jahre später von Neil Postman (1931-2003) in seinem<br />
lesenswerten Buch Building a Bridge to the Eighteenth Century, mit dem Untertitel How the<br />
Past Can Improve Our Future, das aus <strong>der</strong> Sicht eines Amerikaners sich mit viel Empathie<br />
dieser Zeit annahm. Ohne diese geht es nicht! Bei <strong>der</strong> Autorin scheint dem Rezensenten<br />
gerade dieser Aspekt nicht genug ausgeprägt zu sein. <strong>Die</strong> ‚Begeisterung’ für die Sache <strong>der</strong><br />
<strong>Aufklärung</strong> hält sich in Grenzen. Manches wirkt zu sachlich, gelegentlich trocken und<br />
spöttelnd, auch abgehoben und zu belehrend. – Ein Rezensent hat zu eruieren: Was ist<br />
bekannt und kann vorausgesetzt werden? Wurden neue Quellen erschlossen? Ergeben sich aus<br />
dem Zusammenspiel <strong>der</strong> bereits bekannten Fakten und neu gewonnenen Erkenntnisse neue<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> 4 (2008)
<strong>Die</strong> <strong>heimliche</strong> <strong>Religion</strong> <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong><br />
Synergien und Synthesen? All das darf ein Rezensent nicht unberücksichtigt lassen. Welche<br />
Risiken für Leib und Leben sich durch allzu freimütige Meinungsäußerungen ergeben,<br />
beschreibt das Schicksal des Britischen Geistlichen, des unitarischen Reverend Thomas Fyshe<br />
Palmer (1747-1802). <strong>Die</strong>ser fein gebildete Gentleman (B.A., M.A., B.D.), <strong>der</strong> über die<br />
christlichen Glaubenslehren vor allem <strong>der</strong> Church of England gegenüber kritisch schrieb und<br />
sich auch mündlich äußerte. Als er dann noch einem schottischen Weber half bei <strong>der</strong><br />
Veröffentlichung einer politischen Druckschrift, Address to the People on the Subject of<br />
Parlamentary Reform, wurde er 1793 in Dundee verhaftet und mit Kriminellen auf sieben<br />
Jahre, zur Strafkolonie Botany Bay nach New South Wales, Australien verbannt. Dort genoss<br />
er als Geistlicher gewisse Freiheiten und freundete sich u. a. mit dem Entdeckungsreisenden<br />
George Bass an. Nach Ablauf <strong>der</strong> Strafzeit segelte er im Januar 1801 nach England, wobei<br />
das Schiff in einen heftigen Sturm geriet, das Schiff beinahe sank und in Guam anlandete.<br />
Reparaturarbeiten, Mangel an Nahrungsmittel – ausgelaugt von den Strapazen verstarb<br />
Palmer dort am 2. Juni 1802. Daher gilt als For<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong> nach wie vor: Gebt<br />
nicht nur Gedanken- son<strong>der</strong>n auch Redefreiheit, die sich auch schriftlich äußern kann, denn zu<br />
singen: „<strong>Die</strong> Gedanken sind frei“ allein, wie die Romantiker dichteten, bewirkt nichts,<br />
beruhigt lediglich autosuggestiv den inneren Zorn.<br />
Blickt man auf die Ursprünge <strong>der</strong> Französischen Revolution, auf die sogenannten<br />
Illuminaten, auf gutherzige und idealistisch-radikale Aufklärer wie Georg Forster, so galt <strong>der</strong><br />
Horaz’sche Wahlspruch „Sapere Aude“ als Losungswort jedwe<strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>. Wenngleich<br />
<strong>der</strong> Weg ein schicksalhafter sein kann, wurde für Forster und an<strong>der</strong>e die <strong>Aufklärung</strong> zum<br />
lebensbestimmenden Faktor, zur Berufung. <strong>Die</strong> <strong>Aufklärung</strong> spielte sich meist in<br />
bevölkerungsreichen, aber beson<strong>der</strong>s in Universitätsstädten, ab. Wenn z. B. in Preußen mehr<br />
an Reformen, wie bspw. am ‚Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten’, 1794,<br />
gearbeitet wurde als z. B. in <strong>der</strong> sog. Mainzer Republik mit ihrem revolutionären<br />
Bestrebungen um den Freiheitsbaum herum, dann lag es wohl eher daran, dass man in<br />
Preußen selbst in <strong>der</strong> nach-fri<strong>der</strong>izianischen Zeit eine Revolution wie in Frankreich nicht für<br />
zwingend nötig erachtete, wohl aber Reformen, wie die spätere Stein/ Hardenberg’sche, die<br />
nach mehr Freiheit für den Einzelnen strebten, dabei die Pflichterfüllung <strong>der</strong> Bürger nicht aus<br />
den Augen verlor. Viele, die sich <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong> verschrieben, wie z. B. in Berlin,<br />
unterhielten keine engen Beziehungen zur höfischen Gesellschaft, wurden aber gleichwohl<br />
geachtet und gerne konsultiert. Sie kamen aus allen ‚walks of life’, waren Ärzte, Juristen,<br />
Bibliothekare, Schriftsteller usf. Zum Adel hatten sie nur insofern Kontakt, als diejenigen<br />
darunter abgelehnt wurden, die aufgrund Ihres Namens antichambrierten und schmarotzten.<br />
Denn <strong>der</strong> Adel sollte gesellschaftlich verpflichtend sein, wie z. B. <strong>der</strong> stets betriebsame<br />
Adolph Knigge o<strong>der</strong> die Brü<strong>der</strong> von Humboldt u. a. m. Auf <strong>der</strong> (unnummerierten) Seite 141<br />
steht bei Körber:<br />
Und ein Autor, <strong>der</strong> es gewagt hätte, zu behaupten, es gäbe überhaupt ein Leben<br />
außerhalb <strong>der</strong> <strong>Religion</strong>, ein Leben in dem wir Gott nicht verpflichtet sind, wäre<br />
mindestens als „Atheist“ bei einer kirchlichen Behörde angezeigt worden.<br />
Einspruch! <strong>Die</strong>se Autoren gab es nicht nur im preußischen Berlin, sie gaben sich auch in<br />
an<strong>der</strong>en Städten des Reichs mit Gedichten und Fabeln zu erkennen, nicht plump, son<strong>der</strong>n<br />
subtil und un<strong>der</strong>cover. Gelegentlich auch radikal offenherzig. So ließ z. B. <strong>der</strong> bedeutende<br />
Dichter, Mäzen und Begrün<strong>der</strong> des Gleimhaus aus Halberstadt, Johann Wilhelm Ludwig<br />
Gleim, 1788 in die Berlinische Monatsschrift einrücken:<br />
An einige neuere Philosophen.<br />
Ihr fragt uns: Was ist Gott? Und gebt von seinem Wesen<br />
www.friedrich-nicolai.de 7
8<br />
H. W. L. Biester<br />
Zu hören, o<strong>der</strong> auch zu lesen:<br />
Er sei – So was wie Ihr! Das er gewiss nicht ist!<br />
In keinem Stükk’ ist er Euch ähnlich, würd ich sagen.<br />
Allein ich darf’s nicht wagen;<br />
Ihr sagtet ja sogleich; ich wär’ ein Atheist.<br />
Und Gottfried August Bürger schrieb das bedeutende, lei<strong>der</strong> unvollendete Epigramm:<br />
Für wen, du gutes deutsches Volk<br />
Behängt man dich mit Waffen?<br />
Für wen lässt du von Weib und Kind<br />
Und Herd hinweg dich raffen?<br />
Für Fürsten und für Adelsbrut<br />
und fürs Geschmeiß <strong>der</strong> Pfaffen.<br />
War’s nicht genug, ihr Sklavenjoch<br />
Mit stillem Sinn zu tragen?<br />
Für sie im Schweiß des Angesichts<br />
Mit Fronen dich zu plagen?<br />
Für ihre Geißel sollst du nun<br />
Auch Gut und Leben wagen?<br />
Sie nennen’s Streit fürs Vaterland,<br />
In welchem sie dich treiben.<br />
O Volk, wie lange wirst du blind<br />
Beim Spiel <strong>der</strong> Gaukler bleiben?<br />
Sie selber sind das Vaterland<br />
Und wollen’s gern bekleiben.<br />
Was geht uns Frankreichs Wesen an,<br />
<strong>Die</strong> wir in Deutschland wohnen?<br />
Es mochte dort nun ein Bourbon,<br />
Ein Ohnehose thronen.<br />
Wie aktuell, wie zeitgemäß! Hier spannt sich <strong>der</strong> zeitliche Bogen vom 18. in das 21.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t. Es ist daher durchaus begrüßenswert, dass Frau Körber (S. 220) an den<br />
bedeutenden Volksdichter Gottfried August Bürger erinnert hat. Richtig ist, dass „Toleranz“<br />
mit „Duldung“ (S. 142) gleichgesetzt wurde, wenn sie nicht staatsbedrohend war. Wenn Frau<br />
Körber sich wenige Zeilen zuvor auf das 18. Jh. bezog und dann schrieb: „An<strong>der</strong>sgläubige<br />
mussten nicht mehr wegen ihres Bekenntnisses um ihr Leben fürchten“, dann aber auf das<br />
aber auf „das frühe 18. Jh.“ hinwies, so zeigt sich darin das Spannungsverhältnis zwischen<br />
Früh- und Spätaufklärung. Das 18. Jh. war nicht homogen, die Spätaufklärung begann mit<br />
Thomasius, Wolff, Reimarus, Spalding und Lessing, und wurde von den Popularphilosophen<br />
Mendelssohn bis Kant fortgesetzt. Mit ihnen neigte sich die <strong>Aufklärung</strong> dem Ende zu. Nein,<br />
„An<strong>der</strong>sgläubige“ hatten noch bis zum Ende des Jahrhun<strong>der</strong>ts die Zensur, nicht nur in<br />
Preußischen Landen, zu fürchten. Wer sich über das Leben und Wirken des Philosophen<br />
Immanuel Kants informiert, wird den spannungsgeladenen ‚Druck von oben’ nachvollziehen<br />
können, unter dem die freie Meinungsentäußerung stand. <strong>Nicolai</strong> verlegte die Allgemeine<br />
Deutsche Bibliothek nach Kiel; Biester ließ die Berlinische Monatsschrift in Jena und Dessau<br />
erscheinen. So schrieb Kant (zehn Jahre vor seinem Tod) an Biester am 19. Mai 1794:<br />
Ich eile, hochgeschätzter Freund! Ihnen die versprochene Abhandlung zu übersenden,<br />
ehe noch das Ende Ihrer und meiner Schriftstellerey eintritt [auf das Verbot<br />
hinweisend, sich nicht mehr in religiösen Sachen zu äußern , wenn es den Zensoren,<br />
dem Kultusminister von Wöllner o<strong>der</strong> seiner Majestät, dem König nicht genehm sei,<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> 4 (2008)
<strong>Die</strong> <strong>heimliche</strong> <strong>Religion</strong> <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong><br />
H. W. L. B.]. [...] Das Leben ist kurz, vornehmlich das, was nach schon verlebten<br />
Jahren übrig bleibt; um das sorgenfrey zu Ende zu bringen, wird sich wohl ein Winkel<br />
<strong>der</strong> Erde auffinden lassen.<br />
Kant beugte sich – wenn auch wi<strong>der</strong>willig und verklausuliert – dem seit 1788 bestehenden<br />
<strong>Religion</strong>sedikt und gelobte 1794 gegenüber dem erst von seinem König Friedrich Wilhelm II<br />
geadelten und von dessen Nachfolger in den Ruhestand zwangsversetzten Minister Wöllner<br />
(einem „intriganten Pfaffen“, wie ihn <strong>der</strong> 1786 verstorbene König Friedrich II. gelegentlich<br />
nannte), sich fortan an den ‚Spezialbefehl’ zu halten und sich bis auf weiteres religiöser (d. h.<br />
hier, <strong>der</strong> christlichen <strong>Religion</strong> nicht-konformer) Äußerungen zu enthalten. Daher sah sich <strong>der</strong><br />
Dr. jur., Bibliothekar und Herausgeber <strong>der</strong> Berlinischen Monatsschrift Biester veranlasst, in<br />
einem Brief, datiert 17. Dezember 1794, dem er das letzte Quartal <strong>der</strong> Monatsschrift beifügte,<br />
sich einer leichten Rüge nicht zu enthalten:<br />
Ich habe Gelegenheit gehabt, Ihre Vertheidigung an das Geistliche Departem. über die<br />
Beschuldigung wegen Ihrer Schrift: die Rel. innerhalb <strong>der</strong> Gränzen <strong>der</strong> Vern., zu<br />
lesen. Sie ist edel, männlich, würdig, gründlich. - Nur muss es wohl lei<strong>der</strong> Ie<strong>der</strong><br />
bedauren, dass Sie ad 2) das Versprechen freiwillig ablegen: über <strong>Religion</strong> (sowohl<br />
positiv –, als natürliche) nichts mehr zu sagen. Sie bereiten dadurch den Feinden <strong>der</strong><br />
<strong>Aufklärung</strong> einen großen Triumph, u. <strong>der</strong> guten Sache einen empfindlichen Verlust.<br />
Auch, hätten Sie dies nicht nötig gehabt. Sie konnten auf eben die philosophische u.<br />
anständige Weise, ohne welche Sie überhaupt nichts schreiben, u. welche Sie so<br />
vortreflich rechtfertigen, noch immer fortfahren, über die nehmlichen Gegenstände zu<br />
reden, wobei Sie freilich vielleicht wie<strong>der</strong> über einzelne Fälle Sich zu vertheidigen<br />
würden gehabt haben. O<strong>der</strong> Sie konnten auch künftig bei Ihren Lebzeiten schweigen,<br />
ohne jedoch den Menschen die Freude zu machen, sie von <strong>der</strong> Furcht vor Ihrem<br />
Reden zu entbinden. Ich sagte: bei Ihrem Leben, denn dass sie dem ungeachtet<br />
fortfahren werden, an dem großen von Ihnen so glücklich begonnenen Werke <strong>der</strong><br />
philosophischen u. theologischen <strong>Aufklärung</strong> zu arbeiten, in Hofnung dass wenigstens<br />
einst die Nachwelt (und in <strong>der</strong> That, vielleicht eine sehr bald eintretende Zeit <strong>der</strong><br />
Nachwelt) diese Arbeiten wird lesen u. benutzen dürfen: davon sind wir Alle, aus<br />
Liebe zur Vernunft u. Vernunft u. Sittlichkeit, überzeugt.<br />
Viele Aufklärer waren Nonkonformisten o<strong>der</strong> ‚Dissenter’, wie man sie auch bezeichnete.<br />
Wenn daher Frau Körber auf S. 143 schreibt: „Keine Ehe wurde geschlossen ohne kirchlichen<br />
Segen – denn eine nicht-kirchliche Ehe wäre nicht als rechtsgültig akzeptiert worden, sie hätte<br />
nicht mehr gegolten als ein unverbindliches Versprechen“, so war dies sicherlich <strong>der</strong> „Ist-<br />
Zustand“, <strong>der</strong> wi<strong>der</strong>spruchslos von <strong>der</strong> Geistlichkeit dem Volke als Non-plus-ultra vermittelt<br />
wurde. Worauf die Autorin nicht hinweist, ist das Aufbegehren einiger durchaus<br />
einflussreicher Aufklärer aus allen Bereichen <strong>der</strong> Forschung und Lehre, bspw. in Frankreich,<br />
England und Preußen. So wurde bspw. die Ehefrage 1784 in Berlin gestellt. Unter dem<br />
Pseudonym „E. v. K“ lies Johann Erich Biester im Septemberstück (S. 265-276) <strong>der</strong><br />
Zeitschrift seinen eigenen Aufsatz einrücken mit dem Titel Vorschlag, die Geistlichen nicht<br />
mehr bei Vollziehung <strong>der</strong> Ehen zu bemühen. Er plädierte für eine Art standesamtliche,<br />
sekuläre Eheschließung, nicht vor Gott son<strong>der</strong>n für die Ehepartner in dieser Welt selbst,<br />
wobei – wer es wünscht – nicht auf den Segen <strong>der</strong> göttlichen Fügung des Schicksals zu<br />
verzichten brauche. Das rief den erwarteten Wi<strong>der</strong>spruch des Klerus hervor. Der<br />
protestantische Berliner Pfarrer Zöllner, durchaus ein Sympathisant <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>, hatte<br />
seine moralischen Bedenken. Sie waren seiner Ansicht nach das Ergebnis einer pervertierten<br />
Flut ungebremster Vergnügungssucht und des daraus folgenden Sittenverfall aus Frankreich<br />
u. a. auch durch die Literatur (M. de Sade, Mirabeau etc.), <strong>der</strong> auch nach Friedrich II. Tod vor<br />
den Toren Potsdams, am Hofe des okkultistischen Nachfolgers nicht halt machte. <strong>Die</strong><br />
Aufklärer wussten bereits, was auf sie zukommen würde. Am 2. Dezember 1786 schrieb<br />
Mirabeau an Perigord nach Paris:<br />
www.friedrich-nicolai.de 9
10<br />
H. W. L. Biester<br />
Ohne zu zittern, kann man dem Gedanken nicht nachhängen, daß <strong>der</strong> König so<br />
verblendet ist, aus d i e s e m Lager seine Günstlinge, seine Helfer in hohen Ämtern<br />
zu nehmen – <strong>der</strong> Unterbibliothekar Biester, Redacteur <strong>der</strong> „Monatsschrift“ hat von<br />
oben Befehl erhalten, einschlägige Themata nicht zu behandeln.<br />
Da die Machtpositionen <strong>der</strong> orthodoxen <strong>Religion</strong> durch zunehmende Selbstaufklärung mehr<br />
und mehr im Volke an Boden verloren und somit Glaube und Hoffnung schwanden, wandte<br />
sich dieses verstärkt dem <strong>Die</strong>sseits zu (indem es den anthropomorphen Gott „einen guten<br />
Mann“ im transzendenten Bereich sein ließ). So standen bspw. Reformen des Rechtswesens<br />
an. Auch warf die sich von Großbritannien aus entwickelnde Industrialisierung lange Schatten<br />
auf Deutschland und Preußen und kündigte das Zeitalter <strong>der</strong> Dampflokomotive und<br />
Dampfschifffahrt und des elektrischen Lichts an. <strong>Die</strong> Schöngeister suchten Zuflucht in<br />
Romantik und <strong>der</strong> darauf folgenden Bie<strong>der</strong>meierzeit. <strong>Die</strong>ser schnelllebigen Zeit nostalgisch<br />
<strong>der</strong> Berliner Zeit um 1783 zuwendend, schrieb Schadow 1849, ein Jahr vor seinem Tode:<br />
In jener Zeit lebten in Einverständniß: Gedicke, Biester, <strong>Nicolai</strong>, Engel, Ramler,<br />
Moses Mendelssohn, Spalding, Teller, etc.<br />
In seiner 1806 erschienenen Selbstbiographie (in <strong>der</strong> Dritten Person gehalten) resümierte<br />
Biester über die Zeit um 1783, als das Erscheinen <strong>der</strong> Berlinischen Monatsschrift begann:<br />
Noch war die glückliche Zeit Friedrichs; das Thörichte und Schlechte musste sich<br />
verbergen. Aber unter <strong>der</strong> geheimnisvollen Hülle drang es hin und wie<strong>der</strong> nur um so<br />
tiefer ein, und wartete schon auf die Zeit, wo <strong>der</strong> große König nicht mehr sein würde.<br />
Und noch 1797 mahnte und for<strong>der</strong>te Biester in <strong>der</strong> Berlinischen Monatsschrift:<br />
<strong>Aufklärung</strong> und Moralität müssen immer das Losungswort, immer <strong>der</strong> Hauptgedanke<br />
aller Schriftsteller und aller Leser in Deutschland sein.<br />
Kein Zweifel, <strong>der</strong> Erfolg o<strong>der</strong> Misserfolg alles <strong>Aufklärung</strong>sbestreben liegt in <strong>der</strong> praktischen<br />
Anwendung des Toleranzgedankens. <strong>Die</strong>ser kann jedoch ausarten in Lobhudeleien,<br />
Antichambrieren, aus Unvermögen und Gewinnsüchtigkeit, aus Gier und auch Schwäche.<br />
Toleranz kann daher nicht heißen: alles billigen, alles tolerieren, keine eigenständige Meinung<br />
zu besitzen. Auf den Seiten 154 ff. macht sich Frau Körber am Christentum fest und<br />
behauptet:<br />
<strong>Die</strong> rationalistische Religiosität – eine <strong>Religion</strong> mag man sie fast nicht nennen –<br />
erkannte Mythen und Symbole nicht mehr an, weil sie per se wi<strong>der</strong>sprüchlich und<br />
mehrdeutig sind.<br />
Jeglicher gläubige Bezug des Menschen an ein wie immer geartetes ‚Höheres Wesen’ o<strong>der</strong> an<br />
einen ‚Urgrund des Seins’, ist <strong>Religion</strong>. In ihrer Mannigfaltigkeit drückt sie sich aus. Sie kann<br />
pluralistisch sein und sich im Glauben an das trinitarische Christentum verwirklichen gemäß<br />
den ‚heiligen Schriften’, die Anweisungen für ein ‚gottgefälliges’ Leben geben um das<br />
‚Seelenheil’ zu retten durch Befolgung von Geboten die zu Belohnungen und widrigenfalls zu<br />
Strafen im Jenseits führen. Das sind, so dachten viele im 18. Jh., keine <strong>Religion</strong>en <strong>der</strong><br />
<strong>Aufklärung</strong>. Der aufgeklärte Mensch will denkend sich selbst und das Universum, die<br />
Wirkkraft dessen, was uns geschaffen hat, erforschen, statt an ‚Himmel’ und ‚Hölle’ o<strong>der</strong><br />
einen ‚Willen Gottes’ zu glauben. Er will eher im Lessing’schen Sinne die Wahrheit (auch die<br />
über Wesen und Wirken „Gottes“, was immer man sich darunter vorstellt), ergründen als <strong>der</strong><br />
<strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> 4 (2008)
<strong>Die</strong> <strong>heimliche</strong> <strong>Religion</strong> <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong><br />
Überzeugung <strong>der</strong> Geistlichen aller Konfessionen anhängen, man hätte sie bereits schon<br />
gefunden.<br />
<strong>Die</strong> Fragen bleiben: Brauchen <strong>Religion</strong>en Dogmen, Mythen, Symbole, Reliquien und<br />
Anweisungen für ein moralisch-seelisches Leben? O<strong>der</strong> sind auch Fragen im Sinne Kants<br />
gestattet: Gibt es ein radikal Böses in <strong>der</strong> menschlichen Natur? Hat Kant Recht, wenn er<br />
behauptete, <strong>der</strong> Mensch sei das einzige Lebewesen, das erzogen werden müsse? Für die<br />
Gesellschaft <strong>der</strong> Aufklärer war es eminent wichtiger, Fragen zu stellen als großsprecherische<br />
Antworten zu äußern. Geläuterte Vertreter des Christentums in Berlin, wie bspw. die<br />
Geistlichen Teller, Spalding und Zöllner, plädierten für einen entdogmatisierten Glauben und<br />
schätzten auch das religiöse Denken <strong>der</strong> Alten. Sind nicht die kosmologischen Betrachtungen<br />
eines Lukretius, die Ethik eines Epiktet o<strong>der</strong> die Betrachtungen eines Mark Aurel, Seneca<br />
nicht ebenso vom Glauben beseelt wie die religiösen Gedichte eines Matthias Claudius o<strong>der</strong><br />
Christian Fürchtegott Gellert?<br />
Also nochmals: Toleranz. Über diese schrieb J. E. Biester:<br />
Intoleranz heißt die Furie, welche alles Glück vom Erdboden vertilgt, sie ist das<br />
empörendste Verbrechen gegen den Staat, gegen die Menschheit, gegen die Vernunft,<br />
gegen die <strong>Religion</strong>en.<br />
War nicht auch Heuchelei <strong>der</strong> christlichen Lippenbekenner dabei, die Biesters Ruf als<br />
Publizist und die Berliner Monatsschrift schädigen wollten, in die Hamann seine Aufsätze zu<br />
publizieren gedachte und die Herausgeber dann doch die klare Gedankenführungen eines<br />
Kant favorisierten und veröffentlichen, wenn <strong>der</strong> wohlhabende und schwärmerische<br />
Kaufmann und Glaubensphilosoph F. H. Jacobi an Hamann am 22. August 1786 aus<br />
Pempelfort nach Königsberg in einem Postskriptum schrieb:<br />
Der junge Spalding, den ich zu Richmont traf [,] hat eine meine Vorstellung weit<br />
übertreffende Schil<strong>der</strong>ung von dem Haß u. <strong>der</strong> Verachtung gegen das Xstenthum <strong>der</strong><br />
unter den Berlinischen Philosophen herrscht gemacht. Er hat z.B. Biestern sagen<br />
hören, man dürfe diese jetzt nur nicht nachlaßen , u. in zwanzig [Jahren] werde und<br />
müsse <strong>der</strong> Nahme Jesus im religiösen Sinne nicht mehr genannt werden: - Der<br />
historische Glaube an die Schrift, ist auch dem alten Spalding ein Gräuel.<br />
Ja, das war deistisches und auch unitarisches Gedankengut. Nicht nachzuvollziehen und<br />
hochmütig scheint es, wenn Frau Körber (S153) vollmundig schlussfolgert:<br />
Wer sich auf komplizierte erkenntnistheoretische Überlegungen nicht einlassen<br />
möchte, aber trotzdem Gott und die Vernunft versöhnen wollte, dachte im 18. Jh.<br />
meist deistisch. Das heißt, er glaubte, dass es ein göttliches Wesen gebe, das die Welt<br />
am Anfang <strong>der</strong> zeit geschaffen habe. Den ersten Satz <strong>der</strong> Bibel hätte ein Deist also<br />
nicht gestrichen [...].<br />
Hier wird <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong>sbedarf des Volkes aus komplizierten erkenntnistheoretischen<br />
Gründen in Frage gestellt. Es bedarf durchaus solcher Anstrengungen, um „Gott und die<br />
Welt“ miteinan<strong>der</strong> zu versöhnen. Dem Deist ist das All per se heilig, und will er bündig sein,<br />
sieht er sich als Partner auf <strong>der</strong> religiösen Spielwiese des Geistes, hat aber aus historischen<br />
Gründen Bedenken, oft auch Misstrauen gegenüber den irdischen Repräsentanten Gottes, dem<br />
Fußvolk, dem Klerus auf Erden. Der Deist erkennt Gottes Wesen und Wirken einerseits in<br />
sich selbst andrerseits auch in <strong>der</strong> Natur, dem Perpetuum mobile des Göttlichen - nicht aber in<br />
<strong>der</strong> Exegese eines „Heiligen Buches“. Goethe, dem ein nur mäßiger Glaube zugeschrieben<br />
wird, schrieb in Wilhelm Meisters Wan<strong>der</strong>jahre (1795/96):<br />
www.friedrich-nicolai.de 11
12<br />
H. W. L. Biester<br />
Es gibt nur zwei wahre <strong>Religion</strong>en, die eine, die das Heilige, das in und um uns<br />
wohnt, ganz formlos, die an<strong>der</strong>e, die es in <strong>der</strong> schönsten Form anerkennt und anbetet.<br />
Alles, was dazwischen liegt, ist Götzendienst.<br />
In Goethes Nachlass lag auch <strong>der</strong> folgende Vierzeiler:<br />
Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,<br />
Hat auch <strong>Religion</strong>;<br />
Wer jene beiden nicht besitzt,<br />
Der habe <strong>Religion</strong>.<br />
Bis in die Zeit <strong>der</strong> Spätaufklärung hinein spukte noch <strong>der</strong> Westfälische Friedensschluss von<br />
1648 – außerhalb <strong>der</strong> offiziellen Politik – unterschwellig als Residuum des 30-jährigen<br />
Glaubenskriegs und <strong>der</strong> Machtverlust in den Köpfen <strong>der</strong> Geistlichkeit <strong>der</strong> Katholiken,<br />
Jesuiten und Protestanten. Es waren die Proselyten in diesen Glaubenszentralen, die im<br />
Namen Gottes und Christi in den Landen herumreisten und Mitglie<strong>der</strong> warben. Auf <strong>der</strong><br />
Gegenseite kam es zur Gründung des Illuminatenordens in Ingolstadt im Jahre 1776; die<br />
Freimaurerei expandierte, entwickelte sich im ganzen Reich, spann ihr Netz im Namen <strong>der</strong><br />
<strong>Aufklärung</strong> flächendeckend über ganz Deutschland und sprach sich offen gegen verkrustete<br />
Kirchenstrukturen und Dogmatik aus. Allerdings wollten auch manche illuminatische<br />
Heißsporne das Volk „zwangs“-aufklären. Sie taten <strong>der</strong> an sich guten Sache zuviel, und ihre<br />
übertriebene Geheimhaltungstaktik sowie Kompetenzgerangel ihrer Mitglie<strong>der</strong> schwächte den<br />
Orden empfindlich, was letztendlich zum Verbot und nachfolgen<strong>der</strong> Auflösung in Bayern<br />
1785 führte. Der berühmte Brief des mit sich selbst unzufriedenen Lessings an <strong>Nicolai</strong>, von<br />
1769 wonach die fri<strong>der</strong>izianische Preußen zu jener Zeit „einzig auf die Freiheit, gegen die<br />
<strong>Religion</strong> so viele Sottisen auf den Markt zubringen, als man will“ war <strong>der</strong> nach-lessingschen<br />
Periode vorbehalten und gegenüber Friedrich des II. und <strong>Nicolai</strong>s Zeit stark übertrieben. Auch<br />
war Preußen keine „Galeere“ wie er an Gleim schrieb. In den 1780ern standen in Preußen alle<br />
möglichen Fragen an, ob es bspw. Katholiken zu verstatten sei, in protestantischen<br />
Gotteshäusern predigen zu dürfen. Viele solcher „Probleme“ wurden in <strong>der</strong> BMS<br />
veröffentlicht. Symptomatisch hierfür wurde <strong>der</strong> „Disput“ über die Infiltration <strong>der</strong> Katholiken<br />
in Preußen zwischen dem höchst ehrenwerten und bedeutenden Popularphilosophen Christian<br />
Garve (1742-1798) und dem oftmals provozierenden, taktlosen Mitherausgeber <strong>der</strong> BMS Dr.<br />
Biester (Über die Besorgnisse <strong>der</strong> Protestanten in Ansehung <strong>der</strong> Verbreitung des<br />
Katholicismus von 1785). Garve wird als etwas weltfremd geschil<strong>der</strong>t, <strong>der</strong> die Angelegenheit<br />
verharmlost. Zwei Jahre später ergab sich jedoch ein ganz konkreter Rechtsstreit <strong>der</strong> beim<br />
Berliner Kammergericht landete. Der sehr bekannte Prediger und Schriftsteller Dr. Johann<br />
August Freiherr von Starck (auch Stark) (1741-1816) verklagte die BMS Herausgeber wegen<br />
Verleumdung. <strong>Die</strong>sen Prozess gewannen die beiden Angeklagten. Am 16. August 1787<br />
erfolgte <strong>der</strong> Beschluss, <strong>der</strong> im Historisch-politisches Magazin, nebst literarischen<br />
Nachrichten auf 32 Seiten abgedruckt wurde, was sich als Überschrift so liest:<br />
Entscheidung des königl. Kammergerichts zu Berlin, in Sachen des fürstlich Hessen-<br />
Darmstädtischen Oberhofpredigers, Constitorialraths und Definitor Dr. Johann<br />
August Stark, Kläger, wi<strong>der</strong> den Königl. Preußischen Oberconstitorialrath Gedicke,<br />
und den Bibliothekar, Dr. Biester, als Verfasser <strong>der</strong> Berliner Monatsschrift, Beklagte,<br />
wegen angeschuldeten Jesuitismus , <strong>heimliche</strong>n Katholicismus, Proselytenmacherey,<br />
und daraus entstandenen Injurienklage, mit Gründen „Erkennen Wir Friedrich<br />
Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preussen u.sw. den verhandelten Acten<br />
gemäß, hiermit für Recht: > Das die Beklagte von <strong>der</strong> wi<strong>der</strong> sie angestellten<br />
Injurienklage, sowohl in Absicht <strong>der</strong> Privat – als öffentlichen Genugthuung zu<br />
entbinden, <strong>der</strong> Kläger abzuweisen , und für schuldig zu achten sey, den Beklagten die<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> 4 (2008)
<strong>Die</strong> <strong>heimliche</strong> <strong>Religion</strong> <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong><br />
durch diesen Proceß verursachten Kosten, nach <strong>der</strong>en vorgängigen Angabe, und<br />
richterlichen Angabe, und erstatten.
H. W. L. Biester<br />
Schreiben über Politik und <strong>Religion</strong> durch die Justiz unter Androhung von Strafe verboten<br />
wurde, wandte man sich hilfesuchend an die Pädagogik. In seinen Vorlesungen über<br />
Erziehung befand schon Kant, dass <strong>der</strong> Mensch das einzige Lebewesen sei, das erzogen<br />
werden müsse, dem seine Rechte und Grenzen aufgezeichnet werden müsse. Wir wissen<br />
heute um das Aggressionspotential des Menschen, den Macht und übertriebener Ergeiz<br />
korrumpierbar machen kann. In einem Brief des Gräzisten und Dichters J. H. Voss aus<br />
Weimar schrieb er an seine Frau Ernestine, geb. Boie am 6. Juni 1794:<br />
14<br />
In Berlin hat eine Gesellschaft von Bürgern geradezu erklärt, dass sie die aufgeklärte<br />
<strong>Religion</strong> und keine an<strong>der</strong>e verlangten und widrigenfalls ihre Kin<strong>der</strong> nicht mehr taufen<br />
ließen.<br />
Bei <strong>der</strong> „Gesellschaft“ handelte es sich um die „Mittwochsgesellschaft“, die, ohne ihre<br />
Publikumswirksamkeit nach außen offen zu zeigen, für geheim galt, zumal es sich um eine<br />
begrenzte Mitglie<strong>der</strong>zahl handelte, die zurückgezogen Debattierte und die Resultate ihres<br />
Denkens schriftlich unter den Teilnehmern kursieren ließen, damit diese ihre Voten erteilen<br />
konnten. <strong>Die</strong> endgütigen Fassungen wurden dann vereinzelt in die Berlinische Monatsschrift<br />
– Biester war <strong>der</strong> Sekretär <strong>der</strong> Mittwochgesellschaft – „eingerückt“. Es würde den Rahmen<br />
dieses Essays sprengen, sich ausführlich darüber zu verbreiten. Was aber ist eine ‚aufgeklärte<br />
<strong>Religion</strong>’ und wo hat sie sich bereits gezeigt? <strong>Die</strong> Anhänger dieser <strong>Religion</strong> waren Anti-<br />
Trinitarier, nannten sich Socinianer und gelten als Vorläufer <strong>der</strong> Unitarier. Sie waren<br />
ursprünglich in Transsylvanien und Polen beheimatet, mussten von dort fliehen, kamen über<br />
Holland, Großbritannien um die Mitte des 18. Jh. auch nach Deutschland. Sowohl in<br />
Frankreich, die Enzyklopädisten, Voltaire und an<strong>der</strong>e, als auch in England wurde diese schon<br />
durch Toland, Locke, <strong>der</strong> Lunar Society, Joseph Priestley, <strong>der</strong> wegen seines Eintretens für die<br />
Französische Revolution aus England nach New England vertriebene Wissenschaftler und<br />
Unitarische Geistliche (<strong>der</strong> mit Benjamin Franklin und Thomas Jefferson befreundet war).<br />
Bahrdt u. v. m. Der berühmte Kupferstecher und Zeichner, Daniel Chodowiecki (1726-1801),<br />
<strong>der</strong> aus Danzig stammte und seine polnische Heimat schon in jungen Jahren verlassen hatte,<br />
war in Preußens Hauptstadt Berlin beliebt und in Aufklärerkreisen hoch angesehen. Oft war er<br />
mit den Seinen auf Reisen. In seinem Journal gehalten auf einer Lustreyse von Berlin nach<br />
Dressden Leipzig Halle Dessau zu Anno 1789 schrieb er, am 24. Juni nebst seinem Vetter und<br />
an<strong>der</strong>e auch „Herrn Basedow“ frühmorgens aufgesucht zu haben,<br />
<strong>der</strong> uns sehr Freundschaftlich aufnahm; wir sollten Bey ihm Logiren, etliche Tage bey<br />
ihm Bleiben. Wir wollten aber schon um 10 Uhr weiter reiten. Er bestellte das Mittag-<br />
Brod um 11 Uhr, wir musten bey ihm Bleiben. Er sprach viel vom Vergangenen,<br />
Gegenwärtigen, und Zukünftigen; gestand er sey ein Socinianer und erziehe seinen<br />
Sohn auch in diesen Meinungen.<br />
Das galt wohl auch für seine Schüler im „Pfylantropin“. – Sie nannten sich Socinianer und<br />
glaubten an Gott, wenn auch nicht alle Mitglie<strong>der</strong> an einen persönlichen Schöpfer. Auch<br />
lehnten sie die Gottessohnschaft Jesu ab, wenngleich sie überzeugt waren, dass Jesu ein<br />
Ausnahmemensch gewesen sei, <strong>der</strong> Wun<strong>der</strong> bewirken konnte. <strong>Die</strong> Lehre vom „Heiligen<br />
Geist“ wie<strong>der</strong>sprach ihrem Denken. Kurzum, sie waren Unitarier und damit Anti-Trinitarier;<br />
die christliche Dreieinigkeitslehre konnten sie nicht nachvollziehen. Socinianer waren<br />
die Anhänger des Lälius (1525-1562) (und seines Neffen Faustus 1539-1604)<br />
Socininus [...] denen die Unitarier in Siebenbürgen, Polen und den Nie<strong>der</strong>landen ihre<br />
Organisation verdanken, verwarfen im R a k o w e r K a t e c h i s m u s (poln. 1605,<br />
deutsch 1739), Dreieinigkeit, Gottmenschheit, Prädestination und Erbsünde als <strong>der</strong><br />
Schrift und Vernunft wi<strong>der</strong>streitend.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> 4 (2008)
<strong>Die</strong> <strong>heimliche</strong> <strong>Religion</strong> <strong>der</strong> <strong>Aufklärung</strong><br />
Neu in Umlauf gebrachte Begriffe wurden dem gebildeten Publikum oftmals durch Lexika<br />
nahegebracht. So findet sich im Conversations-Lexikon (Erster Band, Amsterdam 1809) die<br />
Eintragung unter „Socinianer“:<br />
<strong>Die</strong>se Lehre nun breitete sich beson<strong>der</strong>s in Pohlen – wohin sowohl Lälius Socinus<br />
(1558) als auch nachher sein Neffe, welcher unweit Cracau starb, sich geflüchtet<br />
hatten - aus, bis auf dem Reichstage im J. 1658 die Socinianer als Ketzer verdammt,<br />
und genöthigt wurden, binnen zwei Jahren das Reich zu verlassen. Ein großer Theil<br />
wendete sich hierauf nach Ungarn und Siebenbürgen, ein an<strong>der</strong>er nach Holland.<br />
England, wo sie öfters Anhang, aber auch noch öftere Verfolgungen fanden; nicht<br />
min<strong>der</strong> auch nach Deutschland, namentlich nach Preußen etc. Ihre Lehre hat<br />
unterdessen immer, auch selbst unter den Protestanten sehr viele Anhänger, öffentlich<br />
und im Stillen, gefunden.<br />
Folgerichtig weist Frau Körber auf die zunehmende Radikalität <strong>der</strong> das geistige Westeuropa<br />
durchziehenden Unzufriedenheit mit <strong>der</strong> christlichen Glaubenslehre hin.<br />
<strong>Die</strong> radikalsten Aufklärer sagten: Von <strong>der</strong> Bibel kann vor dem Richterstuhl <strong>der</strong><br />
Vernunft so wenig bestehen, dass wir uns die Bibel schenken können – und die<br />
Kirche, durch die sie gepredigt wird, gleich mit dazu. Das Konzentrat dieser<br />
Anschauung ist Voltaires Kriegsparole, die er auf die katholische Kirche bezog:<br />
„Ecrasez l’infame!“ „Macht das Scheusal kaputt!“ (S. 153)<br />
<strong>Die</strong> <strong>Religion</strong>, so predigte <strong>der</strong> aus England vertriebene britische Naturwissenschaftler Joseph<br />
Priestley (1733-1804) (er ‚erfand’, d. h. isolierte und bestimmte chemisch, unabhängig von<br />
seinem Zeitgenossen C. W. Scheele, das ‚oxygen’, den Sauerstoff), Philosoph und<br />
Grün<strong>der</strong>vater <strong>der</strong> Unitarians in den Vereinigten Staaten von Amerika in Boston in einem<br />
Abschiedsgottesdienst, On the Uses of Christianity (Über den Nutzen <strong>der</strong> Christenheit):<br />
Men cannot embrace as sacred truth anything of which their common sense revolts.<br />
Nor can that be consi<strong>der</strong>ed as a truth of revealed religion, which is contrary to the<br />
most obvious and acknowledged truth of natural religion.<br />
Menschen können nicht als heilige Wahrheit die Dinge umarmen, gegen die ihr<br />
gesun<strong>der</strong> Menschenverstand revoltiert. Auch können sie nicht als offenbarte <strong>Religion</strong><br />
betrachten, was als Selbstverständlichkeit im Wi<strong>der</strong>spruch zu einer natürlichen<br />
<strong>Religion</strong> steht. (Übers. H. W. L. Biester)<br />
© Hans W. L. Biester, 10/ 2008<br />
Ende des ersten Teils<br />
www.friedrich-nicolai.de 15