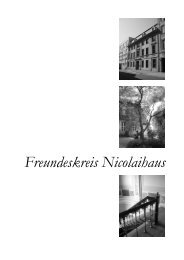2 - Forum Nicolai
2 - Forum Nicolai
2 - Forum Nicolai
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
F o r u m N i c o l a i<br />
B e i t r ä g e z u r E r f o r s c h u n g v o n L e b e n u n d W i r k e n F r i e d r i c h N i c o l a i s<br />
u n d a n g r e n z e n d e n T h e m e n d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s<br />
Neue Beiträge im Februar 2007<br />
PDF-/ Printexemplar<br />
Über die Beziehungen zwischen Friedrich <strong>Nicolai</strong> und Johann Erich Biester .......................... 2<br />
Romantisches Plädoyer für das postfriderizianische Berlin.................................................... 20<br />
Abgesang auf vergangene Zeiten: zum neu erschienenen Band über das <strong>Nicolai</strong>haus ......... 25<br />
www.friedrich-nicolai.de
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Über die Beziehungen zwischen Friedrich <strong>Nicolai</strong> und Johann Erich Biester<br />
von Hans W. L. Biester, Hamburg<br />
Vertraut auch zu recht die gelehrte Zunft,<br />
auf die „Kritik der praktischen Vernunft“,<br />
so gebt den Menschen für das allgemeine Glück,<br />
zunächst einmal den common sense zurück!<br />
Wer den Freundschaftstempel des Gleimhauses in Halberstadt besucht, um die<br />
Portraits der geistigen Elite Deutschlands von der Mitte bis zum Ende des 18ten<br />
Jahrhunderts zu betrachten, der wird vergeblich nach Bildnissen von Goethe und<br />
Schiller an den Wänden Ausschau halten; im ersten Raum hingegen die Portraits Nr.<br />
36 und 37 1 des Journalisten und Co-Editors der Berlinischen Monatsschrift (künftig<br />
BMS) und ab 1791 alleinigen Herausgebers Johann Erich Biester (17.11.1749-<br />
10.2.1816) - künftig JEB – und den 16 Jahre älteren Buchhändler und Schriftsteller<br />
Christoph Friedrich <strong>Nicolai</strong> (18.3.1733-8.1.1811) einträchtig nebeneinander finden.<br />
In <strong>Nicolai</strong> könnte man von Gestalt und Robustheit das deutsche Pendant des<br />
englischen Dr. Samuel Johnson sehen. Durch seine Freundschaft mit G. E. Lessing<br />
(1729-1781) in dessen Gedankenwelt eingetaucht, verschaffte sich <strong>Nicolai</strong> durch sein<br />
Romanwerk, viele Abhandlungen und vor allem die von ihm gegründete und<br />
betriebene sog. „Rezensionsanstalt“, die Allgemeine Deutsche Bibliothek (künftig<br />
ADB), schon frühzeitig Bekanntheit in Deutschland. Dessen Biographie und<br />
Gesamtwerk 2 sind weitgehend erschlossen und zugänglich. JEB’s wachsende<br />
Popularität hingegen setzte erst nach Lessings Tod ein. Ein Negativ-Image von<br />
beiden, JEB und <strong>Nicolai</strong>, bestimmte bis zur Mitte des 20sten Jhdts. die Literatur- und<br />
Philosophiegeschichte. Als Aufklärer (auch verächtlich Aufkläricht und seichte<br />
Popularphilosophen, als Teil der Berliner-Aufklärungssynagoge bezeichnet) wurden sie<br />
abgetan, da sie mit den emanzipierten Deutschen jüdischen Glaubens fraternisierten,<br />
und durch gewisse Grundsätze kamen sie im Laufe der Zeit in Gegnerschaft zu dem<br />
aufstrebenden Geniekult der Schwärmer und Lärmer, Goethe und Schiller, den<br />
Schlegel-Brüdern und manchen Romantikern.<br />
Der später <strong>Nicolai</strong> nicht gerade wohlgesinnte Friedrich Schiller (1759-1805) konnte<br />
noch am 6.11.1782 an seine Schwester Christophine schreiben:<br />
Ich schreibe dir gegenwärtig auf meiner Reise nach Berlin [...]. Sobald ich in Berlin<br />
bin, kann ich in der ersten Woche auf festes Einkommen rechnen, weil ich vollgültig<br />
Empfehlungen an <strong>Nicolai</strong> habe, der dort gleichsam der Souveräin der Litteratur ist,<br />
aber Leute von Kopf sorgfältig anzieht, mich schon im voraus schätzt und einen<br />
ungeheureren Einfluß hat beinahe im ganzen teutschen Reich der Gelehrsamkeit. 3<br />
2
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Leider reiste er dann doch nicht nach Berlin sondern lernte die Stadt erst 1804, ein<br />
Jahr vor seinem Tode, kennen, als der einstige Regimentsmedikus schon ein<br />
gefeierter Schriftsteller war und in Weimar nicht mehr leben wollte. Schiller wurde<br />
zunehmend interessierter nach Berlin zu übersiedeln, doch seine Frau wollte den<br />
Weimarer Musenhof mit allen seinen Annehmlichkeiten nicht verlassen, und auch<br />
Goethe beeinflusste den Herzog zum Bleiben Schillers. Ob sich dieser mit dem alten,<br />
verdienstreichen und gutherzigen 71-jährigen Mann aussöhnte, der noch zu<br />
Lebzeiten vom Schicksal hart getroffen wurde, indem er seine Frau und alle Kinder<br />
überlebte, scheint der Nachwelt nicht überliefert worden zu sein. Durch die Xenien<br />
hatten Schiller und Goethe, „die beiden Sudelköche aus Jena und Weimar“ 4 längst<br />
unwiderruflich ihren Stab über ihn gebrochen. JEB’s Biographie wurde durch den<br />
angehenden Schriftsteller und Dr. phil. Alfred Haß (1880-?) 5 erschlossen. Zwei<br />
andere Literaturhistoriker, Dr. Norbert Hinske 6 und Dr. Peter Weber 7 , haben über<br />
JEB und seine Zeit im Zusammenhang mit der BMS Treffliches geschrieben, als auch<br />
jeweils einen Auswahlband der BMS herausgegeben. Diese Auswahlbände sind seit<br />
der Deutschen Einheit nicht mehr fortgesetzt worden. Über JEB schrieb Schiller am<br />
6.10.1787 aus Weimar an Christian Gottfried Körner (1756-1831):<br />
Biester war dieser Tage auch hier, er gefällt mir wenig. Eine feine, forschende<br />
Physiognomie, der es aber doch auch nicht an Präsumtion fehlt. 8<br />
In dem „Postscript“ eines Briefes von Schiller an den oben genannten Freund, datiert<br />
12.6.1788, steht unter Position 4, für die Gründung des Journals Thalia einen Plan zu<br />
erarbeiten, dass es dazu Personen bedürfe, die hierzu Artikel kontribuieren:<br />
M e i n Name gilt freilich, aber doch nicht gerade bei a l l e n Classen, um deren<br />
Geld es uns zu thun ist; bei denen muß man z. B. einen Garve, Engel, Gotter oder<br />
einen Biester und seines Gelichters (ich meine nicht die Menschen selbst, sondern<br />
ihre Arten) affichiren. Vielleicht, daß es mir gelingt, H e r d e r n , wenn er aus<br />
Italien zurück ist, durch große Preise zu locken; vielleicht komme ich auch mit<br />
G o e t h e n in Verbindung. [Ebd.]<br />
Körner berichtete am 9.5.1789 an Schiller aus Dresden:<br />
Biester ist hier; ich habe ihn nur ein paar Augenblicke gesehen, und werde erst heute<br />
Abend mit ihm in Gesellschaft sein. Sein Gesicht ist gescheidt, flößt aber kein<br />
Zutrauen ein. Ist es vielleicht Täuschung durch das, was man von ihm weiß; genug,<br />
mir schien etwas Ausspürendes in seinem Blicke zu liegen. [Ebd.]<br />
Am 22.5.1789, so berichtet Körner an Schiller weiter,<br />
[...] war Biester hier und ein Kriegsrath Scheffner [1736-1820] aus Königsberg (der<br />
Verfasser der Lebensläufe in aufsteigender Linie und des Buches über die Ehe [sic!]).<br />
Biester war mir anfangs unleidlich, weil er bloß in seiner Jesuitenjagd zu leben<br />
schien; zuletzt wurde er mir genießbarer. Scheffner ist sehr still, und konnte vor<br />
3
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Boden [Joachim Christoph Bode, 1730-1793, Übersetzer, Illuminat] und Biester nicht<br />
aufkommen. [Ebd.]<br />
JEB hatte sich auf einer dienstlichen Reise im Mai 1789 über die Dresdner Bibliothek<br />
informiert und darüber am 23. Mai 1789 einen heute nicht mehr vorhandenen Bericht<br />
J. C. v. Wöllner (1732-1800), dem Kulturminister und Nachfolger v. Zedlitz’,<br />
zugeleitet.<br />
JEB und <strong>Nicolai</strong> wurden von Zeitgenossen und der Nachwelt zu recht als<br />
„Aufklärer“ 9 bezeichnet, und in der Tat, wer den Aufsatz Kants „Was ist<br />
Aufklärung?“ in der BMS von 1784 aufmerksam liest, wird erkennen, dass die beiden<br />
„Popularphilosophen“ 10 , wie sie auch genannt werden, durchaus der Forderung,<br />
freie Selbstdenker zu sein oder zu werden, entsprachen. Zunächst jedoch einige<br />
Angaben zur Biographie und Charakteristik Biesters.<br />
Gustav Parthey (1798-1872), einer der Enkel <strong>Nicolai</strong>s, berichtete 1871 in seinen<br />
„Jugenderinnerungen“, wie sie als Kinder in der Brüderstraße 13 zu Berlin über den<br />
kleingewachsenen Freund ihres Großvaters scherzten.<br />
Der Bibliothekar B i e s t e r , <strong>Nicolai</strong>s genauester Freund, war ein kleiner<br />
verwachsener Mann mit viel Lebhaftigkeit und kräftig tönender Stimme. Sein Kopf<br />
reichte bei Tisch kaum über den Teller, dabei gestikulierte er viel mit den Händen<br />
und gebrauchte Messer und Gabel auf eine eigenthümliche Weise. Auch dies wusste<br />
Fritz mit großer Virtuosität darzustellen. Es versteht sich von selbst, dass seine<br />
harmlosen Exhibitionen nur auf unsere Kinderstube beschränkt blieben. 11<br />
Mit einem längeren Zitat aus dem „Reisetagebuch von 1798“ des Predigers Johann<br />
Friedrich Abegg (1765-1840) aus Berlin, welches von den Nachfahren erst 1987<br />
herausgegeben wurde, soll die Charakterisierung JEB’s abgerundet werden.<br />
Den 23. Juli [...] ging ich zu dem Herrn D. Biester und überreichte ihm den Brief von<br />
Scheffner. Sein Empfang war ziemlich kalt. Nachdem er den Brief flüchtig<br />
durchgelesen, wurde er aber sehr höflich und lud mich gleich auf den Abend ein, mit<br />
ihm in den sogenannten Montag-Club zu gehen, wo Teller, Meil, <strong>Nicolai</strong> Mitglieder<br />
sind, und Ramler auch Mitglied war. Ich verließ ihn bald, weil ich doch noch heute in<br />
seiner Gesellschaft seyn konnte. [...] Über die Policey von Berlin wurde gesprochen.<br />
Biester wünschte, daß sie einen stärkeren Fond haben möge. Die Policey könne nicht<br />
zu gut seyn! Man scheint noch viel vom Könige in dieser Hinsicht zu erwarten. B.<br />
bemerkte, nicht wie der vorige König that, der viele 1000de anwendete, um<br />
Privathäuser zu bauen, sondern solche Gegenstände, wie Schönheit der<br />
Straßenpflaster, der Brücken, Alleen, u.s.w. müsse ein Gegenstand, der höheren<br />
Policey u. Königl. Willens werden, denn dieses kann durch Privatpersonen nicht<br />
zustande gebracht werden. – Gegen 10 Uhr ging die Gesellschaft auseinander. Biester<br />
und Buttmann begleiteten mich, bis ich mich zurecht finden konnte. Biester ist ein<br />
etwas verwachsener, kleiner Mann, von bräunlicher Gesichtsfarbe, hat eine schöne<br />
Physiognomie, aber er scheint leicht ärgerlich zu werden, man merkt ihm aber leicht<br />
an, daß er in alle Tugenden des feinen Umgangs mit Menschen eingeweiht ist.<br />
Jedenfalls mag es eher nöthig sein, gute Addr. an ihn zu haben, weil er keinen hohen<br />
4
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Werth auf neue Bekanntschaften zu legen scheint, da er so viele interessante ältere<br />
hat, u. überhaupt kein weitherziger Mann zu sein scheint. Wie sehr dank ich es<br />
Scheffner, daß er mir diese freundliche Gelegenheit verschafft hat. 12<br />
Während seines Studiums der Rechtswissenschaft an der Göttinger Universität<br />
(1767-1771) las JEB außerordentlich viel und hörte Vorlesungen in Geschichte und<br />
verschiedenen Fachgebieten, trieb nebenher das Studium neuerer Sprachen wie<br />
Französisch und Englisch, gründete mit Gottfried August Bürger (1747-1794) einen<br />
„Shakespeare-Club“, in dem es üblich war, sich in den Konversationen vornehmlich<br />
nur englischer Zitate aus dem Shakespeare zu bedienen. Nach Beendigung des<br />
Studiums war er kurze Zeit am Marstallsgericht seiner Heimatstadt Lübeck tätig,<br />
war aber der Ansicht, dass sich seine Lebensaufgabe nicht darin erschöpfen sollte,<br />
Prozesse zu führen, wiewohl er sich doch mit einer gesicherten Existenz als Jurist<br />
hätte begnügen können. In seiner in der dritten Person gehaltenen Selbstbiographie<br />
(1806) berichtete er über diese Zeit und seine Kontakte:<br />
Er hatte das Glück, die gütige Zuneigung einiger berühmter Lehrer dort [in<br />
Göttingen] zu gewinnen, worunter er den vortreflichen Herrn v. Schlözer [August<br />
Ludwig v. Schlözer, 1735-1829] gewiß noch itzt nennen darf, dessen auf seltene<br />
Weise mit Geist gepaarte Gründlichkeit ihn besonders anzog und den, vermittelst<br />
seiner scharfsinnigen gelehrten Kritik, Deutschland als den Wiederhersteller der<br />
bessern Geschichtslehrmethode verehrt. In diesen glücklichen Jahren schloß er innere<br />
Freundschaft mit dem Dichter Bürger, dem Historiker Sprengel [1746-1804] und mit<br />
dem Freiherrn v. Kielmannsegge [Christian Albrecht von Kielmannsegge, 1748-1811,<br />
ehemaliger Freund Goethes in Wetzlar] (itzt Präsidenten des Hof- und Landgerichts<br />
zu Güstrow) sowie mit Tesdorpf [1749-1824] (itzt Bürgermeister in Lübeck) […] [er]<br />
arbeitete nebenher an den Rostockischen Gelehrten Zeitungen (welche Sprengel<br />
dirigirte, der damal auch nach seiner Vaterstadt Rostock zurückgekehrt war) und<br />
nachher an der Allgemeinen Deutschen Bibliothek. 13<br />
In jener Zeit, als er in Lübeck über seine berufliche Zukunft nachdachte, die seinen<br />
Neigungen und Fähigkeiten entsprechen sollte, war er in den Lübecker Kreis um<br />
Overbeck und Sprickmann, einem Ableger des Göttinger Hainbundes, die den<br />
arrivierten Schriftsteller Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (1737-1823) verehrten,<br />
gesellschaftlich eingetaucht, auch reiste er nach Hamburg, um Klopstock eine Woche<br />
lang aufzusuchen, mit dem er freundschaftlich-achtungsvoll verbunden war. Er<br />
erteilte dem betagten Dichter später auch juristischen Rat. Auch festigte er seine<br />
Liebe zu seiner Cousine Anna Dorothea (Doris) Hake, deren Vater ein Lübecker<br />
Prediger war. Doris galt als eine der schöngeistigsten Frauen der Stadt und wurde<br />
„Glaukopis“ genannt. Mit ihr schloss JEB 1781 ein Ehebündnis, aus dem mehrere<br />
Kinder hervorgingen, von denen der Sohn Carl (1.10.1788-13.4.1853), zwei Töchter,<br />
Charlotte Juliane (1791) – Taufpatin wurde am 26.9. Elisa von der Recke (1754-1833) -<br />
und Sophie (1794) überlebten. JEB’s Großvater, Hans Heinrich Biester, geb. 1676 in<br />
Hainholz, starb 1748 in Hannover. Sein Vater, Ernst August, wurde Kaufmann und<br />
zog früh nach Lübeck, handelte dort mit Seide, heiratete eine Witwe aus Kassel, die<br />
1750 verstarb, wurde Vater von fünf Kindern, von denen JEB das jüngste war. Der<br />
5
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Vater heiratete nicht wieder, investierte viel in die Bildung seiner Kinder, verarmte<br />
jedoch im Laufe der Zeit und starb am 8.11.1779.<br />
[...] Dabei ward ihm von seinem Vater ein sehr ausgedehnter Ankauf von Büchern<br />
gestattet so daß der junge Mensch eine Art von Bibliothek besaß (z.B. Bayles<br />
Dictionnaire und andre große Werke) um welche mancher ältere Gelehrte ihn zu<br />
beneiden Ursache hatte. [Ebd.]<br />
JEB erinnerte sich an die Zeit seiner beruflichen Entfaltung als Lehrer am<br />
Pädagogium im mecklenburgischen Bützow, an dem er nicht ungern tätig war, doch<br />
sie brachte keine Erfüllung:<br />
[...] Er sehnte sich ohnedas mehr nach einem literarischen Amt, wozu aber dort keine<br />
Gelegenheit war und als Schriftsteller hatte er sich nicht gezeigt, auch keine Lust,<br />
sich als solcher zu zeigen. Nach anderthalb Jahren kam ihm der Antrag zu einer<br />
Lehrerstelle an dem Pädagogium in Bützow, wohin er Ostern 1773 ging. [...] Biester<br />
lehrte auf dem Pädagogium Sprachen, Geschichte, schöne Wissenschaften und ward<br />
1774 Doctor der Rechte, um auch vor Studenten Kollegia über Universalhistorie,<br />
Rechtsgeschichte und griechische Autoren lesen zu können. Im Dezember 1775<br />
verließ er Bützow, nachdem er sein Amt niedergelegt hatte, machte im Sommer 1776<br />
eine Reise nach Berlin und hielt sich noch eine Zeitlang in Mecklenburg auf, auch zu<br />
Eickhof bei dem Landmarschall Lützow, dessen Enkel er unterrichtete […]. Der Ort<br />
ist klein aber angenehm. Es lehrten dort als Professoren ganz vorzügliche Männer:<br />
Tetens, Toze, Karsten, Witte, Trendelenburg, Quistorp; und auch an dem<br />
Pädagogium standen sehr ausgezeichnete Köpfe. (Nachher ist sowohl dieses als auch<br />
die Universität aufgehoben worden). [Ebd.]<br />
Den eigentlichen Grund, warum er Bützow verlassen hatte, nannte er nicht; doch er<br />
geht aus einem Brief hervor, den der Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voss am<br />
15.12.1775 schrieb:<br />
Hab’ ich dir schon Biesters Schicksal erzählt? Er war Conrector in Bützow, und<br />
feierte diesen Sommer Klopstocks Geburtstag auf dem Lande. Unter andern mußten<br />
einige Mädchen um einen Altar tanzen, und Blumen darauf werfen. Dies ward<br />
bekannt, man hätt’ ihn in Verdacht des Heidenthums, und nahm ihm sein Amt. Stell’<br />
dir die Aufklärung in meinem lieben Vaterland vor. 14<br />
Am 9.2.1777 schrieb Christian Adolf Overbeck (1755-1821), der 1814 Bürgermeister in<br />
Lübeck wurde (das über die Jahrhunderte hinweg bekannte, zum Volkslied<br />
gewordene Gedicht „Komm lieber Mai und mache...“ erinnert noch an ihn), an den<br />
Freund Matthias Sprickmann (1749-1833), Verwaltungsbeamter zu Münster:<br />
Doris aber hat ihren Biester ganze 3 Monate lang bey sich gehabt; nun aber ist er fort<br />
nach Berlin. Ach Himmel! wie stöhnt sie nun! 15<br />
Was wollte JEB in Berlin? Der preußische Kulturminister Freyherr von Zedlitz suchte<br />
einen fähigen jungen Mann und wandte sich in einem Privatbrief an den versatilen<br />
Buchhändler <strong>Nicolai</strong>, um anzufragen, ob dieser ihm nicht einen geeigneten Mann<br />
6
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
empfehlen könne. <strong>Nicolai</strong>s Wahl fiel auf JEB. Der Minister teilte am 30.3.1776 <strong>Nicolai</strong><br />
mit:<br />
Sie machten mir zwar letzthin Hoffnung, den Gelehrten aus Rostock Biester (…) zu<br />
einer Hierherreise bereden zu können, verlangten aber doch eine nähere Anzeige der<br />
Umstände, in welchen er sich (...) befinden würde. 1. ist es unumgänglich nöthig, daß<br />
ein Mann, den ich im Schulfach brauche, unsern Canzley-Styl lerne oder darin stets<br />
übe; er muß also ein Sekretariat dabey führen (...) 2. alle Arten von Schul-Arbeiten,<br />
die beym Oberkuratorin vorkommen können, Durchgehen des Plans, Prüfung der<br />
Schulberichte, Vorschläge (...) muß er übernehmen können, und sich hauptsächlich in<br />
diesem Fach brauchbar zu machen suchen. Dafür ist 300 Taler, freyes Logis, Holz<br />
und Mittagstisch mit mir, und unfehlbare Beförderung, wenn sich ein Fach findet<br />
und Nb. der (Beförderung) Erwartende würklich arbeiten kann und will. 16<br />
Seiner Freude Ausdruck gebend, teilte JEB <strong>Nicolai</strong> am 7.12.1776 die verbindlichen<br />
Worte v. Zedlitzens mit:<br />
„Alle Bedenklichkeiten sind gehoben. Und ich sage Ihnen, daß ich mein Wort ganz<br />
halten werde, daß es mir angenehm seyn wird, Sie in dem Verhältnisse, das ich<br />
Ihnen angetragen habe und das Sie angenommen haben, in meinem Hause zu<br />
haben.“ Sie glauben nicht, wie sehr mich das freut! Ich hab’s erfahren, was es ist, von<br />
den Wellen der Ungewissheit herumgeworfen zu werden: Nun athme ich freyer,<br />
denn nun bin ich im Hafen. [...] Nie werde ich es vergessen, können, theuerster Herr<br />
<strong>Nicolai</strong>, dass zunächst ich Ihnen diese Stelle zu danken habe, alle Freuden in Berlin,<br />
alles daraus noch künftig entspringende Glück. [Ebd.]<br />
JEB trat seine Stelle als Privatsekretär am 1.2.1777 an, wobei sich peu-à-peu<br />
freundschaftliche Bande mit dem Minister knüpften, den er immer mehr entlastete<br />
und damit nahezu unentbehrlich werden sollte. So konnte am 30.3.1777 Overbeck an<br />
Sprickmann u. a. den Erfolg der Berliner Mission vermelden:<br />
Doris schmachtet jetzt ihrem Biester nach, der in Berlin Sekretair des Minister<br />
Zedtwitz [sic!] geworden ist. Ich glaube doch nicht, daß ich mich in Doris hätte<br />
verlieben können, so ein herrliches Mädchen sie auch ist. Sie hat gar kein douceur,<br />
die ich von einem Mädchen durchaus verlange. Ihr Gang ist in der That ein wenig<br />
bäurisch, und ihre Lippen sind nicht sonderlich geschickt Honigreden zu ergießen,<br />
denn immer stößt ihre Zunge mit Lallen drein. Bei meiner Bine bin ich anders<br />
gewohnt. Doris ist mir nicht einmal reinlich genug. Sonst hab’ ich für ihre Seele allen<br />
Respect. Hagel noch Einmal, was ist sie gebildet! 17<br />
Wie erwähnt, verfasste JEB bereits mehrere Rezensionen für die ADB und stand<br />
dadurch in Korrespondenz mit <strong>Nicolai</strong>. Über seine neue Tätigkeit schrieb er<br />
retrospektiv:<br />
Am 1ten Februar 1777 trat er in Berlin die im vorigen Jahr verabredete Stelle bei dem<br />
Staatsminister Freiherr von Zedlitz an, welchem er zuerst durch <strong>Nicolai</strong> war<br />
vorgeschlagen worden. Was er hier fand. Geist- und Herz-Erhebendes, Belebendes,<br />
Bildendes, ergiebt sich für Jeden der den Ort und die Zeit und die Namen bedenkt.<br />
7
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Friedrich der Große regierte; Seine edlen, festen Grundsätze verbreiteten sich über<br />
alle Theile der Verwaltung. Zedlitz war Justizminister Chef des geistlichen<br />
Departements: ein heiterer liebenswürdiger Staatsmann, ein Freund der Musen, ein<br />
Kenner der Musen, ein Kenner der Wissenschaften [...] Biester ward sein<br />
Privatsekretär im literarischen und pädagogischen Fache und als solcher sein Haus-<br />
und Tischgenosse. Er hatte die Korrespondenz mit Gelehrten, auch außer Landes zu<br />
führen […] 18<br />
…und vieles andere mehr. Hier verband sich in glücklicher Weise das Interesse mit<br />
der Erkenntnis, dass das Leben ein ständiger Erkenntnis gewinnender Prozess,<br />
kurzum, dass Leben gleichbedeutend mit Lernen ist. Bedenkt man, dass Lübeck um<br />
1789 eine Bevölkerung von ca. 30.000 Personen hatte und in Berlin 1795 172.000<br />
Menschen ansässig waren, davon allein 284 Schriftsteller 19 , so ist zu ermessen, wie<br />
beeindruckend dieser Größenvergleich ist. Von Berlin aus schreibt er an seinen<br />
Intimus Bürger am 1.3.1777:<br />
Aber, ach, was ist Berlin für eine schöne Stadt. Es erfreut Herz und Seele, die schönen<br />
breiten geraden Gassen zu sehen, die gewaltigen Gebäude, die herlichen Statüen. Ich<br />
bin im Sommer vor[igen] Jahrs schon 14 Tage hier gewesen und kenne also schon<br />
den Thiergarten und Charlottenburg. Hier leb’ ich also; - in der festen Hoffnung, daß<br />
Gott mir bald aus meinen Schulden (deren ich leider noch immer habe) und aus<br />
meiner Armuth heraushelfen, und mir dann ein Stück Brot geben wolle, um es mit<br />
meinem Weibe zu theilen. 20<br />
Ein junger Mensch „of independent mind“ (mit geistiger Freiheit), dem „get-up-andgo-spirit“<br />
(geistigem Elan), mit einem konkreten Ziel vor Augen, fand auch im<br />
ausgehenden 18ten Jhdt. durch Beziehungen und der entsprechenden Persönlichkeit<br />
einen Weg sich zu empfehlen, um das Gewünschte auch über Hindernisse hinweg zu<br />
erreichen. In einem Brief vom 22.9. desselben Jahres, lässt er Bürger wissen, der mit<br />
<strong>Nicolai</strong> wegen eines Volkslieder-Disputs hadert:<br />
[…] Nikolai [sic], das versichere ich dich, ist sonst ein gar braver Kerl, gutmüthig,<br />
munter, dienstfertig, freundschaftlich; er hat gar mancherley Kenntnisse, hat über<br />
sehr viele Dinge, die man ihm nicht zutrauen sollte, nachgedacht, und spricht gern<br />
und gut darüber. Wenn du hier wärest, du würdest gewiß bald mit ihm<br />
Bekanntschaft und Umgang gewinnen, und er würde dir gefallen. Wenigstens unter<br />
den hisigen Gelehrten ist er der artigste, umgänglichste, beste. Er ist gegen mich<br />
ausserordentlich freundschaftlich, und thut mir mancherley Gefälligkeiten. [...]<br />
Freylich werde ich wol einst durch meinen Minister (von Zedlitz), irgend eine Stelle<br />
erhaschen können, die mir und meinem Weibe eine Hütte und Brot gewähren wird.<br />
Ich wünsche mir das gerade wenn ich 30 Jahre alt seyn werde; ob ich’s erhalten<br />
werde, weiß Gott. [Ebd.]<br />
Nach siebenjähriger Sekretärstätigkeit ergab sich für JEB die Möglichkeit, von einem<br />
personengebundenen Arbeitsverhältnis in eine festere Anstellung zu wechseln; die<br />
Chance zu einer „unfehlbaren Beförderung“ wie es der Minister einst schrieb. An der<br />
Königlichen Bibliothek wurde eine Bibliothekarsstelle vakant, da der abergläubische<br />
8
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
französische Mönch Pernetty 1784 Berlin fluchtartig verließ, in der Annahme, ein<br />
Erdbeben, eine Erdzerspaltung würde die Stadt unfehlbar zerstören. Wiederum war<br />
es <strong>Nicolai</strong>, der den Marchese Lucchesini (1751, Lucca – 1825, Florenz) als Kammerherr<br />
Friedrichs II gewinnen konnte, JEB beim König wegen der vakanten Bibliotheksstelle<br />
vorzuschlagen. Der König dachte zunächst an andere, doch wollte er sich nicht<br />
versagen, Biester aufgrund der Empfehlungen zumindest anzuhören. Dieser wurde<br />
am 10. Januar 1784 auf das Charlottenburger Schloss beordert und erhielt abends um<br />
7 Uhr die für seine endgültige Zukunft begehrte Position eines zweiten Bibliothekars,<br />
die er, später zum Ersten Bibliothekar aufrückend, bis zu seinem Tode bekleiden<br />
sollte. Auf wundersame Weise fand sich hier Beruf und Berufung zusammen und als<br />
bürgerlicher Aufklärer wurde er der, der er bereits war: Beruf und Berufung<br />
zusammen. Zu jener Zeit stand die Spätaufklärung als geistiges Fluidum kurze Zeit<br />
hoch im Kurs. Sie repräsentierte eine Gesinnung, die nachmals als preußischer Geist<br />
mit preußischen Tugenden propagiert in den Geschichtsbüchern Eingang fand,<br />
verbunden mit der selbstverpflichtenden Forderung, freimütig und ehrlich, d. h.<br />
unbestechlich zu sein.<br />
Der Hofrat Karl August Böttiger (1760-1835), der sich wegen seiner z. T. freimütigen<br />
Kritik den Unwillen Goethes und Schillers in Weimar zugezogen hatte, folgte nach<br />
Herders Tod einem Ruf nach Dresden als Direktor der dortigen Antikensammlung.<br />
Böttiger schätze JEB’s Gelehrsamkeit, besuchte ihn gelegentlich in der Bibliothek und<br />
wurde gut mit ihm bekannt. Er schrieb einen 13-seitigen Beitrag unter dem Titel:<br />
„Erinnerungen an das literarische Berlin im August 1796“, der auch J. E. Biester zum<br />
Thema hatte. Darin hieß es u. a.:<br />
Der König wünschte ihn nun selbst zu sehen, und ließ ihn einmal, als er in Berlin<br />
war, zu sich rufen. Biester erkundigte sich in aller Eile bei <strong>Nicolai</strong>, der den König<br />
schon mehreremale gesprochen hatte, nach dem Ceremoniel. Mit pochendem Herzen<br />
trat er, von den Kammerhusaren angewiesen, in des Königs Zimmer, der den Rücken<br />
der Thüre zugekehrt neben dem Kamine saß und sich, einen feurigen Blick<br />
schießend, umdrehte. Wo hat er studirt? In Göttingen. Das gefiel dem König, der vor<br />
Göttingen eine große Achtung hatte, und Münchhausens in jener berühmten<br />
Unterredung mit Garve in Breslau mit Lob gedachte. Als ihm Biester sagte: er habe<br />
vorzüglich sich mit der Geschichte beschäftigt, stutzte der König und fragte, ob dieß<br />
so viel bedeute, als Historie, weil ihn das deutsche Wort nicht geläufig war. Die<br />
Frage vor welcher Biestern am meisten bange war, kam nun auch: wo ist Er zeither<br />
gewesen? Biester mußte antworten: als Sekretair beim Minister Zedlitz [„Zedlitz war<br />
mit dem König zerfallen“ vermerkte Böttiger an anderer Stelle, so dass ihm v. Zedlitz<br />
in Erlangung der Position nicht behilflich sein konnte]. Da nickte der König<br />
einigemal bedächtig mit dem Kopfe: So, so, hält sich Zedlitz einen Secretaire! Er<br />
sprach über eine halbe Stunde mit ihm, ehe er das bekannte Zeichen der Entlassung<br />
mit dem Hutabnehmen gab, und war über alle Erwartung gnädig. 21<br />
Aus der Rückschau des Jahres 1806 vermerkte JEB in seiner „Selbstbiographie“:<br />
9
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Das Vergnügen über diese Stelle ward durch die Freude erhöht, den erhabenen<br />
Mann des Jahrhunderts in der Nähe zu sehn und Worte teilnehmender<br />
Erkundigungen und ausführlicher Belehrungen aus seinem Munde zu hören. 22<br />
Über seine Bibliothekarstätigkeit hat Eugen Paunel umfassend und detailliert<br />
geschrieben, daher sollen nur zwei ganz unterschiedliche Autoren zitiert werden. So<br />
schrieb Heinrich von Treitschke (1834-1896), der nicht gerade als Sympathisant der<br />
Aufklärung gelten kann, über<br />
J. E. Biester, der Herausgeber jener Berlinischen Monatsschrift, in deren Spalten die<br />
aufgeklärten Leute von der Spree ihre angeborene Verstandes- und Naseweisheit<br />
abzulagern pflegten. Trocken und schwunglos, ohne Sinn für die genialen Kräfte der<br />
neuen Literatur, war Biester doch ein gründlicher Gelehrter, gerade so weit<br />
Polyhistor, wie es der Beruf des Bibliothekars verlangt, und wartete seines Amts so<br />
umsichtig, daß selbst sein nachmaliger Vorgesetzter, Minister Wöllner, der Todfeind<br />
der Berliner Aufklärer, den Unentbehrlichen nicht zu entfernen wagte. 23<br />
- Sowie der zeitgenössischen Schriftsteller und Preußenkenner Eberhard Cyran<br />
(1914-1998):<br />
Ein Hort der Musen und des Wissens war die neue Königliche Hofbibliothek am<br />
Opernplatz, die sich unter Leitung Johann Erich Biesters zu einer der führenden<br />
Sammlungen im deutschen Raum entwickelte. Von jetzt an standen die Werke von<br />
Bacon, Hobbes, Locke, d’Alembert, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, wie<br />
von Leibniz, Wolff, Kant und ihren Weggenossen dem aufgeschlossenen Bürgertum<br />
zur Verfügung und wirkten mit zur geistigen Mündigkeit und Volkssouveränität,<br />
die die Entwicklungen des neunzehnten Jahrhunderts kennzeichnen. Die Namen<br />
Winckelmann und Lessing, die sich um ihre Anstellung bei dieser Institution<br />
bemühten, zeugen von deren Ruf und Ausstrahlungskraft. 24<br />
Als JEB seine Wirksamkeit ab 1777 in Berlin aufgrund der Fürsprache geachteter<br />
Männer wie <strong>Nicolai</strong>, von Zedlitz, dem Grafen Herzberg u. a. peu-à-peu entfaltete,<br />
manche sprachen missgünstig von Protektion und Günstlingswirtschaft, hatte er<br />
bereits 37 nachweisbare Rezensionen unterschiedlicher Qualität an <strong>Nicolai</strong> für dessen<br />
ADB geliefert, die dieser seit 1774 darin aufnahm. Es handelte sich überwiegend um<br />
Beurteilungen von Geisteserzeugnissen, deren Autoren längst auf dem Altar der Zeit<br />
geopfert oder dem Strom des Vergessens - Lethe - überantwortet wurden. <strong>Nicolai</strong><br />
druckte diese Rezensionen in den regulären Bänden 22–32 ab. Der literarischen<br />
Nachwelt von Interesse sein könnten JEB’s Stellungnahmen zu:<br />
C. F. D. Schubart: Deutsche Chronik auf das Jahr 1774<br />
C. M. Wieland: Der verklagte Amor, 1777<br />
M. Claudius: Sämmtl. Werke des Wandsbeker Boten, 1777<br />
K. W. Ramler: Lyrische Blumenlese, Band 1-5, 1777<br />
J. K. Wezel: Lebensgeschichte Tobias Knaut des Weisen<br />
10
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Die Kommentare, die oftmals nur eine bis zwei DIN-A-5 Seiten umfassten,<br />
erschienen z. T. anonym oder halb anonym, da sie ein Kürzel, eine Signatur trugen.<br />
Bei JEB waren es überwiegend die Zeichen: Ta, Me, Cz und Df. Aber auch in den<br />
separat erschienenen Anhängen zu den einzelnen Bänden, die gesammelt in einem<br />
jeweiligen Einzelband später erschienen, kontribuierte JEB nachweislich vier<br />
Rezensionen, wie in den Anhängen zu den Bänden 13-24, 1777:<br />
G. E. Lessing: Trauerspiele Miß Sara Sampson, Philotas, Emilia Galotti<br />
[Herder, Goethe u.a.:] Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter<br />
F.G. Klopstock: Der Messias, Band 3 und 4 [die Rezension erstreckt sich<br />
von Seite 1181 bis 1214!]<br />
War JEB bislang der Nehmende, so war er gegenüber <strong>Nicolai</strong> auch gerne der<br />
Gebende und blieb dies auch bis zu <strong>Nicolai</strong>s Tod. Es waren nicht viele Rezensionen,<br />
doch verfügte <strong>Nicolai</strong> bereits über eine große Anzahl Mitarbeiter, die in dem von<br />
ihm gestrickten und sorgsam überwachten Netzwerk tätig waren. Er war ein genialer<br />
Organisator, der die für ihn Arbeitenden das zu beurteilende Sachgebiet zuwies, an<br />
dem sie gebunden waren, z. B. Mathematik, Geologie, Philologie, Philosophie, Justiz,<br />
Historie. Hier wurden die Neuerscheinungen rezensiert, auch in sehr offener und<br />
schonungslos belehrender Weise, wenn es um die Wahrheitsfindung ging. JEB’s<br />
Rezensionen in den Nachtragsbänden finden sich hauptsächlich unter den Rubriken<br />
„Vermischte Schriften“ und „Kurze Nachrichten von den schönen Wissenschaften“.<br />
In Berlin ansässig, stieg auch die Anzahl der Biester’schen Beiträge. In den Jahren<br />
1778-1783 sind nochmals 38 nachweisbar, also insgesamt 75 Rezensionen. Daneben<br />
nochmals 13 als Anhänge zu den Bänden 25–56, so dass <strong>Nicolai</strong> insgesamt 93<br />
Rezensionen veröffentlichen konnte. Darunter u. a.:<br />
Voltaire: Kandide<br />
J. K. Wezel: Peter Marks<br />
J. F. Goldbeck: Über die Erziehung der Weisenkinder<br />
J. H. Jung-Stilling: Die Geschichte des Herrn von Morgenthau<br />
Anakreon: Gedichte [in Übersetzung]<br />
J. G. Meusel: Das gelehrte Deutschland<br />
Justus Möser: Patriotische Phantasien<br />
Friedrich Müller: Fausts Leben<br />
In den Nachträgen erschienen:<br />
L. G. Kosegarten: Psalmen<br />
Fr. <strong>Nicolai</strong>: Eyn feyner kleyner Almanach vol schöner echterr liblicherr<br />
Volkslieder<br />
C. M. Wieland: Der deutsche Merkur: Jg.1774-1777<br />
Oliver Goldsmith: Das entvölkerte Dorf, ein Gedicht<br />
J. F. Goldbeck: Literarische Nachrichten aus Preußen<br />
11
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
G. E. Lessing: Nathan der Weise [12 Seiten!]<br />
J. H. Voss: Homers Odyssee [Übersetzung von 1781]<br />
JEB’s Rezensionen endeten mit dem 56. Band im Jahre 1783, denn im dritten Quartal<br />
erschien die von Friedrich Gedike und JEB neu gegründete Berliner Monatsschrift,<br />
die kein Rezensionsorgan war, auch nicht sein wollte. Darin veröffentlichte letzterer<br />
244 Artikel, wobei mit einer Dunkelziffer von anonym erschienenen Beiträgen sowie<br />
umfangreichen Anmerkungen gerechnet werden darf. <strong>Nicolai</strong> selbst begünstigte das<br />
Unternehmen und ließ über 90 Aufsätze in der BMS und seinen Nachfolgeorganen<br />
erscheinen. Am Anfang des ersten Stücks des 96. Bandes der „Neuen allgemeinen<br />
deutschen Bibliothek“ (NADB) des Jahres 1805 ließ <strong>Nicolai</strong> ein „Bildnis des Königl.<br />
Bibliothekars Hrn Biester“, seines Freundes, von dem Maler Laurens erscheinen.<br />
Dr. Karl Aner schrieb in seiner Biographie „Der Aufklärer Friedrich <strong>Nicolai</strong>“<br />
treffend:<br />
[...] das Tagebuch der Elisa von der Recke rühmt ihn als treuen Retter aus pekuniären<br />
Verlegenheiten. Ein kleines, aber sinniges Zeichen seiner vornehmen<br />
Uneigennützigkeit war das Freundschaftsgefühl – jener menschlich schönste Zug des<br />
achtzehnten Jahrhunderts, der das Gerede von der Gemütsarmut der deutschen<br />
Aufklärung längst widerlegt haben sollte – auch in <strong>Nicolai</strong> rege entwickelt.<br />
Einundsiebzig Freunde zählt Göckingk auf; die intimsten der späteren Jahre waren<br />
der Philosoph Joh. August Eberhard, der nach Lessings Abschied von Berlin seiner<br />
Zeit schon den Dreibund ergänzt hatte, Biester, der nach Moses’ Tod in die Lücke<br />
trat und alle Manuskripte <strong>Nicolai</strong>s vor der Drucklegung zur Durchsicht erhielt,<br />
zuletzt Göckingk selbst. 25<br />
Als <strong>Nicolai</strong> 1811 starb, stellte auch JEB das Publizieren seiner „Neuen Berlinischen<br />
Monatsschrift“ ein. Damit neigte sich die Spätaufklärung dem Ende zu. Das<br />
Leuchtfeuer der deutschen Aufklärung, Gotthold Ephraim Lessing, war bereits<br />
erloschen. Er wurde zu einem Klassiker, der zwar gelesen wurde, doch über den<br />
man nicht mehr leidenschaftlich diskutierte. Johann Jakob Engel (1741-1802),<br />
Friedrich Gedike (1754-1803) starben. Nun auch <strong>Nicolai</strong>, von dem Engel sagte:<br />
„Jedermann hat wohl sein Steckenpferd, aber N i c o l a i hat einen ganzen Stall<br />
davon.“ 26<br />
Viel Verbindendes gab es bei den beiden Protagonisten der Berliner Aufklärung in<br />
der Beurteilung von Sachverhalten und Situationen. Sei es ihre Gegnerschaft den<br />
Jesuiten gegenüber, oder dem angeblich wahrgenommenen krypto-katholischen<br />
Vormarsch auf preußischem Gebiet; sie dachten ähnlich. Gelegentlich schossen sie<br />
über das eigentliche Ziel hinaus, wenngleich – wie man sagt – Übertreibung<br />
anschaulich macht, und JEB sah dies in späteren Jahren ein. Sie gingen auch konform<br />
in dem Respekt für Menschen jüdischen Glaubens. Der Hitzkopf J. G. Fichte (1762-<br />
1814), der Widerspruch an seinen philosophischen Ansichten kaum duldete und<br />
letztlich mit vielen denkenden Menschen in Streit kam, schmiedete heimlich<br />
12
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
menschenverachtende Verse gegenüber <strong>Nicolai</strong> und JEB, die erst im 20. Jhdt. in den<br />
gesammelten Werken erschienen. Als 1801 mit Unterstützung von A. W. v. Schlegel<br />
(1767-1845) das Buch „<strong>Nicolai</strong>s Leben und sonderbare Meinung“ herauskam, tadelte<br />
die Cagliostro-Entlarverin, Elisa v. d. Recke, <strong>Nicolai</strong>s Gelassenheit. So soll sie nach<br />
Gustav Parthey zu <strong>Nicolai</strong> gesagt haben:<br />
„Welchen Nutzen für die Wissenschaft können diese Zänkereien haben, die nur zu<br />
oft in Persönlichkeiten ausarten? Was müssen Sie sich alles gefallen lassen! Ist es<br />
erschrecklich, daß Fichte in seinem neuesten Buch Sie einen Hund genannt hat?“<br />
„Jawohl“ fiel ihr <strong>Nicolai</strong> ins Wort, „ich bin der bellende Hund, der allemal seine<br />
warnende Stimme erheben muß, sobald er merkt, daß irgend etwas in der deutschen<br />
Literatur nicht in Ordnung ist.“ 27<br />
JEB legte sich auch mit Fichte an. Dessen Buch „Der geschlossene Handelsstaat“<br />
wurde in der BMS von einem unbekannten Rezensenten auf Mängel in der<br />
praktischen Durchführung geprüft. Der furiose Fichte suchte JEB in seiner „Stube“<br />
auf und forderte ultimativ, ihm weitere Angaben über den Kritiker zu machen, was<br />
dieser jedoch ebenso kategorisch ablehnte. (Es handelte sich um den noch jungen<br />
Adam Heinrich Müller (1779-1829), den nachmaligen Publizisten und Autor der<br />
dreibändigen „Elemente der Staatskunst“, 1810). Fichte gab dann in der sehr<br />
kurzlebigen Monatsschrift „Kronos“ das Gespräch mit JEB in wörtlicher Rede<br />
heraus. JEB untersagte Fichte in einer Gegenschrift der BMS, sich jemals wieder auf<br />
seiner Stube blicken zu lassen. Der Dichter und Freund JEB’s Karl Müchler (1763-<br />
1857) fasste es in einem kurzen Vers zusammen, der in der BMS nachzulesen ist:<br />
An den Bibliothekar Biester<br />
Über einen vor einiger Zeit gehabten Besuch<br />
Ein Schwärmer lässt sich nicht bedeuten,<br />
Denn er ist seines Wahnes Knecht.<br />
Was nützt es dir mit ihm zu streiten?<br />
Brauch dein geschlossenes Stubenrecht. 28<br />
Auch in freundschaftlichen Beziehungen gibt es Trennendes. Zwar wurde <strong>Nicolai</strong><br />
hochgeachtet, Lichtenberg, Thümmel und eine Unzahl Gelehrter schrieben ihm und<br />
sprachen respektvoll über ihn, allein er war ein entschiedener Gegner jeglicher<br />
spekulativen Philosophie. Reinheit der Begriffe galt ihm, dem Empiriker, als oberstes<br />
Gebot. Beschäftigte er sich mit den Schriften des Philosophen Christian Wolff, so las<br />
JEB den Skeptiker Hume. Ein originärer Denker von Format wie Kant und seine<br />
Begriffswelt mit ihrem a priori und a posteriori musste <strong>Nicolai</strong> fremd bleiben, er<br />
konnte und wollte da nicht folgen - andere wie Moses Mendelssohn und Garve<br />
gaben dies als geistiges Defizit auch offen zu - und zog Kants Ausdrucksweise und<br />
Sprachgebrauch teilweise ins Lächerliche, wenn er von der Philosophie des „von<br />
vorne und von hinten“ sprach. Spekulationen und Worthülsen der Idealisten von<br />
Fichte bis Hegel gespickt mit Dichterergüssen à la Novalis, Eichendorff, die den<br />
Aufklärern abhold waren, flogen wie Geschosse in alle Richtungen kreuz und quer<br />
13
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
am philosophischen Himmel, doch zauberten sie oft nach mehrjährigem Studium<br />
dem jungen Menschen pragmatisch keine anfassbare Wurst in die Pfanne. Heute<br />
würde man von der idealistischen Philosophie den Eindruck gewinnen, sie sei eher<br />
in der transzendentalen virtual-reality eines Wolkenkuckucksheims beheimatet,<br />
wenn z. B. von dem Ding-an-sich die Rede ist. Und wenn es um die Moral geht, so<br />
würde <strong>Nicolai</strong> den Begriff der goldenen Regel verwenden „Was du nicht willst, was<br />
man dir tu, das füg’ auch keinem anderen zu“, statt den „kategorischen Imperativ“<br />
zu bemühen. So beklagte sich der unermüdliche „Racker“ (so bezeichnete in einem<br />
Brief Wilhelm von Humboldt einst JEB) <strong>Nicolai</strong> bei Böttiger, in dem er an den Rand<br />
seines Briefes v. 16.3.1803 schrieb:<br />
Eben wird in dem letzten Aprilstück der Monatsschrift wieder ein gelehrtes Lernen<br />
nur nichts von mir abgedruckt. Calamo audiamus no diabolus nor inveniat offissus!<br />
29<br />
Hier erst kann sich bewähren, was die Rede von Toleranz wert ist. Blieb <strong>Nicolai</strong><br />
neben einer guten Elementarbildung doch im wesentlichen Autodidakt, der unter<br />
anderen Lebensumständen gerne studiert hätte, so gab es nunmehr eine nicht<br />
geringe Anzahl Persönlichkeiten, die auch ohne akademischen Bildungsgrad<br />
gesellschaftliche Bedeutung errungen; in den Kolonien Neuenglands wurden<br />
Thomas Paine und Benjamin Franklin, in Britannien Samuel Johnson als<br />
Autodidakten bekannt. Dr.-Titel werden in der Regel nach Abschluss akademischer<br />
Leistungen verliehen. <strong>Nicolai</strong> jedoch erhielt einen Ehrendoktortitel der Philosophie<br />
von der Universität Helmstedt für sein Lebenswerk, und als der Aufklärer als letzter<br />
der alten Garde auch noch 1799 Außerordentliches Mitglied der Preußischen<br />
Akademie der Wissenschaften und somit die verspätete Ehrung nicht ausblieb, mag<br />
er wohl nicht ohne Berechtigung Genugtuung und Stolz empfunden haben. JEB<br />
wurde infolge der Angliederung der Bibliothek mit der Akademie als Leiter der<br />
Bibliothek 1798 zum Ordentlichen Mitglied ernannt, musste sich aber keiner Wahl<br />
unterziehen. Ihn in die Akademie aufzunehmen schlug nach Friedrichs II. Tod 1787<br />
Graf v. Hertzberg (1725-1795) vor, doch das v. Wöllner’sche Regime unter König<br />
Friedrich Wilhelm II. ermöglichte dies nicht. Dass beide Berliner Aufklärer unter den<br />
jüngeren Akademikern wie Fossilien aus einer längst versunkenen Epoche in die<br />
Gegenwart hineinragten, machte sie den teilweise in sich selbst verliebten Wald- und<br />
Wiesen-Romantikern nicht gerade sympathisch.<br />
Ein Beispiel sei erwähnt: Während JEB in der Akademie einen Nachruf auf <strong>Nicolai</strong><br />
hielt, fand sich offensichtlich keiner für JEB, auch der eng vertraute Philologe und<br />
humorvolle Bibliothekskollege Philipp Karl Buttmann (1764-1829), seit 1806<br />
ordentliches Mitglied der Akademie, wagte es nicht. Keiner wollte oder hatte ein<br />
Interesse daran, eine Gedächtnisrede auf JEB zu halten, was auch nicht<br />
verwunderlich war. Stand doch der Theologe Friedrich Schleiermacher der<br />
philosophischen Klasse vor, und es war bekannt und unvergessen, dass die<br />
Aufnahme des nachmaligen Rektors der neu gegründeten Berliner Universität,<br />
14
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Fichte, in die Akademie der Wissenschaften nach Abstimmung der Mitglieder<br />
deshalb abgelehnt wurde, weil zwei Mitglieder, <strong>Nicolai</strong> und JEB, mit ihren Vetos und<br />
öffentlichen Äußerungen nach vorhergehender Pro- und- Kontra Stimmengleichheit<br />
den Ausschlag gaben. Im Grunde war man froh, dass <strong>Nicolai</strong> und JEB von der<br />
preußischen Bühne abtraten. Noch an dem Tag als JEB starb, wurde das<br />
Schleiermacher’sche Bibliotheks-Reglement eingebracht. In den „Abhandlungen“ der<br />
Preußischen Akademie der Wissenschaften für die Jahre 1816-1817, die 1819 in der<br />
Realschulbuchhandlung Berlin erschienen, wurden auf Seite 4 lapidar zwei<br />
Verstorbene namentlich genannt. Über den einen: „am 20. Februar Herr Jo. Erich<br />
Biester“. 250 Jahre später erinnerte Frau Dr. Friedhilde Krause in einem Vortrag: „Die<br />
slawenkundlichen Studien von Akademiemitglied Johann Erich Biester - Ein Beitrag<br />
anlässlich seines 250. Geburtstages“ am 17. Nov. 1999 in der Klasse für Sozial- und<br />
Geschichtswissenschaften der Leibniz-Sozietät an den kleinen Kommoden-Bibliothekar.<br />
JEB erkannte schon früh die Bedeutung von <strong>Nicolai</strong>s monumentalem Werk, der<br />
ADB; es erschienen bis 1793 immerhin stattliche 107 Bände! Daher äußerte er sich in<br />
seiner „Denkschrift auf Friedrich <strong>Nicolai</strong>“, vorgelesen vor der Philologischen Klasse<br />
der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften, den 3. Juli 1812:<br />
[...] ein Werk von solchem Umfange über unser gemeinschaftliches großes Vaterland,<br />
und von solchem Einfluss auf alle Provinzen desselben, wie keine Nation ein<br />
ähnliches aufzuweisen hat; da überhaupt anderwärts nur verhältnismäßig wenige<br />
schreibende Städte sind. Nun erst erfuhr Deutschland, was überall litterarisch in ihm<br />
vorging, es lernte sich selbst kennen, und kam eben dadurch in nähere Verbindung<br />
mit sich selbst. 30<br />
Im Gegensatz zu dem von Goethe und einigen Romantikern geschmähten <strong>Nicolai</strong>,<br />
fand Heine (1797-1856) im Pariser Exil lobenswerte sowie humorvolle Worte und<br />
ging augenzwinkernd über <strong>Nicolai</strong>s manchmal allzu freimütige Robustheit oder<br />
Narreteien des Alters ( the follies of old age) hinweg. JEB sprach in seinem Nekrolog<br />
über <strong>Nicolai</strong> verständnisvolle und anerkennende Worte:<br />
[...] Als späterhin die deutsche Bibliothek hier sollte erneuert werden, fanden sich der<br />
Mitarbeiter nur wenige, weil die, welche Trieb und Muse dazu hatten, jenen neueren<br />
Instituten beigetreten waren; sie musste aus Schwäche aufhören. Aber wer wäre so<br />
verblendet nur auf das letzte Alter seine Blicke zu heften, und nicht zu der<br />
kraftvollen Periode hinaufzusehen, wo das Werk eine Wirksamkeit geäußert hat, die<br />
eine wahre Revolution von der heilsamsten Art in allen Theilen der Wissenschaft<br />
und Kultur, ja in der ganzen Denkungsweise des deutschen Volks hervorbrachte?<br />
Wer drei kritische Werke begründet hat, wie die leipziger Bibliothek, die<br />
Litteraturbriefe, und die allgemeine Bibliothek, und zwar zu einer Zeit, wo nichts<br />
ähnliches vorhanden war; der kann ruhig zusehen, wenn nachher mit frischer Kraft<br />
jüngere Kämpfer in die Laufbahn eintreten, die von ihm schon durchmessen worden<br />
ist, und wo sie noch höhere fernere Ziele erreichen. [Ebd.]<br />
15
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Geselligkeit, d. h. Kommunikation, war ihnen wichtig. Viele lehrreiche und<br />
erbauliche Gespräche mit den Gästen der „Mittwochgesellschaft“, des „Mittwochs“,<br />
mögen damals in den Räumen und dem schönen Garten der Brüderstraße 13<br />
stattgefunden haben. In manchen Jahren reisten die Aufklärer auch nach Bad<br />
Pyrmont zur Kur. So auch 1787, wo sich JEB und <strong>Nicolai</strong> mit Justus Möser (1720-<br />
1794) aufhielten. Über die „Literarischen Notabilitäten“, wie Madame Johanna<br />
Schopenhauer (1766-1838) sie nannte, die sie mit ihrem Ehemann (Vater des<br />
Philosophen Arthur) kennen zu lernen wünschte, schrieb sie:<br />
[...] Zwei von diesen, der Buchhändler <strong>Nicolai</strong> aus Berlin und sein von ihm<br />
unzertrennlicher Freund, der Bibliothekar Biester, Herausgeber der „Berliner<br />
Monatsschrift“, hatten sich indessen uns mehr genähert. <strong>Nicolai</strong> war ein ältlicher,<br />
etwas finster aussehender Mann, was teils von seinem etwas schweren Gehör, teils<br />
von den vielen, von beiden Seiten oft mit großer Erbitterung geführten literarischen<br />
Fehden herrühren mochte, in welche er in jener Zeit verwickelt war. Doch habe ich<br />
im geselligen Umgange nichts weniger als abstoßend oder mürrisch ihn gefunden.<br />
„Sebaldus Nothanker“ war die einzige seiner Schriften, die ich gelesen [...] <strong>Nicolai</strong><br />
ließ oft sehr freundlich auf mein unbedeutendes Geschwätz sich ein, doch wohl nur<br />
aus höflicher Rücksicht gegen mein Geschlecht; denn daß nicht ich, sondern mein<br />
Mann ihn an uns gezogen, ging aus den lebhaften oft heterogensten Gegenstände<br />
erschöpfenden Gesprächen dieser beiden hervor. Bibliothekar Biester war<br />
gewöhnlich der dritte in ihrem Bunde; doch da in seiner Persönlichkeit wenig<br />
Anziehendes für mich lag, so schwebt sein Bild nur in undeutlichen Umrissen meiner<br />
Erinnerung vor. Das Beste hebt jede gute Hausfrau gern bis zuletzt auf, und so will<br />
denn auch ich, indem ich im Begriffe stehe, von Pyrmont zu scheiden, erst zum<br />
Schlusse den Mann nennen, dessen mir höchst liebe und wohltätige Erscheinung die<br />
zerstörende Gewalt der Jahre in meinem Gemüte nie verlöschen konnte, Justus<br />
Möser. [...] Was sein besonderes Wohlwollen auf mich gerichtet, weiß ich nicht, es<br />
war wohl nur die Gunst aber er gab gern und viel und täglich sich mit mir ab. Wie<br />
stolz war ich, wenn die Leute uns beiden nachsahen, indem wir miteinander die<br />
Allee auf und ab abspazierten. Seine sehr hohe und meine sehr kleine Gestalt mögen<br />
sonderbar genug miteinander kontrastiert haben, auch führte er mich gewöhnlich<br />
wie ein Kind an der Hand, weil es mir zu unbequem war, meinen Arm bis zu dem<br />
seinigen zu erheben „God bless the tall gentleman – Gott segne den langen Herrn!<br />
hatten die Londoner Blumen– und Gemüseverkäuferinnen immer ihm nachgerufen,<br />
wenn er in London über Convent-garden-market ging. 31<br />
Im Nekrolog auf JEB in der Stuttgarter „Beilage zur Allgemeinen Zeitung“ Nr. 28, v.<br />
7.3.1816 stand:<br />
Wenn B i e s t e r s nur zu schnell und für Wahrheit und Wissenschaft viel zu früh<br />
erfolgter Tod von seinen jüngern Zeitgenossen weniger gefühlt und beklagt werden<br />
sollte, liegt die Schuld gewiß blos daran, daß er selbst gleichsam zu einer schon<br />
abgestorbenen Generation gehörend, fast der letzte eines Kreises, abtrat, der sich jetzt<br />
selbst kaum überall in die neuesten Ansichten, Hofnungen und Besorgnisse<br />
hineinfinden würde. Aber er hat redlich gewirkt, und bei dem rastlosesten<br />
muthigsten Streben, den Betrug zu entlarven, die Schwärmerei zu züchtigen und die<br />
seichte Vielwisserei zu bestrafen, nie sich selbst, sondern immer die Sache gewollt. 32<br />
16
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Dies galt ebenso für <strong>Nicolai</strong> als auch für alle seiner Anhänger wie Heine ca. 20 Jahre<br />
später richtig beobachtete und trefflich über das geistige Umfeld der Berliner<br />
Aufklärung bemerken sollte:<br />
Sie hatten kein bestimmtes System, sondern nur eine bestimmte Tendenz. Sie glichen<br />
den englischen Moralisten in ihrem Stil und ihren letzten Gründen. Sie schrieben<br />
ohne wissenschaftlich strenge Form, und das sittliche Bewusstsein ist die einzige<br />
Quelle ihrer Erkenntnis. Ihre Tendenz ist ganz dieselbe, die wir bei den<br />
französischen Philanthropen finden. In der Religion sind sie Rationalisten. In der<br />
Politik sind sie Weltbürger. In der Moral sind sie Menschen, edle, tugendhafte<br />
Menschen, streng gegen sich selbst, milde gegen andere. Was Talent betrifft, so<br />
mögen wohl Mendelssohn, Sulzer, Abbt, Moritz, Garve, Engel und Biester als die<br />
ausgezeichnetsten genannt werden. 33<br />
<strong>Nicolai</strong> lehnte es ab, als Literaturpapst in die deutsche Kulturgeschichte einzugehen.<br />
Etwa ein halbes Jahr vor seinem Tode äußerte er in einem Brief an Böttiger vom<br />
29sten Juni 1810:<br />
Übrigens bin ich keineswegs der Hohepriester im Tempel der Literatur sondern<br />
allenfalls der vieljährige Küster deßelben, welcher die Schlösser treulich bewahret,<br />
und hin und wieder die Wechsler und ander Volk welches den heiligen Opferheerd<br />
entheiligte, herausgetrieben hat. 34<br />
Diesem Genre drohte die Auszehrung, da der Nachwuchs fehlte. Selbst JEB’s Sohn<br />
Karl Biester lief zum Leidwesen seines Vaters zum katholischen Glauben über, hing<br />
also den freien Geist seines Vaters an den Nagel, und es ist daher nicht<br />
verwunderlich, wenn bereits ca. zwei Monate nach <strong>Nicolai</strong>s Beerdigung, die noch<br />
bedeutsam war und viel Staub aufwirbelte, der Freiherr vom Stein (1757-1831) aus<br />
Prag am 17.3.1811 an die Prinzessin Marianne von Preußen schrieb:<br />
Frankreich klagt jetzt laut seine Philosophen an, als Verderber des öffentlichen<br />
Geistes, als Zerstörer der religiösen und moralischen Grundsätze, als Veranlasser<br />
einer scheußlichen Revolution, die mit einem eisernen Despotismus geendet hat –<br />
und was verdankt Deutschland der Berliner theologischen Schule und ihrem<br />
Koryphäen und Kolporteur <strong>Nicolai</strong> und seinen neueren Metaphysikern? Jene haben<br />
den einfältigen, schlichten Bibelglauben hinwegexegesiert und diese alte deutsche<br />
Biederkeit und Treue hinwegräsonniert, den schlichten gesunden Menschenverstand<br />
verdunkelt und Lehren vorgetragen, die die Grundsätze der Moral, den Glauben an<br />
Gott und Unsterblichkeit tief erschütterten und die Herzen der Menschen<br />
austrockneten. Glücklicherweise hat sich diese Schule durch die unter ihren<br />
Anhängern entstandenen Zänkereien verächtlich gemacht, und es wird diese Torheit,<br />
wie bereits so viele andere verschwinden. 35<br />
Hier konnte der 54-jährige preußische Staatsmann Heinrich Friedrich Karl<br />
Reichsfreiherr vom und zum Stein wohl eine Prinzessin beeindrucken, doch keinen<br />
Philosophen, der Kants grundliegenden, weiterführenden und über Jahrhunderte im<br />
Wesentlichen gültig gebliebenen Aufsatz „Was ist Aufklärung?“ verinnerlicht hat.<br />
17
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
Nachdem der Freiherr 1813 seines Amtes enthoben wurde, hätte er die Möglichkeit<br />
gehabt, sich damit auseinander zu setzen. Konsultierte Sympathisanten der<br />
Aufklärung wie Wilhelm und Alexander von Humboldt oder Herrn Varnhagen von<br />
Ense hätten ihn darüber „aufgeklärt“.<br />
Zitierte Literatur und Anmerkungen<br />
1) Vgl. Broschüre: Das Gleimhaus. Halberstadt, o. J.<br />
2) Karl Aner: Der Aufklärer Friedrich <strong>Nicolai</strong>. Gießen, 1912; Friedrich <strong>Nicolai</strong>: Gesammelte Werke.<br />
Georg Olms Verlag. Hildesheim, 1994ff.<br />
3) Friedrich Schiller: Briefe bis zu seiner Verlobung. München, 1909.<br />
4) J.G. Dyk (1750-1811) und J.C.F. Manso (1759-1826): Gegengeschenke an die Sudelköche zu Jena und<br />
Weimar. Leipzig, 1797.<br />
5) Alfred Haß: Johann Erich Biester. Sein Leben und sein Wirken. Diss. Frankfurt a. M., 1925.<br />
6) Norbert Hinske (Hrsg.): Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift.<br />
Darmstadt, 1977.<br />
7) Peter Weber: Berlinische Monatsschrift (1783-1796). Leipzig, 1986.<br />
8) L. Geiger (Hrsg.): Briefwechsel zwischen Schiller und Körner, 1. Bd. Cotta Verlag. Stuttgart, o. J.<br />
Verfasser der „Lebensläufe in aufsteigender Linie und des Buchs über die Ehe“ war Theodor Gottlieb<br />
Hippel (1741-1796).<br />
9) Conversations-Lexikon: oder kurzgefasstes Handwörterbuch in sechs Bänden, 1. Band A bis E.<br />
Amsterdam, 1809: „Aufklärung: Freiheit von Vorurtheilen, Berichtigung der Begriffe, hellere Einsicht.<br />
Man legt unserm Zeitalter des Aufgeklärten bei, ein jeder, welcher in unserm Zeitalter gezählt werden<br />
kann, macht Ansprüche auf Aufklärung; wiewohl ein würdiger Mann behauptet, daß es zwar viel<br />
Dilettanten aber wenig Virtuosen der Aufklärung unter uns gebe.“<br />
10) „Popularphilosophen nennt man eine Gruppe von Schriftstellern des 18. Jh., die die Lehren der<br />
Aufklärungsphilosophie [...] auch dem Nichtfachmann verständlich zu machen suchten. Zu den P.<br />
werden vor allem gerechnet: J. J. Engel, Friedrich <strong>Nicolai</strong>, Thomas Abbt, Christian Garve, Karl. Fr.<br />
Pockels, M. Mendelssohn, J. G. Sulzer. Heute nennt man Popularphilosophie eine literarische<br />
Behandlung philos. Themen, bei der auf das mangelnde Sachverständnis und die Vorurteile der Leser<br />
in einer den wissenschaftl. Wert der Darstellung beeinträchtigten Weise Rücksicht genommen wird;<br />
dies vor allem durch die Versuche, anschauliche, allgemein verständliche Erklärungen und<br />
>Weltbilder< vorzulegen [...].“ Aus: Philosophisches Wörterbuch. Zwanzigste Auflage. Neu bearbeitet<br />
von Fr. Georgi Schischkoff. Stuttgart, 1978.<br />
11) Gustav Parthey: Jugenderinnerungen. Handschrift für Freunde. Berlin, 1871.<br />
12) J. Fr. Abegg: Reisetagebuch von 1798. Frankfurt a. M., 1976.<br />
13) M. S. Lowe: Bildnisse jetztlebender Berliner Gelehrten mit ihren Selbstbiographien. Dritte<br />
Sammlung. Berlin, 1806.<br />
14) Abraham Voß: Briefe von Johann Heinrich Voß. Erster Band. Halberstadt, 1829.<br />
15) Jansen, Heinz: Aus dem Göttinger Hainbund. Overbeck und Sprickmann. Ungedruckte Briefe<br />
Overbecks. Münster, 1933.<br />
16) Alfred Haß: Johann Erich Biesters Bedeutung für das Geistes -und Bildungsleben Preußens<br />
während der Aufklärungszeit. In: Die Deutsche Schule. Monatsschrift. 30. Jahrgang, 1926.<br />
17) Vgl. Anmerkung Nr. 15<br />
18) Vgl. Anmerkung Nr. 13<br />
19) Diese statistischen Angaben stammen aus: Helga Eichler: Die Berliner Intelligenz im 18.<br />
Jahrhundert: Herkunft, Struktur, Funktion. Berlin, 1989. S. 269. (Zugleich= Miniaturen zur Geschichte,<br />
Kultur und Denkmalpflege Berlins; 28)<br />
20) G. A. Bürger: Briefe von uns an... Hrsg. von Adolf Strothmann. Band 1-4, Berlin, 1874.<br />
18
H. W. L. Biester: Über die Beziehungen zwischen F. <strong>Nicolai</strong> und J. E. Biester ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-111<br />
21) „Hofrath Böttiger: Erinnerungen an das literarische Berlin im August 1796.“ In: Friedrich Adolf<br />
Ebert (Hrsg.): Ueberlieferungen zur Geschichte, Literatur und Kunst der Vor- und Mitwelt. Bd. 2.<br />
Dresden, 1827.<br />
22) Vgl. Anmerkung Nr. 13<br />
23) Heinrich v. Treitschke: Die königliche Bibliothek in Berlin. Berlin, 1884.<br />
24) Eberhard Cyran: Preußisches Rokoko. Ein König und seine Zeit. Berlin, 1979.<br />
25) Vgl. Anmerkung Nr. 2<br />
26) J. E. Biester: Denkschrift auf Friedrich <strong>Nicolai</strong>. Vorgelesen den 3ten Jul. 1812, vor der Königlichen<br />
Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Berlin, 1816.<br />
27) Vgl. Anmerkung Nr. 11<br />
28) Karl Müchler: Berlinische Monatsschrift. September 1801.<br />
29) Vgl. Bernd Maurach (Hrsg.): Der Briefwechsel zwischen Friedrich <strong>Nicolai</strong> und Carl August<br />
Böttiger. Bern, 1996.<br />
30) Vgl. Anmerkung Nr. 26<br />
31) Johanna Schopenhauer: Ihr glücklichen Augen. Jugenderinnerungen-Tagebücher-Briefe. Berlin,<br />
1978.<br />
32) Beilage zur Allgemeinen Zeitung (Stuttgart), Nr. 28, Donnerstag, 7. März 1816: „Dr. Johann Erhard<br />
[sic] Biester, gestorben den 20 Febr. 1816.“<br />
33) Heinrich Heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Stuttgart, 1997.<br />
34) Vgl. Anmerkung Nr. 29<br />
35) Freiherr vom Stein: Ausgewählte politische Briefe und Denkschriften. Stuttgart, 1955.<br />
19
C. Sengül über Günter de Bruyn: >Als Poesie gut< ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-112<br />
Romantisches Plädoyer für das postfriderizianische Berlin<br />
Günter de Bruyn: Als Poesie gut. Schicksale aus Berlins Kunstepoche<br />
1786 bis 1807. Frankfurt am Main, 2006. 524 S.<br />
ISBN-13: 978-3100096388<br />
Von einem monumentalen Buch ist bei der Anpreisung des vorliegenden Bandes auf<br />
dem Schutzumschlag die Rede (Daniel Kehlmann), von einem flott lesbaren obgleich<br />
dickleibigen Buch bei der ZEIT (Evelyn Finger). Die neuen märkischen Forschungen<br />
(Tilman Spreckelsen) finden bei der Frankfurter Allgemeinen und der Süddeutschen<br />
Zeitung Lobeshymnen für den Kulturforscher und Prosameister de Bruyn, der hier<br />
nun die Summe seines langjährigen literarischen Bemühens um die teils vergessenen<br />
Schriftsteller der brandenburgischen Mark (Gustav Seibt) vorlegt. Bei der Berliner<br />
Zeitung geht das Buch in der Würdigung und Berichterstattung der Feierlichkeiten<br />
zum 80. Geburtstag des Autoren, der nicht zuletzt durch die Festtagsrede Angela<br />
Merkels am 1. November in Frankfurt an der Oder eine verdiente nationale Ehrung<br />
erhielt, etwas unter. Die zahlreichen Empfehlungen für dieses Buch ließen sich<br />
insgesamt jedoch beliebig fortsetzen, und auch diese Rezension – soviel sei vorab<br />
gesagt - kann sich dem nur anschließen.<br />
In 49 Kapiteln werden Biographien, geschichtliche und gesellschaftliche Ereignisse<br />
eines Zeitalters verwoben: Beginnend mit dem Ende des alten Preußens unter<br />
Friedrich II. (mit Kapitel I verlassen wir sozusagen das friderizianische Berlin) bis hin<br />
zum Zerbrechen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (etwa ab Kapitel<br />
XXXVI) und dem Beginn der langsamen Nationalisierung deutscher Intellektueller<br />
(besonders XLII, XLIX, Anfang und Ende). Zwanzig Jahre wie sie entwicklungsreicher<br />
beinahe nicht sein können – und auch nicht gegensätzlicher. Denn neben den (so<br />
denkt man nach der Lektüre fast) unbelehrbaren Zöpfe tragenden Aufklärichten,<br />
nostalgischen Friedrich-Verehrern und aufstrebenden Romantikern, bestimmen<br />
Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. (u. a. XVII) die politisch äußerst<br />
verwirrende aber kulturell nahrhafte Berliner Luft. Während der Nachfolger<br />
Friedrichs II. sich in vermeintlich staatssichernder Despotie übt, ermöglicht Friedrich<br />
Wilhelm III. durch sein außenpolitisches Lavieren in den europäischen Konflikten<br />
seit Ende der 1790er eine künstlich verlängerte Friedenszeit, die, folgt man de Bruyn,<br />
für das Berliner Kulturleben alles in allem von Vorteil war.<br />
Glanzzeiten Preußens kann man die elf Regierungsjahre Friedrich Wilhelms II.<br />
weder in außen- noch in innenpolitischer Hinsicht nennen, aber für die Kultur<br />
begann in diesen Jahren eine Periode, in der Preußen für Deutschland bedeutsam<br />
wurde und Berlin sich zu einem geistigem Zentrum entwickelte, das dem in Weimar<br />
gleichwertig und ihm vielfach verbunden war. (II, S. 14)<br />
Diesen Zeitraum zu beleben ist ein aufwändiges und schwieriges Unterfangen. Zum<br />
einen erfordert die Auswahl aus den zahllosen Schicksalen von Schriftstellern,<br />
20
C. Sengül über Günter de Bruyn: >Als Poesie gut< ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-112<br />
Musikern, Malern, bildenden Künstlern etc. eine außerordentliche Belesenheit, zum<br />
anderen bedarf es einer kenntnisreichen Empfindung, um die Konflikte und Wirren<br />
jener Zeit für uns Nachgeborene nachzuzeichnen. Mit beidem demonstriert de Bruyn<br />
seine Meisterschaft als Erzähler und Kenner der deutschen Geistesgeschichte,<br />
obgleich eine gewisse Vorliebe – nicht unangekündigt, entsinnt man sich des<br />
Umschlagstextes von Daniel Kehlmann – für die romantische Geistesströmung sehr<br />
deutlich in den Vordergrund tritt. Ungewöhnlich vielem Psychologisieren und<br />
Erotisieren ist bei de Bruyn zu begegnen, wenn man Hintergrundinformationen zum<br />
18. Jahrhundert vornehmlich aus geistesträchtiger Forschungsliteratur kennt. Bspw.<br />
das Aufdecken der Erotik im jüdisch-weiblichen Schicksal Rahel Levins (XI, S. 97 ff.),<br />
de Bruyns Empfindsamkeit für die Liebeswelt Brendel Veits (XII), geborene<br />
Mendelssohn, alias Dorothea Schlegel (an dieser Stelle sei auch der Band von<br />
Thomas Lackmann empfohlen, besonders S. 125-150). Ob es um Liebesanbahnungen<br />
oder Ehemiseren geht: de Bruyns erotische Neugier geht ihm selten verloren. Für<br />
diese Vermenschlichung kann man als Leser nur dankbar sein.<br />
Die mehr oder weniger bekannten, aber in der allgemeinen Gegenwartsbezogenheit<br />
so selten bedachten Menschen und Persönlichkeiten in diesem Buch sind Ärzte wie<br />
Heim und Hufeland (XXIX), Professoren wie A. W. Schlegel und Schleiermacher<br />
(XXXII, XXXIV, XIIL), Dichter wie Schmidt von Werneuchen (XXV), man erquicke<br />
sich an der de Bruyn’schen Auswahl jenes Grasmückengesanges und der Goethe’schen<br />
Parodierfreude, Heinrich von Kleist (XXXVIII), Zacharias Werner (XXXV, XXXIX)<br />
und Novalis (XVII) mit dessen Gleichsetzung von Königs- und Gottesdienst (S.<br />
191f.), Vertreter des Hochadels wie der Draufgänger und Musikliebhaber Prinz Louis<br />
Ferdinand (XIL, Der Kriegsgott am Klavier) und – sie gerät neben den eher farblosen<br />
Monarchen immer wieder in das Blickfeld des Biographen – die Königin Luise (V,<br />
XVII, XXII). Ein entscheidender Vorzug des vorliegenden Bandes ist der immer<br />
wieder gelingende Perspektivenwechsel zwischen Einzelbiographie und politischer<br />
Stimmung in der preußischen Metropole.<br />
Der Autor überrascht mit wieder entdeckten Kunstschätzen (z. B. die Schadow’sche<br />
Prinzessinnengruppe, S. 46, das Gemälde von Alexander Macco: Königin Luise, S. 221) -<br />
verschweigt leider hin und wieder, beinahe geheimniskrämerisch, gegenwärtige<br />
Aufbewahrungsorte - und zeigt, wie sehr das Aussehen des heutigen Berlins den<br />
Architekten des ausgehenden 18. Jahrhunderts geschuldet ist: zahlreiche<br />
Beschreibungen beleuchten Leben und Wirken von Schadow (III bis V), Schinkel und<br />
Gilly (XVIII), Rauch (XIX) und F. Tieck (XXVIII). Mit dem Kapitel über den 1794<br />
begonnenen Abriss der bei Danzig gelegenen Marienburg durch Friedrich Wilhelm<br />
II. wird eindrücklich das Erwachen des preußischen Denkmalschutzes illustriert<br />
(XXXI, Das Andenken der Väter), wenngleich es in folgendem Zitat sehr zugespitzt<br />
formuliert wird:<br />
21
C. Sengül über Günter de Bruyn: >Als Poesie gut< ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-112<br />
Mit der Abkehr vom rationalistischen Nützlichkeitsdenken der friderizianischen<br />
Epoche wuchs die Ehrfurcht vor den Überresten vergangener Zeiten und mit ihr der<br />
Wille zum Denkmalschutz. (S. 297)<br />
Jean Paul (XXVI) darf freilich nicht fehlen, und so zeigt ihn einer seiner besten und<br />
offenherzigsten Kenner auf seinen Berliner Streifzügen im Jahre 1801, worüber wie<br />
auch bei Goethe und Schiller festgehalten wird: Mehr Leser und Verehrer als am<br />
Musenhof Weimar hatte er in der preußischen Hauptstadt (S. 254). Der von Jean Paul<br />
wenig beachtete Schleiermacher beklagt: Er will eigentlich nur Weiber sehen und meint,<br />
selbst eine gemeine wäre immer, wenn auch nicht eine neue Welt, so doch ein neuer Weltteil<br />
(S. 257). In der Tat ist der Dichter auf der Suche nach einer Frau, einer fürs Leben. Er<br />
genießt Berlin (Intensiver als in Berlin konnte er nirgends gefeiert werden, S. 265), jedoch<br />
findet er hier weder seine zukünftige Frau noch einen künstlerisch inspirierenden<br />
Wohnsitz. Das gelingt erst im thüringischen Meiningen, wo er den Titan vollenden<br />
wird: Die Ehe hat mich so recht tief ins häusliche feste stille runde Leben hineingesetzt.<br />
Gearbeitet und gelesen soll jetzt werden. Das Verlieben wird ausgesetzt. (S. 265)<br />
In einem Intermezzo wird Madame de Staëls Deutschlandreise (XXXII) 1804, die sie<br />
auch nach Berlin führt, beschrieben. Apart: wie de Bruyn die bemitleidenswerten<br />
Spalding und Fichte skizziert, die, beide des Französischen wenig kundig, auf<br />
Kommando und mit Stoppuhr zu Zusammenfassungen ihrer Philosophie genötigt<br />
werden (306f). Erschütternd und schonungslos: wie A. W. von Schlegel der<br />
französischen Reisenden„verfällt“, mit ihr nach Coppet bei Genf reist und schließlich<br />
bezeugt: Hiermit erkläre ich, daß Sie jedes Recht auf mich haben und ich keines auf Sie. (S.<br />
310)<br />
Goethes (XXIV) und Schillers (XXXIII) Beziehungen zu Berlin bürgen schlussendlich<br />
für Berlins Rang als Kulturmetropole:<br />
Obwohl Goethe sich von den Romantikern gelegentlich distanzierte, ließ er sich ihre<br />
Lobpreisungen gern gefallen, und Berlin, das wie keine andere Stadt seinen Ruhm<br />
verbreitete, mied er zwar immer, behielt es aber stets im Blick […]. Er blieb lieber in<br />
Weimar, verfolgte aber das kulturelle Geschehen in der Hauptstadt über<br />
Mittelspersonen, von denen es viele gab. (S. 232f.)<br />
Darunter gehören neben Verlegern insbesondere Moritz, Zelter und Tieck, aber auch<br />
Brinckmann, der vom aufkeimenden Götheanismus und seiner unsichtbaren Kirche in<br />
Berliner Kreisen berichtet (S. 234). Viel mehr also, als nur ein Hauch von Weimar (S.<br />
318).<br />
Ist damit alles gesagt? Nicht ganz. Kein Wort fiel bisher über die vielgerühmte<br />
Epoche der deutschen Aufklärung. Sollte sie schon ganz passé sein? Sie ist es ja, die<br />
die soliden Grundlagen für ein kulturell fortgeschrittenes, politisch vorgebildetes<br />
und oft auch tolerantes Bürgertum zu bilden geholfen hat. Wer will das bezweifeln?<br />
Günther de Bruyn freilich nicht. Dennoch wirkt dieser Band etwas<br />
22
C. Sengül über Günter de Bruyn: >Als Poesie gut< ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-112<br />
aufklärungsfeindlich (man denke an die Aufklärer mit derben und doch zur Sensibilität<br />
fähigen Wesen, X S. 84) – und das hat mehrere Gründe, vornehmlich wohl den, dass<br />
de Bruyn sich der Romantik verschrieben hat (was sich nicht nur an seiner<br />
Bibliographie erkennen, sondern auch an der belebten und einnehmenden<br />
Darstellung der meistenteils Künstlerbiographien erleben lässt). Wenn es darum geht,<br />
ein oder ein paar Worte mehr über die Aufklärung in Preußen oder um einzelne oder<br />
mehrere Aufklärer auf einem Schlag zu verlieren, möchte man in dem Erzähler des<br />
vorliegenden Bandes einen romantischen erkennen. Beinahe ausnahmslos (Garlieb<br />
Merkel bspw. scheint in den Musenhof der Romantik gezogen zu werden, obgleich<br />
dessen aufklärerischer Hintergrund nicht verkannt wird) werden die Aufklärer als<br />
sich selbst überlebte Zopfträger und nunmehr ewiggestrige Pedanten bezeichnet, die<br />
mit wenig Sinn für Kunst und Leidenschaft einem spröden Wissenskult und einer<br />
veralteten Moral nachhängen. Es ist bezeichnend, dass de Bruyn als Neo-Romatiker<br />
den Kopf dieser alten Generation in Friedrich <strong>Nicolai</strong> sieht. (Es überrascht aber auch,<br />
wenn man sich an die von de Bruyn herausgegebenen und reichlich kommentierten<br />
Vertrauten Briefe <strong>Nicolai</strong>s erinnert.) Das Bild von <strong>Nicolai</strong> ist einerseits über den<br />
Rückblick auf die Herausgabe der Allgemeinen Deutschen Bibliothek geprägt, da<br />
heißt es durchaus würdigend (XII):<br />
Die ADB […] war ein Unternehmen von einmalig gewaltigem Umfang, das in seiner<br />
bildungsgeschichtlichen und nationalen Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt<br />
werden kann. (S. 115)<br />
Aber das Haupt der Aufklärung wird auch als gefürchteter Befehlshaber einer Armee von<br />
ADB-Rezensenten (S. 116) stilisiert. (Das erinnert nun sehr stark an Jean Paul!) Seine<br />
Verdienste werden vor allem auf die 1760er und 1770er und das Jahr 1799<br />
beschränkt, als er mit seinen Vertrauten Briefen in die öffentliche Debatte um das<br />
Liebesleben Dorothea Schlegels eingriff (S. 106-112). In dem beschriebenen Zeitraum<br />
1786 bis 1807 ist seine Präsenz ansonsten verschwindend gering. Wenn auf die<br />
Repräsentanten des überholten Zeitalters zu weisen ist, dann fällt schnell der Name<br />
<strong>Nicolai</strong>. De Bruyn scheint sich letztendlich mit einer einfachen Rechnung zufrieden<br />
zu stellen: Da er [<strong>Nicolai</strong>] kein Verständnis für die Jungen hatte, konnten diese keines für<br />
ihn aufbringen. (S. 117)<br />
Aber wie wirkt diese Verknappung? Eine Vergegenwärtigung des <strong>Nicolai</strong>’schen<br />
Wirkens zwischen 1786 und 1807 zeigt, dass diese Verknappung nicht ganz<br />
vertretbar ist: im Jahre 1786 wirkt der 53 Jahre junge <strong>Nicolai</strong> immer noch als<br />
Herausgeber der Allgemeinen Deutschen Bibliothek. Mit zwölf publizierten<br />
Teilbänden, also mehreren Tausend Druckseiten Rezensionen hat sie noch nicht<br />
einmal ihren Zenith erreicht. (1803 – der Herausgeber hat sein 70stes Lebensjahr<br />
erreicht - werden es 23 Teilbände plus Register sein.) Wenngleich die Konkurrenz<br />
(etwa die Allgemeine Literatur-Zeitung) ab Mitte der 1780er Jahre nicht spurlos an<br />
der Allgemeinen Deutschen Bibliothek vorbeigeht, und sowohl politisch schwierige<br />
als auch kulturkämpferische Jahre die Entwicklung prägten, so ist es doch<br />
23
C. Sengül über Günter de Bruyn: >Als Poesie gut< ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-112<br />
irreführend, diese Berliner „Rezensionsfabrik“ in ihrer „zweiten Lebenshälfte“<br />
weitgehend auszublenden. 1786 beginnt <strong>Nicolai</strong> mit der Herausgabe von<br />
Sortimentskatalogen, sein zweiter Großauftrag an die russische Kaiserin Katharina II.<br />
fällt in dieses Jahr. Das Jahr 1786 ist eines der interessantesten Jahre in <strong>Nicolai</strong>s<br />
Wirken, obgleich mit dem Tod Moses Mendelssohns am 4. Januar und dem damit<br />
verbundenen Zerfall des Trios der Berliner Aufklärung (Lessing, Mendelssohn, <strong>Nicolai</strong>;<br />
s. Lackmann, S. 54) das Jahr 1786 mit Trauer eingeläutet wird. Bis 1796 wird er<br />
insgesamt zwölf Bände seiner Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die<br />
Schweiz im Jahre 1781 publizieren, darüber hinaus die Geschichte eines dicken Mannes<br />
(1794), den Anhang zu Friedrich Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1797, das Leben<br />
Justus Mösers, das Leben und Meinungen Sempronius Gundibert's eines deutschen<br />
Philosophen (1798), die Vertrauten Briefe von Adelheid B. an ihre Freundin Julie S. (1799),<br />
im selben Jahr Über meine gelehrte Bildung etc. Nicht zu vergessen, <strong>Nicolai</strong>s Anekdoten<br />
über Friedrich II. 1788-89, seine Aufnahme in die preußische Akademie der<br />
Wissenschaften 1798 und die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die<br />
Universität Helmstädt 1799… Ohe, iam satis.<br />
Um zum Anfang zurück zu gelangen: Ja, dieser de Bruyn ist monumental. Aber er ist<br />
monumental in seiner geschickten Straffung bedeutendener Zeitgeschichte. Zum<br />
kulturellen Verständnis Berlins (und nicht nur in Bezug auf die Hinwendung Preußens<br />
zum geistigen Weimar X, 90), zur Veranschaulichung der engen Verzahnung Berlins<br />
mit Brandenburg, zur Vergegenwärtigung der Sogwirkung des künstlerischen<br />
Nährbodens der Spreestadt gibt es kein vergleichbares Werk. Auch die Politisierung<br />
des Theaters (S. 359), das Nebeneinander von patriotisch Entflammten und religiösen<br />
Fanatikern (S. 361), das deutlich spürbare nationale Empfinden (S. 401f, 463, 469) ist<br />
so überzeugend eingebunden, dass man von einem Abbild en miniature sprechen<br />
möchte. Dem darstellenden Teil sind eine ausführliche und teilweise sehr aktuelle<br />
Bibliographie, eine knappe Zeittafel und ein Personenregister angehängt worden.<br />
Vielleicht hätte man der Vollständigkeit halber zumindest in Letzterem die<br />
Lebensdaten aufführen können, hin und wieder fehlen sie im Haupttext und nötigen<br />
den Leser, selbst nachzuschlagen. Bei einem solchen Band wäre auch ein<br />
zeitgenössischer Stadtplan nicht unvorteilhaft gewesen. Mit 93 Abbildungen enthält<br />
dieses Buch eine Ansammlung interessanter und unbekannter Kunstwerke.<br />
Beinahe ein Geheimnis: Auf Seite 469 ist nach dem Schluss des letzten Kapitels zu<br />
lesen: Ende des ersten Teils.<br />
In der Rezension genannte Literatur<br />
Günter de Bruyn: Christoph Friedrich <strong>Nicolai</strong>: Vertraute Briefe von Adelheid B. an ihre Freundin Julie S.<br />
Ein Roman; Freuden des jungen Werthers. Eine Parodie. Herausgegeben und mit einem Nachwort<br />
von Günter de Bruyn. Berlin, 1982.<br />
Thomas Lackmann: Das Glück der Mendelssohns. Geschichte einer deutschen Familie. Berlin, 2005.<br />
Cem Sengül, Berlin<br />
24
Abgesang auf vergangene Zeiten: zum neu erschienenen Band über das <strong>Nicolai</strong>haus<br />
Marlies Ebert und Uwe Hecker: Das <strong>Nicolai</strong>haus. Brüderstraße 13 in<br />
Berlin. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Stadt Berlin. Berlin, 2006.<br />
ISBN-13: 9783894793630<br />
Bereits das eingangs abgebildete Exlibris „Friederici <strong>Nicolai</strong> et Amicorum“ deutet an,<br />
worum es sich allem Anschein nach bei diesem Buch handelt: um eine Würdigung<br />
und Freundesgabe, gerichtet an Freunde des historischen <strong>Nicolai</strong>hauses in Berlin,<br />
gerichtet an eine Berliner Öffentlichkeit, die das Haus nur wenig kennt. Die<br />
liebevolle Gestaltung von Satz, Type, Umschlag und Farbgebung, nicht zu vergessen:<br />
die reichhaltige Bebilderung geben diesem Band (und das zu einem moderaten Preis)<br />
ein augenfälliges und angenehmes Äußeres.<br />
Chronologisch durchschreiten die Autoren Marlies Ebert und Uwe Heckert das<br />
Leben im <strong>Nicolai</strong>haus von Eigentümern wie Johann Ernst Gotzkowsky, Friedrich<br />
<strong>Nicolai</strong> und der Parthey’schen Familie, über Mieter wie Elisa von der Recke,<br />
Christoph August Tiedge, den Körner’schen Familien bis hin zu Ludwig Jonas. Sie<br />
vermitteln gestrafft solides Wissen über ein bürgerliches Haus, das wie kein anderes<br />
die Zeitläufte von 1670 bis nach der Deutschen Einheit überlebt hat. Allerdings ist<br />
das Kapitel zum <strong>Nicolai</strong>haus in der DDR-Zeit zu kurz geraten, beinahe übergangen<br />
worden. (Zur Lektüre seien bspw. Günter de Bruyns Anmerkungen empfohlen, s. u.,<br />
sowie Rüdiger Fleischer) <strong>Nicolai</strong>, über dessen Zeit in der Brüderstraße (von 1787 bis<br />
zu seinem Tod 1811) es heißt: Diese Zeitspanne ist sicher die bedeutendste Epoche in der<br />
Geschichte des Hauses (S. 8f), spielt für diese Rezension freilich eine übergeordnete<br />
Rolle, wenngleich seine ganze Vergangenheit, die das geistige Erbe des<br />
Namensgebers überragt, nicht deutlich genug hervorzuheben ist. – Eine<br />
Vergangenheit, der in der Berliner Gegenwart leider nicht Genüge geleistet wird.<br />
Einer der Vorzüge dieses Buches sei exemplarisch genannt; bspw. vermag es,<br />
<strong>Nicolai</strong>s Arbeitsräumlichkeiten als einen Teil seines Wirkens eindrücklich<br />
darzustellen. So sehr, dass man eine Wiederherstellung in den ursprünglichen<br />
Zustand für wünschenswert hielte.<br />
Sein großes Studierzimmer ging ungefähr nach Süden in den kleinen Garten hinaus.<br />
Ueber dem Schreibtische am Fenster erhob sich ein hohes Regal. Darin stand ein<br />
vollständiges Exemplar der Allgemeinen Deutschen Bibliothek in 268 Bänden […].<br />
An den beiden Seitenwänden standen weiße Bücherschränke mit Glasthüren; an der<br />
Wand den Fenstern gegenüber sah man die Tür nach dem daranstoßenden<br />
Bibliothekssaale, daneben zeigte sich ein kleines tafelförmiges Klavier, auf dem der<br />
Grosvater [d. i. <strong>Nicolai</strong>] manchmal Choräle spielte. Außerdem war die ganze Wand<br />
bis zu einer bedeutenden Höhe hinauf mit den eingerahmten Bildnissen aller<br />
berühmten Zeitgenossen, von Rabener bis auf Alexander v. Humboldt bedeckt. (S.<br />
20)
C. Sengül: Zum neu erschienenen Band über das <strong>Nicolai</strong>haus (Rezension) ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-113<br />
Dieses Zitat vom <strong>Nicolai</strong>-Enkel Gustav Parthey geht ein wenig später weiter:<br />
Der Eintritt in die Studierstube erregte uns Kindern immer ein Gefühl der<br />
Befangenheit, aber unbeschreiblich war unser Erstaunen, als wir eines Tages sahen,<br />
wie der Grosvater die Thür eines Bücherschrankes öffnete, hineintrat und nicht<br />
wieder zum Vorschein kam. (Ebd.)<br />
Diese Tür entpuppt sich dann als Geheimtür, die <strong>Nicolai</strong> anlegen ließ, „um sich den<br />
Umweg durch den Bibliotheksaal nach seinem Schlafzimmer zu sparen.“ (S. 21) – Wie<br />
schade, dass die Autoren nicht versucht haben, diese Räumlichkeiten in einer Skizze<br />
darzustellen (ein grober Grundriss des Hauses findet sich allerdings auf S. 18, er<br />
stammt von Ernst Friedel, s. u.).<br />
Die Autoren präsentieren auf den Seiten 26 bis 30 ein auf Parthey, Göckingk und<br />
Sichelschmidt basierendes Kapitel zu <strong>Nicolai</strong>. (Ein Makel jedoch ist es, dass<br />
Sichelschmidt als konsultierter Autor nicht im Literaturverzeichnis aufgeführt wird!)<br />
„Falsch“ ist lediglich die Datierung eines Zitates von Johann Erich Biester (dessen<br />
Würdigung der Allgemeinen Deutschen Bibliothek 1812) auf 1784 (S. 29), und dass<br />
<strong>Nicolai</strong> am 8. Januar 1811 nicht 78- sondern 77-jährig verstarb (S. 30).<br />
Der Blick in Gegenwart und Zukunft lässt der Lektüre des Buches eher Betrübnis<br />
folgen. Melancholisch wirkt an diesem Buch eigentlich nicht eine Zeile, das haben die<br />
Autoren vermieden, die Umstände aber machen bewusst, vor welch schwierigen<br />
Zeiten das <strong>Nicolai</strong>haus steht, das im Jahre 2000 als „Entschädigung“ für das dem<br />
Jüdischen Museum zugeteilten Collegienhaus in den Besitz der Stiftung<br />
Stadtmuseum kam. Denn die an musealen Schätzen reiche, durch finanzielle und<br />
räumliche Missstände geplagte Stiftung kämpft ohnehin um ihre Identität - Stichwort<br />
Angliederung des sanierungsbedürftigen Marinehauses an das Stammhaus des<br />
Stadtmuseums, dem Märkischen Museum. In diesem Konzept hat das <strong>Nicolai</strong>haus<br />
allenfalls einen repräsentativen Status. Beinahe verwundert es nicht, wenn Franziska<br />
Nentwig - die Direktorin der Stiftung Stadtmuseum – ihr Bekenntnis zum<br />
<strong>Nicolai</strong>haus sehr vage formuliert:<br />
Mit Erscheinen der vorliegenden Publikation liegt erstmals ein umfängliches Werk<br />
zur Historie des heute unter Denkmalschutz stehenden und zu den ältesten<br />
Gebäuden Berlins gehörenden <strong>Nicolai</strong>hauses vor. […] Ein Haus mit Seele […],<br />
dessen heutiger Wert nicht allein durch die Gesetze des Grundstücks- und<br />
Immobilienmarktes bestimmt werden kann. (S. 73f)<br />
Sie verschweigt die allgemein bekannte Situation des <strong>Nicolai</strong>hauses: die<br />
abgebrochenen Sanierungsarbeiten, die Schließung (bis auf die Bibliothek des<br />
Stadtmuseums bleibt das Haus der Öffentlichkeit vorenthalten) und die<br />
Ungewissheit, wann und wie es weiter gehen wird. Sie deutet den finanziellen Wert<br />
des Hauses an und entblößt mehr als ihr lieb sein kann, denn sie zeigt, wie wenig<br />
vorausschauende Tatkraft vorhanden ist und wie sich das Gebäude schon dem<br />
Immobilienmarkt nähert. (Also doch ein kleiner Hinweis auf die ungewisse<br />
26
C. Sengül: Zum neu erschienenen Band über das <strong>Nicolai</strong>haus (Rezension) ● <strong>Forum</strong> <strong>Nicolai</strong> – www.friedrich-nicolai.de/2007-113<br />
Zukunft!? Allein deswegen ist es zu beklagen, dass dieses Buch bis jetzt nicht in den<br />
Berliner Feuilletons wahrgenommen wurde.) Dennoch: An ihren Worten wird<br />
Nentwig in nächster Zukunft zu messen sein. Eine Frage, die wichtigste, lautet ganz<br />
klar: wird das <strong>Nicolai</strong>haus seinem kulturgeschichtlichen Wert entsprechend der<br />
Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht? Ein andere Frage: werden 2011, im Jahre<br />
des 200. Todestages des Namensgebers, die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein?<br />
Dieses Buch könnte eine Rolle spielen, das <strong>Nicolai</strong>haus wieder in das Bewusstsein der<br />
Berliner Öffentlichkeit zu rücken. Und das ist ihm nur zu wünschen.<br />
Literatur<br />
Bruyn, Günter de (Hg.): Christoph Friedrich <strong>Nicolai</strong>: Vertraute Briefe von Adelheid B. an ihre<br />
Freundin Julie S. Ein Roman; Freuden des jungen Werthers. Eine Parodie. Herausgegeben und mit<br />
einem Nachwort von Günter de Bruyn. Berlin, 1982. Darin: Von der Brüder- zur Alten Jakobstraße.<br />
Besonders S. 276.<br />
Fleischer, Rüdiger: <strong>Nicolai</strong>s Altberliner Bürgerhaus im Denkmalensemble Brüderstraße 10-13. Berlin,<br />
1998.<br />
Friedel, Ernst: Zur Geschichte der <strong>Nicolai</strong>schen Buchhandlung und des Hauses Brüderstraße 13 in<br />
Berlin. Berlin, 1891.<br />
Parthey, Gustav: Das Haus in der Brüderstraße. Aus dem Leben einer berühmten Berliner Familie.<br />
Berlin, o. J.<br />
Sichelschmidt, Gustav: Friedrich <strong>Nicolai</strong>. Geschichte seines Lebens, Herford 1971.<br />
Impressum<br />
Redaktion: Cem Sengül, Berlin<br />
Kontakt: redaktion@friedrich-nicolai.de<br />
Cem Sengül, Berlin<br />
27