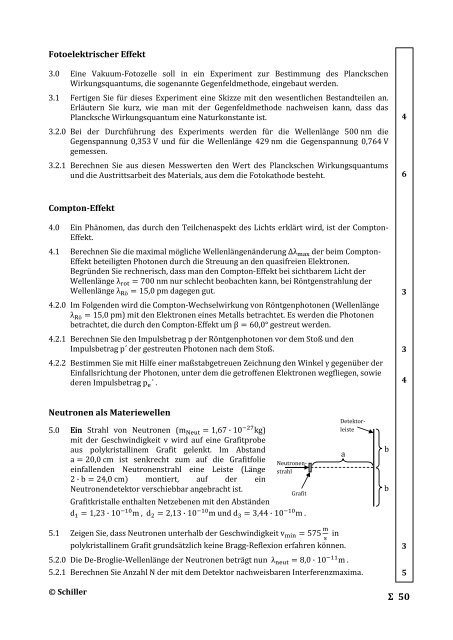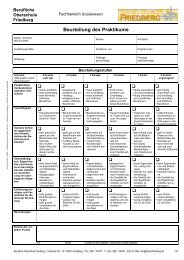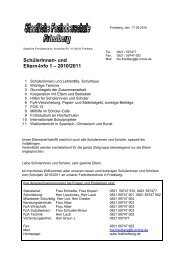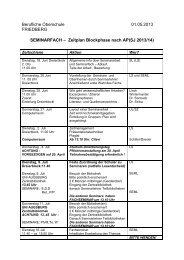Beispiel einer 2. Schulaufgabe - FOS-Friedberg
Beispiel einer 2. Schulaufgabe - FOS-Friedberg
Beispiel einer 2. Schulaufgabe - FOS-Friedberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fotoelektrischer Effekt<br />
3.0 Eine Vakuum-Fotozelle soll in ein Experiment zur Bestimmung des Planckschen<br />
Wirkungsquantums, die sogenannte Gegenfeldmethode, eingebaut werden.<br />
3.1 Fertigen Sie für dieses Experiment eine Skizze mit den wesentlichen Bestandteilen an.<br />
Erläutern Sie kurz, wie man mit der Gegenfeldmethode nachweisen kann, dass das<br />
Plancksche Wirkungsquantum eine Naturkonstante ist.<br />
3.<strong>2.</strong>0 Bei der Durchführung des Experiments werden für die Wellenlänge die<br />
Gegenspannung und für die Wellenlänge die Gegenspannung<br />
gemessen.<br />
3.<strong>2.</strong>1 Berechnen Sie aus diesen Messwerten den Wert des Planckschen Wirkungsquantums<br />
und die Austrittsarbeit des Materials, aus dem die Fotokathode besteht.<br />
Compton-Effekt<br />
4.0 Ein Phänomen, das durch den Teilchenaspekt des Lichts erklärt wird, ist der Compton-<br />
Effekt.<br />
4.1 Berechnen Sie die maximal mögliche Wellenlängenänderung der beim Compton-<br />
Effekt beteiligten Photonen durch die Streuung an den quasifreien Elektronen.<br />
Begründen Sie rechnerisch, dass man den Compton-Effekt bei sichtbarem Licht der<br />
Wellenlänge nur schlecht beobachten kann, bei Röntgenstrahlung der<br />
Wellenlänge dagegen gut.<br />
4.<strong>2.</strong>0 Im Folgenden wird die Compton-Wechselwirkung von Röntgenphotonen (Wellenlänge<br />
) mit den Elektronen eines Metalls betrachtet. Es werden die Photonen<br />
betrachtet, die durch den Compton-Effekt um gestreut werden.<br />
4.<strong>2.</strong>1 Berechnen Sie den Impulsbetrag p der Röntgenphotonen vor dem Stoß und den<br />
Impulsbetrag p´ der gestreuten Photonen nach dem Stoß.<br />
4.<strong>2.</strong>2 Bestimmen Sie mit Hilfe <strong>einer</strong> maßstabgetreuen Zeichnung den Winkel gegenüber der<br />
Einfallsrichtung der Photonen, unter dem die getroffenen Elektronen wegfliegen, sowie<br />
deren Impulsbetrag .<br />
Neutronen als Materiewellen<br />
5.0 Ein Strahl von Neutronen ( )<br />
mit der Geschwindigkeit wird auf eine Grafitprobe<br />
aus polykristallinem Grafit gelenkt. Im Abstand<br />
ist senkrecht zum auf die Grafitfolie<br />
einfallenden Neutronenstrahl eine Leiste (Länge<br />
montiert, auf der ein<br />
Neutronendetektor verschiebbar angebracht ist.<br />
Grafitkristalle enthalten Netzebenen mit den Abständen<br />
, und .<br />
5.1 Zeigen Sie, dass Neutronen unterhalb der Geschwindigkeit<br />
polykristallinem Grafit grundsätzlich keine Bragg-Reflexion erfahren können.<br />
5.<strong>2.</strong>0 Die De-Broglie-Wellenlänge der Neutronen beträgt nun .<br />
5.<strong>2.</strong>1 Berechnen Sie Anzahl N der mit dem Detektor nachweisbaren Interferenzmaxima.<br />
© Schiller<br />
Neutronenstrahl<br />
Grafit<br />
in<br />
Detektor-<br />
leiste<br />
a<br />
b<br />
b<br />
4<br />
6<br />
3<br />
3<br />
4<br />
3<br />
5<br />
8