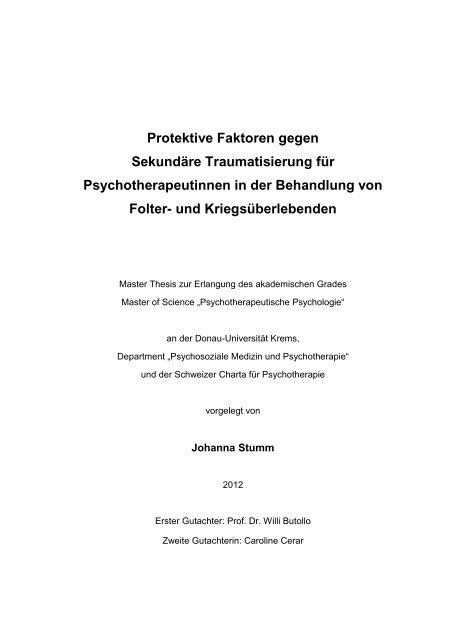Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Protektive</strong> <strong>Faktoren</strong> <strong>gegen</strong><br />
<strong>Sekundäre</strong> <strong>Traumatisierung</strong> <strong>für</strong><br />
Psychotherapeutinnen in der Behandlung von<br />
Folter- und Kriegsüberlebenden<br />
Master Thesis zur Erlangung des akademischen Grades<br />
Master of Science „Psychotherapeutische Psychologie“<br />
an der Donau-Universität Krems,<br />
Department „Psychosoziale Medizin und Psychotherapie“<br />
und der Schweizer Charta <strong>für</strong> Psychotherapie<br />
vorgelegt von<br />
Johanna Stumm<br />
2012<br />
Erster Gutachter: Prof. Dr. Willi Butollo<br />
Zweite Gutachterin: Caroline Cerar
EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG<br />
Ich, Johanna Stumm, geboren am 01. Mai 1980 in Baden-Baden (D) erkläre,<br />
1. dass ich meine Master Thesis selbständig verfasst, andere als die<br />
angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst<br />
keiner unerlaubten Hilfen bedient habe,<br />
2. dass ich meine Master Thesis bisher weder im In- noch im Ausland in<br />
irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe,<br />
3. dass ich, falls die Arbeit mein Unternehmen betrifft, meinen Arbeitgeber über<br />
Titel, Form und Inhalt der Master Thesis unterrichtet und sein Einverständnis<br />
eingeholt habe.<br />
Freiburg, 24. April 2012 Johanna Stumm<br />
Ort, Datum Unterschrift<br />
3
Abstract<br />
In der Psychotraumatologie wird zunehmend die Aufmerksamkeit darauf<br />
gerichtet, welche Auswirkungen die Arbeit mit traumatisierten Menschen auf<br />
professionelle Helferinnen haben kann. Die zentralen theoretischen Konzepte<br />
sekundärer <strong>Traumatisierung</strong> werden in der vorliegenden Arbeit dargestellt und<br />
diskutiert. In einem zweiten Teil werden Psychotherapeutinnen, die mit Kriegs-<br />
und Folterüberlebenden arbeiten, in qualitativen Interviews zu ihrer Arbeit<br />
befragt. Dabei werden Auswirkungen der Arbeit auf ihre Person beschrieben und<br />
zentrale Belastungsfaktoren ermittelt. Mit einer salutogenetischen Perspektive<br />
wird der Frage nachgegangen, welche Ressourcen die Therapeutinnen<br />
benötigen, um mit den Belastungen ihrer Arbeit gut umgehen zu können. Diese<br />
werden in Kategorien zusammengefasst und dargestellt.<br />
Schlagwörter: Burnout - Folter - Grounded Theory - Krieg - Psychotherapie<br />
- Qualitative Inhaltsanalyse - Salutogenese - <strong>Sekundäre</strong> <strong>Traumatisierung</strong> -<br />
Stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong> - Trauma<br />
************************************************************<br />
The field of psychotraumatology increasingly places emphasis on the impact that<br />
working with traumatized persons has on professional helpers. This paper<br />
outlines the essential theoretical concepts of secondary traumatization and<br />
discusses these. A number of psychotherapists who work with survivors of war<br />
and torture are interviewed about their work. The impact their work has on the<br />
therapists are described and essential stressors are identified. With a<br />
salutogenetic perspective the question is addressed which resources are needed<br />
by the therapists to find ways to deal with the above mentioned stressors. These<br />
resources are summarized, categorized, and subsequently illustrated.<br />
Key words: burnout - grounded theory - psychotherapy - qualitative content<br />
analysis - salutogenesis - secondary traumatization - torture - trauma -<br />
vicarious traumatization - war<br />
5
Danksagung<br />
An erster Stelle bin ich meinen InterviewpartnerInnen zu Dank verpflichtet, die<br />
mir ihr Vertrauen schenkten und mit ihrer Offenheit diese Untersuchung<br />
überhaupt erst ermöglicht haben.<br />
Ich möchte all meinen Lehrenden danken, die mir in den letzten Jahren neue<br />
Horizonte eröffnet haben. Herrn PD Lindner danke ich, mir ein Gesprächspartner<br />
<strong>für</strong> methodische Fragen gewesen zu sein.<br />
Von meinen MitstreiterInnen im Studium möchte ich vor allem Beate und Markus<br />
erwähnen und <strong>für</strong> unvergessliche Stunden in unserer Lernhütte danken.<br />
Ein herzlicher Dank geht an all meine Freunde, die in den letzten Monaten viel<br />
Geduld mit mir hatten. Besonderer Dank geht an Michael <strong>für</strong> die moralische<br />
Unterstützung und da<strong>für</strong>, dass er immer ein aufmerksamer Zuhörer war und mir<br />
damit geholfen hat, klare Gedanken zu fassen. Ein herzlicher Dank gilt Steffi <strong>für</strong><br />
Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Ganz herzlicher Dank gebührt<br />
meiner Mutter <strong>für</strong> die finanzielle Unterstützung und ihre Korrekturen.<br />
Vielen Dank!<br />
Auf dass diejenigen, die auf Seiten der Menschlichkeit stehen,<br />
7<br />
„empfangen immer neue Kraft,<br />
dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern,<br />
dass sie laufen und nicht ermatten,<br />
dass sie wandeln und nicht müde werden.“<br />
(Jesaja 40, V. 31, Züricher Bibelübersetzung)
Inhalt<br />
1. EINLEITUNG ..................................................................................................................... 13<br />
2. BESCHREIBUNG DES ARBEITSFELDES ............................................................ 17<br />
3. THEORETISCHE HINTERGRÜNDE ......................................................................... 25<br />
3.1. Das Forschungsfeld <strong>Sekundäre</strong> <strong>Traumatisierung</strong> – ein Überblick ..... 25<br />
3.1.1. Traumaspezifische Gegenübertragung .............................................. 26<br />
3.1.2. Burnout ............................................................................................... 28<br />
3.1.3. <strong>Sekundäre</strong>r traumatischer Stress ....................................................... 30<br />
3.1.4. Mitgefühlserschöpfung ....................................................................... 31<br />
3.1.5. Stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong> ........................................................ 33<br />
3.1.6. Ein neuropsychologisches Modell ...................................................... 37<br />
3.2. Positive Aspekte der Arbeit mit Traumatisierten ................................. 39<br />
3.2.1. Work Engagement .............................................................................. 40<br />
3.2.2. Vicarious Posttraumatic Growth ......................................................... 40<br />
3.2.3. Positive Self-transformation ................................................................ 42<br />
3.2.4. Vicarious Resilience ........................................................................... 43<br />
3.3. Der salutogenetische Ansatz ................................................................. 45<br />
4. FRAGESTELLUNG ........................................................................................................ 49<br />
5. METHODISCHES VORGEHEN .................................................................................. 51<br />
5.1. Datenerhebung ........................................................................................ 51<br />
5.2. Datenauswertung .................................................................................... 55<br />
6. ERGEBNISSE .................................................................................................................. 63<br />
6.1. Auswirkungen der Arbeit auf die Therapeutinnen ............................... 63<br />
9
6.2. Belastungsfaktoren ................................................................................. 70<br />
6.2.1. Patientinnenbezogene Belastungsfaktoren ......................................... 71<br />
6.2.1.1. Intensität des Traumas ................................................................. 71<br />
6.2.1.2. Nicht integrierte psychische Inhalte .............................................. 72<br />
6.2.1.3. Suizidalität .................................................................................... 74<br />
6.2.1.4. Täter oder Täteranteile ................................................................. 75<br />
6.2.1.5. Kinder ........................................................................................... 79<br />
6.2.2. Therapeutinnenbezogene Belastungsfaktoren ................................... 79<br />
6.2.2.1. Schwierige emotionale Reaktionen .............................................. 79<br />
6.2.2.2. Infragestellung eigener Normalität ................................................ 81<br />
6.2.2.3. Schwierigkeiten im Therapieverlauf .............................................. 82<br />
6.2.3. Die institutionelle oder arbeitsorganisatorische Ebene ....................... 83<br />
6.2.3.1. Teamkonflikte ............................................................................... 83<br />
6.2.3.2. Hohe Fallbelastung ...................................................................... 84<br />
6.2.3.3. Globale Erwartunghaltungen ........................................................ 86<br />
6.2.4. Die Ebene des gesellschaftlichen Kontexts ........................................ 87<br />
6.2.4.1. Migration und aufenhaltsrechtliche Fragen .................................. 87<br />
6.2.4.2. Wenig gesellschaftlicher Rückhalt ................................................ 88<br />
6.2.4.3. Aktualität von Kriegen und Konflikten ........................................... 89<br />
6.3. Ressourcen und protektive <strong>Faktoren</strong> .................................................... 90<br />
6.3.1. Ressourcen und protektive <strong>Faktoren</strong> im Team ................................... 90<br />
6.3.1.1. Formale Strukturen („Gefäße“) ..................................................... 91<br />
6.3.1.2. Informeller Austausch ................................................................... 93<br />
6.3.1.3. Funktionen des Teams ................................................................. 95<br />
6.3.2. Ressourcen und protektive <strong>Faktoren</strong> auf der persönlichen Ebene ..... 99<br />
6.3.2.1. Stabiles und ausgefülltes Privatleben ........................................... 99<br />
6.3.2.2. Bewusstheit <strong>für</strong> eigene innere Prozesse .................................... 100<br />
6.3.2.3. Distanzierungsfähigkeit von Bildern ........................................... 101<br />
6.3.2.4. Bewegung .................................................................................. 103<br />
6.3.2.5. Raum <strong>für</strong> Selbstpflege ................................................................ 103<br />
6.3.2.6. Reflexionsräume ........................................................................ 104<br />
6.3.2.7. Persönliche Eigenschaften ......................................................... 104<br />
6.3.3. <strong>Protektive</strong> <strong>Faktoren</strong> in der Therapie .................................................. 105<br />
6.3.4. Die institutionelle und arbeitsorganisatorische Ebene ....................... 107<br />
6.3.4.1. Zeitliche Begrenzung der Arbeit ................................................. 107<br />
6.3.4.2. Begrenzung der Fallbelastung.................................................... 109<br />
6.3.4.3. Ausgleiche schaffen ................................................................... 109<br />
6.3.4.4. Klarer institutioneller Rahmen .................................................... 110<br />
6.3.4.5. Einbeziehung anderer Institutionen ............................................ 111<br />
10
7. DISKUSSION ............................................................................................. 113<br />
7.1. Zusammenfassung ............................................................................... 113<br />
7.2. Vergleich mit bestehender Literatur .................................................... 115<br />
7.3. Bemerkungen zum methodischem Vorgehen .................................... 122<br />
8. SCHLUSSBEMERKUNG ........................................................................................... 125<br />
LITERATUR ........................................................................................................................... 127<br />
ANHANG ................................................................................................................................. 135<br />
11
Abkürzungsverzeichnis<br />
DESNOS Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified<br />
DSM-IV Diagnostical and Statistical Manual, 4. Fassung der American<br />
Psychiatric Association<br />
ICD-10<br />
International Classification of Diseases, 10. Fassung der<br />
Weltgesundheitsorganisation<br />
IP InterviewparterIn<br />
IT Indirekte <strong>Traumatisierung</strong><br />
MBI Maslach Burnout Inventory<br />
OLBI Oldenburg Burnout Inventory<br />
ProQOL Professional Quality of Life<br />
PTBS Posttraumatische Belastungsstörung<br />
PTGI Post Traumatic Growth Inventory<br />
PTSD Post Traumatic Stress Disorder<br />
SOC Sense of Coherence<br />
UWES Utrecht Work Engagement Scale<br />
12
1. Einleitung<br />
Häufig wenn ich nach meinen Vorstellungen gefragt werde, wie meine berufliche<br />
Zukunft aussehen soll, erwidere ich, dass ich Psychotherapeutin werden möchte,<br />
und dass mich derzeit besonders interessiert, welche Therapiemöglichkeiten es<br />
<strong>für</strong> Menschen mit Kriegs- und Gewalterfahrung wie etwa Folter gibt, und mit<br />
welchen realistischen Heilungschancen man in diesem Gebiet rechnen kann. Die<br />
erste Reaktion von Gesprächspartnern lautet meist „Das könnte ich nicht!“ oder<br />
“Das stelle ich mir sehr belastend vor!“ oder „Wie soll man das aushalten?“. Auch<br />
ich habe mich häufig gefragt, wie es sich wohl auf die psychische Gesundheit<br />
von Helferinnen 1 auswirkt, immer wieder mit schlimmsten menschlichen<br />
Schicksalen konfrontiert zu sein, die <strong>für</strong> die Betroffenen häufig so unerträglich<br />
sind, dass sie nicht einmal mehr in Sprache gefasst werden können.<br />
Von Menschenhand herbeigeführte Gewalt wie Krieg, Terror, systematische<br />
Menschenrechtsverletzungen, politisch motivierte Verfolgung und Folter sind in<br />
weiten Teilen der Welt tägliche Realität, wenngleich dies in den westlichen<br />
wohlhabenden Ländern immer wieder der Erinnerung bedarf. Zwar glauben viele,<br />
die moderne Zivilisation könne zumindest roheste Gewalt und ärgste Barbarei<br />
überwinden, doch ist es nicht lange her, dass auch in Westeuropa unfassbare<br />
Brutalität, Massenmord und totale Zerstörung an der Tagesordnung lagen. Und<br />
tägliche Nachrichten aus aller Welt zeigen uns, wie leicht der Rückfall in die<br />
Barbarei fällt, in der jene unheimlichen Schattenseiten des Menschseins zum<br />
Vorschein kommen, und wie dies jederzeit und überall möglich ist (Maier 2007,<br />
Gurris 2005).<br />
Die nord- und westeuropäischen Länder sind Aufnahmeländer <strong>für</strong> viele<br />
Flüchtlinge, die in ihren Ursprungsländern aufgrund von politischen, religiösen,<br />
ethnischen oder geschlechtsspezifischen Gründen verfolgt, misshandelt,<br />
vergewaltigt oder gefoltert wurden. Dies führt dazu, dass aufgrund dieser<br />
weltweiten Migrationsbewegungen hundertausende Opfer und Überlebende<br />
schwerster Gewalt und Menschenrechtsverletzungen unter uns leben (Amnesty<br />
1 Zur besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Text auf die simultane Verwendung der<br />
weiblichen und männlichen Sprachform verzichtet. In Bezug auf Studien zur mentalen<br />
Repräsentation (Heise 2003, Madson & Shoda 2006) wird hier die weibliche Form benutzt, die<br />
männliche ist dabei jeweils mitzudenken.<br />
13
International 2011, Fazel et al. 2005). Während es seit Mitte der 70er Jahre in<br />
vielen europäischen Großstädten kleinere psychosoziale Projekte gab, die meist<br />
aus der Flüchtlingsberatung entstanden waren, wurden die Flüchtlingsströme aus<br />
dem Balkan, sowie dem Mittleren und Nahen Osten in den 90er Jahren damit<br />
beantwortet, dass immer mehr spezialisierte Behandlungseinrichtungen<br />
gegründet wurden, die sich um die gesundheitlichen und psychischen Belange<br />
dieser meist aus der medizinischen Regelversorgung ausgeschlossenen<br />
Population bemühen (Gurris 2005, Maier 2007).<br />
Während in der wissenschaftlichen Disziplin der Psychotraumatologie immer<br />
differenziertere Erkenntnisse über die Folgen traumatischer Ereignisse zu Tage<br />
treten, ist seit etwa 1990 auch eine verstärkte wissenschaftliche<br />
Auseinandersetzung zu beobachten, wie sich die Arbeit mit extrem<br />
traumatisierten Patientinnen auf die Gesundheit der Helferinnen auswirken.<br />
Diese werden in dieser Arbeit mit dem übergeordneten Begriff der ‚sekundären<br />
<strong>Traumatisierung</strong>‘ beschrieben. Mit Konzepten wie etwa dem sekundären<br />
traumatischen Stress oder der Mitgefühlserschöpfung (Figley 1995b), der<br />
stellvertretenden <strong>Traumatisierung</strong> (McCann & Pearlman 1990) oder<br />
traumaspezifischen Gegenübertragungsprozessen (Wilson & Lindy 1994) wurden<br />
Versuche unternommen, dieses Phänomen einer „Ansteckung“ mit den Lasten<br />
schwerer <strong>Traumatisierung</strong>, die sich auch auf Seiten der professionell Helfenden<br />
niederschlagen können, begrifflich klarer zu fassen.<br />
Beachtet man die schwierigen Bedingungen, unter denen Flüchtlinge mit häufig<br />
unsicherem Aufenthaltsstatus sich der psychotherapeutischen Hilfe anvertrauen,<br />
und zieht man die Schwere der traumatischen Verletzungen an Körper und<br />
Seele, die Flüchtlinge dazu bewogen haben, ihre Heimat zu verlassen, um sich in<br />
die Unwägbarkeiten des Exils zu begeben, stellt sich tatsächlich die Frage: Wie<br />
erleben Psychotherapeutinnen ihre Arbeit und damit die tägliche Konfrontation<br />
mit Schicksalen, die Krieg, Verfolgung und Gewalt erzeugen? Welches sind<br />
dabei konkret die <strong>Faktoren</strong>, die am stärksten zu Belastungen führen und damit<br />
das Risiko von ‚sekundärer <strong>Traumatisierung</strong>‘ erhöhen? Unter Rückgriff auf eine<br />
salutogenetische Perspektive kann weiter gefragt werden, was können<br />
Therapeutinnen tun, um dem Risiko der ‚sekundären <strong>Traumatisierung</strong>‘ zu<br />
14
egegnen? Welche Mechanismen und schützenden <strong>Faktoren</strong> sind <strong>für</strong> sie<br />
hilfreich, um sich und ihre Gesundheit zu schützen?<br />
Um diesen Fragen nachzugehen habe ich mich entschieden, in zwei<br />
Gesundheitseinrichtungen, die sich auf die Behandlung von Menschen mit Folter-<br />
und Kriegserfahrung spezialisiert haben, das Erleben der Therapeutinnen ihrer<br />
Arbeit zu erforschen. In einer qualitativen empirischen Untersuchung wurden<br />
Psychotherapeutinnen in Interviews dazu befragt, wie sie ihre Arbeit erleben,<br />
welche Auswirkungen ihre Arbeit auf ihre Person hat, welche Belastungen sie<br />
dabei erfahren und auf welche Ressourcen und schützenden <strong>Faktoren</strong> sie<br />
zurückgreifen können, um einen Umgang mit den Belastungen ihrer Arbeit zu<br />
finden.<br />
Die hier vorliegende Arbeit ist dabei folgendermaßen aufgebaut: Kapitel 2<br />
umschreibt zunächst das Arbeitsfeld der psychotherapeutischen Behandlung von<br />
Kriegs- und Folterüberlebenden mit seinen Besonderheiten und seinen<br />
spezifischen Herausforderungen. Kapitel 3 behandelt einige theoretische<br />
Grundlagen. Verschiedene Konzeptionen von sekundärer <strong>Traumatisierung</strong><br />
werden dabei überblicksartig dargestellt, denen gemein ist, dass sie sich auf<br />
potentiell schädigende Auswirkungen der Psychotherapie mit schwer<br />
traumatisierten Menschen auf die behandelnden Therapeutinnen beziehen. In<br />
einem zweiten Schritt werden diesen Konzepten einige theoretische Ansätze<br />
<strong>gegen</strong>übergestellt, die einen positiven Gegenpol zu dem genannten<br />
Themenkomplex darstellen. Drittens wird der salutogenetische Ansatz vorgestellt,<br />
um in Kapitel 4 diese drei Bereiche klinischer Theorie zu einer Fragestellung zu<br />
verdichten. In der Folge werden die aufgeworfenen Fragen empirisch untersucht.<br />
Dazu wird Kapitel 5 das methodische Vorgehen erläutern, um in Kapitel 6 die<br />
Ergebnisse vorzustellen, die in Kapitel 7 abschließend diskutiert werden.<br />
15
2. Beschreibung des Arbeitsfeldes<br />
Die psychotherapeutische Behandlung von Kriegs- und Folterüberlebenden stellt<br />
einen Sonderfall in der Landschaft der Psychotherapie dar und sieht sich einer<br />
Vielzahl an Herausforderungen <strong>gegen</strong>über. Folter ist eine der schrecklichsten<br />
Verhaltensweisen, zu denen Menschen <strong>gegen</strong>über Menschen fähig sind. Sie ist<br />
eine zielgerichtete Zufügung von starker physischer oder psychischer Gewalt<br />
durch staatlich organisierte Akteure an einem Individuum, um eine Aussage zu<br />
erpressen, einzuschüchtern oder zu bestrafen. 2 Diese Definition erscheint<br />
wichtig, da sie auf das Ausmaß der potentiell traumatischen Erfahrung von<br />
Folteropfern hinweisen kann. Im Volksmund wird unter Folter häufig gemeinhin<br />
das absichtliche Zufügen massiver körperlicher Schmerzen innerhalb einer<br />
einseitigen Machtbeziehung verstanden. Ein solches Gewaltdelikt im zivilen<br />
zwischenmenschlichen Bereich mag jedoch anders wahrgenommen und erlebt<br />
werden, wenn zumindest theoretisch im Nachhinein auf ein intaktes<br />
Rechtssystem zurückgegriffen werden kann, um ein solches Gewaltdelikt<br />
juristisch zu ahnden und der Justiz zuzuführen. Folter im eigentlichen Sinne wird<br />
jedoch gerade von staatlicher Seite ausgeübt, also von jener Instanz, die<br />
zumindest in einem Rechtsstaat die Wahrung von Persönlichkeitsrechten<br />
garantieren soll. Es ist vorstellbar, dass in einer solchen Situation Gefühle von<br />
Ausgeliefertsein und Ohnmacht ein ungleich höheres Ausmaß annehmen als bei<br />
anderen Gewaltdelikten. Und gerade solche Gefühle sind zentral bei<br />
<strong>Traumatisierung</strong>en. Johan Lansen vom Behandlungszentraum <strong>für</strong> Folteropfer in<br />
Berlin beschreibt dazu anschaulich:<br />
Folter und Psychotherapie sind einander Antipoden. Wo Therapie<br />
beabsichtigt, den Menschen von Leiden zu befreien, will die Folter den<br />
Mitmenschen unterdrücken und bewusst Leiden verursachen. Therapie<br />
fördert die Autonomie des Menschen, Folter beabsichtigt eine totale<br />
Abhängigkeit. Therapie bedeutet Wachstum, Folter Beraubung des Glanzes<br />
der Psyche und Verstümmelung des Körpers. Gerade deswegen sind<br />
Therapeuten und Folterer einander Todfeinde. (Lansen 1996, S.253)<br />
2 Laut der UN-Antifolterkonvention, http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html<br />
(abgerufen am 23.09.2010)<br />
17
In diesem Zitat wird deutlich, dass man es im psychotherapeutischen Umgang<br />
mit Folter mit Extremen zu tun hat, sodass Polarisierungen vorprogrammiert<br />
erscheinen. Menschen, die Folter ausgesetzt waren, haben diese von<br />
Menschenhand erfahren. Ein Problem, das bei der Psychotherapie mit<br />
Betroffenen entstehen kann, wird bei Lansen weiter angesprochen: „Wir gehören<br />
derselben Gattung Mensch an wie die Folterer; sie sind keine Teufel, und wir sind<br />
keine Engel. Der totale Gegensatz ist dadurch entstanden, daß sie den<br />
Mitmenschen teuflisch „behandelt“ haben, während wir da<strong>gegen</strong> versuchen, uns<br />
nach einem ethischen Gebot zu richten“ (ebd., S.253-254). Dies kann zu<br />
schwierigen interaktionellen Aspekten wie starkes Misstrauen oder<br />
Übertragungen führen.<br />
Außerdem ist die Arbeit mit Kriegs- und Folterüberlebenden immer in soziale und<br />
politische Umstände eingebettet, die sich unweigerlich auf den Therapieprozess,<br />
die Therapieziele wie auch auf die möglichen Therapieerfolge auswirken. Die<br />
politischen Hintergründe, häufig Kriegsverläufe im Heimatland, die<br />
Fluchterfahrung der Betroffenen, der häufig unsichere Aufenthaltsstatus im<br />
Aufnahmeland sind zentrale <strong>Faktoren</strong>, die unmittelbar auf das<br />
Therapiegeschehen einwirken. Der gesellschaftspolitische Kontext von Folter<br />
besteht nicht nur aus Diktaturen, die Folter gezielt einsetzen. Zu diesem Kontext<br />
gehören auch diejenigen Staaten, die dies unterstützen, dulden oder<br />
folterüberlebende Flüchtlinge nicht aufnehmen. Folter ist nicht eine zufällige<br />
Folge von Gewalt, sondern eine gezielte und politisch gewollte Tat, um ihre Opfer<br />
in extreme Ohnmacht zu bringen und maximalen Schmerz zuzufügen. Angelika<br />
Birck vom Berliner Behandlungszentrum <strong>für</strong> Folteropfer dazu:<br />
Das Erhalten einer Aussage ist bloß vordergründiges Ziel der Folterungen.<br />
Gefoltert wird auch, nachdem die Informationen längst bekannt geworden<br />
sind. Geständnisse unter Folter sind mehr als die Preisgabe von<br />
Informationen und der Verrat von Menschen: Zu gestehen beinhaltet, den<br />
Folterer als Herrscher anzuerkennen. Im Geständnis bricht der letzte<br />
Widerstand. Unter der Folter nicht zu sprechen ist die letzte Möglichkeit,<br />
um die eigenen Grenzen und die eigene Identität zu wahren. Die Folterer<br />
versuchen gezielt, diesen Widerstand zu brechen, um damit das Erleben<br />
von Identität zu zerstören. Deshalb geht die totale Demütigung und<br />
18
Zerstörung der Person auch dann weiter, wenn die angeblich gesuchten<br />
Informationen von ihr längst gegeben wurden. Folter ist ein Angriff auf die<br />
grundlegenden menschlichen körperlichen, psychischen und sozialen<br />
Funktionen. Die Zufügung von Schmerz hat den Zweck, letztendlich die<br />
Persönlichkeit des Opfers zu zerstören. Folter soll das Empfinden ihres<br />
Opfers, Teil einer menschlichen Gemeinschaft zu sein, Pläne und<br />
Hoffnungen <strong>für</strong> die Zukunft zu haben, vernichten. (Birck 2002)<br />
Dies kann nichts Anders als tiefgreifende und verstörende Auswirkungen auf das<br />
‚In-der-Welt-Sein‘ der Überlebenden haben.<br />
Für Menschen, die dies überlebt haben und denen es gelungen ist, der<br />
politischen Verfolgung durch Flucht zu entkommen, liegt deshalb die<br />
<strong>Traumatisierung</strong> dennoch nicht unbedingt in der Vergangenheit. Im Exil dauern<br />
Asylverfahren häufig jahrelang und sind mit einer komplizierten Rechtslage<br />
verbunden. Außerdem gelten während des Asylverfahrens eingeschränkte<br />
Rechte, was fortgesetzte Ohnmachtsgefühle begünstigt und zu der gefühlten<br />
Fortsetzung von Verfolgung führen kann (vgl. Birck 2002). Unter diesen<br />
Umständen Menschen psychotherapeutisch zu behandeln führt zu ganz<br />
spezifischen Problemen. So kann ein therapeutischer Prozess bei einem<br />
unsicheren Aufenthaltsstatus und der drohenden Gefahr einer jederzeitigen<br />
Abschiebung nur schwer gestaltet werden und Therapieziele schwer definiert<br />
werden. Wer mit Kriegs- und Folterüberlebenden arbeitet wird unweigerlich mit all<br />
den Problemen eines Asylverfahrens konfrontiert. Nicht selten werden<br />
Therapeutinnen von Asylbehörden gebeten, Gutachten zu erstellen, was dazu<br />
führt, dass Therapeutinnen zum Teil eines Systems gemacht werden, das<br />
möglicherweise mit ihrer Rolle als Therapeutin kollidiert. Sie mögen sich zu einer<br />
Pathologisierung ihrer Klientinnen gezwungen sehen, um das Asyl<br />
wahrscheinlicher zu machen, oder sie mögen in der Wahrnehmung ihrer<br />
Klientinnen als Teil eines ‚feindlichen Systems‘ gelten und damit Rollenkonflikten<br />
unterworfen sein, was die therapeutische Beziehungsgestaltung wiederum<br />
schwierig werden lässt (Maier 2007, Pross 2009). Ebenso sind die Bedingungen<br />
der Aufnahme im Gastland mit möglicher Arbeitslosigkeit, gesellschaftlicher<br />
Marginalisierung, verschiedenen Formen von Diskriminierung und anderen<br />
soziokulturellen Bedingungen einer Fluchterfahrung <strong>Faktoren</strong>, die in jeden<br />
19
therapeutischen Prozess einfließen werden und innerhalb der Therapie den<br />
Rückgriff auf Ressourcen erschweren.<br />
Folter führt zu schweren körperlichen Schäden und erhöht das Risiko <strong>für</strong><br />
langfristige psychische Erkrankungen. Besonders häufig tritt die Diagnose der<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung auf, aber auch Angsterkrankungen,<br />
Depressionen, somatoforme und dissoziative Störungen und andere (Birck<br />
2002). Flüchtlinge ohne geregelten Aufenthaltsstatus haben kaum Zugang zur<br />
medizinischen Regelversorgung, so dass schwere und chronische Erkrankungen<br />
teils über Jahre unbehandelt bleiben.<br />
All diese Zusammenhänge sprengen häufig den Rahmen üblicher<br />
Diagnosestellung nach vorgegebenen Diagnosekriterien (ICD-10 oder DSM-IV)<br />
und erfordern ein Überdenken des gängigen Traumabegriffes. In den üblichen<br />
Klassifikationssystemen wird ein Trauma als ein punktuelles Ereignis gesehen,<br />
das in der Vergangenheit bei einem bestimmten Zeitpunkt oder auch mehreren<br />
liegt, aber immer zeitlich begrenzt ist. Es wird also davon ausgegangen, dass das<br />
traumatische Ereignis selbst ein Ende habe und sich danach - also<br />
‚posttraumatisch‘ - Reaktionen und Symptome einstellen, die Krankheitscharakter<br />
haben. Dieses konzeptionelle Problem wird auch bei Judith Herman’s Vorschlag<br />
der „Complex PTSD“ 3 nicht gelöst, das von ihr entwickelt wurde, um eine<br />
komplexe Form der Traumafolgestörung bei Überlebenden von langfristigem<br />
oder wiederholtem Trauma zu beschreiben. Hilfeicher ist hier ein<br />
Prozessverständnis wie bei Fischer und Riedesser (2009) und Hans Keilson<br />
(1979).<br />
Fischer und Riedesser (2009) definieren eine traumatische Erfahrung als ein<br />
„vitales Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den<br />
individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen der Hilfslosigkeit und<br />
schutzoser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von<br />
Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fischer & Riedesser 2009, S. 84). Nach<br />
ihrem ökologisch-dialektischen Verlaufsmodell setzt nach der unmittelbaren<br />
3 Das Konzept der komplexen PTBS wurde in Vorbereitung der DSM-IV-Klassifikation durch eine<br />
Expertengruppe um Herman und van der Kolk unter dem Akronym DESNOS (Disorders of<br />
Extreme Stress Not Otherwise Specified) anstelle der Kategorie Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung vorgeschlagen. Es wurde nicht aufgenommen, hat aber Einzug in<br />
wissenschaftliche Diskurse erhalten (Sachsse & Sack 2011).<br />
20
Notfallreaktion (S. 65) ein Prozess der psychischen <strong>Traumatisierung</strong> ein, der<br />
einen integralen Bestandteil der <strong>Traumatisierung</strong> darstellt und konstitutiv <strong>für</strong> die<br />
Herausbildung von Symptomen ist. Ihnen zufolge stellen Reaktionen auf<br />
Traumata Versuche dar, mit der traumatischen Erfahrung zurecht zu kommen.<br />
Tritt nach dem traumatischen Ereignis keine Erholungsphase ein, kommt es zu<br />
einem andauernden traumatischen Prozess. Dieser beinhaltet den Versuch, das<br />
traumatische Ereignis zu verstehen und in das eigene Selbst- und<br />
Weltverständnis zu integrieren. Dabei betonen Fischer und Riedesser die soziale<br />
Dimension. Es ist wichtig, dass das Opfer in seinem Leiden anerkannt wird und<br />
durch die Gesellschaft Gerechtigkeit und Würdigung erfährt. Wird das durch<br />
Menschenhand geschehene Unrecht von der sozialen Umwelt nicht anerkannt,<br />
sondern verleugnet oder bagatellisiert, so wird dies zu einer Vertiefung der<br />
psychischen Störung führen (Fischer & Riedesser 2009, S. 65ff.).<br />
Beobachtungen, die dies bestätigen, machte auch Hans Keilson bereits 1979 bei<br />
seiner Arbeit mit jüdischen Waisenkindern, die durch die Flucht in die<br />
Niederlande die Verfolgung durch die Nazis überlebt hatten. Er prägte dabei den<br />
Begriff der sequentiellen <strong>Traumatisierung</strong>. Er stellte fest, dass die Art und Weise,<br />
wie diese Kinder in den Niederlanden aufgenommen wurden, ein<br />
einflussreicherer Prädiktor <strong>für</strong> ihren Gesundheitszustand war als die<br />
tatsächlichen traumatischen Ereignisse während der Verfolgung in Deutschland.<br />
Nach Keilson ist die sogenannte dritte Phase der sequentiellen <strong>Traumatisierung</strong>,<br />
nach der politischen Verfolgung und nach der erzwungenen Migration,<br />
entscheidend <strong>für</strong> den traumatischen Prozess und damit <strong>für</strong> die Entstehung und<br />
Schwere von klinischen Symptomen. Auch bei Keilson kommt dem sozialen<br />
Umfeld nach Verfolgung und Migration eine besondere Bedeutung zu. Ist es von<br />
frühzeitiger sozialer Unterstützung und rechtzeitigen Hilfsangeboten geprägt,<br />
können somatische und psychische Folgen traumatischer Ereignisse günstig<br />
beeinflusst werden. Ein leugnendes oder marginalisierendes Umfeld wird sich<br />
stark verschlechternd auf den Gesundheitszustand der traumatisierten<br />
Flüchtlinge auswirken. Dies bedeutet, dass die Exilsituation <strong>für</strong> Überlebende von<br />
Folter und Krieg eine Phase im traumatischen Prozess darstellt. Die durch sie<br />
erlebte Hilflosigkeit, die durch die Asylsituation bedingt ist, bedeutet damit einen<br />
zusätzlichen traumatischen Faktor.<br />
21
Dieses Verständnis von Trauma erlaubt uns statt auf ein Ereignis und dessen<br />
Konsequenzen auf einen Prozess zu schauen. Es gibt den Blick frei darauf, dass<br />
wir es bei Überlebenden von Krieg und Folter nicht mit einer bestimmten Anzahl<br />
von Symptomen und Situationen zu tun haben, sondern mit spezifischen<br />
historischen und gesellschaftlichen Prozessen, die im Blickfeld behalten werden<br />
müssen und die je spezifisch auf eine Psychotherapie einwirken (vgl. dazu auch<br />
Becker 2006).<br />
Zu den genannten Schwierigkeiten kommen in der konkreten<br />
psychotherapeutischen Situation weitere hinzu. So gilt es mit kulturellen<br />
Unterschieden und Sprachbarrieren umzugehen. Viele Psychotherapien mit<br />
Überlebenden von Folter wären nicht möglich ohne die Vermittlung durch<br />
Dolmetscherinnen. Dies erfordert ganz bestimmte Qualifikationen an die<br />
Dolmetscherinnen. Die reine Kenntnis der Sprache reicht häufig nicht aus,<br />
sondern die Dolmetscherin muss auch über kulturelles Hintergrundwissen des<br />
Ursprungs- und des Gastlandes verfügen und nicht selten als kulturelle<br />
Dolmetscherin fungieren. Gleichzeitig muss die Dolmetscherin sich mit<br />
psychischen Störungen sowie den Gesundheitssystemen in beiden Ländern gut<br />
auskennen. Zu beachten ist außerdem, dass sich durch die Triade Klientin-<br />
Dolmetscherin-Therapeutin eine andere Beziehungsdynamik entfaltet als dies bei<br />
der typischen dyadischen therapeutischen Beziehung der Fall ist (Morina 2007;<br />
Sejdijaj 2002).<br />
Die Tatsache, dass Flüchtlinge mit unsicherem Aufenthaltsstatus meist von der<br />
medizinischen Regelversorgung ausgeschlossen sind, aber mit massiven<br />
Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben, hat dazu geführt, dass sich in mehr<br />
und mehr europäischen Großstädten spezialisierte Einrichtungen gebildet haben.<br />
Diese begeben sich mit ihrer Aufgabe in eine Sphäre, die ein gesellschaftliches<br />
Tabu anrührt. Pross (2006) beschreibt eindrücklich wie dieser ‚Sonderstatus‘,<br />
gekoppelt mit niedriger sozialer Anerkennung und nicht selten instabilen<br />
finanziellen Ressourcen <strong>für</strong> die Therapeutinnen eine zusätzliche Belastung<br />
darstellen kann. Die so errichteten Hilfsangebote an Flüchtlinge mit Kriegs- und<br />
Foltererfahrungen sind meist interdisziplinär ausgerichtet, mit Teams aus<br />
Ärztinnen, Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, Physiotherapeutinnen,<br />
Kunst-, Musik- und Bewegungstherapeutinnen, sowie teils auch mit<br />
22
Unterstützungsangeboten <strong>für</strong> eine erleichterte Integration in die<br />
„Gastgesellschaft“ erweitert, wie Sprachkurse und Arbeitsintegrations-Angebote.<br />
Hiermit sind einige der zu nennenden Umstände erwähnt worden, die die<br />
Therapie von Folteropfern zu einer multidimensionalen Herausforderung machen,<br />
<strong>für</strong> die es kein Patentrezept gibt. Die Verwundungen der Überlebenden an Körper<br />
und Seele sind enorm, und ihr Leiden kann auch zu großen psychischen<br />
Belastungen der Helferinnen und Helfer führen (Pross 2009; Gurris 2005). Dazu<br />
im folgenden Kapitel mehr.<br />
23
3. Theoretische Hintergründe<br />
3.1. Das Forschungsfeld <strong>Sekundäre</strong> <strong>Traumatisierung</strong> – ein Überblick<br />
Nach Beschreibung der Herausforderungen, die die psychotherapeutische<br />
Behandlung mit Kriegs- und Folteropfern mit sich bringt, braucht es nicht viel<br />
Phantasie, um sich vorzustellen, dass eine solche Arbeit emotional aufreibend<br />
und zuweilen belastend sein kann. Dies trifft nicht nur <strong>für</strong> die therapeutische<br />
Arbeit mit Menschen, die Opfer politischer Gewalt wurden, sondern wird generell<br />
<strong>für</strong> den traumatherapeutischen Bereich in der Literatur breit diskutiert. Einen<br />
Anlass zu der Annahme, dass die therapeutische Arbeit mit traumatisierten<br />
Menschen potentiell schädigende Auswirkungen auf die Therapeutin haben kann,<br />
geben auch die zahlreichen theoretischen Konzepte, die genau diesen Vorgang<br />
zu beschreiben versuchen. Mit einer verwirrenden Vielzahl an Begriffen, die die<br />
Traumaforschung in den letzten zwei Jahrzehnten hervorgebracht hat, wurde<br />
versucht, das Phänomen einer irgendwie gearteten „Ansteckung“ mit dem<br />
Trauma begrifflich, theoretisch und konzeptionell zu fassen und zu messen, um<br />
damit erstmals die Aufmerksamkeit auf die Helfenden und deren Belastungen zu<br />
richten, die zuvor lange vernachlässigt wurden. Auf diese Konzepte wird hier<br />
verallgemeinert unter dem Begriff der ‚<strong>Sekundäre</strong>n <strong>Traumatisierung</strong>‘ verwiesen,<br />
ohne dass damit eine theoretische Festlegung verbunden ist. Lemke hat sich<br />
2006 die Mühe gemacht, die gängigen Begriffe im Forschungsfeld <strong>Sekundäre</strong>r<br />
<strong>Traumatisierung</strong> zu untersuchen, die verschiedenen Begriffe in ihrer jeweiligen<br />
Entwicklung zu beschreiben und sie vergleichend darzustellen. Dabei listet er<br />
allein aus dem englischsprachigen Diskurs 24 verschiedene Begriffe auf (S. 18).<br />
Dies ist als Anzeichen <strong>für</strong> den Trend einer inflationären Begriffsbildungspraxis zu<br />
werten, die das Forschungsfeld bis heute fest im Griff hat. Im Folgenden werden<br />
diejenigen Begriffe kurz dargestellt, die sich in der Forschungsliteratur<br />
weitestgehend durchgesetzt haben und auf die am häufigsten verwiesen wird: die<br />
traumaspezifische Gegenübertragung, Burnout, sekundärer traumatischer Stress,<br />
bzw. die <strong>Sekundäre</strong> Traumatische Belastungsstörung (STBS),<br />
Mitgefühlserschöpfung, stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong>, sowie ein neueres<br />
neuropsychologisches Erklärungsmodell <strong>für</strong> die sekundäre <strong>Traumatisierung</strong>.<br />
25
3.1.1. Traumaspezifische Gegenübertragung<br />
Gegenübertragung ist ein psychoanalytischer Begriff mit einer langen<br />
Entwicklungsgeschichte, der viele kontroverse Debatten provoziert hat. Gemeint<br />
sind damit allgemein Übertragungen, die die Therapeutin auf die Patientin richtet,<br />
die sich in Gefühlen, Gedanken, Vorurteilen, Erwartungen oder Wünschen<br />
äußern. Während in der frühen Entwicklung der Psychoanalyse<br />
Gegenübertragung als Störfaktor im therapeutischen Prozess galt und durch die<br />
Therapeutin zu unterbinden war, gibt es heute weitgehend Einigkeit darüber,<br />
dass Gegenübertragung ein natürlicher und unvermeidlicher Bestandteil einer<br />
therapeutischen Beziehung ist, und darüber hinaus sogar als wertvolle<br />
Informationsquelle <strong>für</strong> die unbewussten Prozesse der Patientin genutzt werden<br />
kann. Dennoch gibt es genau so Einigkeit darüber, dass Gegenübertragung<br />
schädlich sein kann, wenn sie nicht richtig verstanden und eingesetzt wird (vgl.<br />
dazu Lemke 2006).<br />
Im Kontext von Traumatherapie wird meist auf die Systematisierung von<br />
traumaspezifischen Gegenübertragungsphänomenen nach Wilson und Lindy<br />
hingewiesen (1994a). Laut den Autoren ist Empathie die wichtigste<br />
Voraussetzung einer Therapeutin, um einen therapeutischen Prozess, der in<br />
einer sicheren und vertrauensvollen Beziehung stattfindet, zu begleiten.<br />
Gleichzeitig halten sie aber gerade auch die Empathie <strong>für</strong> eine Quelle von<br />
Belastung <strong>für</strong> die Therapeutin, wenn traumaspezifische<br />
Gegenübertragungsreaktionen zum Tragen kommen (empathic strain). Als Folge<br />
einer solchen Belastung thematisieren sie einen potentiellen Bruch mit der<br />
empathischen Haltung der Therapeutin, bzw. den Bruch mit der therapeutischen<br />
Rolle und die schädigenden Effekte dessen auf die Behandlung. Wilson und<br />
Lindy thematisieren nicht explizit Schädigungen an der seelischen Gesundheit<br />
der Therapeutin durch die Therapie mit traumatisierten Menschen. Dennoch ist<br />
ihre Systematisierung zentral in vielen Werken der Traumaliteratur wie auch als<br />
Grundlage <strong>für</strong> die spätere Entwicklung weiterer Konzepte der sekundären<br />
<strong>Traumatisierung</strong>.<br />
Wilson und Lindy halten solche <strong>für</strong> traumatypische Übertragungen, in denen die<br />
Patientin unbewusst in einer Art und Weise mit der Therapeutin in Beziehung tritt,<br />
26
dass dabei ungelöste, nicht-assimilierte und Ich-ferne psychische Inhalte und die<br />
spezifischen Dynamiken der durch sie erlebten Traumata zum Tragen kommen.<br />
Diese können sich in affektiven Zuständen, Verhaltenstendenzen oder<br />
symbolischen Rollenbeziehungen äußern. Typische Gegenübertragungsmuster<br />
können als konkordante oder komplementäre Gegenübertragungsmuster<br />
unterschieden werden. Konkordant bedeutet in diesem Zusammenhang, die<br />
Gefühle der Therapeutin im Gegenübertragungsvorgang stimmen mit denen der<br />
Klientin oder dessen dissoziierten oder verdrängten psychischen Inhalten<br />
überein. Eine komplementäre Gegenübertragung liegt vor, wenn die Therapeutin<br />
die Rolle eines inneren Objektes der Klientin übernimmt und sich in eine<br />
bestimmte Rolle hineingedrängt fühlt, die sowohl positiv (Mitüberlebende,<br />
hilfreiche Unterstützerin, Retterin, Trösterin) als auch negativ (abtrünniger<br />
Kollaborateur, feindseliger „Richter“ oder auch Täter) besetzt sein kann.<br />
Wilson und Lindy gehen davon aus, dass empathische Belastungen (empathic<br />
strain) in der Psychotherapie solche sind, die entweder die therapeutische<br />
Haltung der Therapeutin <strong>gegen</strong>über der Klientin schwächen oder verletzten, oder<br />
über angemessene Grenzen hinaus forcieren. Gegenübertragungsreaktionen<br />
sehen sie als nur eine mögliche Ursache <strong>für</strong> empathische Belastungen, jedoch in<br />
der Behandlung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) als<br />
Hauptursache <strong>für</strong> Behandlungsfehler. Sie erläutern typische traumaspezifische<br />
Gegenübertragungsreaktionen anhand eines Kontinuums zwischen zwei Polen.<br />
Als Typ I bezeichnen sie den Pol „Vermeidung“, als Typ II den Pol „Über-<br />
Identifikation“. Typ I-Gegenübertragungsreaktionen beinhalten Formen von<br />
Leugnen, Minderung, Verzerrung, Vermeidung, Distanzierung und Rückzug von<br />
der empathischen therapeutischen Haltung der Klientin <strong>gegen</strong>über. Typische Typ<br />
II-Gegenübertragungsreaktionen sind etwa Überidentifizierung, Idealisierung,<br />
Verstrickung oder exzessive Fürsprache <strong>für</strong> die Klientin wie auch<br />
Verhaltensweisen, die in Anderen Schuld hervorrufen.<br />
Gekoppelt an die Reaktivierung von ungelösten eigenen Konflikten der<br />
Therapeutin kann es bei einer Typ I-Gegenübertragungsreaktion zu einer starken<br />
Distanzierung und einem Rückzug aus der empathischen therapeutischen<br />
Beziehung kommen, um die aktivierten Konflikte zu vermeiden. Bei einer Typ II-<br />
Gegenübertragungsreaktion wird sich die Therapeutin ganz im Gegensatz dazu<br />
27
verstricken und tendenziell eher überengagiert und unangemessen mit der<br />
Patientin identifiziert sein - mit der Folge eines Verlustes von Rollengrenzen im<br />
Kontext der Behandlung. Als besonders gefährdet <strong>für</strong> diese Art von<br />
Gegenübertragungsreaktion gelten Therapeutinnen mit eigener<br />
Traumageschichte, die unbewusst versuchen mögen, ihre Patientinnen zu retten<br />
– in gewisser Weise stellvertretend, um mit nicht integrierten eigenen<br />
traumatischen Konflikten umzugehen.<br />
Desweiteren beschreiben Wilson und Lindy Gegenübertragungsreaktionen, die<br />
sogenannte „verbotene“ Impulse oder Phantasien in der Therapeutin zum<br />
Vorschein bringen. Während Erzählungen von schweren traumatischen<br />
Ereignissen in erster Instanz meist Ekel und Horror evozieren, könnten sie<br />
durchaus „verbotene Gefühle“ wie Faszination, Erregung, Voyeurismus, erotische<br />
sadistische oder masochistische Impulse, Identifikation mit der Aggressorin o.ä.<br />
auslösen. Für solche Reaktionen einen angemessenen Umgang zu finden sei<br />
besonders schwer. Während Therapeutinnen solche Reaktionen meist schnell<br />
„verstecken“ wollen, könne eben die innere Auseinandersetzung der Therapeutin<br />
mit ihren eigenen Anteilen den Kontakt zur erzählenden Patientin unterbrechen.<br />
Wie bereits erwähnt beschäftigen sich Wilson und Lindy nicht explizit mit den<br />
Auswirkungen der hier beschriebenen Gegenübertragungsreaktionen auf die<br />
Gesundheit der Therapeutinnen, aber sie werfen einen sehr detaillierten Blick auf<br />
das traumaspezifische interaktionelle Geschehen zwischen Patientin und<br />
Therapeutin, und haben damit die Grundlage geschaffen <strong>für</strong> weitergehende<br />
Konzepte, die die langfristigen Auswirkungen dieses Geschehens auf<br />
Therapeutinnen genauer unter die Lupe nehmen.<br />
3.1.2. Burnout<br />
Das Konzept des Burnouts geht ursprünglich auf den New Yorker<br />
Psychoanalytiker Herbert Freudenberger (1974) zurück (zit. in Lemke 2006; Frey<br />
2007; Menschick-Benedele 2011; Rösing 2007), und wurde in verschiedenen<br />
Berufssparten wie etwa bei Ärztinnen, Pflegepersonal, Lehrerinnen und sozialen<br />
Berufen untersucht. Es lässt sich in der wissenschaftlichen Literatur kaum eine<br />
28
einheitliche Definition <strong>für</strong> Burnout finden, jedoch ist der Begriff in empirischen<br />
Studien aufgrund des überwiegend verwendeten Messinstrumentes, dem<br />
Maslach Burnout Inventory (MBI) weitgehend definitorisch festgelegt. Danach ist<br />
Burnout ein berufsbedingtes Belastungssyndrom mit Symptomen, die drei<br />
Dimensionen zugeordnet werden können: (1) Emotionale Erschöpfung: das<br />
Leitsymptom des Burnout beschreibt das Gefühl durch den Kontakt mit anderen<br />
Menschen emotional überanstrengt und ausgelaugt zu sein. (2)<br />
Dehumanisierung, was sich in einer negativen, unpersönlichen oder zynischen<br />
Einstellung <strong>gegen</strong>über dem Arbeitsumfeld äußert, speziell bei<br />
Psychotherapeutinnen in einer gefühllosen und abgestumpften Reaktion auf<br />
Patientinnen, Gleichgültigkeit, dem Verlust des Interesses am Schicksal der<br />
Patientinnen sowie Be<strong>für</strong>chtungen, emotional zu verhärten. (3) Reduzierte<br />
persönliche Leistungsfähigkeit als dritte Dimension bezieht sich in erster Linie auf<br />
den beruflichen Bereich, kann sich aber durchaus auch auf den privaten Bereich<br />
ausdehnen (Willutzki 1997; Lemke 2006). Dabei gilt Burnout als ein allmählich<br />
einsetzender, sich schrittweise verstärkender Prozess, der auf einem<br />
anfänglichen Überengagement aufbaut und sich um die einsetzende emotionale<br />
Erschöpfung herum langsam weiter entwickelt.<br />
Der Begriff Burnout wird generell <strong>für</strong> eine Erschöpfungserscheinung im meist<br />
professionellen Umfeld angewandt, obwohl das Syndrom in den letzten Jahren<br />
erheblich an Popularität gewonnen hat und der Begriff inzwischen auf viele<br />
Berufsfelder wie auch auf außerberufliche Kontexte angewandt wird. Burnout ist<br />
damit bei weitem nicht spezifisch auf die Situation von Traumatherapeutinnen<br />
zugeschnitten. Dennoch taucht der Begriff regelmäßig in der Traumaliteratur als<br />
potentielle Gefahr <strong>für</strong> Therapeutinnen auf. Der Fokus liegt hierbei nicht so sehr<br />
auf dem Kontakt zu Traumamaterial, sondern auf einer ungünstigen Beziehung<br />
zwischen Arbeitsbelastung, Anspruch an die eigene Arbeit, Ressourcen,<br />
Erschöpfung und Erfolge bzw. Misserfolge. Autorinnen, die weitere Konzepte zu<br />
sekundärer <strong>Traumatisierung</strong> entwickelt haben und in dieser Arbeit vorgestellt<br />
werden, beziehen sich in der Regel auf Burnout als Vorläufer-Konzept (Figley<br />
1995b; Mccann & Pearlman 1990).<br />
29
3.1.3. <strong>Sekundäre</strong>r traumatischer Stress<br />
Sowohl im ICD-10 als auch im DSM-IV ist die Posttraumatische<br />
Belastungsstörung (PTBS) als eine diagnostische Kategorie angeführt. Die<br />
Version im DSM-IV hat jedoch eine Besonderheit, die die ICD-10-Kategorie nicht<br />
aufweist. Im DSM-IV heißt es bei den diagnostischen Merkmalen:<br />
Das Hauptmerkmal der Posttraumatischen Belastungsstörung ist die Entwicklung<br />
charakteristischer Symptome nach der Konfrontation mit einem extrem<br />
traumatischen Ereignis. Das traumatische Ereignis beinhaltet das direkte<br />
persönliche Erleben einer Situation, die mit dem Tod oder der Androhung des<br />
Todes, einer schweren Verletzung oder einer anderen Bedrohung der körperlichen<br />
Unversehrtheit zu tun hat oder die Beobachtung eines Ereignisses, das mit dem<br />
Tod, der Verletzung oder der Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit einer<br />
anderen Person zu tun hat oder das Miterleben eines unerwarteten oder<br />
gewaltsamen Todes, schweren Leids, oder Androhung des Todes oder einer<br />
Verletzung eines Familienmitglieds oder einer nahestehenden Person<br />
[Hervorhebung durch Verfasserin] (Kriterium A1). (DSM-IV, S. 515)<br />
In dieser Definition ist also die mögliche <strong>Traumatisierung</strong> ohne direkt von dem<br />
traumatischen Ereignis betroffen zu sein bereits inbegriffen. Eine sekundäre<br />
traumatische Belastungsstörung ist also in der Sprache des DSM-IV schlicht<br />
ebenfalls eine PTBS. Dennoch wird in der Literatur häufig von der <strong>Sekundäre</strong>n<br />
Traumatischen Belastungsstörung (STBS) gesprochen. Der Terminus wurde<br />
durch Charles Figley in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt und als<br />
eigenständiges Syndrom vorgeschlagen 4 .<br />
Figley definiert ‘sekundären traumatischen Stress’ relativ weit als „the natural<br />
consequent behaviors and emotions resulting from knowing about a traumatizing<br />
event experienced by a significant other – the stress resulting from helping or<br />
wanting to help a traumatized or suffering person” (Figley 1995b, S. 7). Was<br />
seinen Begriff der <strong>Sekundäre</strong>n Traumatischen Belastungsstörung (STBS)<br />
angeht, so sind seine eigenen Aussagen widersprüchlich. Er betont einerseits,<br />
dass das Erleben eines primären Traumas fundamental verschieden sei zu dem<br />
4 Ohne damit Erfolg zu haben schlug Figley außerdem vor, bei „post-traumatic stress disorder“<br />
(PTSD) „post“ durch „primary“ zu ersetzen, da jede Stressreaktion per Definition „post“ wäre und<br />
damit eine klarere Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer <strong>Traumatisierung</strong> möglich<br />
wäre (Figley 1995:9).<br />
30
Erleben einer Person, die „nur“ sekundär betroffen ist. In einer vergleichenden<br />
Auflistung von Symptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)<br />
einerseits und <strong>Sekundäre</strong>n Traumatischen Belastungsstörung (STBS)<br />
andererseits arbeitet er jedoch ein Störungsbild der STBS heraus, das sich nur<br />
im Auslöser von der PTBS unterscheidet, sonst aber identisch ist (Figley 1995b,<br />
S. 8f.; s.a. Lemke 2006).<br />
Figley hat sich wie kein anderer darum bemüht das Phänomen der <strong>Sekundäre</strong>n<br />
<strong>Traumatisierung</strong> begrifflich zu fassen, wobei seine Begriffe dabei jeweils eine<br />
Entwicklung durchlaufen haben. Diese ist letztlich in den einzelnen Schritten<br />
schwer nachvollziehbar und hat zu nicht klar voneinander abgrenzbaren<br />
Begriffen geführt. Diese unklaren Begriffsentwicklungen haben unter anderem<br />
dazu geführt, dass die Forschungsliteratur zu <strong>Sekundäre</strong>r <strong>Traumatisierung</strong> auf<br />
ein Begriffswirrwarr zurückgreift, das bis heute zu unscharfen Definitionen im<br />
wissenschaftlichen Diskurs führt.<br />
3.1.4. Mitgefühlserschöpfung<br />
Figley schlägt ebenfalls vor, das Phänomen ‚sekundärer traumatischer Stress‘<br />
grundsätzlich compassion stress (Mitgefühlsstress) oder compassion fatigue<br />
(Mitgefühlserschöpfung) zu nennen. Bereits im Einführungskapitel seines<br />
einschlägigen Buchs ‚Compassion Fatigue – Coping with Secondary Stress<br />
Disorder in Those Who Treat the Traumatized‘ (1995) macht er darauf<br />
aufmerksam, dass Mitgefühlserschöpfung identisch zur <strong>Sekundäre</strong>n<br />
Traumatischen Belastungsstörung (STBS) sei, und diese wiederum ein<br />
Äquivalent zur Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), was<br />
missverständlich und verwirrend ist. Was er zu Beginn eine Form von Burnout<br />
nannte, wurde zu „secondary victimization“ und schließlich entwickelte er<br />
aufgrund seines Verständnisses von sekundärem traumatischem Stress das<br />
Konzept der Mitgefühlserschöpfung (compassion fatigue), da dieser Terminus<br />
weniger pathologisierend und damit weniger abwertend klänge (Figley 2002a).<br />
Wie bereits angesprochen, hat Figley die Mitgefühlserschöpfung zunächst als<br />
Synonym zum sekundären traumatischen Stress benutzt. Dennoch lohnt es, der<br />
31
Mitgefühlerschöpfung ein eigenes Kapitel zu widmen, da dieser Begriff breiten<br />
Einzug in den wissenschaftlichen Diskurs erhalten hat und darüber hinaus in<br />
späteren Publikationen begrifflich verwässert wurde.<br />
Figley bezeichnet Mitgefühlserschöpfung als „the most friendly term for this<br />
phenomenon“ (Figley 1995b, S.14), weil dieser Begriff auf die wichtige<br />
Bedeutung des Mitgefühls im Sinne einer tiefen Sympathie und Sorge <strong>für</strong> eine<br />
leidende Person hinweise. Als Voraussetzung <strong>für</strong> die Entwicklung einer<br />
Mitgefühlserschöpfung nennt Figley in erster Linie Empathie und den Kontakt zu<br />
traumatisierten Menschen: „If we are not empathic or exposed to the traumatized,<br />
there should be little concern for compassion fatigue“ (ebd., S.15).<br />
Figley entwickelte ein Trauma-Transmissions-Modell, in dem er zehn <strong>Faktoren</strong><br />
<strong>für</strong> die Herausbildung einer Mitgefühlserschöpfung verantwortlich macht: Kontakt<br />
zur Klientin (Faktor 1), empathische Besorgnis (Faktor 2) und Empathiefähigkeit<br />
(Faktor 3). Diese führen zu einer empathischen Reaktion auf die<br />
Traumageschichte der Klientin (Faktor 4). Zwischen dieser und der Entwicklung<br />
von Mitgefühlsstress (Faktor 7) trägt die Fähigkeit der Therapeutin, sich vom<br />
Leiden der Klientin zu distanzieren (Faktor 5) und das Ausmaß in dem die<br />
Therapeutin mit ihrer Arbeit zufrieden ist (Faktor 6) ihren Anteil. Gemeinsam mit<br />
einer prolongierten Exposition (Faktor 8), dem Wecken eigener traumatischer<br />
Erinnerungen (Faktor 9) sowie eigene belastende Lebensereignisse (Faktor 10)<br />
führen alle genannten <strong>Faktoren</strong> zu einer erhöhten Vulnerabilität, eine<br />
Mitgefühlserschöpfung zu entwickeln. Einen klaren Katalog von Symptomen,<br />
oder eine klare Beschreibung, wie sich eine Mitgefühlserschöpfung äußert, liefert<br />
Figley nicht.<br />
Ein interessantes Produkt seiner Forschung ist jedoch der von ihm entwickelte<br />
Selbsttest <strong>für</strong> Psychotherapeutinnen mit 66 Fragen. Das Messinstrument soll<br />
einerseits einen Hinweis darauf geben, wie gefährdet eine Therapeutin aktuell ist,<br />
eine Mitgefühlserschöpfung gerade zu entwickeln oder bereits zu erleiden.<br />
Andererseits wird dabei die persönliche „compassion satisfaction“ ermittelt, d.h.<br />
das Ausmaß zu dem die Therapeutin durch ihr Mitgefühl Befriedigung erfährt –<br />
ein in diesem Forschungsbereich seltener positiver Pol.<br />
32
Sowohl die <strong>Sekundäre</strong> Traumatische Belastungsstörung als auch die<br />
Mitgefühlserschöpfung sind explizit <strong>für</strong> die traumatherapeutische Konstellation<br />
entwickelt. Dabei geht Figley darauf ein, dass es Autorinnen gibt, die die<br />
beeinträchtigende Wirkung von Traumatherapie auf die Therapeutin unter dem<br />
Begriff Burnout als ausreichend beschrieben erachten. Während Burnout<br />
gemeinhin kein sehr klar umrissener Begriff ist, liegt nach Figley dabei der Fokus<br />
darauf, dass sich 1) Burnout als ein schleichender Prozess herausbildet, und 2)<br />
dabei in erster Linie Symptome wie körperliche, mentale und emotionale<br />
Erschöpfung, das Gefühl von beruflichem Misserfolg und Wirkungslosigkeit des<br />
eigenen Tuns, sowie ein Rückzug und die Aufgabe idealistischer Vorstellungen<br />
vorliegen (Figley 1995b, S.11). Figley unterscheidet sekundären traumatischen<br />
Stress/ Mitgefühlserschöpfung von Burnout so, dass ersteres auch plötzlich und<br />
ohne Vorwarnung auftreten könne, und meist mit Gefühlen von Hilflosigkeit und<br />
Verwirrung, dem Gefühl von niemandem unterstützt zu werden und dem<br />
Umstand, dass den auftretenden Symptomen häufig keine realen Ursachen<br />
zugrunde liegen, einhergehen (Figley 1995b, S.12; Figley 2002a, S.53).<br />
3.1.5. Stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong><br />
Das Konzept der stellvertretenden <strong>Traumatisierung</strong> (vicarious traumatization)<br />
wurde von Laurie Anne Pearlman und ihren Mitarbeiterinnen entwickelt. In dem<br />
vielzitierten Aufsatz von McCann und Pearlman wird 1990 das Konzept<br />
basierend auf der konstruktivistischen Selbstentwicklungstheorie der Autorinnen<br />
vorgestellt. Sie beschreiben wie Traumatherapeutinnen trotz gutem Training,<br />
hochwertiger akademischer Ausbildung und Supervision bei der Behandlung von<br />
Traumaüberlebenden nicht immun <strong>gegen</strong>über den schmerzhaften Bildern,<br />
Gedanken und Gefühlen sind, die mit der Exposition von traumatischen<br />
Erinnerungen ihrer Klienten einhergehen. Dabei unterscheiden sie kurzfristige<br />
Reaktionen, die im Rahmen von Gegenübertragungsphänomenen bereits<br />
beschrieben wurden, von langfristigen Reaktionen, die sich als Veränderungen<br />
der kognitiven Schemata, Glaubenssätze, Erwartungen und Annahmen der<br />
Therapeutin über das eigene Selbst und Andere niederschlagen (McCann/<br />
33
Pearlman 1990, S.132). Diese können sich auf alle Lebensbereiche der<br />
Therapeutin auswirken und bauen sich meist kumulativ auf.<br />
Die konstruktivistische Selbstentwicklungstheorie basiert auf der Annahme, dass<br />
Menschen ihre eigene Realität konstruieren, indem sie komplexe kognitive<br />
Strukturen hervorbringen, die sie nutzen, um Ereignisse zu interpretieren. Diese<br />
kognitiven Strukturen entwickeln sich stets weiter und werden über die<br />
Lebensspanne immer komplexer, da sie permanent mit der Umwelt interagieren.<br />
Piaget nannte diese kognitiven Strukturen Schemata (zit. nach McCann/<br />
Pearlman 1990, S.137). Diese Schemata beinhalten Glaubenssätze, Annahmen<br />
und Erwartungen über das Selbst und die Welt, die es dem Individuum<br />
ermöglichen, ihre Erfahrung sinnvoll einzuordnen. Die Hypothese von McCann<br />
und Pearlman lautet, dass ein Trauma diese Schemata überfordert und<br />
durchbricht (disruption). Wie ein Mensch ein Trauma erlebt und verwindet hinge<br />
demnach davon ab, wie zentral die betroffenen Schemata <strong>für</strong> die Persönlichkeit<br />
des Individuums sind. In Analogie dazu beschreiben die Autorinnen, wie die<br />
Arbeit mit Traumaüberlebenden <strong>für</strong> eine Therapeutin ebenso ihre individuellen<br />
Schemata überfordern und nachhaltig verändern könne. Das Maß einer<br />
stellvertretenden <strong>Traumatisierung</strong> hängt demnach davon ab, wie zentral die<br />
betroffenen Schemata <strong>für</strong> die Persönlichkeit der Therapeutin sind (ebd., S.137).<br />
Die Veränderung oder der Bruch kognitiver Schemata kann sich in<br />
verschiedenen Bereichen in Form spezifischer Gefühle oder Gedanken in der<br />
Therapeutin niederschlagen. Diese Bereiche werden nachfolgend vorgestellt.<br />
Bezugsrahmen<br />
Der Mensch hat ein Bedürfnis, die Dinge die er erlebt hat, in ein sinnvolles<br />
Ganzes zusammenzufügen. Genau dieses sinnvolle Ganze sei es, das bei<br />
traumatisierten Menschen in Frage gestellt ist. So könne durch die Arbeit mit<br />
Traumatisierten das eigene Identitätsgefühl, die eigene Weltsicht oder die eigene<br />
Spiritualität beeinträchtigt werden. Die Folgen können vielfältig sein: ein Gefühl<br />
der Desorientierung, da die eigene Identität in Frage gestellt wird; moralische<br />
Prinzipien oder Lebensphilosophien werden auf den Prüfstand gestellt und<br />
können in Zynismus münden; oder eine ‚spirituelle Verarmung‘, wenn die<br />
Therapeutin ihr Gefühl von Sinn, Hoffnung oder Verbundenheit verliert (McCann<br />
34
&Pearlmen 1990; Pearlman & Saakvitne 1995; Pearlman 2002; Rosenbloom et al<br />
2002). Pearlman und Saakvitne bezeichnen den Bruch mit dem Bezugsrahmen<br />
als ein besonderes Merkmal der indirekten <strong>Traumatisierung</strong>, das tatsächlich bei<br />
keinem der anderen Konzepte so beschrieben wird.<br />
Fähigkeiten im Umgang mit sich selbst und Ich-Ressourcen<br />
Durch die Berührung mit schwerem Trauma können innere Fähigkeiten, die es<br />
uns ermöglichen, ein gesundes Maß an Selbstachtung und Selbst<strong>für</strong>sorge zu<br />
erhalten, beeinflusst werden. Diese bestehen laut Pearlman & Saakvitne (1995)<br />
im Wesentlichen aus drei Komponenten: (a) die Fähigkeit, ein grundsätzlich<br />
positives Gefühl zum eigenen Selbst aufrechtzuerhalten, (b) die Fähigkeit,<br />
konstruktiv mit starken Affekten umzugehen, und (c) die Fähigkeit ein Gefühl der<br />
Verbundenheit mit Anderen aufrechtzuerhalten. Brüche mit diesen Fähigkeiten<br />
und damit deutliche Anzeichen <strong>für</strong> eine stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong> können<br />
sein: Überanstrengung, Übertreibungen oder zwanghafter Konsum zur<br />
Affektvermeidung, Selbstkritik bis hin zu Selbsthass, Schwierigkeiten mit starken<br />
Gefühlen umzugehen oder Hypersensibilität bei emotional aufgeladenen Stimuli<br />
(z.B. Unfähigkeit, Zeitung zu lesen), Gefühle von Isolierung oder Getrenntheit von<br />
Anderen etc. Solche Tendenzen können auch verschleiert sein durch das<br />
Eintauchen in Arbeit, emotionale Taubheit oder Intellektualisierung. Als Ich-<br />
Ressourcen bezeichnen Pearlman & Saakvitne jene inneren Fähigkeiten, die es<br />
uns ermöglichen, unsere psychischen Bedürfnisse zu erfüllen und<br />
zwischenmenschliche Beziehungen zu unterhalten. Auch diese können durch<br />
selbst erlebte Traumata wie auch durch Traumaarbeit beeinflusst werden.<br />
Beeinträchtigungen durch stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong> stellen Ressourcen<br />
wie Selbstprüfung, Willenskraft, Humor, Empathie, die Fähigkeit Grenzen zu<br />
setzen und Intelligenz auf den Prüfstand (Pearlman 2002b, S.83f.).<br />
Psychische Bedürfnisse<br />
Bestimmte grundlegende psychische Bedürfnisse sind besonders empfänglich <strong>für</strong><br />
Veränderung durch Traumata oder die Arbeit mit einem Trauma. Jeder Mensch<br />
hat diese Bedürfnisse, doch sind im Einzelfall manche zentraler und andere<br />
weniger zentral. Am wichtigsten <strong>für</strong> einen Menschen sind meist die Bedürfnisse,<br />
deren Erfüllung am meisten gefährdet ist. In der Traumaarbeit sind es laut<br />
35
Pearlman und ihren Kolleginnen die Bedürfnisse nach Sicherheit, Vertrauen,<br />
Wertschätzung, Nähe und Kontrolle, die zentral angesprochen werden<br />
(Rosenbloom et al. 2002):<br />
Bilderleben<br />
McCann und Pearlman berichten darüber, wie sich bei Therapeutinnen das<br />
Gedächtnissystem verändern kann. Dabei können sich Bilder von Erzählungen<br />
ihrer Patientinnen bei den Therapeutinnen als Flashbacks oder in Träumen<br />
niederschlagen, die sich dann anfühlen als wären es eigene Erfahrungen. Dies<br />
können fragmentarische Bilder sein, die ohne Kontext durch bislang neutrale<br />
Stimuli hervorgerufen werden können und sich dann mit den Erzählungen der<br />
Klientinnen assoziieren. Auf diese Art werden traumatische Erinnerungen von<br />
Klientinnen durch Therapeutinnen geradezu inkorporiert und in ihr eigenes<br />
Erinnerungssystem integriert (McCann & Pearlman 1990, S.143).<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Konzept der stellvertretenden<br />
<strong>Traumatisierung</strong> eine tiefgreifende wenn auch allmähliche Veränderung oder<br />
einen Bruch mit den eigenen Vorstellungen von Sinn, Verbundenheit, Identität,<br />
Weltsicht, wie auch eine Veränderung der eigenen Affekttoleranzgrenze,<br />
Bedürfnisse, Glaubenssätze vom eigenen Selbst und Anderen, interpersonellen<br />
Beziehungen, des sensorischen Gedächtnisses und dem Erleben innerer Bilder<br />
beschreibt.<br />
Für die Vertreterinnen dieses Konzeptes ist die stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong><br />
nicht eine Diagnose, ein einmaliges Ereignis oder ein einmaliges Erleben. „Es<br />
handelt sich um ein fließendes Phänomen, das sich ständig verändert und uns<br />
wie ein Schatten folgt. Solange wir uns mitfühlend um Traumaüberlebende<br />
kümmern und wir uns da<strong>für</strong> verantwortlich fühlen, ihnen auf irgendeine Weise zu<br />
helfen, werden wir IT [indirekte <strong>Traumatisierung</strong>, was hier synonym zu<br />
‚sekundärer <strong>Traumatisierung</strong>‘ verwendet wird, Anmerkung der Verfasserin]<br />
erleben“ (Pearlman 2002, S.36). Sie möchte damit betonen, „dass wir nicht<br />
Meister unserer IT sind“ (ebd., S.36), sondern dass dieses Problem als gegeben<br />
und nicht verhinderbar anzuerkennen sei und man ihm mit Respekt begegnen<br />
solle.<br />
36
Das Konzept der stellvertretenden <strong>Traumatisierung</strong> ist das detaillierteste der hier<br />
vorgestellten Konzepte. So nachvollziehbar das Konzept erscheint ist fraglich,<br />
worin nun <strong>für</strong> die Therapeutin das traumatische Moment liegt. Dass die<br />
traumatischen Erinnerungen, von denen Klientinnen berichten, die Therapeutin<br />
schockieren und schmerzhaft sein können, und dass sie darüber hinaus auf<br />
lange Sicht zu einer Veränderung der Weltsicht führen können, erscheint intuitiv<br />
einleuchtend. Ist es jedoch gerechtfertigt, in diesem Zusammenhang von einer<br />
<strong>Traumatisierung</strong> zu sprechen und damit das Leiden einer stellvertretend<br />
traumatisierten Therapeutin qualitativ in die Nähe eines primärtraumatisierten<br />
Menschen zu stellen, dem am eigenen Leibe Schreckliches widerfahren ist? Es<br />
könnte auch argumentiert werden, dass die Veränderung von kognitiven<br />
Schemata ein Weg hin zu einer realistischeren vertieften Weltsicht bedeutet, in<br />
der auch die Möglichkeit Platz hat, dass Menschen eine große Bandbreite an<br />
Handlungsmöglichkeiten haben und dazu auch zutiefst bösartige Handlungen<br />
gehören können.<br />
3.1.6. Ein neuropsychologisches Modell<br />
Eine neuere Arbeit ist das neuropsychologische Modell der sekundären<br />
<strong>Traumatisierung</strong> von Daniels (2006; 2007). Durch eine epidemiologische Studie<br />
ermittelt sie ein Syndrom der sekundären <strong>Traumatisierung</strong>, das sich stark an den<br />
Kernsymptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung anlehnt. Neben<br />
diesen weist sie typische komorbide Symptome wie Suchtmittelmissbrauch oder<br />
depressive Verstimmungen nach, sowie Symptome, die über eine klassische<br />
Traumafolgestörung hinausgehen, wie Entgrenzung, parapsychotische<br />
Bedrohungszustände oder diverse Auswirkungen auf die eigene Sexualität.<br />
Als zentral und erklärungsbedürftig empfindet Daniels die Tatsache, dass<br />
sekundär traumatisierte Therapeutinnen sensorische Intrusionen aufweisen, wo<br />
sie doch selbst diesen sensorischen Reizen des Traumas ihrer Klientinnen nicht<br />
direkt ausgesetzt waren und obwohl die therapeutische Situation in den<br />
Dimensionen Vorhersehbarkeit, Kontrolle und Wissen sich eindeutig von der<br />
Situation primärer Traumaopfer unterscheidet. Sie weist nach, dass sowohl<br />
Therapeutinnen als auch Supervisorinnen eine Distanzierung vom emotionalen<br />
37
Erleben der Klientin als zentrale Kategorie in der Herausbildung einer<br />
sekundären <strong>Traumatisierung</strong> erachten, und sowohl als Schutz- wie auch als<br />
Risikofaktor beschreiben. Dabei wird die bewusste Distanzierung als<br />
unverzichtbare Technik in der Traumatherapie als Schutzfunktion beschrieben,<br />
während sich das unwillkürliche Abdriften in dissoziative Zustände während einer<br />
Trauma-Exposition als zentraler Risikofaktor herauskristallisiert (Daniels 2007,<br />
S.50).<br />
In Analogie zu Ätiologietheorien der PTBS, die die ‚peritraumatische Dissoziation‘<br />
als varianzstärksten Prädiktor <strong>für</strong> die Herausbildung einer PTBS verantwortlich<br />
machen, entwickelt Daniels Hypothesen darüber, wie hirnphysiologisch erklärt<br />
werden kann, dass auch Therapeutinnen aufgrund einer dissoziativen<br />
Informationsverarbeitung sekundärtraumatische Symptome entwickeln können.<br />
Dabei spielen – so vermutet Daniels – Empathie, Kindling und Dissoziation<br />
jeweils eine zentrale Rolle. Sie erläutert, dass bei einer empathischen<br />
therapeutischen Haltung der Therapeutinnen aufgrund des<br />
Spiegelneuronensystems die gleichen neuronalen Netzwerke aktiv werden wie<br />
beim eigenen Erleben des Erzählten und der ‚Fehler‘ der<br />
Informationsverarbeitung im Wegfall der Selbst-Fremd-Differenzierung liegen<br />
muss. Diesen Wegfall erklärt sie sich aufgrund des Kindling der Amygdala, d.h.<br />
einer zunehmenden Sensibilisierung der Amygdala durch wiederholte<br />
unterschwellige Aktivierung und einer dissoziativen Reaktion in der Folge. Auf<br />
dieser Grundlage formuliert Daniels die folgende Ätiologiehypothese <strong>für</strong> die<br />
sekundäre <strong>Traumatisierung</strong>:<br />
Durch die Konfrontation mit Traumamaterial kommt es wiederholt zu einer<br />
durch die Spiegelneurone vermittelten Angsterregung. Diese führt zum<br />
Kindling der Amygdala. Die unterschwellige intermittierende Reizung, die<br />
die Voraussetzung <strong>für</strong> das Kindling der Amygdala ist, entsteht also durch<br />
die über die Spiegelneurone vermittelte emotionale Resonanz auf mehrere<br />
traumatisierte Klientinnen. In der Folge würden geringe Aktivierungen zu<br />
einer Überschreitung der Aktivierungsschwelle führen, so dass die<br />
Therapeutin intensive Emotionen von Angst, Entsetzen oder Hilflosigkeit<br />
erlebt, die der aktuellen äußeren Situation nicht angemessen sind. Auf<br />
38
Grund der intensiven emotionalen Beteiligung kommt es bei den<br />
Therapeutinnen zu einer peritraumatischen Dissoziation. Diese bedingt den<br />
Ausfall der Selbst-Fremd-Differenzierung sowie eine Enkodierung der<br />
Traumabeschreibungen ohne Kontextinformationen. Diese Verarbeitung<br />
führt zu den beschriebenen Intrusionen sowie dem Gefühl aktueller<br />
Bedrohung. (Daniels 2007, S.55)<br />
Die in diesem Kapitel bisher beschriebenen theoretischen Ansätze und die bloße<br />
Tatsache, dass es eine solche Vielzahl an Versuchen gab, potentiell<br />
schädigende Auswirkungen von Psychotherapie mit traumatisierten Klientinnen<br />
zu beschreiben und theoretisch fassbarer zu machen, zieht die Frage nach sich,<br />
wie man sich von diesen schädigenden Auswirkungen als Therapeutin schützen<br />
kann, um eine sekundäre <strong>Traumatisierung</strong>, wie auch immer sie begrifflich gefasst<br />
sein mag, zu vermeiden. Zuvor wird jedoch im Folgenden eine Reihe von<br />
theoretischen Ansätzen vorgestellt, die meist in Anlehnung an die hier<br />
vorgestellten Konzepte sekundärer <strong>Traumatisierung</strong> gezielt positive Gegenpole<br />
der Arbeit mit dem Trauma thematisieren.<br />
3.2. Positive Aspekte der Arbeit mit Traumatisierten<br />
In der Traumaliteratur gibt es einige wenige Publikationen, die sich mit den<br />
potentiell positiven Auswirkungen von Trauma beschäftigen. Bekannt geworden<br />
ist allen voran der Begriff des „post-traumatic growth“ (Tedeschi & Calhoun<br />
1996). Dieser wie auch andere Begriffe haben auf den Bereich der sekundären<br />
Traumafolgen eine analoge Anwendung gefunden. So gibt es einige Autorinnen,<br />
die sich mit den Auswirkungen von Psychotherapie mit Traumatisierten auf die<br />
Therapeutin beschäftigen, die neben möglichen Belastungen auch auf einen<br />
positiven Pol hingewiesen haben, wie etwa der Begriff der compassion<br />
satisfaction (Mitgefühlszufriedenheit) bei Figley (1995). Er hat mit seinem<br />
Selbsttest <strong>für</strong> Therapeutinnen das Maß <strong>für</strong> Mitgefühlserschöpfung auf einem<br />
Kontinuum zwischen compassion fatigue und compassion satisfaction<br />
angesiedelt und damit einen positiven Pol geschaffen, der in diesem<br />
Forschungsgebiet selten ist (siehe dazu Kapitel 3.1.4). Weitere solcher positiven<br />
theoretischen Ansätze sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.<br />
39
3.2.1. Work Engagement<br />
Mit work engagement wurde ein Konzept von Bakker et al. (2008) entwickelt, das<br />
die Autorinnen als positive Antipode zu Burnout sehen. Ähnlich wie Maslach und<br />
ihre Mitarbeiterinnen ein direktes Gegenteil zu Burnout aus den drei<br />
Kerndimensionen des Burnout ableiten (Energie, Engagement und Wirksamkeit),<br />
definieren Bakker et al. work engagement als „a positive, fulfilling, work-related<br />
state of mind that is characterized by vigour, dedication, and absorption“<br />
(Schaufeli et al., zit. nach Bakker et al. 2008, S. 188). Während das Maslach<br />
Burnout Inventory (MBI) und das Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) die<br />
zentralen Symptomdimensionen auf einer Skala abbilden, die ebenso die<br />
positiven Pole der gemessenen Dimensionen umfassen und damit dem Burnout<br />
<strong>gegen</strong>sätzlich <strong>gegen</strong>überstehende Konzepte messen können, haben Schaufeli<br />
und Bakker (zit. nach Bakker 2008, S.190) die Utrecht Work Engagement Scale<br />
(UWES) entwickelt, um explizit das Maß work engagement anhand der<br />
Dimensionen Kraft (vigour), Hingabe (dedication) und ‚Aufgehen in‘ (absorption)<br />
zu ermitteln [Übersetzung der Autorin]. Work engagement wird dabei von<br />
Workaholism durch die Abwesenheit eines zwanghaften Arbeitsdranges<br />
abgegrenzt. Bakker et al. zeigen, dass hohe Ausprägungen des work<br />
engagement mit bestimmten berufsbedingten (z.B. Autonomie, Supervision und<br />
Coaching, Feedback <strong>für</strong> Leistungen) und persönlichen Ressourcen (z.B.<br />
Optimismus, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein) korrelieren. Dieses Konzept<br />
ist zwar ebenso wie Burnout nicht auf die Tätigkeit als Traumatherapeutin gezielt<br />
zugeschnitten, kann aber gerade in diesem Bereich Anwendung finden, da<br />
Therapeutinnen in diesem Bereich häufig mit viel Idealismus und Hingabe ans<br />
Werk gehen.<br />
3.2.2. Vicarious Posttraumatic Growth<br />
Die amerikanischen Psychologen Tedeschi und Calhoun haben sich mit der<br />
Wirkung von Traumata beschäftigt, einen Anstoß <strong>für</strong> eine positive Entwicklung zu<br />
geben (1996). Sie haben ein Messinstrument zur Erfassung positiver<br />
Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen entwickelt: das posttraumatic<br />
40
growth inventory (PTGI). Sie begründen ihren Ansatz damit, dass viele<br />
Betroffene davon berichten, durch eine <strong>Traumatisierung</strong> neue Möglichkeiten in<br />
ihrem Leben entdeckt zu haben, dass sich ihre Beziehungen zu anderen<br />
Menschen positiv verändert haben, ebenso wie sie an persönlicher und<br />
spiritueller Stärke gewonnen haben. Anhand von fünf Dimensionen (Relating to<br />
Others, New Possibilities, Personal Strength, Spiritual Change, Appreciation of<br />
Life) misst das PTGI, inwiefern Traumaüberlebende neben negativen Effekten<br />
auch positive Auswirkungen eines Traumas wahrnehmen können und wie diese<br />
mit anderen <strong>Faktoren</strong>, wie Persönlichkeitseigenschaften oder der Schwere und<br />
Art des Traumas, zusammenhängen. Während die meisten empirischen Studien<br />
zur Untermauerung des Konzepts des posttraumatic growth an amerikanischen<br />
College-Studenten durchgeführt wurden, hat ein Forscherteam um Steve Powell<br />
das Konzept auf Überlebende von Krieg und Vertreibung in Sarajevo angewandt<br />
und dort empirisch geprüft. Mit dem PTGI als primärem Messinstrument wurde<br />
festgestellt, dass die Werte <strong>für</strong> posttraumatisches Wachstum generell um einiges<br />
niedriger ausfielen als bei den amerikanischen Studien. Außerdem kamen junge<br />
Menschen auf sehr viel höhere Werte <strong>für</strong> posttraumatisches Wachstum als ältere<br />
(Powell et al. 2003).<br />
Interessant ist das Konzept des posttraumatic growth hier in erster Linie in Bezug<br />
auf die Frage, ob es sich analog auch auf Therapeutinnen, die mit<br />
Traumaüberlebenden arbeiten, und die hier beschriebenen potentiellen<br />
Berufsrisiken übertragen lässt. Genau dies haben Arnold et al. in einer Studie<br />
versucht, in der 21 Psychotherapeutinnen zu den Konsequenzen der Arbeit mit<br />
Traumaüberlebenden in qualitativen Interviews befragt wurden (Arnold et al.<br />
2005). Unter dem Begriff des Vicarious Posttraumatic Growth beschreiben die<br />
Autorinnen wie klinisch Tätige auch wichtige Gewinne und Entlohnung durch die<br />
Arbeit mit Traumatisierten erfahren, wie etwa verbesserte Beziehungsfähigkeit,<br />
verstärkte Wertschätzung <strong>für</strong> die Widerstandskraft des menschlichen Geistes, die<br />
Zufriedenheit, das Wachstum und den Heilungsprozess ihrer Klientinnen zu<br />
begleiten, persönliches Wachstum oder spirituelles Wohlbefinden. Die Autorinnen<br />
weisen darauf hin, dass ihre Interviews ergeben haben, dass alle interviewten<br />
Therapeutinnen sowohl negative als auch positive Aspekte ihrer Arbeit<br />
erwähnen. Dennoch sei die Erforschung der positiven Aspekte <strong>gegen</strong>über den<br />
41
negativen Aspekten weit unterrepräsentiert. So wurden ihre Interviews mit einem<br />
Fokus auf die folgenden Aspekte geführt: (a) Veränderungen des<br />
Gedächtnissystems und der Schemata in Bezug auf das Selbst und die Welt (die<br />
zentralen Kennzeichen einer stellvertretenden <strong>Traumatisierung</strong>), und (b) das<br />
selbst wahrgenommene psychische Wachstum, gemessen an drei zentralen<br />
Kategorien, die auch im Konzept des posttraumatic growth beschrieben werden:<br />
Veränderungen in der Selbstwahrnehmung, persönlichen Beziehungen oder der<br />
Lebensphilosophie (vgl. Arnold et al. 2005, S. 244). Es stellte sich heraus, dass<br />
ein Großteil der Therapeutinnen anhaltende Veränderungen ihrer Wesenszüge in<br />
positiver Weise beschrieben in Bezug auf ihre Sensibilität, ihr Mitgefühl, ihre<br />
Toleranz und ihre Empathie. Die meisten Therapeutinnen berichteten von<br />
positiven Auswirkungen auf ihre eigene Spiritualität und eine tiefe Dankbarkeit <strong>für</strong><br />
die Entwicklung ihres eigenen Lebens. Zusammenfassend ist diese Studie eine<br />
der wenigen, die sich mit den positiven Effekten der Arbeit mit traumatisierten<br />
Menschen <strong>für</strong> Psychotherapeutinnen beschäftigt, und bezeichnet diese Effekte<br />
als vicarious posttraumatic growth – stellvertretendes posttraumatisches<br />
Wachstum.<br />
3.2.3. Positive Self-transformation<br />
Benatar (2004) geht in Anknüpfung an die Vorstellungen der stellvertretenden<br />
<strong>Traumatisierung</strong> darauf ein, dass Traumatherapie eine Therapeutin irgendwann<br />
immer an Herausforderungen heranführen wird, die sich zunächst nicht<br />
bewältigbar anfühlen. Nimmt sie die Herausforderung an, so könne sie sowohl<br />
gestärkt als auch verletzt daraus hervorgehen. Schmerzhafte Konfrontationen mit<br />
dunklen Seiten der menschlichen Natur, der Kontakt mit Leiden und Überleben<br />
wird laut Benatar eine Therapeutin immer dazu bringen, sich existentielle oder<br />
spirituelle Fragen zu stellen. Und diese könnten einen wichtigen Teil der eigenen<br />
Wachstums- und Entwicklungsreise der Therapeutin ausmachen.<br />
Traumatherapie könne <strong>für</strong> die Therapeutin also eine Transformation bedeuten,<br />
die sie mit einem vertieften und gereiften Bewusstsein zurücklässt. Benatar<br />
schlägt da<strong>für</strong> den Begriff der „Positiven Selbst-Transformation“ (positive self-<br />
transformation) als Korrelat zur stellvertretenden <strong>Traumatisierung</strong> vor und<br />
42
definiert ihn als Wandlung im Selbst-System der Therapeutin hin zu mehr Reife<br />
und Selbstentfaltung (Benatar 2004, S. 6, eigene Übersetzung).<br />
3.2.4. Vicarious Resilience<br />
Auch bei Pearlman und ihren Kolleginnen und ihren Ausführungen über die<br />
vicarious traumatization wird auf den Gewinn der Arbeit mit traumatisierten<br />
Klientinnen hingewiesen. Werden die Autorinnen Pearlman und Saakvitne dazu<br />
befragt, wie sie ihre Arbeit aushalten können, so antworten sie (ohne dies in ein<br />
theoretisches Konzept einzubetten):<br />
Wie könnten wir über die Fähigkeit verfügen, zu einem Prozess der<br />
Hoffnung und der Heilung beizutragen und sie nicht nutzen? Es gibt keine<br />
andere Arbeit, die wir sinnvoller, herausfordernder und befriedigender<br />
fänden. Welche andere Arbeit würde uns ermöglichen, uns voll einzulassen<br />
– mit Kopf, Herz und Seele? Wie könnten wir anders, als das zu tun, was<br />
unsere Kreativität, was all unsere intellektuellen Fähigkeiten, all unsere<br />
Gefühle, unsere ganze Menschlichkeit erfordert? [Hervorhebung im<br />
Original] (Pearlman & Saakvitne zit. nach Rösing, 2007, S.180)<br />
Sie beschreiben die Erfahrung, an der Heilung und Entwicklung anderer<br />
Menschen teilzuhaben, als Ehre, als eine spirituelle Erfahrung: „Die Resilienz<br />
unserer Klienten, ihre Heilungsfähigkeit und ihre Entfaltung sind kraftvolle<br />
Gegengewichte <strong>gegen</strong> den schleichenden Zynismus, der die Stellvertretende<br />
<strong>Traumatisierung</strong> kennzeichnet. Diese Erfahrungen vertiefen unsere Achtung vor<br />
der Seele des Menschen“ (Pearlman & Saakvitne zit. nach Rösing, 2007, S.180,<br />
Hervorhebung im Original).<br />
Dabei ist der Begriff der Resilienz 5 ein Paradigma, das sich verstärkt seit den<br />
1990er Jahren in Psychologie, Pädagogik und Gesundheitswissenschaften<br />
eingebürgert hat. Angestoßen durch Langzeitstudien wie etwa die Untersuchung<br />
von Emmy Werner auf der Hawaii-Insel Kauai (siehe dazu Fröhlich-Gildhoff &<br />
Rönnau-Böse 2009, S. 15-16) und das Salutogenese-Konzept des israelischen<br />
5 Der deutsche Begriff Resilienz leitet sich aus dem Englischen „resilience“ ab, was so viel<br />
bedeutet wie Spannkraft, Widerstandsfähigkeit oder Elastizität.<br />
43
Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1997) (s. Kapitel 3.3) brachte die<br />
Resilienzforschung einen Wechsel der Blickrichtung mit sich: Während bislang<br />
vor allem die Ursachen und Bedingungen bei der Entstehung psychischer<br />
Störungen untersucht wurden, ging man dazu über neben den Risikofaktoren<br />
explizit Schutzfaktoren zu identifizieren, die <strong>für</strong> die Entwicklung und den Erhalt<br />
seelischer und körperlicher Gesundheit verantwortlich sind. Resilienz beschreibt<br />
die Fähigkeit eines Individuums, „erfolgreich mit belastenden Lebensumständen<br />
und negativen Stressfolgen“ umgehen zu können“ (Wustmann, zit. nach Fröhlich-<br />
Gildhoff & Rönnau-Böse 2009, S. 9). Dabei gilt Resilienz nicht als eine<br />
angeborene Eigenschaft, sondern als Interaktionsprozess zwischen Individuum<br />
und Umwelt, bei dem zum einen das Individuum in einem dynamischen<br />
Anpassungs- und Entwicklungsprozess selbst aktiv regulierend auf seine Umwelt<br />
einwirkt, und gleichzeitig der sozialen Unterstützung, auf die das Individuum<br />
zurückgreifen kann, eine besondere Bedeutung zukommt.<br />
Im deutschsprachigen Diskurs bezieht sich das Forschungsprogramm Resilienz<br />
in erster Linie auf Kinder, die unter widrigen Umständen aufwachsen und sich<br />
trotzdem gut entwickeln. Es wird daher auch vor allem in der Pädagogik, speziell<br />
in der Frühförderung, aber auch in der klinischen Kinderpsychotherapie genutzt.<br />
Im englischsprachigen Forschungsdiskurs wird ‚resilience‘ begrifflich meist etwas<br />
weiter gefasst. Auch die englischsprachige Resilienzforschung begann mit der<br />
Erforschung von negativen Kindheitserfahrungen. Mit der Zeit wurde dieser<br />
Fokus jedoch weiter und umfasst heute Lebensereignisse oder -umstände der<br />
gesamten Lebensspanne wie beispielsweise Armut, Wohnungslosigkeit,<br />
traumatische Ereignisse, Naturkatastrophen, Gewalt, Krieg und körperliche<br />
Erkrankungen, sowie deren Überwindung. Ebenso wird heute Resilienz nicht<br />
mehr nur als Eigenschaft von Individuen angenommen. Der Begriff wird auch auf<br />
ganze Familien, Gemeinschaften oder Gesellschaften angewandt (Herrman et al.<br />
2011). Grundsätzlich bezieht sich ‚resilience‘ auf positive Anpassungsleistungen,<br />
bzw. die Fähigkeit psychische Gesundheit (wieder-) zu erhalten trotz der<br />
Erfahrung von Not. Der Begriff der Salutogenese, der von Antonovsky geprägt<br />
wurde, ist eng mit der Resilienzforschung verknüpft. Dazu mehr in Kapitel 3.3.<br />
Ein interessanter Versuch, das Konzept der Resilienz auf Psychotherapeutinnen<br />
und deren Umgang mit den Belastungen durch die Arbeit mit traumatisierten<br />
44
Menschen anzuwenden (wenn auch konzeptionell noch wenig ausgereift), wurde<br />
von Hernandez et al. (2007) unter dem Namen vicarious resilience<br />
(stellvertretende Resilienz) formuliert. Die Autorinnen haben mit einer<br />
explorativen qualitativen Interviewstudie mit Therapeutinnen, die in Kolumbien<br />
mit Opfern politischer Gewalt arbeiten, versucht, positive Aspekte der Arbeit mit<br />
Traumatisierten aufzuspüren und haben dabei Theorien sekundärer<br />
<strong>Traumatisierung</strong> auf der einen Seite und das Konzept Resilienz auf der anderen<br />
zusammengebracht. Die Therapeutinnen wurden explizit danach befragt, wie sie<br />
selbst positive Effekte erlebt haben, durch die Art wie ihre Klientinnen ihr Leid<br />
überwinden lernten und ob sie von diesen etwas lernen konnten. Als Ergebnis<br />
fassen die Autorinnen zusammen, dass ein Prozess der stellvertretenden<br />
Resilienz nachweisbar sei und argumentieren, dass dies ähnlich wie die<br />
stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong> ein natürlicher und üblicher Prozess sei. Er<br />
stelle eine Transformation der inneren Erlebnisweise der Therapeutin in Folge<br />
von empathischer Arbeit mit Traumatisierten dar. Zentrale Kategorien, in denen<br />
sich diese Transformation niederschlage, wurden folgendermaßen identifiziert:<br />
Zeugenschaft <strong>für</strong> die enormen menschlichen Kapazitäten zu heilen; Spiritualität<br />
als Ressource; die Neubewertung eigener persönlicher Probleme; die<br />
Entwicklung von Hoffnung und Engagement; verstärkte professionelle und<br />
persönliche Formulierung eigener Positionen <strong>gegen</strong>über politischer Gewalt; die<br />
Entwicklung einer höheren Frustrationstoleranz und andere (Hernandez et al.<br />
2007, S. 238). Darüber hinaus postulieren die Autorinnen, dass stellvertretende<br />
<strong>Traumatisierung</strong> und stellvertretende Resilienz zwei Prozesse seien, die parallel<br />
ablaufen können und schlagen weitere Forschungsbemühungen vor zur<br />
Untersuchung der Interaktionen zwischen beiden Prozessen.<br />
3.3. Der salutogenetische Ansatz<br />
Das Konzept der Salutogenese wird hier gesondert dargestellt, da dieses Modell<br />
die Entwicklung der Fragestellung dieser Arbeit in besonderer Weise beeinflusst<br />
hat. Es geht auf den israelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky zurück,<br />
der 1970 eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat. In einer Untersuchung<br />
über Adaptionsprozesse von Frauen verschiedener ethnischer Gruppen an das<br />
Klimakterium wurde in die Erhebung eine simple Ja-Nein-Frage zum Aufenthalt in<br />
45
einem Konzentrationslager während des Holocausts eingebaut, ohne damit ein<br />
explizit formuliertes Erkenntnisziel zu verfolgen. Mit großem Erstaunen stellte<br />
Antonovsky fest, dass neben 51% der Kontrollgruppe 29% der Überlebenden aus<br />
Konzentrationslagern insgesamt über eine gute psychische wie auch physische<br />
Gesundheit verfügten: „Den absolut unvorstellbaren Horror des Lagers<br />
durchgestanden zu haben, anschließend jahrelang eine deplatzierte Person<br />
gewesen zu sein und sich dann ein neues Leben in einem Land neu aufgebaut<br />
zu haben, das drei Kriege erlebte … und dennoch in einem angemessenen<br />
Gesundheitszustand zu sein! Dies war <strong>für</strong> mich die dramatische Erfahrung, die<br />
mich bewußt auf den Weg brachte, das zu formulieren, was ich später als das<br />
salutogenetische Modell bezeichnet habe […]“ (Antonovsky 1997, S.15). Das<br />
daraufhin von Antonovsky entwickelte Forschungsprogramm verstand sich in<br />
Abkehr von der gängigen pathogenetischen Orientierung, die danach fragt,<br />
warum Menschen krank werden. Antonovsky begreift Krankheit nicht als eine<br />
Ausnahme oder eine seltene Abweichung vom Normalzustand, sondern aufgrund<br />
seiner statistischen Daten als einen weit verbreiteten Zustand. Mit seiner neu<br />
entdeckten salutogenetischen Orientierung, die sich auf die Ursprünge von<br />
Gesundheit konzentriert, stellt er die Frage: „Warum befinden sich Menschen auf<br />
der positiven Seite des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums oder warum<br />
bewegen sie sich auf den positiven Pol zu, unabhängig von ihrer aktuellen<br />
Position?“ (ebd., S.15).<br />
Antonovsky stellt fest, dass die Antwort auf diese Frage nicht in der Abwesenheit<br />
von Stressoren liegen kann, da im menschlichen Leben Stressoren omnipräsent<br />
sind. Dabei gibt es Menschen, die sogar mit einer hohen Stressorbelastung gut<br />
zurechtkommen, möglicherweise sogar gerade aus schwierigen Erfahrungen<br />
gestärkt hervorgehen. Eine Antwort, die er im Laufe seiner Forschungstätigkeit<br />
auf diese Frage gefunden hat, liegt im Konzept des Kohärenzgefühls (sense of<br />
coherence, SOC). Dieses definiert er als „eine globale Orientierung […], die das<br />
Maß ausdrückt, in dem man ein durchdringendes, andauerndes aber<br />
dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß die eigene interne und externe<br />
Umwelt vorhersagbar ist und daß es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, daß sich<br />
die Dinge so entwickeln werden, wie vernünftigerweise erwartet werden kann“<br />
(ebd., S.16, Hervorhebung im Original). Das Kohärenzgefühl besteht im<br />
46
Wesentlichen aus drei zentralen Komponenten: (1) dem Gefühl der<br />
Verstehbarkeit von Situationen und Ereignissen (sense of comprehensibility),<br />
also dem Gefühl, dass zukünftige Stimuli vorhersagbar sein werden, oder wenn<br />
sie überraschend auftreten, dass sie eingeordnet oder erklärt werden können; (2)<br />
dem Gefühl der Handhabbarkeit (sense of managability), verstanden als das<br />
Ausmaß, in dem man wahrnimmt, dass man geeignete Ressourcen zur<br />
Verfügung hat, um schwierigen Anforderungen begegnen zu können und ihnen<br />
nicht unkontrolliert ausgeliefert zu sein; (3) dem Gefühl der Bedeutsamkeit oder<br />
Sinnhaftigkeit (sense of meaningfulness), was sich auf das Ausmaß bezieht, in<br />
dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet, sodass die vom Leben<br />
gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, Energie in sie zu<br />
investieren (ebd., S.34-36).<br />
Das Konzept des Kohärenzgefühls wurde stark in die Resilienzforschung<br />
aufgenommen und wird dort als eine persönliche Ressource gesehen. Die<br />
Resilienzforschung und das Forschungsprogramm der Salutogenese sind sich in<br />
ihren Kernannahmen und Fragestellungen sehr ähnlich. Sie setzen aber leicht<br />
verschiedene Akzente. Während sich die Resilienzforschung auf Prozesse der<br />
positiven Adaption und Bewältigung schwieriger Lebensumstände oder –<br />
ereignisse konzentriert, legt die Salutogenese den Schwerpunkt auf<br />
Schutzfaktoren zur Erhaltung oder (Wieder-) Erlangung von Gesundheit (vgl.<br />
dazu Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2009, S.14). Die salutogenetische<br />
Perspektive hat die Fragestellung der hier vorliegenden Arbeit stark geprägt.<br />
47
4. Fragestellung<br />
Für die hier vorliegende Fragestellung werden die drei bislang vorgestellten<br />
Bereiche klinischer Theorie zusammen gedacht. Erstens legen die Ausführungen<br />
verschiedener theoretischer Modelle in Kapitel 3.1 nahe, dass die therapeutische<br />
Arbeit mit schwer traumatisierten Menschen ein gewisses Berufsrisiko in sich<br />
birgt. Es ist nicht das primäre Ziel, an dieser Stelle Position in die eine oder<br />
andere theoretische Richtung in Bezug auf verschiedene Konzeptionen<br />
<strong>Sekundäre</strong>r <strong>Traumatisierung</strong> zu beziehen oder diese in Tiefe zu diskutieren. Die<br />
bloße Vielzahl an konzeptionellen Bemühungen, die schädigende Wirkung dieser<br />
Arbeit in eine überprüfbare, wissenschaftliche Sprache zu überführen und diese<br />
Konzepte empirisch zu überprüfen, sind ein starker Hinweis darauf, dass dies ein<br />
natürliches und weitverbreitetes Vorkommnis und eine reale Gefahr <strong>für</strong><br />
Traumatherapeutinnen ist.<br />
Als zweite Komponente wurden in Kapitel 3.2 einige (wenn auch zahlenmäßig<br />
weniger und schwächer empirisch überprüfte) Konzepte vorgestellt, die positive<br />
Wachstumsmöglichkeiten <strong>für</strong> Therapeutinnen in den Fokus nehmen, die sich aus<br />
der Arbeit mit Traumatisierten heraus ergeben. Aus diesen ergibt sich, dass<br />
neben den negativen Konsequenzen auch positive Auswirkungen von<br />
Traumaarbeit möglich sind und es nicht nur darum geht, den potentiellen<br />
Schaden zu begrenzen. Daraus ableitend stellt sich die Frage, was<br />
Therapeutinnen tun können, bzw. was sie brauchen, damit sie entweder mit einer<br />
positiven oder zumindest mit einer neutralen Position aus dieser Arbeit<br />
hervorgehen.<br />
Und hier kommt die salutogenetische Perspektive mit ins Spiel, da diese die<br />
gleiche Frage stellt: Welche Ressourcen sind nötig, damit Menschen gesund<br />
bleiben, im Angesicht der Herausforderungen, die das Leben bereithält? Auf die<br />
Zielgruppe der Traumatherapeutinnen ist dies die Frage nach den Ressourcen,<br />
die nötig sind, um einen die Gesundheit erhaltenden Umgang mit den Risiken der<br />
Traumaarbeit zu finden.<br />
Daraus resultiert die zentrale Frage dieser Arbeit: Welches sind die zentralen<br />
protektiven <strong>Faktoren</strong>, die die interviewten Therapeutinnen selbst<br />
heranziehen, um ihre psychotherapeutische Arbeit mit Folter- und<br />
49
Kriegsüberlebenden leisten zu können und um sich davor zu schützen, im<br />
Sinne einer sekundären <strong>Traumatisierung</strong> durch ihre Arbeit geschädigt zu<br />
werden?<br />
Dazu wurden Psychotherapeutinnen, die mit Folter- und Kriegsüberlebenden<br />
arbeiten, in einem ersten Schritt zu generellen Auswirkungen ihrer Arbeit befragt.<br />
In einem nächsten Schritt wurde versucht, besondere Stressoren zu<br />
identifizieren, die sich im therapeutischen Tagesgeschäft besonders belastend<br />
auf die Therapeutinnen auswirken. Letztlich wurde ermittelt, welches die<br />
zentralen Ressourcen sind, auf die die Therapeutinnen zurückgreifen, um mit den<br />
genannten Belastungen umgehen zu können.<br />
50
5. Methodisches Vorgehen<br />
Das vorherrschende Interesse lag in dem subjektiven Erleben der<br />
Therapeutinnen. Es ging nicht darum, sich dabei auf bestimmte bestehende<br />
theoretische Konzepte zu beziehen und diese empirisch zu überprüfen. Vielmehr<br />
wollte ich als Forscherin mich auf eine Begegnung mit den Therapeutinnenen<br />
einlassen, um möglichst viel von ihrer eigenen Wahrnehmung und Einstellung<br />
ihrer Arbeit <strong>gegen</strong>über zu erfahren. Dazu wurden qualitative Interviews geführt,<br />
die sich im Wesentlichen an der Methode des problemzentrierten Interviews nach<br />
Witzel (1985) orientierten. Zur Auswertung wurde die Qualitative Inhaltsanalyse<br />
nach Mayring herangezogen, sowie einige Elemente der Grounded Theory nach<br />
Strauss und Corbin genutzt. Bei all diesen Methoden wird der Haltung der<br />
Forscherin eine besondere Rolle zugesprochen. Sie soll sich eine „theoretische<br />
Sensibilität“ 6 zum Forschungs<strong>gegen</strong>stand aneignen, die einerseits hilft den<br />
eigenen Standpunkt zu reflektieren, andererseits befähigen soll, das<br />
Datenmaterial mit analytischem Tiefgang zu verstehen.<br />
5.1. Datenerhebung<br />
In zwei verschiedenen Behandlungszentren, die Folter- und Kriegsüberlebende<br />
psychotherapeutisch behandeln, wurden insgesamt fünf Psychotherapeutinnen<br />
befragt. Drei davon waren Ärztliche Psychotherapeutinnen und zwei<br />
Psychologische Psychotherapeutinnen, zwei der Interviewpartner waren<br />
männlich, drei weiblich. Zwei der Therapeutinnen waren außerdem ärztliche<br />
Leiterinnen ihrer jeweiligen Einrichtung. Die Berufserfahrung der<br />
Interviewpartnerinnen lag zwischen fünf und zehn Jahren, davon Erfahrung mit<br />
Kriegs- und Folterüberlebenden zwischen 9 Monaten und 6 Jahren. Bis auf die<br />
Leiterinnen arbeiteten alle interviewten Therapeutinnen in Teilzeit (50-60%),<br />
beide Leiterinnen hatten zwar 100%-Stellen, haben aber „nur“ zu 50%<br />
6 Zum Begriff der theoretischen Sensibilität und wie man diese erhalten kann gibt es innerhalb der<br />
Grounded Theory widersprüchliche Positionen. Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf das<br />
Verständnis der theoretischen Sensibilität nach Strauss & Corbin (1996), was im Wesentlichen<br />
als Bewusstsein <strong>für</strong> die Feinheiten in der Bedeutung von Daten gefasst wird. Quellen<br />
theoretischer Sensibilität werden hier in der Literatur, in beruflicher und persönlicher Erfahrung<br />
und dem analytischen Prozess selbst gesehen.<br />
51
Patientinnenkontakt, und nehmen sonst administrative und Leitungsaufgaben<br />
wahr, sowie Lehre, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Als Interviewtechnik wurde eine Methode gewählt, die sich mit kleinen<br />
Abweichungen an das problemzentrierte Interview nach Witzel (1985) anlehnt.<br />
Das problemzentrierte Interview wurde von Witzel 1985 als forschungspraktische<br />
Einlösung der Kritik standardisierter Messverfahren der empirischen<br />
Sozialforschung entwickelt, um komplexe Gegenstände zu erfassen, die nach<br />
situationsadäquaten, flexiblen und Konkretisierung fördernden Methoden<br />
verlangen, und hat seither in der Psychologie breite Verwendung gefunden.<br />
Ohne eine ex ante Formulierung von Hypothesen gilt dieses Verfahren als<br />
besonders geeignet, um subjektive Erlebnisweisen zu erforschen. Das Verfahren<br />
wurde ursprünglich als Methodenkombination aus qualitativem Interview,<br />
Fallanalyse, biographischer Methode, Gruppendiskussion und Inhaltsanalyse<br />
konzipiert, ist aber auch in seinen Teilelementen anwendbar. Es ist durch drei<br />
zentrale Kriterien gekennzeichnet: Problemzentrierung, was bedeutet, dass sich<br />
die Forscherin dabei an einer spezifischen Problemstellung orientiert (S. 230);<br />
Gegenstandsorientierung, was heißt, dass die Methoden am Gegenstand<br />
orientiert entwickelt werden (S. 232); und schließlich die Prozessorientierung im<br />
Forschungsprozess und im Gegenstandverständnis (S. 233). Das<br />
problemzentrierte Interview umfasst in der Regel vier Elemente: einen<br />
vorgeschalteten Kurzfragebogen, ein Leitfadeninterview, eine Tonbandaufnahme<br />
und das Postscriptum (ein Interviewprotokoll) (S. 236). Ziel des vorgeschalteten<br />
Kurzfragebogens ist es, demographische Daten, die <strong>für</strong> den eigentlichen<br />
Gegenstand des Interviews weniger relevant sind, aufzunehmen, um damit die<br />
meist knapp bemessene Interviewzeit zu entlasten.<br />
In der Vorbereitung auf die Interviews wurde entschieden, keinen<br />
Kurzfragebogen in den Interviews anzuwenden. Ich kannte die Interviewpartner<br />
vor den jeweiligen Interviews nicht, und es erschien mir als ein schlechter<br />
Einstieg, das Gespräch mit einem Fragebogen zu beginnen. Ich be<strong>für</strong>chtete,<br />
durch einen Fragebogen als Einstieg könnte sich eine Frage-Antwort-Struktur auf<br />
das gesamte Interview ausdehnen, was ich vermeiden wollte. Außerdem<br />
erschien es bedeutender, eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu<br />
schaffen, in der die Interviewpartnerinnen auch persönliche Informationen über<br />
52
sich preisgeben können und wollen und sich mit mir gemeinsam einem potentiell<br />
schmerzhaften Thema zuwenden. Ein Fragebogen erschien in diesem Stadium,<br />
in dem sich der Kontakt zu meiner Interviewpartnerin gerade aufbaut, eher als<br />
störend. Letztlich ist der Forschungs<strong>gegen</strong>stand auf den Beruf der<br />
Interviewpartnerinnen bezogen und nicht auf deren ganze Person, sodass eine<br />
umfassende Aufnahme der demographischen oder biographischen Daten nicht<br />
nötig war. Das Interview wurde daher mit einer Vorstellung meiner Person<br />
begonnen und daraufhin die Interviewpartnerinnen gebeten, ihren beruflichen<br />
Werdegang bis zu deren Tätigkeit als Psychotherapeutin, die mit Kriegs- und<br />
Folterüberlebenden arbeiten, grob zu umreißen. Im Gegensatz zu einem<br />
narrativen Interview, in dem sich die Forscherin weitestgehend auf die Rolle der<br />
Zuhörerin beschränkt, greift beim problemzentrierten Leitfadeninterview die<br />
Forscherin aktiver in das Gesprächsgeschehen ein. So habe ich bei den hier<br />
geführten Interviews die Befragten zwar weitestgehend ohne Unterbrechungen<br />
erzählen lassen, habe jedoch das Gespräch strukturiert und konkret nachgefragt,<br />
wo es relevant war, wo etwas unklar geblieben war, oder eine Vertiefung<br />
fruchtbar erschien.<br />
Das eigentliche Interview 7 bestand im Kernstück aus den Fragen, wie die<br />
Interviewpartnerinnen ihre Arbeit wahrnehmen, welche Auswirkungen die Arbeit<br />
auf sie als Person (sowohl beruflich als auch privat) hat und wie sie mit<br />
Belastungen umgehen, ohne dabei mit Fragen nach positiven oder negativen<br />
Aspekten eine Richtung vorzugeben. Nach dieser allgemeinen Fragestellung<br />
wurden die Interviewpartnerinnen gebeten, sich an die drei <strong>für</strong> sie schwierigsten<br />
und am meisten belastenden Fälle zu erinnern, deren Fallgeschichte grob zu<br />
umreißen und im Einzelnen zu erläutern, wie es ihnen bei der Behandlung erging<br />
und welche Quellen der Unterstützung sie bei besonderen Belastungssituationen<br />
herangezogen haben. Eine Interviewpartnerin hatte auf Anhieb vier Patientinnen<br />
vor Augen, aus der sie nicht drei auswählen wollte oder konnte, sodass hier von<br />
vier Fällen berichtet wurde. Daraus ergaben sich bei fünf Interviewpartnerinnen<br />
Berichte über 16 Patientinnen und deren Fallgeschichten, bzw.<br />
Behandlungsverläufe, sowie die jeweiligen Reaktionen der Therapeutinnen und<br />
Maßnahmen bzw. Ressourcen um mit Belastungssituationen umzugehen, die in<br />
7 Der Interview-Leitfaden ist einsehbar im Anhang A.<br />
53
der Folge qualitativ ausgewertet wurden. Diese Vorgehensweise wurde gewählt,<br />
um ein allgemeines „Sprechen über“ zu vermeiden, und um die Befragten<br />
anzuregen, möglichst von ihren je subjektiven Erfahrungen mit konkreten<br />
Patientinnen und deren Therapieverläufen zu berichten.<br />
Ich hatte mich im Vorfeld zur dieser Forschungsarbeit eingehend mit der Haltung<br />
des Forschers in der qualitativen Interviewforschung beschäftigt. Nach dem<br />
Prinzip der Offenheit (Witzel 1985; Helfferich 2005) war es wichtig die Fragen im<br />
Interview nicht so zu stellen, dass von vornherein ein bestimmtes Verständnis<br />
über den Gegenstand impliziert ist und damit potentielle Antwortmöglichkeiten<br />
eingeschränkt sind. Deshalb wurde vermieden bestimmte Fachtermini wie<br />
Sekundärtraumatisierung o.ä. in den Fragen zu benutzen. Es sollte damit den<br />
Interviewparterinnen die Möglichkeit gegeben werden, ihr eigenes<br />
„Relevanzsystem“ (Kruse 2009) zu entfalten und möglichst theoriefrei von ihrem<br />
subjektiven Erleben zu berichten. Einschränkend ist dabei wohl zu bemerken,<br />
dass sowohl alle Interviewpartnerinnen als auch ich „vom Fach“ sind und damit<br />
bestimmte psychologische und therapeutische Grundbegriffe selbstverständlich<br />
erscheinen und nicht grundsätzlich hinterfragt wurden.<br />
Die Leitfaden-Interviews wurden auf einem Tonbandgerät aufgenommen und<br />
später transkribiert 8 . Das bei Witzel (1985) vorgeschlagene Postscriptum<br />
erschien als hilfreich, um im direkten Anschluss an das Interview Informationen<br />
wie Besonderheiten, atmosphärische oder generelle Eindrücke über die<br />
Befragten oder die Interviewsituation zu notieren, die aus dem gesprochenen<br />
Text selbst nicht herausgelesen werden können. Es ist neben dem transkribierten<br />
Interviewtext eine Erinnerungsstütze.<br />
Die komplett transkribierten Interviews werden aufgrund der in ihnen<br />
vorkommenden sensitiven Fallgeschichten, die Anonymität erfordern, nicht an<br />
diese Arbeit angehängt. Allein zu Bewertungszwecken der Arbeit werden die<br />
transkribierten Interviews als zusätzliche Datei in elektronischer Form an die<br />
Gutachter weitergeleitet. Außerdem liegt auf der Veröffentlichung der Arbeit eine<br />
Sperrfrist von 5 Jahren.<br />
8 Die angewandten Transkriptionszeichen werden im Anhang beschrieben.<br />
54
5.2. Datenauswertung<br />
Die Qualitative Inhaltsanalyse hat grundsätzlich das Ziel der Analyse von<br />
Material, das aus Kommunikation entstanden ist. Dabei bezieht sich die Analyse<br />
nicht rein auf die Kommunikationsinhalte, neben den manifesten Inhalten<br />
interessiert ebenso der latente Gehalt. Der Gegenstand von Inhaltsanalysen ist<br />
die fixierte Kommunikation, also eine Form protokollierter Kommunikation. Das<br />
Vorgehen ist dabei systematisch, regelgeleitet, theoriegeleitet und zielt darauf ab,<br />
Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen zu können<br />
(Mayring 2003, S. 12).<br />
Um Systematik und Regelgeleitetheit im Vorgehen zu sichern wird zu Beginn der<br />
Analyse ein Ablaufmodell festgelegt, das Regeln <strong>für</strong> jeden Analyseschritt<br />
definiert. Dabei ist die Qualitative Inhaltsanalyse kein Standardinstrument, das<br />
immer gleich aussieht. Eine ihrer Stärken ist gerade der Gegenstandsbezug, was<br />
bedeutet, dass die Analysetechnik am Material entwickelt und ausgerichtet wird.<br />
Da die Analyse hier möglichst nicht theoriegeleitet ablaufen sollte, wurde als<br />
Analysetechnik das Kodierungssystem der Grounded Theory eingesetzt, da dies<br />
sehr offen ist und sich gerade in der Gegenstandsverankerung (grounding)<br />
auszeichnet. Das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmodell sieht<br />
folgendermaßen aus (Mayring 2003, S.54):<br />
1. Festlegung des Materials<br />
2. Analyse der Entstehungssituation<br />
3. Formale Charakteristika des Materials<br />
4. Richtung der Analyse<br />
5. Theoretische Differenzierung der Fragestellung<br />
6. Bestimmung der Analysetechnik(en) und Festlegung des konkreten<br />
55<br />
↓<br />
↓<br />
↓<br />
↓<br />
↓<br />
Ablaufmodells<br />
↓
7. Definition der Analyseeinheiten<br />
8. Analyseschritte mittels des Kategoriensystems<br />
9. Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material<br />
10. Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung<br />
11. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien<br />
Dabei dienen die Punkte 1. bis 3. in erster Linie der Bestimmung des<br />
Ausgangsmaterials, die Punkte 4. und 5. sollen helfen, die Fragestellung(en) zu<br />
präzisieren, 6. bis 8. stellen die eigentlichen Analyseschritte dar, während 9. bis<br />
11. der Überprüfung, Darstellung und Bewertung der Ergebnisse dienen.<br />
1. Festlegung des Materials<br />
Gegenstand der Analyse sind die fünf vollständig transkribierten Interviews, die<br />
mit Therapeutinnen geführt wurden, die mit Folter- und Kriegsüberlebenden<br />
psychotherapeutisch arbeiten.<br />
2. Analyse der Entstehungssituation<br />
Im Vorfeld wurden in den untersuchten Behandlungseinrichtungen die jeweiligen<br />
Leiterinnen, bzw. Forschungsbeauftragte per E-Mail mit der Frage nach der<br />
Bereitschaft zu Interviews zu dem genannten Thema angeschrieben. Als<br />
Information über das Forschungsthema wurde mit der Anfrage ein 10-seitiges<br />
Masterthesenkonzept versandt. Das Forschungsvorhaben wurde jeweils intern in<br />
den Teams der Einrichtungen diskutiert und beide Einrichtungen haben sich zur<br />
Zusammenarbeit bereit erklärt. Die fünf teilnehmenden Therapeutinnen haben<br />
sich freiwillig <strong>für</strong> die Interviews zur Verfügung gestellt. Die jeweils 90-minütigen<br />
Interviews haben an drei verschiedenen Tagen in den Behandlungsräumen der<br />
Einrichtungen stattgefunden. Die auf Tonband aufgenommenen Interviews<br />
wurden von mir selbst transkribiert, was den analysierten Textkorpus <strong>für</strong> die hier<br />
vorliegende Untersuchung darstellt.<br />
56<br />
↓<br />
↓<br />
↓<br />
↓
3. Formale Charakteristika des Materials<br />
Der transkribierte Text entspricht wortgetreu den Tonbandaufnahmen. Der Text<br />
wurde möglichst wenig bereinigt, d.h. dass Fehler, Abbrüche, unvollständige<br />
Sätze und Sprünge, sowie gesprochener Dialekt beibehalten und so weit wie<br />
möglich phonetisch notiert wurden. Dabei wurden Betonungen, Pausen und<br />
sonstige Anmerkungen im Text markiert bzw. dargestellt. Die<br />
Transkriptionszeichen sind in Anhang B dargestellt.<br />
4. Richtung der Analyse<br />
Die Analyse hat das Ziel, Aussagen über die emotionalen, kognitiven und<br />
Handlungshintergründe der Interviewpersonen im Umgang mit<br />
Belastungssituationen zu treffen, die durch die psychotherapeutische Arbeit mit<br />
Kriegs- und Folterüberlebenden entstanden sind. Durch die Interviews sollten die<br />
Teilnehmerinnen angeregt werden, über die Auswirkungen ihrer Arbeit auf ihr<br />
Leben (in beruflicher wie in privater Hinsicht) zu berichten, darüber welche<br />
Situationen mit Patientinnen besonders schwierig zu bewältigen waren und<br />
welche Umgangsformen sie <strong>für</strong> die Bewältigung entwickelt haben. Die Analyse<br />
orientiert sich an den explizit formulierten Fragestellungen.<br />
5. Theoretische Differenzierung der Fragestellung(en)<br />
Die Untersuchung war explizit nicht theoriegeleitet angelegt. Dennoch fließen die<br />
hier behandelten Theorien natürlich in die Analyse mit ein, da spezifisch benutzte<br />
Begrifflichkeiten auf bestimmte theoretische Hintergründe hinweisen. Die<br />
Fragestellung ist dabei dreiteilig wie sie in Kapitel 4 ausführlich vorgestellt wurde.<br />
Zusammengefasst: Erstens werden allgemeinere Aussagen der<br />
Interviewpartnerinnen über die Auswirkungen ihrer Arbeit auf die eigene Person<br />
daraufhin untersucht, inwieweit positive oder negative Aspekte betont werden<br />
und welche Auswirkungen benannt werden. Diese werden beispielhaft deskriptiv<br />
dargestellt.<br />
Der zweite Teil der Analyse bezieht sich auf besondere Stressoren bei der Arbeit<br />
mit Folter- und Kriegsüberlebenden in den untersuchten Einrichtungen. Anhand<br />
der Fallgeschichten, die als besonders belastend erinnert werden, wurde<br />
untersucht, ob bestimmte sich wiederholende Themen oder Muster hervortreten,<br />
57
die als besondere Stressoren gelten können. Diese werden beispielhaft durch die<br />
gebildeten Kategorien dargestellt.<br />
Den Hauptteil der Analyse betrifft die Hauptfragestellung, die an die ersten<br />
beiden geknüpft ist. In Anlehnung an den theoretischen Ansatz des<br />
salutogenetischen Modells wird die Frage an den Text gestellt, welche<br />
protektiven <strong>Faktoren</strong> ermittelt werden können, die den interviewten<br />
Therapeutinnen zur Verfügung stehen, um die Belastungen ihrer Arbeit<br />
bewältigen zu können. Diese wurden analysiert und in der Folge kategorisierend<br />
dargestellt.<br />
6. Bestimmung der Analysetechnik(en) und Festlegung des konkreten<br />
Ablaufmodells<br />
Das allgemeine Ablaufmodell wurde in seiner ursprünglichen Form beibehalten.<br />
Als konkretes Vorgehen wurden Analysetechniken bestimmt, die eine<br />
Kombination aus Qualitativer Inhaltsanalyse und Grounded Theory darstellen.<br />
Bei der Qualitativen Inhaltsanalyse besteht die Analyse bzw. die Interpretation<br />
des Datenmaterials nach Mayring (2003) aus drei möglichen Schritten:<br />
Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Das Ziel ist die Bildung von<br />
Kategorien. Dabei sind zwei Vorgehensweisen denkbar: Eine deduktive<br />
Kategoriendefinition würde aufgrund von theoretischen Vorüberlegungen in<br />
einem Operationalisierungsprozess Kategorien auf das Material hin entwickeln.<br />
Da ohne vorherige theoretische Festlegung gearbeitet werden sollte, war hier ein<br />
induktives Vorgehen angezeigt. Bei der induktiven Kategorienbildung leiten sich<br />
die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab.<br />
Dabei wurde das Prozessmodell nach Mayring befolgt, nach dem in einer<br />
Schleife mehrerer Materialdurchgänge Kategorien zunächst formuliert werden<br />
und in nachfolgenden Materialdurchgängen kontinuierlich geprüft und<br />
gegebenenfalls revidiert werden (siehe dazu Mayring 2003, S. 75).<br />
Für die Kategorienbildung wurde das Kodierungssystem nach der Grounded<br />
Theory als Technik gewählt. Ziel der Grounded Theory ist generell die<br />
Theoriebildung. In der vorliegenden Arbeit ist es nicht das erklärte Ziel, eine neue<br />
Theorie zu entwickeln. Dennoch wurden Teile des Auswertungssystems der<br />
Grounded Theory genutzt, da das hier angewandte Kodierungssystem eine<br />
58
inspirierende und aufschlussreiche Methode anbietet, sich mit dem Interview-<br />
Text auseinanderzusetzen. Bei der Grounded Theory sind drei<br />
Kodierungsschritte vorgesehen:<br />
1. Offenes Kodieren<br />
Ziel dieses analytischen Schrittes ist es, den Text in erster Instanz aufzubrechen<br />
und zentrale Konzepte zu identifizieren sowie diese in Bezug auf ihre<br />
Eigenschaften und Dimensionen zu entwickeln. Grundlegende Verfahrensschritte<br />
bestehen im Durcharbeiten der Analyseeinheiten, dem Stellen von Fragen an die<br />
Daten und dem Vergleich hinsichtlich Ähnlichkeiten und Unterschieden der<br />
Phänomene. So werden Konzepte ermittelt und ähnliche Konzepte zu Kategorien<br />
gruppiert.<br />
2. Axiales Kodieren<br />
Der zweite Schritt dient dem In-Beziehung-Setzen der Kategorien und ihrer<br />
Subkategorien. Die Grounded Theory bedient sich dabei des paradigmatischen<br />
Modells, bei dem die Kategorien auf einen Satz von Beziehungen untersucht<br />
werden, die auf ursächliche Bedingungen, Phänomene, Kontext, intervenierende<br />
Bedingungen, Handlungs- und interaktionale Strategien und Konsequenzen<br />
verweisen (vgl. Strauss/ Corbin 1996, S. 78). So werden Konzepte und<br />
Kategorien, die im ersten Kodierungsschritt entwickelt werden, um den Text<br />
„aufzubrechen“, in gewisser Weise wieder in einen sinnhaften Zusammenhang<br />
gebracht.<br />
3. Selektives Kodieren<br />
Der letzte Kodierungsschritt dient der Theoriebildung. Dabei wird in intensiver<br />
Auseinandersetzung mit dem Text eine Kernkategorie ermittelt, zu der alle<br />
anderen Kategorien in Beziehung gesetzt werden, um das untersuchte Material<br />
in eine „analytische Geschichte“ mit einem „klaren roten Faden“ (ebd., S. 117) zu<br />
übersetzen. Da das Ziel hier nicht die Theoriebildung ist, wurde dieser<br />
Kodierungsschritt nicht durchgeführt und wird hier nur der Vollständigkeit wegen<br />
aufgeführt. Vielmehr war das Ziel der hier durchgeführten Analyse, den<br />
entstandenen Interviewtext durchzuarbeiten, um in Bezug auf die gestellten<br />
Forschungsfragen sich wiederholende Muster zu entdecken und Konzepte sowie<br />
59
Kategorien zu ermitteln: die induktive Kategorienbildung. Diese Kategorien<br />
werden unten dargestellt und mit Interview-Zitaten illustriert.<br />
7. Definition der Analyseeinheiten<br />
In einem ersten Schritt wurde das Material in kleinere Einheiten zerlegt, die<br />
sogenannten Analyseeinheiten. Die Interviewtexte wurden Absatz <strong>für</strong> Absatz<br />
durchgearbeitet und in sinnhafte Abschnitte unterteilt, und diese wiederum den<br />
drei zentralen Fragestellungen zugeordnet. Die Zuordnung zu einzelnen<br />
Fragestellungen wurde im gedruckten Text farbig markiert, um <strong>für</strong> die einzelnen<br />
Analyseschritte im Originaltext die Orientierung zu erleichtern. Diese waren je<br />
nach Sinnzusammenhang einzelne oder mehrere Abschnitte, teils auch nur<br />
einzelne Sätze oder Satzteile.<br />
8. Analyseschritte mittels des Kategoriensystems<br />
Die Kodierungsschritte nach der Grounded Theory wurden wie unter 6.<br />
dargestellt durchgeführt. Zunächst wurde jedes der fünf Interviews getrennt<br />
analysiert, um im zweiten Schritt die Kategorien zwischen den Interviewtexten zu<br />
vergleichen. Nach einem ersten Durchlauf offenen Kodierens wurde mit dem<br />
axialen Kodieren begonnen. Dabei wurden Konzepte regelmäßig modifiziert und<br />
neu formuliert, so dass sich in dieser Phase das offene Kodieren und das axiale<br />
Kodieren permanent abwechselten. Im nächsten Schritt wurde ein Analyseraster<br />
entwickelt, das die Bewältigung der Menge der kodierten Einheiten erleichtert<br />
und Übersicht schafft:<br />
Codes - IP 1 - 5 Kommentar Konzept Kategorie Hierarchie Ebene<br />
Mit jedem neu analysierten Interview wurden Konzepte zu Kategorien gruppiert<br />
und diese Kategorien im weiteren Verlauf entweder bestätigt und damit verfestigt<br />
oder revidiert und neu formuliert. Sie wurden daraufhin betrachtet, wie sie sich<br />
zueinander verhalten (Hierarchie), und letztlich unterschiedlichen Ebenen<br />
zugeordnet.<br />
60
9. Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material<br />
Der Analyseprozess wurde bei jedem weiteren Materialdurchgang wiederholt und<br />
dabei die entwickelten Kategorien kontinuierlich geprüft und gegebenenfalls<br />
modifiziert. Die Identifizierung von Ebenen diente der Ordnung der Kategorien,<br />
was letztlich auch die schriftliche Darstellung erleichterte und sie übersichtlicher<br />
gestalten ließ.<br />
10. Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung<br />
In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der qualitativen Auswertung dargestellt und<br />
mit Interviewzitaten illustriert. Diese werden in Kapitel 7 mit bestehender Literatur<br />
und bereits durchgeführten Studien verglichen und diskutiert.<br />
11. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien<br />
Das nomologische Wissenschaftsparadigma verlangt in der Regel die bekannte<br />
Trias der Gütekriterien: Objektivität, Reliabilität und Validität. Diese lassen sich<br />
auf inhaltsanalytische qualitative Arbeit nicht ohne weiteres anwenden.<br />
Grundsätzliche Gütekriterien empirischen Arbeitens liegen in der Systematik und<br />
der Nachvollziehbarkeit des Erkenntnisweges (Transparenz). An die Stelle von<br />
Objektivität tritt hier die Intersubjektivität. Anstelle von Reliabilität und Validität<br />
gewinnen Reflexion und Transparenz an Bedeutung. Dazu gehört auch die<br />
Reflexion der Aussagekraft der Ergebnisse (siehe dazu Diskussion).<br />
61
6. Ergebnisse<br />
6.1. Auswirkungen der Arbeit auf die Therapeutinnen<br />
Alle Interviewpartnerinnen (im Folgenden IP) wurden nach den Auswirkungen<br />
ihrer Arbeit – teils allgemein, teils in Bezug auf eine bestimmte Fallgeschichte –<br />
auf ihre Person befragt. Auffallend war, dass alle IP, ohne explizit nach positiven<br />
oder negativen Auswirkungen befragt worden zu sein, sowohl positive als auch<br />
negative Aspekte betonten, dass zahlenmäßig sogar etwas mehr positive<br />
Aspekte erwähnt wurden. Viele der beschriebenen Auswirkungen lassen sich<br />
auch nicht eindeutig als positiv oder negativ klassifizieren. So beschreibt eine IP<br />
beispielsweise, dass ihre Freizeitgewohnheiten sich durch die Arbeit mit<br />
Folteropfern insofern verändert haben, dass sie keine Kriminalromane mehr lese<br />
oder gewaltsame Filme schaue, da sie empfinde, dass ihr erträgliches Maß an<br />
Leid und Schmerz durch die Arbeit ausgereizt sei und sie sich mit Gewaltthemen<br />
in ihrer Freizeit nicht mehr beschäftigen möchte (IP 5:62-68). Eine Bewertung in<br />
Richtung positiv oder negativ ist hier nicht sinnvoll, die Bewertung positiv oder<br />
negativ kann im Zweifelsfalle nur die betroffene Person selbst vornehmen.<br />
Eine Interviewpartnerin, die sich in ihren Aussagen stärker darauf konzentrierte,<br />
<strong>für</strong> sie erfreuliche oder belastende Aspekte der Therapien zu benennen und<br />
damit nur indirekt eine Aussage über potentielle Auswirkungen auf ihre Person<br />
traf, betonte, dass ohne die positiven Aspekte in der Beziehungsgestaltung die<br />
eigentliche therapeutische Arbeit gar nicht möglich wäre:<br />
IP 2: also wie vorher auch es ist letztlich ist es auch da wieder ne [ATMET TIEF<br />
EIN] ne SCHÖNE ZUSAMMENARBEIT, es ist eigentlich nirgends so, dass es<br />
einfach nur SCHLIMM wäre nur FOLTER und äh nur SCHRECKLICHES, ähm<br />
und ich GLAUB auch nicht dass die leute davon ERZÄHLEN würden wenn nicht<br />
das andere schon DA wär, wenn nicht eben ne therapeutische BEZIEHUNG da<br />
wäre, wenn nichts TRAGfähiges da wär und ähm *3* und auch irgendwie n<br />
VERTRAUEN da wär, und ich glaub all diese sachen diese voraussetzungen die<br />
erfüllt sein müssen quasi die bewirken auch dass es dann eben viele POSITIVE<br />
ASPEKTE gibt in der arbeit. ich glaub sonst kommts gar nicht so weit (IP 2:160).<br />
Insgesamt sind die von den Interviewpartnerinnen berichteten Auswirkungen<br />
ihrer Arbeit auf sie selbst vielschichtig und daher schwierig zusammenzufassen.<br />
63
Eher negative Aspekte werden durch positive komplettiert, es wurde von<br />
Auswirkungen berichtet, die einerseits sehr persönlich-emotional waren, andere<br />
die sich eher auf politische Haltungen beziehen. Eingeteilt in kurzfristige und<br />
längerfristige Reaktionen lassen sich die Auswirkungen folgendermaßen<br />
zusammenfassend-beispielhaft darstellen:<br />
Kurzfristige Reaktionen<br />
Die genannten kurzfristigen Auswirkungen lagen überwiegend auf der negativen<br />
Seite und eher im affektiven Bereich. Reaktionen, von denen<br />
Interviewpartnerinnen gesprochen haben, die sie unmittelbar in einer<br />
Behandlungsstunde oder in Bezug auf eine bestimmte Fallgeschichte erlebten,<br />
waren in erster Linie das intensive Spüren von unmittelbarem und aktuellem Leid.<br />
Eine Interviewpartnerin beschreibt anschaulich wie sie intensiv die Destruktivität<br />
des Krieges zu spüren bekam:<br />
IP 3: da hab ich schon auch erlebt was so KRIEG mit den leuten MACHEN kann<br />
ja also wie wie DESTRUKTIV das ist wie ZERSTÖRERISCH das auch sein kann<br />
ja und das MITZUERLEBEN das hat mich einfach SCHOCKIERT ja das war so<br />
so so so NAHE ja und so UNMITTELBAR ja denke das war das war das (IP<br />
3:209).<br />
Alle interviewten Therapeutinnen berichteten von starken emotionalen<br />
Reaktionen, wie etwa regelmäßig auftretenden Gefühlen von Ohnmacht und<br />
Hilflosigkeit im Angesicht des erlebten Leides ihrer Patientinnen. Häufig wurden<br />
diese Gefühle in Zusammenhang mit als ungerecht empfundenen Asylverfahren<br />
berichtet, wie etwa hier:<br />
IP 2: was auch schwierig ist das ist so die OHNMACHT in bezug auf unser auf<br />
UNSER system, das heißt die leute vierzig prozent von unseren patienten haben<br />
einen unsicheren aufenthaltsstatus zum beispiel die sind SCHWER traumatisiert<br />
haben die SCHRECKLICHSTEN geschichten hinter sich und werden nicht als<br />
flüchtlinge anerkannt hier und bekommen dann entweder eine VORLÄUFIGE<br />
aufnahme oder werden ABgewiesen * manchmal wieder ausgeschafft. häufig<br />
werden die von den betreuenden institutionen als FEINDSELIG wahrgenommen<br />
und FORDERND und SCHMAROTZEND und werden dann entsprechend<br />
schlecht behandelt entsprechend zumindest ihrer wahrnehmung, aber ich glaube<br />
da ist auch viele male was dran das kann manchmal ganz großen ärger<br />
64
verursachen oder eben so eine HILFLOSIGKEIT so eine WUT die sich dann<br />
überträgt. häufig sind DAS die sachen die ich dann mit nach hause nehme (IP<br />
2:44).<br />
Zwei Therapeutinnen sprachen von Insuffizienzgefühlen, also dem Gefühl mit<br />
dem was sie an Hilfe anbieten können nicht „auszureichen“ oder sogar als<br />
Therapeutin unfähig zu sein (IP 4:100). Drei andere betonten starke Gefühle von<br />
Trauer, Wut und Ungerechtigkeit im Angesicht dessen, was ihre Patientinnen<br />
erlebt haben. Zwei Therapeutinnen berichteten von Auflösungserscheinungen,<br />
also dem Gefühl ihre eigene psychische Struktur würde sich bei dem Gehörten<br />
kurzfristig auflösen. Eine Therapeutin berichtete von einer starken<br />
Abwehrreaktion <strong>gegen</strong>über einer bestimmten Klientin, wo sie Unlust und Ekel<br />
empfand. Eine Therapeutin sprach bei einer bestimmten Klientin von Unruhe,<br />
Schwitzen und Schwierigkeiten sich zu konzentrieren (IP 4:78).<br />
Längerfristige Reaktionen<br />
Auch von längerfristigen negativen Reaktionen berichteten die<br />
Interviewpartnerinnen. Eine Therapeutin berichtete wie sie durch die Arbeit mit<br />
Kriegs- und Folteropfern zu Beginn stark somatisch reagierte, indem sie heftige<br />
Rückenschmerzen bekam (IP 3:95). Eine Therapeutin sprach darüber wie sie<br />
durch ihre Arbeit einerseits als Mutter sehr viel ängstlicher geworden sei und<br />
gleichzeitig in wiederkehrenden Phasen von ihrer Arbeit sehr okkupiert sei:<br />
IP 4: zum beispiel als MUTTER bin ich ÄNGSTLICHER geworden im sinn von<br />
mm ich sehe hier was so TRAUMATA BEWIRKEN kann und die meisten die hier<br />
zu uns kommen haben nicht nur als ERWACHSENE traumatische erfahrungen<br />
sondern schon als KINDER sei es mit KRIEG oder mit frühen<br />
VERLUSTerfahrungen und so und jetzt bin ich ängstlicher geworden im sinne<br />
davon dass ich zum beispiel MIR könnte etwas passieren und was DAS dann <strong>für</strong><br />
die KINDER heisst wenn sie ohne MUTTER aufwachsen und hab manchmal so<br />
VORSTELLUNG was das <strong>für</strong> ein LEBEN oder <strong>für</strong> ein mensch bewirken kann<br />
wenn er als KIND solche ERFAHRUNGEN macht und gleichzeitig weiss ich dass<br />
niemand davor GEFEIT ist aber ich habs halt VOR mir was das auch <strong>für</strong><br />
auswirkungen hat *[RÄUSPERN] äm *3* im moment ist es eben überhaupt nicht<br />
aber das KAM schon VOR dass mich diese arbeit so OKKUPIERT hat auch in<br />
gedanken und und dass ich wirklich BELASTET war dass ich zu HAUSE dann<br />
65
wie nicht mehr richtig PRÄSENT war UNKONZENTRIERT war GEREIZT und mir<br />
dann das auch KINDER und der MANN gesagt hat also das kommt immer wieder<br />
so in phasen und hab ich vorher an ANDEREN arbeitsstellen NICHT in DEM<br />
maße erlebt *2* also dass irgendwie mein vierjähriger sohn sagt ich würde nicht<br />
ZUhören und so (IP 4:44).<br />
Eine andere Therapeutin erzählt wie sie durch die Arbeit mit Kriegs- und<br />
Folterüberlebenden eine Anstrengung erlebe, wie sie sie von anderen<br />
Arbeitsstellen nicht kenne:<br />
IP 5: ähm also grundsätzlich fühl ich mich gut mm ich fühle mich aber auch<br />
ANGESTRENGT also ich bin abends jeweils wirklich auf eine art und weise müde<br />
wie ich vorher NICHT oder SELTEN war und zwar nicht gestresst also nicht diese<br />
art von müdigkeit sondern einfach wirklich eine es ist ANSTRENGEND es<br />
braucht mich auf VERSCHIEDENEN ebenen so das MERK ich (IP 5:62).<br />
Auch auf der Ebene politischer Einstellungen, die sich durch diese spezielle<br />
Arbeit verändert haben, berichteten die IP von Ernüchterung und Wut in Bezug<br />
auf das Asylsystem im eigenen Land (IP 2:100; IP 4:100), generell von einer<br />
negativeren Weltsicht, beziehungsweise von der Angst durch langjährige Arbeit<br />
in diesem Feld eine negative deprimierte Weltsicht zu entwickeln (IP 4:32), sowie<br />
von einer Radikalisierung der politischen Einstellung (IP 5:62).<br />
Auf der anderen Seite stehen aber auch viele längerfristige positive<br />
Auswirkungen, die die IP in den Interviews zum Ausdruck brachten. Ein Motiv,<br />
das bei vier der fünf Interviewpartnerinnen auftauchte, war das der Dankbarkeit,<br />
jedoch in unterschiedlichen Facetten. Für eine Therapeutin war es eine sehr<br />
positive Erfahrung, die Dankbarkeit ihrer Klientinnen zu spüren:<br />
IP 1: DER STUNDE kommt natürlich alles an von TRAUER von von von von<br />
auch WUT […], und NATÜRLICH auch TRAUER mit den leuten mmm ALLES<br />
TRAURIGKEIT, LEID AUCH dass man spürt ja SCHON * ALLE GEFÜHLE.<br />
ALLE [LACHT] aber auch FREUDE HUMOR sie geben einem viel oder, s isch ne<br />
breite palette net nur NEGATIV auch die DANKBARKEIT oder, viele sind sehr<br />
dankbar sei es zum ERSTEN mal kann ich da zum ERSTEN MAL hört mir mal<br />
jemand ZU oder, und diese DANKBARKEIT spürt man oft auch, die einem dann<br />
auch son bissel den motor oder den kick gibt weiterzumachen (IP 1:72).<br />
66
Eine andere Therapeutin betont eher die eigene Dankbarkeit da<strong>für</strong> in der Position<br />
zu sein, ihren Patientinnen etwas anbieten zu können und dass bei all den<br />
Schwierigkeiten und schwierigen Voraussetzungen doch etwas Positives<br />
entstehen kann:<br />
IP 2: ich glaub EIN wichtiger punkt den ich bei ALLEN patienten nennen kann<br />
weil die ja ALLE schlimme geschichten haben irgendwie ist das was ich am<br />
anfang gesagt habe dass ichs einfach sehr SPANNEND und sehr<br />
BEREICHERND finde und auch sehr dankbar mit diesen menschen zu arbeiten<br />
JS: dankbar in dem sinne dass die DIR dankbar sind?<br />
IP 2: ja dankbar oder nicht dass sie sagen danke xy, dass sie mir so geHOLFEN<br />
haben so das ist ja nicht so oft der fall, dass wir wirklich so helfen können ähm<br />
aber doch dass sie dass sie das AUFnehmen, was ich sage, dass sie ähm *4*<br />
SCHÄTZEN dass sie SCHÄTZEN was ich ihnen zu BIETEN habe dass ich ihnen<br />
irgendwie doch helfen kann auf ne gewisse art und weise, ähm *3* ja ähm, wie<br />
soll ich das sagen es geht ja nicht um dankbarkeit, *3* aber es ist so ein<br />
gemeinsamer prozess irgendwie wo von beiden seiten was beigetragen wird und<br />
es WÄCHST irgendwas gemeinsames und das zu sehen finde ich bei diesen so<br />
SCHWIERIGEN voraussetzungen dieses MISSTRAUEN und so weiter, dass<br />
dann trotzdem irgendwie sowas entstehen kann, doch das find ich dankbar, das<br />
ist was SCHÖNES eigentlich (IP 2:132-134).<br />
Zwei andere Therapeutinnen betonten vor allem ihre eigene Dankbarkeit da<strong>für</strong>,<br />
dass sie in relativer Sicherheit, Wohlstand, Freiheit und Gesundheit leben dürfen,<br />
was ihnen besonders durch ihre Arbeit als wertvolles Gut bewusst wurde:<br />
IP 4: was sich sonst noch verändert hat ich bin es geht etwas in das gleiche ich<br />
bin sehr DANKBAR <strong>für</strong> das was ich HABE bin also DANKBAR gesunde KINDER<br />
zu haben einen guten MANN zu haben SELBST GESUND zu sein äm *3* nicht<br />
verfolgt zu sein selber einfach so <strong>für</strong> das ja äh ne gewisse DANKBARKEIT die ich<br />
vorher nicht so KANNTE (IP 4:44).<br />
Eine Therapeutin sprach von der Bereicherung durch die Arbeit und den Kontakt<br />
mit interessanten Persönlichkeiten:<br />
IP 2: ich finde man wird in der täglichen auseinandersetzung mit anderen<br />
NORMEN REFERENZEN KULTUREN im weitesten sinn immer wieder sehr auf<br />
67
sich selber zurückgeworfen in FRAGE gestellt auch, man gleicht sich eigentlich<br />
jeden Tag ab mit ganz anderen WERTEN und äh das find ich EXTREM<br />
spannend und BEREICHERND, dann sind jetzt grad auch bei den opfern von<br />
politischer gewalt sehr viele menschen dabei die als persönlichkeit sehr<br />
interessant sind * grade bei den menschen die gefoltert worden sind wir haben ja<br />
viele mitglieder einer bestimmten volksgruppe aus einem bestimmten land das<br />
sind sehr POLITISCHE MENSCHEN sehr IDEALISTISCHE MENSCHEN auch<br />
menschen die sehr OPFERbereit sind die unglaublich sich eingesetzt haben <strong>für</strong><br />
ihre werte die finde ich einfach als PERSÖNLICHKEIT sehr spannend (IP 2:26).<br />
Auch eine andere Therapeutin betonte wie sehr sie von ihren Klientinnen häufig<br />
beeindruckt ist und welchen Respekt sie vor deren Idealen hat:<br />
IP 5: es gibt mir auch so ein wie soll ich sagen ich glaub das ist der SCHÖNE teil<br />
dass so ein STAUNEN wie menschen überLEBEN oder wie menschen nicht nur<br />
überleben sondern wie so * ja wie sich menschen so eine ZARTE SCHÖNE<br />
SEITE ERHALTEN können AUCH in zehn jahren gefängnis oder wie menschen<br />
äh * auch wenn es <strong>für</strong> sie ein LEICHTES wäre sich dadurch dass sie andere<br />
SCHLECHT behandeln eigene vorteile rauszuholen das dann EBEN NICHT tun<br />
also * ja all diese varianten von MUT oder IDEALEN das find ich SEHR<br />
EINDRÜCKLICH und sehr SCHÖN das eben auch miterleben zu können<br />
mithören zu können (IP 5:70).<br />
Eine Therapeutin sprach darüber, wie sie es als positiv erlebt, dass sie durch ihre<br />
Arbeit eigene Probleme häufig relativieren kann (IP 4:44). Eine andere<br />
Therapeutin bemerkt, dass sie gerade durch die schweren Schicksale, von denen<br />
sie erfährt und dadurch, dass auch sie selbst einen Umgang mit dem Gehörten<br />
finden muss, <strong>für</strong> sich mehr Sicherheit entwickeln konnte, was ihre eigenen<br />
Bewältigungsfähigkeiten angeht (IP 5:156).<br />
Die möglicherweise wichtigste positive Auswirkung, von denen alle interviewten<br />
Therapeutinnen sprachen, ist dass sie durch ihre Arbeit eine bewusste<br />
Auseinandersetzung mit den Realitäten dieser Welt führen müssen und dass<br />
diese ihnen zu einer vertieften Weltsicht verhilft. Die IP betonten, dass sie durch<br />
ihre Arbeit stärker politisch interessiert und informiert seien, dass sie durch ihre<br />
Arbeit offener und interessierter <strong>für</strong> Lebensrealitäten seien, die jenseits der<br />
relativen Sicherheit und Stabilität Westeuropas liegen und dass sie durch diese<br />
68
Konfrontation zu einer differenzierteren Positionierung gezwungen wurden.<br />
Besonders anschaulich beschrieb das ein Therapeut 9 , der durch einen<br />
gleichaltrigen Klienten aus einem Bürgerkriegsland mit den daran illustrierten<br />
sehr ungleichen Lebenschancen konfrontiert wurde:<br />
IP 2: der patient der war gleich alt wie ich ziemlich genau, und äh, im<br />
UNTERSCHIED ZU MIR, der hier irgendwie behütet aufgewachsen ist und äh<br />
immer alles schön REIBUNGSLOS abgelaufen ist und der alles ERREICHT hat<br />
was er WOLLTE keine hindernisse zu überwinden hatte, äh ist DER mit<br />
sechzehn ins GEFÄNGNIS gekommen und ist dort GEBLIEBEN bis er irgendwie<br />
ACHTUNDZWANZIG war. und hat die GRAUENVOLLSTEN sachen erlebt, die<br />
man sich vorstellen kann, * und dabei hat er wohl entschieden zu einer<br />
politischen organisation zu gehen, zu den rebellen zu gehen, aber der hat noch<br />
KEINEN EINZIGEN SCHUSS abgegeben gehabt in seinem leben und das * das<br />
hat mich in DIESER ZEIT, das war GANZ in der ersten zeit hier in der einrichtung<br />
da hat mich das sehr beschäftigt diese willkür sozusagen des schicksals der hat<br />
jetzt halt einfach PECH gehabt dass er dort auf die welt gekommen ist und ich<br />
hab jetzt halt GLÜCK gehabt dass ich hier auf die welt gekommen bin, und äh ich<br />
bin jetzt sein arzt obwohl wir gleich alt sind und ER ist schwerst traumatisiert<br />
irgendwo in einem fremden land, und ähm mit allen TAUSEND<br />
KOMPLIKATIONEN die das nach sich zieht das hat mir sehr zu knabbern<br />
gegeben in der zeit.<br />
JS: was heißt das?<br />
IP2: ich wusst nicht so richtig wie mit dem UMGEHEN *2* das das das fühlt sich<br />
einfach so UNGERECHT an, das ist so ne WILLKÜR, das kann doch nicht sein,<br />
*2* ich bin kein religiöser mensch aber es es ist es ist ne komische geschichte ich<br />
würd nicht sagen ich bin atheist, ich würd wahrscheinlich sagen ähm * wie<br />
KANNST du sowas zulassen so in der art, so ein ANTI-theist sozusagen * ähm *<br />
das hat ja dann nen ganzen rattenschwanz an konsequenzen, wenn man sich<br />
dann überlegen muss, was MACH ich jetzt mit der erkenntnis, dass die welt so<br />
ungerecht ist oder so willkürlich ist und dass es da leute gibt, die irgendwie<br />
extrem LEIDEN und dass es leute gibt die nicht mal WISSEN dass da andere<br />
leute extrem leiden oder sich gar nicht drum kümmern also (unverständlich) da<br />
9 An dieser Stelle wird ausnahmsweise auf die weibliche Form verzichtet, da aus dem Zitat<br />
deutlich hevorgeht, dass es sich sowohl um einen männlichen Therapeuten wie auch einen<br />
männlichen Patienten handelt.<br />
69
kommen ganz viele fragen hinterher wie man sich POSITIONIEREN soll, zu<br />
bestimmten dingen. auch zu diesen auch zu diesen zu FOLTER AN SICH, was<br />
die leute erlebt haben, und das war einer von denen, die das ganze in GANG<br />
gebracht haben *2*, oder in gang gebracht mich GEZWUNGEN haben mich<br />
damit auseinanderzusetzen und sachen zu sehen, die ich vorher vielleicht lieber<br />
nicht gesehen hab.<br />
JS: klingt fast n bisschen auch wie ne KRISE? […]<br />
IP2: ja ja, ich habs eigentlich nicht als krise empfunden, ich habs als was sehr ja<br />
wahrscheinlich ANREGENDES empfunden was DENKANSTOSSENDES<br />
sozusagen und die zusammenarbeit mit dem war auch SPANNEND und *<br />
GRADE aus dieser DYNAMIK DER GLEICHALTRIGEN heraus über die wir auch<br />
ab und zu gesprochen haben äh von dem her behalte ich den in sehr POSITIVER<br />
erinnerung. dass das irgendwie meine arbeit infrage gestellt hätte, das war GAR<br />
NICHT der fall, im <strong>gegen</strong>teil, das hat mich eigentlich sehr bestärkt, in allem was<br />
ich gemacht hab. insofern keine krise. aber doch DURCHGESCHÜTTELT, das<br />
schon ein bisschen (IP 2:110-116).<br />
So wurden hier beispielhaft einige Auswirkungen der Arbeit mit Kriegs- und<br />
Folterüberlebenden dargestellt, die sich aus den Interviews ermitteln ließen. In<br />
einem nächsten Schritt wird etwas systematischer vorgegangen. Im nächsten<br />
Kapitel werden Stressoren ermittelt, die zu einer besonderen Belastung in dieser<br />
Art der Traumaarbeit führen können, um im darauffolgenden Kapitel die<br />
Ressourcen und protektiven <strong>Faktoren</strong> zu schildern, die die Interviewpersonen als<br />
hilfreich genannt haben, um aus ihrer Arbeit möglichst unbeschadet<br />
hervorzugehen.<br />
6.2. Belastungsfaktoren<br />
Die im Folgenden aufgezählten Belastungsfaktoren haben sich aus der Analyse<br />
der Interviewtexte ergeben. Bei der Frage nach besonders belastenden<br />
Fallgeschichten hat sich gezeigt, dass einzelne Motive, die als besonders<br />
belastend empfunden wurden, gehäuft auftauchten und damit ein Muster<br />
darzustellen scheinen. Diese lassen sich auf vier verschiedenen Ebenen<br />
ansiedeln: der Ebene der Patientinnen, der Ebene der Therapeutinnen, der<br />
70
institutionellen Ebene oder der Ebene der Gesellschaft als Kontext. Die meisten<br />
der so identifizierten Kategorien sind durch Mehrfachnennung entstanden.<br />
Einzelne Kategorien wurden nur einmalig genannt, sind aber hier aufgelistet, da<br />
sie dennoch wichtig erschienen. Diese sind als solche auch benannt.<br />
6.2.1. Patientinnenbezogene Belastungsfaktoren<br />
6.2.1.1. Intensität des Traumas<br />
Die zu allererst zu nennende und eine bei jeder einzelnen Therapeutin genannte<br />
Belastung bezog sich auf die Natur oder Intensität der Traumata, mit denen die<br />
Therapeutinnen in ihrem Tagesgeschäft konfrontiert werden, und die <strong>für</strong> sich<br />
schlichtweg teilweise sehr schwer zu ertragen sind. Einige Stimmen dazu<br />
lauteten folgendermaßen:<br />
IP 1: also man kann es sich eigentlich KAUM VORSTELLEN dass menschen<br />
sowas aushalten können, es war ein schreckliches schicksal (IP 1:162).<br />
IP 2: DAS ist so verrückt, das find ich so unglaublich bei den patienten wenn man<br />
IRGENDEIN jahr rauspicken würde aus seinem leben würde das ALLEIN schon<br />
reichen um *, das DAS ALLEIN ist schon UNGLAUBLICH was der in so kurzer<br />
zeit erlebt hat das ist so ne DICHTE an TRAUMATA und an ERLEBNISSEN, das<br />
ist einfach UNGLAUBLICH, dass das in EIN LEBEN reinpasst (IP 2:144).<br />
IP 3: […] weil das LEID oder das was ihnen ANGETAN wurde TEILweise wirklich<br />
etwas unsagbares ist (IP 3:95).<br />
IP 3: ich hab ihn sehr ZERSTÖRT erlebt also wirklich MASSIVST traumatisiert<br />
*9* und ich bin ihm immer hinten nach und was SCHWIERIG war war auch DA<br />
wieder so *4* ja das einfach AUSZUHALTEN ja das glaub das war wirklich auch<br />
wieder so eine schwierigkeit (IP 3:207).<br />
IP 5: und das war schon der SCHRECKEN der in diesem in dieser<br />
GESCHICHTE war die sie erzählt hat also wirklich so etwas sehr<br />
UNGLAUBLICHES (IP 5:138).<br />
Solcherlei Aussagen weisen darauf hin, dass die schlimmen Geschichten und<br />
Schicksale, derer sie Zeuge werden, <strong>für</strong> sich genommen häufig schwer<br />
auszuhalten sind und allein deren Bericht eine Belastung in sich birgt. Einzelne<br />
71
Therapeutinnen haben davon berichtet, was sie dabei besonders berührt und<br />
belastet. Eine Therapeutin sprach davon, wie sie besonders die Einsamkeit<br />
mancher Patientinnen spürt:<br />
IP 1: und er ist dann als junger ja mit siebzehn achtzehn achtzehnjährig isch er<br />
dann hierher gekommen in die schweiz, hat quasi ALLES verloren oder, alle<br />
familie ham die [ATMET TIEF EIN] ham die anderen rebellentruppen *<br />
ausgelöscht mehr oder weniger. und es gibt GANZ ganz ganz viele<br />
einzelschicksale nebst dem RIESEN trauma dass er quasi völlig allein und hilflos<br />
ist auf der welt und es hat mich bei vielen anderen patienten auch aber bei IHM<br />
hats mich speziell berührt dieses ALLEIN sein auf der welt oder, des isch was<br />
was mir sehr nahe ging er isch wirklich also GANZ es GIBT NIEMANDEN er ist<br />
komplett entwurzelt fertig (IP 1:162).<br />
Eine andere Therapeutin sprach davon, dass sie vor allem von den „kleinen“<br />
Alltagsgeschichten, die Zeichen der Traumatiserung tragen, schmerzhaft berührt<br />
wird:<br />
IP 5: und es sind manchmal so die KLEINEN geschichten die ich so nach hause<br />
nehme also nicht die großen foltergeschichten sondern so wie FOLGEN davon<br />
so alltägliche EINSCHRÄNKUNGEN die leute jetzt haben so die mich dann auch<br />
so BERÜHREN<br />
JS: mhm kannst du dir so in etwa erklären warum dich DIE vielleicht manchmal<br />
MEHR berühren als die GROßEN?<br />
IP 5: weil ich mich da vielleicht im moment weniger WAPPNE da<strong>gegen</strong> oder weil<br />
ich mich auch berühren lassen WILL weil das etwas MENSCHLICHES hat halt<br />
oder ja dass wirklich so ich da auch viel MITGEFÜHL spüre und bei andern bei<br />
wirklich so SCHRECKENSgeschichten bemüh ich AKTIV dass mir das mir das<br />
nicht GANZ NAHE kommen zu lassen also da DISTANZIERE ich mich eigentlich<br />
schon während des zuhörens (IP 5:74-76).<br />
6.2.1.2. Nicht integrierte psychische Inhalte<br />
Ein weiteres Element, das bei drei der fünf IP genannt wurde, ist dass nicht<br />
integrierte psychische Inhalte ihrer Patientinnen zu besonderen<br />
Belastungsreaktionen führen können. Diese wurden von den Therapeutinnen mit<br />
72
unterschiedlichen Worten benannt. Sie wurden ‚abgespaltene Affekte‘ betitelt, die<br />
die Therapeutin zu spüren bekommt (IP 2:44), oder ‚unsymbolisierte Inhalte‘, also<br />
solche, die nicht oder kaum in Worte zu fassen sind (IP 3:95; IP 5:82; IP 5:95).<br />
Eine Therapeutin meinte dazu:<br />
IP 3: weil ich das bei diesen patienten sehr merke dass da viel grad wenn die<br />
dinge so ni- diese TRAUMATISCHEN erfahrungen so mm ja so SCHWIERIG<br />
INTEGRIERBAR sind oder ÜBERHAUPT NICHT integriert sind ja dann * is es<br />
auch sehr schwierig da<strong>für</strong> worte zu finden sowohl <strong>für</strong> die patienten aber AUCH äh<br />
als therapeut und TROTZDEM entstehen gewisse übertragungen äm bekommt<br />
dinge ab irgendwo (IP 3:23).<br />
Die gleiche Therapeutin beschrieb, wie sich diese nicht integrierten psychischen<br />
Inhalte häufig in körperlichen Reaktionen niederschlagen:<br />
IP 3: was SCHON spezifisch ist ich hab das vorhin schon so angedeutet ich<br />
denke dass hier sehr viel UNSYMBOLISIERTES man hat mit sehr viel<br />
UNSYMBOLISIERTEM zu tun äm das heisst dinge die ÜBERHAUPT NICHT<br />
integriert sind äm * bei den patienten NICHT integriert sind NICHT sowohl in der<br />
AFFEKTwahrnehmung sie sie sie sind nicht beNENNbar die GEFÜHLE sind nicht<br />
beNENNbar aber auch der INHALT ist oft nicht benennbar also wirklich<br />
ABGESPALTen und trotzdem ist es DA und und da so wie ja auch die<br />
PATIENTEN sehr viel über den KÖRPER abarbeiten bekommt man als<br />
THERAPEUT das auch über den KÖRPER sehr oft sehr mit und so MEINE<br />
erfahrung dass ich einen TEIL auch nicht über REFLEXION machen kann<br />
sondern wirklich auch über den KÖRPER wieder abarbeiten muss also ich hatte<br />
wie ich hier beGONNEN habe SEHR viel RÜCKENschmerzen gehabt sehr viel<br />
MEHR als ich SONST rückenschmerzen gehabt hab das ist eine gewisse<br />
SCHWACHstelle bei mir ich denke das ist IMMER sucht sich ja auch diese wege<br />
aber ich hatte ja also sehr AUFFÄLLIG VIEL und MEHR und intensivere<br />
rückenschmerzen und äm und ich denke das hat was mit dieser problematik zu<br />
tun (IP 3:95).<br />
Eine andere Therapeutin beschreibt wie sie aufgrund der Dissoziierung einer<br />
Patientin eine starke Reaktion zu spüren bekam:<br />
IP 5: ich hatte eine KURZE unsicherheit zu beginn dieser stunde soll ich das<br />
zulassen oder nicht ich war wirklich so methodisch unsicher aber ich hab dann<br />
73
gemerkt es war eine andere unsicherheit und ich hab wirklich ich hab das noch<br />
nicht erlebt ich hab wirklich dann den GANZEN PACKEN an an GEFÜHLEN an<br />
allem was sie dissoziiert abbekommen und ähm ich war am schluss der st- und<br />
sie äh ich war am schluss der stunde total ver- ich SPÜRS jetzt ich kanns wirklich<br />
SPÜREN kommen wieder ein ich glaubs ist ein gefühl von totaler OHNMACHT<br />
und und DESORIENTIERTHEIT ich konnte TERMINE nicht mehr richtig<br />
abmachen ich brauchte wirklich <strong>für</strong> jeden termin zwei drei anläufe und habs dann<br />
IMMER NOCH falsch gemacht ich musste ihr am nächsten tag anrufen und sie<br />
hatte dann eine woche lang SCHMERZEN * also es ging ihr ganz schlecht * ich<br />
hab das GEMERKT ich geh nach hause ich hab das wirklich MIT nach hause<br />
genommen ich hab auch GETRÄUMT und ich kam am nächsten tag zur arbeit<br />
und hab gemerkt das ist wirklich SCHEISSE es ist NICHT gut gelaufen (IP<br />
5:130).<br />
Die Abspaltung von Affekten, sowie die Unfähigkeit, das Erlebte in Worte zu<br />
fassen, sind typische Merkmale einer <strong>Traumatisierung</strong> und können in der<br />
Interaktion zu den beschriebenen Reaktionen führen. Solche<br />
Gegenübertragungsreaktionen in der Traumatherapie wurden in der Literatur<br />
zahlreich beschrieben.<br />
6.2.1.3. Suizidalität<br />
Ein Thema, das in den Interviews mehrfach als belastend genannt wurde, ist das<br />
der Suizidalität. Dies mag kein Thema sein, dass sich bei der<br />
psychotherapeutischen Behandlung von Folter- und Kriegsüberlebenden<br />
besonders hervorhebt. In jeder Therapie ist die Suizidalität von Patientinnen <strong>für</strong><br />
die Therapeutin potentiell belastend. Dieses Thema findet hier jedoch gesondert<br />
Beachtung, da es von vier der fünf IP bei besonders belastenden Fällen genannt<br />
wurde. Dabei ist anzumerken, dass die hier angewandte Methode keinen<br />
Rückschluss darüber erlaubt, ob die Suizidalität der Patientinnen selbst ein<br />
Belastungsfaktor <strong>für</strong> die Therapeutinnen darstellt, oder ob die Suizidalität eine<br />
Folgeerscheinung besonders schwieriger Schicksale darstellt, die ihrerseits <strong>für</strong><br />
eine erhöhte Belastung auf Seiten der Therapeutinnen verantwortlich gemacht<br />
werden können.<br />
74
Bekannt ist aus der Fachliteratur, dass die Suizidalität von Patientinnen in<br />
Therapeutinnen in der Regel Auseinandersetzungen über Macht und Ohnmacht,<br />
über die eigene Handlungskompetenz, bzw. –inkompetenz und Fragen zu<br />
Verantwortung provozieren können, was ohnehin Themen sind, die in der<br />
Psychotherapie mit Folter- und Kriegsüberlebenden auftauchen (vgl. dazu<br />
Sonneck 2000).<br />
6.2.1.4. Täter oder Täteranteile<br />
Ein Motiv, das bei drei Therapeutinnen bei besonders schwierigen Fällen<br />
genannt wurde, hat mit Patientinnen zu tun, die ganz oder anteilig Täter waren,<br />
oder bei denen ein eigenes Gewaltpotential oder tatsächliche Gewalttätigkeit in<br />
der Therapie eine Rolle spielten. Dies gibt Anlass zu der Annahme, dass auch<br />
hier ein besonderer Belastungfaktor liegt. Es wurde beschrieben wie dieser<br />
Aspekt zu schwierigen emotionalen Reaktionen führen kann, da er zu einer<br />
schwierigen moralischen Positionierung zwingt. Eine Therapeutin, bei der<br />
allerdings zusätzlich der Umstand ihrer Schwangerschaft eine Sondersituation<br />
darstellte, berichtete Folgendes:<br />
IP 1: ich hatte einen n TÄTER auch also n FOLTERER mit ner täter-PTSD dann<br />
also der einfach der folterer war in einem bestimmten land n täter * da war ich<br />
relativ HOCHschwanger dann am schluss und des hab ich dann net mehr ausg-<br />
da hab ich dann gemerkt so jetzt isch fertig des kann ich net im MOMENT<br />
JS: mhm<br />
IP 1: da also EINMAL in der zeit wo ich gemerkt hab NE dat geht net. der war mir<br />
sehr * von seiner persönlichkeit einfach so man konnt sich den vorstellen als so<br />
der henker, der folterer und er hatte sehr eindrücklich auch da hat man dann<br />
gearbeitet da an der sache und es wurd mir zuviel dann<br />
JS: mhm<br />
IP 1: dat war aber sicherlich auch SO schon SCHWIERIG weil man hat immer die<br />
patienten die OPFER und dann hat man ne stunde später den ders MACHT mit<br />
den andern oder, das isch son bissel schwierig gewesen mim umstellen auch von<br />
MIR. er hat gleichermaßen gelitten KLINISCH oder, * aber SCHLUSSENDlich<br />
war er – und viele sind TÄTER durchs REGIME und dazu geZWUNGen oder wie<br />
75
auch immer und er aber er war WIRKLICH n TÄTER n anderer bereich und da<br />
hab ich gemerkt * ich weiss net wies gewesen wär ohne schwanger aber * da hab<br />
gesagt NE KANN ich net GEHT net. dat wurd mir zu zu zu ffhhh [ATMET AUS]<br />
auch son bisschen des isch MEIN Kind der det HÖRT da drin also so bissel<br />
BLÖD vielleicht aber ich gesagt NE NE NE KEINE ahnung was des <strong>für</strong> das<br />
KIND macht wenn man so ch [GESTE ETWA VON ANGESPANNTHEIT] ich war<br />
sehr so wütend und emotional wo ich gemerkt hab oh ich muss mich n bissel ffhh<br />
[ATMET AUS] sonst ischs net mehr [ATMET NOCHMAL AUS] net mehr<br />
professionell oder, net mehr therapeutisch dann. na ja den hab ich abgebrochen<br />
(IP 1:102-106).<br />
Die Therapeutin beschrieb starke Reaktionen auf diesen Patienten, eine starke<br />
Abwehrhaltung und Ekelgefühle <strong>gegen</strong>über seinen sadistischen<br />
Persönlichkeitsanteilen, so dass sie in dieser Situation die Therapie nicht<br />
weiterführen konnte.<br />
Doch auch andere Patientinnen wurden beschrieben, die ob ihrer häufig<br />
verzweifelten Lage ein Gewaltpotential entwickelten, mehrfach wurde von<br />
Patientinnen gesprochen, die Waffen besaßen und diese auch in den<br />
Therapieraum mitbrachten, wie etwa dieses Beispiel dokumentiert:<br />
IP 2: es kam auch zu SELBSTverletzungen, er hat sehr sehr sehr große WUT<br />
gehabt in sich, äh <strong>gegen</strong> die schweizer behörden, und DROHTE immer damit,<br />
ähm wenn die dann kommen würden ihn auszuschaffen, dass ER dann<br />
irgendwas tun würde, seine wohnung in brand stecken würde, sich umbringen<br />
würde, erst alle polizisten umbringen würde oder so. und mehr oder weniger<br />
konkret war er in den stunden immer sehr gespannt, hatte am anfang ein<br />
MESSER bei sich wie ich dann irgendwann mal festgestellt hab, <strong>für</strong> den fall dass<br />
ich da irgendwie ihm auch zu NAHE treten würde oder so […] und dann immer<br />
wieder auch VERLETZUNGEN an den FÄUSTEN vom SCHLAGEN <strong>gegen</strong> die<br />
wand oder am kopf vom SCHLAGEN <strong>gegen</strong> die wand und mit seinen kindern<br />
immer mal wieder [ATMET TIEF EIN] ähm gewalttätig sagen wir mal zumindest<br />
TÄTLICH er hat seine kinder geschlagen geschüttelt herumgeschrien zu Hause<br />
es ist ja ne siebenköpfige achtköpfige, am schluss warens sieben kinder<br />
NEUNköpfige familie in einer dreieinhalb-zimmer-wohnung […] er traumatisiert<br />
das ist ja ne super horrorvorstellung das war einfach so ein PULVERFASS, über<br />
zwei jahre lang wusste ich NIE, ob der das nächste mal wieder kommt, und wen<br />
76
er vielleicht sonst noch umgebracht hat, aus VERSEHEN oder absichtlich in der<br />
zwischenzeit. und in der ganzen zeit liefen auch die rekursverfahren <strong>gegen</strong><br />
dieses abgewiesene asylgesuch und äm niemand hat ihm geGLAUBT, in DER<br />
STADT niemand und im KANTON niemand, bei der GEMEINDE niemand und da<br />
gabs er war natürlich auch auf der GEMEINDE aggressiv er hat mal ne tür<br />
irgendwie kurz und klein gehackt und die ham ihn natürlich AUCH gehasst und<br />
ham ihn geschnitten wos ging und schlecht behandelt, * [ATMET TIEF EIN] und<br />
um die KINDER hab ich mir immer sorgen gemacht (IP 2:86-88).<br />
Auch eine andere Therapeutin berichtete, wie sehr viel schwieriger es sei, sich<br />
mit der Täterseite in den Patientinnen zu verbinden:<br />
Oder später:<br />
IP 3: […] und das hat in ihm extrem viel ausgelöst und er ist gekommen und er<br />
hat gesagt er geht jetzt zum bundeshaus und er wird dort eine BOMBE ZÜNDEN<br />
und hatte mir auch schon erzählt er weiß genau wie man das wie man eine<br />
bombe BASTELT er hat er hat eben diese vielleicht kann man nochmal es gibt<br />
immer die opferseite mit der man sich relativ rasch IDENTIFIZIERT und dann hilft<br />
und gibt’s aber eben auch die TÄTERseite die natürlich bei vielen von unseren<br />
patienten auch da sind die haben geKÄMPFT die haben geTÖTET und da ist<br />
dieses ausmaß an gewalt möglicher gewalt äm ist in diesem gespräch MASSIV<br />
geworden also ich ich wusste nicht mehr ich hab dann versucht zu KLÄREN und<br />
zu sagen und das auf die PHANTASIE zu bringen und dass so<br />
RACHEphantasien entstehen können ABER dass es was andres ist das zu TUN<br />
und es war <strong>für</strong> mich SEHR SCHWIERIG abzuschätzen macht der das jetzt oder<br />
macht ers NICHT (IP 3:149).<br />
IP 3: […] die wahrnehmung der AGGRESSION in dieser arbeit und die<br />
DESTRUKTION auch die das sind alles menschen wo massiv destruktive dinge<br />
ihnen GESCHEHEN ist ja und die das natürlich auch in sich tragen also diesen<br />
teil auch wirklich WAHRzunehmen und noch einmal auch mit dem einen umgang<br />
zu lernen und das ist schon das hat da hat sich schon was verändert […]und also<br />
sich DESSEN auch BEWUSST zu sein dass es da auch so etwas gibt also das<br />
sind NICHT NUR OPFER […] ja von massiver gewalt sondern dieser teil gibt es<br />
auch diesen teil gibt es auch äm das ist UNANGENEHM gewesen <strong>für</strong> mich dass<br />
auch ja dass mir das so nah kommt dass ich so mit dem konfrontiert werde ja<br />
dass ich auch weiss es kann auch HIER passieren es gibt auch patienten die mit<br />
77
messern und pistolen in die therapien kommen ohne dass wirs wissen irgendwo<br />
also das immer auch MITZUDENKEN ja das gibt es auch das hat mich schon<br />
VERÄNDERT ja in dem also in bezug auf die ARBEIT auch verändert ja mm<br />
mich nicht nur mit der LEIDENDEN und mit der OPFERseite zu verbünden (IP<br />
3:163-167).<br />
Dieser Aspekt der Arbeit hat ganz spezifische Folgen. Zum einen kann es sehr<br />
belastend sein, mit der damit einhergehenden Angst umgehen zu müssen:<br />
IP 2: das war das war schon das war sehr belastend ich hab immer angst gehabt<br />
dass irgendwas passiert (IP 2:88).<br />
Zum anderen birgt dieser Aspekt eine nicht leicht wahrzunehmende<br />
Verantwortung in sich, wenn es darum geht die Beziehung zur Patientin<br />
einerseits und den Schutz vor Fremdgefährdung andererseits abzuwägen. Zwei<br />
Therapeutinnen brachten diese Belastung folgendermaßen zum Ausdruck:<br />
IP 3: und ich bin so sehr mit dem jetzt dagestanden jetzt muss ich ihn fahnden<br />
lassen? muss ich die polizei äh involvieren? was heisst das <strong>für</strong> so einen<br />
menschen wenn dann die polizei kommt und ihn festnimmt? das risiko noch<br />
einmal einschätzen und er hat mir das einfach so HINGEGEBEN und ich musste<br />
mit dem UMGEHEN (IP 3:149).<br />
IP 1: der KANN austickern ja, und er hat pistolen und er läuft da durch die<br />
<strong>gegen</strong>d mit so ner knarre, des isch schwierig, isses IMMER noch, des isch immer<br />
noch thema oder, im sinn von * was ist ärztliche SCHWEIGEpflicht, was ist<br />
SCHUTZ der öffentlichkeit, inwieweit muss ich da die polizei benachrichtigen<br />
oder ihn IHN dann also er sagt mir das im VERTRAUEN aber ich muss *<br />
SCHUTZ FREMDGEFÄHRDUNG ich muss ANZEIGE machen oder, ich verlier<br />
IHN dann aber auch in der therapie würd ihn WIEDER enttäuschen er wird<br />
WIEDER verlassen also DIESE GANZEN THEMEN machens bei IHM<br />
SCHWIERIG (IP 1:162).<br />
Aspekte von Täterschaft und Gewaltbereitschaft der Patientinnen sind in der<br />
Fachliteratur zur psychotherapeutischen Behandlung von Folter- und<br />
Kriegsüberlebenden ein vernachlässigtes Thema. Es wird meist betont, dass es<br />
um die Behandlung von Opfern geht, sodass es leicht verstehbar ist, dass<br />
manche Therapeutin zunächst überrascht wird, in der Praxis auch mit den<br />
78
Täteranteilen, die viele der Patientinnen in diesem Kontext in sich tragen,<br />
konfrontiert zu werden.<br />
6.2.1.5. Kinder<br />
Ein weiterer belastender Aspekt, der zwar nur von einer Therapeutin genannt<br />
wurde, der mir jedoch wichtig erschien, war die Arbeit mit Kindern, oder mit<br />
Menschen, die bereits in früher Kindheit mit Krieg und Gewalt konfrontiert<br />
wurden. Eine Therapeutin spricht darüber, wie sie eine besondere Belastung<br />
verspürt, wenn es um Kinder geht:<br />
IP 1: er hat ne schwierige geschichte wie VIELE hier auch oder hier am alle<br />
irgendwo ihre schlimmen schicksale und schlimmen geschichten bei IHM hats<br />
mich jetzt noch besonders mitgenommen weil er bei dem geht es sehr FRÜH in<br />
die KINDHEIT und ich hab selber immer son bisschen schwierigkeiten wenns so<br />
um KINDERsachen geht. Vielleicht auch weil selber mama und man denkt dann<br />
die kleinen sind einfach noch so schutzlos und irgendwie hm und er war sehr früh<br />
kindersoldat also irgendwie mit sechs schon oder sehr früh hat er schon * äm da<br />
kämpfen müssen (IP 1:162).<br />
So wurden in diesem Abschnitt Belastungsfaktoren identifiziert, die sich auf der<br />
Seite der Patientinnen ansiedeln lassen. Zusammengefasst sind diese die<br />
Intensität des Traumas, nicht integrierte psychische Inhalte, Suizidalität, die<br />
Arbeit mit Tätern oder Täteranteilen, sowie die Arbeit mit Kindern. Als nächster<br />
Schritt werden Belastungsfaktoren auf der Ebene der Therpeutinnen<br />
beschrieben.<br />
6.2.2. Therapeutinnenbezogene Belastungsfaktoren<br />
6.2.2.1. Schwierige emotionale Reaktionen<br />
Eine Belastung, die alle interviewten Therapeutinnen erwähnten, sind schwierige<br />
eigene Gefühle, die durch die Therapie mit Kriegs- und Folterüberlebenden<br />
entstehen, mit denen es gilt umzugehen oder einen Umgang mit ihnen zu<br />
erlernen.<br />
79
Ein Gefühl, das in diesem Zusammenhang häufig genannt wurde ist das Gefühl<br />
von Ungerechtigkeit und der Wut darüber. Zwei Therapeutinnen dazu:<br />
IP 2: ich wusst nicht so richtig wie mit dem UMGEHEN *2* das das das fühlt sich<br />
einfach so UNGERECHT an, das ist so ne WILLKÜR, das kann doch nicht sein<br />
(IP 2:112).<br />
IP 1: also wie so oft in diesen ländern beispielsweise in xx ganz häufig oder, dass<br />
die FRAUEN dass die KULTUR so isch auch in yy die frauen die sind<br />
VERGEWALTIGT worden aber die sind SCHULD oder, also des macht mich<br />
EXTREM WÜTEND, wütend auf männerwelt auf diese männerdominierten länder<br />
(IP 1:223).<br />
Alle Therapeutinnen berichteten von regelmäßig auftretenden Gefühlen der<br />
Ohnmacht und der Hilflosigkeit, wie beispielsweise hier:<br />
IP 3: womit man SEHR zu tun hat das ist OHNMACHT und HILFLOSIGKEIT<br />
auch als THERAPEUT mit der UMGEHEN zu können das ist etwas wo<br />
BESONDERS ist und auch MEHR als bei vielen andern das hat auch<br />
verschiedene gründe das eine äm weil das LEID oder das was ihnen ANGETAN<br />
wurde TEILweise wirklich etwas unsagbares ist aber auch das leben HIER DANN<br />
ja und und mm die die SCHWIERIGKEITEN sich HIER dann noch einmal ein<br />
leben aufzubauen die ABHÄNGIGKEITEN äm das ist etwas wo man sehr SPÜRT<br />
und wo man auch merkt da kann man gar nichts VERÄNDERN und da entsteht<br />
etwas ganz ÄHNLICHES man ist als therapeut doch sehr HILFLOS kann nichts<br />
bewegen kann auch nicht wirklich viel ANBIETEN sondern muss DABEI sein<br />
über gewisse strecken dann immer wieder ja und das das denk ich ist eine<br />
BELASTUNG ja mit der man ZURECHT kommen muss ja sonst kann man denk<br />
ich diese arbeit NICHT machen das muss man denk ich bei sich auch immer das<br />
muss man auch PRÜFEN (IP 3:95).<br />
Die Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit treten häufig in Zusammenhang mit<br />
Aufenthaltsfragen ihrer Patientinnen auf oder werden mit dem Gefühl des<br />
eigenen Ungenügens oder dem Gefühl, an eigene Grenzen zu stoßen,<br />
zusammengebracht:<br />
IP 5: ich glaub es gibt mir auch immer wieder so ein OHNMACHTSGEFÜHL ja<br />
wahrscheinlich hat es schon damit zu tun dass ich gerne MEHR HILFREICH sein<br />
können mehr bewirken können oder mehr mit ihr rausfinden können was denn da<br />
80
HILFT [ATMET TIEF EIN] so das ist wahrscheinlich ein teil der bei MIR ist (IP<br />
5:170).<br />
IP 3: und ich war so mit meinen KONZEPTEN irgendwo an der GRENZE so den<br />
THEORETISCHEN konzepten mit den dingen die man so in der traumatherapie<br />
lernt an der GRENZE ich war überall an der GRENZE alles was ich so ZUR<br />
VERFÜGUNG hatte hat NICHT GEHOLFEN (IP 3:207).<br />
6.2.2.2. Infragestellung eigener Normalität<br />
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt, der sich destabilisierend und damit<br />
belastend auf Therapeutinnen auswirken kann, ist die Infragestellung der eigenen<br />
Normalität durch die Konfrontation mit anderen Kulturen und Normen einerseits<br />
aber auch durch die Konfrontation mit extremem Leid, das in deutlichem<br />
Gegensatz zu dem relativen Wohlstand und der Sicherheit in Westeuropa steht.<br />
Während eine Therapeutin es grundsätzlich als sehr bereichernd darstellte, mit<br />
fremden Kulturen und Werten konfrontiert zu werden und dadurch auch die<br />
eigenen kulturellen Werte immer wieder in Frage zu stellen (IP 2:26), wurde<br />
eben dies an anderer Stelle auch als verunsichernd, unangenehm und belastend<br />
beschrieben:<br />
IP 2: doch, es ist SCHON belastend. man stellt ja all das, was hier so gemeinhin<br />
in unsrer gesellschaft an werten KULTIVIERT wird und verfolgt wird in FRAGE,<br />
und das ist SCHON irgendwie verunsichernd und dann insofern unangenehm *<br />
oder in sofern belastend. so vielleicht – unangenehm, belastend, ja. Und dann<br />
auch eben die * diese HEFTIGKEIT, mit der einen diese erfahrungen und<br />
erlebnisse TREFFEN wenn man das noch nicht so kennt das * das ist schon ja<br />
das ist HEFTIG am anfang, ja. in dem sinn heute auch (IP 2:122).<br />
Eine andere Therapeutin beschreibt die belastende Erfahrung extremer<br />
Gegensätze sehr plastisch:<br />
IP 3: ja und und das war vor allem so in der ANFANGszeit das war <strong>für</strong> mich auch<br />
so ein bisschen ein ALARMzeichen mm *3* dass das schwierig auszuhalten war<br />
diese GEGENSÄTZE ja man ist hier spricht mit einer frau aus einem<br />
afrikanischen land mit zwei kleinen kindern die keinen aufenthalt haben die ein<br />
SCHRECKliches leben führen und am abend geht man auf ein SOMMERfest in<br />
81
irgendeinem LUXUS- also wirklich in einem schönen gebäude so jugendstil und<br />
üppig und […] es sind MASSIVE unterschiede und da können dann schon so<br />
gedanken kommen ja steht das denen ZU und diese ja das das HAT MICH<br />
SCHON SEHR BEEINFLUSST und da da muss ich MUSSTE ich auch AKTIV<br />
WAS DAGEGEN HALTEN ja um zu sagen ICH geh trotzdem in diese äh das lass<br />
ich AUCH zu und das hat AUCH seine berechtigung und das DARF ich auch<br />
GENIESSEN irgendwo auch WENN das LEID und das ELEND dem <strong>gegen</strong>über<br />
steht ja, auch DA wieder ja das hat so ein sonst wär das eine tendenz dass das<br />
auch wieder wie ausufert (IP 3:105-107).<br />
Es scheint verführerisch <strong>für</strong> Therapeutinnen zu sein, sich innerlich eher mit dem<br />
Leiden zu solidarisieren, und sich von den hiesigen kulturellen Gepflogenheiten<br />
entfremdet zu fühlen, möglicherweise diese sogar zu entwerten, und die eigene<br />
Tätigkeit zu überhöhen. Die oben zitierte Therapeutin hat eingänglich<br />
beschrieben, wie es einer aktiven Bemühung bedarf, die harten Lebensrealitäten<br />
von Flüchtlingen und die vergleichsweise eher „sorglosen“ Lebensrealitäten<br />
hiesiger Menschen gleichberechtigt nebeneinander stehen zu lassen. Im Idealfall<br />
führt die Konfrontation mit solchen Gegensätzen zu einer Auseinandersetzung<br />
und einer letztlich vertieften Weltsicht, in der verschiedenste Möglichkeiten und<br />
Realitäten ihren Platz finden (siehe dazu auch Kapitel 6.1). Im ungünstigeren Fall<br />
kann sie aber auch zur Entfremdung von den eigenen kulturellen Referenzen<br />
führen.<br />
6.2.2.3. Schwierigkeiten im Therapieverlauf<br />
Ein weiterer Belastungsfaktor liegt in auftretenden Schwierigkeiten im<br />
Behandlungsverlauf. Dieser wurde auf der Ebene der Therapeutinnen<br />
angesiedelt, da es sich bei der Therapiegestaltung um das „Handwerk“ der<br />
Therapeutinnen handelt und hier auftretende besondere Herausforderungen eine<br />
Belastung darstellen können. Diese können sich in unterschiedlicher Form<br />
manifestieren. Aufgrund von komplexen und sequentiellen <strong>Traumatisierung</strong>en,<br />
bzw. Traumafolgestörungen, schwierigen Kontextvariablen aufgrund der<br />
besonderen Herausforderungen der Migration, möglichen prätraumatischen<br />
Belastungen der Patientinnen, sowie zahlreichen transkulturellen Aspekten, die<br />
auch erschwerend auf eine Therapie einwirken können, kommt es in diesem<br />
82
Arbeitssegment nicht selten zu schwierigen Behandlungsverläufen (vgl. IP5:164;<br />
IP2:60; IP2:176).<br />
Aufgrund der Vielzahl an Problemen, die die Patientinnen häufig mitbringen, die<br />
zum Teil juristischer oder sozialarbeiterischer Natur sind, und da gleichzeitig die<br />
Patientinnen nicht selten sehr konkrete Wünsche, was sie erreichen möchten, in<br />
die Therapie mitbringen, kann die Auftragsklärung schwierig sein. Die<br />
Eingrenzung auf Probleme, die tatsächlich psychotherapeutisch gelöst oder<br />
zumindest gelindert werden können, wurde als eine Herausforderung genannt.<br />
Auch die Beziehungsgestaltung, die <strong>für</strong> die psychotherapeutische Arbeit zentral<br />
ist, kann sich speziell in einem traumatherapeutischen Kontext als schwierig<br />
erweisen. Dazu eine Therapeutin:<br />
IP 3: aber kann natürlich auch wieder ne belastung sein weil man merkt es ist<br />
etwas sehr fraGILES dass man überhaupt in eine tragfähige arbeitsbeziehung<br />
KOMMT und dass man sehr austauschbar bleibt auch als therapeut es braucht<br />
SEHR lange bis es wirklich n KONTAKT gibt teilweise ja auch verständlich weil ja<br />
auch ein großes vertrauen zerstört wurde bei diesen leuten und sie auch<br />
PRÜFEN müssen SCHAUEN müssen immer wieder ja sich das versichern<br />
müssen (IP 3:97).<br />
Zusammenfassend lassen sich also die identifizierten Belastungsfaktoren auf<br />
Ebene der Therapeuten in drei übergeordnete Themen kategorisieren:<br />
schwierige emotionale Reaktionen, Infragestellung eigener Normalität und<br />
Schwierigkeiten im Therapieverlauf.<br />
6.2.3. Die institutionelle oder arbeitsorganisatorische Ebene<br />
6.2.3.1. Teamkonflikte<br />
Zum Thema Teamkonflikte als Belastungsfaktor gibt es in den untersuchten<br />
Einrichtungen eine Vorgeschichte, die die heutigen Aussagen stark zu<br />
beeinflussen schienen. Alle interviewten Therapeutinnen in beiden untersuchten<br />
Einrichtungen berichteten von einer derzeit guten, unterstützenden und<br />
wertschätzenden Teamatmosphäre, und dass das Team die wichtigste<br />
unterstützende Ressource in ihrer Arbeit darstelle. Gleichzeitig hat es in beiden<br />
83
Einrichtungen in der Vergangenheit schwierige Teamprozesse und –konflikte<br />
gegeben, die in den Interviews erwähnt wurden, da die Teams teilweise noch mit<br />
der Aufarbeitung älterer Konflikte beschäftigt waren. Ohne Einzelheiten über<br />
diese Konflikte erfahren zu haben ist deutlich geworden, dass diese tief im<br />
institutionellen Gedächtnis der Mitarbeitenden verankert zu sein scheinen und als<br />
Warnung im Raum stehen. Eine Therapeutin sagte dazu: „alle wissen SO SOLLS<br />
NIE MEHR WERDEN“ (IP 2:184).<br />
In beiden Einrichtungen wurde davon gesprochen, dass sie nach einer extrem<br />
konfliktreichen Zeit eine Transformationsphase durchlaufen hätten, die mit einer<br />
Professionalisierung und klareren Struktierung einherging. Einen guten Überblick<br />
<strong>für</strong> solche Transformationsprozesse gibt Pross (2009), eine Publikation, auf die in<br />
einem der Interviews hingewiesen wurde, da sich die Einrichtung dort gut<br />
beschrieben wiedergefunden hat.<br />
Zu der Frage, welchen Stellenwert das Team hat, welchen Stellenwert also auch<br />
Teamkonflikte <strong>für</strong> die Belastungssituation der Therapeutinnen haben können,<br />
sind die Aussagen einer Therapeutin aufschlussreich:<br />
IP 2: der ANDERE aspekt der manchmal sehr schwierig ist oder schwierig<br />
gewesen ist mehr früher das war der teamaspekt. wenns da zu spannungen kam<br />
das fand ich fast SCHWERER zu ertragen als wenns in der einzeltherapie<br />
schwierig ist ähm, wenn sich diese wenns zu SPALTUNGEN kommt das ist ganz<br />
ekelhaft find ich im team, man BRAUCHT irgendwie das team um sich<br />
auszutauschen und äh manchmal ein bisschen * ja das ist ein bisschen<br />
übertrieben ausgedrückt n bisschen TRAGEN zu lassen aber manchmal ist es<br />
wichtig dass man sagen kann das war jetzt scheiße das war jetzt auch ne<br />
schwierige exposition und dann sagt dir jemand ja [LACHT] @ich kenn das@ *<br />
manchmal hilft das. also das KLIMA ist ganz entscheidend <strong>für</strong> unsere<br />
arbeitsfähigkeit das klima UNTEREINANDER und jetzt geht das ganz gut im<br />
moment eigentlich (IP 2:42).<br />
6.2.3.2. Hohe Fallbelastung<br />
Alle interviewten Therapeutinnen arbeiteten zum Zeitpunkt der Befragung „nur“ in<br />
Teilzeit in der Behandlungseinrichtung oder hatten eine Vielzahl von<br />
84
verschiedenen Aufgaben (z.B. Leitungsfunktionen, Forschung und Lehre,<br />
Öffentlichkeitsarbeit), so dass der Patientenkontakt „nur“ einen Teil der<br />
Arbeitszeit ausmachte. Somit kamen alle befragten Therapeutinnen mit ihrer<br />
Fallbelastung gut zurecht. Jedoch betonten gleichzeitig alle<br />
Interviewpartnerinnen, dass eine höhere Fallbelastung, sei es innerhalb der<br />
Arbeitszeit mehr Patientinnen oder tatsächlich mehr Arbeitszeit zu einer<br />
Belastung führen würden, die sie nicht tragen wollen würden. Eine Therapeutin<br />
formuliert dies recht deutlich:<br />
IP 1: also ICH ich GLAUB ich könnts HUNDERT prozent NICHT machen also in<br />
ner vollzeitanstellung oder auch achtzig prozent oder hundert prozent full-time<br />
job in der einrichtung könnt ICH mir <strong>für</strong> MICH NICHT vorstellen weil ich glaub<br />
DANN hat mas problem dass mas * oder ich kann nur <strong>für</strong> mich reden aber DANN<br />
würd ichs wahrscheinlich auch mit NACH HAUSE nehmen (IP 1:64).<br />
Eine andere Therapeutin berichtete, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt zu<br />
achtzig prozent in der Einrichtung arbeitete und währenddessen ausschließlich<br />
patientenkontakt hatte, und beschreibt dies als grenzwertig (IP 2:42).<br />
Eine andere Form der hohen Fallbelastung wurde ausschließlich in einer der<br />
beiden Einrichtungen beschrieben: der Druck auf Therapeutinnen, der durch sehr<br />
lange Wartezeiten ensteht:<br />
IP 2: vielleicht noch ein faktor der SEHR belastend ist das ist dass wir sehr lange<br />
wartezeiten haben * ein jahr im moment bis die leute zum erstgespräch kommen<br />
können. und DAS find ich GEFÄHRLICH weil uns das alle son bisschen unter<br />
DRUCK setzt oder wir uns dadurch unter DRUCK setzen LASSEN, dass wir das<br />
gefühl haben: wir MÜSSEN, MÜSSEN, MÜSSEN leute NEHMEN, irgendwie<br />
UNTERKRIEGEN und tendenziell wahrscheinlich alle ein bisschen überlastet<br />
sind. das denk ich ist son latentes risiko, das immer mitschwingt (IP 2:178).<br />
Bemerkenswert ist dabei, dass die andere untersuchte Einrichtung anders damit<br />
umgeht. Sie lehnt es grundsätzlich ab, eine Warteliste zu führen, um eben diesen<br />
Druck zu vermeiden. Keine der Therapeutinnen dort hat dementsprechend<br />
diesen Risikofaktor erwähnt, da Patientinnen, die nicht aufgenommen werden<br />
können, eben auf die Regelversorgungsangebote zurückgreifen oder sich<br />
85
gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut um einen Therapieplatz<br />
bemühen müssen.<br />
6.2.3.3. Globale Erwartunghaltungen<br />
Ein belastender Aspekt wurde zwar nur einmal genannt, aber er erschien wichtig<br />
und wird daher hier aufgelistet. Beide Einrichtungen sind in ein größeres<br />
Hilfswerk eingebettet. Da die meisten Patientinnen multiple Problemlagen<br />
mitbringen, die nicht allein therapeutisch lösbar sind, sehen sich die<br />
Therapeutinnen nicht selten einer globalen Erwartungshaltung <strong>gegen</strong>über. Eine<br />
Therapeutin beschrieb:<br />
IP 3: […] die WÜNSCHE auch an uns weil die sind oft ganz durchmischt mit das<br />
ist die organisation die im hintergrund steht und da ist die therapie und wir<br />
machen noch wir bieten wir schaffens auch noch dass sie einen AUFENTHALT in<br />
der schweiz bekommen und DORT noch was machen und DA noch was also<br />
dass wir das wirklich gut klären am anfang das hab ich so herausgenommen (IP<br />
3:171).<br />
Die Therapeutin beschrieb dies im Zusammenhang mit einer<br />
Patientinnengeschichte, bei der die Patientin ein konkretes Anliegen hatte, <strong>für</strong><br />
das sie von der Therapeutin verlangt hatte zu kämpfen. Die Therapeutin<br />
berichtete davon, sich dabei massivst manipuliert gefühlt zu haben und betonte<br />
diesen Aspekt, um zu untermauern wie wichtig einerseits die Auftragsklärung mit<br />
einer Patientin zu Beginn der Therapie sei, um keine falschen Erwartungen zu<br />
wecken, gleichzeitig aber auch um zu betonen, dass es klarer institutioneller<br />
Rahmenbedingungen und einer klar definierten Aufgabenstellung bedarf, um<br />
solche globalen Erwartungen mit eindeutigen Kompetenzen zu beantworten oder<br />
gegebenenfalls abzuweisen. Ein diffuses Hilfsangebot, dass zu entsprechenden<br />
Erwartungshaltungen führt, kann damit eindeutig als eine Gefahr identifiziert<br />
werden.<br />
Die hier ermittelten zentralen Kategorien von Belastungsfaktoren auf<br />
institutioneller Ebene lassen sich also folgendermaßen zusammenfassen:<br />
Teamkonflikte, hohe Fallbelastung und globale Erwartunghaltungen.<br />
86
6.2.4. Die Ebene des gesellschaftlichen Kontexts<br />
6.2.4.1. Migration und aufenhaltsrechtliche Fragen<br />
Als einer der schwerwiegendsten Belastungsfaktoren in der Behandlung von<br />
Folter- und Kriegsüberlebenden wurden aufenthaltsrechtliche Fragen als<br />
besondere Herausforderung der Migration benannt und beschrieben. Viele der<br />
Patientinnen in den untersuchten Einrichtungen haben einen unsicheren<br />
Aufenthaltsstatus und die ständig präsente Gefahr der Abschiebung, bzw.<br />
Ausschaffung macht die Therapiegestaltung im Einzelfall extrem schwierig.<br />
Mehrere Therapeutinnen beschrieben, dass dies häufig zu starken Gefühlen der<br />
Ohnmacht oder auch zu Ärger führt. Dazu eine Therapeutin:<br />
IP 4: und stand einfach vor dieser auswegslosen situation dass er ILLEGAL hier<br />
war äm * und das war eine sehr SCHWIERIGE therapie am anfang weil einfach<br />
DAS verständlicherweise das war sein THEMA hier nicht AKZEPTIERT zu sein<br />
immer sofort von der polizei gefangen werden zu können und das hat mich<br />
SELBER ja sehr auch BESCHÄFTIGT und HILFLOS gemacht und auch<br />
SCHWIERIG irgendwelche therapieziele zu definieren weil das thema ja DAS das<br />
dominante thema war und ich hab dann mit ihm sehr viel so<br />
ALLTAGSSTRUKTUR AKTIVITÄTEN geschaut was er machen kann aber das<br />
war alles nur auf schweizer deutsch sagt man so pflästerli pflaster draufkleben<br />
(IP 4:96).<br />
Dies kann zur Folge haben, dass Therapeutinnen, wenn sie nicht ohnehin mit der<br />
Erstellung von Gutachten oder dem Anstoßen von Rekursverfahren aktiv an den<br />
entsprechenden Verfahren beteiligt sind, sich über ihre reguläre Arbeitzeit hinaus<br />
im Kontakt mit Rechtsanwältinnen oder den Behörden direkt <strong>für</strong> ihre Patientinnen<br />
engagieren (IP 2:75-76). Nicht selten müssen die Therapeutinnen selbst<br />
juristische oder sozialarbeiterische Tätigkeiten übernehmen, um überhaupt eine<br />
Grundlage <strong>für</strong> die therapeutische Arbeit zu schaffen:<br />
IP 3: […] ich musste da dann auch mit den behörden vieles machen weil die ihm<br />
auch keinen AUSWEIS gegeben haben also große unsicherheit da hab ich dann<br />
wirklich auch GANZ KONKRETE juristische und sozialarbeiterische dinge<br />
übernommen ja um den aufenthalt zu klären um ihn zu entlassen dann um doch<br />
wieder die möglichkeiten ja unterSTÜTZUNGsmöglichkeiten zu aktivieren und ihn<br />
dann da REIN zu bringen wir sind so oft GESCHEITERT daran ja irgendwelche<br />
87
andern einzubeziehen und dann sind wir wieder so dagehockt alleine mit dieser<br />
ganzen massiven symptomatik und äh schwierigen situation und wir haben halt<br />
immer wieder versucht und immer also ein stetiger tropfen höhlt den stein kann<br />
man kann man sagen ja und da MITZUGEHEN das war einfach eine<br />
BELASTUNG ja<br />
JS: aber das heisst sie mussten eben aufgaben übernehmen um überhaupt<br />
erstmal RAHMENBEDINGUNGEN zu schaffen wo sie eigentlich ihre arbeit<br />
MACHEN können<br />
IP 3: JA GENAU JA macht klar ja genau kann man so sagen ja es war ein teil der<br />
arbeit dann ja (IP 3:215-217).<br />
6.2.4.2. Wenig gesellschaftlicher Rückhalt<br />
Folter- und Kriegsüberlebende, die als Migrantinnen mit unsicherem<br />
Aufenthaltsstatus im Aufnahmeland leben, stehen dort in vielerlei Hinsicht am<br />
Rande der Gesellschaft. Dies wirkt sich auch auf den Kontext der<br />
psychotherapeutischen Behandlung dieser Menschen aus. So wurde teils<br />
beschrieben, wie die Behandlungeinrichtung <strong>für</strong> manche Patientinnen die einzige<br />
Anlaufstelle war:<br />
IP 4: sie HAT einfach NIEMAND hier und irgendwie hat sich relativ rasch<br />
herausgestellt dass WIR so die einzige ANLAUFSTELLE <strong>für</strong> sie und ich<br />
ZUSAMMEN mit der ÜBERSETZERIN so eine art MUTTER und FREUNDIN äm<br />
* und dass es einfach EINE KRISE nach der ANDEREN gab und eine<br />
NOTSITUATION nach der anderen und sie irgendwie wir so irgendwie die<br />
einzigen @RETTER@ waren äh *3* und SUIZIDALITÄT immer wieder ein thema<br />
war äm GEWALT immer wieder ein thema war und es immer wieder sehr viel<br />
VERANTWORTUNG gab <strong>für</strong> MICH (IP 4:66).<br />
Dieser fehlende gesellschaftliche Rückhalt, von dem einige der Patientinnen<br />
betroffen sind, spiegelt sich auch auf institutioneller Ebene wider. So beschreibt<br />
eine Therapeutin in Bezug auf gewaltbereite Patientinnen, wie der institutionelle<br />
Rahmen, der hier Schutz und klare Regeln bieten könnte, im Kontext der Arbeit<br />
in ihrer Einrichtung fehlt:<br />
88
IP 3: wenn man in der psychiatrie in der forensik arbeitet dann hat man einen<br />
RIESEN apparat rundherum wenns um fremdgefährdung geht, wir arbeiten ja<br />
auch eigentlich mit mördern ja leute die auch andre leute umgebracht haben und<br />
haben aber die ganzen rahmenbedingungen nicht die die FORENSIK zum<br />
beispiel hat (IP 3:163).<br />
6.2.4.3. Aktualität von Kriegen und Konflikten<br />
Eine weitere Kategorie, die <strong>für</strong> besondere Belastungsfaktoren gelten kann, ließ<br />
sich ermitteln: die Aktualität von Kriegen und Konflikten. Drei der fünf<br />
Interviewpartnerinnen berichteten jeweils von einem Fall, wo ein aktueller Krieg<br />
oder Konflikt im Heimatland der Patientin die Therapie begleitete und dadurch<br />
eine besondere Belastung bedeutete. Der eine Aspekt ist dabei, dass aktuelle<br />
Konflikte durch Bilder in den Medien präsenter sind, und damit eine<br />
Distanzierung <strong>für</strong> die Therapeutinnen schwieriger wird. Die Geschichten, die<br />
Patientinnen aus ihren Heimatländern berichten, lassen vermuten, was <strong>für</strong><br />
schreckliches Leid in dem Kriegsland täglich weiteren Menschen widerfährt, was<br />
es den Therapeutinnen erschwert Abstand zu nehmen.<br />
Ein weiterer Aspekt ist, dass Patientinnen aus Heimatländern mit laufenden oder<br />
neu aufflammenden Konflikten möglicherweise unmittelbarer betroffen sind,<br />
Traumata akualisiert werden, oder Patientinnen in den Konflikt vor Ort aktuell<br />
weiter verwickelt sind, und damit eine therapeutische Bearbeitung ihrer Traumata<br />
erschwert wird. Eine Therapeutin berichtete von einem Patienten, der kurz vor<br />
dem Interview vermutlich in sein Heimatland zurückkehrte, um dort an aktuellen<br />
Kämpfen teilzunehmen:<br />
IP 5: und jetzt hab ich vor ein paar tagen eine mail bekommen wo er mir den<br />
nächsten termin abgesagt hat und er mir geschildert hat ja ich werde weit weg sein<br />
ich rufe an wenn ich wieder da bin und ich merk so ich nehme an er ist jetzt in den<br />
kampf gegangen ich WEIß es nicht äm und dass ich mir wirklich sorgen mache (IP<br />
5:192).<br />
Die ermittelten Kategorien von Belastungsfaktoren, die auf der Ebene des<br />
gesellschaftlichen Kontextes anzusiedeln sind, lauten nochmalig<br />
89
zusammengefasst: aufenthaltsrechtliche Fragen, schwacher gesellschaftlicher<br />
Rückhalt und aktuelle Konflikte.<br />
6.3. Ressourcen und protektive <strong>Faktoren</strong><br />
Auch die hier aufgeführten Ressourcen und protektiven <strong>Faktoren</strong> ergeben sich<br />
aus der Analyse der geführten Interviews. Sie gehen also auf die Aussagen der<br />
interviewten Therapeutinnen zurück. Insgesamt lassen sich die <strong>Faktoren</strong> auf vier<br />
verschiedenen Ebenen unterteilen: Ressourcen im Team, Ressourcen auf der<br />
persönlichen Ebene, in der Therapie und Ressourcen auf institutioneller bzw.<br />
arbeitsorganisatorischer Ebene.<br />
6.3.1. Ressourcen und protektive <strong>Faktoren</strong> im Team<br />
Alle Interviewpartnerinnen betonten die Wichtigkeit des Teams als zentrale, wenn<br />
nicht sogar die zentralste Ressource in ihrer Arbeit. Im Kapitel über<br />
Belastungsfaktoren wurde bereits erwähnt, wie unterstützend das Team<br />
wahrgenommen wird, wenn die Atmosphäre tatsächlich gut und wertschätzend<br />
ist, wie extrem belastend es aber auch sein kann, wenn es im Team zu Konflikten<br />
kommt. Zweiteres kann als Hinweis darauf verstanden werden wie zentral die<br />
Ressource Team tatsächlich ist, wenn es sich als so starker Verlust herausstellt,<br />
wenn diese Ressource wegfällt. Eine Therapeutin dazu:<br />
IP 2: ich glaub das TEAMKLIMA ist fast am allerzentralsten <strong>für</strong> mich,<br />
wahrscheinlich <strong>für</strong> die MEISTEN hier. das klima an sich und auch die art wie wir<br />
miteinander faktisch arbeiten fachlich arbeiten können aber VOR ALLEM das<br />
klima. * man muss es irgendwie ABSTÜTZEN können, was man macht, und das<br />
team ist * ich glaub wir alle sind uns am NÄCHSTEN so mit der arbeit. wir wissen<br />
genau was der andere MACHT und wie sich das ANFÜHLT und schon ein<br />
supervisor ist irgendwie weiter weg. von dem her würd ich sagen, ja das team ist<br />
das WICHTIGSTE, das was am MEISTEN BASIS bringen kann oder so<br />
UNTERSTÜTZUNG bringen kann, aber auch eben wenns SCHLECHT läuft<br />
EXTREM BELASTEND sein kann und die arbeit auch irgendwann<br />
verunmöglichen kann. und ich merk auch wenn es sachen gibt, die mich MEHR<br />
90
elasten, dann sinds MEISTENS so teamgeschichten nicht mal so sehr die<br />
patienten (IP 2:180).<br />
Dabei wird es von den interviewten Therapeutinnen sehr geschätzt, dass das<br />
Team einerseits formal eingerichtete Strukturen bereithält, die dazu dienen sie<br />
und ihre Arbeit zu unterstützen. Andererseits scheinen aber auch informelle<br />
Austauschmöglichkeiten innerhalb eines Teams eine enorme Wichtigkeit zu<br />
besitzen.<br />
6.3.1.1. Formale Strukturen („Gefäße“)<br />
In beiden Einrichtungen wurde von formal eingerichteten Strukturen berichtet, die<br />
von allen interviewten Therapeutinnen als absolut unabdingbar beschrieben<br />
haben. Dazu gibt es fünf verschiedene formale Plattformen, die unterschiedliche<br />
Funktionen erfüllen. In einer der beiden Einrichtungen haben alle<br />
Interviewpartnerinnen in diesem Zusammenhang von „Gefäßen“ gesprochen.<br />
Nachgefragt, woher diese Bezeichnung kam, konnte sich keiner erklären, wie<br />
sich dieser Begriff eingebürgert hatte, wohl aber, dass alle Mitarbeitenden in<br />
dieser Einrichtungen ihn benutzten. Der Begriff wurde hier übernommen, weil er<br />
bildhaft darstellt, welche Funktion die eingerichteten Strukturen haben: Sie stellen<br />
einen definierten Ort innerhalb der Arbeitsstrukturen dar, an dem <strong>für</strong> bestimmte<br />
Themen, Fragen und Schwierigkeiten Raum geschaffen wird.<br />
Zum einen gibt es die Intervision, die in einer der beiden Einrichtungen<br />
Fallplattform genannt wird. Hier geht es darum, im gesamten Team Patientinnen<br />
vorzustellen und zu diskutieren. Diese Plattform dient in erster Linie dem<br />
fachlichen Austausch und dem interdisziplinären Austausch innerhalb des<br />
Teams. Ein weiteres bei jeder Therapeutin genanntes wichtiges Gefäß ist die<br />
Fallsupervision. Dabei kommt auch das ganze Team zusammen, allerdings unter<br />
Anleitung eines externen Supervisors. Beide Gefäße werden als sehr hilfreich<br />
und als nicht aus der Arbeit wegzudenken erlebt. Vor allem der interdisziplinäre<br />
Charakter dieser Austauschforen scheint anregend zu sein, indem<br />
unterschiedliche Perspektiven dort zu Wort kommen können. Eine Therapeutin<br />
dazu:<br />
91
IP 1: die supervision hier wos um patientenzentrierte sachen geht die find ich<br />
eigentlich am besten * weil ich finds gut was sagt […] der supervisor was sagt<br />
ER und man kriegt aber auch gleichzeitig mit was sagt wie würds die kollegin<br />
machen oder wie sagts der xxx als chef oder was sagt er und was sagt die<br />
sozialarbeiterin wie son interdisziplinäres - * das hilft mir eigentlich am meisten *<br />
[…] viele unserer patienten haben wir ja auch interdisziplinär BETREUT also die<br />
meisten patienten die ich hab sind auch noch bei der sozialarbeiterin oder bei ihm<br />
beim sozialarbeiter oder in der physiotherapie oder irgendwie bei anderen sachen<br />
noch dabei und wie zeigt er sich denn DORT der patient, oft kommen dann da<br />
ganz andere sachen (IP 1:266).<br />
Diese beiden Gefäße sind zweifelsfrei die wichtigsten Foren, in denen sich die<br />
Therapeutinnen Unterstützung des Teams holen können, indem Erfahrungen<br />
ausgetauscht werden, fachliche Fragen und Unsicherheit geklärt werden können,<br />
aber auch der Informationsfluss unter den Therapeutinnen kontinuierlich<br />
aufrechterhalten wird, was im Einzelfall eine kurzfristigere Hilfestellung<br />
ermöglicht, ohne dabei die gesamte Patientengeschichte berichten zu müssen.<br />
Ein weiteres wichtiges Gefäß, das allerdings nur eine der beiden<br />
Behandlungseinrichtungen hat, sind die regelmäßigen bilateralen Gespräche<br />
zwischen einer einzelnen Therapeutin und der Einrichtungsleiterin. Diese dienen<br />
teilweise strukturellen Fragen, aber auch dem Austausch über einzelne<br />
Patientinnen oder der Absprache über jegliche aktuellen Belange der<br />
Therapeutin. Dieses Forum wird von einer Therapeutin als hilfreich beschrieben,<br />
die sich im gesamten Team den Raum <strong>für</strong> eigene Belange eher nicht nimmt:<br />
IP 4: was ich habe das sind regelmäßige gespräche mit meinem VORgesetzten<br />
und das hab ich auch schon öfter BENUTZT <strong>für</strong> das und das HILFT dann auch<br />
ich glaub ich funktioniere auch einfach so wenn ich dann weiß jetzt ist ZEIT da<strong>für</strong><br />
und und jetzt hab ich auch das RECHT dazu dann geht’s aber sonst äm hab ich<br />
mühe mir das einfach so zu nehmen (IP 4:132).<br />
Ein weiteres Forum, das in einer der beiden Einrichtungen relativ neu eingerichtet<br />
ist und in der zweiten Einrichtung noch diskutiert wird, die die Teamsupervision.<br />
Hier soll es um die Personen und die Belange des Teams gehen, ohne im<br />
Einzelnen Patientinnen zu besprechen. In der einen Einrichtung wird dieses<br />
Forum als nötig beschrieben, um alte Teamkonflikte zu bereinigen. In der<br />
92
anderen Einrichtung, wo die Teamsupervision unter Diskussion steht, wird<br />
berichtet, dass diese lange Zeit tabuisiert wurde, da es früher vor allem dort zum<br />
Ausbruch vorhandener Konflikte kam.<br />
Ein fünftes Forum, das allerdings die geringste Bedeutung <strong>für</strong> die Unterstützung<br />
der Therapeutinnen zu haben scheint ist das der Teamsitzung. Hier geht es in<br />
erster Linie um administrative Belange, aber auch um konzeptuelle oder<br />
strukturelle Fragen.<br />
6.3.1.2. Informeller Austausch<br />
Sehr viel ausführlicher wurde in den Interviews der informelle Austausch<br />
innerhalb des Teams beschrieben, was aber nichts über die Wertigkeit des<br />
formellen oder des informellen Austausches aussagt. Bei einigen Aussagen, die<br />
sich generell auf den Austausch im Team beziehen, ist dabei jedoch nicht<br />
deutlich ersichtlich, ob es sich dabei um formelle oder informelle Kommunikation<br />
handelt.<br />
Als informeller Austausch ist hierbei gemeint, dass man sich beispielsweise in<br />
der Kaffeepause kurz austauscht, oder an der Bürotür der Kollegin<br />
zwischendurch anklopfen und etwas erzählen kann, oder auch das gemeinsame<br />
Mittagessen, das Gelegenheit bietet, sich mitzuteilen. Die folgenden Zitate<br />
unterstreichen die Bedeutung dieser Kommunikation:<br />
IP 2: vor allem dieses schnell vorbeischauen oder zusammen mittagessen<br />
gehen, so dieses INFORMELLE, das find ich eigentlich viel wichtiger als das<br />
formale. das ist wahrscheinlich letztlich auch ne HALTUNGSFRAGE, die man<br />
schlecht irgendwie mit ner reglementierung hinkriegen kann (IP 2:182).<br />
IP 3: das ist schon so ein STIL hier man kann JEDERZEIT auch wenn mans<br />
braucht jemanden PACKEN und sagen ich muss jetzt da KURZ was besprechen<br />
ja das machen wir das funktioniert eigentlich in dem team in dem wir jetzt sind<br />
SEHR GUT […] ja dass man sich das HOLT dass man sich auch ZEIGT dass<br />
man äm dass auch mit eigentlich einer großen WERTSCHÄTZUNG miteinander<br />
umgegangen wird. ja und dass man auch mal etwas NICHT kann und dass man<br />
93
elastet ist oder dass man etwas NICHT versteht das liegt gut drin (IP 3:247-<br />
249).<br />
Eine Therapeutin beschreibt dabei, wie es manchmal darauf ankommt, spontan<br />
Unterstützung von Kolleginnen zu bekommen, wenn ein Problem nicht auf das<br />
formale Gefäß „warten“ kann:<br />
IP 5: was ich auch mache ist HIER mit kolleginnen und kollegen sprechen wenn<br />
ich merke es ist mir etwas zu nahe oder zu viel dass ich wirklich frage kann ich<br />
darf ich ABLADEN […] und auch die so die FIXEN gefäße die wir haben<br />
SUPERVISION oder FALLBESPRECHUNG die sind da<strong>für</strong> wichtig aber<br />
manchmal brauchts SCHNELLER was<br />
JS: mhm UNMITTELBAR<br />
IP 5: ja genau<br />
JS: ist das immer MÖGLICH das dann einzurichten?<br />
IP 5: ja bis jetzt schon mhm *4* weil es braucht auch NICHT VIEL manchmal ist<br />
es wirklich nur ZWEI DREI minuten so und ich glaub es geht oft auch so um<br />
EIGENE gefühle von ohnmacht oder UNSICHERHEIT oder irgendetwas was<br />
nicht gut EINzuordnen ist dass man oder was ich dann GENOMMEN habe aus<br />
der therapie so (IP 5:84-90).<br />
Andererseits gibt es hierzu auch eine Gegenposition, die diese Möglichkeit bei<br />
einer Therapeutin eher relativiert:<br />
IP 4: jederzeit zum kollegen gehen stimmt natürlich so jetzt nicht ganz *4* äh *2*<br />
also wir haben hier alle VIEL zu tun und MEISTENS sind alle BESETZT es ist<br />
nicht so also man KANN das aber man muss sich das sehr erKÄMPFEN und<br />
auch die GELEGENHEIT SUCHEN äm *3* und eben ich merke ich benutze diese<br />
gefäße sehr SUPERVISION und FALLPLATTFORM das ist auch hilfreich aber so<br />
dass persönliche gepräche mit kollegen wos jetzt NICHT darum geht was könnt<br />
ich noch machen hast du noch TIPPS oder so das mach ich schon aber wo es<br />
wirklich darum geht eine BELASTUNG zu besprechen ist <strong>für</strong> mich eher noch so<br />
ein TABU im sinne von die hören ja auch schon den ganzen tag diese<br />
geschichten also muss ich nicht auch noch kommen (IP 4:126).<br />
94
Diese letzte Aussage unterstreicht wohl, wie wichtig es ist, dass es neben dem<br />
guten Teamklima, in dem informelle Gespräche stattfinden können, auch die<br />
formalen Gefäße, wie sie genannt wurden, gibt.<br />
Ein weiterer Aspekt, der unter dem Zeichen der informellen Kommunkation auch<br />
genannt wird, ist der der gemeinsamen Pausen, in denen gezielt nicht über die<br />
Arbeit gesprochen wird und in denen Humor eine große Rolle spielt:<br />
IP 3: wir machen auch PAUSEN ja versuchen auch die auch wenn möglich<br />
ZUSAMMEN zu machen und dann auch über ganz andere dinge zu sprechen,<br />
HUMOR ist da wichtig das ist jetzt keine institution- das ist jetzt nicht<br />
institutionalisiert aber das ist so etwas wo wir MACHEN und wo wir wo wir<br />
versuchen ja wo wir da sind wir teilweise SEHR @regressiv@ SEHR blödeln wir<br />
halt umeinander irgendwo über IRGENDwas (IP 3:249).<br />
6.3.1.3. Funktionen des Teams<br />
Alle Therapeutinnen betonten die Wichtigkeit des Teams als Ressource, um mit<br />
den alltäglichen Belastungen ihrer Arbeit besser umgehen zu können. Genauer<br />
nachgefragt kristiallisieren sich die folgenden Funktionen, die das Team dabei<br />
erfüllt, heraus.<br />
Neben dem Austausch, bei dem andere Perspektiven zum Tragen kommen,<br />
scheint es eine zentrale Rolle zu spielen, Erfahrungen mitteilen zu können, um<br />
diese damit zu validieren und zu normalisieren. Es ist einleuchtend, dass<br />
Therapeutinnen, die täglich Patientinnengeschichten hören, die teilweise die<br />
Vorstellungskraft des „normalen Westeuropäers“ bei weitem übersteigen, sich mit<br />
anderen, die ähnliche Erfahrungen machen, abgleichen müssen, um diese<br />
Erfahrungen in die eigene Landkarte dessen, was auf dieser Welt alles möglich<br />
ist, einordnen und damit validieren zu können.<br />
Eine Therapeutin berichtet beispielsweise, wie wichtig es manchmal sei,<br />
Geschichten miteinander zu teilen, um sie schlichtweg vor sich selbst glaubhafter<br />
machen zu können:<br />
IP 5: ich glaub ich erzähl vor allem wies MIR gegangen ist es gibt zwei arten<br />
entweder erzähl ich wies mir GEGANGEN ist dass ich mich total MIES gefühlt<br />
95
hab oder welche variante von mies oder dann geht’s WIRKLICH um ein stück<br />
GESCHICHTE der patientinnen und patienten und dann geht’s mir darum zu<br />
sagen hey das ist UNGLAUBLICH was ich gehört habe kann ich dir das<br />
ERZÄHLEN *2* und es geht glaub ich auch da ich glaub auch das waren selten<br />
eigentlich FOLTERszenen zum beispiel sondern mehr wenn politische<br />
organisationen ihre MITGLIEDER gequält haben oder solche dinge wo ich denke<br />
dass ist wie wirklich UNGLAUBLICH ich kann das nicht FASSEN so solche<br />
DINGE und dass sie durch erzählen <strong>für</strong> mich auch mehr FASSBARER werden so<br />
also TEILEN und das nicht ALLEINE zu tragen wie wie äh manchmal geht auch<br />
gar nicht darum also FACHLICH was hätt ich anders tun können sondern wie ein<br />
ECHO das hab ich auch schon gehört oder eine bestätigung das ist wirklich<br />
SCHRECKLICH so (IP 5:94).<br />
Die gleiche Therapeutin betont auch wie wichtig es oft ist, Dinge wirklich zu<br />
benennen, um sie kontrollierbarer zu machen:<br />
IP 5: das ist dann DISTANZIERT das ist dann nicht mehr ein diffuses GEFÜHL<br />
das ich mit mir rumtrage ich denke das ist ja auch was das in der THERAPIE<br />
passiert sondern das ist etwas das ich BENENNEN kann, es ist dann ein TEIL<br />
vielleicht auch MEINER geschichte (…) aber den ich EINORDNEN kann und das<br />
ist nicht etwas das über mich VERFÜGT oder BESTIMMT oder MICH bestimmt<br />
ohne dass ich nicht genau weiss was es ist<br />
JS: also so was wie deine eigene symbolisierung um es einordnen zu können<br />
IP 5: mhm genau und KONTROLLE dadurch wieder, sonst hab ich ja keine wenn<br />
es mit mir TUT hab ich keine kontrolle dadurch dass ichs ausdrücken kann gibt’s<br />
mir wie KONTROLLE und damit DISTANZ zurück auch (IP 5:96-98).<br />
Ein weiteres Zitat unterstreicht, wie wesentlich es dabei ist, mit Menschen zu<br />
sprechen, die ähnliche Erfahrungen kennen, auch um sich Bestätigung darüber<br />
zu verschaffen, wie wichtig diese Arbeit ist:<br />
JS: ob es was bestimmtes gab, was dich unterstützt hat im umgang<br />
IP 2: mhm ja konkret könnte man sicher sagen das TEAM, dass man sich<br />
austauschen kann dass irgendwie alle wissen wovon man spricht und das ja aus<br />
EIGENER ERFAHRUNG kennen dass man sieht das ist nicht was was mit MIR<br />
zu tun hat sondern es geht ALLEN so also dass man das eben so<br />
96
NORMALISIERT und VALIDIERT, äm *3* umgekehrt ja auch die erkenntnis,<br />
dass das GUT ist was wir machen dass das SINN macht, was wir machen hier<br />
*2* gerade wenn man sieht was den leuten widerfahren ist, dass es ja auch<br />
darum geht so was wie n GEGENpol zu setzen auf ne art (IP 2:139-140).<br />
Eine andere Therapeutin betont, wie der Austausch mit den Kolleginnen dabei<br />
helfen kann, Haltungen zu entwickeln und Belastungen auch gemeinsam<br />
auszuhalten:<br />
IP 3: das TEAM ist wahnsinnig WICHTIG also immer wieder BESPRECHEN und<br />
BESPRECHEN und BESPRECHEN diese OHNMACHT TEILEN auch sich HILFE<br />
suchen AUSHALTEN ZUSAMMEN es NICHT ALLEINE zu machen darüber<br />
NACHDENKEN HALTUNGEN entwickeln und das geht ALLEINE SCHWIERIG ja<br />
man kanns bis zu einem gewissen grad alleine machen aber man braucht die<br />
anderen dazu (IP3:175).<br />
Dieses Zitat weist auf einen weiteren Aspekt hin, der in einigen Interviews<br />
erwähnt wurde. Die Unterstützung des Teams besteht zu großen Teilen auch<br />
darin, Verantwortung nicht alleine tragen zu müssen, schwierige Entscheidungen<br />
gemeinsam treffen zu können (wie etwa der Umgang mit einer gewaltbereiten<br />
Patientin), aber auch Belastungen nicht alleine tragen zu müssen.<br />
IP 3: was mir geholfen hat in dieser zeit ist dann der EINBEZUG von von<br />
KOLLEGEN SUPERVISION nochmal durchgehen ZUSAMMEN ÜBERLEGEN<br />
lassen wir ihn jetzt ziehen oder nicht werden wir aktiv oder nicht dass ichs nicht<br />
ALLEINE tragen musste ich denke das war wichtig in dieser situation (IP 3:151).<br />
Dies kann entweder durch Gespräche und gemeinsames Überlegen entstehen,<br />
oder tatsächlich dadurch, dass die Verantwortung und die Arbeit geteilt werden.<br />
Im folgenden Fall war die Aufteilung von Verantwortung und Belastung die<br />
Lösung, um aus einem recht krisenhaften Therapieverlauf herauszukommen, hier<br />
sogar mit der Besonderheit, dass die Verantwortung nicht nur innerhalb des<br />
Teams auf verschiedene Schultern verteilt wurde, sondern auch externe Akteure<br />
mitgetragen haben:<br />
IP 4: die lösung war dass wir sehr viel MEHR bezugspersonen noch in die<br />
therapie einbezogen haben und dass ICH die sitzungen SEHR strikter<br />
STRUKTURIERT habe und mir dann das auch die SICHERHEIT gab ne äm und<br />
97
dass alle hier vom TEAM wussten von ihr und wir manchmal das auch zu ZWEIT<br />
führten die gespräche äm BEISTANDschaft vom JUGENDAMT errichtet wurde<br />
so also verantwortung wurde AUFGETEILT und belastung auch GETEILT indem<br />
alle hier WUSSTEN und das auch mit mir TEILTEN so und das ist bis HEUTE<br />
also eben sie kommt immer noch HEUTE einmal die woche aber das ist keine<br />
BELASTUNG mehr das hat sich GUT so LÖSEN können so (IP 4:72).<br />
Speziell in Bezug auf die Supervision wurde berichtet, dass sie hilft den „Rücken<br />
zu stärken“ (IP 3:159) und dabei Unterstützung bietet, mit der Distanz eines<br />
außenstehenden Beobachters besser zu verstehen, was in der Interaktion mit<br />
den Patientinnen geschieht. Eine Therapeutin unterscheidet daher die Funktion<br />
des Teams, in dem vor allem gemeinsam getragen und Verantwortung aufgeteilt<br />
wird, von der Funktion der Supervision, wo es stärker darum geht, gemeinsam<br />
mit einer externen Position zu verstehen:<br />
IP 3: GESPRÄCH MIT KOLLEGEN SUPERVISION […] zum EINEN<br />
VERANTWORTUNGSAUFTEILUNG das ist dann HIER ja das macht dann nicht<br />
die supervisorin und die supervision da geht’s dann mehr um ein VERSTEHEN<br />
von dem was da gewesen ist und wie sich das entwickelt hat und wie ICH<br />
reagiert habe (IP 3:159).<br />
Abschließend lässt sich sagen, dass das Team als wichtige Ressource jedoch<br />
ein fragiles Gut ist und gepflegt werden muss. Das Zitat einer Therapeutin<br />
unterstreicht wie das unterstützende Klima auch in ein belastendes Klima<br />
umschlagen kann und stellt die Frage ob ein Team bei dieser Arbeit nicht auch<br />
Dynamiken ausgesetzt ist, die manchmal jenseits der Kontrolle der einzelnen<br />
Mitglieder eines Teams liegen:<br />
JS: wie erlebst du das?<br />
IP 4: [RÄUSPERN] sehr abhängig vom TEAM also im MOMENT erleb ich das<br />
GUT und sehr HILFREICH und auch dass die quantität ist gut und ausreichend<br />
es gab aber auch schon zeiten wo einfach im team viel KONFLIKTE waren und<br />
SCHWIERIGE STIMMUNG und dann ist das AUCH nicht mehr hilfreich. also es<br />
hängt auch sehr vom KLIMA ab würd ich sagen […] und ich WÜNSCHE mir<br />
natürlich jetzt dass das da gibt’s ja auch viele STUDIEN und BERICHTE die die<br />
wirkung dieser arbeit auf ein TEAM beschreiben jetzt im moment ist es gut aber<br />
ich weiss auch nicht ob wir davor GEFEIT sind dass das so BLEIBT weil wegen<br />
98
dieser schwierigen ARBEIT ich wünsch es mir natürlich weil eben DANN ist es<br />
hilfreich [IP 4:124).<br />
6.3.2. Ressourcen und protektive <strong>Faktoren</strong> auf der persönlichen<br />
Ebene<br />
6.3.2.1. Stabiles und ausgefülltes Privatleben<br />
Alle Therapeutinnen betonten, dass es wichtig sei ein stabiles und ausgefülltes<br />
Privatleben zu haben, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen wird es<br />
als „Paralleluniversum“ (IP 2:46) bezeichnet, das insofern hilfreich sei, als es eine<br />
andere Referenz anbietet, als die schwierigen Lebenskontexte, mit denen es die<br />
Therapeutinnen durch ihre Patientinnen täglich zu tun haben. Eine Therapeutin<br />
beschreibt dies lebendig:<br />
IP 2: ich hab ne FAMILIE zu hause mit zwei kindern und äh das ist wie so ne art<br />
paralleluniversum, es ist irgendwie es ist natürlich nicht die heile welt aber es ist<br />
irgendwie VERGLEICHSWEISE ne heile welt, äh da geht’s dann eher drum,<br />
welcher lehrer jetzt grad BLÖD ist und welche freundin jetzt grad COOL ist und<br />
solche sachen das zwingt einen total wieder irgendwie zu unterscheiden<br />
zwischen BEIDEN realitäten. das rückt einem den kopf wieder zurecht das ist <strong>für</strong><br />
mich wahrscheinlich das allerwichtigste. einfach ein ANDERER maßstab ne<br />
ANDERE referenz die man dann anlegen kann (IP 2:46).<br />
Eine ähnliche Funktion mit einer etwas anderen Einfärbung nennt eine weitere<br />
Therapeutin, indem sie betont, wie wichtig es sei, Kontakt mit Menschen zu<br />
haben, die dem Themenkomplex der Therapie mit Kriegs- und<br />
Folterüberlebenden eher fern stehen. Sie beschreibt wie diese Kontakte dem<br />
Sog, den das Trauma mit sich bringt, und die Versuchung, immer mehr <strong>für</strong> die<br />
Menschen zu tun, die die Unterstützung so dringend brauchen, ent<strong>gegen</strong>wirkt:<br />
IP 3: was sicher wichtig ist auch das ist äm dass ich sehr darauf ACHT geben<br />
muss dass ich AUCH ja so so NORMALE LEBENSbereiche würd ich jetzt mal<br />
sagen habe also dass ich das was ich NICHT MÖCHTE und ist eben das hat ja<br />
auch damit zu tun dass man immer MEHR machen könnte dass man sich dann<br />
POLITISCH engagiert und dass man noch ÜBERstunden machen und dass man<br />
dann auch am wochenende noch und und und und und ja, sondern dass man<br />
sich auch in GANZ geWÖHNlichen lebensbereichen bewegt ja, und dass man<br />
99
auch LUST dabei hat dass man auch ne FREUDE dabei hat, beZIEHUNGEN<br />
führt mit leuten die mit diesem ganzen thema nix am hut haben ja wo man<br />
einfach auch HERAUS kommt aus dem ganzen wieder ja ich denke das ist das<br />
ist und da da muss ich auch darauf ACHTEN weil es hat schon einen gewissen<br />
SOG […] dass man dann in dem so DRINNEN steckt und dann geht man halt<br />
noch auch noch auf die DEMO mit und dann macht man DA noch was und dann<br />
sagt zu DEM noch zu und dann REDET man darüber DAS das geht NICHT<br />
irgendwo (IP 3: 101-103).<br />
Dies scheint vor allem wichtig, um der in Kapitel 6.2.2.2 beschriebenen<br />
Entfremdung von den eigenen kulturellen Referenzen ent<strong>gegen</strong> zu wirken. Eine<br />
weitere Funktion liegt in der Stabilisierung der eigenen Person. Die eigene<br />
Stabilität, die fest in tragfähigen Beziehungen eingebettet ist, wurde von allen<br />
Therapeutinnen als unabdingbare Voraussetzung <strong>für</strong> diese Arbeit beschrieben.<br />
Eine Therapeutin formuliert das aus der anderen Richtung her so:<br />
IP 5: ich glaube lange jetzt zum beispiel lange liebeskummer haben und diese<br />
arbeit machen und sonst nicht viel zur freude eben so dieses depressive<br />
verhängen das würde SCHLECHT funktionieren (IP 5:284).<br />
Weitere selbsterklärende Einfachnennungen <strong>für</strong> Ressourcen aus dem privaten<br />
Bereich waren wichtige positive Lebensereignisse wie etwa die Geburt eines<br />
eigenen Kindes (IP 1:92-94) oder ganz allgemein viel Freude im eigenen Leben<br />
als Gegengewicht zu dem Schweren, das die Arbeit manchmal darstellt (IP<br />
5:282).<br />
6.3.2.2. Bewusstheit <strong>für</strong> eigene innere Prozesse<br />
Eine weitere Ressource stellt die Fähigkeit dar, eigene innere Prozesse bewusst<br />
wahrzunehmen, und dabei Gefühle und Gedanken, die als Reaktion zu dem<br />
Therapiegeschehen entstehen, von eigenen Gefühlen gut unterscheiden zu<br />
können. Dabei geht es zum einen darum mit guter Selbstkenntnis Gefühle<br />
einzuordnen und zu sortieren, was vor allem im Umgang mit nicht integrierten<br />
psychischen Inhalten bei traumatisierten Patientinnen wichtig wird:<br />
IP 3: ich glaub auch zu diesen ganzen zu den fragen wie haltet man das aus also<br />
da ist natürlich ein GROSSER teil selbsterfahrung auch dabei […] ja und ich<br />
denke das ist schon ein wichtiger teil ja UM die arbeit dann auch machen zu<br />
100
können ja dieser die wahrnehmung von sich den eigenaffekten das doch<br />
zumindest TEILweise reflektieren zu können weil ich das bei diesen patienten<br />
sehr merke dass da viel grad wenn die dinge so ni- diese TRAUMATISCHEN<br />
erfahrungen so mm ja so SCHWIERIG INTEGRIERBAR sind oder ÜBERHAUPT<br />
NICHT integriert sind ja dann * is es auch sehr schwierig da<strong>für</strong> worte zu finden<br />
sowohl <strong>für</strong> die patienten aber AUCH äh als therapeut und TROTZDEM entstehen<br />
gewisse übertragungen äm bekommt dinge ab irgendwo und dass man mit denen<br />
irgendwo auch lernt umzugehen DA denk ich hilft so ne doch AUSFÜHRLICHE<br />
selbsterfahrung doch ganz gut ja das ist denk ich doch eine von den wichtigen<br />
pfeilern davon (IP 3:21-23).<br />
Dies kann umso wichtiger sein, wenn es darum geht, bestimmte Warnsignale zu<br />
erkennen. Zum anderen geht es um die wichtige Fähigkeit, eigene Grenzen zu<br />
erkennen und diese zu respektieren. Vor allem eine Therapeutin hat diese<br />
Fähigkeit ausführlich beschrieben:<br />
IP 3: ja auch immer wieder ist auch WAHRzunehmen weil das natürlich auch eine<br />
dynamik ist mit DIESEN patienten dass man IMMER MEHR machen könnte es<br />
ist eigentlich NIE genug und das heisst man muss irgendwo auch die grenze<br />
ziehen können und dann mal sagen da ist einfach JETZT die GRENZE und DIE<br />
ist ja auch flexibel die kann einmal mehr sein einmal weniger sein aber es muss<br />
einem auch BEWUSST sein dass es eine grenze gibt. Ne dass man äh ja DAS<br />
machen kann was man machen kann aber das ist begrenzt dass man nicht in so<br />
ALLMACHTsphantasien auch hineingerät oder in rettungsphantasien ich denke<br />
das sind das sind immer ALARMzeichen wenn so RETTUNGsphantasien in<br />
einem auftauchen ja dass man da schon ein bisschen zu WEIT gegangen ist (IP<br />
3:87).<br />
Für diese Fähigkeit sind eine ausführliche Selbsterfahrung sowie eine fundierte,<br />
gute therapeutische Ausbildung unerlässlich.<br />
6.3.2.3. Distanzierungsfähigkeit von Bildern<br />
Eine Fähigkeit, die drei der fünf interviewten Therapeutinnen als wichtigen<br />
Schutzmechanismus benannt haben, ist die, sich von den in der Therapie<br />
geschilderten Szenen keine Bilder zu machen, da diese stark im eigenen<br />
101
psychischen System wirken und schwerer kontrollierbar sind als abstrakte<br />
Informationen:<br />
Oder:<br />
IP 3: und äm dass ich mir keine bilder mache von den dingen die passieren weil<br />
die BILDER noch schwieriger um weil die leben dann in einem das weiss man ja<br />
auch NEURObiologisch inzwischen dass äm bilder eine entsprechende wirkung<br />
haben äm und die auch schwierig sind dann wieder wegzubekommen also da<br />
ACHT ich ganz bewusst darauf dass ich das NICHT laufen lasse und dass ich<br />
nicht so HINEINfalle in das ganze ja und halte distanz (IP 3:31).<br />
IP 5: da DISTANZIERE ich mich eigentlich schon während des zuhörens indem<br />
ich mir keine BILDER zu machen versuche also wirklich aktiv also die so GANZ<br />
DISTANZIERT mache auch nur<br />
JS: hast du da spezielle TECHNIKEN entwickelt wie du dich distanzieren kannst?<br />
IP 5: mhm * ich denke das eine ist wirklich dass ich mir VERBIETE mir bilder zu<br />
machen wirklich GANZ AKTIV oder wenn dann irgendwie schwarz-weiß so ich<br />
ich seh das wirklich so auf der SEITE wenn mir leute szenen schildern dass ich<br />
das äh * und das hilft mir nicht gefühlsmäßig total involviert zu werden (IP 5:76-<br />
78).<br />
Dazu gehört <strong>für</strong> einige Therapeutinnen, dass sie sich keine visuellen<br />
Nachrichtensendungen anschauen, sondern Nachrichten nur lesen, um informiert<br />
zu sein, aber ohne dabei visuelles Bildmaterial in ihre Vorstellungen<br />
aufzunehmen:<br />
IP 3: VERMEIDE auch dann BILDER im FERNSEHEN oder INTERNET mir<br />
anzuschauen VIDEOS zu irgendwelchen geschichten oder JETZT so wenn man<br />
so sieht was in einem bestimmten land passiert und man hat patienten aus dem<br />
land die ERZÄHLEN einem das und da kann man im internet ganz vieles sehen<br />
und das MACH ich NICHT also ich LESE nachrichten aber ich SCHAUE nicht so<br />
also das ist so etwas wo wo hilft ja kognitiv isses einfach n bisschen distanzierter<br />
als wenn die bilder so nahe kommen (IP 3:39).<br />
102
6.3.2.4. Bewegung<br />
Ein sehr wichtiges Medium, um die Belastungspotentiale der therapeutischen<br />
Arbeit mit Folter- und Kriegsüberlebenden abzumildern, ist <strong>für</strong> vier der fünf<br />
Interviewpartnerinnen die eigene Bewegung und der Sport. Eine Therapeutin<br />
beschreibt anschaulich wie und warum der Sport <strong>für</strong> sie in der Bewältigung ihrer<br />
Arbeit zentral ist:<br />
IP 3: also ich bin bei dieser arbeit VIEL MEHR darauf angewiesen dass ich<br />
regelmäßigen sport mache dass ich schwimmen gehe ich bei mir ist es das<br />
schwimmen vor allem teilweise auch das LAUFEN ja schwimmen hat auch eine<br />
gewisse SYMBOLIK in dem ganzen da wird man so GETRAGEN und ist<br />
REINIGEND und so irgendwie da kann man sich das kann man noch so wenn<br />
man [LACHT KURZ] wenn man kann ja auch die therapietechniken bei sich<br />
anwenden das das ist ja eine form von einer IMAGINATION auch wie man dinge<br />
wieder LOSbekommt irgendwo aber es muss KÖRPERLICH sein, das ist so<br />
etwas wo ANDERS ist als äm bei den arbeitsstellen zuvor (IP 3:95).<br />
Diese Therapeutin betont diesen Aspekt vor allem in Bezug auf die vielen nicht<br />
integrierten psychischen Inhalte ihrer Patientinnen, die sich bei ihr stark<br />
körperlich niederschlagen.<br />
6.3.2.5. Raum <strong>für</strong> Selbstpflege<br />
Eine wichtige Ressource zum Erhalt des Selbstschutzes ist es, im Alltag<br />
genügend Raum <strong>für</strong> die Selbstpflege zu haben. Wie diese Selbstpflege im<br />
Einzelfall aussieht, ist sehr individuell. Ein solches Element kann der schon<br />
beschriebene Sport sein, <strong>für</strong> andere ist es wichtig auch neben der Familie ab und<br />
zu etwas Zeit <strong>für</strong> sich zu haben oder genügend Ruhephasen in den Alltag<br />
einzubauen. Andere gehen aktiv einer Meditations- bzw. Achtsamkeitspraxis<br />
nach, um sich selbst Räume zur inneren Reinigung und Selbstpflege zu<br />
erschließen. Hier scheinen die Therapeutinnen sehr kreativ und erfinderisch zu<br />
sein, um Strategien der Erholung und Entspannung je nach eigenen Vorlieben<br />
und Gewohnheiten zu entwickeln.<br />
103
6.3.2.6. Reflexionsräume<br />
Für drei der fünf Interviewpartnerinnen war es wichtig zu erwähnen, dass sie sich<br />
eigene Reflexionsräume schaffen, um <strong>für</strong> sich Umgang mit einigen<br />
Belastungsfaktoren zu finden. Eine Therapeutin sprach von privat organisierter<br />
Einzel-Supervision, die <strong>für</strong> sie sehr hilfreich sei, um über die<br />
Gruppensupervisionssitzungen hinaus einen Raum zu haben, in dem sie<br />
Unterstützung <strong>für</strong> ihre Arbeit erhält. Eine andere Therapeutin hat weiterhin<br />
regelmäßige Sitzungen in Eigentherapie, um eine äußere Stütze und einen<br />
zuverlässigen äußeren Beobachter <strong>für</strong> die eigenen inneren Prozesse zu haben.<br />
Ein anderer Pfeiler dieser Reflexionsräume ist die philosophische<br />
Auseinandersetzung mit Fragen, die diese spezifische Arbeit provoziert:<br />
IP 5: ich glaub überhaupt dieser ganze äm nicht in einem RELIGIÖSEN sinn aber<br />
ja mehr so einem PHILOSOPHISCHEN sinn vielleicht umgang mit LEIDEN oder<br />
so das ist <strong>für</strong> mich wichtig auch so als ZUFLUCHT eben manchmal (IP 5:282).<br />
Oder die eigene Beschäftigung mit Themen wie Rache oder Versöhnung wie bei<br />
dieser Therapeutin:<br />
IP 3: ich hab mich mehr mit diesen andern THEMEN auch begonnen<br />
auseinanderzusetzen also dem thema der RACHE äm was das eigentlich heisst<br />
RACHE NEHMEN * VERSÖHNUNG auf der andern seite wann kann man sich<br />
überhaupt versöhnen das ist eine position der STÄRKE rache ist eher eine<br />
position der SCHWÄCHE meiner meinung nach und wie kann man von der rache<br />
zur VERSÖHNUNG hinkommen (IP 3:168).<br />
6.3.2.7. Persönliche Eigenschaften<br />
Ein Aspekt, der in den geführten Interviews kaum zur Sprache kam, der hier aber<br />
erwähnt sein sollte, ist der der persönlichen Eigenschaften. Es ist wohl<br />
unbestreitbar, dass es bestimmte persönliche Eigenschaften braucht, um eine<br />
solche Arbeit leisten zu können. So betont eine Therapeutin die eigene<br />
Stresstoleranz, Ausgeglichenheit und Gelassenheit als wichtige Ressourcen <strong>für</strong><br />
die Arbeit (IP 2:194). Eine andere Therapeutin beschreibt sich eher als sehr<br />
neugierig, was ihr <strong>für</strong> diese Arbeit unabkömmlich erscheint, um sich auf die<br />
104
Begegnung mit verschiedensten dunklen Seiten der menschlichen Seele<br />
einzulassen.<br />
Ein weiterer Aspekt, aus dem Kraft <strong>für</strong> die teils schwierige Arbeit mit Folter- und<br />
Kriegsüberlebenden geschöpft werden kann, ist in der Arbeit einen hohen<br />
ideellen Wert zu sehen. Ohne einen gewissen Idealismus ist es wohl kaum<br />
möglich sich auf eine solche Arbeit einzulassen. Eine Therapeutin dazu:<br />
IP 2: ich kann sie glaub ich NUR machen, weil ich das <strong>für</strong> ne SEHR WICHTIGE<br />
ARBEIT halte, * ich glaub ohne das würds wirklich nicht gehen, einfach als<br />
ARBEIT glaub ich geht’s nicht wüsst ich jedenfalls nicht wie das gehen würde *<br />
einfach als job (IP 3:194).<br />
Ein Aspekt, der in den Interviews erstaunlich wenig zur Sprache kam, ist der der<br />
eigenen Traumata. Nur eine Therapeutin hat darüber eine Aussage getroffen,<br />
indem sie als es wichtige Ressource benannt hat, keine eigenen traumatischen<br />
Erfahrungen gemacht zu haben, die durch die Arbeit möglicherweise reaktiviert<br />
werden (IP 3:25). Es gibt in der Fachliteratur ambivalente Haltungen dazu. Die<br />
einen halten eigene traumatische Erfahrungen <strong>für</strong> eine Gefahr. Andere sehen<br />
darin eine wichtige Ressource, weil die Überwindung eigener <strong>Traumatisierung</strong>en<br />
als Erfahrungsschatz begriffen wird, auf den die Therapeutin in dieser<br />
schwierigen Bewältigungsarbeit ihrer Patientinnen zurückgreifen kann. Davon<br />
profitieren sowohl die Patientinnen, wie aber auch die Therapeutinnen selbst, um<br />
mit den sekundären traumatischen Belastungen umgehen zu können. Einigkeit<br />
scheint es darüber zu geben, dass eigene Traumata nur dann eine Ressource<br />
darstellen, wenn diese gut durchgearbeitet und in das eigene biographische<br />
Skript überführt und integriert sind. Dies ist jedoch ein ganzer eigener<br />
Forschungszweig, der in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt wird (siehe dazu<br />
u.a. Pross 2009; Figley 1995).<br />
6.3.3. <strong>Protektive</strong> <strong>Faktoren</strong> in der Therapie<br />
Vergleichweise wenige Aussagen haben die interviewten Therapeutinnen über<br />
Ressourcen in der eigentlichen Therapiegestaltung getroffen. Sehr viel mehr<br />
protektive <strong>Faktoren</strong> wurden genannt, die auf den anderen drei Ebenen liegen:<br />
105
dem Team, den persönlichen Ressourcen und der arbeitsorganisatorischen<br />
Ebene.<br />
Dennoch gab es einige Beschreibungen, was in der konkreten Therapiesituation<br />
geholfen hat, um schwerwiegende Belastungen abzuwenden. So war es <strong>für</strong> eine<br />
Therapeutin eine Entlastung mit einer Patientin, die regelmäßig Waffen mit in die<br />
Therapie brachte, hier<strong>für</strong> eine klare Regel aufzustellen. Sie hat die Präsenz von<br />
Waffen im Therapieraum verboten und damit den therapeutischen Raum, aber<br />
auch sich selbst, geschützt (IP 1:176).<br />
Für eine andere Therapeutin war es sehr bedeutsam zu Beginn der Therapie die<br />
Auftragsklärung sehr ernst zu nehmen, um keine unrealistischen Erwartungen zu<br />
wecken. Dies kann als Prävention gesehen werden, um potentiell belastende<br />
Situationen durch Abklärungen im Vorfeld zu vermeiden:<br />
IP 3: […] dass ich die auftragsklärung SEHR ERNST nehme sehr viel auch<br />
darüber dem patienten ERZÄHLE WAS ich HIER eigentlich mache WAS ich<br />
anbieten kann was ich aber eben auch NICHT anbieten kann dass ich die<br />
ERWARTUNGEN der pat- der leute an uns auch sehr DEUTLICH kläre […] und<br />
wenn sich dann auch zeigt dass es ÜBERHAUPT keine schnittmenge gibt<br />
zwischen den ERWARTUNGEN des patienten und dem was WIR BIETEN<br />
können dass wir das dann auch zu beginn dann einfach klären und sagen dann<br />
sind WIR nicht die richtigen also dass wir auch DAZU dass wir das AUCH können<br />
dass wir auch patienten ABLEHNEN können dass wir nicht alles auch<br />
übernehmen müssen weil sie so viel LEID erlitten haben (IP 3:171).<br />
Eine andere Therapeutin berichtete, wie es gerade in schwierigen<br />
Therapieverläufen wichtig sei, eine starke Struktur in die Therapie<br />
hereinzubringen, sich aber auch die Erlaubnis zu erteilen, in unkonventionellen<br />
Situationen unkonventionelle therapeutische Wege zu gehen, die den<br />
Extremsituationen, in denen sich manche der Patientinnen befinden, eher<br />
entsprechen (IP 4:72; 102).<br />
Wieder eine andere Therapeutin machte eine sehr positive Erfahrung damit, ihre<br />
eigene Belastung durch die Exposition mit extrem traumatischem Material mit der<br />
Patientin zu besprechen und damit offen zu legen:<br />
106
IP 5: und das interessante war ich hab die person dann schon vorher mal noch<br />
ein zweites mal gesehen und da hat sich ganz viel aufgelöst also bei mir auch<br />
schon aber auch bei der person die in therapie kommt * das war EXTREM<br />
INTERESSANT zu sehen dass durch das ansprechen und andere dinge die wir<br />
dann gemacht haben dass sich das aufgelöst hat (IP 5:134).<br />
Diese Möglichkeit des Umgangs mit schwierigen Traumaexpositionen wird unter<br />
anderen bei Lemke (2006) unter dem Stichwort der „self-disclosure“ ausführlich<br />
diskutiert. Die genannten Strategien scheinen sehr individuell und sowohl von<br />
den Therapeutinnen als auch von dem konkreten Therapieverlauf abhängig zu<br />
sein. Es hat auf dieser Ebene keine Mehrfachnennungen gegeben.<br />
6.3.4. Die institutionelle und arbeitsorganisatorische Ebene<br />
6.3.4.1. Zeitliche Begrenzung der Arbeit<br />
Weitere protektive <strong>Faktoren</strong> sind auf der institutionellen und<br />
arbeitsorganisatorischen Ebene angesiedelt. Ein Element, das dabei deutlich<br />
durch Nennung aller Interviewpartnerinnen hervorsticht, ist das der zeitlichen<br />
Begrenzung der direkten Patientinnenarbeit. Von den interviewten<br />
Therapeutinnen arbeiten drei in Teilzeit (50 – 60 %), zwei Therapeutinnen, die<br />
gleichzeitig Einrichtungsleiterinnen sind, arbeiten zwar in Vollzeit, haben aber<br />
jeweils nur ca. 50% Patientinnenkontakt. Alle halten diese Einschränkung <strong>für</strong><br />
zentral, um nicht sekundärtraumatische Reaktionen auf ihre Arbeit zu entwickeln.<br />
Eine Therapeutin dazu:<br />
IP 1: also ICH ich GLAUB ich könnts HUNDERT prozent NICHT machen also in<br />
ner vollzeitanstellung oder auch achtzig prozent oder hundert prozent full-time<br />
job in der einrichtung könnt ICH mir <strong>für</strong> MICH NICHT vorstellen weil ich glaub<br />
DANN hat mas problem dass mas * oder ich kann nur <strong>für</strong> mich reden aber DANN<br />
würd ichs wahrscheinlich auch mit NACH HAUSE nehmen […] da kommen viele<br />
emotionen man isch keine MASCHINE man isch kein ROBOTER also ich mein<br />
dat KOMMT AN und aber ich hab <strong>für</strong> MICH s gefühl ich kanns insofern ganz gut<br />
filtern dass ich sag hier mein JOB und hier is meine FAMILIE oder s<br />
PRIVATLEBEN des gelingt mit diesem TEILZEITMODUS (IP 1:64).<br />
107
Für die Therapeutinnen, die Kinder haben, war die Familie ein wichtiges<br />
Gegengewicht zur Arbeit. Für eine Therapeutin, die keine Kinder hat, war es<br />
entscheidend, dennoch ihre Arbeitszeit zum Abend hin bewusst klar zu<br />
begrenzen, um nicht viele Überstunden zu machen. Sie betonte wie wichtig es<br />
dabei ist, sich bewusst eine Grenze zu setzen, wann abends die Arbeitszeit<br />
vorbei ist:<br />
IP 3: ich muss es ist schon ein innerer prozess ja auch diese grenze finden ich<br />
denke also das ist etwas was ich so am meisten merke dass dass man nicht<br />
wirklich in der arbeit bleibt und dann bis acht neun am abend dann arbeitet ja äh<br />
ich habe KEINE KINDER, das wäre wahrscheinlich HILFreich weil dann muss<br />
man gehen muss man dort sein und so weiter da kann man die GRENZE dann<br />
veschieben DA muss ich da muss ich KLAR sein und ja da das das HILFT dann<br />
zum beispiel TERMINE auszumachen ja äm am abend und dann ist auch eine<br />
beGRENZung da ja dass mans sich dass ichs mir nicht OFFENhalte also sowohl<br />
ÄUSSERE dinge aber auch INNERE dinge das MERKEN aber dann auch weil<br />
man kann ja nicht die ganze zeit das erSPÜREN immer wieder also auch wirklich<br />
so dass zu MARKIEREN da ist dann FERTIG und da beginnt dann das<br />
FREIZEITleben und das ist ein ANDERES ne mit ANDEREN inhalten (IP 3:125).<br />
Eine andere Art der zeitlichen Begrenzung, die einige der Interviewpartnerinnen<br />
erwähnt haben, ist die, dass sie diese Art therapeutischer Arbeit nur eine<br />
bestimmte Anzahl von Jahren machen möchten, um zu verhindern, dass sie<br />
sekundärtraumatische Reaktionen entwickeln. Eine Therapeutin dazu:<br />
IP 4: ich hab aber AUCH noch eine ANDRE meinung dass ich auch denke NOCH<br />
SO VIELE STRATEGIEN und NOCH SO VIELE eben WEITERBILDUNGEN und<br />
alles was man macht kann man einen kann eigentlich nicht VERHINDERN dass<br />
das TROTZDEM PASSIERT also ich hab <strong>für</strong> mich selber zum beispiel hab mir<br />
FEST vorgenommen also ich mach das NICHT länger als ZEHN jahre (IP 4:26).<br />
Oder eine andere Therapeutin:<br />
JS: würdest du sagen dein weltbild hat sich VERÄNDERT durch die arbeit hier?<br />
IP 5: ich glaub nicht dass es sich GRUNDSÄTZLICH verändert hat aber es ist so<br />
wie der FOKUS ist ein bisschen mehr auf der seite wos auch SADISMUS und<br />
und viel SCHMERZEN und viel GEWALT gibt, das war immer DA aber das ist so<br />
wie äh eine andere GEWICHTUNG im moment […] aber ich hoffe nicht und ich<br />
108
MÖCHTE auch nicht dass das immer so bleibt also ich werde nicht ZWANZIG<br />
jahre hier arbeiten (IP 5:103-106).<br />
6.3.4.2. Begrenzung der Fallbelastung<br />
Andere Arten der Begrenzung der Fallbelastung als die zeitliche Einschränkung<br />
sind eher auf institutioneller Ebene angesiedelt. So liegt das Soll <strong>für</strong> die<br />
angestellten Therapeutinnen bei ca. 3,5 Patientinnen am Tag, was bei anderen<br />
therapeutischen Einrichtungen in der Regel mehr ist (IP 5:238). Die Begrenzung<br />
der Fallbelastung beinhaltet auch, dass sich die Organisation vorenthält,<br />
Patientinnen auch abzulehnen, sollte sich nach eingehender Abklärung der<br />
Erwartungen und des Auftrages herausstellen, dass die Schnittmenge zwischen<br />
Erwartung der Patientin und dem, was die Einrichtung anbieten kann, gering ist<br />
(IP 3:171). Dazu gehört auch, dass mit wachsender Erfahrung durch gründliche<br />
Vorabklärungen abgeschätzt werden kann, ob eine Patientin mit den Kapazitäten<br />
der Einrichtung so versorgt werden kann, wie sie das benötigen würde. Eine<br />
Interviewpartnerin, die auch Einrichtungsleiterin ist, dazu:<br />
IP 3: das ist vielleicht auch ein TEIL der erfahrung dass man das im VORFELD<br />
abklären kann besser abschätzen kann und dann entsprechend der eigenen<br />
KAPAZITÄTEN dann auch ÜBERNIMMT oder eben auch NICHT ÜBERNIMMT ja<br />
ich denke das ist auch eine LEHRE aus dem ganzen und jetzt auch grad wenns<br />
um meine MITARBEITENDEN geht dass ich da auf diese dinge sehr schau […]<br />
was kommt da auf uns zu […] und was vertragen wir was vertragen wir NICHT<br />
[…] weil wenn man mal DRINsteckt dann steckt man DRIN (IP 3:219-225).<br />
Auch dass in der einen Einrichtung keine Warteliste <strong>für</strong> Patientinnen geführt wird<br />
ist eine Form, die Fallbelastung zu begrenzen.<br />
6.3.4.3. Ausgleiche schaffen<br />
Die Einrichtungsleiterinnen, die neben der Patientinnenarbeit noch einen großen<br />
Teil ihrer Arbeitszeit mit anderen Aufgaben verbringen, wie administrative<br />
Aufgaben, Leitungsaufgaben, sowie Öffentlichkeitsarbeit, Forschung und Lehre<br />
109
erwähnten, dass auch die Abwechslung im Aufgabenfeld <strong>gegen</strong>über der reinen<br />
therapeutischen Arbeit eine Entlastung mit sich bringe:<br />
IP 3: ich hab so fünfzig fünfzig circa jetzt ja, wie ich begonnen habe hab ich<br />
hundert prozent therapie gemacht und jetzt so seit knapp einem halben jahr<br />
mach ich ähm fünfzig prozent THERAPIE und fünfzig prozent<br />
LEITUNGsaufgaben so ist das aufgeteilt also das ist auch etwas was ganz also<br />
wo ich sehr gut finde <strong>für</strong> MICH jetzt die ABWECHSLUNG und die<br />
VIELFÄLTIGKEIT dadurch auch ähm auf der einen seite die THERAPIE auf der<br />
anderen seite leitungsarbeit TEAMarbeit auf der anderen seite auch noch<br />
öffentlichkeitsarbeit also das machts ein bisschen abwechslungsreich und ich<br />
denk diese abwechslung ist wichtig (IP 3:47).<br />
Auch andere Therapeutinnen, die außerhalb ihrer Teilzeittätigkeit in der<br />
Einrichtung anderen Aufgaben nachgehen, haben diese als Entlastung benannt.<br />
6.3.4.4. Klarer institutioneller Rahmen<br />
Ein wichtiges Element, das Schutz <strong>für</strong> die einzelnen Therapeutinnen bietet, ist<br />
der Rahmen in dem sie arbeiten. Eine Therapeutin beschreibt das treffend<br />
folgendermaßen:<br />
IP 5: das heisst <strong>für</strong> mich eigentlich dass die STRUKTUR und die LEITUNG sehr<br />
wichtig sind weil ich denke die macht ganz viel davon aus wie ein team<br />
funktionieren kann ich glaub nicht dass das die einzelnen beziehungen einfach so<br />
sind sondern sobald der rahmen STIMMT dann sind auch die BEZIEHUNGEN<br />
einfacher (IP 5:262).<br />
Eine andere Therapeutin beschreibt ausführlich wie ein klarer institutioneller<br />
Rahmen als wichtige „Leitplanke“ fungiert, um Aufgaben klar zu verteilen und<br />
klare Regeln aufzustellen, um so die Belastungen <strong>für</strong> die einzelnen<br />
Therapeutinnen möglichst gering zu halten:<br />
IP 3: und dann natürlich auch das INSTITUTIONELL KLÄREN also von vom von<br />
der institution her zu klären was MACHEN wir hier […] also dass das auch KLAR<br />
ist also dass das nicht eine BELIEBIGKEIT hat und JEDER macht so wie ers <strong>für</strong><br />
richtig haltet sondern äh die ENTSCHEIDUNG der institution wir sind eine<br />
THERAPEUTISCHE einrichtung und wir machen hier THERAPIE wir kämpfen<br />
110
nicht JURISTISCH oder äm auch zu klären was wir SOZIALARBEITERISCH<br />
übernehmen und was eben auch NICHT ja und dass das eben auch durch die<br />
INSTITUTION GEKLÄRT werden muss das denk ich das ist auch ein wichtiger<br />
schritt in dem ganzen gewesen wo die einrichtung ja auch jetzt so einen<br />
PROZESS durchgemacht hat ja da äh so eine PROFESSIONALISIERUNG […]<br />
äm von der STRUKTUR der einrichtung auch zu erarbeiten ich denke das ist<br />
etwas etwas was da auch sehr HILFREICH und ENTSCHEIDEND ist das kann<br />
man dann nicht nur alleine machen da braucht man auch ja n KLAREN RAHMEN<br />
auch von der institution […] der einem da auch ORIENTIERUNG gibt weil wenn<br />
man mit dem patienten schon DRIN ist dann man schon drin und dann kanns<br />
rasch AUSUFERN und da ist dann auch gut wenn man da wie LEITPLANKEN<br />
hat wo man sich bisschen orientieren kann und das muss die INSTITUTION ja *<br />
mhm und dass eben nicht ALLE ALLES machen sondern dass eben auch die<br />
AUFGABEN klar VERTEILT sind ich denke das ist etwas wo wir jetzt so äm am<br />
entwickeln sind und entwickelt haben so in den letzten ein zwei jahren zwei<br />
jahren drei jahren ja was auch ein schmerzhafter prozess <strong>für</strong> die einrichtung<br />
selber war aber ein NOTWENDIGER (IP 3:175-181).<br />
6.3.4.5. Einbeziehung anderer Institutionen<br />
Eine Entlastung und damit eine Ressource ist nach Berichten der<br />
Interviewpartnerinnen die Einbeziehung anderer Institutionen soweit dies möglich<br />
ist, auch wenn es selten zu solchen Kooperationen und damit einer Verteilung<br />
der Verantwortung kommt. Eine Therapeutin berichtete, wie es gelingen konnte,<br />
eine sehr krisenhafte Therapie zu deeskalieren, indem neben der Unterstützung<br />
im Team auch andere Institutionen, in diesem Fall das Jugendamt,<br />
hinzugezogen wurden:<br />
IP 4: alle hier vom TEAM wussten von ihr und wir manchmal das auch zu ZWEIT<br />
führten die gespräche äm BEISTANDschaft vom JUGENDAMT errichtet wurde<br />
so also verantwortung wurde AUFGETEILT und belastung auch GETEILT indem<br />
alle hier WUSSTEN und das auch mit mir TEILTEN so und das ist bis HEUTE<br />
also eben sie kommt immer noch HEUTE einmal die woche aber das ist keine<br />
BELASTUNG mehr das hat sich GUT so LÖSEN können so (IP 4:72).<br />
111
Dazu gehört eine Bemühung, die eher jüngeren Alters ist: die Vernetzung mit<br />
anderen Einrichtungen, national wie international etwa in europäischen<br />
Netzwerken, um so in einem Erfahrungsaustausch stehen zu können (IP 3:273).<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stabilität, die es den<br />
Therapeutinnen erlaubt ihre Arbeit zu machen, ohne Schaden davon zu nehmen,<br />
von einer Vielzahl von <strong>Faktoren</strong> abhängt. Eine Therapeutin beschreibt dies<br />
treffend:<br />
IP 2: ich glaube wenn es IRGENDWO fehlen würde würde es kippen ich glaube, *<br />
ich glaub, dass ich die arbeit mit den ressourcen die ich hab, so machen kann<br />
wie ich sie MÖCHTE, und wenn irgendeine von den ressourcen fehlen würde,<br />
dann müsste ich meine arbeit ANDERS machen, quantitativ, oder dann vielleicht<br />
auch irgendwann qualitativ.<br />
JS: kannst Du grad nochmal benennen was diese ressourcen sind?<br />
IP 2: zum beispiel ein SCHLECHTERES KLIMA im team oder MEHR DIENSTE<br />
beispielsweise oder SCHWIERIGE FAMILIÄRE SITUATION <strong>für</strong> MICH jetzt<br />
PERSÖNLICH oder MEHR ADMINISTRATIVE SCHWIERIGKEITEN -<br />
AUFENTHALTSRECHTLICHE oder SOZIALE, dienstlich oder was auch immer<br />
oder MEHR MISSTRAUEN, das mir <strong>gegen</strong>über gebracht wird *<br />
JS: von?<br />
IP 2: von den PATIENTEN, oder mehr schwierigkeiten mit den dolmetschenden,<br />
oder *2* ich glaub das was am schluss rauskommt, das ist so ne resultierende<br />
aus ganz vielen positiven und negativen einflüssen, und wenn IRGENDEINER<br />
von den einflüssen anders wäre, würde die resultierende anders dabei<br />
rauskommen, wobei das wahrscheinlich SCHON son bisschen sich <strong>gegen</strong>seitig<br />
noch kompensieren kann dass ist nicht son GANZ starres system (IP 2:174-178).<br />
112
7. Diskussion<br />
7.1. Zusammenfassung<br />
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung lassen sich wie folgt kurz<br />
zusammenfassen:<br />
Auf die Frage nach den Auswirkungen ihrer Arbeit berichteten alle interviewten<br />
Therapeutinnen sowohl von negativen als auch von positiven Auswirkungen. Die<br />
kurzfristigen Reaktionen lagen eher im negativen Bereich. So wurde<br />
beschrieben, wie das intensive Spüren von unmittelbarem und aktuellem Leid<br />
sehr belastend sein kann. Darüber hinaus wurde am häufigsten von Gefühlen der<br />
Ohnmacht und Hilflosigkeit berichtet, sowie von Trauer, Wut und dem Gefühl der<br />
Ungerechtigkeit. Bei den längerfristigen Reaktionen gab es Einzelnennungen wie<br />
somatische Reaktionen (Rückenschmerzen), wachsende Ängstlichkeit und ein<br />
Gefühl der Anstrengung und Erschöpfung. Außerdem berichten alle<br />
Interviewpartnerinnen, wie sich ihre politischen Einstellungen durch ihre Arbeit<br />
verändert haben. In erster Linie wurden dabei Wut und Ernüchterung in Bezug<br />
auf das Asylsystem im eigenen Land genannt, aber auch eine Radikalisierung in<br />
der Bewertung gewaltsamer Regime.<br />
An positiven Auswirkungen wurde an erster Stelle das Empfinden von<br />
Dankbarkeit genannt, und zwar die Dankbarkeit, selbst in einer helfenden<br />
Position sein zu können, und Menschen in Not etwas anbieten zu können,<br />
Dankbarkeit darüber, selbst in relativer Sicherheit, Wohlstand, Freiheit und<br />
Gesundheit leben zu dürfen, oder die Dankbarkeit <strong>für</strong> die Bereicherung durch die<br />
Arbeit mit und den Kontakt zu den Patientinnen. Eine weitere Auswirkung, die<br />
von den Interviewpartnerinnen als positiv berichtet wurde, war die bewusste<br />
Auseinandersetzung mit den sozialen und politischen Realitäten, die uns<br />
umgeben, was den Therapeutinnen zu einer vertieften Weltsicht verhilft.<br />
Was die Belastungsfaktoren betrifft, so wurden diese auf vier verschiedenen<br />
Ebenen angesiedelt: Die Ebenen der Patientinnen und der Therapeutinnen, die<br />
institutionelle bzw. arbeitsorganisatorische Ebene und die Ebene des<br />
gesellschaftlichen Kontextes. Auf Patientinnenebene wurden die Intensität des<br />
Traumas, nicht integrierte psychische Inhalte, Suizidalität, die Arbeit mit Tätern<br />
113
oder Täteranteilen, sowie die Arbeit mit Kindern als besonders belastend<br />
genannt. Auf Ebene der Therapeutinnen waren unmittelbare schwierige<br />
emotionale Reaktionen, wie etwa starke Wut oder Trauer, wie auch Gefühle von<br />
Ohnmacht und Hilflosigkeit als belastend beschrieben. Weiter wurde die<br />
Infragestellung der eigenen Normalität durch die Konfrontation mit extremen<br />
Kontrasten als destabilisierend beschrieben und Schwierigkeiten im<br />
Therapieverlauf als Belastungsfaktor genannt. Auf institutioneller und<br />
arbeitsorganisatorischer Ebene wurden in erster Linie Teamkonflikte als<br />
belastend beschrieben. Weiter wurden die hohe Fallbelastung sowie die diffusen<br />
und manchmal globalen Erwartungshaltungen, mit denen Patientinnen an die<br />
Behandlungseinrichtungen herantreten, als belastende <strong>Faktoren</strong><br />
herausgearbeitet. Auf einer gesellschaftlichen Ebene stehen<br />
aufenthaltsrechtliche Fragen an erster Stelle der Belastungsfaktoren. Darüber<br />
hinaus wurde der geringe gesellschaftliche Rückhalt <strong>für</strong> diese Arbeit als<br />
belastend beschrieben, sowie die Aktualität von Kriegen und Konflikten in den<br />
Herkunftsländern der Patientinnen.<br />
Auch die Ressourcen, bzw. protektiven <strong>Faktoren</strong> wurden in vier verschiedene<br />
Ebenen unterteilt: Das Team, die persönliche Ebene, die Therapie selbst, sowie<br />
Ressourcen auf institutioneller, bzw. arbeitsorganistorischer Ebene. Das Team<br />
wurde generell als sehr wichtige Ressourcen beschrieben. Dabei sind zunächst<br />
die formellen Strukturen zu nennen, wie Intervision, Fallsupervision,<br />
Teamsupervision, Teamsitzungen sowie bilaterale Gespräche zwischen den<br />
Therapeutinnen und ihren Vorgesetzten. Doch auch der informelle Austausch wie<br />
gemeinsame Pausen oder die spontane Unterstützung in Belastungssituationen<br />
wurde als Ressource beschrieben. Zentrale Funktionen des Teams liegen darin,<br />
die eigenen Erfahrungen mitteilen zu können und diese damit zu validieren und<br />
zu normalisieren. Der Austausch im Team kann dabei helfen, Dinge zu<br />
benennen, um sie kontrollierbarer zu machen. Nicht zuletzt ist das Team eine<br />
wichtige Ressource, um Belastungen gemeinsam auszuhalten und<br />
Verantwortung untereinander zu teilen. Auf der persönlichen Ebene wird vor<br />
allem ein stabiles ausgefülltes Privatleben als Ressource beschrieben. Darüber<br />
hinaus werden eine Bewusstheit <strong>für</strong> eigene innere Prozesse, eine<br />
Distanzierungsfähigeit von Bildern, ausreichend Bewegung, Raum <strong>für</strong><br />
114
Selbstpflege und Reflexion, sowie bestimmte persönliche Eigenschaften genannt.<br />
Vergleichsweise wenige Ressourcen wurden auf der Ebene der<br />
Therapiegestaltung genannt. Einzelnennungen waren etwa klare Regeln, starke<br />
Strukturen, eine ausführliche Auftragsklärung zu Beginn der Therapie. Eine<br />
Therapeutin sprach von einer guten Erfahrung damit, eigene Belastungen den<br />
Patientinnen <strong>gegen</strong>über offenzulegen. Auf institutioneller Ebene galten die<br />
zeitliche Begrenzung der Arbeit, die Begrenzung der Fallbelastung und<br />
ausreichend Ausgleiche als Ressourcen. Gleichzeitig wurden ein klarer<br />
institutioneller Rahmen sowie die Einbeziehung anderer Institutionen als<br />
schützende <strong>Faktoren</strong> genannt.<br />
7.2. Vergleich mit bestehender Literatur<br />
Die derzeit umfassendste und dabei recht neue Studie zum Thema wurde 2009<br />
von Christian Pross unter dem Titel „Verletzte Helfer“ veröffentlicht. Er hat<br />
aufgrund seiner eigenen Erfahrung als Leiter eines Behandlungszentrums <strong>für</strong><br />
Folterüberlebende nach Aufgabe all seiner exekutiven Funktionen das<br />
Phänomen der Sekundärtraumatisierung eingehend wissenschaftlich untersucht,<br />
das ihm während seiner praktischen Tätigkeit so häufig begegnet war. In 8<br />
verschiedenen Ländern und 13 Behandlungseinrichtungen hat Pross 72<br />
Personen, die einen helfenden Beruf mit traumatisierten Menschen ausüben,<br />
interviewt und diese Interviews mithilfe der Grounded Theory ausgewertet. Seine<br />
Ergebnisse konzentrieren sich in erster Linie auf die Beschaffenheit von<br />
Organisationen und deren strukturelle wie organisationstheoretische Aspekte. Er<br />
arbeitete heraus, dass Organisationen, die im Traumabereich tätig sind,<br />
natürlicherweise einen Entwicklungsprozess durchlaufen. Er beschreibt wie nach<br />
einer enthusiastischen Pionierphase in den Einrichtungen meist eine Phase der<br />
Ernüchterung einsetzt, voller Konflikte, Konfrontation mit gesellschaftlichen und<br />
sozialen Realitäten und den entsprechenden Enttäuschungen und Brüchen.<br />
Entscheidend sei es dann, eine Phase der Differenzierung und<br />
Professionalisierung zu durchlaufen. Einrichtungen mit hohem Stress- und<br />
Konfliktpegel charakterisiert er als solche, die in der Pionierphase<br />
steckenbleiben, was sich darin äußert, dass formale Organigramme stark von<br />
115
den Realitäten in den Einrichtungen abweichen. Er beschreibt wie in diesen<br />
Organisationen an einer basisdemokratischen Organisationsform festgehalten<br />
wird und sich dabei informelle und häufig wechselnde Machtkoalitionen ergeben.<br />
Das Ergebnis sei häufig eine Atmosphäre von Misstrauen und Feindseligkeit,<br />
Grabenkämpfen, Intransparenz der Kommunikationswege, von fehlenden<br />
verbindlichen Regeln und Strukturen sowie Leitungen, die keine echten<br />
Kontrollfunktionen ausfüllen können. Die Folge seien Grenzverletzungen<br />
zwischen den Mitarbeiterinnen, die letztlich auch die Beziehungsgestaltung<br />
zwischen Helferinnen und Patientinnen negativ beeinflussen und damit den<br />
Nährboden <strong>für</strong> sekundärtraumatische Reaktionen bereiten. Anders als in der hier<br />
vorliegenden Studie sieht Pross daher als Stressoren in erster Linie strukturelle<br />
Aspekte, die zu spezifischen Teamdynamiken und Beziehungsgestaltungen<br />
innerhalb eines Teams führen.<br />
Interessant an Pross‘ Studie ist zum einen, dass er sich im Laufe seiner<br />
Forschungsarbeit zunehmend von theoretischen Konzepten sekundärer<br />
<strong>Traumatisierung</strong> entfernt hat, da er diese als nicht hilfreich empfand. Zum<br />
anderen ist seine Studie eine der wenigen Publikationen in diesem Bereich, die<br />
Ressourcen von Helferinnen identifiziert, die diese entwickelt haben, um mit den<br />
beschriebenen Belastungen umzugehen. Er widmet ihnen ein ganzes Kapitel.<br />
Diese sind zwar anders kategorisiert als in der vorliegenden Untersuchung,<br />
decken sich inhaltlich aber weitgehend mit den von mir identifizierten<br />
Ressourcen 10 . Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass in den <strong>für</strong> diese<br />
Untersuchung durchgeführten Interviews auf die Studie von Pross Bezug<br />
genommen wurde, da sie ein lange vernachlässigtes Forschungsfeld eingehend<br />
als eine der ersten Studien in dieser Richtung bearbeitet hat. Für eine der beiden<br />
Einrichtungen wurde berichtet, dass sie sich in den vorgelegten Ergebnissen sehr<br />
gut wiederfindet und dass die Einrichtung gerade eine solche beschriebene<br />
Phase der Differenzierung und Professionalisierung durchlaufen hätte, nach<br />
mehreren Jahren schwieriger Konflikte und Reibungen.<br />
10 Die bei Pross genannten Ressourcen lauten überblicksartig folgendermaßen: Familie, Kinder,<br />
Realistische Ziele, Dokumentieren, Forschen, Publizieren, Lehren, Ausbildung, Weiterbildung,<br />
Eigenes Trauma als Antriebskraft, Kulturelle Aktivitäten, Austausch unter Kollegen, Politisches<br />
Engagement, Öffentlichkeitsarbeit, Humor, Erfolgserlebnisse, Patientenarbeit, Sport, Natur, Aus-<br />
Zeiten, Sabbatjahr, Ausstieg, Geselligkeit, Freunde, Reisen, Reframing statt Containing,<br />
Sinngebung, Tradierte Lebensweisheiten.<br />
116
Eine weitere Studie zum Thema „Stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong> und<br />
Behandlungseffizienz in der therapeutischen Arbeit mit traumatisierten<br />
Flüchtlingen“ wurde 2005 von Norbert Gurris abgeschlossen. Gurris hat ein<br />
Kollektiv von 100 Therapeutinnen in 23 Behandlungseinrichtungen in<br />
Deutschland, Österreich und der Schweiz per Fragebogen mit anonymisiertem<br />
Rücklauf befragt und diese quantitativ ausgewertet. Zu dem Fragenkatalog<br />
gehörten das Berlin-Ulmer Traumatherapeuten-Inventar, der Maslach-Burnout-<br />
Inventory (MBI-D) sowie der Professional Quality of Life (ProQOL R-III), eine<br />
verkürzte Fassung des Compassion Satisfaction and Fatigue Test von Figley. Es<br />
stellte sich heraus, dass 37% der Therapeutinnen ein hohes Risiko der<br />
Compassion Fatigue aufwiesen, 36% <strong>für</strong> Burnout und 52% der Therapeutinnen<br />
eine geringe Compassion Satisfaction. Mit einer Abfragung von Symptomen aus<br />
dem Spektrum der PTSD stellte Gurris fest, dass die untersuchten<br />
Therapeutinnen in hohem Maße stellvertretend traumatisiert seien. Als wichtigste<br />
Quellen der Belastung identifiziert er in erster Linie die unsichere<br />
Aufenthaltssituation der Patientinnen. In Verbindung damit stellt Gurris einen<br />
Zusammenhang zwischen stellvertretender <strong>Traumatisierung</strong> bzw. Burnout und<br />
der Angst der Therapeutinnen vor der Durcharbeitung traumatischen Materials<br />
und daraus folgender Vermeidungshaltung her. Als zentrale Quellen der<br />
Belastung <strong>für</strong> Therapeutinnen fasst Gurris die folgenden zusammen: die<br />
extremen Traumaerfahrungen der Patientinnen, die traumatisierende<br />
Aufenthaltssituation der Patientinnen, Team-, Leitungs- und Trägerkonflikte,<br />
sowie geringe Erfolge in der Traumabearbeitung mit den Patientinnen. Mit<br />
Ressourcen bzw. protektiven <strong>Faktoren</strong> <strong>für</strong> die Therapeutinnen <strong>gegen</strong> die<br />
Belastungen hat sich Gurris nicht beschäftigt.<br />
Die bei Gurris herausgearbeiteten zentralen Belastungsfaktoren finden sich unter<br />
anderen auch in der hier vorliegenden Untersuchung. Jedoch wurden hier sehr<br />
viel mehr verschiedene Belastungsfaktoren identifiziert, als in Gurris‘ Studie. Die<br />
methodische Vorgehensweise der hier vorliegenden Arbeit erlaubt keine<br />
Gewichtung der verschiedenen identifizierten Belastungsfaktoren, da sie keiner<br />
quantitativen Analyse unterzogen wurden, was ohnehin bei einer kleinen<br />
Stichprobe wenig sinnvoll wäre. So wurde hier eher ein breit gefächerter Katalog<br />
an Belastungsfaktoren erstellt, die – anders als bei Gurris – nicht hierarchisch<br />
117
zueinander geordnet wurden. Die hier vorliegende Untersuchung geht mit dem<br />
Schwerpunkt auf Ressourcen der Therapeutinnen außerdem einen Schritt weiter<br />
und stellt die Frage wie mit den Belastungen umgegangen werden kann.<br />
Die Studien von Pross und Gurris sind die einzigen mir bekannten Studien, die<br />
sich gezielt und systematisch mit den Belastungen <strong>für</strong> Psychotherapeutinnen in<br />
der Arbeit speziell mit Folterüberlebenden beschäftigen. Beide Studien haben<br />
aufgrund ihrer Stichprobengröße ein höheres Potential der Generalisierbarkeit.<br />
Bemerkenswert ist jedoch, dass meine Untersuchung mit der sehr viel kleineren<br />
Stichprobengröße von fünf Interviewpartnerinnen auf sehr ähnliche Ergebnisse<br />
kommt, und einen Teil der Ergebnisse bei Pross und Gurris bestätigt.<br />
Drei weitere Publikationen, die hier vorgestellt werden sollen, sind nicht explizit<br />
Studien, sondern entstammen praktischen Handbüchern, bzw. Sammelbänden<br />
über die Psychotherapie mit Folter- und Kriegsopfern. Conrad Frey hat 2007 in<br />
einem Handbuch zum Thema der Sekundärtraumatisierung darin die Ergebnisse<br />
der Studie von Gurris (2005) rezipiert. Als darüber hinausgehenden Schritt<br />
beschreibt er prophylaktische Maßnahmen, die <strong>für</strong> ihn in erster Linie im Wissen<br />
um die Risiken und deren Prädiktoren, sowie dem Erkennen entsprechender<br />
Warnsignale liegen.<br />
Als Maßnahmen zur Vorbeugung von sekundärer <strong>Traumatisierung</strong> betont Frey<br />
auf Ebene der Fachpersonen zunächst die kritische Überprüfung der eigenen<br />
Motive <strong>für</strong> diese Arbeit, besonders bei Menschen mit eigenen traumatischen<br />
Erfahrungen. Außerdem sei es nach Frey wichtig, sich ein realistisches Bild der<br />
Arbeit zu machen. Neben einer fundierten therapeutischen Ausbildung und<br />
ausreichender Berufserfahrung erwähnt er die Bedeutung von Inter- und<br />
Supervisionen. In ausgleichenden Tätigkeiten, wie andere berufliche Standbeine<br />
oder sinnstiftende, entspannende und kreative Aktivitäten in der Freizeit, sowie in<br />
ausreichenden sozialen und familiären Kontakten sieht er außerdem wichtige<br />
prophylaktische Ressourcen. Auf institutioneller Ebene betont Frey die<br />
Wichtigkeit einer Bewusstheit um die beruflichen Risiken, die sich in<br />
wertschätzendem Umgang mit Mitarbeitenden, sinnvollen Maßnahmen zur<br />
Reduzierung von Belastungen, sowie einer sorgfältigen Auswahl geeigneter<br />
Mitarbeitenden äußert. Er erwähnt die Bedeutung eines wertschätzenden und<br />
118
unterstützenden Umgangs miteinander im Team, was durch spontane<br />
<strong>gegen</strong>seitige Unterstützung, regelmäßige Fallbesprechungen und Supervisionen,<br />
sowie wenn nötig externe Team-Coachings, die teamdynamische Aspekte<br />
reflektieren helfen, gestützt werden soll. Auf struktureller Ebene plädiert Frey <strong>für</strong><br />
eine klare Verteilung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, mit einer<br />
gewissen Flexibilität <strong>für</strong> die Möglichkeit ausgleichender Tätigkeitsfelder <strong>für</strong><br />
belastete Mitarbeiter. Außerdem schlägt er vor, soweit wie möglich die<br />
therapeutische Arbeit von der Expertentätigkeit als Begutachter zu trennen, um<br />
Rollenkonflikte zu vermeiden, und ein strukturiertes Aufnahmeverfahren mit<br />
überprüfbaren Indikationskriterien durchzuführen, um die Belastungen der<br />
einzelnen Mitarbeiter gleichmäßig und überschaubar zu koordinieren (Frey 2007,<br />
S. 252-254). Die hier beschriebenen Protektivfaktoren fußen auf weitreichender<br />
Berufserfahrung des Autors in diesem Berufsfeld. Sie werden durch die<br />
Ergebnisse meiner Untersuchung gänzlich bestätigt.<br />
Johan Lansen, Berater und Supervisor in verschiedenen europäischen<br />
Behandlungseinrichtungen <strong>für</strong> Kriegs- und Folterüberlebende mit langjähriger<br />
Berufserfahrung, hat 1996 einen Artikel in einem Sammelband über die<br />
therapeutische Arbeit mit Folterüberlebenden geschrieben (Graessner, Gurris &<br />
Pross 1996). Unter dem Titel „Was tut „es“ mit uns?“ beschäftigt auch er sich mit<br />
den potentiell schädigenden Auswirkungen der Arbeit mit Folterüberlebenden<br />
und gibt einige Empfehlungen ab, wie diesen ent<strong>gegen</strong>gewirkt werden kann.<br />
Dabei nennt er die Notwendigkeit einer Bewusstheit <strong>für</strong> die schwierigen Gefühle,<br />
die auftauchen können, und den konstruktiven Umgang mit ihnen. Er spricht sich<br />
<strong>für</strong> die Wichtigkeit aus, das Schweigen zu brechen – das gelte auch <strong>für</strong><br />
Therapeutinnen, möglichst im Team, durch spontanes emotionales „debriefing“ 11<br />
oder institutionalisiert durch Inter- und Supervision. Auf Seiten der Leitungen und<br />
Träger plädiert er <strong>für</strong> die Einsicht, dass sich die Kosten und der Aufwand solcher<br />
Schutzmaßnahmen <strong>für</strong> die Therapeutinnen auszahlen und letztlich auch der<br />
Qualität der Arbeit zugute kommen. Er spricht sich außerdem da<strong>für</strong> aus, die<br />
Arbeit innerhalb der Teams gut zu verteilen und Behandlungsziele regelmäßig zu<br />
11 Debriefing ist eine traumatherapeutische Intervention, die kurz nach einem traumatischen<br />
Ereignis angewandt wird, um das Risiko <strong>für</strong> posttraumatische Symptombildung zu verringern.<br />
Meist wird dabei auf ein Gesprächsmodell nach Mitchell und dem Critical Incident Stress<br />
Debriefing (CISD)-Modell verwiesen.<br />
119
überprüfen. Es zeigt sich in seinem Artikel, dass bereits Ende der 90er Jahre<br />
Ansätze diskutiert wurden, wie Therapeutinnen vor den schädigenden<br />
Auswirkungen ihrer Arbeit geschützt werden können und welche Ressourcen<br />
da<strong>für</strong> hilfreich sowie auch notwendig sind. Es wird jedoch auch deutlich, dass es<br />
seitdem eine Weiterentwicklung gab, und dass die Ressourcen, die die<br />
Therapeutinnen in der vorliegenden Untersuchung nennen können, bereits sehr<br />
viel weitreichender und vielschichtiger sind. Es zeigt sich, dass sowohl<br />
Einrichtungen als auch betroffene Therapeutinnen in den letzten Jahren kreativ<br />
und erfinderisch darin waren, Strategien zur Erholung und Stärkung zu<br />
entwickeln (Lansen 1996, S. 253-270). Sein Appell, das Schweigen zu brechen<br />
und auch als Therapeutin ein Bewusstsein <strong>für</strong> die eigenen schwierigen Gefühle in<br />
der Behandlung von Folter- und Kriegsüberlebenden zu entwickeln, scheint heute<br />
sehr viel weniger ein Tabu anzurühren, als das in seinem Text aus 1996 noch<br />
klingt.<br />
In einem späteren Sammelband der gleichen Behandlungseinrichtung hat sich<br />
Ralf Weber (2002) mit dem intersubjektiven Erleben von Traumatherapeutinnen<br />
beschäftigt und Risiken sowie Ressourcen aufgezeigt. Auf gestalttheoretischer<br />
Grundlage des Figur-Hintergrund-Prinzips richtet er zunächst den Blick auf<br />
kontextuelle Wirkfaktoren, die sich nachteilig auf Therapieverläufe auswirken<br />
können. Für ihn äußern sich die Risiken in erster Linie im interaktionellen<br />
Geschehen und in der Beziehungsgestaltung. Er beschreibt entsprechende<br />
Übertragungs-Gegenübertragungsreaktionen, die die Gefahr bergen, die<br />
Therapeutin in einen schleichenden traumatisierenden Prozess hineinzuziehen.<br />
Darauf aufbauend stellt er die Frage, wie die Therapeutin die therapeutische<br />
Beziehung so gestalten kann, dass Risiken und Gefahren vermieden und<br />
Übertragungsreaktionen <strong>für</strong> Kontakt- und Entwicklungsmöglichkeiten produktiv<br />
genutzt werden können. Er betont die Notwendigkeit zur Bereitschaft zu<br />
intensiver Selbsterfahrung und Meta-Reflektion der Therapeutin und macht sich<br />
stark <strong>für</strong> eine kontaktvolle Arbeit im ‚Hier und Jetzt‘. In dieser Hinsicht spricht er<br />
davon, dass der zentrale Baustein der Traumatherapie nicht die<br />
Traumaexposition, sondern die Transformation traumatischer Erinnerungen und<br />
Körperempfindungen sein muss, indem die Gegenwart betont wird und Gefühle,<br />
Gedanken und Körperempfindungen, die aktuell präsent sind, in den Vordergrund<br />
120
ücken. Er plädiert außerdem <strong>für</strong> eine therapeutische Haltung der Präsenz, die<br />
eher durch direkte Antworten als durch Neutralität und Abstinenz gekennzeichnet<br />
sind. Er begründet diese damit, dass gerade bei traumatisierten Menschen häufig<br />
die Persönlichkeits- und Ich-Funktionen nachhaltig beeinträchtigt sind. Dieser<br />
Zustand kann sich zu einem starken Bedürfnis nach unmittelbarer Rückmeldung<br />
und Unmittelbarkeit formen. Eine abstinente Therapeutenhaltung könne daher im<br />
Einzelfall eher zu einer traumatisierenden Interaktion führen, von der sowohl<br />
Patientin wie auch Therapeutin Schaden nehmen. Einen weiteren Schwerpunkt<br />
setzt er auf die Bedeutung von Grenzen. Weber hält es <strong>für</strong> nicht förderlich, wenn<br />
die Therapeutin sich in die Rolle des Aushaltens begibt und sieht darin eher ein<br />
schwaches Modell <strong>für</strong> Ich-Funktionen und Grenzen. Vielmehr sieht er die<br />
Therapeutin in der Verantwortung, <strong>für</strong> eine Begrenzung des Leidens und<br />
Aushaltens zu sorgen, weil gerade dies die Patientinnen häufig nicht mehr<br />
können. Er hält persönliche Äußerungen wie „Das ist kaum zu ertragen, was Sie<br />
da gerade erzählen“ <strong>für</strong> erlaubt, wenn nicht sogar methodisch ausdrücklich <strong>für</strong><br />
geboten. Diese Vorstellung steht im Widerspruch zu der üblichen geforderten<br />
Therapeutenhaltung der leeren Projektionsfläche, kann aber auch <strong>für</strong> die<br />
Gesundheit der Therapeutin eine wichtige und schützende Haltung sein. Weitere<br />
Schutzmechanismen sieht Weber in der eigenen Entlastung durch Supervision,<br />
Intervision, professioneller Bescheidenheit sowie ausgleichenden Tätigkeiten wie<br />
z.B. die Behandlung nichttraumatischer Patientinnen oder Forschung und Lehre.<br />
Als letzten Punkt erwähnt Weber auch die Hinwendung in der Therapie zum<br />
Leben und zur Weiterentwicklung, statt einer Konzentration auf die traumatischen<br />
Ereignisse im Leben der Patientinnen. Auch dies würde letztlich die Belastung,<br />
die auf die Therapeutinnen einwirkt, verringern.<br />
Ralf Webers Ausführungen werden hier so ausführlich beschrieben, weil sie<br />
gerade aufgrund des gestalttherapeutischen Hintergrunds eine Sonderstellung in<br />
der Landschaft der Traumaliteratur darstellen. Er benutzt ein anderes Vokabular<br />
und andere therapeutische Konzepte in seiner Argumentation als das Gros der<br />
Schriften in diesem Bereich. Daher beziehen sich die vorgestellten Ressourcen<br />
und Strategien zum Schutz vor Sekundärtraumatisierung eher auf typisch<br />
gestalttherapeutische Kategorien und haben einen starken Fokus auf Kontakt,<br />
Grenzen und Authentizität. Dies weist eine andere Perspektive auf als sie die<br />
121
Ergebnisse meiner empirischen Untersuchung darstellen. Zwar sind mit der<br />
Selbsterfahrung und der Entlastung durch Inter- und Supervisionen gleiche<br />
Ressourcen benannt wie in der vorliegenden Untersuchung. Die Betonung von<br />
Kontakt, authentischer Präsenz sowie dem Setzen von Grenzen innerhalb der<br />
Beziehungsgestaltung sind jedoch Aspekte, die sich in dieser Form aus meiner<br />
empirischen Untersuchung nicht ergeben. Dennoch werfen sie relevante Fragen<br />
auf und beinhalten Überlegungen, die weitergetragen werden sollten.<br />
7.3. Bemerkungen zum methodischem Vorgehen<br />
Manch ein Leser dieser Arbeit mag die Idee gehabt haben, dass zusätzliche<br />
wertvolle Informationen hätten gewonnen werden können, wäre im<br />
Untersuchungsdesign vorgesehen gewesen, das Belastungsniveau meiner<br />
Interviewpartnerinnen zu ermitteln, um damit eine Aussage darüber treffen zu<br />
können, ob und in welchem Ausmaß die interviewten Therapeutinnen zum<br />
Zeitpunkt der Erhebung sekundär traumatisiert waren oder nicht. Mit geeigneten<br />
Tests hätte ermittelt werden können, welche Interviewpartnerinnen von einer<br />
sekundären <strong>Traumatisierung</strong> betroffen sind und welche dies nicht sind, um dann<br />
vergleichend zu erforschen, ob sich protektive <strong>Faktoren</strong> ermitteln lassen, die die<br />
Gesundgebliebenen im Gegensatz zu der sekundärtraumatisierten Gruppe zur<br />
Verfügung haben. Bei einer größeren Stichprobe wäre es sicher sinnvoll<br />
gewesen, das Belastungsniveau zu messen, um Aussagen der<br />
Interviewpartnerinnen entsprechend untereinander zu vergleichen. Dies hätte<br />
erfordert, dass enorm viele Daten über die Therapeutinnen gesammelt werden,<br />
die als potentielle Protektivfaktoren hätten isoliert werden können.<br />
Es gab drei Gründe, warum dieser Weg nicht gewählt wurde. Erstens hätte eine<br />
Ermittlung des Belastungsniveaus der Therapeutinnen eine theoretische<br />
Festlegung auf ein Konzept <strong>Sekundäre</strong>r <strong>Traumatisierung</strong> erfordert. Das Ziel war<br />
es jedoch offen und ‚theoriefrei‘ - so weit das möglich ist - vorzugehen, um mich<br />
auf die persönliche Begegnung mit meinen Interviewpartnerinnen einzulassen.<br />
Der zweite Grund ist der, dass ich mich mit dieser Untersuchung gemeinsam mit<br />
meinen Interviewpartnerinnen einem schmerzhaften und schwierigen Thema<br />
zugewandt habe. Alle Interviewpartnerinnen waren vor unseren Gesprächen<br />
122
Fremde <strong>für</strong> mich ebenso wie ich eine Fremde <strong>für</strong> sie war. Ein standardisierter<br />
psychometrischer Test hätte <strong>für</strong> mich in einem Widerspruch gestanden zu der<br />
offenen Gesprächsatmosphäre, die ich schaffen wollte, und zu dem Vertrauen,<br />
das mir in den Gesprächen ent<strong>gegen</strong> gebracht wurde. Drittens hätte eine solche<br />
Vorgehensweise die Ressourcen der hier vorliegenden Forschungsarbeit bei<br />
weitem überstiegen.<br />
Da also das Belastungsniveau der Interviewpartnerinnen nicht psychometrisch<br />
festgehalten wurde, kommen meinen persönlichen Eindrücken von<br />
interaktionellen Aspekten sowie atmosphärischen Informationen, die ich während<br />
meiner Besuche in den Behandlungseinrichtungen erhalten habe, eine gewisse<br />
Bedeutung zu. Diese sollen an dieser Stelle kurz erwähnt werden: In beiden<br />
Einrichtungen wurde ich sehr offen und freundlich empfangen. Ich hatte die<br />
Interviewanfrage an die Einrichtungen als Ganze gestellt und es wurde individuell<br />
oder im Team entschieden, wer sich die Zeit <strong>für</strong> meine Interviews nimmt. In einer<br />
Einrichtung war eine Therapeutin <strong>für</strong> ein Interview vorgesehen, das ohne eine<br />
weitere Begründung kurzfristig abgesagt wurde, weil die Person zu dem Thema<br />
nicht sprechen wollte. Jeder Therapeutin wurde zu Beginn des Interviews die<br />
Frage gestellt, ob das Thema und die Fragestellungen <strong>für</strong> sie Relevanz haben<br />
und welche Bedeutung ihnen zukommen. Ausnahmslos alle haben bestätigt,<br />
dass die Belastung und entsprechende Protektivmaßnahmen <strong>für</strong> die<br />
Therapeutinnen in diesem Arbeitsumfeld zentral und wichtig sind.<br />
Alle Interviewpartnerinnen erschienen sehr aufmerksam in Bezug auf die Risiken<br />
der therapeutischen Arbeit mit Kriegs- und Folterüberlebenden und die<br />
Wichtigkeit sich einerseits mit offenen Augen diesem Thema zuzuwenden und<br />
andererseits entsprechend nötige prophylaktische Maßnahmen zu ergreifen, um<br />
die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen und zu erhalten. Alle fünf<br />
Therapeutinnen zeigten einen hohen Grad an Reflexion zu den befragten<br />
Themen, worin sich zeigt, dass es <strong>für</strong> das Thema bereits eine hohe Bewusstheit<br />
gab. Hierin mag ein gewisser ‚bias‘ liegen, da möglicherweise gerade die<br />
Therapeutinnen sich zu den Interviews bereit erklärt haben, die eine Offenheit<br />
und Sensibilität <strong>für</strong> das Thema aufwiesen. Eine Generalisierbarkeit meiner<br />
Ergebnisse ist also aus diesem Grund nur begrenzt möglich.<br />
123
Atmosphärisch war in beiden Einrichtungen auffällig, dass der Umgang der<br />
Therapeutinnen untereinander, den ich beobachten konnte, sehr herzlich und<br />
wohlwollend war. Es wurde viel gelacht, was mich als Interviewerin überraschte,<br />
da ich mich eher auf eine etwas düstere, möglicherweise gedrückte Stimmung in<br />
den Behandlungszentren, die gerade mit solchen Schicksalen gefüllt sind,<br />
eingestellt hatte. Auch betonten alle fünf Therapeutinnen, dass derzeit das<br />
Teamklima, die Zufriedenheit im Team und mit der jeweiligen Leitung sehr gut<br />
sei. In beiden Einrichtungen waren die jeweiligen Leiterinnen relativ neu (1 und<br />
1,5 Jahre). Auch wurde in beiden Einrichtungen davon berichtet, dass das<br />
Teamklima zu früheren Zeiten bei weitem nicht immer so gut und damit<br />
unterstützend gewesen sei.<br />
Meine persönlichen Eindrücke und die Aussagen der Therapeutinnen geben also<br />
starken Anlass dazu, dass davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei<br />
beiden Einrichtungen um Traumazentren mit niedrigem Stress- und Konfliktpegel<br />
handelt, um die Worte von Christian Pross (2009) zu benutzen. Insofern mögen<br />
die untersuchten Einrichtungen besonders geeignet gewesen sein – ohne dass<br />
dies vorher absehbar gewesen wäre -, um speziell nach Ressourcen und<br />
protektiven <strong>Faktoren</strong> in der Arbeit mit Kriegs- und Folterüberlebenden <strong>gegen</strong><br />
sekundäre <strong>Traumatisierung</strong> zu suchen, da diese hier gut ausgebaut waren.<br />
Auch aufgrund der relativ kleinen Stichprobe ist die Generalisierbarkeit der hier<br />
vorliegenden Ergebnisse zu beschränken. Bei fünf Interviews kann nicht auf die<br />
Gesamtheit der Traumatherapeutinnen geschlossen werden, die mit Kriegs- und<br />
Folteropfern arbeiten, zumal gesellschaftliche und einrichtungsspezifische<br />
<strong>Faktoren</strong> nicht vergleichend ermittelt wurden. Dennoch konnte durch das<br />
explorative Vorgehen ein Katalog von <strong>Faktoren</strong> – sowohl belastende als auch<br />
schützende – ermittelt werden, die <strong>für</strong> Therapeutinnen in vergleichbaren<br />
Behandlungseinrichtungen möglicherweise hilfreich und inspirierend sind.<br />
124
8. Schlussbemerkung<br />
Die theoretischen Konzepte <strong>Sekundäre</strong>r <strong>Traumatisierung</strong> wurden dem<br />
empirischen Teil in dieser Arbeit vorangestellt, ohne dabei Partei <strong>für</strong> die eine oder<br />
andere theoretische Ausrichtung zu ergreifen. Die Vielzahl der verschiedenen<br />
Konzepte spricht da<strong>für</strong>, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft, die sich mit<br />
diesem Themenkomplex beschäftigt, nach wie vor damit ringt, zu begreifen und<br />
in treffende Worte zu fassen, was mit Menschen in helfenden Berufen passieren<br />
kann, die mit schwer traumatisierten Menschen arbeiten.<br />
Opfer von Folter und Krieg bergen eine Erinnerung daran, wie dünn die Decke<br />
unserer Zivilisation ist, denn man kommt unweigerlich mit den abgründigen und<br />
düsteren Seiten der menschlichen Existenz in Berührung. Dies allein kann<br />
belasten und provoziert eine Auseinandersetzung mit der Natur des Menschen<br />
einerseits, und den politischen und sozialen Realitäten unserer Welt<br />
andererseits.<br />
Zweifelsfrei werden dabei Gefühle von Wut, Schmerz, Trauer und Empörung<br />
erzeugt. Fraglich erscheint dabei jedoch, ob es angebracht ist, den Reaktionen<br />
von Psychotherapeutinnen klinische Qualität zuzusprechen. Zu vieles spricht<br />
da<strong>für</strong>, Hypothesen einer unvermeidlichen Reaktion auf den Kontakt mit schweren<br />
Traumata, die quasi naturgemäß zu stellvertretenden <strong>Traumatisierung</strong>en oder<br />
Mitgefühlserschöpfung führen, in Frage zu stellen. Viel zu wenig abgrenzbar ist<br />
in diesem Zusammenhang, welche Reaktionen von Therapeutinnen unmittelbar<br />
auf die traumatischen Erfahrungen der Patientinnen während des Krieges im<br />
Heimatland oder im Exil im Gastland zurückzuführen sind, oder welchen Anteil<br />
generell die Arbeitsbedingung, eventuelle Arbeitsüberlastung oder –<br />
unzufriedenheit, sowie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben. Die<br />
Wichtigkeit des sozialen Rückhalts und die gesellschaftlichen Bedingungen unter<br />
denen einerseits Flüchtlinge in den Gastländern des Westens aufgenommen<br />
werden, und unter denen andererseits die Therapeutinnen ihre herausfordernde<br />
Arbeit leisten müssen, sind in dieser Arbeit angesprochen worden.<br />
Fest steht, dass die Therapeutinnen, die mit Folter- und Kriegsüberlebenden<br />
arbeiten, eine enorm wichtige soziale und politische Arbeit leisten und dass ihnen<br />
125
Respekt gebührt, allein weil sie den Mut haben, sich einer schmerzhaften Realität<br />
zuzuwenden, die allzu häufig ignoriert wird.<br />
Es wurde in dieser Arbeit gezeigt, wo zentrale Belastungsfaktoren in der Arbeit<br />
mit Kriegs- und Folterüberlebenden liegen. Es wurde auch aufgezeigt, wie kreativ<br />
die Therapeutinnen sind, Ressourcen heranzuziehen, die ihnen den Umgang mit<br />
dieser teils schwierigen Arbeit erleichtern. Dabei wurde ein Katalog von<br />
schützenden Maßnahmen, Strukturen und Tätigkeiten erstellt, der hoffentlich von<br />
anderen Therapeutinnen als Inspiration genutzt werden kann.<br />
126
Literatur<br />
Almedom, Astier M. (2005). Resilience, hardiness, sense of coherence, and<br />
posttraumatic growth. Alls paths leading to “light at the end of the tunnel?”<br />
Journal of Loss and Trauma, 10, S. 253-265.<br />
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of<br />
Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). Deutsche<br />
Fassung: Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen<br />
– Textrevision, deutsche Bearbeitung und Einführung von Saß, Henning/<br />
Wittchen, Hans-Ulrich/ Zaudig, Michael/ Houben, Isabel, Göttingen, Bern,<br />
Toronto, Seattle: Hogrefe.<br />
Amnesty International (2011). Report 2011. Zur weltweiten Lage der<br />
Menschenrechte. Frankfurt: S. Fischer.<br />
Antonovsky, Aaron (1997). Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit.<br />
Deutsche Herausgabe von Alexa Franke. Tübingen: Dvgt-Verlag.<br />
Arnold, Deborah/ Calhoun, Lawrence G./ Tedeschi, Richard/ Cann, Arnie (2005).<br />
Vicarious posttraumatic Growth in Psychotherapy. Journal of Humanistic<br />
Psychology 45 (2), S. 239-263.<br />
Aronson, Elliot/ Pines, Ayala M./ Kafry, Ditsa (1982). Ausgebrannt. Vom<br />
Überdruß zur Selbstentfaltung. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Bakker, Arnold B./ Schaufeli, Wilmar B./ Leiter, Michael P./ Taris, Toon W.<br />
(2008). Work Engagement: An emerging concept in occupational health<br />
psychology. Work & Stress 22 (3), S. 187-200.<br />
Becker, David (2006). Die Erfindung des Traumas - Verflochtene Geschichten.<br />
Edition Freitag.<br />
Benatar, May (2004). Purification and the Self-System of the Therapist. Journal of<br />
Trauma & Dissociation 5 (4), S. 1-15.<br />
Birck, Angelika (2002). Psychotherapie mit traumatisierten Flüchtlingen.<br />
Gesellschaftliche Bedingungen und therapeutische Konsequenzen.<br />
Psychotraumatologie 3(4). Online: https://www.thiemeconnect.com/ejournals/html/psychotrauma/doi/10.1055/s-2002-35024<br />
(abgerufen am 04.04.2012).<br />
Birck, Angelika/ Pross, Christian/ Lansen, Johan (Hrsg.)(2002). Das Unsagbare.<br />
Die Arbeit mit Traumatisierten im Behandlungszentrum <strong>für</strong> Folteropfer<br />
Berlin. Berlin: Springer-Verlag.<br />
Daniels, Judith (2006). <strong>Sekundäre</strong> <strong>Traumatisierung</strong> – kritische Prüfung eines<br />
Konstruktes. Dissertation. Universität Bielefeld.<br />
127
Daniels, Judith (2007). Eine neuropsychologische Theorie der <strong>Sekundäre</strong>n<br />
<strong>Traumatisierung</strong>. Zeitschrift <strong>für</strong> Psychotraumatologie,<br />
Psychotherapiewissenschaft, Psychologische Medizin,<br />
Themenschwerpunkt <strong>Sekundäre</strong> <strong>Traumatisierung</strong>, 5 (3), Asanger-Verlag,<br />
S. 49-64.<br />
Fazel, M./ Wheeler, J./ Danesh, J. (2005). Prevalence of serious mental disorder<br />
in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review.<br />
Lancet, 365, S. 1309-1314.<br />
Figley, Charles R. (1995b). Compassion Fatigue as Secondary Traumatic Stress<br />
Disorder: An Overview. In Figley, Charles R. (Hrsg.), Compassion Fatigue.<br />
Coping with Secondary Traumatic stress Disorder in Those Who treat the<br />
Traumatized (S. 1-20). New York: Routledge.<br />
Figley, Charles R. (2002a). Mitgefühlserschöpfung – der Preis des Helfens. In<br />
Stamm, Hudnall B. (Hrsg.), <strong>Sekundäre</strong> Traumastörungen: Wie Kliniker,<br />
Forscher und Erzieher sich vor traumatischen Auswirkungen ihrer Arbeit<br />
schützen können (S. 41-59). Paderborn: Junfermann.<br />
Figley, Charles R. (2002b). Treating Compassion Fatigue. New York: Brunner-<br />
Routledge.<br />
Figley, Charles R. (Hrsg.)(1995a). Compassion Fatigue. Coping with Secondary<br />
Traumatic stress Disorder in Those Who treat the Traumatized. New York:<br />
Routledge.<br />
Fischer, Gottfried/ Riedesser, Peter (2009). Lehrbuch der Psychotraumatologie<br />
(4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.<br />
Flick, Uwe (2006). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (4. Auflage).<br />
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuchverlag.<br />
Frey, Conrad (2007). <strong>Sekundäre</strong>r traumatischer Stress bei den Helfenden. In<br />
Maier, Thomas/ Schnyder, Ulrich (Hrsg.), Psychotherapie mit Folter- und<br />
Kriegsopfern. Ein praktisches Handbuch (S. 233-255). Bern: Verlag Hans<br />
Huber.<br />
Fröhlich-Gildhoff, Klaus/ Rönnau-Böse, Maike (2009). Resilienz. München:<br />
Reinhardt-Verlag.<br />
Graessner, Sepp/ Gurris, Norbert/ Pross, Christian (Hrsg.)(1996). Folter. An der<br />
Seite der Überlebenden. Unterstützung und Therapien. München: Verlag<br />
C.H. Beck.<br />
Gurris, Norbert (2005). Stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong> und<br />
Behandlungseffizienz in der therapeutischen Arbeit mit traumatisierten<br />
Flüchtlingen. Dissertation. Universität Ulm.<br />
128
Gurris, Norbert (2002): Überlegungen zur stellvertretenden <strong>Traumatisierung</strong> bei<br />
Therapeuten in der Behandlung von Folterüberlebenden.<br />
Psychotraumatologie 3(45). Online: http://www.thiemeconnect.com/ejournals/html/psychotrauma/doi/10.1055/s-2002-35265<br />
(abgerufen am 03.04.2010).<br />
Heise, Elke (2003). Auch einfühlsame Studenten sind Männer: Das generische<br />
Maskulinum und die mentale Präsentation von Personen.<br />
Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis, 2, S. 285-292.<br />
Helfferich, Cornelia (2005). Die Qualität qualitativer Daten. Manual <strong>für</strong> die<br />
Durchführung qualitativer Interviews (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag<br />
<strong>für</strong> Sozialwissenschaften.<br />
Herman, Judith Lewis (1992). Complex PTSD: A Syndrome in Survivors of<br />
Prolonged and Repeated Trauma. Journal of Traumatic Stress 5 (3), S.<br />
377-391.<br />
Hernandez, Pilar/ Gangsei, David/ Engstrom, David (2007). Vicarious Resilience:<br />
A new concept in work with those who survive trauma. Family Process 46<br />
(2), S. 229-241.<br />
Herrman, Helen/ Stewart, Donna E./ Diaz-Granados, Natalia/ Berger, Elena L./<br />
Jackson, Beth/ Yuen, Tracy (2011). What Is Resilience? La Revue<br />
canadienne de psychiatrie 56(5), S. 258-265.<br />
Janssen, Paul L./ Cierpka, Manfred/ Buchheim, Peter (Hrsg.)(1997).<br />
Psychotherapie als Beruf. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.<br />
Jüttemann, Gerd (Hrsg.)(1985). Qualitative Forschung in der Psychologie<br />
Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder. Weinheim: Beltz<br />
Verlag.<br />
Keilson, Hans (1979). Sequentielle <strong>Traumatisierung</strong> bei Kindern: deskriptivklinische<br />
und quantifizierend-statistische follow-up Untersuchung zum<br />
Schicksal der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden. Stuttgart:<br />
Enke-Verlag.<br />
Kruse, Jan (2009). Reader „Einführung in die Qualitative Interviewforschung“<br />
(Version Oktober 2009, überarbeitete, korrigierte und umfassend ergänzte<br />
Version). Freiburg (Bezug über http://www.soziologie.unifreiburg.de/kruse).<br />
Lansen, Johan (1996). Was tut „es“ mit uns? In Graessner, Sepp/ Gurris,<br />
Norbert/ Pross, Christian (Hrsg.). Folter. An der Seite der Überlebenden.<br />
Unterstützung und Therapien (S. 253-270). München: Verlag C.H. Beck.<br />
129
Lemke, Jürgen (2006). <strong>Sekundäre</strong> <strong>Traumatisierung</strong>. Klärung von Begriffen und<br />
Konzepten der Mittraumatisierung, Kröning: Asanger Verlag.<br />
Linley, Alex P. (2003). Positive Adaptation to Trauma: Wisdom as Both Outcome<br />
and Process. Journal of Traumatic Stress 16 (6), S. 601-610.<br />
Linley, Alex P./ Joseph, Stephen (2004). Positive Change Following Trauma and<br />
Adversity: A Review. Journal of Traumatic Stress 17 (1), S. 11-21.<br />
Madson, Laura/ Shoda, Jennifer (2006). Alternating between masculine and<br />
feminine pronouns does essay topic affect readers’ perceptions? Sex<br />
Roles, 54(3-4), S. 275-285.<br />
Maier, Thomas (2007). Asylverfahren, Arztberichte und Gutachten. In Maier,<br />
Thomas/ Schnyder, Ulrich (Hrsg.). Psychotherapie mit Folter- und<br />
Kriegsopfern. Ein praktisches Handbuch (S. 221-231). Bern: Verlag Hans<br />
Huber.<br />
Maier, Thomas (2007). Einleitung. In: In Maier, Thomas/ Schnyder, Ulrich (Hrsg.).<br />
Psychotherapie mit Folter- und Kriegsopfern. Ein praktisches Handbuch<br />
(S. 13-20). Bern: Verlag Hans Huber.<br />
Maier, Thomas/ Schnyder, Ulrich (Hrsg.)(2007). Psychotherapie mit Folter- und<br />
Kriegsopfern. Ein praktisches Handbuch. Bern: Verlag Hans Huber.<br />
Mayring, Philipp (2003). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken<br />
(8. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.<br />
McCann, Lisa/ Pearlman, Laurie Anne (1990). Vicarious Traumatization: A<br />
Framework for Understanding the Psychological Effects of Working with<br />
Victims. Journal of Traumatic Stress 3(1), 1990.<br />
Medico International (2005). Im Inneren der Globalisierung. Psychosoziale Arbeit<br />
in Gewaltkontexten. Medico-Report 26. Frankfurt a.M.: Mabuse-Verlag.<br />
Medico International (1997). Schnelle Eingreiftruppe „Seele“: auf dem Weg in die<br />
therapeutische Weltgesellschaft; Texte <strong>für</strong> eine kritische „Trauma-Arbeit“.<br />
Frankfurt a.M.: Verlag medico international.<br />
Menschick-Bendele, Jutta (2011). Niemand ist eine Insel. Burnout und<br />
Burnoutbewältigung im Arztberuf. In Ratheiser, Klaus Michael/ Menschik-<br />
Bendele, Jutta/ Krainz, Ewald E./ Burger, Michael (Hrsg.), Burnout und<br />
Prävention. Ein Lesebuch <strong>für</strong> Ärzte, Pfleger und Therapeuten (S. 1-29).<br />
Wien: Springer-Verlag.<br />
Mitchell, Jeffrey (o.J.). Critical Incident Stress Debriefing (CISD). Online:<br />
http://www.info-trauma.org/flash/mediae/mitchellCriticalIncidentStressDebriefing.pdf<br />
(abgerufen am 22.04.2012).<br />
130
Morina, Naser (2007). Sprache und Übersetzung. In Maier, Thomas/ Schnyder,<br />
Ulrich (Hrsg.). Psychotherapie mit Folter- und Kriegsopfern. Ein<br />
praktisches Handbuch (S. 179-201). Bern: Verlag Hans Huber.<br />
Pearlman, Laurie Anne (2002a). Aktuelle Notizen – Was ist indirekte<br />
<strong>Traumatisierung</strong>? In Stamm, Hudnall B. (Hrsg.), <strong>Sekundäre</strong><br />
Traumastörungen: Wie Kliniker, Forscher und Erzieher sich vor<br />
traumatischen Auswirkungen ihrer Arbeit schützen können (S. 34-36).<br />
Paderborn: Junfermann.<br />
Pearlman, Laurie Anne (2002b). Selbst<strong>für</strong>sorge <strong>für</strong> Traumatherapeuten.<br />
Linderung der Auswirkung einer indirekten <strong>Traumatisierung</strong>, in: Stamm,<br />
Hudnall B. (Hrsg.), <strong>Sekundäre</strong> Traumastörungen: Wie Kliniker, Forscher<br />
und Erzieher sich vor traumatischen Auswirkungen ihrer Arbeit schützen<br />
können (S. 77-86). Paderborn: Junfermann.<br />
Pearlman, Laurie Anne/ Saakvitne, Karen W. (1995). Treating Therapists with<br />
Vicarious Traumatization and Secondary Traumatic Stress Disorders. In<br />
Figley, Charles R. (Hrsg.), Compassion Fatigue. Coping with Secondary<br />
Traumatic stress Disorder in Those Who treat the Traumatized (S. 150-<br />
177). New York: Routledge.<br />
Powell, Steve/ Rosner, Rita/ Butollo, Willi/ Tedeschi, Richard G./ Calhoun,<br />
Lawrence R. (2003). Posttraumatic Growth After War: A Study with Former<br />
Refugees and Displaced People in Sarajevo. Journal of Clinical<br />
Psychology 59 (1), S. 71-83.<br />
Pross, Christian (2009). Verletzte Helfer. Umgang mit dem Trauma: Risiken und<br />
Möglichkeiten, sich zu schützen. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Pross, Christian (2006). Burnout, vicarious traumatization and its prevention.<br />
Torture 16(1), S. 1-9.<br />
Ratheiser, Klaus Michael/ Menschik-Bendele, Jutta/ Krainz, Ewald E./ Burger,<br />
Michael (2011). Burnout und Prävention. Ein Lesebuch <strong>für</strong> Ärzte, Pfleger<br />
und Therapeuten. Wien: Springer-Verlag.<br />
Rösing, Ina (2007). Der verwundete Heiler. Kritische Analyse einer Metapher.<br />
Kröning: Asanger-Verlag.<br />
Sachsse, Ulrich/ Sack, Martin (2011). Die komplexe Posttraumatische<br />
Belastungsstörung. In Seidler, Günter H./ Freyberger, Harald J./ Marcker,<br />
Andreas (Hg.). Handbuch der Psychotraumatologie (S. 178-188). Stuttgart:<br />
Klett-Cotta.<br />
Seidler, Günter H./ Freyberger, Harald J./ Marcker, Andreas (Hg.)(2011).<br />
Handbuch der Psychotraumatologie. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
131
Sejdijaj, Dafina/ Younansardaroud, Helen/ Wegener, Ana (2002). Dolmetschen<br />
im BZFO. In Birck, Angelika/ Pross, Christian/ Lansen, Johan (Hrsg.). Das<br />
Unsagbare. Die Arbeit mit Traumatisierten im Behandlungszentrum <strong>für</strong><br />
Folteropfer Berlin (S. 45-56). Berlin: Springer-Verlag.<br />
Senf, Wolfgang/ Broda, Michael (Hg.) (2005). Praxis der Psychotherapie. Ein<br />
integratives Lehrbuch (3., völlig neu bearbeitete Auflage). Stuttgart:<br />
Thieme Verlag.<br />
Sonneck, Gernot (2000). Krisenintervention und Suizidverhütung. Facultas: Wien.<br />
Stamm, Hudnall B. (Hrsg.)(2002). <strong>Sekundäre</strong> Traumastörungen: Wie Kliniker,<br />
Forscher und Erzieher sich vor traumatischen Auswirkungen ihrer Arbeit<br />
schützen können, Paderborn: Junfermann.<br />
Tedeschi, Richard G./ Calhoun, Lawrence G. (1996). The Posttraumatic Growth<br />
Inventory: Measuring the Positive Legacy of Trauma. In: Journal of<br />
Traumatic Stress, Vol. 9, No. 3.<br />
Tedeschi, Richard G./ Calhoun, Lawrence G. (1996). The Posttraumatic Growth<br />
Inventory: Measuring the Positive Legacy of Trauma. Journal of Traumatic<br />
Stress 9 (3), S. 455-471.<br />
Weber, Ralf (2002). Risiken und Ressourcen des intersubjektiven Erlebens von<br />
Traumatherapeuten. In Birck, Angelika/ Pross, Christian/ Lansen, Johan<br />
(Hrsg.). Das Unsagbare. Die Arbeit mit Traumatisierten im<br />
Behandlungszentrum <strong>für</strong> Folteropfer Berlin (S. 199-226). Berlin: Springer-<br />
Verlag<br />
Wicker, Hans-Rudolf (2007). Transkulturalität in der Therapie von Folter- und<br />
Kriegsopfern. In Maier, Thomas/ Schnyder, Ulrich (Hrsg.). Psychotherapie<br />
mit Folter- und Kriegsopfern. Ein praktisches Handbuch (S.203-220). Bern:<br />
Verlag Hans Huber.<br />
Willutzki, Ulrike et al (1997). Zufrieden oder ausgebrannt: Die berufliche Moral<br />
von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. In Janssen, Paul L./<br />
Cierpka, Manfred/ Buchheim, Peter (Hrsg.), Psychotherapie als Beruf (S.<br />
207-222), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.<br />
Wilson, John P./ Lindy, Jacob D. (1994a). Empathic Strain and<br />
Countertransference. In Wilson, John P./ Lindy, Jacob D. (Hrsg.).<br />
Countertransference in the Treatment of PTSD (S. 5-30). New York: The<br />
Guildford Press.<br />
Wilson, John P./ Lindy, Jacob D. (Hrsg.)(1994b). Countertransference in the<br />
Treatment of PTSD, New York: The Guildford Press.<br />
132
Witzel, Andreas (1985). Das problemzentrierte Interview. In: Jüttemann, Gerd<br />
(Hrsg.), Qualitative Forschung in der Psychologie. Grundfragen,<br />
Verfahrensweisen, Anwendungsfelder (S. 227-255). Weinheim: Beltz-<br />
Verlag.<br />
133
134
Anhang<br />
Anhang A – Interview-Leitfaden<br />
Anhang B – Transkriptionszeichen <strong>für</strong> Interviewtexte<br />
Anhang C – Code-Referenzen <strong>für</strong> die Interviews<br />
135
136
Anhang A<br />
Interview-Leitfaden<br />
Wie ist grob ihr Werdegang, wie sind sie dazu gekommen, speziell in diesem<br />
Bereich therapeutisch tätig zu werden?<br />
Welche Ausbildung haben sie erfahren?<br />
Wie lange arbeiten sie schon in diesem Bereich?<br />
Vollzeit oder Teilzeit? Bei Teilzeit, womit füllen sie den Rest der Zeit?<br />
Welche Relevanz hat das Thema, bzw. meine Fragestellung <strong>für</strong> sie?<br />
Beschreiben sie, wie sie ihre Arbeit empfinden.<br />
o Fällt Ihnen spontan dazu ein, wie sie sie beeinflusst, ihren Alltag, ihr<br />
Leben?<br />
Könnten sie versuchen, sich an die drei schwierigsten und belastendsten<br />
Fälle (<strong>für</strong> sie persönlich) zu erinnern, und mir davon erzählen (Zeit lassen<br />
da<strong>für</strong>).<br />
o Wie ging es ihnen dabei?<br />
o Was hat ihnen geholfen?<br />
o Sind sie verändert daraus hervorgegangen?<br />
Wie wird in der Einrichtung mit der Gefahr der Sekundärtraumatisierung<br />
umgegangen?<br />
Was <strong>für</strong> Schutzmechanismen sind da<strong>für</strong> eingerichtet?<br />
Wie werden diese erlebt?<br />
Sind sie ausreichend?<br />
Haben sie weitere Ressourcen, die bisher nicht erwähnt wurden, die ihnen<br />
wichtig erscheinen?<br />
137
138
Anhang B<br />
Transkriptionszeichen <strong>für</strong> die Interviewtexte<br />
grundsätzlich wird zunächst alles kleingeschrieben<br />
großBUCHstaben betont gesprochene Silben/ Wortteile/ Buchstaben<br />
* kurze Pause<br />
*3* ca. 3 Sekunden Pause<br />
, leichte Stimmhebung<br />
? starke Stimmhebung<br />
. Stimmsenkung<br />
(Unverständliches) unsichere Transkription in runden Klammern<br />
Kursiv Zur Anonymisierung Verfremdetes<br />
[ATMET EIN] Anmerkungen in Großbuchstaben in eckigen Klammern<br />
@lachend@ lachend gesprochene Worte in @@<br />
Fett lauter gesprochene Worte<br />
gleichzeitig Gesprochenes wird unterstrichen<br />
139
140
Anhang C<br />
Code-Referenzen <strong>für</strong> die Interviews<br />
Intensität des Traumas<br />
{IP1:162}; {IP1:221-230}; {IP2:144-<br />
148}; {IP3:95}; {IP3:101-103};<br />
{IP3:207}; {IP4:66}; {IP5:74-76};<br />
{IP5:138}; {IP5:192}.<br />
Nicht integrierte psychische Inhalte<br />
{IP2:44}; {IP3:23}; {IP3:95}; {IP5:82};<br />
{IP5:96}; {IP5:130}; {IP5:182}.<br />
Suizidalität<br />
{IP1:134}; {IP2:86}; {IP4:66}; {IP4:98}.<br />
Täter oder Täteranteile<br />
{IP1:100-114}; {IP1:134}; {IP1:148};<br />
{IP1:162}; {IP1:162-172}; {IP1:172};<br />
{IP2:86-90}; {IP2:106}; {IP3:149};<br />
{IP3:163}.<br />
Kinder<br />
{IP1:162}; {IP1:280}.<br />
Schwierige emotionale Reaktionen<br />
{IP1:146}; {IP1:223-230}; {IP1:230};<br />
{IP2:90}; {IP2:112}; {IP3:95}; {IP3:169};<br />
{IP3:207}; {IP5:100}; {IP5:170}.<br />
Infragestellung eigener Normalität<br />
{IP2:122}; {IP3:105-107}; {IP3:113}.<br />
Schwierigkeiten im Therapieverlauf<br />
{IP2:60}; {IP2:176}; {IP3:95}; {IP3:97};<br />
{IP3:169}; {IP5:164}.<br />
Teamkonflikte<br />
141<br />
{IP2:42}; {IP2:176}; {IP2:180};<br />
{IP2:184}; {IP4:124}; {IP4:132};<br />
{IP5:260}.<br />
Hohe Fallbelastung<br />
{IP1:64}{IP2:42}; {IP2:178}; {IP5:238}.<br />
Globale Erwartunghaltungen<br />
{IP3:171}; {IP3:215}.<br />
Herausforderungen der Migration,<br />
Aufenhaltsrechtliche Fragen<br />
{IP1:228}; {IP2:44}; {IP2:58-60};<br />
{IP2:176}; {IP3:95}; {IP3:215-217};<br />
{IP4:96}.<br />
Wenig gesellschaftlicher Rückhalt<br />
{IP3:163}; {IP3:207}; {IP3:215}.<br />
Aktualität von Kriegen und Konflikten<br />
{IP3:209}; {IP4:54}; {IP4:110};<br />
{IP5:192}.<br />
Formale Gefäße<br />
{IP1:242};{IP1:264}; {IP2:182};<br />
{IP3:233}; {IP3:239}; {IP3:243};<br />
{IP3:313}; {IP4:72}; {IP4:116};<br />
{IP4:126}; {IP4:128}; {IP5:86};<br />
{IP5:130}; {IP5:132}; {IP5:238}.<br />
Informeller Austausch<br />
{IP1:238}; {IP1:244}; {IP2:182};<br />
{IP3:247}; {IP3:249}; {IP4:126};<br />
{IP5:84}; {IP5:130}.
Funktionen des Teams<br />
{IP1:170}; {IP1:178}; {IP1:238};<br />
{IP1:266-268}; {IP2:140}; {IP2:176};<br />
{IP3:151}; {IP3:159}; {IP3:175};<br />
{IP4:72}; {IP4:116}; {IP4:124};<br />
{IP4:132}; {IP5:94}; {IP5:160}.<br />
Stabiles und ausgefülltes Privatleben<br />
{IP1:92-94}; {IP1:296}; {IP1:306};<br />
{IP2:46}; {IP2:176}; {IP2:194};<br />
{IP3:101}; {IP3:113-115}; {IP3:117};<br />
{IP3:125}; {IP4:104}; {IP4:132};<br />
{IP5:280}; {IP5:202}.<br />
Bewusstheit <strong>für</strong> eigene innere<br />
Prozesse<br />
{IP3:21-23}; {IP3:31}; {IP3:33};<br />
{IP3:87}; {IP3:111}; {IP3:173}; {IP4:86-<br />
92}.<br />
Distanzierungsfähigkeit von Bildern<br />
{IP3:31}; {IP4:46-54}; {IP4:112};<br />
{IP5:76-78}.<br />
Bewegung<br />
{IP2:46}; {IP2:194}; {IP3:95}; {IP4:134};<br />
{IP5:78}; {IP5:82}; {IP5:214}.<br />
Raum <strong>für</strong> Selbstpflege<br />
{IP4:134}; {IP5:150}; {IP5:214};<br />
{IP5:152}; {IP5:282}; {IP5:282}.<br />
142<br />
Reflexionsräume<br />
{IP1:240}; {IP3:123}; {IP3:125};<br />
{IP3:168}; {IP5:282}.<br />
Persönliche Eigenschaften<br />
{IP2:70-75}; {IP2:160}; {IP2:194};<br />
{IP3:25}; {IP5:220}.<br />
<strong>Protektive</strong> <strong>Faktoren</strong> in der Therapie<br />
{IP1:176}; {IP3:171}; {IP3:219-223};<br />
{IP3:171}; {IP4:72}; {IP4:102};<br />
{IP5:130}; {IP5:134}.<br />
Zeitliche Begrenzung der Arbeit<br />
{IP1:64-68}; {IP1:74}; {IP1:84-86};<br />
{P1:296}; {IP1:320}; {IP2:42};<br />
{IP3:125}; {IP4:8}; {IP4:26}; {IP5:106}.<br />
Begrenzung der Fallbelastung<br />
{IP2:176}; {IP3:171}; {IP3:219-223};<br />
{IP3:53-63}; {IP3:219}; {IP5:238}.<br />
Ausgleiche schaffen<br />
{IP2:42}; {IP3:47}; {IP5:110}.<br />
Klarer institutioneller Rahmen<br />
{IP3:175-179}; {IP3:181}; {IP5:262}.<br />
Einbeziehung anderer Institutionen<br />
{IP3:211-213}; {IP3:273-279}; {IP4:72};<br />
{IP4:116}.