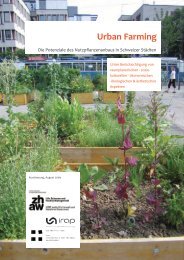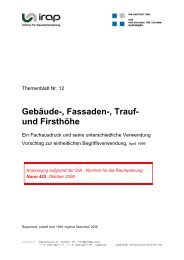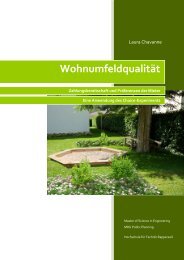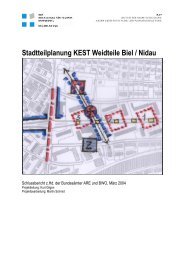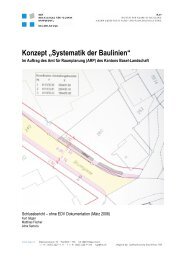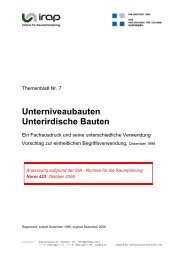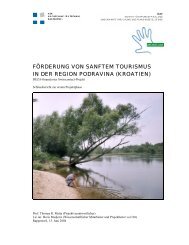Nr. 10: Lichte Höhe/Geschosshöhe - IRAP
Nr. 10: Lichte Höhe/Geschosshöhe - IRAP
Nr. 10: Lichte Höhe/Geschosshöhe - IRAP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong><br />
<strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong><br />
<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Ein Fachausdruck und seine unterschiedliche Verwendung<br />
Vorschlag zur einheitlichen Begriffsverwendung, April 1999<br />
Anpassung aufgrund der SIA - Normen für die Raumplanung<br />
Norm 423, Oktober 2006<br />
Rapperswil, erstellt April 1999, ergänzt Dezember 2006
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Institut für Raumentwicklung<br />
SIA Normen für die Raumplanung<br />
Folgende SIA – Normen für die Raumplanung existieren oder werden entwickelt und können beim<br />
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) www.sia.ch bezogen werden.<br />
Norm Titel / Name Inkrafttreten<br />
SIA 421 Nutzungsziffern Oktober 2006<br />
SIA 422 Bauzonenkapazität Voraussichtlich Ende 2007<br />
SIA 423 Gebäudedimensionen und Abstände Oktober 2006<br />
SIA 424 Darstellung der Rahmennutzungspläne Voraussichtlich Ende 2007<br />
SIA 425 Erschliessungsplanung Voraussichtlich Ende 2007<br />
In der folgenden Übersicht wird aufgezeigt, wie die unterschiedlichen Themenblätter in die SIA- Normen,<br />
respektive in die IVHB (Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe und<br />
Messweisen) eingeflossen sind.<br />
<strong>Nr</strong>. Titel Themenblatt Jahr<br />
SIA<br />
Norm<br />
IVHB<br />
Definitionen<br />
1 Nutzungsplanverfahren 1998 - -<br />
2 Gebäudegrundfläche 1998 SIA 421 -<br />
3 Gebäudegrundriss 1998 - -<br />
4 Fassadenlänge 1998 - -<br />
5 Gebäudelänge, -breite, -tiefe 1998 SIA 423 4.1, 4.2<br />
6 Kleinbauten, An- und Nebenbauten 1998 SIA 423 2.2, 2.3<br />
7 Unterniveaubauten 1998 SIA 423 2.5<br />
8 Niveaupunkt 2000 - -<br />
9 Dachdurchbrüche, Dachaufbauten,<br />
Dacheinschnitte, Dachflächenfenster<br />
1998 SIA 423 In Erläuterungen zu<br />
5.2, 5.2, 6.3<br />
<strong>10</strong> <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>, <strong>Geschosshöhe</strong> 1999 SIA 423 5.4<br />
11 Voll-, Unter-, Dach- und Attikageschoss 1999 SIA 423 6.1, 6.2, 6.3, 6.4<br />
12 Gebäude-, Fassaden-, Trauf- und Firsthöhe 1999 SIA 423 5.1, 5.2<br />
13 Nutzungsziffern (AZ, BMZ, ÜZ, GZ und FFZ) 1999 SIA 421 8.1 – 8.5<br />
11/06 SIA und IVHB Ergänzungen GIL / coa
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Vorbemerkung zu den Themenblätter<br />
Das <strong>IRAP</strong> hat sich in den Jahren 1998 – 2000 mit der Zusammenstellung der unterschiedlichen Definitionen<br />
von Fachausdrücken in den kantonalen Gesetzen befasst und sich für deren Vereinheitlichung<br />
eingesetzt. Das Resultat wurde in Form von Themenblättern veröffentlicht. Seit dem Jahre<br />
2000 engagiert sich der Verein „Normen für die Raumplanung“ in diesem Themenbereich. Die Resultate<br />
der Arbeiten werden Schritt für Schritt als SIA-Normen veröffentlicht. Die Bau-, Planungs- und<br />
Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) hat im November 2005 eine Interkantonale Vereinbarung zur<br />
Harmonisierung der Baubegriffe und Messweisen (IVHB) beschlossen. Deren Anhang 1 basiert auf<br />
den Normen des SIA und ist – soweit diese übernommen wurden – mit ihnen identisch. Das koordinierte<br />
Vorgehen bei der Normierung und Harmonisierung war dank der engen Zusammenarbeit des<br />
Bundesamtes für Raumentwicklung ARE der BPUK und des SIA zu Stande gekommen. Das <strong>IRAP</strong><br />
konnte in diesem ganzen Prozess als bearbeitendes und beratendes Institut mitwirken.<br />
Die nun vorliegenden Formulierungen gemäss der Normen und des Anhangs zum Konkordat IVHB<br />
ersetzen nun die ursprünglichen Vorschläge zur Vereinheitlichung der Begriffe. Sie wurden im Laufe<br />
der zahlreichen Diskussionen in verschiedenen Gremien und basierend auf Vernehmlassungen mehrfach<br />
verändert. Auch die Zusammenstellung der rechtskräftigen Gesetzesbestimmungen im Kapitel<br />
Anhang sind durch die Revisionen der Gesetze in einzelnen Kantonen nicht mehr in allen Teilen aktuell.<br />
In der vorliegenden Fassung der Themenblätter werden die ursprünglichen Formulierungen und<br />
Zusammenstellungen dennoch unverändert beibehalten. Dieser ursprüngliche Teil dient als Orientierungshilfe<br />
und hat nur noch teilweise Gültigkeit. Die entsprechenden Formulierungen der Normen SIA<br />
421 und 423 sowie des Anhangs 1 zur IVHB wird vorangestellt. Diese Gegenüberstellung möge dem<br />
Leser das Auffinden der entsprechenden heute aktuellen kantonalen Bestimmungen erleichtern und<br />
lässt Vergleiche zu. Bis zu einem gewissen Grad lassen sich damit auch die Überlegungen, die zur<br />
aktuellen Formulierung geführt haben, nachvollziehen.<br />
Im Folgenden werden die sich entsprechenden Inhalte der SIA-Normen und des IVHB-Anhangs den<br />
Inhalten der Themenblätter gegenübergestellt.<br />
Bemerkung zum Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong><br />
Empfehlung der Begriffe in Kapitel 3 überholt:<br />
<strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong><br />
<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Neue Formulierung in Normen SIA 423 und im<br />
Anhang 1 IVHB betreffend:<br />
<strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong><br />
<strong>Geschosshöhe</strong><br />
GIL / coa SIA und IVHB Ergänzungen 11/06
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Institut für Raumentwicklung<br />
11/06 SIA und IVHB Ergänzungen GIL / coa
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Auszug der SIA-Norm 423 und IVHB<br />
<strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong><br />
Hauteur de jour<br />
Die lichte <strong>Höhe</strong> ist der <strong>Höhe</strong>nunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Bodens und der<br />
Unterkante der fertigen Decke bzw. Balkenlage, wenn die Nutzbarkeit eines Geschosses durch die<br />
Balkenlage bestimmt wird.<br />
Die lichte <strong>Höhe</strong> dient als Hilfsgrösse zur Definition von wohnhygienischen und arbeitsphysiologischen<br />
Mindestanforderungen.<br />
Einzelne sichtbare Balken mindern beispielsweise die Nutzbarkeit der Raumhöhe noch nicht.Die<br />
Gebäudelänge ist die längere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die projizierte<br />
Fassadenlinie umfasst.<br />
<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Hauteur d’étage<br />
Die <strong>Geschosshöhe</strong> wird von Oberkante zuOberkante der fertigen Böden gemessen.<br />
Figur: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong> und <strong>Geschosshöhe</strong><br />
GIL / coa SIA und IVHB Ergänzungen 11/06
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Institut für Raumentwicklung<br />
Einleitung zu den Themenblättern 1998 - 2000<br />
In der Reihe Themenblätter stellt die Abteilung Raumplanung an der HSR Materialien zusammen,<br />
welche sowohl den Dozenten im Unterricht, den Studierenden - beispielsweise bei Semester- und<br />
Diplomarbeiten - als auch den Planungsfachleuten in der Praxis dienen mögen. Es handelt sich dabei<br />
um Zusammen- und Gegenüberstellungen unterschiedlicher Gesetzesregelungen in den Kantonen,<br />
um Betrachtungen zur damit verbundenen Praxis, um Vergleiche zwischen verschiedenen Definitionen<br />
von Fachausdrücken und um Analysen.<br />
Im Ringen um eine gemeinsame Fachsprache, um Annäherung und schliesslich Vereinheitlichung all<br />
dessen, was - unter Wahrung eines zweckdienlichen Gesetzesföderalismus - in der Schweiz verantwortet<br />
werden kann, legen wir mit den Materialien auch Vorschläge vor. Diese sind mit der Hoffnung<br />
verbunden, dass sich die kantonalen Planungs- und Baugesetze hinsichtlich der verwendeten Fachausdrücke<br />
nach und nach annähern werden und dass damit eine einheitlichere Fachsprache der<br />
Raumplanung entsteht. Vielleicht wird dann auch einmal ein Bundesrahmengesetz über das Bauwesen<br />
mit einer einheitlichen Begriffsbildung, als Grundlage für die Ausführungsgesetze in den Kantonen,<br />
möglich.<br />
Die Themenblätter stellen auch ein Gefäss dar, wo Forschungsresultate, die in der Praxis dienlich<br />
sein können, sich aber wegen ihres bescheidenen Umfanges nicht für eine grössere Publikation eignen,<br />
Planungsfachleuten zugänglich gemacht werden können.<br />
Es liegt im Wesen solcher Veröffentlichungen, dass sie weder vollständig noch fehlerfrei sein können;<br />
zudem veralten sie häufig sehr schnell. Ein Grund besteht allein schon darin, dass kaum ein Jahr<br />
vergeht, ohne dass nicht zwei, drei Kantone ihre Planungs- und Baugesetze revidieren. Es ist vorgesehen,<br />
die Themenblätter periodisch zu korrigieren, zu ergänzen und zu aktualisieren.<br />
Kurt Gilgen<br />
11/06 SIA und IVHB Ergänzungen GIL / coa
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Inhalt<br />
1. Definitionen ................................................................................................................................. 1<br />
1.1 <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong> ................................................................................................................................... 1<br />
1.2 <strong>Geschosshöhe</strong> .............................................................................................................................. 2<br />
1.3 Überschreitung der maximalen <strong>Geschosshöhe</strong>............................................................................ 2<br />
2. Einfluss auf die Gestaltung........................................................................................................ 2<br />
2.1 <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong> ................................................................................................................................... 2<br />
2.2 <strong>Geschosshöhe</strong> .............................................................................................................................. 2<br />
3. Empfehlungen ............................................................................................................................. 2<br />
4. Anhang: Beispiele aus kantonalen Gesetzen .......................................................................... 4<br />
4.1 Aussagen zu lichter <strong>Höhe</strong>, Mindestanforderungen an Wohn- und Arbeitsräume ........................ 4<br />
4.2 Aussagen zur <strong>Geschosshöhe</strong>....................................................................................................... 6<br />
4.3 Aussagen zur Kompetenzverteilung ............................................................................................. 7<br />
4.4 Aussagen zum Inhalt des Baugesuchs......................................................................................... 7
Themenblatt <strong>Nr</strong>. 6: Klein-, An- und Nebenbauten<br />
Institut für Raumentwicklung<br />
11/06 SIA und IVHB Ergänzungen GIL / coa
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
1. Definitionen<br />
1.1 <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong><br />
Als lichte <strong>Höhe</strong> wird der – im Licht stehende – Raum zwischen Oberkant Fussboden und Unterkant<br />
Decke definiert. Sie wird hauptsächlich zur Festlegung der Mindestanforderungen in Wohn- und Arbeitsräumen<br />
angewendet. Bei Balkendecken wird die lichte <strong>Höhe</strong> von Oberkant Fussboden bis Unterkant<br />
Balken gemessen.<br />
Im Kanton FR wird die lichte <strong>Höhe</strong> als Stockwerkhöhe bezeichnet.<br />
lichte <strong>Höhe</strong><br />
<strong>Geschosshöhe</strong><br />
lichte <strong>Höhe</strong><br />
<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Abb. 1:<br />
Unterscheidung von lichter <strong>Höhe</strong> und <strong>Geschosshöhe</strong>.<br />
Bei der Festlegung der minimalen lichten <strong>Höhe</strong> für Wohn- und Arbeitsräume ist eine grosse Regelvielfalt<br />
festzustellen:<br />
• BE, BL, SH: 2.3 m<br />
• BS: 2.3 – 2.5 m (zonenspezifisch)<br />
• FR: 2.4 m (Stockwerkhöhe)<br />
• GL: 2.2 m<br />
• LU: 2.2 m (in Dach-/Untergeschossen sowie in EFH), 2.3 m (in MFH)<br />
• NW: 2.1 m (in Dach-/Untergeschossen sowie in EFH), 2.2 m (in MFH)<br />
• SO: 2.2 m (in Dach-/Untergeschossen), 2.4 m (in übrigen Geschossen)<br />
Für Räume in Dachgeschossen, die dem ständigen Aufenthalt (wohnen und arbeiten) dienen, gelten<br />
spezielle Mindestanforderungen der lichten <strong>Höhe</strong>:<br />
• BE: Mindesthöhe (2.3 m) auf über 2 / 3 resp. 1 / 2 (EFH) der anrechenbaren Bodenfläche.<br />
• BL: Mindesthöhe (2.3 m) in Räumen mit Dachschräge auf mindestens 8 m 2 (MFH, Doppel-EFH,<br />
Reihen-EFH).<br />
• FR, GL, NW: Mindesthöhe (FR: 2.4 m, GL: 2.2 m, NW 2.1 m) in Dachgeschossen und abgeschrägten<br />
Räumen auf mindestens 1 / 2 der Bodenfläche.<br />
• LU: Mindestfläche mit lichter <strong>Höhe</strong> 2.3 m ist <strong>10</strong> m 2 ; Mindesthöhe in abgeschrägten Räumen auf 1 / 2<br />
der Fläche.<br />
• SO: Mindesthöhe in Dachstock und bewohnten Kellerräumlichkeiten mindestens 2.2 m.<br />
GIL / ds Themenblatt 04/99<br />
1
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
1.2 <strong>Geschosshöhe</strong><br />
Die <strong>Geschosshöhe</strong> wird in der Regel von Oberkant zu Oberkant der fertigen Bodenkonstruktion gemessen<br />
(Abb. 1). In einigen Kantonen werden – u.a. zur Berechnung der zulässigen Gebäudehöhe –<br />
maximale durchschnittliche <strong>Geschosshöhe</strong>n festgelegt:<br />
• AG, LU, NW, OW, TG: 3.0 m<br />
• BL: 3.5 m<br />
• ZH: 3.3 – 4.0 m<br />
1.3 Überschreitung der maximalen <strong>Geschosshöhe</strong><br />
In den Kantonen LU und NW kann für Bauten mit Geschäfts- und Gewerbebetrieben die maximale<br />
<strong>Höhe</strong> der Vollgeschosse (3.0 m) überschritten werden, wenn dies nachweisbar betriebsbedingt ist. Im<br />
Kanton LU beträgt dieser Zuschlag gesamthaft 1.5 m und im Kanton NW darf die Gesamthöhe des<br />
Gebäudes dadurch um nicht mehr als 3 m zunehmen.<br />
2. Einfluss auf die Gestaltung<br />
2.1 <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong><br />
Durch die Festlegung der lichten <strong>Höhe</strong> soll hauptsächlich das Innere einer Baute beeinflusst und damit<br />
die Wohnlichkeit und die minimalen hygienischen Anforderungen gewährleistet werden.<br />
2.2 <strong>Geschosshöhe</strong><br />
Da die Gebäudehöhe in einigen Kantonen (vgl. Themenblatt 12) auch über die zulässige Anzahl der<br />
Vollgeschosse definiert werden darf, kann die maximale <strong>Geschosshöhe</strong> einen direkten Einfluss auf<br />
das Erscheinungsbild einer Baute und der Siedlung haben. Über die maximale <strong>Geschosshöhe</strong> und die<br />
zulässige Geschosszahl kann – z.B. in Verbindung mit der Überbauungsziffer – direkt auch der maximal<br />
umbaubare Raum festegelegt werden. Grenzbaumasse wie maximale <strong>Geschosshöhe</strong> und zulässige<br />
Anzahl Geschosse wirken sich in dieser Kombination auf die Nutzungsintensität aus.<br />
3. Empfehlungen<br />
Hinsichtlich der lichten <strong>Höhe</strong> und der <strong>Geschosshöhe</strong>n bestehen in der Schweiz keine nennenswerten<br />
Definitionsunterschiede. Die Empfehlungen können sich demnach auf die Bemessung beschränken.<br />
Wo die Nutzungsplanung keine zonenspezifischen Festlegungen enthält, sollen folgende<br />
Masse beachtet werden:<br />
04/99 Themenblatt GIL / ds<br />
2
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
• Minimale lichte <strong>Höhe</strong><br />
In Räumen die vorwiegend dem Wohnen oder Arbeiten dienen, gilt eine minimale lichte <strong>Höhe</strong> von 2.2<br />
m. In Dachgeschossräumen muss für diese Nutzungszwecke die minimale lichte <strong>Höhe</strong> auf mindestens<br />
<strong>10</strong> m 2 der Dachgeschossfläche erreicht werden.<br />
• Maximale <strong>Geschosshöhe</strong>n<br />
Für die Bemessung der zulässigen Gebäudehöhe wird von einer maximal anzunehmenden <strong>Geschosshöhe</strong><br />
von 3.0 m für Normalgeschosse und 4.5 m für Erdgeschosse mit gewerblicher Nutzung<br />
ausgegangen. Im übrigen sind dabei die Geschossdefinitionen (vgl. Themenblatt 11) zu beachten.<br />
GIL / ds Themenblatt 04/99<br />
3
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
4. Anhang: Beispiele aus kantonalen Gesetzen<br />
4.1 Aussagen zu lichter <strong>Höhe</strong>, Mindestanforderungen an Wohn- und Arbeitsräume<br />
BE<br />
Wohn- und Arbeitsräume müssen wenigstens eine lichte <strong>Höhe</strong> von 2.3 m aufweisen. In abgeschrägten<br />
Räumen muss die Mindesthöhe wenigstens über zwei Dritteln, bei Einfamilienhäusern<br />
über der Hälfte der anrechenbaren Bodenfläche (Abs. 3) vorhanden sein. Die<br />
Bodenfläche von Wohnräumen, Zimmer für häusliche Arbeiten ausgenommen, muss wenigstens<br />
8 m 2 betragen; Raumteile mit einer lichten <strong>Höhe</strong> unter 1.5 m werden nicht angerechnet.<br />
(BE BauV Art. 67)<br />
BL<br />
Das lichte Mass der Fensterfläche von Wohn- und Schlafzimmern, Küchen und Räumen, in<br />
denen regelmässig gearbeitet wird, muss mindestens 1/<strong>10</strong> der Bodenfläche betragen.<br />
In Dachräumen liegt der erforderlichen Fensterfläche diejenige Bodenfläche zugrunde, über<br />
der die lichte <strong>Höhe</strong> mindestens 1.20 m beträgt. Es können schrägliegende Fenster eingebaut<br />
werden, sofern feuerpolizeiliche Rettungsmassnahmen möglich sind.<br />
Die ausschliessliche Belichtung von dauernd benutzten Räumen über Lichtschächte ist unzulässig.<br />
Für Industrie- und Gewerbebauten gelten die Bestimmungen der Arbeitsgesetzgebung.<br />
(BL RBV § 73)<br />
Wohn- und Schlafzimmer, Küchen und weitere Räume, in denen regelmässig gearbeitet wird,<br />
müssen eine lichte <strong>Höhe</strong> von mindestens 2.30 m aufweisen.<br />
Bei sichtbarer Balkenlage muss die lichte <strong>Höhe</strong> zwischen Bodenfläche und Balkenunterkante<br />
eingehalten werden.<br />
Bei Mehrfamilienhäusern, Doppel- und Reiheneinfamilienhäusern muss bei Dachschrägen in<br />
Räumen im Sinne von Absatz 1 über mindestens 6 m 2 die lichte <strong>Höhe</strong> von 2.30 m eingehalten<br />
werden.<br />
(BL RBV § 74)<br />
BS<br />
Wohnräume im Sinne von § 144 müssen bei Neubauten mindestens die folgenden Masse<br />
aufweisen:<br />
1. <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong> 2.50 m, wo nicht in den Zonenvorschriften (Anhang § 7) ein niedrigeres<br />
Mass zugelassen ist. Für Wohnräume, die über dem obersten vollausge- bauten Geschosse<br />
liegen, darf die vorgeschriebene lichte <strong>Höhe</strong> für höchstens die halbe Bodenfläche<br />
jeden Raumes vermindert werden.<br />
(…)<br />
(BS HBG § 169)<br />
Das Mindestmass der lichten <strong>Höhe</strong> von Wohnräumen wird gemäss § 169 des Gesetzes festgelegt:<br />
für die Zonen 6, 5, 5a, 4 und 3 auf 2.50 m,<br />
für die Zonen 2 und 2a auf 2.30 m.<br />
(BS Anhang HBG § 7)<br />
04/99 Themenblatt GIL / ds<br />
4
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
FR<br />
Die Fläche, die <strong>Höhe</strong>, das Ausmass, die Beleuchtung, die Sonneneinstrahlung, die Lüftung,<br />
die Schallisolation von Wohn- oder Arbeitsräumen sowie der Schutz gegen schädliche Einwirkungen<br />
von aussen müssen je nach Zweckbestimmung und den örtlichen Verhältnissen den<br />
hygienischen Anforderungen entsprechen.<br />
(FR RPBG Art. 158)<br />
Die Stockwerkhöhe von Wohnräumen (<strong>Höhe</strong> zwischen Fussboden und Decke) darf nicht unter<br />
2.40 m liegen. Folgt die Decke der Dachneigung, muss die minimale Stockwerkhöhe wenigstens<br />
auf der Hälfte der Fläche jedes Raumes eingehalten werden.<br />
(FR ARRPBG Art. 43)<br />
GL<br />
LU<br />
NW<br />
SH<br />
SO<br />
Alle zum Aufenthalt von Menschen dienenden Räume müssen wenigstens 2.20 m lichte <strong>Höhe</strong><br />
haben. Bei Räumen im Dachgeschoss muss wenigstens für die Hälfte der Bodenfläche diese<br />
<strong>Höhe</strong> vorhanden sein.<br />
(GL BauV Art. 3)<br />
Die zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Räume müssen ihrer Zweckbestimmung entsprechend<br />
genügend gross sein. Bei Mehrfamilienhäusern haben die Wohn- und Schlafräume<br />
eine Bodenfläche von mindestens <strong>10</strong> m 2 und eine lichte <strong>Höhe</strong> von mindestens 2.3 m aufzuweisen.<br />
Im Dach- und Untergeschoss und bei Einfamilienhäusern genügt eine <strong>Höhe</strong> von mindestens<br />
2.2 m; in abgeschrägten Räumen muss diese <strong>Höhe</strong> mindestens bei der Hälfte des<br />
Zimmers eingehalten werden.<br />
(LU PBG § 154)<br />
Bei Mehrfamilienhäusern haben diese Räume eine Bodenfläche von mindestens 8 m 2 und<br />
eine lichte <strong>Höhe</strong> von mindestens 2.20 m aufzuweisen. Im Dach- und Untergeschoss sowie bei<br />
Einfamilienhäusern genügt eine <strong>Höhe</strong> von 2.<strong>10</strong> m; in abgeschrägten Räumen muss diese <strong>Höhe</strong><br />
mindestens bei der Hälfte des Zimmers eingehalten werden.<br />
(NW BauG Art. 174)<br />
Zum Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume haben mindestens 6 m 2 Bodenfläche und<br />
eine lichte <strong>Höhe</strong> von 2.3 m aufzuweisen. Sie sind durch ins Freie gehende Fenster, deren<br />
Lichtmass nicht weniger als den zehnten Teil der Bodenfläche betragen darf, zu belichten.<br />
(SH BauG Art. 43)<br />
Wohn- und Schlafräume sowie Räume, in welchen regelmässig gearbeitet wird, müssen folgende<br />
Bedingungen erfüllen:<br />
a) ihre durchschnittliche lichte <strong>Höhe</strong> muss im Dachstock und in bewohnten Keller- räumlichkeiten<br />
mindestens 2.20 m, in den übrigen Geschossen mindestens 2.40 m betragen;<br />
(…)<br />
(SO KBV § 57)<br />
GIL / ds Themenblatt 04/99<br />
5
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
4.2 Aussagen zur <strong>Geschosshöhe</strong><br />
AG<br />
BL<br />
LU<br />
NW<br />
OW<br />
TG<br />
Untergeschoss, Dach- und Attikageschoss gelten nicht als Vollgeschoss. Die <strong>Geschosshöhe</strong><br />
wird von Oberkant zu Oberkant der fertigen Konstruktion gemessen. Soweit die Gemeinden<br />
nichts anderes festlegen, beträgt die <strong>Höhe</strong> der Vollgeschosse im Durchschnitt höchstens 3 m.<br />
(AG ABauV § 14)<br />
(…)<br />
Massgebend für die Berechnung des Grenzabstandes sind die Fassadenlängen und die Geschosszahlen.<br />
Unabhängig von den in den Zonenvorschriften der Gemeinde festgelegten Gebäudeprofilen<br />
gilt für die Bemessung des Grenzabstandes eine Fassadenhöhe bis 4.5 m als<br />
eingeschossig. Für weitere Geschosse kommen je 3.5 m dazu.<br />
(…)<br />
(BL RBV § 52)<br />
Die Gebäudehöhe ergibt sich aus der Zahl der zulässigen Vollgeschosse. Dabei dürfen für die<br />
<strong>Höhe</strong> der einzelnen Geschosse im Durchschnitt höchstens 3 m eingesetzt werden. Bei Bauten<br />
mit Geschäfts- und Gewerbebetrieben kann gesamthaft ein Zuschlag bis zu 1,5 m gewährt<br />
werden, wenn es nachweisbar betriebsbedingt ist.<br />
(LU PBG § 139)<br />
Die Gebäudehöhe ergibt sich aus der Zahl der zulässigen Vollgeschosse. Dabei dürfen für die<br />
<strong>Höhe</strong> der Vollgeschosse im Durchschnitt höchstens 3 m eingesetzt werden. Bei Bauten mit<br />
Geschäfts- und Gewerbebetrieben darf diese <strong>Höhe</strong> je Vollgeschoss überschritten werden,<br />
wenn dies nachweisbar betriebsbedingt ist, und die Gesamthöhe des Gebäudes nicht um<br />
mehr als 3 m zunimmt.<br />
(NW BauG Art. 163)<br />
Die Geschosszahl entspricht der Zahl der Vollgeschosse. Bei Gebäuden mit überhohen Räumen<br />
werden jeweils 3.0 m Raumhöhe als Geschoss angerechnet.<br />
(OW BauG Art. 45)<br />
Die <strong>Höhe</strong> der einzelnen Vollgeschosse darf im Durchschnitt höchstens 3 m betragen. Als<br />
<strong>Geschosshöhe</strong> gilt die <strong>Höhe</strong> von oberkant fertig Boden bis oberkant fertig Boden. Bei vertikal<br />
oder horizontal gestaffelten Bauten wird die <strong>Höhe</strong> jeder Einheit für sich gemessen.<br />
(TG PBV § 8)<br />
Erlaubt die geplante Gebäudehöhe den nachträglichen Einbau weiterer Geschosse, sind die<br />
entsprechenden Geschossflächen anzurechnen, wobei von einer durchschnittlichen <strong>Geschosshöhe</strong><br />
von 3.0 m auszugehen ist.<br />
(TG PBV § <strong>10</strong>)<br />
ZH<br />
Wo die Bau- und Zonenordnung nichts anderes bestimmt, ist für die Gebäudehöhe aufgrund<br />
der erlaubten Vollgeschosszahl mit einer Bruttogeschosshöhe von 3,3 m, in Zentrums- und<br />
Industriezonen von 4 m, und zusätzlich mit 1,5 m für die Erhebung des Erdgeschosses zu<br />
rechnen.<br />
(ZH PBG § 279)<br />
04/99 Themenblatt GIL / ds<br />
6
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
4.3 Aussagen zur Kompetenzverteilung<br />
GL<br />
LU<br />
NW<br />
Der Regierungsrat erlässt Vorschriften über:<br />
(…)<br />
b. die minimalen <strong>Geschosshöhe</strong>n und Raumgrössen, die Art und Grösse der Fenster, sowie<br />
über die sanitäre Ausstattung bei Wohnungen und Arbeitsräumen.<br />
(…)<br />
(GL RPBG Art. 30)<br />
Die Gemeinden erlassen in den Bau- und Zonenreglementen allgemeine Bau- und Nutzungsvorschriften<br />
für das ganze Gemeindegebiet und spezielle Bau- und Nutzungsvorschriften für<br />
die einzelnen Zonen.<br />
Soweit notwendig, sind insbesondere Vorschriften zu erlassen über<br />
(…)<br />
2. Gebäude- und Firsthöhe, Gebäudelänge, Gebäudetiefe, Geschosszahl, <strong>Geschosshöhe</strong>,<br />
Gestaltung der Bauten.<br />
(…)<br />
(LU PBG § 36)<br />
In den Bau- und Zonenreglementen erlassen die Gemeinden Bau- und Nutzungsvorschriften<br />
für das ganze Gemeindegebiet und spezielle Bau- und Nutzungsvorschriften für die einzelnen<br />
Zonen.<br />
Soweit notwendig, sind im Rahmen dieses Gesetzes insbesondere Vorschriften zu erlassen<br />
über:<br />
(…)<br />
2. Gebäude- und Firsthöhe, Gebäudelänge, Gebäudetiefe, Geschosszahl, <strong>Geschosshöhe</strong>,<br />
Gestaltung der Bauten<br />
(…)<br />
(NW BauG Art. 50)<br />
4.4 Aussagen zum Inhalt des Baugesuchs<br />
BE<br />
NW<br />
Dem Baugesuch sind folgende Projektpläne im Massstab 1:<strong>10</strong>0 oder 1:50 beizulegen:<br />
(…)<br />
b) die zum Verständnis des Bauvorhabens nötigen Schnitte mit Angabe der Hauptdimensionen,<br />
der lichten <strong>Geschosshöhe</strong>n,<br />
(…)<br />
(BE BewD Art. 14)<br />
Dem Baugesuch sind in dreifacher Ausführung beizulegen:<br />
(…)<br />
3. die Grundrisse aller Geschosse einschliesslich Keller und Dachgeschoss sowie die Fassaden-<br />
und Schnittpläne im Massstab 1:<strong>10</strong>0 oder 1:50; die Pläne müssen vollständige Angaben<br />
enthalten über: Erdgeschoss-, Fassaden-, Gebäude- und Firsthöhen in Metern über<br />
Meer, Aussenmasse, Stockwerk- und lichte Raumhöhen,<br />
(…)<br />
(NW BauG Art. 217)<br />
GIL / ds Themenblatt 04/99<br />
7
Themenblatt <strong>Nr</strong>. <strong>10</strong>: <strong>Lichte</strong> <strong>Höhe</strong>/<strong>Geschosshöhe</strong><br />
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong><br />
VS<br />
Die Projektpläne sind nach den Regeln der Baukunst im Massstab 1: 50 oder 1: <strong>10</strong>0 zu erstellen,<br />
zu datieren und vom Projektverfasser und vom Bauherrn zu unterzeichnen. Für wichtige<br />
Bauvorhaben kann die zuständige Baubewilligungsbehörde Baupläne im Massstab 1: 200<br />
oder 1: 500 gestatten. Sie enthalten alle zum Verständnis des Bauvorhabens und für die Kontrolle<br />
der Einhaltung der Bauvorschriften nötigen Unterlagen, namentlich:<br />
(…)<br />
b) die zum Verständnis des Bauvorhabens nötigen Schnitte mit Angabe der lichten <strong>Geschosshöhe</strong>n,<br />
die Angabe des natürlich gewachsenen und des fertigen Bodens, die Angabe<br />
des im Situationsplan eingetragenen Fixpunktes betreffend die <strong>Höhe</strong>. Die Lage der<br />
Schnitte ist im Situationsplan oder im Erdgeschossgrundriss einzutragen;<br />
(…)<br />
(VS BauV Art. 35)<br />
Die Themenblätter können bezogen werden bei:<br />
Institut für Raumentwicklung <strong>IRAP</strong> HSR, Oberseestr. <strong>10</strong>, CH-8640 Rapperswil<br />
Tel. 055 222 48 95 – Fax: 055 222 44 00 – E-Mail: irap@hsr.ch –<br />
Internet: http://www.irap.ch<br />
04/99 Themenblatt GIL / ds<br />
8