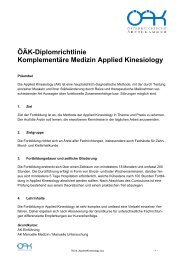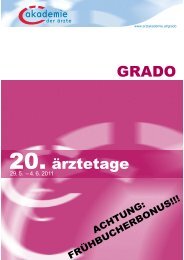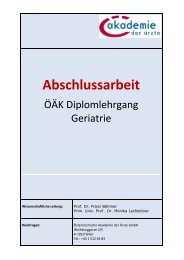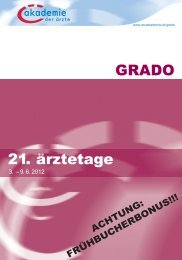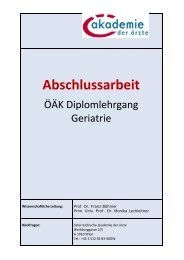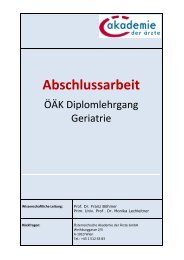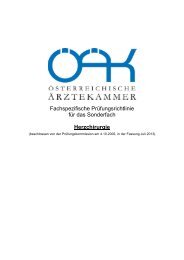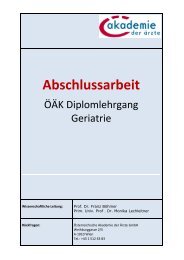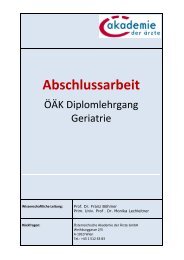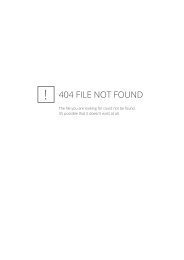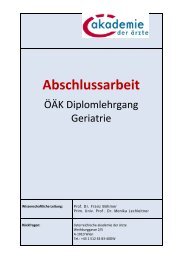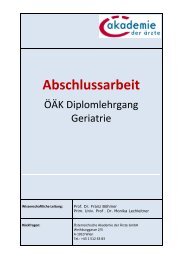Motivierende Gesprächsführung unter dem Aspekt der ...
Motivierende Gesprächsführung unter dem Aspekt der ...
Motivierende Gesprächsführung unter dem Aspekt der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong><br />
<strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong> Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
ÖÄK Diplom für Kurmedizin, Präventivmedizin und Wellness – Modul 1<br />
15. 6. 2013 Bad Hofgastein<br />
10:30 -11:15<br />
Dr. Christa Reinecker-Hecht<br />
Gesundheits- und Klinische Psychologin<br />
Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie)<br />
Lehrtherapeutin<br />
0662/627820<br />
christareinecker@elsnet.at
Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
Antoine de Saint-Exupéry:<br />
Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,<br />
Aufgaben zu verteilen, son<strong>der</strong>n lehre die Männer die Sehnsucht nach <strong>dem</strong> endlosen weiten Meer<br />
© Christa Reinecker 2013 2
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong> <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
Überblick<br />
• Einleitung<br />
• Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung (Prochaska & DiClemente)<br />
• <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> (Miller & Rollnik)<br />
• Selbstmanagement (Kanfer, Reinecker & Schmelzer)<br />
• Ziele<br />
• Wi<strong>der</strong>stand<br />
• Weitere Gesprächs- und Motivationsstrategien, konkrete Umsetzung<br />
© Christa Reinecker 2013 3
Motivation für Kuraufenthalt<br />
≠<br />
Motivation zur Verhaltens-,Lebensstilän<strong>der</strong>ung<br />
© Christa Reinecker 2013 4
Ziel des Gesprächs<br />
Unterstützung des Patienten, ein<br />
(realistisches) Ziel für eine Verän<strong>der</strong>ung<br />
zu sehen und Schritte in diese Richtung<br />
zu setzen<br />
© Christa Reinecker 2013<br />
5
Voraussetzung<br />
zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Verständnis für die Problematik des Patienten und<br />
dessen mögliche Schwierigkeiten betreffend einer<br />
Verän<strong>der</strong>ung<br />
• Zuerst verstehen, um dann verstanden zu werden –<br />
Erfahren <strong>der</strong> aktuellen Motivationslage (wozu ist <strong>der</strong><br />
Patient gerade motiviert?)<br />
© Christa Reinecker 2013 6
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong> <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
Überblick<br />
• Einleitung<br />
• Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung (Prochaska & DiClemente)<br />
• <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> (Miller & Rollnik)<br />
• Selbstmanagement (Kanfer, Reinecker & Schmelzer)<br />
• Ziele<br />
• Wi<strong>der</strong>stand<br />
• Weitere Gesprächsstrategien, konkrete Umsetzung<br />
© Christa Reinecker 2013 7
Menschen sind niemals unmotiviert, die<br />
Frage ist nur, wozu sind sie motiviert....?<br />
© Christa Reinecker 2013 8
„Current Concerns“<br />
Pie of life:<br />
IST<br />
SOLL<br />
Ist-Kuchen<br />
Soll-Kuchen<br />
Engagement in verschiedenen Lebensbereichen<br />
Christa Reinecker 2013
Grundlegende Motivationsfragen<br />
– Wie wird mein Leben sein, falls ich mich än<strong>der</strong>e?<br />
– Wie werde ich besser dastehen, falls ich mich än<strong>der</strong>e?<br />
– Kann ich es schaffen?<br />
– Was muss ich für eine Än<strong>der</strong>ung investieren?<br />
(„Lohnt es sich?“)<br />
– Kann ich auf die Unterstützung dieses Arztes, Therapeuten,<br />
dieser Institution bauen?<br />
© Christa Reinecker 2013 10
Komponenten <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
nach Miller & Rollnik(2002)<br />
• Ich will mich än<strong>der</strong>n - Überzeugung<br />
• Ich kann mich än<strong>der</strong>n - Vertrauen<br />
• Ich werde mich än<strong>der</strong>n - Bereitschaft<br />
© Christa Reinecker 2013 11
Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Positivaussagen:<br />
– „Es ist wichtig, weil...“<br />
– „Ich habe es schon einmal geschafft“<br />
– „Jetzt ist <strong>der</strong> Zeitpunkt, ich habe schon probiert..“<br />
• Negativaussagen:<br />
– „Warum sollte ich ...“<br />
– „Es ist nicht meine Schuld“<br />
– „Jetzt nicht, erst...“<br />
© Christa Reinecker 2013 12
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong> <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
Überblick<br />
• Einleitung<br />
• Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung (Prochaska & DiClemente)<br />
• <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> (Miller & Rollnik)<br />
• Selbstmanagement (Kanfer, Reinecker & Schmelzer)<br />
• Ziele<br />
• Wi<strong>der</strong>stand<br />
• Weitere Gesprächs- und Motivationsstrategien, konkrete Umsetzung<br />
© Christa Reinecker 2013 13
Transtheoretisches Modell – Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung<br />
Prochaska & Di Clemente<br />
(1982)<br />
© Christa Reinecker 2013 14
Je nach<strong>dem</strong>, in welcher Phase sich <strong>der</strong> Patient befindet, können<br />
<strong>unter</strong>schiedliche Strategien sinnvoll und notwendig sein, um die<br />
Än<strong>der</strong>ungsmotivation zu <strong>unter</strong>stützen<br />
© Christa Reinecker 2013 15
Patient sieht selber keine<br />
Notwendigkeit für eine Verän<strong>der</strong>ung<br />
„Ich habe kein<br />
Problem,......“<br />
© Christa Reinecker 2013 16
Person überlegt Verän<strong>der</strong>ung<br />
„Irgendwie<br />
möchte ich mich<br />
än<strong>der</strong>n, aber...“<br />
© Christa Reinecker 2013 17
Person wägt Vor- und Nachteile ab<br />
„ Ich möchte mich jetzt än<strong>der</strong>n“<br />
© Christa Reinecker 2013 18
Person setzt erste Schritte in<br />
Richtung Än<strong>der</strong>ung,<br />
Erweiterung des<br />
Verhaltensrepertoires<br />
„Ich bin dabei,<br />
etwas zu<br />
versuchen...“<br />
© Christa Reinecker 2013 19
Integration <strong>der</strong><br />
Verän<strong>der</strong>ung in<br />
Lebensstil, Vorbeugung<br />
von Rückschritten<br />
„Ich habe mich<br />
verän<strong>der</strong>t“<br />
© Christa Reinecker 2013 20
Ausrutscher, Rückschritte<br />
gehören dazu<br />
„ich kann aus meiner<br />
Erfahrung lernen...“<br />
© Christa Reinecker 2013 21
Idealverlauf vs. realistischer<br />
Verlauf und Umgang mit<br />
Rückschritten<br />
© Christa Reinecker 2013 22
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong> <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
Überblick<br />
• Einleitung<br />
• Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung (Prochaska & DiClemente)<br />
• <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> (Miller & Rollnik)<br />
• Selbstmanagement (Kanfer, Reinecker, Schmelzer)<br />
• Ziele<br />
• Wi<strong>der</strong>stand<br />
• Weitere Gesprächs- und Motivationsstrategien, konkrete Umsetzung<br />
© Christa Reinecker 2013 23
Motivational Interviewing<br />
Miller & Rollnik(2002)<br />
Wie kann man Menschen <strong>unter</strong>stützen, die ein<br />
schädigendes Verhalten nicht än<strong>der</strong>n wollen,<br />
sich dazu nicht in <strong>der</strong> Lage fühlen o<strong>der</strong> eine<br />
Verän<strong>der</strong>ung nicht weiterführen können/<br />
wollen.<br />
© Christa Reinecker 2013 24
Grundlegende Prinzipien des MI<br />
(nach Fuller & Taylor, 2013)<br />
• Empathie zeigen (express empathy): Der Therapeut nimmt eine<br />
klientenzentrierte, akzeptierende Haltung ein und versucht, durch aktives<br />
Zuhören (reflective listening) die Situation aus <strong>der</strong> Sicht des Klienten zu<br />
betrachten und zu verstehen.<br />
• Diskrepanz erzeugen (develop discrepancy): Hierbei wird mit Hilfe von<br />
gezielten (offenen) Fragen direktiv vorgegangen und das Problembewusstsein<br />
gestärkt, um <strong>dem</strong> Pat. zu helfen, Argumente für eine Än<strong>der</strong>ung zu entwickeln<br />
(change talk).<br />
• Wenn <strong>dem</strong> Klienten deutlich wird, dass sein momentanes Verhalten im<br />
Wi<strong>der</strong>spruch zu wichtigen Zielen und Vorstellungen für seine Zukunft steht<br />
(kognitive Dissonanz), kann dies die Verän<strong>der</strong>ungsbereitschaft (intrinsische<br />
Motivation) stärken.<br />
© Christa Reinecker 2013 25
Grundlegende Prinzipien des M - Fortsetzung<br />
(nach Miller & Rollnik, 2012, Fuller & Taylor, 2013)<br />
• flexibler Umgang mit Wi<strong>der</strong>stand (roll with resistence): Ambivalenz o<strong>der</strong><br />
Wi<strong>der</strong>stand werden als normaler Teil des Verän<strong>der</strong>ungsprozesses (und nicht als<br />
"krankhaft") angesehen, auf konfrontatives Vorgehen wird verzichtet.<br />
Mit Hilfe von aktivem Zuhören wird erneut das Finden eigener Lösungswege<br />
<strong>unter</strong>stützt (Verständnis, Analyse etc. s. u.!).<br />
• Selbstwirksamkeit stärken (support self-efficacy), in<strong>dem</strong> <strong>der</strong> Klient in <strong>der</strong><br />
Zuversicht bestärkt wird, Verän<strong>der</strong>ungen erreichen zu können. Hierbei handelt<br />
es sich um einen zentralen <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong> Motivation, <strong>der</strong> sich generell als wichtig<br />
für den Behandlungserfolg erwiesen hat.<br />
© Christa Reinecker 2013 26
Zentrale Gesprächsfertigkeiten beim MI<br />
• aktives Zuhören und Zusammenfassen (reflective listening) (“Habe ich Sie richtig<br />
verstanden...?“)<br />
• offene Fragen (nicht mehr als drei hintereinan<strong>der</strong>!) auf die Nachteile des<br />
momentanen Verhaltens und die Vorteile einer Verän<strong>der</strong>ung (change talk) lenken<br />
("Welche Vorteile hätte es, aufzuhören?“)<br />
• Bestätigen („Da haben Sie recht,...)“<br />
• selbstmotivierende Haltungen des Klienten hinsichtlich Problemeinsicht, Bedenken<br />
und Verän<strong>der</strong>ungsbereitschaft hervorlocken und selektiv verstärken („Ich kann,<br />
will, werde mich än<strong>der</strong>n....“)<br />
• <strong>dem</strong> Klienten mit <strong>der</strong> Haltung begegnen, dass er stets die freie Wahl hat und selbst<br />
Entscheidungsfreiheit kann, was er möchte („Es liegt bei Ihnen, wie Sie sich<br />
entscheiden, was Sie aus <strong>dem</strong> Aufenthalt machen.“<br />
© Christa Reinecker 2013 27
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong> <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
Überblick<br />
• Einleitung<br />
• Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung (Prochaska & DiClemente)<br />
• <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> (Miller & Rollnik)<br />
• Selbstmanagement (Kanfer, Reinecker & Schmelzer)<br />
• Ziele<br />
• Wi<strong>der</strong>stand<br />
• Weitere Gesprächs- und Motivationsstrategien, konkrete Umsetzung<br />
© Christa Reinecker 2013 28
Selbstmanagement<br />
Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2012<br />
= Methode und Ziel<br />
Der Patient lernt im Idealfall, sein eigener Therapeut zu werden<br />
© Christa Reinecker 2013 29
Selbstregulation<br />
Modell <strong>der</strong> Selbstregulation (Kanfer & Karoly, 1972)<br />
1. Selbstbeobachtung und Selbstregistrierung<br />
2. Selbstbewertung und Vergleich mit Standards<br />
3. Selbstbelohnung und Selbstbestrafung<br />
© Christa Reinecker 2013 30
Selbstkontrolle<br />
Selbstkontrolle als Spezialfall von Selbstregulation:<br />
- Heldenhaftes Verhalten (Aushalten einer aversiven<br />
Situation)<br />
- Wi<strong>der</strong>stehen einer Versuchung<br />
Problem <strong>der</strong> <strong>unter</strong>schiedlichen kurz- und langfristigen<br />
Konsequenzen!<br />
© Christa Reinecker 2013 31
Selbstmanagement<br />
VT-<strong>Gesprächsführung</strong><br />
• Aktives Interesse<br />
• Respekt und Wertschätzung<br />
• Empathie (Cave....!)<br />
• Transparentes Vorgehen<br />
• Konkrete, spezifische Themen<br />
• Geleitetes Entdecken, Erfahrung<br />
© Christa Reinecker 2013 32
Cave!<br />
• Depression, Hoffnungslosigkeit nicht<br />
„verstärken“<br />
• Eigenaktivität des Patienten för<strong>der</strong>n<br />
• Keine unrealistischen<br />
„Versprechungen“ („Sie sind gesund“)<br />
• Keine voreiligen Tipps<br />
© Christa Reinecker 2013 33
Therapeutische Beziehung<br />
Notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für<br />
Therapieerfolg!!!<br />
• Zweck bestimmt<br />
• Zeitlich begrenzt<br />
• Arbeitsbeziehung<br />
• Ziel gerichtet<br />
• Spezifische Rollenverteilung<br />
• Spezielle Rahmenbedingungen<br />
• Wechselseitige Beeinflussung jedoch einseitige Zielrichtung<br />
• Keine alltägliche Freundschaftsbeziehung<br />
• Kein Selbstzweck (Ersatz von Alltagsbeziehungen)<br />
• Kein bedingungsloses Akzeptieren (beidseitig)<br />
© Christa Reinecker 2013 34
Grenzen <strong>der</strong> VT<br />
im Speziellen des Selbstmanagement-Ansatzes<br />
– Krisenintervention<br />
– An<strong>der</strong>e Berufsgruppen/Anlaufstellen<br />
– Individuelle Therapie vs gesellschaftspolitische Verän<strong>der</strong>ungen<br />
– Allgemeine Grenzen von Therapie<br />
– Mangelnde Fähigkeit zur Interaktion<br />
© Christa Reinecker 2013 35
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong> <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
• Einleitung<br />
• Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
Überblick<br />
• Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung (Prochaska & DiClemente)<br />
• <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> (Miller & Rollnik)<br />
• Selbstmanagement (Kanfer, Reinecker & Schmelzer)<br />
• Ziele<br />
• Wi<strong>der</strong>stand<br />
• Weitere Gesprächsstrategien, konkrete Umsetzung<br />
© Christa Reinecker 2013 36
© Christa Reinecker 2013<br />
37
ZIELE<br />
„Ziele zu finden ist wichtig<br />
o<strong>der</strong> würdest du in einen Zug<br />
steigen,<br />
von <strong>dem</strong> du nicht weißt,<br />
wo er hinfährt?“<br />
Christa Reinecker 2013
Schematische Darstellung von<br />
Problemanalyse, Zielbestimmung und Therapie<br />
Beachte: Problem vs. Tatsache!!!<br />
Barriere<br />
Ziel<br />
Problem<br />
Methoden<br />
© Christa Reinecker 2013 39
Möglichkeiten <strong>der</strong> Diskrepanzmin<strong>der</strong>ung,<br />
Problemlösung, Selbstregulation<br />
(Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2012)<br />
• Ziele beibehalten, Verhalten än<strong>der</strong>n<br />
• Verhalten beibehalten, Ziele än<strong>der</strong>n<br />
• Ziele und Verhalten än<strong>der</strong>n im Sinne gegenseitiger<br />
Annäherung<br />
• Ziele und Verhalten völlig än<strong>der</strong>n = totale<br />
„Neukalibrierung“<br />
Christa Reinecker 2013
Positive Zielfantasie<br />
“push-pull-Esel-Metapher”<br />
Antrieb vs. Anreiz<br />
Negativ vs. Positiv-Motivierung<br />
• „warum bin ich hier, was möchte ich erreichen, was kann mich<br />
<strong>unter</strong>stützen, sinnvolle Strategien tatsächlich ein- und umzusetzen?“<br />
• vergleich Schispringer vs Langläufer, Marathonläufer<br />
• „Was ist die Karotte, die ich erreichen will?“ –<br />
nur mit wichtigem Motiv im Hinterkopf werde ich etwas verän<strong>der</strong>n<br />
können!“<br />
• Gemeinsames Erarbeiten solcher mögl. Motive!<br />
Christa Reinecker 2013 41
Ziele<br />
• „Was wird besser sein, wenn ich mich verän<strong>der</strong>e.....?“<br />
• „Womit möchte ich beginnen?“<br />
• „Was kann ich bis zu unserem nächsten Termin versuchen?“<br />
© Christa Reinecker 2013 42
Bei <strong>der</strong> Zielbestimmung zu beachten:<br />
– Konsequenzen einer Verän<strong>der</strong>ung und Folgen<br />
<strong>der</strong> Zielerreichung nicht immer nur erwünscht!<br />
– Übereinstimmung mit eigenen Werten,<br />
Lebensleitsätzen, Lebensmottos!<br />
– Weniger ist oft mehr!<br />
© Christa Reinecker 2013 43
Goal attainment<br />
scaling<br />
Zielerreichungskala<br />
Kiresuk & Sherman, 1968<br />
Kiresuk & Lund, 1979<br />
Christa Reinecker 2013
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong> <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
Überblick<br />
• Einleitung<br />
• Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung (Prochaska & DiClemente)<br />
• <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> (Miller & Rollnik)<br />
• Selbstmanagement (Kanfer, Reinecker, Schmelzer)<br />
• Ziele<br />
• Wi<strong>der</strong>stand<br />
• Weitere Gesprächs- und Motivationsstrategien, konkrete Umsetzung<br />
© Christa Reinecker 2013 45
Hin<strong>der</strong>nisse an <strong>der</strong> Zielerreichnung<br />
• Aufwand des Verän<strong>der</strong>ungsprozesses<br />
(Bsp.„Automatikauto“, „Wiesenweg“)<br />
• Mögliche kurz- und/o<strong>der</strong> langfristige negative Folgen<br />
• Angst vor „Neuem“<br />
• Unterschiedliche Prioritäten Arzt – Patient<br />
• Mangelnde Übereinstimmung mit Zielen und Werten des<br />
Patienten<br />
• Kein Alternativverhalten vorhanden<br />
© Christa Reinecker 2013 46
„Wi<strong>der</strong>stand“<br />
• Verhaltensträgheit<br />
• Angst vor Versagen<br />
• Angst vor Verän<strong>der</strong>ung<br />
• Festhalten an einem speziellen HBM<br />
• Opposition gegen Therapieziele (Motivation, Konflikt,<br />
multiple VH-Regulation, externe Bedingungen)<br />
• Mögliche Negativfolgen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung, Angst vor Verlust<br />
© Christa Reinecker 2013 47
Umgang mit Wi<strong>der</strong>stand<br />
Achtung vor „Straßensperren“ (Gordon, 1970*):<br />
• schnelle Ratschläge<br />
• Drohungen<br />
• moralisieren<br />
• verurteilen<br />
• beschämen,<br />
• befehlen<br />
• belehren<br />
* Gordon, T. (1970). Parent Effectiveness Training. New York: Wyden.<br />
© Christa Reinecker 2013 48
Umgang mit Wi<strong>der</strong>stand<br />
• Reflektierend zuhören, spiegeln<br />
• Analyse des Wi<strong>der</strong>standes<br />
• Auf sokratische Art nachfragen, welche Begründungen <strong>der</strong> Patient hat,<br />
Verän<strong>der</strong>ung des Blickwinkels<br />
• „Wie könnte man das auch an<strong>der</strong>s sehen?“<br />
• Diskrepanzen hervorheben, Ambivalenz oft Ziel<br />
• „Vor- und Nachteile (Waage)?“<br />
• „Was sind die Konsequenzen?“<br />
• Persönliche Entscheidungsfreiheit und Verantwortung betonen<br />
• „Es ist ihre Entscheidung“<br />
• Umlenken,<br />
• „Was würden Sie .... raten?“<br />
• „Was wäre eine Alternative?“<br />
© Christa Reinecker 2013 49
<strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> <strong>unter</strong> <strong>dem</strong> <strong>Aspekt</strong> <strong>der</strong><br />
Beson<strong>der</strong>heiten am Kurort<br />
Überblick<br />
• Einleitung<br />
• Än<strong>der</strong>ungsmotivation<br />
• Phasen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung (Prochaska & DiClemente)<br />
• <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> (Miller & Rollnik)<br />
• Selbstmanagement (Kanfer, Reinecker<br />
• Ziele<br />
• „Wi<strong>der</strong>stand“<br />
• Weitere Gesprächs- und Motivationsstrategien, konkrete Umsetzung<br />
© Christa Reinecker 2013 50
Metapher „Bergtour“<br />
• Wir stehen am Beginn einer längeren Therapie. Das ist wie vor einer schweren<br />
Bergtour und Sie sind wie eine Touristin, die zu einem erfahrenen Bergführer kommt,<br />
um ihn zu bitten auf den Gipfel geführt zu werden. Der Bergführer erläutert die<br />
Schwierigkeiten <strong>der</strong> Tour, die Länge und die Anstrengungen, die auf sie beide warten.<br />
„Er sei erfahren“, meint er, „er kenne den Weg, aber er wisse nicht genau wie das<br />
Wetter sich entwickle, wie die Eisverhältnisse seinen und was sonst an<br />
unvorhergesehenen Dingen passieren könne. Er traue Ihnen zu, dass sie es schaffen<br />
könnten, sonst würde er sich nicht mit Ihnen auf den langen Weg machen“. „Aber“, und<br />
das schärft er Ihnen ein: „Ich kann sie nicht tragen. Ich werde Ihnen den Weg zeigen,<br />
ich werde ihnen vorangehen, aber laufen müssen Sie selbst. Und es wird Momente<br />
geben, da wird es sein Stück bergab gehen, da werden sie meinen, keine Kraft mehr zu<br />
haben, da wollen sie verzweifeln und aufgeben. Ich sage Ihnen lieber gleich – Ich<br />
werde das nicht zulassen. Wenn wir zusammen losgehen, kommen wir zusammen<br />
an.“ (Bohus Bor<strong>der</strong>line-Störung 2002)<br />
© Christa Reinecker 2013 51
Gesprächsstrategien<br />
• Aktives, empathisches Zuhören - ,<br />
– Reformulieren, Spiegeln („Sie meinen also,.....“)<br />
– Nachfragen<br />
– Diskrepanzen herausarbeiten<br />
– „mit den Augen hören“ (Mehrabian, 1972)- Körpersprache, Mimik<br />
etc.)<br />
– Eigenverantwortung för<strong>der</strong>n<br />
– Zusammenfassen<br />
– „Aufgabe“<br />
© Christa Reinecker 2013 52
Zukunftsprojektion:<br />
Weitere Gesprächsstrategien<br />
- Wenn ich Sie in.....<br />
- Was müsste passieren, dass Sie sich wie<strong>der</strong><br />
wohler fühlen<br />
- Wie möchten Sie die Kur verlassen, dass Sie sagen können, <strong>der</strong><br />
Aufwand hat sich gelohnt...<br />
- Wenn ich Sie in einem halben Jahr wie<strong>der</strong> treffe, ....<br />
- Was könnten Sie dazu beitragen<br />
- Was könnte Ihnen dabei im Weg stehen<br />
© Christa Reinecker 2013 53
Weitere Gesprächsstrategien<br />
Fragen<br />
- Offene Fragen stellen (nicht: „haben sie noch eine Frage?“<br />
son<strong>der</strong>n: “Welche Fragen haben sie noch?“<br />
- Nachfragen („Können Sie mir das noch genauer erklären?“<br />
- Gezielte Fragen (was will ich mit <strong>der</strong> Frage erreichen)<br />
© Christa Reinecker 2013 54
Sokratischer Dialog<br />
Zentrale Methode <strong>der</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> mit <strong>der</strong> <strong>der</strong> Klient angeleitet werden<br />
soll seine dysfunktionalen Denkinhalte zu identifizieren, zu hinterfragen und wenn<br />
möglich zu verän<strong>der</strong>n<br />
• Kern <strong>der</strong> Technik von Beck ist die so genannte „Realitätsüberprüfung“<br />
• Modell des „Zitterrochen“ –; d. h. sich selbst und an<strong>der</strong>e in<br />
Verwirrung bringen (weg von „Scheinklarheit“)<br />
• Hebammenkunst, Verzerrung <strong>dem</strong> Patienten einsichtig machen mit <strong>dem</strong> Ziel<br />
einer Korrektur (Methode <strong>der</strong> „begonnenen Sätze“)<br />
• Untersuchung auf Begründung, Zutreffendheit und alternative Sichtwesen<br />
• Spaltentechnik,.....<br />
© Christa Reinecker 2013 55
Akzeptanz- und Commitmenttherapie ACT *<br />
• Moving toward Acceptance of thoughts and feelings<br />
• Moving toward behaviors that are consistent with the<br />
patients valued life goals<br />
Have a life that is worth the effort!<br />
(not a happy life)<br />
*Literatur:<br />
Ciarrochi, J. & Bailey, A. (2010). Akzeptanz- und Commitmenttherapie in <strong>der</strong> KVT. Weinheim: Beltz.<br />
Eifert, G. (2011). Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT). (Reihe: Fortschritte <strong>der</strong> Psychotherapie).<br />
Göttingen: Hogrefe.<br />
Wengenroth, M. (2012). Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT). (Reihe: Therapie-Tools). Bern: Huber.<br />
© Christa Reinecker 2013 56
Weitere Tipps<br />
• Kleine Schritte<br />
• Motivation follows action (mit <strong>dem</strong> Essen<br />
kommt <strong>der</strong> Appettit)<br />
• Erfahrungslernen<br />
• Experimente wagen<br />
• Transferlernen (Übertragung in den Alltag)<br />
© Christa Reinecker 2013 57
5 Denkregeln<br />
nach: F. Kanfer<br />
• Think positive<br />
• Think solution<br />
• Think flexible<br />
• Think future<br />
• Think behavior<br />
© Christa Reinecker 2013 58
Hausübungen/Übungen<br />
• Erarbeitetes zwischen den Sitzungen umsetzen, ausprobieren,<br />
neue Erfahrungen machen<br />
• „Experimentieren“<br />
• Eigentliche Therapie passiert zwischen den Sitzungen!<br />
• Nachfragen, Schwierigkeiten<br />
© Christa Reinecker 2013 59
„Three blessings“<br />
in Anlehnung an Seligman, Kaluza und Frank<br />
„Was ist Ihnen heute gelungen und was war<br />
Ihr Anteil dabei?“<br />
Frank, R. (2010). Wohlbefinden för<strong>der</strong>n. Positive Psychotherapie in <strong>der</strong> Praxis. inkl. CD (Reihe: Leben Lernen). Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Kaluza, G. (2011). Salute! Was die Seele stark macht. Programm zur För<strong>der</strong>ung psychosozialer Gesundheitsressourcen. (Reihe: Leben<br />
LERNEN). Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Seligman, M. (2005). Der Glücks-Faktor. Warum Optimisten länger leben. Bergisch-Gladbach: Bastei Lübbe.<br />
© Christa Reinecker 2013 60
© Christa Reinecker 2013<br />
61
Literatur<br />
• Arkowitz, H. & al. (2010). <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> bei <strong>der</strong> Behandlung<br />
psychischer Störungen. Weinheim: Beltz.<br />
• De Zwaan, M. & Müller, A. (2009). Compliance und Motivation in <strong>der</strong><br />
Ernährungstherapie. In K. Widhalm (Hrsg.), Ernährungsmedizin. Wien:<br />
Verlagshaus <strong>der</strong> Ärzte.<br />
• Fehm, L & Helbig, S. (2008). Hausaufgaben in <strong>der</strong> Psychotherapie. Strategien<br />
und Materialien für die Praxis. Göttingen: Hogrefe<br />
• Fuller, c. & Taylor, P. (2012). Therapie-Tools. <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong>.<br />
Weinheim: Beltz.<br />
• Kanfer, F., Reinecker, H. & Schmelzer, D. (2012). Selbstmanagement-Therapie.<br />
Ein Lehrbuch für die klinische Praxis. (5. Aufl.). Berlin: Springer.<br />
• Miller, W. R. & Rollnik, S. (2002). Motivational Interviewing –Preparing People to<br />
Change (2nd ed.). New York: Guilford.<br />
• Naar-King, S. & Suarez, M. (Hrsg.). (2012). <strong>Motivierende</strong> <strong>Gesprächsführung</strong> mit<br />
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Weinheim: Beltz.<br />
© Christa Reinecker 2013 62