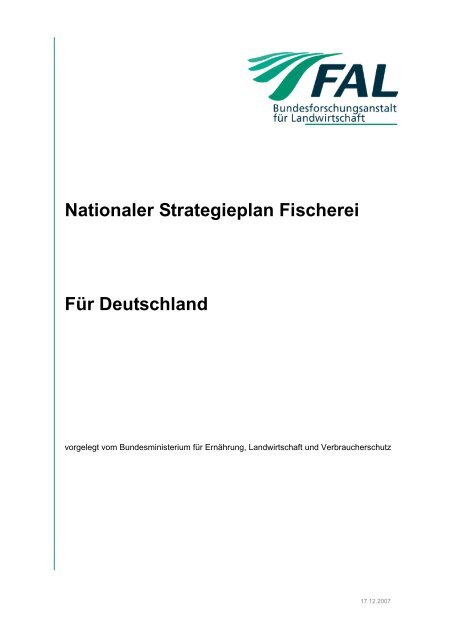Nationaler Strategieplan (NSP) (pdf-Datei | 4,5 MB) - Portal-Fischerei
Nationaler Strategieplan (NSP) (pdf-Datei | 4,5 MB) - Portal-Fischerei
Nationaler Strategieplan (NSP) (pdf-Datei | 4,5 MB) - Portal-Fischerei
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong><br />
Für Deutschland<br />
vorgelegt vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong><br />
I<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung ......................................................................................................................1<br />
2. Allgemeine Beschreibung des Sektors ........................................................................ 3<br />
2.1 Struktur........................................................................................................................................3<br />
2.2 Bruttowertschöpfung ...................................................................................................................3<br />
2.3 Beschäftigung..............................................................................................................................4<br />
2.4 Regional-, strukturpolitische und ökologische Aspekte ..............................................................5<br />
2.5 Seefischerei .................................................................................................................................6<br />
2.6 Binnenfischerei und Aquakultur..................................................................................................8<br />
2.7 Verarbeitung und Vermarktung...................................................................................................9<br />
2.8 Versorgung und Vermarktungswege...........................................................................................9<br />
3. SWOT - Analyse der Sektoren und ihrer Entwicklung.......................................... 11<br />
3.1 Seefischerei ...............................................................................................................................15<br />
3.1.1 Hochseefischerei (pelagisch) ...................................................................................................................15<br />
3.1.2 Hochseefischerei (demersal) ....................................................................................................................17<br />
3.1.3 Kutter- und Küstenfischerei.....................................................................................................................19<br />
3.1.3.1 Frischfischfischerei (Nordsee) ................................................................................................................ 19<br />
3.1.3.2 Krabbenfischerei (Nordsee) .................................................................................................................... 20<br />
3.1.3.3 Muschelfischerei und -kulturen .............................................................................................................. 21<br />
3.1.3.4 Frischfischfischerei (Ostsee)................................................................................................................... 21<br />
3.2 Aquakultur und Binnenfischerei................................................................................................24<br />
3.2.1 Karpfenteichwirtschaften.........................................................................................................................24<br />
3.2.2 Forellenwirtschaften ................................................................................................................................26<br />
3.2.3 Fluss- und Seenfischerei ..........................................................................................................................28<br />
3.2.4 Technische Haltungssysteme ...................................................................................................................30<br />
3.3 Fischverarbeitung und –vermarktung........................................................................................32<br />
3.4 Infrastruktur/<strong>Fischerei</strong>häfen ......................................................................................................36<br />
3.5 Fischwirtschaftsgebiete .............................................................................................................38<br />
4. Ziele, Prioritäten und Perspektiven.......................................................................... 43<br />
4.1 Hauptziel ...................................................................................................................................43<br />
4.2 Unterziele ..................................................................................................................................44<br />
4.2.1 Langfristige Stabilisierung der Fischbestände nach dem Ökosystemansatz ............................................44<br />
4.2.2 Umweltverträgliche Produktion von Fisch- und Fischerzeugnissen ........................................................47<br />
17.12.2007
Inhaltsverzeichnis<br />
II<br />
4.2.3 Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Gewährleistung einer angemessenen<br />
Lebenshaltung..........................................................................................................................................50<br />
4.2.4 Verbesserte Positionierung am Markt......................................................................................................51<br />
4.2.5 Strukturwandel in der Fischwirtschaft und Weiterentwicklung des Sektors............................................52<br />
4.2.6 Gute Governance der GFP .......................................................................................................................53<br />
4.3 Ziele und Prioritäten (nach <strong>NSP</strong>-Vorgaben) .............................................................................55<br />
4.3.1 <strong>Fischerei</strong>liche Nutzung ............................................................................................................................55<br />
4.3.2 Versorgung und Gleichgewicht der Märkte.............................................................................................56<br />
4.3.3 Fortentwicklung einer nachhaltigen Binnenfischerei und Aquakultur.....................................................56<br />
4.3.4 Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftszweiges............................................................57<br />
4.3.4.1 Seefischerei............................................................................................................................................. 57<br />
4.3.4.2 Binnenfischerei und Aquakultur ............................................................................................................. 57<br />
4.3.5 Verarbeitung und Vermarktung ...............................................................................................................58<br />
4.3.6 Sozioökonomische Dimension der <strong>Fischerei</strong> ...........................................................................................58<br />
4.3.7 Gewässerschutz........................................................................................................................................59<br />
4.3.8 Gute Governance der GFP .......................................................................................................................59<br />
5. Fischwirtschaftsgebiete .............................................................................................. 61<br />
5.1 Fischwirtschaftsgebiet „Nordseeküste“.....................................................................................61<br />
5.2 Fischwirtschaftsgebiet „Ostseeküste“........................................................................................62<br />
5.3 Fischwirtschaftsgebiet „Karpfenerzeugung“.............................................................................62<br />
5.4 Ziele und Prioritäten in den Fischwirtschaftsgebieten...............................................................64<br />
6. Finanzielle Vorschau.................................................................................................. 66<br />
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung der<br />
Förderung nach der Verordnung über den Europäischen <strong>Fischerei</strong>fonds<br />
(EFF)............................................................................................................................ 70<br />
7.1 <strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> (<strong>NSP</strong>) und Operationelles Programm (OP) .......................................70<br />
7.2 Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems..............................................................73<br />
7.3 Mechanismen zur Konsistenz und Kohärenz ............................................................................83<br />
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren................................................. 88<br />
8.1 Typologie der Flotte ..................................................................................................................89<br />
8.2 Unternehmen, Beschäftigung und Produktion...........................................................................95<br />
8.3 Indikatoren nach Zielen und Prioritäten ..................................................................................160<br />
8.3.1 <strong>Fischerei</strong>liche Nutzung (Bezug Kapitel. 4.3.1)......................................................................................161<br />
8.3.2 Versorgung und Gleichgewicht der Märkte (Bezug Kapitel 4.3.2)........................................................161<br />
8.3.3 Fortentwicklung einer nachhaltige Binnenfischerei und Aquakultur (Bezug Kapitel 4.3.3) .................163<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong><br />
III<br />
8.3.4 Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftszweiges (Bezug Kapitel 4.3.4) ......................163<br />
8.3.5 Sozioökonomische Dimension der <strong>Fischerei</strong> (Bezug Kapitel 4.3.6)......................................................165<br />
8.3.6 Gewässerschutz (Bezug Kapitel 4.3.7) ..................................................................................................167<br />
8.3.7 Gute Governance der GFP (Bezug Kapitel 4.3.8)..................................................................................167<br />
17.12.2007
Inhaltsverzeichnis<br />
IV<br />
Verzeichnis der Abbildungen<br />
Abbildung 1 : Regionale Verteilung der <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge ...............................................................91<br />
Abbildung 2 : Beschäftigung in der Seefischerei nach Heimathafen der Fahrzeuge............................92<br />
Abbildung 3 : Regionale Verteilung der kW-Fahrzeugkapazitäten......................................................93<br />
Abbildung 4 : Regionale Verteilung der BRZ-Fahrzeugkapazitäten....................................................94<br />
Abbildung 5 : Regionale Verteilung der Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge in<br />
Deutschland ...................................................................................................................97<br />
Abbildung 6 : Regionale Verteilung der Erlöse aus Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge<br />
in Deutschland ...............................................................................................................98<br />
Abbildung 7 : Entwicklung der Quotennutzung nach <strong>Fischerei</strong>en und Fischarten 1994 – 2007........110<br />
Abbildung 8 : Erlöse aus Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge nach Ländern........................111<br />
Abbildung 9 : Preisentwicklung ausgewählter Fischarten..................................................................119<br />
Abbildung 10 : Regionale Verteilung der Forellen- und Karpfenbetriebe ...........................................120<br />
Abbildung 11 Forellen- und Karpfenerzeugung nach Bundesländern ...............................................122<br />
Abbildung 12: Forellen- und Karpfenumsätze nach Bundesländern...................................................125<br />
Abbildung 13: Fischwirtschaftgebiete, Gemeinden auf NUTS-III-Ebene und zugehörige<br />
Landkreise ...................................................................................................................128<br />
Abbildung 14 : Regionale Verteilung der Fisch verarbeitenden und handelnden Betriebe..................140<br />
Abbildung 15 : NATURA-2000 - Schutzgebietsmeldungen innerhalb und außerhalb der AWZ<br />
der Ost- und Nordsee (Stand 28.4.2004) .....................................................................149<br />
Abbildung 16 : Vorgeschlagene FFH-Gebiete .....................................................................................151<br />
Abbildung 17 : Vorgeschlagene Vogelschutzgebiete...........................................................................153<br />
Abbildung 18: Flussgebietseinheiten in Deutschland nach der Wasserrahmenrichtlinie.....................155<br />
Abbildung 19: Konkurrierende Meeresnutzung in niedersächsischen Küstengewässern ....................158<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong><br />
V<br />
Verzeichnis der Tabellen:<br />
Tabelle 1 : Flottenstruktur und Kapazitäten nach Regionen und <strong>Fischerei</strong>en – 31.12.2006 ...........89<br />
Tabelle 2 : Entwicklung der Flottenstruktur nach <strong>Fischerei</strong>en 1997 bis 2006 ................................90<br />
Tabelle 3 :<br />
Tabelle 4 :<br />
Unternehmen, Produktion, Umsatz und Beschäftigung nach Sektoren.........................95<br />
Quotenabhängigkeit und Risikopotenzial in der Meeresfischerei nach<br />
Flottensegmenten...........................................................................................................99<br />
Tabelle 5 : Fangmengen und Anteile nach Fischarten und <strong>Fischerei</strong>en - 2006 -...........................114<br />
Tabelle 6 : Umsatz und Anteile nach Fischarten und <strong>Fischerei</strong>en - 2006 - ...................................116<br />
Tabelle 7: Eckdaten zum <strong>Fischerei</strong>gebiet "Nordseeküste" ...........................................................131<br />
Tabelle 8:<br />
Eckdaten zum <strong>Fischerei</strong>gebiet "Ostseeküste"..............................................................132<br />
Tabelle 9: Eckdaten zum <strong>Fischerei</strong>gebiet "Karpfenerzeugung" ...................................................134<br />
Tabelle 10:<br />
abelle 11 :<br />
Eckdaten zum <strong>Fischerei</strong>gebiet "Karpfenerzeugung" (Fortsetzung).............................137<br />
Kennzahlen der Fisch verarbeitenden Industrie 1995 - 2005 (nach fachlichen<br />
Betriebsteilen)..............................................................................................................142<br />
Tabelle 12 : Entwicklung der Industriellen Erzeugung nach Produktgruppen Fisch, 2002 -<br />
2005 .............................................................................................................................143<br />
Tabelle 13 : Außenhandel mit Fisch und Krebs- und Weichtieren, Fanggewicht (t) 2000-2005....144<br />
Tabelle 14: Selbstversorgungsgrad für Deutschland nach Produktgruppen 2000-2005.................146<br />
Tabelle 15 : Zollbelastungen für Grundfische für Importe nach Deutschland, 2004 und 2005 ......148<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 1<br />
1. Einleitung<br />
Nach Artikel 14 der Verordnung des Rates über den Europäischen <strong>Fischerei</strong>fonds (EFF) ist die<br />
Erstellung eines Nationalen <strong>Strategieplan</strong>s (<strong>NSP</strong>) vorgesehen.<br />
Das vorliegende Dokument ist der <strong>NSP</strong> der Bundesrepublik Deutschland für den <strong>Fischerei</strong>sektor.<br />
Wegen der föderalistischen Struktur Deutschlands ist die nationale Strategie in enger Zusammenarbeit<br />
mit den Bundesländern, die die zur Durchführung der Strukturförderung notwendigen<br />
Verwaltungsbehörden stellen, entwickelt worden. Der Plan wurde darüber hinaus nach Konsultation<br />
der Partner verfasst; er enthält eine Kurzbeschreibung aller Aspekte der Gemeinsamen <strong>Fischerei</strong>politik<br />
(GFP), die für Deutschland relevant sind.<br />
Bei der Durchführung der EFF-Förderperiode 2007-2013 wird Deutschland auf die in der<br />
Finanzinstrument zur Ausrichtung der <strong>Fischerei</strong> (FIAF)-Förderperiode 2000-2006 etablierten und<br />
bewährten Verwaltungs- und Kontrollsysteme der einzelnen Bundesländer zurückgreifen. Die<br />
Durchführung und Kontrolle der einzelnen Operationen obliegt den entsprechenden Verwaltungs- und<br />
Kontrollorganen der Bundesländer. Die Beschreibung dieser Systeme wurde der Europäischen<br />
Kommission im Rahmen der VO (EG) Nr. 438/2001 vom 2. März 2001 übermittelt und dort geprüft.<br />
Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) wird der<br />
Europäischen Kommission wie bisher als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und die<br />
Koordinierung der Programmabwicklung übernehmen. Im Rahmen der Begleitung des<br />
EFF-Programms wird das BMELV den Vorsitz im Begleitausschuss übernehmen.<br />
Die im Titel VII der EFF-Verordnung aufgeführten Behörden (Verwaltungsbehörde,<br />
Bescheinigungsbehörde und Prüfbehörde) werden aufgrund der föderativen Struktur Deutschlands<br />
nicht auf Bundesebene, sondern bei den jeweiligen Bundesländern in gegenüber der Förderperiode<br />
2000-2006 weitgehend unveränderter Form eingerichtet.<br />
Die laufende Strukturfondsförderung nach der FIAF-Verordnung hat die volle Funktionsfähigkeit der<br />
hierfür erforderlichen Administration demonstriert.<br />
17.12.2007
2. Allgemeine Beschreibung des Sektors 2<br />
2. Allgemeine Beschreibung des Sektors<br />
2.1 Struktur<br />
Der deutsche <strong>Fischerei</strong>sektor gliedert sich in die Seefischerei mit der Hochseefischerei und der stärker<br />
lokal orientierten Kutter- und Küstenfischerei, die Binnenfischerei und Aquakultur mit den Sparten<br />
Teich- und Forellenwirtschaften, Fluss- und Seenfischerei sowie technischen Anlagen einschließlich<br />
Netzgehegen.<br />
Gerade in der Binnenfischerei und Aquakultur spielt die Direktvermarktung wirtschaftlich eine<br />
wichtige Rolle. Für die nachgelagerten Bereiche sind besonders die Fisch verarbeitende Industrie und<br />
der Großhandel neben Einzelhandel und Fischgastronomie als wichtige Wirtschaftsfaktoren<br />
hervorzuheben.<br />
Auch die Angelfischerei (es gibt in Deutschland ca. 1,5 Mio. <strong>Fischerei</strong>scheininhaber) ist als<br />
bedeutender Wirtschaftsfaktor anzusehen. Diese ebenfalls seit langem ausgeübte Art der <strong>Fischerei</strong><br />
erfährt in Deutschland seit einigen Jahren einen ständig wachsenden Zuspruch. In einigen Regionen<br />
stellt die Angelfischerei heute die vorherrschende Bewirtschaftungsform von Seen und Flüssen dar;<br />
nach Schätzungen liegt die Angelfischerei mit 17 000 t bei einem Anteil von etwa 30 % des<br />
Gesamtaufkommens der Binnenfischerei und Aquakultur 1 .<br />
2.2 Bruttowertschöpfung<br />
Die Bruttowertschöpfung der Primärproduktion aller <strong>Fischerei</strong>sparten beträgt etwa 250 Mio. €. Dies<br />
entspricht ca. 1 % der Wertschöpfung des Gesamtbereichs der „Land- und Forstwirtschaft und<br />
<strong>Fischerei</strong>“ oder 0,01 % in Relation zur gesamten Volkswirtschaft. Werden die nachgelagerten<br />
Sektoren der Verarbeitung und Vermarktung mit eingeschlossen, so erhöht sich die<br />
Bruttowertschöpfung auf ca. 750 Mio. €. Über die Wertschöpfung des Groß- und Einzelhandels sowie<br />
des Catering und Gastronomiebereiches liegen keine Zahlen vor. Der Gesamtumsatz aller Bereiche<br />
(Produktion, Verarbeitung und Vermarktung) wird mit ca. 2 Mrd. € angegeben.<br />
2.3 Beschäftigung<br />
Die Beschäftigung aller Sparten der <strong>Fischerei</strong>wirtschaft, einschließlich der Zulieferindustrie, des<br />
Handels und der Gastronomie, wird grob auf ca. 100 000 Beschäftigte geschätzt.<br />
Ca. 2 500 Beschäftigte in der marinen und ca. 4 500 in der binnenländischen <strong>Fischerei</strong> tragen zur<br />
Stärkung der meist strukturschwachen Regionen bei.<br />
1 Ohne Meeresaquakultur<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 3<br />
2.4 Regional-, strukturpolitische und ökologische Aspekte<br />
Die <strong>Fischerei</strong> ist traditionell in die Wirtschafts- und Lebensweise der Regionen eingebunden. Dies<br />
findet seinen Ausdruck in einem hohen Anteil von Nebenerwerbsbetrieben sowohl in der<br />
Binnenfischerei als auch in der kleinen Küstenfischerei. Durch das Flair der fischereilichen Kultur,<br />
mit Booten, Häfen und der <strong>Fischerei</strong> selbst, entstehen Synergien mit der Lokal- und<br />
Regionalwirtschaft, insbesondere dem Tourismus, einem bedeutenden Wirtschaftszweig für die<br />
Küstenregionen und die Binnenfischerei- und Aquakulturgebiete im Binnenland.<br />
Der Bedeutung regional-, strukturpolitischer und ökologischer Aspekte soll durch die Ausweisung und<br />
besondere Förderung von drei Fischwirtschaftsgebieten besonders Rechnung getragen werden (vgl.<br />
Abbildung 13 und Tabelle 7ff.). Im Einzelnen gelten die Regionen der ausgewiesenen<br />
<strong>Fischerei</strong>wirtschaftsgebiete „Nord- und Ostseeküste“ als Schwerpunkte der handwerklich orientierten<br />
Seefischwirtschaft. Nahezu ausschließlich als Familienbetriebe geführt, zeichnen sie sich durch eine<br />
starke Verwurzelung in der Region und einer traditionellen Wirtschaftsweise aus. Im Binnenland sind<br />
insbesondere die Teichlandschaften Bayerns, Brandenburgs und Sachsens landschaftsbildend und als<br />
strukturschwache Gebiete besonders förderungswürdig. Sie können teils auf eine über 1000-jährige<br />
Tradition zurückblicken und leisten einen wichtigen Beitrag zur regionalen aber auch zur EU-weiten<br />
Versorgung mit Karpfen. Der hohe ökologische Wert der Karpfenteichwirtschaften und die<br />
Ressourcen schonende Erzeugung durch Nutzung des natürlichen Nahrungsangebotes sind besonders<br />
erwähnenswert. Die „Fischverarbeitungsgebiete“ liegen für die Nordseeküste in der strukturschwachen<br />
Region um Bremerhaven/Cuxhaven. Stark rückläufige Anlandungen, insbesondere im<br />
Frischfischbereich, bei hohem Beschäftigungsanteil in der Fischwirtschaft haben die Region in eine<br />
schwere wirtschaftliche Krise geführt. Inzwischen konnte sie Schritt für Schritt wieder zur<br />
bedeutendsten Schwerpunktregion Fischverarbeitung in Deutschland entwickelt werden. Für die<br />
Ostsee gilt dies für die Region Sassnitz/Mukran. Nach dem Zusammenbruch der Fischverarbeitung<br />
nach der Wiedervereinigung ist es im Verlauf der letzten Jahre gelungen, Sassnitz/Mukran für die<br />
Ostsee zu einem Kompetenzzentrum für die Verarbeitung von Hering aufzubauen. Hiervon profitieren<br />
nicht nur die regionalen <strong>Fischerei</strong>betriebe über einen gesicherten Absatz ihrer Fänge, sondern es<br />
konnten auch zahlreiche Fischverarbeiter der zweiten Verarbeitungsstufe zur Ansiedelung im Umfeld<br />
des Mukraner Werkes veranlasst werden - mit signifikanten Arbeitsplatzeffekten für die Region.<br />
2.5 Seefischerei<br />
Die deutsche <strong>Fischerei</strong>flotte gliedert sich mit knapp über 2 000 Fahrzeugen in eine Ostsee-, eine<br />
Nordsee- und eine Hochseeflotte. Ca. 80 % der Fahrzeuge gehen in der Ostsee und ca. 20 % in der<br />
17.12.2007
2. Allgemeine Beschreibung des Sektors 4<br />
Nordsee dem Fischfang nach. Einige wenige, größere Hochseeschiffe nutzen auch weiter entfernt<br />
liegende Gebiete (s. auch Tabelle 1).<br />
In der Ostsee wird - außer der Schleppnetzfischerei mit ca. 100 Fahrzeugen in den küstennahen<br />
Gebieten - hauptsächlich mit ca. 1 500 Fahrzeugen der kleinen Küstenfischerei die passive <strong>Fischerei</strong><br />
betrieben.<br />
In der Nordsee entfällt der weitaus größte Teil der Flotte auf die Krabbenkutter (ca. 260), während<br />
sich der kleinere Teil der Nordseeflotte auf den Frischfischbereich (ca. 30) spezialisiert hat. Außerdem<br />
wird mit einigen Fahrzeugen entlang der Küste die Muschelfischerei (ca. 20) ausgeübt.<br />
In beiden Seegebieten gibt es außerdem noch einige meist kleinere Fahrzeuge, die sich auf den Fang<br />
unquotierter Arten, insbesondere bedingt salzwassertoleranter Süßwasserarten spezialisiert haben.<br />
Die Hochseefischerei wird mit zum Teil modernen und leistungsstarken Fahrzeugen überwiegend im<br />
Nordatlantik betrieben. Dabei handelt es sich um sechs Trawler mit Teilverarbeitung und<br />
Frosteinrichtungen - überwiegend auf demersale Arten eingesetzt - sowie um drei Spezialfahrzeuge für<br />
den Fang pelagischer Arten.<br />
Die Gesamtanlandungen der deutschen Seefischereiflotte bewegten sich in den letzten Jahren auf<br />
relativ stabilem bis leicht ansteigendem Niveau von ca. 280 000 t bei einem Umsatz von etwas über<br />
200 Mio. €.<br />
Die Fänge der deutschen <strong>Fischerei</strong>flotte verteilen sich etwa zu gleichen Teilen auf die neun<br />
Fahrzeuge der Hochseefischerei und die übrige Flotte (Kutter- und<br />
Küstenfischerei) mit etwas über 2 000 Einheiten. Im wirtschaftlichen Sinne als<br />
Haupterwerbsbetriebe aktiv sind ca. 700 Fahrzeuge. Die Verteilung der<br />
Fahrzeuge, der Anlandungen und Erlöse nach Regionen und <strong>Fischerei</strong>en sowie<br />
den wichtigsten Fischarten veranschaulichen die Abbildung 1, 5 und 6 sowie<br />
Tabelle 5 und<br />
Tabelle 6 des Anhangs.<br />
In der Nordsee-Küstenfischerei dominieren erlösseitig die Krabbenanlandungen, während in der<br />
Ostsee der Dorsch und der Hering die wichtigste Einkommensquellen sind. Hauptzielfischarten der<br />
Hochseefischerei sind Hering, Makrele und neuerdings auch Wittling im Schwarmfischfang sowie<br />
Kabeljau, Schwarzer Heilbutt, Seelachs und Rotbarsch im Grundfischfang.<br />
Tabelle 1 und die Abbildung 1 bis Abbildung 4 des Anhangs geben einen Überblick über die regionale<br />
Verteilung der <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge und deren Kapazitäten.<br />
An der Nord- und Ostseeküste liegen rd. 220 zugelassene Anlandehäfen, von denen nur einige auch<br />
eine überregionale Bedeutung für den Seeverkehr haben. Der überwiegende Teil der Häfen, der sich<br />
vorwiegend in kommunaler Trägerschaft befindet, wird hauptsächlich von der <strong>Fischerei</strong>, der<br />
Freizeitschifffahrt und dem regionalem Ausflugs- und Fährverkehr genutzt.<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 5<br />
Der Zustand dieser Häfen ist in der Regel zufrieden stellend, ein Teil der Ostseehäfen wurde im<br />
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative PESCA 1994 – 1999 sowie im Rahmen des OP FIAF 1994-1999<br />
und des OP FIAF 2000-2006 modernisiert. Allerdings erfordert bereits die Unterhaltung in aller Regel<br />
einen hohen finanziellen Aufwand, so dass seitens der Küstengemeinden größere Investitionen in die<br />
Infrastruktur kaum zu bewältigen sind.<br />
Auf der anderen Seite sind es vor allem die kleinen Häfen mit ihrem maritimen Flair, die bedeutsame<br />
Anziehungspunkte für den Tourismus in der Küstenregion sind. Insofern bedarf es hier erheblicher<br />
Anstrengungen, diese Funktion zu erhalten und mit den Möglichkeiten des EFF zielgerichtet zu<br />
verbessern.<br />
2.6 Binnenfischerei und Aquakultur<br />
Die Fluss- und Seenfischereibetriebe nutzen das natürliche Ertragspotenzial ihrer Gewässer. Die<br />
Aquakultur gliedert sich ihrer Bedeutung nach in Deutschland in die Produktionssysteme<br />
Forellenwirtschaft, Karpfenteichwirtschaft und die unter technischen Haltungssystemen<br />
zusammengefassten (voll- oder teilgeschlossene) Kreislaufanlagen und Netzgehegeanlagen (vgl.<br />
Tabelle 3). Die Kreislaufanlagen haben in Deutschland bei der Welserzeugung eine gewisse<br />
Bedeutung erlangt. Die Aalproduktion in Kreislaufanlagen ist aufgrund der mit der Bestandssituation<br />
negativ korrelierenden starken Preisantiege für Glasaale seit einigen Jahren stark rückläufig. Die<br />
Muschelkulturen werden der Seefischerei zugeordnet.<br />
Von ca. 850 000 ha Gesamtbinnengewässerflächen werden ca. 50 000 ha in unterschiedlicher<br />
Intensität zur Forellen- und Karpfenproduktion und ca. 360 000 ha extensiv für die Seen- und<br />
Flussfischerei genutzt. Bei den knapp 24 000 <strong>Fischerei</strong>betrieben dominieren die<br />
Karpfenteichwirtschaften mit 52 % in der Anzahl, während bei der Produktion und dem Umsatz die<br />
Forellen (53 %) überwiegen (siehe auch: Anhang Abbildung 10 bis Abbildung 12 und Tabelle 3). Die<br />
Fluss- und Seenfischerei trägt mit 8 % (3 600 t), Netzgehege- und Kreislaufanlagen mit 2 % (1 000 t)<br />
zum Gesamtaufkommen bei. Insgesamt summiert sich die Fischmenge auf 45 300 t oder ca. 18 % des<br />
Gesamtaufkommens der deutschen <strong>Fischerei</strong>. Bei deutlich höheren Preisen liegt der Umsatz von<br />
Binnenfischerei und Aquakultur mit knapp 180 Mio. € fast auf gleichem Niveau mit der<br />
Meeresfischerei.<br />
2.7 Verarbeitung und Vermarktung<br />
Die Verarbeitung und Vermarktung von Fisch- und Fischprodukten in Deutschland umfasst knapp<br />
90 industrielle Verarbeitungsbetriebe (mit mehr als 10 Beschäftigten als Abgrenzungskriterium) sowie<br />
mehrere tausend kleinere Familienbetriebe im Haupt- und Nebenerwerb. Mit enger Bindung an die<br />
Primärerzeugung leisten Verarbeitung und Direktvermarktung von Fischen und Fischprodukten<br />
17.12.2007
2. Allgemeine Beschreibung des Sektors 6<br />
unterschiedlichen Veredelungsgrades für diese Kombibetriebe einen wesentlichen und meist auch die<br />
Existenz sichernden Einkommensbeitrag. Einen nicht unwesentlichen und stabilisierenden Beitrag für<br />
diesen wirtschaftlichen Erfolg leisten hierbei die Frauen. Sowohl hinsichtlich des Produktionswertes,<br />
der im Jahr 2005 allein bei den industriellen Verarbeitungsbetrieben bei rd. 1,77 Mrd. € lag, als auch<br />
hinsichtlich der Zahl der Beschäftigten (2005 rd. 8 200 Personen) übersteigt die Bedeutung der<br />
Verarbeitungsindustrie die der Urproduktion der See- und Binnenfischerei deutlich (vgl. auch Tabelle<br />
3 im Anhang).<br />
Innerhalb der Binnenfischerei und Aquakultur ist die Direktvermarktung mit allerdings erheblichen<br />
Anteilsschwankungen zwischen den Bundesländern klar vorherrschend.<br />
2.8 Versorgung und Vermarktungswege<br />
Hauptbezugsquelle für die industrielle Verarbeitung sind die internationalen Fischmärkte. Nur knapp<br />
über 10 % der verarbeiteten und vermarkteten Seefische - mit beträchtlichen Schwankungen zwischen<br />
Fischarten – stammen aus Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge (vgl. Anhang Tabelle 14). Bei<br />
Süßwasserfischen wird die Nachfrage hingegen in stärkerem Maße über die eigene Erzeugung gedeckt<br />
(Ausnahme Lachs). Der Großteil der deutschen Produktion von Fisch- und Fischerzeugnissen von ca.<br />
450 000 t und einem Verkaufswert von 1,5 Mrd. € wird wiederum im Land selbst verzehrt.<br />
Bei den industriell hergestellten Produkten rangiert auf Wertebasis die Warengruppe der gefrosteten<br />
Produkte, vorwiegend (panierte) Fischfilets und Fischstäbchen mit ca. 24 % vor Heringserzeugnissen<br />
mit ca. 16 % und Räucherlachs (11 %), wie Tabelle 12 des Anhangs veranschaulicht,. Der Pro-Kopf-<br />
Verbrauch liegt seit geraumer Zeit bei etwa 14 kg pro Jahr. Bei den Einkaufsstätten macht der<br />
allgemeine Trend hin zu den Discountern auch bei Fisch keinen Halt. Ihr Anteil liegt bei derzeit 45 %<br />
bzw. 32 % (Menge und Wert), vor den Verbraucher- (jeweils 28 %), Supermärkten (8 % und 9 %) und<br />
dem Fischfachhandel (7 % und 11 %).<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 7<br />
3. SWOT - Analyse der Sektoren und ihrer Entwicklung<br />
Im Wesentlichen bilden die Faktoren Ressourcenverfügbarkeit, Fischpreise und die Kosten die Grundlage<br />
für die wirtschaftliche Tätigkeit der fischwirtschaftlichen Betriebe. Vor allem bei dem zunehmend hohen<br />
Anteil von Zu- und Nebenerwerbsbetrieben in Deutschland kommen daneben einkommensergänzenden<br />
Tätigkeiten zur Sicherung eines hinreichenden Lebensstandards wachsende Bedeutung zu. Nicht zu<br />
unterschätzen für die Zufriedenheit der Beschäftigten und Stabilität der meist strukturschwachen<br />
Regionen sind die „weichen“ Standortfaktoren - Tradition und das weithin intakte soziale Gefüge dieser<br />
benachteiligten Gebiete.<br />
In der Seefischerei kann die Ressourcen- und Quotensituation insgesamt als gut (Krabbenfischerei) bis<br />
befriedigend (Ostseefischerei) bezeichnet werden. Gleichwohl bilden die starke Spezialisierung auf<br />
wenige Fangobjekte und die Schwankungen der Bestände Risiken, die oft nur schwer durch die auf meist<br />
schwacher Kapitalbasis wirtschaftenden Familienbetriebe aufgefangen werden können. Absatzseitig<br />
verfügt die große Hochseefischerei in der Regel über langjährige stabile und vielfältige Absatzkanäle,<br />
wohingegen besonders die kleine Küstenfischerei stark an wenige dominierende preisbestimmende<br />
Abnehmer auf globalisierten Märkten gebunden ist. Trotz der genannten Defizite auf der Absatzseite<br />
können die Betriebe bei steigender Nachfrage und weltweiter Verknappung der Ressource Fisch<br />
insgesamt und mittelfristig und langfristig mit weiter steigenden Preisen rechnen. Für die künftige<br />
Flottenentwicklung wird bei anhaltender Konzentration auf wenige <strong>Fischerei</strong>standorte ein weiterer<br />
moderater Rückgang der Fahrzeuganzahl erwartet. Treibende Kräfte dieses segmentspezifischen Abbau-,<br />
Anpassungs- und Konzentrationsprozess werden sowohl die Bestandsentwicklungen als auch künftig am<br />
Markt zu erzielende Preise sein. Der Verlauf, die Stärke als auch die Richtung sind jedoch heute nur vage<br />
abzuschätzen. Die dabei freiwerdende Kapazitäten und Quoten werden mit einer stärkeren vertikalen<br />
Integration vom Fang bis zum Verbraucher das Überleben der verbleibenden Betriebe sichern helfen.<br />
Den Aquakulturbetrieben mit den Karpfenteich- und Forellenwirtschaften sind mit der Abhängigkeit von<br />
Raum und der Wasserverfügbarkeit geeigneter Qualität Grenzen im innerbetrieblichen Wachstum gesetzt.<br />
Steigender Kostendruck bei den Betriebsmitteln brachte viele Betriebe in Bedrängnis. Trotz dieses<br />
schwierigen Umfelds und international stärker werdendem Angebots- und Preisdruck, sowohl durch<br />
Karpfen und Forellen als auch durch andere konkurrierende Aquakulturerzeugnisse, blieb die Anzahl der<br />
Betriebe sowie deren Erzeugung in den letzten Jahren weitgehend konstant. Hierzu trugen zum einen der<br />
Nebenerwerbscharakter der meisten Betriebe bei als auch - bei Haupterwerbsbetrieben - die<br />
Intensivierung der Produktion und die Rationalisierung der Betriebsabläufe mit verstärkter Nutzung des<br />
Kostensenkungspotenzials. Doch entscheidender für die Weiterentwicklung vieler Betriebe wird künftig<br />
der Einstieg bzw. der Ausbau der (überbetrieblichen) Verarbeitung und (Direkt-)Vermarktung sein.<br />
Tourismusorientierte Begleitangebote ("Erlebnistourismus") als zweites Standbein werden sowohl in den<br />
ausgewiesenen <strong>Fischerei</strong>gebieten der Aquakultur als auch der Seefischerei einen Förderschwerpunkt<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 8<br />
bilden. Der Mix aus Tradition und regionaler Verbundenheit bei adäquatem Marketing sowie der<br />
Familiencharakter der Betrieb mit hoher Anpassungsfähigkeit an die Markterfordernisse lassen konstante<br />
Produktionsmengen und -preise bei leicht rückläufiger Betriebszahl mit höherem Wertschöpfungsanteil<br />
erwarten.<br />
Die Fisch verarbeitende Industrie (definiert als Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten) in<br />
Deutschland ist im Wesentlichen auf die Zufuhr von importierten Rohwaren zur Weiterverarbeitung<br />
angewiesen, da deren Rohwarenbedarf die Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge in Deutschland bei<br />
weitem übersteigt. Dies führte in jüngster Vergangenheit bei knapper werdendem Angebot zu einer<br />
deutlichen Verteuerung auf der Beschaffungsseite bis hin zu Versorgungsengpässen. Und auch künftig<br />
wird in Kombination mit dem Aufbau von Verarbeitungskapazitäten an fangplatznahen Standorten<br />
und/oder in Niedriglohnländern der Druck auf die deutsche Fischverarbeitungsindustrie erhalten bleiben.<br />
Trotzdem scheint sich nach Jahren rückläufiger Umsätze und Beschäftigtenzahlen sowie massiver<br />
Umstrukturierungen die wirtschaftliche Lage und Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu stabilisieren, wie<br />
wachsende Exportanteile belegen. Doch auch künftig wird die Lage schwierig bleiben, nicht zuletzt<br />
wegen der globalisierten Märkte und der weitgehenden Zollfreiheit bei Einfuhren in die EU. Die<br />
Entwicklung von Produkten mit höherem Wertschöpfungsanteil, wie Convenienceprodukten, regionalen<br />
Spezialitäten, Nischenprodukten bieten einen möglichen Ausweg. Auf wenige, meist strukturschwache<br />
Standorte (wie z. B. Bremerhaven, Sassnitz, Lüneburg) konzentriert, sind die Unternehmen mit der<br />
Bereitstellung von über 10 000 Arbeitplätzen regional als Arbeitgeber von erheblicher Bedeutung.<br />
Die unmittelbar an die Erzeugung (Seefischerei und Aquakultur) gekoppelte handwerkliche Verarbeitung<br />
und Vermarktung hat ihre Stärken in der Direktvermarktung. Sie bietet große Chancen und<br />
Entwicklungspotenziale und wird auch künftig für viele Betriebe überlebenswichtig sein. Hier bieten sich<br />
vielfach attraktive Chancen für Frauen in der Voll- und Teilzeitbeschäftigung mit der Vereinbarkeit von<br />
Beruf und Familie. Die Übernahme von Bündelungsfunktionen durch Erzeugerorganisationen,<br />
überbetriebliche Verarbeitung und Vermarktung zu höherwertigen Produkten mit innovativem Charakter,<br />
und der Absatz mit Betonung des Regionalcharakters, der Rückverfolgbarkeit und der einwandfreien<br />
gleichbleibend hohen Qualität werden das notwendige Vertrauen beim Kunden erzeugen, um höhere<br />
Preise erzielen zu können. Bei der bereits oben genannten begrenzten Ausdehnungsmöglichkeit der<br />
Primärerzeugung wird dieser Bereich als besonders entwicklungsfähig und wirtschaftlich stabilisierend<br />
für den Kombibetrieb (Fang/Erzeugung und Verarbeitung und Vermarktung) angesehen.<br />
Die Mehrzahl der <strong>Fischerei</strong>häfen an der Ostsee- und Nordseeküste wurde im Verlauf der letzten<br />
Förderperioden zeitgemäß ausgestattet. Trotzdem wird auch künftig die Bereitstellung von effizienten<br />
Serviceeinrichtungen im Hafenbereich für das Ent- und Beladen bei einer weiteren Verringerung der<br />
Hafenliegezeiten an Bedeutung gewinnen und einen ständigen Erneuerungsbedarf erfordern. Des<br />
Weiteren wird die Konzentration der Anlandungen auf weniger Hafenstandorte zu deutlich höherem<br />
Umschlag je Hafen führen und entsprechende Kapazitätsausstockungen notwendig machen. Zur<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 9<br />
Steigerung der touristischen Attraktivität der traditionellen <strong>Fischerei</strong>häfen bedarf es einer feinen<br />
Abstimmung zwischen den konkurrierenden Nutzern.<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 10<br />
3.1 Seefischerei<br />
3.1.1 Hochseefischerei (pelagisch)<br />
Hochseefischerei (pelagisch)<br />
Stärken<br />
- Quoten im Rahmen der relativen Stabilität für<br />
Schwarmfischfänger vorhanden<br />
- Fahrzeuge in technisch hohem und<br />
zeitgemäßem Zustand<br />
- wirtschaftlich stabile Unternehmen<br />
- stabile Handelsbeziehungen<br />
Chancen<br />
- Gesundes Nahrungsmittel mit steigender<br />
Nachfrage<br />
- Derzeit und auch künftig stabile Preissituation<br />
erwartet<br />
- Erschließung neuer Märkte durch innovative<br />
Vermarktungsinitiativen<br />
Schwächen<br />
- Abhängigkeit von wenigen Fischarten<br />
- Wirtschaftlichkeit stark von Beständen/Quoten<br />
abhängig<br />
Risiken<br />
- Unsicherheiten der Entwicklung der Bestände<br />
- Starke Abhängigkeit von Drittlandsabkommen<br />
- Konkurrenzdruck auf globalisierten Märkten<br />
Im Schwarmfischbereich sind drei deutsche speziell für die pelagische <strong>Fischerei</strong> konzipierte<br />
Fahrzeuge im Einsatz. Da sich ihr Fangspektrum auf nur wenige Fischarten<br />
beschränkt, sind sie in ganz besonderem Maße auf ausreichende<br />
Quotenverfügbarkeit angewiesen. Knapp 90 % ihrer Erlöse erzielen sie mit nur<br />
vier Fischarten (siehe Anhang, Tabelle 5 und<br />
Tabelle 6). Nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen in der Vergangenheit zeigen sich die<br />
Froster in einem durchweg guten technischen Zustand. Ihre derzeit wirtschaftlich stabile<br />
Ausgangssituation resultiert nicht zuletzt aus der Nutzung der gesamten Wertschöpfungskette und der<br />
langjährigen Pflege weltweiter stabiler Handelsbeziehungen. Nur sie können den Absatz der Fänge im<br />
globalen Wettbewerb zu angemessenen Preisen garantieren. Ihre mittelfristige Wettbewerbsfähigkeit ist<br />
von der Bestands- bzw. Quotenentwicklung, einschließlich künftiger Fangmöglichkeiten außerhalb der<br />
EU-Gewässer, wo bereits jetzt intensiv von deutschen <strong>Fischerei</strong>fahrzeugen gefischt wird sowie der<br />
Entwicklung der Fischpreise abhängig. Die Mehrzahl der Schwarmfischbestände wird derzeit EU-weit<br />
nachhaltig bewirtschaftet (siehe Anhang, Tabelle 4). Die Ertragsprognosen scheinen wegen zu<br />
erwartender weiterer Verknappung der Rohwarenbasis bei gleichzeitig steigender globaler Nachfrage<br />
stabil eingeschätzt (vergl. Abb. 9 Preisentwicklung ausgewählter Fischarten).<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 11<br />
3.1.2 Hochseefischerei (demersal)<br />
Hochseefischerei (demersal)<br />
Stärken<br />
- Quoten im Rahmen der relativen Stabilität<br />
derzeit für zahlreiche Bestände vorhanden<br />
- Fahrzeuge im Laufe der letzten Jahre<br />
modernisiert und hocheffizient<br />
- Stark vertikal integrierte Unternehmen<br />
Chancen<br />
- Mittel- bis langfristig stabile bis steigende<br />
Preise im Feinfischbereich erwartet<br />
- Erschließung neuer Märkte durch innovative<br />
Vermarktungsinitiativen<br />
- Positionierung im anspruchsvollen<br />
Hochpreissegment und Nischenmärkten<br />
Schwächen<br />
- Insgesamt knappe Ressourcen<br />
- Wirtschaftlichkeit stark von Quoten/Beständen<br />
abhängig<br />
Risiken<br />
- Konkurrenzdruck auf globalisierten Märkten<br />
- Abhängigkeit von Drittlandsabkommen<br />
- Kostenanstieg, insbesondere bei Treibstoffen<br />
Die demersale <strong>Fischerei</strong> wird mit derzeit mit sechs Frostern betrieben. Die Fänge werden bereits auf den<br />
Schiffen zu Filets verarbeitet und schockgefrostet. Ein geringes Durchschnittsalter der Fahrzeuge und die<br />
kontinuierliche Anpassung der Schiffsausrüstungs- und Verarbeitungsanlagen an den Stand der Technik<br />
durch die Investitionsfördermaßnahmen der letzten Jahre ließen – ausreichende Quotenverfügbarkeit<br />
vorausgesetzt (vgl. auch Tabelle 4 des Anhangs) – eine konkurrenzfähige und rentable Grundfischflotte<br />
entstehen.<br />
Sorgen bereitet der Rückgang vieler Bestände und die daraus folgende immer stärker werdende<br />
Abhängigkeit von den Quotenzuteilungen an Kabeljau, Schwarzem Heilbutt und Rotbarsch. Auch der<br />
Übergang zu bisher nicht vermarkteter Fischarten änderte nichts an diesem grundsätzlichen Problem.<br />
Hierin spiegelt sich auch die wirtschaftlich schwierige Lage der Grundfischflotte wieder. Verkauf und<br />
Ausflaggungen von deutschen Fahrzeugen im Verlauf der letzten Jahre waren die Folge.<br />
Die Perspektiven sind, trotz des etwas breiteren Fangspektrums als in der pelagischen Hochseefischerei<br />
(siehe Anhang, Tabelle 5), aufgrund der rückläufigen Bestände sowie der starken Abhängigkeit von<br />
Quoten und Drittlandsabkommen insgesamt schwierig zu beurteilen und mit hohen Unsicherheiten<br />
behaftet. Die geringe Preiselastizität der Nachfrage und global rückläufigen Angebotsmengen lassen<br />
jedoch bei einem Rückgang der globalen Hochseeflottenkapazitäten auf stabilere künftige Erträge hoffen.<br />
In wieweit die deutsche Grundfischfängerflotte jedoch von den derzeitigen und künftig zu erwartenden<br />
Kapazitätsanpassungsprozessen betroffen sein wird, ist unklar.<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 12<br />
3.1.3 Kutter- und Küstenfischerei<br />
Kutter- und Küstenfischerei<br />
Stärken<br />
- Ausreichende Quotenverfügbarkeit von<br />
Seelachs<br />
- Keine Einschränkungen (Quoten) der<br />
Verfügbarkeit der Zielart Krabbe<br />
- Im Rundfischbereich hohe Arbeitsplatzeffekte<br />
und regionale Bindungen durch Verarbeitung<br />
(Filetierung) und Vermarktung in Deutschland<br />
- Nachhaltige Nutzung der Ressourcen<br />
(Muscheln, Krabben und Hering)<br />
- Stabile wirtschaftliche Situation (Muscheln)<br />
Chancen<br />
- Steigende Nachfrage/gesicherter Absatz<br />
- Mittel- bis langfristig stabile bis steigende<br />
Frischfisch- und Schalentierpreise erwartet<br />
- Weitere Stärkung der Stellung im regionalen<br />
und nationalen hochpreisigen Frisch- und<br />
Feinfischmarkt<br />
- Ausbau des Anteils an der<br />
Wertschöpfungskette bei zunehmender<br />
vertikaler Integration in die Verarbeitung und<br />
Vermarktung<br />
Schwächen<br />
- Insgesamt Verknappung der Ressourcen, besonders<br />
schwache Kabeljau- und mäßige Dorsch- und<br />
Plattfischbestände<br />
- Teils gemischte <strong>Fischerei</strong> (mit Kabeljau, der<br />
besonders starken Beschränkungen unterliegt,<br />
Seetageregelung)<br />
- Schwächen in der Vermarktung mit teils<br />
monopolistischer Abnehmerstruktur (Krabben)<br />
- Starke Abhängigkeit von natürlichem Brutfall und<br />
Witterung (Muscheln)<br />
- Wegen mangelnder Attraktivität Überalterung der<br />
Flotte und Nachwuchsmangel<br />
Risiken<br />
- Teils schwache Bestandssituation (Kabeljau, Dorsch<br />
und Plattfische)<br />
- Verschlechterung des Zustandes des<br />
Meeresökosystems durch Über- und konkurrierende<br />
Nutzung („global change“)<br />
- Nutzungsentzug oder –einschränkungen durch<br />
Flächenentzug für Nationalparks (Muscheln),<br />
Schutzzonen und Windparks<br />
- Geringe Investitionsbereitschaft wegen<br />
Unsicherheiten (Bestände, Schwankungen bei der<br />
Quotenzuteilung, Betriebsnachfolger)<br />
- Fortschreitende Überalterung (Flotte und<br />
Mannschaft)<br />
3.1.3.1 Frischfischfischerei (Nordsee)<br />
Nach einem starken überproportionalen Schrumpfungsprozess in den letzten Jahren (vgl. Tabelle 2) in<br />
diesem Flottenbereich - vor allem mit dem Rückgang der Kabeljaubestände - haben sich zwei Gruppen<br />
von Fahrzeugen im Frischfischbereich (Nordsee) erfolgreich etabliert. Mit unterschiedlicher Fangtechnik<br />
befischt die eine Gruppe vorwiegend Kabeljau und Plattfische, während die andere Gruppe hauptsächlich<br />
Seelachs und andere Rundfischarten, wie Seehecht und Rotbarsch fängt. Die wirtschaftliche Situation<br />
stellt sich für beide Gruppen als relativ stabil dar, wobei den Kabeljaufängern mit den sich<br />
verschärfenden Seetageregelungen im Rahmen des Cod recovery plans der EU mit einer Umorientierung<br />
auf andere Fischarten oder einer Ausflaggung gerechnet werden muss.<br />
3.1.3.2 Krabbenfischerei (Nordsee)<br />
Die Krabbenfischerei in der Nordsee mit rd. 260 Baumkurrenfahrzeugen und einem Anteil von 50 % an<br />
den Umsätzen der deutschen Küstenfischerei ist der bedeutendste Flottenteil. Die Fangaktivitäten<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 13<br />
konzentrieren sich ausschließlich auf die Nordseeküste einschließlich der vorgelagerten Inseln. Durch den<br />
Rückgang der Plattfischbestände, insbesondere der Seezunge, ist in den letzten Jahrzehnten der ehemals<br />
lukrative Plattfischfang fast vollständig zum Erliegen gekommen. Heute erwirtschaften die Betriebe ihre<br />
Einkommen fast ausschließlich aus Krabbenfängen in Form von 1–2 Tidenreisen. Aktuell gelten die<br />
Krabbenbestände als nicht gefährdet, doch leiden die Krabbenkutter grundsätzlich unter einer einseitigen<br />
Abhängigkeit von nur einem Fangobjekt. Auch bei der Vermarktung sehen sich die Betriebe mit einer<br />
monopolistischen Nachfragestruktur von nur zwei preisbestimmenden Abnehmern konfrontiert. Trotz<br />
nicht immer befriedigender Preise ist die wirtschaftliche Lage der meisten Betriebe zwar relativ gut, für<br />
umfangreichere Investitionen jedoch nicht ausreichend.<br />
Problematisch, weil in ihren Folgen im Zeitkontext wenig absehbar, sind die vielfältigen konkurrierenden<br />
Meeresnutzungen (Windparks, Schutzgebiete mit Bewirtschaftungsauflagen, Schiffsverkehr,<br />
Kabeltrassen, Meeresbergbau, Verklappungen, Fahrrinnenvertiefungen mit Änderungen der<br />
Strömungsverhältnisse), die zu möglichen Einschränkungen bei der Nutzung von traditionellen<br />
Fanggebieten und in Konsequenz daraus auch zu Betriebsaufgaben führen können (vgl. Abbildung 15 bis<br />
Abbildung 19).<br />
3.1.3.3 Muschelfischerei und -kulturen<br />
Die Muschelwirtschaft stellt einen hoch spezialisierten Subsektor mit nur wenigen Betrieben dar, der die<br />
natürlichen Ressourcen des Wattenmeeres nutzt und über die Bewirtschaftung von Kulturflächen<br />
Speisemuscheln produziert. Die Verknappung der Ressourcen bzw. marktseitigen Angebots und eine<br />
verstärkte Nachfrage am Markt haben in den letzten Jahren zu einer Verbesserung der Erlössituation<br />
geführt.<br />
Die Besatzmuschelgewinnung ist in besonderem Maße von den jährlich stark schwankenden Brutfällen<br />
und den allgemeinen Witterungsverhältnissen abhängig. Die Betriebe haben sich jedoch auf die<br />
Ertragsschwankungen eingestellt und zeigen sich wirtschaftlich stabil. Die Muschelfischerei unterliegt<br />
erheblichen Einschränkungen durch die Wattenmeer-Nationalparks.<br />
Alternative Verfahren zur Produktion von Besatzmuscheln mittels künstlicher Kollektoren, die die<br />
Abhängigkeit von natürlichen Brutfällen vermindern könnten, befinden sich in der Entwicklung.<br />
Generell gibt es noch ungenutzte Wachstumspotenziale für die Muschelbetriebe. Allerdings sind hier<br />
weitere Konflikte mit dem Naturschutz zu erwarten (vgl. Abbildung 15 bis Abbildung 17).<br />
3.1.3.4 Frischfischfischerei (Ostsee)<br />
Die Flotte der Ostsee lässt sich in zwei Sparten unterteilen. Mit ca. 100 größeren und leistungsstärkeren<br />
Kuttern wird die <strong>Fischerei</strong> mit Grundschleppnetzen betrieben, während ca. 1 500 Fahrzeuge, überwiegend<br />
teilgedeckte kleine Kutter oder offene Boote, der Stillen <strong>Fischerei</strong> nachgehen. Die Hauptzielarten sind<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 14<br />
Dorsch, Plattfische und Hering. Für die Ostsee-Schleppnetzfischerei gibt es nur wenige<br />
Ausweichmöglichkeiten auf andere Gewässer oder Fischarten. Daher leidet diese <strong>Fischerei</strong> schon seit<br />
Jahren unter der rückläufigen Dorschquote, doch konnte auf der Erlösseite der fangmengenmäßige<br />
Rückgang durch positive Preisbewegungen teilweise wettgemacht werden. Gleichwohl spiegelt sich die<br />
angespannte wirtschaftliche Situation in der Entwicklung dieses Flottenteils wider, aus dem in der letzten<br />
Dekade jährlich jeweils etwa 2 % der Fahrzeuge ausgeschieden sind (siehe auch Typologie der Flotte<br />
Tabelle 1 und Tabelle 2). Diese Anpassungsprozesse an die wirtschaftlichen Möglichkeiten werden<br />
anhalten und sich voraussichtlich mit den zu erwartenden weiteren Beschränkungen (Dorsch) verstärken.<br />
Auswege werden von den Betroffenen in einer stärkeren horizontalen und vertikalen Vernetzung, einer<br />
vorübergehenden Zurückhaltung bei Investitionen und einem Ausbau der Verarbeitungstiefe auf der<br />
Vermarktungsseite gesehen. Das knappere regionale Frischfischangebot in Folge von Quotenkürzungen<br />
und/oder anderer fangbeschränkender Maßnahmen sowie die stabile Nachfrage könnte hierbei, wie<br />
bereits in den letzten Jahren, zu überlebensfähigen Erzeugerpreisen und -erlösen führen und die<br />
einzelbetrieblichen Härten abfedern (vergl. Abb. 9, Preisentwicklung ausgewählter Fischarten).<br />
Sowohl für ausstiegswillige Betriebe als auch zur Diversifizierung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten<br />
werden schon seit Jahren Umschulungs- und Weiterbildungsangebote von Seiten der hiesigen<br />
Arbeitsämter angeboten. Eine adäquate finanzielle Unterstützung ist gewährleistet.<br />
Auch in der Passiven <strong>Fischerei</strong> sind Dorsch, Plattfische und Hering von hoher wirtschaftlicher<br />
Bedeutung, so dass auch hier sich die rückläufigen Dorschquoten auswirken. Diese<br />
<strong>Fischerei</strong> fängt allerdings zusätzlich einige nicht quotierte Süßwasserarten in<br />
unmittelbarer Küstennähe und in den angrenzenden Boddengewässern, die für die<br />
Betriebe ertragsstabilisierend wirken (siehe auch Tabelle 5 und<br />
Tabelle 6).<br />
Die passive <strong>Fischerei</strong> zeigt sich wirtschaftlich robuster und leidet weniger unter den Fangbeschränkungen<br />
bei Dorsch sowie der Erhöhung der Treibstoffpreise. Ihre Stärken liegen in dem bereits erwähnten<br />
breiteren Fangspektrum und der Erschließung der lokalen Märkte in Form der Direktvermarktung mit<br />
hohem Wertschöpfungsanteil.<br />
Aber auch für die Vielzahl der Betriebe der Passiven <strong>Fischerei</strong> ist, ebenso wie in der oben genannten<br />
Frischfischfischerei der Ostsee, ein starker Strukturwandel erkennbar. Vorwiegend altersbedingt, aber<br />
auch durch die Ausweitung ihrer Aktivitäten in der regionalen Wirtschaft, vorwiegend dem Tourismus,<br />
wird ein zweites Standbein geschaffen. Gleichwohl leidet insbesondere die strukturschwache<br />
mecklenburg-vorpommerische Ostseeregion seit der Wiedervereinigung unter einem anhaltenden<br />
Abwanderungsdruck aufgrund insgesamt ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.<br />
Bezüglich der ungünstigen Bestandsentwicklung beim Dorsch in der Ostsee werden von beiden<br />
Ostseefischereien große Hoffnungen in das im Rahmen des EFF geförderten Dorsch-Sea-Ranching-<br />
Projekt gesteckt (siehe Kapitel 4.2.1).<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 15<br />
3.2 Aquakultur und Binnenfischerei<br />
3.2.1 Karpfenteichwirtschaften<br />
Karpfenteichwirtschaften<br />
Stärken<br />
- Hoher Anteil Familienbetriebe mit großer<br />
Anpassungsfähigkeit und hoher<br />
wirtschaftlicher Stabilität<br />
- Größtenteils extensive Erzeugung<br />
- Besonders nachhaltige Art der Aquakultur<br />
- Lebensraum für aquatisch gebundene,<br />
gefährdete Tier- und Pflanzenarten<br />
- Landschafts- und strukturbildende Elemente<br />
mit hoher Attraktivität für den Tourismus<br />
Schwächen<br />
- Erzeugung teils kleinstrukturiert<br />
- Erzeugung stark witterungsabhängig<br />
- Stark saisonaler Absatz<br />
- Defizite im Bereich der Verarbeitung/Vermarktung<br />
und Marketing<br />
- Schäden durch unter Schutz stehende<br />
fischfressende und teichwirtschaftlich schädigende<br />
Tierarten<br />
Chancen<br />
- Ausbau des hochpreisigen Direktabsatzes<br />
- Erschließung neuer Märkte durch Produktneuund<br />
Weiterentwicklungen und<br />
Angebotsbündelung<br />
- Auf- und Ausbau eines zweiten Standbeins im<br />
(Angel- und Regional-)Tourismus<br />
- Zucht von Satzfischen für Anglervereine und<br />
Wiederansiedlungspläne (Schleie, Hecht,<br />
Zander, u. a.)<br />
- Sicherung von Absatzmärkten durch<br />
gemeinsame Vermarktungsinitiativen (von der<br />
Region für die Region, EU-anerkannte und<br />
geschützte geographische Herkunft und<br />
Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit)<br />
Risiken<br />
- In Teilen kritische wirtschaftliche Situation wegen<br />
starker Konkurrenz durch Kostenvorteile<br />
(Lohnkosten, geringe Umweltstandards)<br />
benachbarter Staaten<br />
- Tendenziell leichter Rückgang in<br />
Produktion/Nachfrage<br />
- wenig marktgängiges Produkt und Konkurrenz durch<br />
andere (Import-)Fischprodukte aus der Aquakultur<br />
- Sich ständig verschärfende Auflagen im<br />
Umweltbereich<br />
Die kulturelle Bedeutung der Karpfenteichwirtschaft wird allein schon aus ihrer über 1000-jährigen<br />
Tradition offensichtlich. Ihre Verwurzelung in der Landschaft als struktur- und landschaftsbildendes<br />
Element ist insbesondere in Nordbayern, Teilen Sachsens und Brandenburgs unübersehbar und umfassend<br />
(vgl. Abbildung 10 bis Abbildung 122). Fast ausschließlich als naturnahe und extensive Erzeugung<br />
betrieben, trägt sie unbestritten zur Verbesserung des Wasserhaushalts und der Wasserqualität bei. Als<br />
Lebensraum für aquatisch gebundene, vielfach gefährdete Tierarten sind die Teiche von außerordentlicher<br />
ökologischer Bedeutung und häufig Schwerpunkt von Schutzgebietsausweisungen. Trotz hoher<br />
Produktqualität konnte der leicht rückläufige Trend sowohl in der Erzeugung wie auch in der Nachfrage<br />
nicht aufgehalten werden. Dies zwingt zur Erschließung neuer Märkte und zur Weiterentwicklung des<br />
noch schwach entwickelten Marketings. Die Erweiterung der Angebotspalette durch Vermarktung von<br />
Nebenfischen und Zucht weiterer Süßwasserarten eröffnet zusätzliche Einkommenschancen. Mögliche<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 16<br />
Produktionssteigerungen stoßen allerdings zunehmend an Grenzen infolge umweltrechtlicher Auflagen.<br />
Auch die wachsenden wirtschaftlichen Schäden durch Fisch fressende Tiere, insbesondere den Kormoran,<br />
bereiten existenzielle wirtschaftliche Probleme. Perspektivisch wird in der Förderung synergetischer<br />
Effekte durch Zusammenwirken von Teichwirtschaft, Naturschutz und Tourismus ein bedeutendes<br />
Aufgabenfeld erwachsen.<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 17<br />
3.2.2 Forellenwirtschaften<br />
Forellenwirtschaften<br />
Stärken<br />
- Ganzjährige Erzeugung und Marktbelieferung<br />
- Weitgehend Ressourcen schonende Erzeugung<br />
- Hohe Wertschöpfung durch stabilen Anteil in<br />
der Direktvermarktung, insbesondere im<br />
Frischfischbereich, durch Teilver-/bearbeitung<br />
und Veredelung<br />
- Ausbaufähiger Absatzmarkt von Satz- und Nebenfischen<br />
für Wiederansiedlungsprogramme<br />
und die Angelfischerei (Saibling, Äsche,<br />
Lachs, u. a.)<br />
Chancen<br />
- Hohes Intensivierungspotenzial in der<br />
Erzeugung durch Einsatz neuer Techniken<br />
- Zucht von Satzfischen für Anglervereine und<br />
Wiederauffüllungspläne<br />
- Aufbau und Ausbau eines zweiten<br />
Standbeines im (Angel- und Regional-)<br />
Tourismus<br />
- Hohes Intensivierungspotenzial in der<br />
Vermarktung<br />
- Sicherung von Absatzmärkten durch<br />
gemeinsame Vermarktungsinitiativen (von der<br />
Region für die Region, EU-anerkannte und<br />
geschützte geographische Herkunft)<br />
- Weiterentwicklung des hochpreisigen<br />
Direktabsatzes mit Betonung der Regionalität<br />
und der 100 %igen Rückverfolgbarkeit<br />
- Erschließung neuer Märkte durch Produktneuund<br />
Weiterentwicklung und<br />
Angebotsbündelung<br />
Schwächen<br />
- Konkurrenz auch durch den wachsenden Markt<br />
alternativer Aquakulturprodukte (wie z. B.<br />
Dorade, Wels)<br />
- Beeinträchtigungen durch fischfressende Tierarten<br />
bzw. erhöhte Kosten für deren Abwehr, wo<br />
möglich<br />
- In Deutschland kaum/keine Forschung und<br />
Entwicklung/Zulassung von Aquakulturtherapeutika<br />
Risiken<br />
- Futterkostenanstieg durch weltweite<br />
Verknappung der Ressource Fisch als Basis für<br />
Fischfutter bei gleichzeitiger weltweiter<br />
Ausdehnung der Aquakultur<br />
- Ressourcenbegrenzung (Wasser hoher Qualität)<br />
behindert Betriebswachstum und die Nutzung<br />
von Größendegressionseffekten<br />
- Sich verschärfende Umweltschutzauflagen<br />
erschweren die Expansion der Betriebe über die<br />
Fläche und durch Intensivierung der Erzeugung<br />
- Konkurrenz auch durch den wachsenden Markt<br />
alternativer Aquakulturprodukte (wie z. B.<br />
Dorade, verschiedene Barscharten)<br />
- Große Konkurrenz aus den Nachbarländern,<br />
derzeit vorwiegend Dänemark, Frankreich,<br />
Italien, künftig auch aus Polen erwartet<br />
Schwerpunkte der Forellenerzeugung liegen aufgrund naturräumlicher Gegebenheiten vorwiegend in<br />
den Mittelgebirgsregionen Baden-Württembergs, Bayerns, Hessens, Nordrhein-Westfalens, sowie<br />
Niedersachsens und Thüringens (vgl. 10 bis Abbildung 122). Die vorwiegend kleinstrukturierten<br />
Betriebe konkurrieren mit Großbetrieben im EU-Umfeld. Die starke Position des Auslandes äußert<br />
sich in einer seit Jahren konstanten Importquote von 50 %. Wegen der sich ständig verschärfenden<br />
Umweltschutzauflagen ist der Neubau und die Erweiterung schon bestehender Anlagen zur Ausnahme<br />
geworden. Produktionssteigerungen sind meist nur durch eine Intensivierung der Produktion über<br />
technische Maßnahmen erreichbar. Als Stärke der heimischen Erzeuger erwies sich die<br />
Vor-Ort-Veredelung und Vermarktung im Direktabsatz. Als erheblicher Vorteil der<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 18<br />
Forellenwirtschaften gegenüber den Karpfen erzeugenden Betrieben gilt die Möglichkeit der<br />
ganzjährigen kontinuierlichen Marktbelieferung und Kundenpflege. Insgesamt werden die Aussichten<br />
für die Forellenerzeuger deutlich positiver gesehen als für die Karpfen erzeugenden Betriebe.<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 19<br />
3.2.3 Fluss- und Seenfischerei<br />
Fluss- und Seenfischerei<br />
Stärken<br />
- Besonders nachhaltige Art der Süßwasserfischerzeugung<br />
- Hege und Pflege der heimischen Fischbestände<br />
und Gewässer<br />
- Hohe Nachfrage und Anteil in der Direktvermarktung<br />
mit guten Preisen<br />
- Touristische Attraktivität durch traditionelle<br />
Wirtschaftsweise (z. B. seenahe Gastronomie)<br />
Chancen<br />
- Ausbau der Wertschöpfungskette durch<br />
Nutzung des Potenzials in der Veredelung<br />
- Ausbau der Nutzungskombination Seen- und<br />
Flussfischerei mit Regionaltourismus und<br />
Angelfischerei<br />
- Nutzung von Gewässern aus<br />
Rekultivierungsmaßnahmen<br />
- Vergütung von nicht-monetären Leistungen im<br />
Landschaftskulturbereich<br />
Schwächen<br />
- Sehr geringe Rentabilität<br />
- Abhängigkeit vom natürlichen Ertragspotenzial<br />
der Gewässer<br />
- Schwierige wirtschaftliche Lage durch Rückgang<br />
der Aalbestände<br />
- Schäden durch Kormorane und andere Fisch<br />
fressende Tiere<br />
Risiken<br />
- Sinkendes Ertragspotenzial bei Verbesserung<br />
der Gewässergüte nach der EU-WRRL<br />
- Zunehmende Nutzungskonkurrenz und<br />
Verdrängung durch Freizeit- und<br />
Tourismusaktivitäten<br />
- Beschränkungen in der Bewirtschaftung durch<br />
Ausweisung als Ramsar-, FFH- und<br />
Naturschutzgebiet<br />
Die Fluss- und Seenfischerei nutzt die natürlichen Ressourcen der Binnengewässer. Zu den<br />
Hauptzielarten gehören vor allem Aal, Barsch, Zander und Hecht; hinzu kommen verschiedene<br />
Coregonenarten ( z.B. Blaufelchen und Gangfisch) vor allem in den süddeutschen Seen. Auch wenn<br />
diese Arten insgesamt nicht als bedroht gelten, muss die durch anthropogene Einflüsse beeinträchtigte<br />
Reproduktion ergänzt werden. Ein Teil dieser Arten wird daher durch Besatzmaßnahmen gestützt.<br />
Sofern es künftig auf EU-Ebene entsprechende Rechtsvorschriften wie z. B. für den Europäischen Aal<br />
gibt, soll der EFF im Zuge der Aalmanagementpläne auch für die Förderung von Besatzmaßnahmen in<br />
den Binnengewässern herangezogen werden. Die Bedeutung der Fluss- und Seenfischer in Hege und<br />
Pflege der natürlichen Gewässer ist unumstritten. Sie sind wie kein anderer Zweig der <strong>Fischerei</strong> vom<br />
guten ökologischen Zustand der Gewässer abhängig. So profitieren sie auf der einen Seite von den<br />
Renaturierungsmaßnahmen und der Verbesserung der Gewässerqualität sowie der Wiederherstellung<br />
der Durchwanderbarkeit von Flüssen. Auf der anderen Seite nimmt das natürliche Ertragspotenzial in<br />
Folge der verringerten diffusen Stoffeinträge aus der Landwirtschaft, vor allem in Form von Stickstoff<br />
und Phosphor, kontinuierlich ab. Während die natürlichen Gegebenheiten die Produktionsmenge und<br />
das Artenspektrum beschränken, wirkt auf der Ertragsseite die zunehmende Nahrungskonkurrenz von<br />
Prädatoren. Allerdings kann die Fischnachfrage im direkten Absatz, küchenfertig oder veredelt, an den<br />
Endverbraucher und die lokale Gastronomie kaum befriedigt werden. Bei begrenzter Erzeugung<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 20<br />
besteht in der stärkeren Veredelung die Chance, die Wirtschaftlichkeit der Betriebe zu verbessern. Zur<br />
Anzahl der Betriebe und ihrer Bedeutung vgl. Tabelle 3.<br />
.<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 21<br />
3.2.4 Technische Haltungssysteme<br />
Technische Haltungssysteme<br />
Stärken<br />
- Geringer Ressourcenverbrauch Wasser bei<br />
Kreislaufanlagen<br />
- Hohe Wachstumsraten bei physiologisch<br />
optimal temperiertem Umlaufwasser<br />
- Ganzjährige und den Markterfordernissen<br />
angepasste Produktion<br />
- Nachnutzung vorhandener Wärmequellen<br />
Chancen<br />
- Stabilisierung junger Tagebergbauseen mit<br />
angepasster Fischproduktion in Netzgehegen<br />
- Kaum Begrenzungen bei der Expansion, da<br />
geringer Ressourcenverbrauch<br />
- Vollständige Nutzung der<br />
Wertschöpfungskette bei integrierter<br />
Erzeugung, Weiterverarbeitung und<br />
Vermarktung<br />
Schwächen<br />
- Technisch anspruchsvoll und störanfällig<br />
- Hoher Kapitalbedarf, hohes Risiko und hohe<br />
Betriebskosten bei Kreislaufanlagen<br />
- Bei Netzgehegen umweltrelevante Tatbestände<br />
nicht gelöst<br />
Risiken<br />
- Hohes wirtschaftliches Risiko, da die meisten<br />
Anlagen als Pilotanlagen betrieben werden und<br />
das Experimentierstadium noch nicht verlassen<br />
haben<br />
- Technisch meist äußerst anspruchsvolle und<br />
störanfällige Verfahrenstechnik<br />
- Höheres Marktrisiko<br />
Hinsichtlich der Anzahl der Betriebe und ihrer Erzeugung sind die verschiedenen technischen<br />
Haltungssysteme zurzeit in Deutschland noch eine Nischenproduktion (zur Unternehmen,<br />
Beschäftigung und Produktion vgl. Tabelle 3). Im Gegensatz zu anderen technischen<br />
Haltungssystemen (z. B. Rundbecken, Netzgehege, Durchlaufanlagen) befinden sich die<br />
Kreislaufanlagen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nach wie vor im Experimentierstadium.<br />
Technische (Klärtechnik), wirtschaftliche (Nicht-Erreichen der Zielpreise) und bei Netzgehegen<br />
umweltrelevante Probleme werden als Ursachen gesehen. Nur wenige Kreislaufanlagen haben sich<br />
bisher am Markt erfolgreich etablieren können. Nennenswerte Mengen wurden bisher nur für Wels<br />
und bei einigen Zierfischarten sowie in der Vergangenheit bei Aal erreicht. Grundsätzlich besteht hier<br />
trotz aller Risiken noch erhebliches Entwicklungspotenzial.<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 22<br />
3.3 Fischverarbeitung und –vermarktung<br />
Fischverarbeitung und -vermarktung<br />
Stärken<br />
Seefischerei<br />
- Wenige große, international konkurrenzfähige<br />
Betriebe mit konstantem bis leicht ansteigendem<br />
Exportanteil<br />
- Zahlreiche flexible kleine und mittelgroße<br />
Verarbeitungsbetriebe mit stark regionalem<br />
und nationalem Bezug und entsprechend<br />
angepasster Produktpalette<br />
- Hoher Spezialisierungsgrad auf wenige<br />
Produkte/Produktgruppen<br />
- hohe Qualitäts- und Hygienestandards<br />
- Steigender Anteil von Produkten mit innovativem<br />
oder Conveniencecharakter<br />
Aquakultur und Binnenfischerei<br />
- Hoher Anteil an der Wertschöpfungskette<br />
durch integrierte Erzeugung, Verarbeitung und<br />
Vermarktung<br />
- Starke Position/Kundenbindung in Nischenund<br />
lokalen Märkten<br />
- Hoher Anteil und weiteres Entwicklungspotenzial<br />
im Direktabsatz<br />
Chancen<br />
Seefischerei<br />
- Bei fortschreitender vertikaler Integration<br />
Sicherung hoher Qualitätsstandards<br />
einschließlich der Rückverfolgbarkeit<br />
- Zunehmende weltweit steigende Nachfrage<br />
und die Ressourcenverknappung lässt<br />
steigende Preise erwarten<br />
- Potenzial Fisch als Trendprodukt („healthy“,<br />
„convenience“)<br />
Schwächen<br />
- Hohe Importabhängigkeit beim Rohwarenbezug<br />
- Hoher Wettbewerbsdruck aufgrund starker<br />
Globalisierungstendenzen<br />
- Hohe Lohn- und Betriebskosten<br />
- Probleme bei der Kapitalbeschaffung für größere<br />
Investitionen<br />
- Unzureichendes überregionales und<br />
betriebsübergreifendes Marketing zur<br />
Absatzförderung<br />
- Schwache Position gegenüber dem LEH<br />
- Kleinstrukturierte und weitflächige Produktion<br />
erschwert die Nutzung von Größendegressionseffekten<br />
in der Verarbeitung und Vermarktung<br />
- Schwache Marktposition der vorwiegend<br />
Kleinproduzenten über den regionalen Markt<br />
hinaus<br />
Risiken<br />
- Hohe Importabhängigkeit beim Rohwarenbezug<br />
- Hoher Wettbewerbsdruck aufgrund starker<br />
Globalisierungstendenzen<br />
- Steigende Preise bei der Rohwarenbeschaffung<br />
wegen weltweit steigender Nachfrage bei<br />
begrenzten Fisch-Ressourcen<br />
- Überkapazitäten in Teilbereichen der<br />
Verarbeitung<br />
Aquakultur und Binnenfischerei<br />
- Weiteres Entwicklungspotenzial im<br />
Direktabsatz und Regionalmarketing bei<br />
flexiblen Familienbetrieben<br />
- Durch den Ausbau gemeinsamer<br />
Verarbeitungs- und Vermarktungsketten<br />
Zugang zum Lebensmitteleinzelhandel und<br />
zum überregionalen Absatz<br />
- Ausweitung des Wertschöpfungsanteils und<br />
Erschließung neuer Märkte durch<br />
Convenienceprodukte<br />
- Starke Konkurrenz auf dem Markt für<br />
Fischprodukte durch Substitute<br />
- Wegen kleinstrukturierter Erzeugung nur<br />
geringes Rationalisierungs- und<br />
Kostensenkungspotenzial im Verarbeitungs- und<br />
Vermarktungsbereich<br />
- Hohe und steigende Transaktionskosten<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 23<br />
Die deutschen Betriebe der Verarbeitung und Vermarktung von Seefisch zeichnen sich durch einen<br />
hohen Spezialisierungsgrad aus. Wenige große Unternehmen - auf einige Standorte konzentriert -<br />
stehen flächendeckend einer Vielzahl von mittleren und kleinen Unternehmen einschließlich<br />
Kleinstbetrieben gegenüber. Bei letzteren handelt es sich häufig um kleine handwerkliche<br />
Räuchereien, meist in unterschiedlicher Weise mit den Erzeugern verbunden und in Gebieten mit<br />
fischereilicher Tradition gelegen. Für Gebiete mit touristischen Schwerpunkten ist dies zumindest in<br />
den Sommermonaten eine wichtige und ausbaufähige Einnahmequelle. Der Aktionsradius dieser<br />
Betriebe ist regional jedoch stark beschränkt.<br />
Nahezu alle industriellen Verarbeitungsbetriebe hingegen sind auf Importe bei der<br />
Rohwarenbeschaffung (ca. 90 %) angewiesen (s. a. Tabelle 14). Allein die Hersteller von<br />
Fischdauerkonserven und Marinaden, deren Ausgangsprodukt vorwiegend der Hering ist, greifen in<br />
erwähnenswertem Umfang auf Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge zurück. Doch auch hier<br />
spielt, bei einer weitgehenden Standardisierung und somit Austauschbarkeit der eingesetzten<br />
Rohwaren, der Preis die Entscheidungsgrundlage für die Bezugsquelle. Dies gilt in gleicher Weise für<br />
den Absatz der Erzeugnisse.<br />
Die Angleichung der Verzehrsgewohnheiten setzt die Verarbeitungsindustrie in immer stärkerem<br />
Maße dem internationalen Wettbewerbsdruck aus. Eine Ausnahme bilden hier die<br />
Fischdauerkonserven und Marinaden auf Heringsbasis, die nur einen begrenzten Absatzmarkt<br />
außerhalb Deutschlands vorfinden. Im Zuge des zunehmenden Wettbewerbsdrucks sind verbesserte<br />
Technologietransferbedingungen für die verarbeitende Industrie unerlässlich. Nur so sind mittel- bis<br />
langfristig die notwendigen Produkt- und Verfahrensinnovationen sicherzustellen und damit fehlende<br />
Kostenvorteile zu kompensieren.<br />
Die Verarbeitungsbetriebe für Produkte der Aquakultur und Binnenfischerei wie auch deren<br />
Vermarktungsstrukturen sind kaum mit denen der Meeresfischerei vergleichbar. Ursache hierfür sind<br />
die vom Direktabsatz geprägte Primärproduktionsstruktur der Teichwirtschaften und Binnenfischerei.<br />
Durch die Bindung der Betriebe an bestimmte geographische Verhältnisse wird auch die Entwicklung<br />
größerer lokaler Verarbeitungseinheiten erschwert. Über Jahrhunderte als Zuerwerbswirtschaften und<br />
Familienbetriebe definiert, bereitete der Direktabsatz geringer Mengen auf den lokalen oder<br />
traditionellen regionalen Märkten (Verbrauchszentren) wenig Schwierigkeiten. Umso schwieriger<br />
gestaltet sich in manchen Gebieten der Rohwarenabsatz der Erzeugnisse der 5 – 10 %<br />
Haupterwerbsbetriebe mit deutlich höherer Erzeugung. Die eigene Wirtschaftskraft reicht jedoch nur<br />
selten aus, um aus eigenen Kräften tragfähige Strukturen in der Verarbeitung und Vermarktung<br />
aufzubauen. Diese Betriebe sehen sich künftig zusätzlich - trotz fester lokaler Verankerung – mit<br />
zunehmenden Einflüssen des freien Warenverkehrs innerhalb der EU und im Rahmen der WTO-<br />
Verhandlungen auch weltweit konfrontiert.<br />
17.12.2007
3. SWOT - Analyse des Sektors und dessen Entwicklung 24<br />
Die deutschen <strong>Fischerei</strong>betriebe sind damit auch einem sich verschärfenden internationalen<br />
Wettbewerb ausgesetzt. Der Konkurrenzdruck macht sich insbesondere auf dem Markt für<br />
Frostprodukte aller Fischarten und Erzeugnisse sowohl durch den freieren Handel innerhalb der EU<br />
als auch das Absenken der Protektion durch Zollsenkungen im Außenbereich bemerkbar. Um diesem<br />
Druck auszuweichen, vermarktet die Aquakultur ihre Fänge und Ernte möglichst frisch und im<br />
direkten Absatz ab Hof, über Verkaufsläden oder mobile Verkaufstände an den Endverbraucher. Bei<br />
außerordentlicher Qualität und Frische und unter Betonung des geographischen Ursprungs überwiegt<br />
so die Platzierung im höherpreisigen Marktsegment. Nur die Stabilisierung und der Ausbau dieser<br />
Vermarktungswege vermag die Kostenvorteile der ausländischen Mitkonkurrenten zu kompensieren.<br />
Ähnliche Wege beschreitet die Kutter- und Küstenfischerei, bei der diese Vermarktungsfunktionen die<br />
Erzeugerorganisationen und Genossenschaften, mit und ohne vorherige Veredelung, übernehmen. Die<br />
Hochseefischerei zeigt sich nach den Umstrukturierungen der letzten Jahre und der Ausrichtung auf<br />
qualitativ anspruchsvolle internationale Nischenmärkte, die die Verarbeitung und Vermarktung mit<br />
einschließen, für den freien Wettbewerb weitgehend gerüstet.<br />
Auch die deutsche Fisch verarbeitende Industrie verfügt im internationalen Vergleich über eine stabile<br />
Wettbewerbsposition. Hierauf weist u. a. die leicht ansteigende Exportquote von derzeit rund 20 % hin<br />
(s. auch Tabelle 11). Ihre starke Stellung wird auch im Vergleich zur übrigen Ernährungsindustrie<br />
deutlich, die in den letzten Jahren nur einen Exportanteil von durchschnittlich 12 % erreichte,<br />
allerdings mit leicht steigender Tendenz. Die globale Rohstoffverknappung verteuert die Erzeugung<br />
bei eng begrenzten Möglichkeiten, die gestiegenen Rohstoffpreise auf die Endprodukte bzw. den<br />
Kunden abzuwälzen.<br />
In allen Sektoren der <strong>Fischerei</strong>wirtschaft kommt es zusätzlich zu einer verstärkten vertikalen<br />
Integration mit einer Reduktion der Handelsstufen mit dem Ziel der Kostenreduktion und höherer<br />
Flexibilität. Die Notwendigkeit einer Entwicklung von einer angebotsorientierten Produzentenpolitik<br />
zu einer nachfrageorientierten Konsumentenstrategie der Unternehmen entlang der<br />
Wertschöpfungskette ist in der Fischwirtschaft ebenso wie im übrigen (Lebensmittel-)Einzelhandel<br />
unverkennbar.<br />
Für die Zielquantifizierung wird auf die Indikatoren im Anhang verwiesen.<br />
3.4 Infrastruktur/<strong>Fischerei</strong>häfen<br />
<strong>Fischerei</strong>häfen / Infrastruktur<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 25<br />
Stärken<br />
- Fangplatznahe Lage der Häfen für die<br />
Küstenfischerei<br />
- meist hinreichende Infrastruktur vorhanden<br />
- Größere Häfen in wesentlichen Bereichen<br />
bereits modernisiert<br />
- Wichtige Funktion für den regionalen<br />
Tourismus<br />
Chancen<br />
- Entwicklung von Regional- und<br />
Hafenkonzepten zur gemeinsamen<br />
fischereilichen und touristischen Nutzung<br />
Schwächen<br />
- Verteilung der Anlandungen auf viele Häfen<br />
erschwert die Bündelung und erhöht die<br />
Transaktionskosten<br />
- Hohe Unterhaltungskosten für die kommunalen<br />
Träger<br />
- Strukturelle Defizite in kleinen Häfen<br />
- Ver- und Entsorgungskosten z. T. deutlich höher<br />
als in ausländischen Konkurrenzhäfen<br />
Risiken<br />
- Probleme bei der Aufrechterhaltung der lokalen<br />
Hafeninfrastruktur bei weiterem Rückgang der<br />
<strong>Fischerei</strong>flotte<br />
- Erhöhung der Transaktionskosten für die<br />
Betriebe bei Konzentration auf wenige<br />
<strong>Fischerei</strong>häfen<br />
Über die gesamte Nord- und Ostseeküste verteilt liegen insgesamt 220 von der EU zugelassene<br />
Anlandehäfen in überwiegend kommunaler Trägerschaft. Der Großteil der Anlandungen erfolgt in<br />
etwa 30 Häfen (vgl. auch Abbildung 5).<br />
Die Vielzahl der Häfen begünstigt zwar die <strong>Fischerei</strong> durch kurze Anlandewege vor allem für die<br />
Tagesfischerei, erhöht andererseits jedoch die Transaktionskosten für die Vermarktung. Nahezu alle<br />
Häfen sind mit ihrem maritimen Flair gleichzeitig auch besondere Anziehungspunkte für den<br />
regionalen Tourismus. Infrastruktur und technische Ausstattung der meisten Häfen ist in der Regel<br />
zufriedenstellend. Hierzu haben maßgeblich auch die FIAF-Förderung der zurückliegenden Jahre und<br />
die Gemeinschaftsinitiative PESCA beigetragen. Die Hafenentwicklung ist eine regional bedeutsame<br />
Aufgabe, die übergreifende Konzeptionen erfordert, um Synergien insbesondere mit dem Tourismus<br />
und der übrigen regionalen Wirtschaft zu nutzen.<br />
Künftig wird es bei weiter abnehmender Anzahl der Betriebe zu einer fortschreitenden Konzentration<br />
auf weniger Hafenstandorte kommen. Unter regional- und strukturpolitischen Gesichtspunkten wird<br />
die Förderung auf entwicklungsfähige Hafenstandorte konzentriert. In der Folge werden bei<br />
steigendem Umsatz je Hafenstandort sinkende Kosten je Vermarktungsmengeneinheit erwartet. Dies<br />
stärkt sowohl die Betriebe als auch deren Vermarktungseinrichtungen gegenüber den nachgelagerten<br />
Sektoren. Direkte sowie Spin-off-Effekte und Synergien mit vor- und nachgelagerten Bereichen und<br />
dem regionalen Tourismus werden über im Anhang definierte Indikatoren zum Politikbereich 5<br />
quantifiziert und Zielgrößen genannt.<br />
17.12.2007
4. Ziele, Prioritäten und Perspektiven 26<br />
3.5 Fischwirtschaftsgebiete<br />
Bezüglich der an der Küste gelegenen Fischwirtschaftsgebiete sei auf Kapitel 3.1. verwiesen, denn<br />
denn dort gibt es bereits die SWOT-Analysen für<br />
- die Kutter- und Küstenfischerei (Frischfisch Nord- und Ostsee, Krabben, Muscheln)<br />
- die <strong>Fischerei</strong>häfen<br />
- und Fischverarbeitung- und Vermarktung<br />
Das sind die Komponenten mit fischereilichem Bezug, die bei einer gesonderten SWOT-Analyse für<br />
die Küsten-Fischwirtschaftsgebiete zu bewerten sind.<br />
Bei den im Binnenland gelegenen Fischwirtschaftsgebieten wird wie teilweise schon in 3.2.1<br />
beschrieben, die Karpfenteichwirtschaft in den teichwirtschaftlich orientierten<br />
Fischwirtschaftsgebieten seit etwa 1 000 Jahren in nahezu unveränderter naturnaher Weise betrieben.<br />
Einige der heute noch vorhandenen Teiche existieren schon seit 600 Jahren in ununterbrochener<br />
Nutzung. Die Teiche konzentrieren sich in den Fischwirtschaftsgebieten zu überregional bekannten<br />
Teichlandschaften, wie z. B. den Aischgrund und die Tirschenreuther Teichplatte in Bayern oder die<br />
Region Oberlausitz in Sachsen. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich dabei eine einzigartige<br />
Landschaft entwickelt, die zu den wenigen noch verbliebenen Rückzugsgebieten aquatisch<br />
gebundener und bedrohter Tier- und Pflanzenarten zählt. Dies und der darin begründete<br />
landschaftliche Reiz macht die Fischwirtschaftsgebiete zu einem attraktiven Ziel für den<br />
Ökotourismus, der allerdings noch weiter zu entwickeln ist.<br />
Sowohl die fast ausschließlich auf schwerer Handarbeit beruhende Bewirtschaftungsweise als auch<br />
ihre weitgehende Abhängigkeit von Boden, Wasser und Klima schwächen die Stellung der<br />
Karpfenteichwirtschaft innerhalb der Aquakultur, aber auch in der gesamten Volkswirtschaft. Für die<br />
Fischwirtschaftsgebiete trifft dies in besonderem Maß zu. Aus diesem Grund sollten die spezifischen<br />
Werte dieser traditionellen Erzeugungsform zur Sicherung ihres Erhalts und der Existenz der<br />
Familienbetriebe genutzt und eine Ausweitung der touristischen Attraktivität gefördert werden.<br />
Fischwirtschaftsgebiete an der Küste<br />
Stärken<br />
Wirtschaft und Soziales<br />
- vergleichsweise niedriges Lohniveau<br />
Tourismus<br />
Schwächen<br />
Geografie, Wirtschaft und Soziales<br />
- periphere Lage<br />
- überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit,<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 27<br />
- seit Generationen gut eingeführte und beliebte<br />
Tourismusdestination<br />
- gute Erreichbarkeit aus Ballungsräumen (insbesondere<br />
Ruhrgebiet/Rheinland/Berlin)<br />
- gutes ursprüngliches Angebot im Tourismus, das<br />
regional authentisch ist (Meer, Strände,<br />
Landschaft, <strong>Fischerei</strong>, Natur, bauliches Erbe).<br />
Insbesondere die <strong>Fischerei</strong>häfen sind eine Stärke<br />
der ausgewählten Standorte, vor allem auch die<br />
Möglichkeit, dass Touristen eine lebendige und<br />
aktive <strong>Fischerei</strong> sehen können (Anlandung der<br />
Fänge etc.)<br />
- relativ gute touristische Infrastruktur<br />
- ständige Weiterentwicklung des Angebots, u. a.<br />
im Rahmen von Programmen, Projekten und<br />
Konzepten und unter Beinbeziehung der<br />
Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Bevölkerung<br />
- teilweise relativ lange Tourismus-Saison,<br />
Nachfrage außerhalb der Hauptreisezeiten<br />
- <strong>Fischerei</strong>häfen spielen regional eine besondere<br />
Rolle im Bereich Tourismus<br />
(authentisches Erlebnis der <strong>Fischerei</strong>)<br />
- intakte und gut geschützte Umwelt (Ausweisung<br />
großflächiger Schutzgebiete mit<br />
unterschiedlichem Status)<br />
- in ihrem ursprünglichen Charakter erhaltene Natur<br />
ist Anziehungspunkt für Touristen<br />
Natur<br />
- intakte bzw. durch Nationalparks und andere<br />
Mechanismen vergleichsweise gut geschützte<br />
Umwelt; die Natur ist auch Anziehungspunkt für<br />
den Tourismus<br />
<strong>Fischerei</strong><br />
- <strong>Fischerei</strong> ist traditionell in der Region verwurzelt,<br />
fester Bestandteil der Regionalkultur<br />
- manche Hauptzielarten sind ausreichend<br />
vorhanden, für sie lassen sich vergleichsweise<br />
hohe Preise erzielen<br />
naturnahe Erzeugung (Fang) der fischereilichen<br />
Produkte<br />
Chancen<br />
<strong>Fischerei</strong><br />
- Stärkung der Genossenschaften und Erzeugerorganisationen,<br />
u. a. durch zusätzliche<br />
Einnahmemöglichkeiten aus Direktvermarktung<br />
und Tourismus<br />
unterdurchschnittliches verfügbares Einkommen<br />
und BIP pro Kopf<br />
- wenig Hochtechnologie, „Zukunftstechnologien“<br />
- wenig produzierendes Gewerbe<br />
- Abwanderung von jungen und gut ausgebildeten<br />
Personen<br />
Tourismus<br />
- hoher Anteil von Tourismusformen, die eine<br />
vergleichsweise geringe Wertschöpfung in der<br />
Region ermöglichen (Wohnmobile,<br />
Zweitwohnungen)<br />
- touristische Infrastruktur stellenweise überaltert/erneuerungsbedürftig,<br />
die „begleitende<br />
Infrastruktur“ (neben den großen Angeboten wie<br />
Strand und Schwimmbäder) ist teilweise noch<br />
defizitär<br />
- an einigen Standorten fehlen noch touristische<br />
Angebote z. B. im Bereich „Wellness“<br />
- Tourismus saison- und witterungsabhängig<br />
- Angebot an Gastronomie außerhalb der Hauptsaison<br />
teilweise unzureichend<br />
<strong>Fischerei</strong>/Fischwirtschaft<br />
- Bestände einiger Fischarten schlecht (z. B.<br />
Plattfische, Kabeljau/Dorsch), in der Folge<br />
erlassene Managementregelungen schränken die<br />
<strong>Fischerei</strong> stark ein<br />
- <strong>Fischerei</strong>häfen an manchen Orten sanierungsbedürftig<br />
(Spundwände, Kaimauern, etc.)<br />
- deutlicher Rückgang der Beschäftigung in der<br />
Fischverarbeitung (z.B. Cuxhaven)<br />
Risiken<br />
<strong>Fischerei</strong><br />
- Einschränkungen und Flächenentzug der <strong>Fischerei</strong><br />
durch konkurrierende Meeresnutzungen<br />
(Offshore-Windenergie,<br />
Schifffahrt,<br />
Baggergutmanagement, Meeresbergbau).<br />
17.12.2007
4. Ziele, Prioritäten und Perspektiven 28<br />
<strong>Fischerei</strong> und Tourismus<br />
- weitere Ausbaupotenziale im Tourismus,<br />
insbesondere im Zusammenspiel mit der <strong>Fischerei</strong><br />
- weitere Potenziale für die <strong>Fischerei</strong> zur<br />
Generierung zusätzlicher Einkommen aus dem<br />
Tourismus u. a. durch Direktvermarktung, was<br />
die <strong>Fischerei</strong> stützt und absichert<br />
- in den meisten Hafenorten des Fischwirtschaftsgebiets<br />
gibt es eine Reihe von<br />
Möglichkeiten und Ideen, durch einzelne Projekte<br />
eine Verbesserung des Gesamtangebots zu<br />
erreichen<br />
- zusätzliche Einkommensmöglichkeiten für<br />
<strong>Fischerei</strong>unternehmen durch Tourismus<br />
- vielfältige Möglichkeiten für <strong>Fischerei</strong><br />
- Erweiterung der Einkommensmöglichkeiten<br />
andere Branchen<br />
- Offshore-Windenergie als Wachstumsbranche<br />
- der Fortbestand der <strong>Fischerei</strong> ist an einigen<br />
Standorten konkret bedroht (z. B. Ditzum und<br />
Greetsiel durch Ems-Ausbau und Offshore-<br />
Windkraft); andere Standorte können langfristig<br />
durch Verschlickung und mangelnde Freihaltung<br />
der Fahrrinne bedroht werden<br />
<strong>Fischerei</strong> und Tourismus<br />
- im Falle des Abzugs der <strong>Fischerei</strong> von einzelnen<br />
Standorten sind dort gravierende Einbrüche im<br />
Tourismus zu befürchten<br />
- weitere Einschränkungen der <strong>Fischerei</strong> durch<br />
zukünftige Managementregelungen<br />
- Flächenverlust für <strong>Fischerei</strong> durch konkurrierende<br />
Nutzung (Offshore-Windenergieparks,<br />
Schifffahrt, Abbau von Sanden und Kiesen,<br />
Verklappungsgebiete, Bau von Pipelines usw.)<br />
- im Falle der totalen Aufgabe einzelner Standorte<br />
durch die Berufsfischerei ist mit gravierenden<br />
Auswirkungen auf den Tourismus zu rechnen<br />
Fischwirtschaftsgebiete im Binnenland<br />
Stärken<br />
- effektive Nutzung der natürlichen Ressourcen<br />
- entsprechen seit jeher der naturnahen<br />
Erzeugungsweise<br />
- hohe Akzeptanz der naturnah erzeugten Produkte<br />
beim Verbraucher<br />
- integraler Bestandteil ökologisch wertvoller<br />
Kulturlandschaften<br />
- potenziell attraktive Gebiete für Ökotourismus<br />
Chancen<br />
- Diversifizierung der im Sektor Tätigen<br />
- Erweiterung der Einkommens- und<br />
Vermarktungsmöglichkeiten<br />
- höhere Anerkennung und dadurch Schutz des<br />
Produktionssystems durch Politik und<br />
Öffentlichkeit<br />
Schwächen<br />
- häufig noch mangelhafte gastronomische und<br />
touristische Infrastrukturen<br />
- noch relativ geringer Bekanntheitsgrad bei<br />
Tourismus und Verbraucher<br />
- noch kein prägnantes Werbe- und<br />
Führungssystem<br />
Risiken<br />
- Erschwernis und Gefährdung durch zunehmende<br />
Auflagen des Natur- und Artenschutzes<br />
- infolge der Naturnähe wachsende Probleme durch<br />
Fisch fressende und den Teich zerstörende Tiere<br />
- eventuell ausbleibende Attraktivitätssteigerung<br />
durch fehlerhafte Maßnahmenwahl<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 29<br />
4. Ziele, Prioritäten und Perspektiven<br />
Zu Beginn dieses Kapitels werden zunächst übergreifende Ziele, Prioritäten, die teils über den enger<br />
gefassten Rahmen der <strong>Fischerei</strong> und auch den EFF-Förderkontext hinausgehen, und die damit<br />
verbundenen Perspektiven dargestellt. In den folgenden Unterkapiteln wird dann auf die<br />
Vorgabenstruktur des <strong>NSP</strong> zurückgegriffen und die prioritären fischereispezifischen Förderbereiche<br />
sowie deren Ziele genannt.<br />
Neben der in diesem Kapitel gegebenen qualitativen Beschreibung der Ziele sei auch auf die<br />
Indikatoren im Anhang verwiesen, die die hier genannten Ziele quantitativ unterlegen und bei einem<br />
kontinuierlichen Programmmonitoring oder bei Auswertungen im Rahmen einer Ex-Post-Evaluation<br />
als Maßstab der Zielerreichung zu verstehen sind.<br />
Insgesamt sind die Zielsetzungen der <strong>Fischerei</strong>politik Deutschlands eng in die Gemeinsame<br />
<strong>Fischerei</strong>politik der EU eingebettet. Gleichwohl werden nationale Schwerpunkte gesetzt, zu denen<br />
nicht zuletzt die nach wie vor nicht erreichte Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zwischen<br />
Konvergenz- und Nicht-Konvergenzgebieten Deutschlands zählt. Die SWOT-Analyse und<br />
Erfahrungen aus den zurückliegenden Förderperioden zeigen deutlich, dass die<br />
Strukturfondsförderung nach wie vor erforderlich und geeignet ist, die Konvergenzziele zu erreichen.<br />
4.1 Hauptziel<br />
Aus Sicht Deutschlands wird die <strong>Fischerei</strong> als wichtiger Wirtschaftsfaktor gesehen. Daher besteht das<br />
Hauptziel der künftigen deutschen <strong>Fischerei</strong>politik in der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen,<br />
um die wirtschaftliche Situation der in der <strong>Fischerei</strong> Beschäftigten nachhaltig zu stabilisieren und, wo<br />
möglich und nötig, auch zu verbessern. Im internationalen Kontext bedeutet dies, die<br />
Wettbewerbsfähigkeit der <strong>Fischerei</strong> auf den verschiedenen Ebenen entlang der Wertschöpfungskette zu<br />
stärken. Aus gesamtwirtschaftlicher und aus Verbrauchersicht kommt dem Ziel der Versorgung der<br />
Verbraucher zu angemessenen Preisen als übergreifendes Ziel eine große Bedeutung zu. Dieses Ziel<br />
steht jedoch – soll die heimische <strong>Fischerei</strong>wirtschaft davon profitieren – in engem Zusammenhang mit<br />
dem oben genannten Hauptziel der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Branche im<br />
globalen Kontext.<br />
4.2 Unterziele<br />
Folgende Unterziele und Prioritäten lassen sich daraus zur Erreichung des Primärzieles ableiten.<br />
17.12.2007
Ziele und Prioritäten des Mitgliedstaates 30<br />
4.2.1 Langfristige Stabilisierung der Fischbestände nach dem Ökosystemansatz<br />
In der marinen <strong>Fischerei</strong> zählt zu den Unterzielen an erster Stelle die langfristige Stabilisierung der<br />
Fischbestände und des Meeresökosystems. Von deren Zustand ist die <strong>Fischerei</strong> unmittelbar<br />
wirtschaftlich abhängig. Die Meere als labile Ökosysteme sind durch vielfältige sowohl nicht<br />
fischereiliche als auch fischereiliche Einflüsse Belastungen ausgesetzt. Aus fischereilicher Sicht<br />
zunehmend beeinträchtigend wirken Windparks, Nationalparks, stark zunehmender Schiffsverkehr,<br />
Fahrrinnenvertiefungen mit Änderungen der Strömungsverhältnisse, Schutzzonen (FFH und Natura-<br />
2000), Meeresbergbau, Verklappungsstellen, Trassenführungen für Versorgungsleitungen aller Art<br />
und vieles mehr (vgl. auch Abbildung 15 bis Abbildung 17). Der <strong>Fischerei</strong>sektor wird auch mit Hilfe<br />
von Fördermaßnahmen im Rahmen des EFF auf verschiedene Art und Weise zur Verringerung<br />
negativer Auswirkungen auf das Meeressystem beitragen. Hierzu zählen die ständige und adäquate<br />
Anpassung der Kapazitäten an die Ressourcen, Entwicklung und Einsatz von umwelt- und<br />
bestandsschonenden Fangtechniken, Ausweisung von Schutz- und Ruhezonen/zeiten im Rahmen von<br />
Meeresnutzungsplänen (Intensiv-, Extensiv- und Nullnutzungszonen, soweit möglich Gewährung von<br />
Ausgleichszahlungen), Schaffung von künstlichen Riffen, wissenschaftliche Studien zum besseren<br />
Verständnis der komplexen Zusammenhänge sowie Unterstützung von Wiederauffüllungsplänen.<br />
Angestrebt wird mittel- und langfristig insgesamt ein gleich bleibender Fischbestand. Für die derzeit<br />
stark gefährdeten Bestände des Ostseedorsches, des Nordseekabeljaus und der Plattfische in der<br />
Nordsee wird im Förderzeitraum Besserung erwartet (vgl. auch Tabelle 4, S. 99). Die Förderung von<br />
Neuentwicklungen und Initiativen für strengere gesetzliche Vorschriften in der Fang- und Netztechnik<br />
auf EU- und nationaler Ebene, sowie deren Einhaltung durch effiziente Kontrollen, sollen hierzu einen<br />
wesentlichen Beitrag leisten.<br />
Einen besonderen Stellenwert nimmt ein Pilotprojekt in Mecklenburg-Vorpommern ein, das vor allem<br />
der Stabilisierung des Dorschbestandes dienen und intensiv wissenschaftlich begleitet werden soll.<br />
Projekt zum Dorschmanagement in der westlichen Ostsee des Landes Mecklenburg-<br />
Vorpommerns<br />
Der Dorschbestand in der westlichen Ostsee befindet sich im Vergleich zu historischen<br />
Bestandssituationen auf einem niedrigen, stabilen Niveau, wobei die volle Reproduktionsfähigkeit<br />
nicht erreicht wird. Das Quotensystem einschließlich die bisher getroffenen technischen und<br />
administrativen Maßnahmen (Mindestlänge, zeitliche Fangverbote, Schutzzonen etc.) haben zu keiner<br />
entscheidenden Bestandsverbesserung geführt. Daher soll ein aquakulturgestütztes<br />
Dorschmanagement die Maßnahmen der Europäischen Union zur Entwicklung und der Umsetzung<br />
von Wiederauffüllungsplänen ergänzen. Ihm kommt damit eine besondere Bedeutung zu.<br />
Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass dieses Projekt nicht angelegt ist, um andere Maßnahmen<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 31<br />
zum Bestandsaufbau, wie technische Maßnahmen oder Reduzierung des Aufwandes<br />
(Flottenreduzierung) zu kompensieren bzw. zu ersetzen.<br />
Ziel ist die Stabilisierung des Dorschbestandes durch gezielten Besatz als bestandsstützende<br />
Maßnahme. Gleichzeitig sollen durch wissenschaftliche Untersuchungen alle biologischen,<br />
ökologischen, technischen, ökonomischen und rechtlichen Fragestellungen und Problemfelder<br />
untersucht werden, um nach Ablauf des Projektes eine ökonomisch und ökologisch vertretbare<br />
Überführung in den privatwirtschaftlichen Bereich zu ermöglichen.<br />
Für dieses Pilotprojekt wurde im Vorfeld eine Machbarkeitsstudie planerisch entwickelt.<br />
Das Projekt gliedert sich im Wesentlichen in folgende Phasen:<br />
1. Die Gewinnung von Laichfischen aus dem Verbreitungsgebiet des Bestandes,<br />
2. die anschließende Aufzucht in der Kulturanlage bis zur Bereitstellung besatzfähiger Jungfische,<br />
sowie<br />
3. die Besatzmaßnahme selbst, in zuvor auf ihre Eignung untersuchten Gebieten, bis hin<br />
4. zum Wiederfang im natürlichen Bestand.<br />
Vorgesehen ist ein internationales Projekt, in dem wissenschaftliche Untersuchungen von Fragen der<br />
Biologie, der Ökologie, des Artenschutzes, der Tiergesundheit, der Genetik, der Ökonomie u. a.<br />
Aspekte wie z. B. der als möglich angenommenen Ausbildung eines Territorialverhaltens der<br />
fangfähigen Dorsche integriert sein werden.<br />
Daher sind neben erheblichen Investitionen in die Kulturanlage auch entsprechende Aufwendungen zu<br />
den vorbereitenden und begleitenden wissenschaftlichen Programmen vorgesehen.<br />
Ziele und Bedeutung des Projektes:<br />
1. Vorbereitung des langfristigen Zieles, durch Dorschbesatz der Dorschbestand der westlichen Ostsee<br />
zu stabilisieren<br />
2. Entwicklung der Voraussetzungen für die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation für<br />
<strong>Fischerei</strong>unternehmen<br />
3. Erarbeitung einer Konzeption zur Nutzung der Anlage nach Beendigung der Forschungsaufgaben<br />
4. Anschluss an die internationale Aquakulturforschung<br />
5. Erkenntnisse über die Biologie des Dorsches und seine Rolle im Ökosystem<br />
6. Einbindung des Pilotprojektes in die Forschung und die Curricula an der Universität Rostock<br />
17.12.2007
Ziele und Prioritäten des Mitgliedstaates 32<br />
Entsprechend den Ergebnissen der ausführlichen Konsultation mit der GD <strong>Fischerei</strong> soll das Projekt in<br />
Stufen geplant und durchgeführt werden. Da die Erreichung der Projektziele deutlich über das Ende<br />
der Programmperiode (s. etwa Ziel 1) hinausweist,, wurde die Kommission gebeten, sich für eine<br />
Finanzierung des Projektes über das Jahr 2015 hinaus einzusetzen.<br />
Bei der Fortentwicklung des Projekts werden die Ergebnisse eines von der GD <strong>Fischerei</strong> an den ICES<br />
in Auftrag gegebenen Gutachtens zu berücksichtigen sein.<br />
4.2.2 Umweltverträgliche Produktion von Fisch- und Fischerzeugnissen<br />
Auch in der Binnenfischerei und Aquakultur sowie in der Verarbeitung tritt die umweltverträgliche<br />
Produktion von Fisch- und Fischerzeugnissen in der künftigen Förderperiode stärker in den<br />
Vordergrund. Erwartet werden in der Aquakultur Extensivierungsmaßnahmen, aber auch der<br />
vermehrte Einsatz technischer Verfahren zur Reduktion der Ablaufwasserbelastungen. Synergien<br />
werden hier mit weiteren Maßnahmen auf regionaler Ebene im Rahmen der<br />
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) angestrebt. Einen breiten Raum werden – erstmals –<br />
Maßnahmen der Gewässersanierung einnehmen, wo klare Defizite bestehen. Hierzu zählen<br />
Gewässermodifikationen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit, Schaffung von geeigneten<br />
Ruhe- und Laichhabitaten, Verringerung belastender Einträge, aber auch gezielte Entnahmen und<br />
Besatzmaßnahmen, Erprobung von alternativen Bewirtschaftungsplänen und Wiederansiedlungs- oder<br />
Bestandsstützungsprogramme (Aal, Lachs, Schnäpel, Stör, sofern die Voraussetzungen des Art. 38 (2)<br />
der EFF-Verordnung vorliegen). In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die in der FIAF-<br />
Förderperiode begonnenen Besatzmaßnahmen zur Erhöhung des Laicherbestandes beim Europäischen<br />
Aal fortgeführt werden sollen (Rechtsgrundlage ist die 2007 angenommene Verordnung des Rates mit<br />
Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aals). Die wissenschaftliche<br />
Begleitforschung und die Überwachung im Rahmen der WRRL wird die Fortschritte auch<br />
quantifizierbar machen. Die bisher im Rahmen der WRRL durchgeführten Maßnahmen und eine<br />
Zustandsbeschreibung sollen hier kurz separat aufgeführt werden.<br />
Nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sollen möglichst alle Oberflächengewässer (Flüsse, Seen,<br />
Übergangs- und Küstengewässer) bis 2015 einen „guten ökologischen Zustand“ und einen „guten<br />
chemischen Zustand“ erreichen. Die WRRL setzt für die Zukunft neue Qualitätsmaßstäbe und fordert<br />
die Politik zum Handeln auf. Naturnahe Fließgewässer mit ihren Auen sind zentrale Achsen eines<br />
länderübergreifenden Biotopverbundes und zugleich Hochwasserretentionsräume. Nach derzeitigem<br />
Kenntnisstand erreicht der überwiegende Teil der Gewässer die Umweltziele nicht. Morphologische<br />
Beeinträchtigungen der Gewässerstrukturen und Querbauwerke, die die natürliche Wanderung von<br />
Fischen und kleineren Organismen verhindern, sind die Hauptursache für Zielverfehlungen.<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 33<br />
Grundwasser soll nach der WRRL ebenfalls bis 2015 möglichst flächendeckend einen „guten<br />
chemischen Zustand“ und einen „guten mengenmäßigen Zustand“ erreichen. Fast die Hälfte der<br />
Wasserkörper erreicht diese Ziele, während die andere Hälfte Defizite aufweist, wobei die chemische<br />
Qualität das entscheidende Problem darstellt. Die Hauptbelastung für das Grundwasser sind<br />
Nährstoffeinträge (insbesondere Nitrat) aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, gefolgt von<br />
zusätzlichen stofflichen Belastungen aus Kläranlagen und der Niederschlagsentwässerung. Andere<br />
spezifische stoffliche Belastungen können regional von Bedeutung sein.<br />
Nur selten ist der gute mengenmäßige Zustand bedroht, was bedeutet, dass bereits heute eine<br />
nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung stattfindet und auch zukünftig ausreichend Grundwasser zur<br />
Verfügung steht. Für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch wurden in<br />
Deutschland über 11.000 Wasserschutzgebiete mit einer Fläche von mehr als 36.000 km² oder 10 %<br />
der Bundesfläche ausgewiesen. Bewirtschaftungsauflagen werden im Umlageverfahren den<br />
Bewirtschaftern entgolten.<br />
Bereits in den 70 ern wurde mit der Überwachung und Bewertung des Zustandes von Nord- und<br />
Ostsee begonnen. Der Grundstein wurde in einer Bund-Ländervereinbarung zur Errichtung einer<br />
Meeresmwelt Datenbank (MUDAB) gelegt, ein gemeinsames Projekt des Bundesamtes für<br />
Seeschiffahrt und Hydrographie und des Umweltbundesamtes. Gegenwärtig verfügt die Datenbank<br />
über insgesamt 13 Millionen Datensätze zu Parametern wie Temperatur, Salzgehalt, aber auch<br />
Nährstoffen, organische wie anorganische und radiochemische Bestandteilen. Gespeist wird der<br />
öffentlich zugängliche Datenbestand aus einem Verbund von 25 Institutionen, die die Daten auf<br />
Seereisen von 25 Forschungsschiffen und zahlreichen zusätzlichen Stationen erfassen und in die<br />
Datenbank uploaden. Mit der Umsetzung kommt die Bundesregierung auch den<br />
Überwachungsanforderungen der EU-WRRL, in der Nordsee den Anforderungen des OSPAR Joint<br />
Monitoring and Assessment Programme (JAMP) und in der Ostsee den Anforderungen des HELCOM<br />
CO<strong>MB</strong>INE beispielhaft nach.<br />
Von den 10 für Deutschland relevanten Flussgebietseinheiten sind 6 internationale<br />
Flussgebietseinheiten (Oder, Elbe, Ems, Rhein, Maas, Donau). Daneben umfassen auch die<br />
Flussgebietseinheiten Schlei/Trave und Eider kleine grenzüberschreitende Einzugs- oder<br />
Teileinzugsgebiete an der Grenze zu Dänemark. Die Flussgebietseinheiten Weser und Warnow/Peene<br />
sind nationale Flussgebietseinheiten. Mit Ausnahme der Flussgebietseinheit Eider haben außerdem<br />
immer mindestens zwei Länder Anteile an der jeweiligen Flussgebietseinheit, im Falle der Elbe sind<br />
es 10 Länder. Die hieraus resultierenden Koordinierungserfordernisse haben zu unterschiedlichen<br />
Organisationsformen zur Sicherstellung der notwendigen Koordination in den Flussgebietseinheiten<br />
geführt (siehe Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland an die Europäische<br />
Kommission vom 18.06.2004 zum Bericht gemäß Artikel 3 Abs. 8 und Anhang I der<br />
17.12.2007
Ziele und Prioritäten des Mitgliedstaates 34<br />
Wasserrahmenrichtlinie). Vergleiche auch Abbildung ?? Flusseinzugsgebiete in der Bundesrepublik<br />
Deutschland (nach Richtlinie 2000/60 Wasserahmenrichtlinie).<br />
4.2.3 Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Gewährleistung einer<br />
angemessenen Lebenshaltung<br />
Die Standorte der <strong>Fischerei</strong> sind meist in strukturschwachen Gebieten gelegen. Dort hat der Erhalt<br />
bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen zwangsläufig einen zentralen Stellenwert. Mit den oben<br />
genannten Effizienzsteigerungen und Rationalisierungseffekten wird für die <strong>Fischerei</strong> erwartet, dass<br />
dieses Ziel weitgehend erreicht werden kann und sowohl der Umsatz als auch das verfügbare<br />
Einkommen der in der <strong>Fischerei</strong> Beschäftigten um jährlich 1 %- 2 % steigt. Außerdem und neben den<br />
Bemühungen um berufliche Diversifikation sollte verhindert werden, dass die Beschäftigtenzahl in der<br />
marinen Primärerzeugung in der Förderperiode stärker als 1 % pro Jahr sinkt. Flankiert werden wird<br />
der Umstrukturierungsprozess durch bereits bestehende weitreichende nationale arbeitspolitische<br />
Angebote (außerhalb des EFF), wie Umschulungen zum Ausstieg oder der Diversifizierung der<br />
bisherigen Tätigkeit, Vorruhestandsregelungen u. ä. In der Aquakultur, weniger begrenzt durch die<br />
natürliche Ressource Fisch als vielmehr durch die Flächen- und Wasserverfügbarkeit, wird angestrebt,<br />
dass sowohl die bewirtschaftete Fläche als auch die Beschäftigtenzahl – durch die Ausdehnung der<br />
Erzeugung von ca. 1 % - pro Jahr insgesamt konstant bleibt, auch wenn hier<br />
Konzentrationsbewegungen sicher nicht ausbleiben werden (vgl. Indikatoren im Anhang, S. 99 ff.).<br />
4.2.4 Verbesserte Positionierung am Markt<br />
Die verbesserte Positionierung am Markt wird auch über die Förderperiode 2007-2013 hinaus ein<br />
Schlüsselinvestitionsbereich für die Überlebensfähigkeit der gesamten Branche werden. Zwei<br />
unterschiedliche Entwicklungen sollen entsprechend unterstützt werden, um über Generierung von<br />
(Zusatz-)Einkommen Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Zum einen wird für<br />
vergleichsweise ballungszentrennahe Standorte die stärker kundenorientierte Direktvermarktung (im<br />
Folgenden auch Direktabsatz oder Selbstvermarktung. Direktvermarktung wird z.B. durch das<br />
deutsche Steuerrecht vom Einzelhandel abgegrenzt, da Einkünfte aus Teichwirtschaft (Aquakultur)<br />
und Binnenfischerei gem. § 13 Einkommenssteuergesetz i. V. mit § 62 Bewertungsgesetz Einkünfte<br />
aus Land- und Forstwirtschaft sind. Ob die eigenen Erzeugnisse zum Weiterverkauf an Groß- und<br />
Einzelhandel oder unmittelbar an Endverbraucher (Direktvermarktung) veräußert werden, ist<br />
unerheblich. Dies gilt auch, wenn zugekaufte Erzeugnisse betriebstypischer Produkte zur Abrundung<br />
des Angebots im Rahmen der „Zukaufsgrenze“ verkauft werden. Diese Zukaufsgrenze wird<br />
überschritten, wenn der Umsatz aus dem Zukauf über 20 % (unter besonderen Umständen über 30 %)<br />
des Gesamtumsatzes liegt.) mit der Bereitstellung von Nischen- und Convenienceprodukten an<br />
Bedeutung gewinnen. Klare Identifizierung mit dem Betrieb oder dem Erzeugerverbund,<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 35<br />
Rückverfolgbarkeit, ganzjährige Kundenbindung und die hohe Flexibilität der Kleinbetriebe gelten als<br />
Erfolgsfaktoren zur Stabilisierung bestehender und der Erschließung neuer Märkte. Für die<br />
überwiegende Zahl der (größeren) Betriebe, vor allem in der marinen <strong>Fischerei</strong>, muss zum anderen<br />
jedoch durch Bündelung des Angebotes auf Erzeugerseite und Einstieg in die (Teil-)Verarbeitung<br />
und/oder ein Zusammenrücken von Primärerzeugern durch Zusammenschlüsse oder vertragliche<br />
Bindungen deren Position gegenüber den Verarbeitern und Vermarktern bzw. dem<br />
Lebensmitteleinzelhandel gestärkt werden. Das ist eine Möglichkeit, adäquate Preise zur Sicherung<br />
des Einkommens zu erzielen. Während im industriellen Verarbeitungssektor durch den technischen<br />
Fortschritt mit einem weiteren Rückgang in der Beschäftigung bei ansteigender Produktivität im<br />
bisherigen Umfang zu rechnen ist (s. auch abelle 11 und Indikatoren im Anhang), wird die<br />
Beschäftigung in den übrigen Verarbeitungs- und Vermarktungsbereichen konstant gehalten werden<br />
können. Beim Selbstversorgungsgrad als quantitativem Indikator wird im Förderzeitraum ein<br />
konstanter Wert für marine <strong>Fischerei</strong>zeugnisse und eine Steigerung von 1 % per annum in der<br />
Aquakultur als Zielgröße genannt. Marketingmaßnahmen sollen die jeweiligen Aktionen begleiten.<br />
Zur Sicherung und der Verbesserung der lokalen, regionalen wie auch zunehmend internationalen<br />
Wettbewerbsfähigkeit werden zusätzlich alle Stufen der Produktion Effizienzsteigerungen über eine<br />
kostenbewußte Erzeugung und Rationalisierungsinvestitionen realisieren müssen.<br />
4.2.5 Strukturwandel in der Fischwirtschaft und Weiterentwicklung des Sektors<br />
Wie bereits ausgeführt, wird der Strukturwandel in der Fischwirtschaft weiter voranschreiten und mit<br />
der Weiterentwicklung des Sektors Hand in Hand gehen. Als Branche mit zahlreichen Side- und Spinoff-Effekten<br />
kommt der <strong>Fischerei</strong>wirtschaft eine ganz besondere Funktion in der Regionalwirtschaft,<br />
dem regionalen Tourismus und als historisches Kulturgut zu. Einer der wesentlichen Aufgaben im<br />
neuen EFF wird daher die Flankierung des Strukturwandels sein, um Strukturbrüche zu vermeiden und<br />
aussichtsreiche Entwicklungen fördernd zu unterstützen. Infrastrukturelle Investitionen in<br />
<strong>Fischerei</strong>häfen können beide Funktionen erfüllen, indem sie zum einen die touristische Attraktivität<br />
rund um den Themenbereich „<strong>Fischerei</strong> erleben“ erhöhen, vorhandene Potenziale im<br />
Regionaltourismus synergetisch nutzen und auf der anderen Seite hafenseitige Serviceeinrichtungen<br />
für die <strong>Fischerei</strong>betriebe auf einem zeitgemäßen und technisch aktuellen Stand halten. Weiter bildet<br />
der bereits genannte Auf- und Ausbau der regionalen Direktvermarktung, aber auch der<br />
Erlebnistourismus hierbei eine Schlüsselfunktion und machen die engen Wechselbeziehungen<br />
zwischen <strong>Fischerei</strong>, Gastronomie und Tourismus deutlich. Die Förderung integrierter Projekte zur<br />
Regionalentwicklung hat in diesem Zusammenhang Vorbildcharakter.<br />
Von den über den EFF förderfähigen Maßnahmen wird ein deutlicher Beitrag zur Erreichung des Ziels<br />
erwartet, die Attraktivität dieser Regionen zu erhalten bzw. zu steigern (messbar z. B. durch Anstieg<br />
der Anzahl der Besucher/Übernachtungen).<br />
17.12.2007
Ziele und Prioritäten des Mitgliedstaates 36<br />
4.2.6 Gute Governance der GFP<br />
Sowohl im nationalen als auch im europäischen Kontext ist eine verlässliche nationale<br />
<strong>Fischerei</strong>aufsicht mit stringenten Kontrollen und Inspektionen eine entscheidende Säule für die<br />
erfolgreiche Umsetzung der GFP. Deutschland unterstützt aktiv die bisher getroffenen Maßnahmen<br />
der Kommission zur Beseitigung der bestehenden Defizite.<br />
Die Aufgaben der <strong>Fischerei</strong>aufsicht und der Küstenwache nimmt in Deutschland ein<br />
Koordinierungsverbund der Vollzugskräfte des Bundes auf See mit drei Fahrzeugen wahr. Unterstützt<br />
werden sie durch weitere Fahrzeuge des Zolls, der Bundespolizei und der Bundesländer. Über 10 000<br />
Kontrollen pro Jahr erstrecken sich auf die Ostsee, Nordsee und die NEAFC/NAFO–Gebiete und die<br />
Anlandehäfen. Die Mehrzahl der Überprüfungen fanden in Deutschland und den unmittelbar<br />
angrenzenden Nachbarländern statt. Neben der Einhaltung technischer Vorgaben in der Ausgestaltung<br />
der Netze, von Fangverboten und Mindestanlandegrößen wurden auch spezifische Regelungen zu<br />
Schutzgebieten, Sperrzeiten und Fangtageregelungen auf ihre korrekte Einhaltung überprüft.<br />
Logbücher und das Fangquotenmanagement wurden ebenfalls kontrolliert und gaben in Einzelfällen<br />
Anlass zu Beanstandungen. Mit 28 oder 4 % lag die Höhe der Verstöße gegen fischereirechtliche<br />
Bestimmungen im langjährigen Durchschnitt. Insgesamt hat sich die Organisation der<br />
<strong>Fischerei</strong>aufsicht und des Küstenschutzes als heterogener Verbund (EU, Bund, Länder,<br />
Hafenfischereiaufsichtsbehörden) als äußerst effizient erwiesen. Sie wird auch künftig, wie schon in<br />
der Vergangenheit, sich ändernden Anforderungen adäquat und zeitnah angepasst.<br />
Die Partizipation aller relevanten Gesellschaftsgruppen, der sog. „Partner“, war schon bei der<br />
Erstellung des <strong>NSP</strong> ein Grundprinzip und wird auch für die Programmdurchführung eine hohe<br />
Präferenz genießen. Die regelmäßige Veröffentlichung von Fördermöglichkeiten und Berichten zum<br />
Programmverlauf wird als wichtiger Teil des Transparenzgrundsatzes der Good Governance<br />
verstanden. Zudem ist der aktuelle <strong>Strategieplan</strong> via Internet für jedermann verfügbar unter<br />
http://www.portal-fischerei.de/fileadmin/redaktion/dokumente/fischerei/070207_<strong>NSP</strong>.<strong>pdf</strong><br />
Zur optimalen Nutzung der Fördermöglichkeiten im <strong>Fischerei</strong>bereich ist generell das Vorhalten<br />
angemessener administrativer Strukturen Voraussetzung, im weiteren Sinne naturgemäß auch eine<br />
zielführende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. hierzu im Einzelnen Kapitel 7).<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 37<br />
4.3 Ziele und Prioritäten (nach <strong>NSP</strong>-Vorgaben)<br />
Im Folgenden werden die Ziele und Prioritäten auf den jeweiligen Ebenen nach den Vorgaben für die<br />
Struktur des <strong>NSP</strong> aufgeführt. Die Reihenfolge der Aufzählung spiegelt im Wesentlichen die<br />
Gewichtung der Ziele und Prioritäten wider. Quantitative Indikatoren und Zielgrößen werden im<br />
Anhang entsprechend der hier vorgenommenen Kapitelunterteilung spezifiziert.<br />
4.3.1 <strong>Fischerei</strong>liche Nutzung<br />
- Nachhaltige Nutzung der <strong>Fischerei</strong>ressourcen in einer artenreichen aquatischen Umwelt;<br />
- Maßnahmen zur Wiederauffüllung der Bestände, insbesondere des Dorschbestandes der<br />
westlichen Ostsee und des Aals in den Flusseinzugsgebieten (sofern die Voraussetzungen des<br />
Art. 38 (2) der EFF-Verordnung vorliegen);<br />
- Ausrichtung der <strong>Fischerei</strong>flotte an den verfügbaren Ressourcen;<br />
- Verbesserung selektiver Fangtechniken.<br />
Prioritäten:<br />
- Die Entwicklung nachhaltiger Bewirtschaftungsstrategien;<br />
- Diversifizierung der fischereilichen Tätigkeiten;<br />
- Studien und Untersuchungen zur Bestandsdynamik und zu umweltrelevanten Einflussfaktoren<br />
unter Berücksichtigung von Discards und „High-grading“;<br />
- Entwicklung der marinen Aquakultur, einschließlich Sea-Ranching;<br />
- Wiederansiedlungsprogramme, Renaturierungs- und Wiederauffüllungsmaßnahmen (z. B. Aal).<br />
4.3.2 Versorgung und Gleichgewicht der Märkte<br />
Ziel:<br />
- Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen und innovativen<br />
<strong>Fischerei</strong>erzeugnissen.<br />
Prioritäten:<br />
- Erhöhung des Selbstversorgungsgrades mit Fisch und <strong>Fischerei</strong>erzeugnissen, insbesondere aus<br />
dem Aquakulturbereich;<br />
- Stärkung des Direktabsatzes und der Regionalvermarktung;<br />
- Sicherung eines kostengünstigen Rohwarenbezuges zur Versorgung der heimischen<br />
Verarbeitungsindustrie;<br />
17.12.2007
Ziele und Prioritäten des Mitgliedstaates 38<br />
- Steigerung des Pro-Kopf-Verbrauchs.<br />
4.3.3 Fortentwicklung einer nachhaltigen Binnenfischerei und Aquakultur<br />
Ziele:<br />
- Fortentwicklung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in Binnenfischerei und Aquakultur;<br />
- nachhaltige Nutzung der Ressourcen im Binnenfischerei- und Aquakultursektor.<br />
Prioritäten:<br />
- Verbesserung der Verfahren und Technologien;<br />
- Erhaltung der kulturhistorisch bedeutsamen Teichlandschaften und von Betrieben in<br />
Schutzgebieten;<br />
- Innovationen durch wissenschaftlich begleitete Pilotprojekte;<br />
- Bestandsmanagement bei Prädatoren und teichschädigenden Tieren;<br />
- Wiederansiedlungsprogramme (soweit Besatzmaßnahmen beabsichtigt sind: nur sofern die<br />
Voraussetzungen des Art. 38 (2) der EFF-Verordnung vorliegen) und<br />
Renaturierungsmaßnahmen.<br />
4.3.4 Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftszweiges<br />
- Schaffung von Rahmenbedingungen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Fischwirtschaft,<br />
sowohl auf globalen als auch lokalen Märkten zum Nutzen der Produzenten und Konsumenten.<br />
4.3.4.1 Seefischerei<br />
Ziele:<br />
- Erhaltung einer wettbewerbsfähigen Flotte;<br />
- Verbesserung der Marktsituation der Erzeuger.<br />
Prioritäten:<br />
- Maßnahmen der Arbeitssicherheit, Arbeitserleichterung und Valorisierung der Produkte;<br />
- Starthilfen für Jungfischer beim erstmaligen Erwerb eines <strong>Fischerei</strong>fahrzeugs gemäß den<br />
Bestimmungen des Art. 27 der EFF-Verordnung;<br />
- Förderung von Erzeugerorganisationen, von Zusammenschlüssen und Kooperationen.<br />
4.3.4.2 Binnenfischerei und Aquakultur<br />
Ziel:<br />
- Erhaltung und Fortentwicklung einer wettbewerbsfähigen Binnenfischerei und Aquakultur.<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 39<br />
Prioritäten:<br />
- Strukturelle Verbesserung von <strong>Fischerei</strong>gewässern, Beseitigung der Degradierung von<br />
Fließgewässern durch Wiederherstellung der Durchgängigkeit, Anlage von Laich- und<br />
Aufzuchtgebieten;<br />
- Wiederansiedlungs- und bestandserhaltende Maßnahmen (soweit Besatzmaßnahmen<br />
beabsichtigt sind: nur sofern die Voraussetzungen des Art. 38 (2) der EFF-Verordnung<br />
vorliegen);<br />
- bessere Markterschließung über Valorisierung auch für bisher wenig genutzte Fischarten sowie<br />
über größere Verarbeitungstiefe und Stärkung des Direktabsatzes;<br />
- Entwicklung innovativer Verfahren (z. B. Pilotprojekte).<br />
4.3.5 Verarbeitung und Vermarktung<br />
Ziele:<br />
- Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit;<br />
- Erhöhung der Wertschöpfung.<br />
Prioritäten:<br />
- Erneuerung und Modernisierung der Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen;<br />
- Steigerung der Angebotsvielfalt durch Produktinnovationen und Diversifizierung;<br />
- Verbesserung der Produktqualität sowie der Gesundheits- und Hygienebedingungen;<br />
- Erhöhung der Transparenz bei Produktionsprozessen und Produkten;<br />
- Verringerungen negativer Umweltwirkungen;<br />
- Stärkung regionaler Verarbeitungs- und Vermarktungspotenziale.<br />
4.3.6 Sozioökonomische Dimension der <strong>Fischerei</strong><br />
Ziele:<br />
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen;<br />
- Förderung des Nachwuchses;<br />
- Stärkung der Rolle der Frau in der <strong>Fischerei</strong>.<br />
Prioritäten:<br />
- Förderung integrierter Projekte zur regionalen Entwicklung;<br />
- Förderung von Maßnahmen zur Sicherheit an Bord und an Land sowie Investitionen zur<br />
Arbeitserleichterung.<br />
17.12.2007
Ziele und Prioritäten des Mitgliedstaates 40<br />
4.3.7 Gewässerschutz<br />
Ziel:<br />
- Sicherung bzw. Herstellung eines guten ökologischen und chemischen Zustands der<br />
fischereilich genutzten Gewässer.<br />
Prioritäten:<br />
- Wiederherstellung der Passierbarkeit der Gewässer für Fische;<br />
- Schaffung von Laichplätzen und Aufwuchsgebieten;<br />
- künstliche Riffe;<br />
- Fortentwicklung Ressourcen schonender Strategien in Fischproduktion und –verarbeitung.<br />
4.3.8 Gute Governance der GFP<br />
Ziel:<br />
- Optimale Nutzung der Strukturfondsförderungsmöglichkeiten zur Behebung der Schwächen des<br />
<strong>Fischerei</strong>sektors in Deutschland;<br />
- Bereitstellung der Infrastruktur für Kontrollen und Inspektionen.<br />
Prioritäten:<br />
- Vorhalten angemessener administrativer Strukturen zur Durchführung der GFP;<br />
- Einbindung der Partner und lokaler Akteure (Bottom-Up-Prinzip) bei Konzeption und<br />
Durchführung des Programms;<br />
- Transparenz bei der Programmdurchführung;<br />
- Publikation von Ergebnissen der Fördermaßnahmen.<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 41<br />
5. Fischwirtschaftsgebiete<br />
In Deutschland gibt es Regionen, in denen die Fischwirtschaft in wirtschaftlicher, sozioökonomischer<br />
und landeskultureller Hinsicht von besonderer Bedeutung ist. Dies sind:<br />
- Hafen- und Anlandeorte der Küsten- und Seefischerei,<br />
- zusammenhängende Produktionsgebiete von Süßwasserfischen,<br />
- Verarbeitungsstandorte für fischwirtschaftliche Erzeugnisse.<br />
Lokal können sich die vorgenannten Funktionen auch überlagern.<br />
Diese fischwirtschaftlich bedeutenden Gebiete liegen an der deutschen Nord- und Ostseeküste und in<br />
zwei Regionen des Binnenlandes (vgl. Abbildung 13).<br />
5.1 Fischwirtschaftsgebiet „Nordseeküste“<br />
Das Fischwirtschaftsgebiet „Nordseeküste“ umfasst die gesamte deutsche Nordseeküste und liegt in<br />
den Bundesländern<br />
- Niedersachsen (Landkreise Leer, Aurich, Wittmund, Friesland, Wesermarsch, Cuxhaven),<br />
- Bremen (Stadt Bremerhaven) und<br />
- Schleswig-Holstein (Landkreise Dithmarschen, Nordfriesland).<br />
Die zahlreichen Häfen sind Stand- und Anlandeorte der Hochsee- und Küstenfischerei. Die meisten<br />
von ihnen gehören zu den kleinen, über die gesamte Küstenlinie verteilten Kutterhäfen, in denen die<br />
Fänge der regionalen Küstenfischerei angelandet werden. Lediglich in den größeren Häfen Cuxhaven<br />
und Bremerhaven erfolgen daneben auch noch Anlandungen der Hochseefischerei (vgl. auch<br />
Abbildung 1 : Regionale Verteilung der <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge und Abbildung 5 : Regionale Verteilung<br />
der Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge in Deutschland). Schwerpunkte der Fischverarbeitung<br />
liegen ebenfalls vor allem in Bremerhaven und Cuxhaven (vgl. Tabelle 7: Eckdaten zum<br />
<strong>Fischerei</strong>gebiet "Nordseeküste").<br />
Schon im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative PESCA 1994-1999 sind die Küstenregionen bereits<br />
Zielgebiet gewesen. Hier wurden unter Anwendung des Bottom-Up-Prinzips zahlreiche Projekte<br />
gefördert, die zu substanziellen strukturellen Verbesserungen geführt haben. Aus den Regionen ist<br />
daher wiederholt um eine Fortsetzung derartiger Fördermöglichkeiten geworben werden, wie sie jetzt<br />
der EFF anbietet.<br />
17.12.2007
5. Fischwirtschaftsgebiete 42<br />
5.2 Fischwirtschaftsgebiet „Ostseeküste“<br />
Das Fischwirtschaftsgebiet „Ostseeküste“ umfasst die gesamte deutsche Ostseeküste und liegt in den<br />
Bundesländern<br />
- Schleswig-Holstein (Landkreise Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Plön,<br />
Ostholstein, kreisfreie Stadt Lübeck) und<br />
- Mecklenburg-Vorpommern (Landkreise Rügen, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg,<br />
Ostvorpommern, Uecker-Randow, Doberan sowie kreisfreie Städte Wismar, Rostock, Stralsund<br />
und Greifswald).<br />
Auch hier sind die zahlreichen Häfen Heimathafen und Anlandeort der deutschen <strong>Fischerei</strong>flotte sowie<br />
benachbarter Mitgliedstaaten. Ein Schwerpunkt der Heringsverarbeitung liegt in Sassnitz-Mukran.<br />
Die Ostseeküste war ebenfalls Zielgebiet der Gemeinschaftsinitiative PESCA 1994–1999 mit vielen<br />
erfolgreichen Förderprojekten.<br />
5.3 Fischwirtschaftsgebiet „Karpfenerzeugung“<br />
Deutschland hat an der gemeinschaftlichen Karpfenproduktion einen Anteil von rd. 20 % und ist damit<br />
der viertgrößte Karpfenerzeuger in der Europäischen Gemeinschaft. Gebiete mit einer besonderen<br />
Konzentration an Karpfenteichen liegen in den Bundesländern<br />
- Bayern (Landkreise Schwandorf, Tirschenreuth, Bamberg, Forchheim, Ansbach,<br />
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Erlangen-Höchstadt) und<br />
- Sachsen (Landkreise Bautzen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Kamenz, Sächsische<br />
Schweiz, Löbau-Zittau).<br />
(Abbildung 13: Fischwirtschaftgebiete, Gemeinden auf NUTS-III-Ebene und zugehörige Landkreise)<br />
In diesen Regionen prägen die Wasserflächen der Teichwirtschaften gleichzeitig das Landschaftsbild.<br />
Sie sind kennzeichnend für einen besonderen Typ der Kulturlandschaft in Deutschland, der über<br />
Jahrhunderte durch traditionelle Bewirtschaftungsformen entstanden ist. Gleichzeitig sind die<br />
zahlreichen Teiche in diesen Regionen auch wertvolle Lebensräume für eine artenreiche Fauna und<br />
Flora und damit häufig Schwerpunkt von Schutzgebietsausweisungen.<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 43<br />
5.4 Ziele und Prioritäten in den Fischwirtschaftsgebieten<br />
Die vorstehend beschriebenen Fischwirtschaftsgebiete sollen in ihrer strukturellen Entwicklung mit<br />
Mitteln des EFF in der Förderperiode 2007-2013 gefördert werden. Dabei sollen vor allem die<br />
bestehenden Strukturen unter Anwendung des Bottom-Up-Prinzips unterstützt und weiterentwickelt<br />
werden. Eine besondere Bedeutung wird dabei der Verbesserung der sozioökonomischen Verhältnisse<br />
über integrierte Ansätze zukommen.<br />
Im Rahmen des EFF 2007-2013 werden in den Fischwirtschaftsgebieten unterhalb der<br />
NUTS-III-Ebene folgende Ziele verfolgt:<br />
- Stärkung einer nachhaltigen Entwicklung,<br />
- Stärkung der regionalen Wirtschaftsstrukturen,<br />
- Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen,<br />
- Verbesserung der Lebensqualität,<br />
- Wahrung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands,<br />
- Steigerung der Wertschöpfung bei <strong>Fischerei</strong>- und Aquakulturerzeugnissen.<br />
Besondere Priorität soll dabei folgenden Bereichen zukommen:<br />
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,<br />
- Stärkung der fischwirtschaftlichen und touristischen Infrastrukturen,<br />
- Diversifizierung der Erwerbstätigkeit,<br />
- Förderung des Ökotourismus,<br />
- Schutz der Umwelt in den Fischwirtschaftsgebieten,<br />
- Erneuerung und Entwicklung von Küstenorten,<br />
- Schutz und Verbesserung der Landschaft und des baulichen Erbes.<br />
17.12.2007
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s 44<br />
6. Finanzielle Vorschau<br />
Nicht-Konvergenzgebiet nach Jahren<br />
Jahr<br />
EFF 1)<br />
€ (in aktuellen Preisen)<br />
2007 7.936.768<br />
2008 8.095.504<br />
2009 8.257.413<br />
2010 8.422.560<br />
2011 8.591.011<br />
2012 8.762.832<br />
2013 8.938.089<br />
gesamt 59.004.177<br />
Konvergenzgebiet nach Jahren<br />
Jahr<br />
EFF 1)<br />
€ (in aktuellen Preisen)<br />
2007 13.802.007<br />
2008 13.821.981<br />
2009 13.837.235<br />
2010 13.847.569<br />
2011 13.852.783<br />
2012 13.852.664<br />
2013 13.847.001<br />
gesamt 96.861.240<br />
1)<br />
die Mittelaufteilung auf Jahre ist von der EU-Kommission vorgegeben<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 45<br />
Finanzplan<br />
Prioritätsachse/<br />
Schwerpunkte EFF 2007-2013<br />
Bundesrepublik Deutschland<br />
CCI Stand: 2.11.2007<br />
Konvergenzgebiet €<br />
(zu aktuellen Preisen)<br />
Konvergenzgebiet gesamt<br />
Prioritätsachse/<br />
Schwerpunkt<br />
Öffentliche Beteiligung<br />
insgesamt<br />
(1)=(2)+(3)<br />
EFF-Beteiligung<br />
(2)<br />
Nationale Beteiligung<br />
(3)<br />
EFF Rate (%)<br />
(4)=(2)/(1)*100<br />
I 6.013.334 4.510.000 1.503.334 75,00<br />
II 44.489.634 33.367.225 11.122.409 75,00<br />
III 66.533.197 49.899.897 16.633.300 75,00<br />
IV 10.584.000 7.938.000 2.646.000 75,00<br />
V 1.528.161 1.146.118 382.043 75,00<br />
gesamt 129.148.326 96.861.240 32.287.086 75,00<br />
Finanzplan<br />
Prioritätsachse/<br />
Schwerpunkte EFF 2007-2013<br />
Bundesrepublik Deutschland<br />
CCI Stand: 27.8.2007<br />
Nichtkonvergenzgebiet €<br />
(zu aktuellen Preisen)<br />
Nichtkonvergenzgebiet gesamt<br />
Prioritätsachse/<br />
Schwerpunkt<br />
Öffentliche Beteiligung<br />
insgesamt<br />
(1)=(2)+(3)<br />
EFF-Beteiligung<br />
(2)<br />
Nationale Beteiligung<br />
(3)<br />
EFF Rate (%)<br />
(4)=(2)/(1)*100<br />
I 7.270.000 3.635.000 3.635.000 50,00<br />
II 48.386.000 24.193.000 24.193.000 50,00<br />
III 37.575.894 18.787.947 18.787.947 50,00<br />
IV 23.000.000 11.500.000 11.500.000 50,00<br />
V 1.776.460 888.230 888.230 50,00<br />
gesamt 118.008.354 59.004.177 59.004.177 50,00<br />
PA I<br />
PA II<br />
PA III<br />
PA IV<br />
PA V<br />
Maßnahmen zur Anpassung der <strong>Fischerei</strong>flotte<br />
Aquakultur, Binnenfischerei, Verarbeitung und Vermarktung<br />
Maßnahmen von gemeinsamen Interesse<br />
Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete<br />
Technische Hilfe<br />
17.12.2007
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s 46<br />
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und<br />
Überwachung der Förderung nach der Verordnung über den<br />
Europäischen <strong>Fischerei</strong>fonds (EFF)<br />
7.1 <strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> (<strong>NSP</strong>) und Operationelles Programm<br />
(OP)<br />
Der nationale <strong>Strategieplan</strong> Deutschland wurde gemäß den Vorgaben der Europäischen Kommission<br />
vom BMELV in enger Zusammenarbeit mit den Fachbehörden und den Bundesländern entwickelt.<br />
Bereits frühzeitig wurden die Partner konsultiert und in den Prozess einbezogen. Der Plan wird bei<br />
Bedarf fortgeschrieben. Im Verlaufe der Erstellung wurden die Öffentlichkeit, die zuständigen<br />
Behörden und Einrichtungen, einschließlich derjenigen, die für die Umwelt und die Förderung der<br />
Gleichstellung von Männern und Frauen zuständig sind sowie die Wirtschafts- und Sozialpartner<br />
wiederholt konsultiert und in die programmatische Arbeit einbezogen. Der erste Entwurf wurde der<br />
gemäß Art. 2 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni<br />
2001 (in Verbindung mit Art. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung) definierten<br />
Öffentlichkeit, nach innerstaatlicher Praxis repräsentiert durch die entsprechenden Verbände,<br />
Organisationen und Gruppen, und den Umweltbehörden im Januar 2007 schriftlich bekannt gegeben,<br />
einer breiteren Öffentlichkeit wurden darüber hinaus die Entwürfe des Operationellen Programms, des<br />
Umweltberichts, des Nationalen <strong>Strategieplan</strong>s und der Ex-ante-Bewertung über Veröffentlichungen<br />
in einschlägigen Zeitschriften und das Internet zugänglich gemacht Die entsprechenden Dokumente<br />
lagen zudem zur öffentlichen Einsicht im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz aus (vgl. „Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung der Entwürfe…“ vom 22.<br />
Februar 2007).<br />
Folgende Stellen wurden beteiligt:<br />
- Beteiligte Bundesministerien (Bundesministerium für Umwelt, Bundesministerium der<br />
Finanzen, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Arbeit<br />
und Soziales, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,<br />
Bundesministerium, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung<br />
- Für die <strong>Fischerei</strong> zuständige Ministerien der Bundesländer und nachgeordneter Bereich<br />
- Bundesmarktverband der Fischwirtschaft, Bundesverband der deutschen Fischindustrie,<br />
Deutscher <strong>Fischerei</strong>verband, Verband der deutschen Binnenfischerei, Deutscher<br />
Bauernverband, Deutscher Landfrauenverband, Deutscher Gewerkschaftsbund, VERDI,<br />
Verbraucherzentrale, Bund für Umwelt und Naturschutz BUND e.V., Naturschutzbund<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 47<br />
Deutschland NABU e.V., Greenpeace, WWF Deutschland, Alfred-Wegener-Institut für Polarund<br />
Meeresforschung (AWI), Cofad GmbH<br />
Auf Bundesebene wurde in diversen Bund-Länder-Besprechungen die Erstellung des <strong>NSP</strong> und dessen<br />
Weiterentwicklung kontinuierlich besprochen und abgestimmt. Die im Laufe der Zeit erstellten<br />
Fassungen wurden intensiv diskutiert und aufgrund etwaiger Änderungswünsche angepasst,<br />
konkretisiert und verbessert.<br />
Nach Fertigstellung des Entwurfes wurden die wichtigsten Stellen auf Bundes- und Landesebene<br />
(Ministerien, Verbände und andere Nichtregierungsorganisationen) nochmals informiert und ihnen<br />
Gelegenheit für eine schriftliche Stellungnahme gegeben. Die schriftlichen Konsultationen begannen<br />
am 03. Januar 2007, eine angemessene Konsultationsfrist wurde gewährt.<br />
Hinsichtlich der Reaktionen ist erstens festzustellen, dass sich bis zum September 2007 vornehmlich<br />
Partner der „Umwelt- und Naturschutzseite“ geäußert haben. Und zweitens, dass diese<br />
Stellungnahmen in der Masse auf spezifische Vorschläge auf Projektebene abzielten. Thematisch im<br />
Schwerpunkt lagen etwa Fragen und Vorschläge zur EFF-Förderung bei NATURA 2000-Zielen, zu<br />
Besatzmaßnahmen zur Bestandserhaltung oder zum Bestandswiederaufbau, zur ökologischen<br />
Produktion und Ökozertifizierung von <strong>Fischerei</strong>produkten und zu Einzelaspekten der marinen<br />
Aquakultur. Der WWF unterstützte nachdrücklich die zumindest im Vergleich zur vorangegangenen<br />
Förderperiode vorgesehene geringere Mittelausstattung der Prioritätsachse 1 und regte an, die<br />
Darstellung der Prioritätsachse 4 besonders mit Blick auf das „Bottom-up-Prinzip“ und die dadurch<br />
zentrale Bedeutung erlangenden Gruppen in den Fischwirtschaftsgebieten zu verdeutlichen und die<br />
sinnvolle Implementierung dieses neuen und begrüßenswerten Förderansatzes mit Nachdruck zu<br />
überwachen.<br />
Diese Anmerkungen und Vorschläge sind in die Überarbeitung des <strong>NSP</strong> eingeflossen, bei den nicht<br />
integrierbaren Vorschlägen zu Einzelprojekten wurde dafür Sorge getragen, dass diese sich inhaltlich<br />
in den beschriebenen Maßnahmen wieder finden können (sofern sie durch den Text der EFF-<br />
Verordnung gedeckt sind, z.B.: Besatzmaßnahmen zur Bestandserhaltung sind nur möglich, wenn<br />
hierfür ein gemeinschaftlicher Rechtsakt vorliegt).<br />
Nachdem die Konsultationsfrist abgelaufen und die Stellungnahmen von Partnern, Öffentlichkeit und<br />
Behörden (die Spitzen der zuständigen Länderministerien waren inhaltlich informiert, in<br />
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wurden darüber hinaus die Kabinette befasst) zum <strong>NSP</strong><br />
17.12.2007
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s 48<br />
eingearbeitet waren, galt er als auf nationaler Ebene angenommen. Zusammen mit dem OP wird auch<br />
die Durchführung des <strong>NSP</strong> vom EFF-Begleitausschuss im Sinne einer Strategiediskussion überwacht.<br />
Für die Strategiedebatte im Jahr 2011 wird ein dementsprechender Bericht vorgelegt.<br />
Die Bekanntgabe der Entscheidung erfolgte gemäß Art. 9 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter<br />
Pläne und Programme in Verbindung mit Art. 14 des UVP-Gesetzes im Dezember 2007.<br />
Der nationale <strong>Strategieplan</strong> wird der Kommission spätestens bei der Vorlage des Operationellen<br />
Programms unterbreitet. Er war bereits im Vorfeld Gegenstand eines Dialogs zwischen dem BMELV<br />
und der Kommission.<br />
Das operationelle Programm Deutschland wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der<br />
Gemeinsamen <strong>Fischerei</strong>politik und des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s erstellt.<br />
7.2 Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems<br />
Bestimmung der zuständigen Behörden<br />
Auf Grund der föderativen Verwaltungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland wird das<br />
Operationelle Programm EFF nicht vom Bund, sondern von den Bundesländern ausgeführt.<br />
Demzufolge werden Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörden nicht auf Bundes-, sondern auf<br />
Ebene der Bundesländer eingerichtet (vgl. Erklärungen Deutschlands und der Europäischen<br />
Kommission zu Artikel 58 der EFF-Verordnung).<br />
Beschreibung der Behörden:<br />
Verwaltung des operationellen Programms<br />
(siehe Art. 59 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006)<br />
Verwaltungsbehörde<br />
Jedes betroffene Bundesland richtet eine für den EFF zuständige<br />
Verwaltungsbehörde ein. Bei den hier zuständigen Behörden bzw. verantwortlichen<br />
Verwaltungen handelt es sich um die obersten <strong>Fischerei</strong>behörden der Bundesländer,<br />
d.h. im Regelfall die <strong>Fischerei</strong>referate der jeweiligen Fachministerien. In die<br />
Durchführung des Programms werden auf deren Weisung auch nachgeordnete<br />
Fachbehörden eingeschaltet.<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 49<br />
Bescheinigung der Ausgabenerklärungen und der Zahlungsanträge vor<br />
Übermittlung an die Kommission<br />
(siehe Art. 60 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006)<br />
Bescheinigungsbehörde<br />
Die vom betroffenen Bundesland festgelegte Bescheinigungsbehörde bescheinigt die<br />
betreffenden Ausgabenerklärungen und Zahlungsanträge.<br />
Diesen Einzelerklärungen und -anträgen stellt das BMELV eine<br />
Gesamtzusammenstellung voran und übermittelt diese Unterlagen im elektronischen<br />
System „SFC 2007“ an die Kommission.<br />
Prüfung der Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme<br />
(siehe Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006)<br />
Prüfbehörde<br />
Ebenso bestimmt jedes Bundesland eine von der Verwaltungs- und<br />
Bescheinigungsbehörde funktionell unabhängige Prüfbehörde, die mit der Prüfung<br />
der effizienten Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme, mit der<br />
Prüfung der Ausgaben anhand geeigneter Stichproben, der Erstellung der<br />
Prüfstrategie, der Erstellung der jährlichen Kontrollberichte und der Fertigung der<br />
Abschlusserklärung betraut ist. Ggf. kann die Prüfbehörde Prüfungsteile auf andere<br />
ebenfalls unabhängige Stellen delegieren.<br />
17.12.2007
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s 50<br />
Die Verwaltungsbehörden und die Bescheinigungsbehörden sind in den nachfolgenden<br />
Landesministerien angesiedelt:<br />
BADEN-WÜRTTE<strong>MB</strong>ERG<br />
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum<br />
Baden-Württemberg<br />
Postfach 10 34 44<br />
70029 Stuttgart<br />
BAYERN<br />
Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten<br />
Postfach 22 00 12<br />
80535 München<br />
BRANDENBURG UND BERLIN<br />
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz<br />
des Landes Brandenburg<br />
Heinrich-Mann-Allee 103<br />
14473 Potsdam<br />
Zwischengeschaltete Stelle für Berlin (Verwaltungsbehörde)<br />
Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz<br />
<strong>Fischerei</strong>amt Berlin<br />
Havelchaussee 149-151<br />
14055 Berlin<br />
BREMEN<br />
Der Senator für Wirtschaft und Häfen<br />
Postfach 10 15 29<br />
28015 Bremen<br />
HA<strong>MB</strong>URG<br />
Freie und Hansestadt Hamburg<br />
Behörde für Wirtschaft und Arbeit<br />
- Landwirtschaft und Forsten -<br />
Postfach 11 21 09<br />
20421 Hamburg<br />
HESSEN<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 51<br />
Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz<br />
Postfach 31 09<br />
65021 Wiesbaden<br />
MECKLENBURG-VORPOMMERN<br />
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
19048 Schwerin<br />
NIEDERSACHSEN<br />
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum,<br />
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
Postfach 2 43<br />
30002 Hannover<br />
NORDRHEIN-WESTFALEN<br />
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Postfach 30 06 52<br />
40190 Düsseldorf<br />
RHEINLAND-PFALZ<br />
Ministerium für Umwelt, Forsten<br />
und Verbraucherschutz<br />
des Landes Rheinland-Pfalz<br />
Postfach 31 60<br />
55021 Mainz<br />
SACHSEN<br />
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
Wilhelm-Buck-Straße 2<br />
01097 Dresden<br />
SACHSEN-ANHALT<br />
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt<br />
des Landes Sachsen-Anhalt<br />
Olvenstedter Straße 4-5<br />
39108 Magdeburg<br />
17.12.2007
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s 52<br />
SCHLESWIG-HOLSTEIN<br />
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume<br />
des Landes Schleswig-Holstein<br />
Mercatorstr. 5<br />
24106 Kiel<br />
THÜRINGEN<br />
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt<br />
Postfach 90 03 65<br />
99106 Erfurt.<br />
Die Trennung der Funktionen ist eindeutig und entsprechend dokumentiert. Die von Artikel 57 Absatz<br />
1 a) der VO (EG) Nr. 1198/2006 geforderte Festlegung der Aufgaben der mit der Verwaltung und<br />
Kontrolle betrauten Stellen und klare Aufgabenzuweisung innerhalb jeder Stelle sind gewährleistet.<br />
Die Prüfbehörden gehören überwiegend ebenfalls den o.a. Ministerien an. Die erforderliche<br />
funktionelle Unabhängigkeit von den Verwaltungsbehörden, den Bescheinigungsbehörden und deren<br />
zwischengeschalteten Stellen ist durch die unmittelbare Zuordnung zum Amtschef oder zur Stabsstelle<br />
des betreffenden Ministeriums sichergestellt. In vier Bundesländern werden die Prüfbehörden<br />
voraussichtlich in den Finanzministerien etabliert.<br />
Der Bericht und die Stellungnahme zur Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß<br />
Art. 71 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1198/2006 werden in der Regel durch die Prüfbehörden erstellt werden.<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 53<br />
Die „Mainstream“-Verwaltungs- und Kontrollstruktur ergibt sich aus dem nachfolgenden<br />
Flussdiagramm.<br />
ABBILDUNG Nr.: 1<br />
CCI 2007 DE 14 FPO 001: VERWALTUNGS-, FINANZ- und KONTROLLSTRUKTUR<br />
KOMMISSION<br />
GD<br />
BUDGET<br />
Zahlung<br />
(payment)<br />
GD<br />
FISH<br />
SFC<br />
2007<br />
Programmergänzungen<br />
+<br />
Antrag auf Zahlung<br />
(payment claim)<br />
BESCHEINIGENDE<br />
STELLE<br />
(Certifying authority)<br />
DIENSTSTELLE der<br />
HAUSHALTS- oder<br />
ZENRTALABTEILUNG<br />
in dem für die <strong>Fischerei</strong><br />
zuständigen<br />
Landesministerium<br />
BUNDESLÄNDER 1- 15 (AUTONOMOUS REGIONS)<br />
DIE TRENNUNG DER<br />
FUNKTIONEN IST<br />
GEWÄHRLEISTET<br />
VERWALTUNGS-<br />
BEHÖRDE<br />
(Managing authority)<br />
- z. B. FACHREFERAT bzw.<br />
FACHABTEILUNG<br />
in dem für die <strong>Fischerei</strong><br />
zuständigen<br />
Landesministerium<br />
PRÜFBEHÖRDE<br />
- z.B. Stabsstelle, dem Amtschef des<br />
Ministeriums unmittelbarzugeordnet -<br />
(Control Body)<br />
B M E L V<br />
(FEDERAL MINISTRY OF<br />
AGRICULTURE)<br />
621<br />
FISHERIES<br />
SFC<br />
2007<br />
615<br />
FINANCIAL<br />
+ CONTROL<br />
SYSTEMS<br />
Zahlung<br />
(payment)<br />
Programmergänzungen<br />
PROJEKT ...<br />
PROJEKT ...<br />
PROJEKT ...<br />
Ggf.<br />
Bewilligungsbehörde<br />
-z.B. Landesanstalt<br />
für Ernährung -<br />
(Intermediate Body)<br />
Begünstigte<br />
(Beneficiaries)<br />
- p r o j e c t s -<br />
PROJEKT ...<br />
PROJEKT ...<br />
PROJEKT ...<br />
Koordinierung:<br />
Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) wird<br />
demgegenüber die Koordinierung übernehmen und steht der Europäischen Kommission als einziger<br />
Ansprechpartner zur Verfügung.<br />
17.12.2007
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s 54<br />
Innerhalb des BMELV sind die Referate<br />
- 621 für die Koordinierung der Durchführung des EFF-Programms<br />
und<br />
- 615 für die Koordinierung der finanziellen Abwicklung und der Durchführung der<br />
Kontrollmaßnahmen zuständig.<br />
Beschreibung des Überwachungs- und Bewertungssystems sowie der Zusammensetzung des<br />
Begleitausschusses<br />
. Es ist vorgesehen, eine inhaltliche Begleitung und eine Beobachtung von Ergebnissen und<br />
Wirkungen in erster Linie durch die Verwaltungsbehörden, den Begleitausschuss und externe<br />
Gutachter u.a. anhand der nach Art. 59 c) VO (EG) Nr. 1198/2006 und Art. 40 und Anhang III der VO<br />
(EG) Nr. 438/2007 geforderten Datenbasis (inklusive der Indikatoren), vorzunehmen. Weitergehende<br />
Analysen sollen auch in Zukunft den Bewertungen überlassen werden, denen aus der Begleitung aber<br />
eine verbesserte Datenbasis zur Verfügung gestellt werden soll.<br />
Die Begleitung wird von den jeweiligen Fachministerien der Bundesländer durchgeführt und durch<br />
den alle Bundesländer und Partner übergreifenden Begleitausschuss koordiniert.<br />
Bei der Begleitung ist die Einbindung der Partner beabsichtigt, einschließlich derjenigen zur<br />
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung/Umweltintegration. Die genauen Modalitäten sollen mit<br />
den Partnern erarbeitet und vereinbart werden, können hier also noch nicht abschließend beschrieben<br />
werden.<br />
Der Begleitausschuss wird sich u.a. aus Vertretern des BMELV, der beteiligten Bundesländer, den<br />
Fondsverwaltern (EFRE, ESF, ELER) der anderen Bundesressorts, sowie der Wirtschafts- und<br />
Sozialpartner (vgl. hierzu Kapitel 8. f) zusammensetzen. Eine fondsübergreifende Begleitung ist damit<br />
sicher gestellt. Der Europäischen Kommission wird vorgeschlagen, Vertreter mit Beobachter- und<br />
Beraterstatus in den Begleitausschuss zu delegieren.<br />
Der Begleitausschuss gibt sich im Einvernehmen mit den Verwaltungsbehörden eine<br />
Geschäftsordnung.<br />
Er wird binnen sechs Monate nach Genehmigung des Programms die Kriterien für die Auswahl der<br />
Vorhaben prüfen und billigen.<br />
Die Ex-ante-Bewertung des OP wurde an einen externen Gutachter vergeben und von diesem bereits<br />
erstellt. Der Bericht wurde dem Operationellen Programm beigefügt. Es ist vorgesehen, die<br />
Zwischenbewertung (geplant im Jahr 2010) wieder an unabhängige Gutachter zu vergeben. Die<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 55<br />
Vorgaben der EU bezüglich der Qualität von Bewertungen werden in der Aufgabenbeschreibung und<br />
bei der Abnahme der Bewertungen Anwendung finden.<br />
.<br />
17.12.2007
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s 56<br />
7.3 Mechanismen zur Konsistenz und Kohärenz<br />
Der bestmögliche Einsatz der knappen Fördermittel verlangt die Kohärenz der Maßnahmen des EFF<br />
mit den anderen EU-Förderprogrammen (EFRE, ESF, ELER) sowie mit der nationalen Wirtschaftsund<br />
Sozialpolitik. Dabei sind Schwerpunkt übergreifend auch die Ziele des Umwelt- und<br />
Naturschutzes sowie der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen zu berücksichtigen. Die<br />
Fördermaßnahmen sind u. a. so aufeinander abzustimmen, dass Doppelförderungen vermieden<br />
werden.<br />
Die Umsetzung der in den Strategischen Leitlinien der EU vorgeschriebenen Konsistenz und<br />
Kohärenz mit den EU-Gemeinschaftspolitiken einschließlich der EU-Förderprogramme wird auf<br />
mehreren Stufen sichergestellt. Dabei werden Synergien erschlossen. Der Schwerpunkt der<br />
Abstimmung muss auf Programmebene liegen. Aus den unterschiedlichen Bedingungen und<br />
politischen Prioritäten resultieren zwischen den Ländern unterschiedliche Abgrenzungen zu den<br />
anderen Förderpolitiken. Hinzu kommt, dass auch andere Förderinstrumente (insbesondere<br />
Strukturfonds) gebietsabhängig in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung bzw. in bestimmten<br />
Gebieten gar nicht angeboten werden. Die Abgrenzung ist in den Operationellen Programmen<br />
vorzunehmen.<br />
Im Einzelnen laufen folgende Arbeitsschritte ab:<br />
Auf der Ebene des Mitgliedstaates:<br />
- Bei Aufstellung der nationalen Strategie und des OP erfolgt im Rahmen der<br />
Ressortabstimmungen eine Koordinierung der verschiedenen Instrumente.<br />
- Die Vertreter der Strukturfonds werden über die Arbeit des Begleitausschusses für den EFF<br />
stets informiert.<br />
- In den Länderrichtlinien werden Abgrenzungskriterien (z. B. inhaltlicher, sektoraler,<br />
räumlicher oder größenabhängiger Art) entwickelt oder Verfahren bestimmt, die<br />
Überschneidungen der Förderaktivitäten aus den verschiedenen Finanzquellen vermeiden.<br />
Dabei wird darauf geachtet, dass die für den EFF festgelegten Auswahlkriterien mit denen für<br />
die Strukturfonds und den ELER in der jeweiligen Region in Einklang stehen.<br />
- Besonders die Bewilligungsverfahren schließen Doppelförderungen aus.<br />
Für die Prioritätsachsen nach dem EFF gelten folgende Abgrenzungskriterien:<br />
Maßnahmen nach Prioritätsachse 1:<br />
Diese Maßnahmen werden nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung zur<br />
Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig.<br />
Maßnahmen nach Prioritätsachse 2:<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 57<br />
Bei produktiven Investitionen in der Aquakultur zur Diversifizierung nach Art. 52 a)i) in Verbindung<br />
mit Art. 53 und von Kleinstunternehmen nach Art. 54 werden Investitionen in der Aquakultur aus der<br />
Förderkulisse des ELER herausgenommen, um Überschneidungen zu vermeiden. Das gleiche gilt für<br />
die Förderung nach Art. 26 (Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe) und Art. 28 (Erhöhung der<br />
Wertschöpfung der Unternehmen).<br />
Bei Umweltschutzmaßnahmen in der Aquakultur gilt: Bisher sind Umweltschutzmaßnahmen dieser<br />
Art außerhalb des FIAF in einigen Bundesländern im Rahmen der ländlichen Entwicklung (KULAP)<br />
gefördert worden. Für die Förderperiode 2007-2013 haben die Dienststellen der Europäischen<br />
Kommission und die Mitgliedstaaten sich mit Blick auf die Kohärenz zwischen dem ELER und dem<br />
EFF auf folgende Abgrenzungskriterien verständigt:<br />
Aus dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums können auch ab 2007 (ELER) weiterhin<br />
Umweltverpflichtungen an Teichen gefördert werden, wenn diese Teiche fischereiwirtschaftlich nicht<br />
genutzt werden oder der aus einer fischereiwirtschaftlichen Nutzung resultierende Einkommensbeitrag<br />
den geringeren Anteil am gesamten Betriebseinkommen ausmacht. Weiterhin ist es möglich,<br />
Umweltverpflichtungen aus dem ELER zu unterstützen, die auf die Verlandungszonen von Teichen<br />
abzielen und die Umweltqualität der Teiche verbessern (z.B. Anlegen von Randstreifen, Verringerung<br />
des Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes, Erhaltung von Landschaftselementen wie Hecken).<br />
Die Bundesländer werden sich bei ihren Fördermaßnahmen eng an diesen Kriterien ausrichten. In<br />
Bayern und Sachsen ist beabsichtigt, Teichpflegemaßnahmen ausschließlich aus Landesmitteln zu<br />
fördern (Staatsbeihilfen).<br />
Bestimmte Hygiene- und Veterinärmaßnahmen im <strong>Fischerei</strong>bereich sollen nur im Rahmen des EFF<br />
gefördert werden. Eine Verfahrensregelung zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht<br />
notwendig.<br />
Bei der Förderung von Investitionen in der Binnenfischerei zur Diversifizierung nach Art. 52 a)i) in<br />
Verbindung mit Art. 53 und von Kleinstunternehmen nach Art. 54 werden Investitionen aus der<br />
Förderkulisse des ELER herausgenommen, um Überschneidungen zu vermeiden. Das gleiche gilt für<br />
die Möglichkeit der Förderung nach Art. 26 (Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe) und Art.<br />
28 (Erhöhung der Wertschöpfung der Unternehmen).<br />
Bei der Verarbeitung und Vermarktung gilt: Bei der Förderung von Kleinstunternehmen nach Artikel<br />
54 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 werden <strong>Fischerei</strong>unternehmen aus der Förderkulisse des<br />
ELER herausgenommen, um Überschneidungen zu vermeiden. Das gleiche gilt für die Möglichkeit<br />
der Förderung nach Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 zur Erhöhung der Wertschöpfung<br />
der Unternehmen.<br />
17.12.2007
7. Verfahren zur Entwicklung, Durchführung und Überwachung des nationalen <strong>Strategieplan</strong>s 58<br />
Bei der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung fischereilicher Produkte wird eine EFRE-<br />
Förderung nur dann geprüft, wenn eine Förderung nach Art. 35 Abs. 3 b der VO Nr. 1198/2006 aus<br />
dem EFF nicht mehr möglich ist.<br />
Maßnahmen nach Prioritätsachse 3<br />
Kollektive Aktionen sollen kann nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung<br />
zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig.<br />
Für Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna und –flora gilt: In Ergänzung der<br />
Kofinanzierungsmöglichkeiten von Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna<br />
und -flora aus dem EFF wird die Förderung der Seensanierung und der naturnahen Entwicklung der<br />
Gewässer aus dem ELER gesehen, sodass vor allem beim Bau von Fischwegen und beim Rückbau<br />
von Querverbauungen eine Abstimmung einzelner Projekte erfolgt und ggf. eine Zusammenarbeit<br />
zwischen den beiden Fonds organisiert wird.<br />
Bei der Förderung der <strong>Fischerei</strong>häfen wurde sich darauf verständigt, dass die der <strong>Fischerei</strong> unmittelbar<br />
zuzuordnenden Hafeninvestitionen nicht aus dem EFRE gefördert werden. Projektbezogen wird aber<br />
wie in der Vergangenheit die Förderung miteinander abgestimmt, um Möglichkeiten gemeinsamer<br />
Nutzungen von <strong>Fischerei</strong> und „Nichtfischerei“ oder andere Synergien zu ermitteln und abzustimmen.<br />
Bei Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten und Ausarbeitung von Werbekampagnen werden in den<br />
Fällen, in denen eine Förderung der Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten oder der<br />
Netzwerkbildung möglich ist, im <strong>Fischerei</strong>sektor vorrangig EFF-Mittel eingesetzt werden.<br />
Da über den EFF eine Förderung der Zertifizierung fischereilicher Produkte und Strukturen möglich<br />
ist, wird der ELER diese Möglichkeit aus seinem Fonds für die Fischwirtschaft nicht anbieten.<br />
Bei Pilotprojekten haben sich in Mecklenburg-Vorpommern <strong>Fischerei</strong>verwaltung und ESF-<br />
Verwaltung darauf verständigt, die Verwertung der Forschungsergebnisse von Pilotprojekten soweit<br />
möglich über den ESF zu finanzieren. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten, z.B. im<br />
Ostseeraum, werden projektbezogen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Rahmen des<br />
INTERREG geprüft werden.<br />
Maßnahmen nach Prioritätsachse 4:<br />
Aufgrund der breit angelegten Zielrichtung der Prioritätsachse 4 können bestimmte Projekte<br />
(Ökotourismus, Erhalt des kulturellen Erbes u. a.) in den Fischwirtschaftsgebieten grundsätzlich aus<br />
verschiedenen Fonds unterstützt werden. Die Gruppen werden daher – nicht zuletzt im Rahmen der<br />
integrierten Strategie – dafür Sorge tragen, dass die von ihnen ausgewählten Projekte einen deutlichen<br />
fischwirtschaftlichen Bezug haben und ausschließlich aus dem EFF gefördert werden.<br />
Maßnahmen nach Prioritätsachse 5:<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> 59<br />
Diese Maßnahme werden nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung zur<br />
Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig.<br />
Neben der äußeren Kohärenz mit anderen Förderpolitiken ist die innere Kohärenz der<br />
Fördermaßnahmen des EFF wichtig. So ist darauf zu achten, dass z. B. die zentralen Ziele einer<br />
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der <strong>Fischerei</strong>wirtschaft, des Umweltschutzes und der Schaffung<br />
und Sicherung von Arbeitsplätzen bestmöglich in Einklang gebracht werden. Generell sind die<br />
Belange des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes mit den wirtschaftlichen Interessen abzustimmen.<br />
Auf diese Weise kann die Effizienz des Mitteleinsatzes gesteigert und im Sinne einer<br />
partnerschaftlichen Zusammenarbeit eine kohärente, zielgruppenorientierte Ausgestaltung der<br />
Entwicklungsstrategien für die Umsetzung des EFF erreicht werden.<br />
Damit wird auch die Transparenz zwischen den Förderinstrumenten sichergestellt.<br />
17.12.2007
Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 60<br />
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 61<br />
8.1 Typologie der Flotte<br />
Tabelle 1 : Flottenstruktur und Kapazitäten nach Regionen und <strong>Fischerei</strong>en – 31.12.2006<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 62<br />
Anzahl kW BRZ<br />
Region Typ n % zu Subtotal % zu Total Summe % zu Subtotal % zu Total Summe % zu Subtotal % zu Total<br />
Kleine Hochseefischerei und Küstenfischerei<br />
Ostsee<br />
Stille <strong>Fischerei</strong> 1 483 91 73 30 487 61 19 3 737 40 6<br />
Frischfischtrawler 98 6 5 18 910 38 12 5 456 59 9<br />
Spezialfahrzeuge (nicht quotierte Fischarten) 51 3 3 820 2 1 103 1 0<br />
Subtotal Ostsee 1 632 100 81 50 217 100 32 9 296 100 15<br />
Nordsee<br />
Krabbenkutter 261 69 13 46 292 58 29 10 955 48 17<br />
Frischfischtrawler 32 8 2 21 303 27 13 7 285 32 12<br />
Spezialfahrzeuge, einschl. Muschelfischerei 35 9 2 8 672 11 5 3 238 14 5<br />
Stille <strong>Fischerei</strong>, Nordsee 51 13 3 3 560 4 2 1 170 5 2<br />
Subtotal Nordsee 379 100 19 79 827 100 21 22 648 100 36<br />
Große Hochseefischerei<br />
Nordsee, Westbritische Gewässer, Grönland, Nordafrika<br />
Große Hochsee, demersal 6 67 0,3 16 134 56 10 12 759 41 20<br />
Große Hochsee, pelagisch 3 33 0,1 12 841 44 8 18 105 59 29<br />
Subtotal Große Hochsee 9 100 0,4 28 975 100 18 30 864 100 49<br />
Total 2 020 100 159 019 100 62 808 100<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 63<br />
Tabelle 2 : Entwicklung der Flottenstruktur nach <strong>Fischerei</strong>en 1997 bis 2006<br />
1997 2006 relative jährliche Änderungen<br />
Region Typ Anzahl BRZ kW Anzahl BRZ kW Anzahl BRZ kW<br />
Kleine Hochseefischerei und Küstenfischerei<br />
Ostsee<br />
Stille <strong>Fischerei</strong>, Ostsee 1 747 4 059 27 675 1 483 3 737 30 487 -2% -1% 1%<br />
Frischfischtrawler, Ostsee 121 5 904 22 529 98 5 456 18 910 -2% -1% -2%<br />
Spezialfahrzeuge (und nicht quotierte Fischarten) 2 2 9 51 103 820 272% 561% 1001%<br />
Subtotal Ostsee 1 870 9 965 50 213 1 632 9 296 50 217 -1% -1% 0%<br />
Nordsee<br />
Krabbenkutter, Nordsee 301 10 978 48 765 261 10 955 46 292 -1% 0% -1%<br />
Frischfischtrawler, Nordsee 43 7 602 20 313 32 7 285 21 303 -3% 0% 1%<br />
Spezialfahrzeuge, Nordsee 40 2 422 5 604 35 3 238 8 672 -1% 4% 6%<br />
Stille <strong>Fischerei</strong>, Nordsee 71 1 264 4 047 51 1 170 3 560 -3% -1% -1%<br />
Subtotal Nordsee 455 22 266 78 729 379 22 648 79 827 -2% 0% 0%<br />
Große Hochseefischerei<br />
Nordsee, Westbritische Gewässer, Grönland, Nordafrika<br />
Große Hochsee, demersal 8 17 437 20 816 6 12 759 16 134 -3% -3% -2%<br />
Große Hochsee, pelagisch 4 18 264 11 749 3 18 105 12 841 -3% 0% 1%<br />
Subtotal 12 35 701 32 565 9 30 864 28 975 -3% -2% -1%<br />
Total 2 337 67 932 161 507 2 020 65 882 161 243 -2% 0% 0%<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 64<br />
Abbildung 1 : Regionale Verteilung der <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 65<br />
Abbildung 2 : Beschäftigung in der Seefischerei nach Heimathafen der Fahrzeuge<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 66<br />
Abbildung 3 : Regionale Verteilung der kW-Fahrzeugkapazitäten<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 67<br />
Abbildung 4 : Regionale Verteilung der BRZ-Fahrzeugkapazitäten<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 68<br />
8.2 Unternehmen, Beschäftigung und Produktion<br />
Tabelle 3 :<br />
Unternehmen, Produktion, Umsatz und Beschäftigung nach Sektoren<br />
Anzahl Erzeug. [1000 t] Umsatz [Mio.€] FTE-Beschäftigte (Anzahl)<br />
Seefischerei 1,3<br />
Hochseefischerei 36 164,1 97,8 368 (368)<br />
Kutter- und Küstenfischerei 1.463 91,3 77,9 1965 (3.536)<br />
Total (Seefischerei) 1.499 255,4 175,7 2.333 (3.904)<br />
Binnenfischerei & Aquakultur 2<br />
Salmoniden<br />
Haupt 440 19.123<br />
Neben 9.981 4.643<br />
Subtotal (Salmoniden) 10.421 23.766 109,9<br />
Karpfen<br />
Haupt 183 11.106<br />
Neben 12.074 5.726<br />
Subtotal (Karpfen) 12.257 16.832 50,0<br />
Fluss- und Seenfischerei<br />
Haupt 663<br />
Neben 172<br />
Subtotal (Fluss- und Seenfischerei) 866 3.625 9,1<br />
Kreislaufanlagen 31 688 4,1<br />
Netzgehege 21 359 2,0<br />
Total (Binnenfischerei & Aquakultur) 23.575 44911 175,1 4.535 (23.617)<br />
Angler 1<br />
Angler Vereine 8.888<br />
Angler organisiert 954.436<br />
Angelscheine 1.500.000<br />
Total (Angler) 17391 57,3<br />
Fischverarbeitung<br />
Fischverarbeitungsbetriebe (EFB) 3 348 n.v. n.v. n.v.<br />
Fisch verarbeitende Industrie BRD 2,4<br />
Alte Bundesländer 96 383.757 1.428,3 7.310<br />
Neue Bundesländer 27 55.880 208,0 1.415<br />
Total (Fisch verarbeitende Industrie) 123 439637 1636,3 8.725<br />
Handel<br />
Umpackzentren (EFU) 3 229 n.v. n.v. n.v.<br />
Großhandelsmärkte (EFG) 3 23 n.v. n.v. n.v.<br />
Versandzentren für Mucheln (EMV) 3 9 n.v. n.v. n.v.<br />
Fischgroßhandel 1 237 n.v. 891,0 2.747<br />
Fischeinzelhandel 1 9.650 n.v. 470,0 17.800<br />
Gastronomie / Imbiss 1 690 n.v. 300,0 4.000<br />
1=2003, 2=2004, 3=2005, 4=fachliche Betriebsteile mit mehr als 10 Beschäftigten<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 69<br />
Abbildung 5 : Regionale Verteilung der Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge in Deutschland<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 70<br />
Abbildung 6 : Regionale Verteilung der Erlöse aus Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge in Deutschland<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 71<br />
Tabelle 4 :<br />
Quotenabhängigkeit und Risikopotenzial in der Meeresfischerei nach Flottensegmenten<br />
Große Hochseefischerei, pelagisch<br />
Gesamtfang<br />
[t]<br />
BRD [t]<br />
Referenzjahr<br />
Gesamtbestand<br />
SSB [t]<br />
B pa [t]<br />
B lim [t]<br />
Referenzpunkt<br />
Referenzpunkt<br />
F pa (2004)<br />
[Referenzpunkt]<br />
F lim<br />
Status<br />
Bewirtschaftung<br />
Hering HER (Nordsee: Atlanto-Scan herring), unklare Schätzungen wegen widersprüchlicher Prognosemodellergebnisse<br />
2002 372 000 27 213 0,04 (0-1) 91 %<br />
leicht<br />
2003 472 000 44 000 1 742 000 [0,12 (0-1)] nicht nachhaltig<br />
99 %<br />
1 300 000 800 000<br />
abnehmend<br />
2004 567 000 42 000 1 900 000 0,24 (2-6) defniert +++<br />
bis konstant 81 %<br />
2005 46105<br />
[0,25 (2-6)]<br />
98 %<br />
Makrele MAC (NO-Atlantik: I, II, III, IV, Vb, VI, VII, VIIIa,b,c,d,e und IXa)<br />
2002 726 935 26 530 1 779 544 100 %<br />
bedingt<br />
2003 617 330 24 060 1 821 410 nicht 0,32 (2-8)<br />
97 %<br />
2 300 000<br />
0,26 bis nicht abnehmend<br />
2004 611 461 24 000 1 998 940 definiert [0,17]<br />
nachhaltig<br />
100 %<br />
2005 23180<br />
99 5<br />
Holzmakrele / Stöcker JAX (NO-Atlantik: IIa, Va, VIa, VIIa-c, e-k und VIIIa,b,de)<br />
2002 172 200 13 210 Nicht Nicht nicht<br />
nicht<br />
90 %<br />
eher weiter<br />
2003 220 000 20 118 definiert / definiert / definiert / nicht definiert / definiert /<br />
93 %<br />
unklar abnehmend<br />
2004 unter unter unter unter Revision unter<br />
88 %<br />
Revision Revision Revision<br />
Revision<br />
2005 18 981<br />
86 %<br />
Blauer Wittling WHB (NO-Atlantik: I - IX, XII und XIV)<br />
2002 1 556 954 17 050 4 881 275 37 %<br />
nicht<br />
2003 2 365 319 22 803 4 295 000 0,32<br />
0,51<br />
37 %<br />
2 250 000 1 500 000<br />
nachhaltig kritisch /<br />
2004 2 377 569 15 294 3 790 000<br />
[0,32] [0,51]<br />
abnehmend<br />
- - -<br />
2005 20 151 5 113 236<br />
46 %<br />
B pa = Vorsorgereferenzpunkt für die Biomasse, B lim = Limitreferenzpunkt für die Biomasse, F pa = fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B pa , F lim =<br />
fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B lim<br />
Mittelfristige<br />
Ertragsprognose<br />
Quotennutzung<br />
Quotenabhängigkeit<br />
% Erlösanteil<br />
34 %<br />
Sehr hoch<br />
33 % /<br />
sehr hoch<br />
20 % /<br />
hoch<br />
10 % /<br />
mittel<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 72<br />
Große Hochsee, (vorwiegend) demersal und Frischfischfänger Nordsee<br />
Referenzjahr<br />
[t]<br />
bestand<br />
Bewirt-<br />
Ertragsnutzunabhängigkeit<br />
Gesamtfang BRD [t] Gesamt-<br />
B pa [t] B lim [t] F pa<br />
F lim Status Mittelfristige Quoten-<br />
Quoten-<br />
Referenzpunkpunkpunkt]<br />
% Erlösanteil<br />
Referenz-<br />
[Referenzpunkt] [Referenz-<br />
SSB [t]<br />
schaftung prognose<br />
Schwarzer Heilbutt GHL (Nordsee, ICES V, XII und XIV)<br />
2002 29 260 2 148 unklar k.A. k.A. k.A.<br />
k.A.<br />
55 % 39 % /<br />
unklar / rüchläufig /<br />
2003 30 858 2 948 unklar wegen wegen wegen wegen<br />
89 % sehr hoch<br />
nicht<br />
2004 ca. 30 000 ca. 3 000 unklar unsicherer unsicherer unsicherer unsicherer<br />
unklar<br />
nachaltig<br />
83 % 30 % /<br />
Datenlage Datenlage Datenlage Datenlage<br />
sehr hoch<br />
Seelachs, Pollack POK (Nordsee: IIIa, IV und VI)<br />
2002 122 000 11 466 202 500 83 %<br />
2003 107 000 9 010 220 900 0,27 [3-6]<br />
nachhaltig konstant bis<br />
81 %<br />
200 000 106 000<br />
[0,6]<br />
2004 114 000 9 593 260 000 [0,4]<br />
+ + + ansteigend 54 %<br />
2005 12 838 244 000<br />
80 %<br />
Rotbarsch RED (Nordsee; ICES V, VI, XII und XIV)<br />
2002 209 125 17 953 32 %<br />
unklar / deutlich<br />
2003 219 537 9 637 33 %<br />
unklar unklar unklar unklar unklar nicht<br />
2004 137 335 4 653 rückläufig<br />
nachhaltig<br />
26 %<br />
2005 2 498<br />
51 %<br />
3 % /<br />
gering<br />
18 % /<br />
hoch<br />
10 % / mittel<br />
3 % / gering<br />
B pa = Vorsorgereferenzpunkt für die Biomasse, B lim = Limitreferenzpunkt für die Biomasse, F pa = fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B pa , F lim =<br />
fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B lim<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 73<br />
Schellfisch HAD (Nordsee und Skagerrak/Kattegat; ICES IIIa, IVa und IVb)<br />
2002 107 917 1 091 351 241 29 %<br />
2003 68 735 1 675 344 372 [0,7]<br />
89 %<br />
140 000 100 000<br />
1,0 nachhaltig konstant<br />
2004 66 476 1 306 288 592 0,2<br />
68 %<br />
2005 808 565 500<br />
63 %<br />
Kabeljau COD Nordsee ICES IIIa, Iva, Ivb und VII)<br />
2 % /<br />
gering<br />
5 % /<br />
gering<br />
2002 66 700 2 101 73 %<br />
26 % / 21 %<br />
2003 78 000 2 048 42 900 nicht konstant 74 %<br />
150 000 70 000 [0,65] [0,86]<br />
2004 2 123 nachhaltig niedrig<br />
sehr hoch /<br />
99 %<br />
hoch<br />
2005 2734<br />
88 %<br />
B pa = Vorsorgereferenzpunkt für die Biomasse, B lim = Limitreferenzpunkt für die Biomasse, F pa = fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B pa , F lim =<br />
fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B lim<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 74<br />
Krabbenfischerei, Nordsee<br />
2002 28 182 12 003<br />
2003 31 624 11 901<br />
2004 Ca. 33 000 13 000<br />
2005<br />
F lim<br />
Referenzjahr<br />
[t]<br />
bestand<br />
Gesamtfang BRD [t] Gesamt-<br />
B pa [t] B lim [t] F pa<br />
Referenzpunkpunkt<br />
Referenz-<br />
[Referenzpunkt]<br />
SSB [t]<br />
Nordsee-Garnelen CSH (Nordsee und Skagerrak/Kattegat; ICES IIIa, IVa und IVb)<br />
[Referenzpunkt]<br />
Status<br />
Bewirtschaftung<br />
unklar unklar unklar unklar unklar stabil stabil<br />
nicht<br />
quotiert<br />
Mittelfristige<br />
Ertragsprognose<br />
Quotennutzung<br />
Quotenabhängigkeit<br />
% Erlösanteil<br />
77 % /<br />
sehr hoch<br />
Seezungen SOL (Nordsee; ICES IVa und IVb, ohne und Skagerrak/Kattegat, da Bedeutung mit 11, 17 und 18 t Anlandungen (BRD) in 2002-2004<br />
gering)<br />
2002 16 300 759 41 000 noch<br />
70 %<br />
2003 17 900 749 42 100 [0,4] nicht nachhaltig langsam 91 %<br />
35 000 25 000<br />
2004 19 300 949 27 200 definiert jedoch abnehmend 97 %<br />
2005 790 41 000<br />
gefährdet<br />
80 %<br />
Schollen PLA (Nordsee; ICES IVa und IVb, ohne und Skagerrak/Kattegat, da Bedeutung mit 29, 14 und 77 t Anlandungen (BRD) in 2002-2004<br />
gering)<br />
2002 134 716 3 927 180 806 noch<br />
79 %<br />
2003 133 838 3 800 202 391 [0,6]<br />
nachhaltig langsam 86 %<br />
230 000 160 000<br />
0,74<br />
2004 120 125 3 649 169 225 0,71<br />
jedoch abnehmend 91 %<br />
2005 3560 205 000<br />
gefährdet<br />
94 %<br />
6 % /<br />
mittel bis<br />
gering<br />
B pa = Vorsorgereferenzpunkt für die Biomasse, B lim = Limitreferenzpunkt für die Biomasse, F pa = fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B pa , F lim =<br />
fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B lim<br />
8 % /<br />
mittel<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 75<br />
Frischfischfänger und Stille <strong>Fischerei</strong>, Ostsee<br />
Referenzjahfang<br />
[t]<br />
bestand<br />
Gesamt-<br />
BRD [t] Gesamt-<br />
B pa [t] B lim [t] F pa<br />
Referenzpunkpunkt<br />
Referenz-<br />
[Referenzpunkt]<br />
SSB [t]<br />
Dorsch COD (westliche Ostsee; Gebiet 22, 23 und 24; bis 2003 Gebiete 22 - 29 und 32)<br />
F lim<br />
Referenzp<br />
unkt<br />
Status<br />
Bewirtschaftung<br />
Mittelfristige<br />
Ertragsprognose<br />
Quotennutzung<br />
2002 24 158 7 322 95 %<br />
2003 24 686 6 775 14 000 nicht [ ]<br />
konstant bis<br />
nicht nicht<br />
89 %<br />
23 000<br />
leicht<br />
2004 21 000 6 800 17 700 definiert 1,11<br />
definiert nachhaltig<br />
abnehmend 85 %<br />
2005 27 400 7 003 16 800<br />
100 %<br />
Dorsch COD (östliche Ostsee; Gebiet 25 – 32; bis 2003 Gebiete 22 - 29 und 32)<br />
2002 67 740 1 445 85 775 nicht<br />
95 %<br />
2003 68 925 1 363 87 427 [0,60]<br />
unsicher<br />
nachhaltig<br />
89 %<br />
240 000 160 000<br />
[0,96]<br />
wahrscheinl.<br />
2004 67 768 2 659 93 584 0,94<br />
stark<br />
abnehmend 85 %<br />
gefährdet<br />
2005 2342 84 389<br />
100 %<br />
Hering (HER, Frühjahrslaicher) (westliche Ostsee; Gebiet IIIa und 22, 23 und 24)<br />
% Quotenabhängigkeit<br />
% Erlösanteil<br />
50 % / sehr<br />
hoch<br />
33 % /<br />
sehr hoch<br />
< 5 % /<br />
gering<br />
0 % / -<br />
2002 125 600 22 400 185 430 83 %<br />
2003 109 600 19 500 157 600 nicht nicht [...]<br />
88 %<br />
[...] nachhaltig konstant<br />
16 % / hoch<br />
2004 94 200 18 500 180 386 definiert definiert 0,39<br />
90 %<br />
27 % /<br />
2005 25 344 193 981<br />
91 % sehr hoch<br />
B pa = Vorsorgereferenzpunkt für die Biomasse, B lim = Limitreferenzpunkt für die Biomasse, F pa = fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B pa , F lim =<br />
fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B lim<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 76<br />
Hering HER (mittlere Ostsee; Gebiet 25 – 29)<br />
2002 129 222 291 398 221 83 %<br />
2003 113 742 3 861 490 591 nicht nicht [0,19]<br />
nachhaltig konstant bis<br />
88 %<br />
[...] jedoch leicht<br />
2004 93 006 4 300 483 978 definiert definiert 0,21<br />
gefährdet abnehmend 90 %<br />
2005 2 692 617 184<br />
99 %<br />
Flunder FLX (westliche und mittlere Ostsee; Gebiet 22, 24 und 25)<br />
2002 13 996 2 383 25 000 79 %<br />
2003 9 840 1 731 26 400 nicht nicht [...]<br />
konstant bis<br />
unklar /<br />
86 %<br />
[...]<br />
leicht<br />
2004 11 981 1 906 27 500 definiert definiert 0,61<br />
nachhaltig<br />
abnehmend 91 %<br />
2005 1108 27 000<br />
43 %<br />
< 5 % /<br />
gering<br />
0 % / -<br />
2 % / gering<br />
5 % / mittel<br />
Industriefischerei Ostsee und Nordsee<br />
Gesamtfang<br />
[t]<br />
BRD [t]<br />
Sprotten SPR (Ostsee; Gebiet 22 – 32)<br />
Referenzjahr<br />
Gesamtbestand<br />
SSB [t]<br />
F pa<br />
[Referenzpunkt]<br />
F lim<br />
B pa [t]<br />
Referenzpunkt<br />
B lim [t]<br />
Referenzpunkt<br />
[Referenzpunkt]<br />
Status<br />
Bewirtschaftung<br />
Mittelfristige<br />
Ertragsprognose<br />
Quotennutzung<br />
Quotenabhängigkeit<br />
% Erlösanteil<br />
2002 343 191 950 1 057 062 6 %<br />
konstant bis<br />
2003 308 260 18 023 982 989 [0,40] nicht<br />
94 % 95 %<br />
275 000 200 000<br />
nachhaltig<br />
2004 373 675 28 500 1 216 545 0,28<br />
definiert<br />
leicht<br />
97 % sehr hoch<br />
ansteigend<br />
2005 28 974 1 564 000<br />
89 %<br />
B pa = Vorsorgereferenzpunkt für die Biomasse, B lim = Limitreferenzpunkt für die Biomasse, F pa = fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B pa , F lim =<br />
fischereiliche Sterblichkeit bezogen auf B lim<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 77<br />
Abbildung 7 : Entwicklung der Quotennutzung nach <strong>Fischerei</strong>en und Fischarten 1994 – 2007<br />
Quotennutzung der Großen Hochseefischerei 1994 - 2007<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Kabeljau Rotbarsch Schellfisch<br />
(est.)<br />
Seelachs Makrele Hering<br />
Schwarzer Heilbutt<br />
Quotennutzung der Kutter- und Küstenfischerei 1994 - 2007<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
(est.)<br />
Kabeljau Dorsch Schellfisch Seelachs Scholle<br />
Seezunge Sprotte Hering Wittling<br />
17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 78<br />
Abbildung 8 : Erlöse aus Anlandungen deutscher <strong>Fischerei</strong>fahrzeuge nach Ländern<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 79<br />
Tabelle 5 : Fangmengen und Anteile nach Fischarten und <strong>Fischerei</strong>en - 2006 -<br />
Ostsee<br />
Stille <strong>Fischerei</strong>, Ostsee Frischfischtrawler, Ostsee Spezialfahrzeuge, Ostsee<br />
subtotal,<br />
Ostsee<br />
Fischart kg % Fischart kg % Fischart kg % kg<br />
HER 8 599 216 62 HER 21 286 100 45 MUS 1 488 812 94<br />
COD 2 540 836 18 SPR 12 066 830 25 FBR 25 995 2<br />
FLE 561 684 4 COD 6 052 807 13 FPE 20 916 1<br />
FRO 430 372 3 SAN 3 604 539 8 FPP 17 171 1<br />
FLX 240 893 2 WHG 830 065 2 FRO 15 652 1<br />
FBR 237 367 2 PLE 727 485 2 ELE 4 356 0<br />
FPP 180 200 1 POK 566 707 1 PLN 3 513 0<br />
FPE 168 687 1 DAB 539 841 1 SME 2 450 0<br />
SOL 139 509 1 FLE 448 893 1 FPI 1 250 0<br />
DAB 122 893 1 JAX 442 460 1 CSH 944 0<br />
übrige 552 514 4 übrige 1 208 715 3 übrige 1 080 0<br />
subtotal 13 774 171 100 subtotal 47 774 442 100 subtotal 1 582 139 100 63 130 752<br />
Anteil zu Total 5 Anteil zu Total 17 Anteil zu Total 1 22<br />
Stille <strong>Fischerei</strong>, Nordsee<br />
Frischfischtrawler,<br />
Nordsee<br />
Nordsee<br />
Spezialfahrzeuge, Nordsee,<br />
einschl. Muschelfischerei<br />
subtotal,<br />
Nordsee<br />
Fischart kg % Fischart kg % Fischart kg % kg<br />
KEF 443 916 77 SPR 18 656 808 35 MUS 3 672 362 99<br />
ANF 63 145 11 HER 15 218 860 29 CSH 20 832 1<br />
CRE 52 087 9 POK 11 671 344 22 ELE 329 0<br />
CSH 5 620 1 COD 3 006 345 6 FPP 110 0<br />
SME 4 832 1 PLE 1 355 130 3 MUL 38 0<br />
ELE 3 623 1 HAD 668 065 1 FPE 34 0<br />
FPP 1 089 0 DAB 358 542 1 FPI 23 0<br />
LIN 883 0 RED 284 971 1 FRF 9 0<br />
POR 435 0 SOL 282 812 1 SAL 7 0<br />
LBE 278 0 WHB 271 479 1 OTH 4 0<br />
übrige 612 0 übrige 1 269 365 2 übrige 0 0<br />
subtotal 576 520 100 subtotal 53 043 721 100 subtotal 3 693 748 100 79 950 026<br />
Anteil zu Total 0 Anteil zu Total 19 Anteil zu Total 1 28<br />
Nordsee<br />
Westbritische Gewässer, Grönland, Nordsee, Nordafrika<br />
Krabbenkutter, Nordsee Große Hochsee, demersal Große Hochsee, pelagisch<br />
subtotal, Gr.<br />
Hochsee<br />
Fischart kg % Fischart kg % Fischart kg % kg<br />
CSH 18 438 908 81 HER 6 940 602 19 WHB 36 033 749 35<br />
PLE 1 710 859 8 POK 5 542 310 15 HER 28 368 923 28<br />
DAB 672 082 3 RED 5 189 226 14 SAR 14 782 492 14<br />
COD 637 453 3 COD 5 136 792 14 MAC 12 640 646 12<br />
NEP 230 224 1 GHL 4 850 793 13 JAX 8 760 689 9<br />
WHG 209 181 1 MAC 3 980 233 11 PIL 650 990 1<br />
LEF 127 105 1 JAX 3 354 649 9 RED 410 517 0<br />
TUR 105 535 0 HAD 1 009 096 3 ARU 218 462 0<br />
SRA 104 496 0 RNG 19 844 0 SPR 18 000 0<br />
LEM 102 083 0 CAT 18 343 0 OTH 17 719 0<br />
übrige 298 111 1 übrige 51 265 0 übrige 54 654 0<br />
subtotal 22 636 037 100 subtotal 36 093 153 100 subtotal 101 956 841 100 138 049 994<br />
Anteil zu Total 8 Anteil zu Total 13 Anteil zu Total 36 49<br />
17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 80<br />
Tabelle 6 : Umsatz und Anteile nach Fischarten und <strong>Fischerei</strong>en - 2006 -<br />
Ostsee<br />
Stille <strong>Fischerei</strong>, Ostsee Frischfischtrawler, Ostsee Spezialfahrzeuge, Ostsee<br />
subtotal,<br />
Ostsee<br />
Fischart € % Fischart € % Fischart € % €<br />
COD 3 801 585 34 COD 9 206 768 42 MUS 160 376 50<br />
HER 2 681 785 24 HER 5 586 310 26 FPP 72 152 23<br />
SOL 1 655 298 15 SPR 1 629 439 7 FPE 31 349 10<br />
ELE 729 779 7 PLE 1 278 220 6 ELE 29 541 9<br />
FPP 704 625 6 WHG 625 529 3 SME 5 875 2<br />
FPE 274 696 2 SAN 504 092 2 PLN 4 773 1<br />
FLE 253 490 2 POK 472 858 2 FBR 4 110 1<br />
FLX 184 026 2 DAB 424 441 2 FRO 3 769 1<br />
TUR 132 066 1 CSH 398 430 2 CSH 2 400 1<br />
FRO 125 787 1 HAD 338 417 2 FPI 2 322 1<br />
übrige 623 211 6 übrige 1 280 679 6 übrige 2 980 1<br />
subtotal 11 166 348 100 subtotal 21 745 183 100 subtotal 319 646 100 33 231 178<br />
Anteil zu total 5 Anteil zu total 10 Anteil zu total 0 15<br />
Stille <strong>Fischerei</strong>, Nordsee<br />
Frischfischtrawler,<br />
Nordsee<br />
Nordsee<br />
Spezialfahrzeuge, Nordsee<br />
einschl. Muschelfischerei<br />
subtotal,<br />
Nordsee<br />
Fischart € % Fischart € % Fischart € % €<br />
KEF 2 277 387 89 POK 9 460 872 26 MUS 6 949 648 99<br />
ANF 226 076 9 COD 8 077 648 22 CSH 46 691 1<br />
ELE 26 027 1 HER 4 951 366 13 ELE 2 699 0<br />
CSH 11 894 0 SOL 3 568 299 10 FPP 552 0<br />
SME 11 114 0 PLE 2 695 453 7 SAL 150 0<br />
FPP 5 524 0 SPR 1 985 006 5 FPI 58 0<br />
MUL 1 340 0 ANF 1 345 741 4 FPE 47 0<br />
SAL 1 308 0 HAD 1 139 930 3 FRF 37 0<br />
LIN 1 201 0 TUR 950 324 3 MUL 0 0<br />
POR 455 0 RED 523 267 1 OTH 0 0<br />
übrige 904 0 übrige 2 262 346 6 übrige 0 0<br />
subtotal 2 563 230 100 subtotal 36 960 252 100 subtotal 6 999 883 100 93 238 591<br />
Anteil zu total 1 Anteil zu total 17 Anteil zu total 3 43<br />
Nordsee<br />
Westbritische Gewässer, Grönland, Nordsee, Nordafrika<br />
Krabbenkutter, Nordsee Große Hochsee, demersal Große Hochsee, pelagisch<br />
subtotal, Gr.<br />
Hochsee<br />
Fischart € % Fischart € % Fischart € % €<br />
CSH 37 000 969 79 GHL 13 415 239 29 HER 12 727 414 30<br />
PLE 3 367 278 7 COD 10 393 876 22 MAC 11 360 601 27<br />
NEP 1 490 880 3 RED 7 970 292 17 WHB 9 003 451 22<br />
SOL 1 053 473 2 MAC 4 820 806 10 JAX 3 950 372 9<br />
COD 1 012 016 2 HER 3 735 356 8 SAR 3 914 038 9<br />
TUR 996 036 2 JAX 3 123 283 7 RED 410 529 1<br />
DAB 489 504 1 POK 1 569 137 3 PIL 244 024 1<br />
LEM 395 676 1 HAD 1 509 600 3 ARU 98 309 0<br />
WHG 240 356 1 HAL 28 596 0 OTH 8 320 0<br />
BLL 177 166 0 CAT 20 817 0 TUN 7 468 0<br />
übrige 491 874 1 übrige 50 359 0 übrige 11 643 0<br />
subtotal 46 715 227 100 subtotal 46 637 361 100 subtotal 41 736 169 100 88 373 530<br />
Anteil zu total 22 Anteil zu Total 22 Anteil zu Total 19 41<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 81<br />
Abbildung 9 :<br />
Preisentwicklung ausgewählter Fischarten<br />
17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 82<br />
Abbildung 10 : Regionale Verteilung der Forellen- und Karpfenbetriebe<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 83<br />
Abbildung 11 Forellen- und Karpfenerzeugung nach Bundesländern<br />
17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 84<br />
Abbildung 12: Forellen- und Karpfenumsätze nach Bundesländern<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 85<br />
Abbildung 13: Fischwirtschaftgebiete, Gemeinden auf NUTS-III-Ebene und zugehörige<br />
Landkreise<br />
17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 86<br />
Tabelle 7:<br />
Eckdaten zum <strong>Fischerei</strong>gebiet "Nordseeküste"<br />
Fischwirtschaftsgebiet "Nordseeküste"<br />
NUTS-II-Ebene (Land)<br />
NUTS-III-Ebene (Landkreis / Stadt)<br />
< NUTS-III ( Gemeinde o. ä.)<br />
Fläche in<br />
km²<br />
Einwohner<br />
Einwohnerdichte<br />
pro<br />
km²<br />
Arbeitslosenquote<br />
2004<br />
Verfügbares Einkommen<br />
privater Haushalte pro<br />
Einwohner in Euro<br />
2003<br />
DE9 Niedersachsen 47.620 8.001.000 168 10,6 16.422<br />
DE94C Leer 1.086 164.522 152 13,2 14.762<br />
Gemeinde Jemgum 78 3.740 48<br />
DE947 Aurich 1.287 190.110 148 13,4 13.764<br />
Gemeinde Krummhörn 159 13.485 85<br />
Stadt Norden 106 25.112 236<br />
Gemeinde Dornum 77 4.782 62<br />
DE94H Wirrmund 657 57.898 88 13,0 13.262<br />
Stadt Esens 162 13.983 86<br />
Stadt Wittmund 215 21.499 100<br />
DE94A Friesland 608 101.760 167 11,5 14.672<br />
Gemeinde Wangerland 175 10.223 58<br />
Stadt Varel 114 25.204 222<br />
DE94G Wesermarsch 822 94.075 114 10,3 14.486<br />
Gemeinde Butjadingen 129 6.615 51<br />
Sadt Brake 38 16.267 426<br />
DE932 Cuxhaven 2.073 206.308 100 11,0 15.111<br />
Stadt Cuxhaven 162 52.567 325<br />
Samtgemeinde Land Wursten 117 9.730 83<br />
Gemeinde Nordholz 65 7.606 117<br />
DEF Schleswig-Holstein 15.763 2.829.000 179 9,8 16.541<br />
DEF05 Dithmarschen 1.428 137.398 96 11,1 15.023<br />
Gemeinde Büsum 8 4.828 585<br />
Gemeinde Friedrichskoog 53 2.515 47<br />
Stadt Marne 5 6.014 1.245<br />
DEF07 Nordfriesland 2.049 166.610 81 9,2 15.563<br />
Gemeinde Dagebüll 36 948 26<br />
Stadt Husum 18 20.884 1.159<br />
Stadt Tönning 44 5.028 113<br />
Gemeinde List a. Sylt 18 2.640 143<br />
Gemeinde Pellworm 37 1.143 31<br />
Stadt Wyk auf Föhr 8 4.401 550<br />
DEF09 Pinneberg 664 298.272 449 8,7 18.798<br />
Gemeinde Helgoland 4 1.434 341<br />
DEF0E Steinburg 1.056 136.978 130 11,0 15.485<br />
Stadt Glückstadt 23 12.027 528<br />
DE5 Bremen 404 663.213 1.641 14,5 17.501<br />
DE502 Bremerhaven 79 117.281 1.485 20,0 16.760<br />
Stadt Bremerhaven 79 117.281 1.485 20,0 16.760<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 87<br />
Tabelle 8:<br />
Eckdaten zum <strong>Fischerei</strong>gebiet "Ostseeküste"<br />
Fischwirtschaftsgebiet "Ostseeküste"<br />
NUTS-II-Ebene (Land)<br />
NUTS-III-Ebene (Landkreis / Stadt)<br />
< NUTS-III ( Gemeinde o. ä.)<br />
Fläche in<br />
km²<br />
Einwohner<br />
Einwohnerdichte<br />
pro<br />
km²<br />
Arbeitslosenquote<br />
2004<br />
Verfügbares Einkommen<br />
privater Haushalte pro<br />
Einwohner in Euro<br />
2003<br />
DEF Schleswig-Holstein 15.763 2.829.000 179 9,8 16.541<br />
DEF01 Flensburg 56 85.762 1.521 14,0 14.473<br />
Stadt Flensburg 56 85.762 1.521 14,0 14.473<br />
DEF0C Schleswig-Flensburg 2.072 199.999 97 8,7 15.187<br />
Gemeinde Maasholm 8 686 82<br />
Stadt Kappeln 43 9.799 226<br />
Stadt Schleswig 24 24.237 997<br />
DEF0B Rendsburg-Eckernförde 2.185 273.130 125 7,8 16.536<br />
Stadt Eckernförde 18 23.249 1.294<br />
DEF0A Plön 1.082 135.446 125 9,2 15.630<br />
Gemeinde Heikendorf 15 8.155 554<br />
Gemeinde Laboe 5 5.316 1.016<br />
Gemeinde Stein 4 858 224<br />
Gemeinde Wentorf 5 1.131 222<br />
Gemende Hohwacht 9 879 100<br />
DEF05 Ostholstein 1.392 205.589 148 9,6 16.038<br />
Stadt Heiligenhafen 18 9.299 513<br />
Gemeinde Großenbrode 21 2.187 104<br />
Stadt Fehmarn 185 12.813 69<br />
Gemeinde Grömitz 51 7.805 153<br />
Stadt Neustadt 20 16.366 829<br />
Gemeinde Scharbeutz 52 11.874 227<br />
Gemeinde Timmendorfer Strand 20 9.004 448<br />
DEF03 Stadt Lübeck 214 211.874 989 14,0 15.317<br />
Stadt Lübeck 214 211.874 989 14,0 15.317<br />
DE8 Mecklenburg-Vorpommern 23.179 1.720.000 74 22,1 13.745<br />
DE80H Rügen 974 71.816 74 22,9 13.702<br />
Stadt Saßnitz 46 10.903 237<br />
Gemeinde Binz 25 5.462 217<br />
Gemeinde Göhren 8 1.314 171<br />
Gemeinde Thiessow 2 473 205<br />
Gemeinde Gager 9 418 48<br />
DE801 Stadt Greifswald 50 52.869 1.050 22,8 14.532<br />
Stadt Greifswald 50 52.869 1.050 22,8 14.532<br />
DE80D Nordvorpommern 52 25,4 13.208<br />
Stadt Ribnitz-Dammgarten 122 17.155 141<br />
DE80E Nordwestmecklenburg 2.075 120.819 58 16,1 13.524<br />
Tarnewitz (Boltenhagen)<br />
DE80F Ostvorpommern 1.910 112.225 59 24,7 13.120<br />
Stadt Wolgast 19 12.873 670<br />
Gemeinde Karlshagen 5 3.124 620<br />
Stadt Lassan 13 1.466 116<br />
Gemeinde Ahlbeck 9 3.395 399<br />
Gemeinde Kamminke 3 309 105<br />
DE801 Uecker-Randow 1.624 77.834 48 31,4 12.701<br />
Gemeinde Mönkebude 25 820 33<br />
Stadt Ueckermünde 172 11.060 64<br />
Gemeinde Altwarp 13 648 51<br />
DE803 Stadt Rostock 181 198.303 1.095 20,6 14.373<br />
Stadt Rostock 181 198.303 1.095 20,6 14.373<br />
DE806 Stadt Wismar 42 45.714 1.096 19,8 13.640<br />
Stadt Wismar 42 45.714 1.096 19,8 13.640<br />
DE807 Bad Doberan 1.362 119.645 88 18,0 14.166<br />
Stadt Rerik 33 2.398 72<br />
DE805 Stadt Stralsund 39 59.140 1.518 25,6 14.099<br />
Stadt Stralsund 39 59.140 1.518 25,6 14.099<br />
17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 88<br />
Tabelle 9:<br />
Eckdaten zum <strong>Fischerei</strong>gebiet "Karpfenerzeugung"<br />
Fischwirtschaftsgebiete "Karpfenerzeugung"<br />
NUTS-II-Ebene (Land)<br />
NUTS-III-Ebene (Landkreis / Stadt)<br />
< NUTS-III ( Gemeinde o. ä.)<br />
Fläche in<br />
km²<br />
Einwohner<br />
Einwohnerdichte<br />
pro<br />
km²<br />
Arbeitslosen-quote<br />
2005<br />
Verfügbares Einkommen<br />
privater Haushalte pro<br />
Einwohner in Euro<br />
2003<br />
DE2 Bayern 70.549 12.444.000 176 7,8 17.501<br />
DE239 Schwandorf 1.473 144.904 98 7,9 14.863<br />
sämtliche Gemeinden des Landkreises<br />
DE23A Tirschenreuth 1.084 78.399 72 10,4 14.477<br />
sämtliche Gemeinden des Landkreises<br />
DE245 Bamberg 1.167 144.831 124 7,2 15.372<br />
Stadt Schlüsselfeld 70 5.864 84<br />
Markt Burgebrach 88 6.427 73<br />
Gemeinde Pommersfelden 36 1.464 41<br />
Gemeinde Frensdorf 44 4.824 110<br />
Markt Hirschaid 41 11.425 279<br />
DE25C Weißenburg-Gunzenhausen 971 94.815 98 8,5 16.040<br />
Gemeinde Haundorf 51 2.691 52<br />
DE248 Forchheim 643 113.447 176 7,0 17.169<br />
Gemeinde Hallerndorf 41 3.935 95<br />
Gemeinde Heroldsbach 16 5.001 321<br />
Gemeinde Hausen 14 3.638 269<br />
DE256 Ansbach 1.972 184.567 94 7,2 15.351<br />
sämtliche Gemeinden des Landkreises<br />
DE25A Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 1.268 100.033 79 6,7 15.619<br />
sämtliche Gemeinden des Landkreises<br />
DE257 Erlangen-Höchstadt 565 130.652 231 5,4 18.881<br />
sämtliche Gemeinden des Landkreises<br />
DE246 Bayreuth 1.273 108.724 85 8,3 14.899<br />
Gemeinde Speichersdorf 53 6.245 118<br />
Gemeinde Kirchenpingarten 34 1.407 42<br />
DE237 Neustadt a. d. Waldnaab 1.430 100.682 70 8,6 16.180<br />
Gemeinde Kirchendemenreuth 39 930 24<br />
DE235 Cham 1.510 131.172 87 8,7 14.324<br />
Markt Stamsried 43 2.296 53<br />
Gemeinde Pemfling 45 2.246 50<br />
Gemeinde Pösing 9 1.004 110<br />
DE234 Amberg-Sulzbach 1.255 107.755 86 9,5 14.406<br />
Stadt Schnaittenbach 63 4.351 69<br />
Stadt Hirschau 75 6.257 84<br />
Markt Freihung 46 2.687 58<br />
Gemeinde Freudenberg 82 4.236 52<br />
Markt Hahnbach 67 5.235 78<br />
DED Sachsen 18.415 4.296.000 233 19,6 14.515<br />
DED24 Bautzen 955 153.897 161 21,3 14.032<br />
Gemeinde Großdubrau 54 4.799 89<br />
Gemeinde Guttau 42 1.728 41<br />
Gemeinde Königswartha 41 3.792 92<br />
Gemeinde Malschwitz 52 3.771 73<br />
Gemeinde Neschwitz 46 2.640 57<br />
Gemeinde Puschwitz 12 1.041 89<br />
Gemeinde Radibor 62 3.626 59<br />
Gemeinde Rammenau 11 1.526 142<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 89<br />
Tabelle 10:<br />
Eckdaten zum <strong>Fischerei</strong>gebiet "Karpfenerzeugung" (Fortsetzung)<br />
Fischwirtschaftsgebiete "Karpfenerzeugung" (Fortsetzung)<br />
NUTS-II-Ebene (Land)<br />
NUTS-III-Ebene (Landkreis / Stadt)<br />
Fläche in<br />
km²<br />
Einwohner<br />
Einwohnerdichte<br />
pro<br />
km²<br />
Arbeitslosen-quote<br />
2005<br />
Verfügbares Einkommen<br />
privater Haushalte pro<br />
Einwohner in Euro<br />
2003<br />
< NUTS-III ( Gemeinde o. ä.)<br />
DED26 Niederschlesischer Oberlausitzkreis 1.338 98.391 74 21,4 13.463<br />
Gemeinde Boxberg/O. L. 119 3.097 26<br />
Gemeinde Hohendubrau 45 2.283 50<br />
Gemeinde Honka 41 2.067 51<br />
Gemeinde Klitten 54 1.502 28<br />
Gemeinde Kodersdorf 42 2.652 63<br />
Gemeinde Königshain 20 1.296 66<br />
Gemeinde Krauschwitz 107 4.005 38<br />
Gemeinde Kreba-Neudorf 32 1.053 33<br />
Gemeinde Mankersdorf 62 4.389 70<br />
Gemeinde Mücka 24 1.268 52<br />
Gemeinde Neißeaue 47 986 21<br />
Stadt Niesky 54 11.092 207<br />
Gemeinde Quitzdorf am See 36 1.588 44<br />
Gemeinde Rietschen 73 3.055 42<br />
Stadt Rothenburg(O. L. 72 5.868 81<br />
Gemeinde Schleife 42 2.946 70<br />
Gemeinde Schöpstal 30 2.791 94<br />
Gemeinde Trebendorf 32 1.092 34<br />
Gemeinde Uhyst 44 1.160 27<br />
Gemeinde Vierkirchen 35 2.007 57<br />
Gemeinde Waldhufen 59 2.873 49<br />
Gemeinde Weißkeißel 50 1.466 29<br />
Stadt Weißwasser/O. L. 64 22.218 349<br />
DED2B Kamenz 1.349 155.545 115 17,5 14.135<br />
Stadt Bernsdorf 34 5.776 169<br />
Gemeinde Bretnig-Hauswalde 14 3.257 226<br />
Gemeinde Crostwitz 13 1.180 89<br />
Stadt Kamenz 53 18.308 344<br />
Stadt Königsbrück 78 4.745 61<br />
Gemeinde Laußnitz 64 2.112 33<br />
Gemeinde Lohsa 119 4.535 38<br />
GemeindeNebelschütz 23 1.250 55<br />
Gemeinde Oßling 44 2.608 60<br />
Gemeinde Ottendorf-Okrilla 26 5.109 197<br />
Gemeinde Panschwitz-Kuckau 23 2.219 95<br />
Stadt Pulsnitz 17 6.578 394<br />
Gemeinde Räckelwitz 12 1.253 109<br />
Gemeinde Ralbitz-Rosenthal 32 1.835 58<br />
Gemeinde Schönteichen 45 2.405 53<br />
Gemeinde Schwepnitz 56 2.843 51<br />
Gemeinde Spreetal 109 2.263 21<br />
Gemeinde Steina 12 1.870 150<br />
Gemeinde Straßgräbchen 10 791 83<br />
Gemeinde Wachau 38 4.553 120<br />
Gemeinde Wiednitz 16 1.242 78<br />
Stadt Wittichenau 61 6.256 103<br />
DED29 Sächsische Schweiz 888 142.662 161 17,8 14.389<br />
Gemeinde Hohwald 59 4.879 83<br />
Gemeinde Rathmannsdorf 4 1.143 262<br />
DED28 Löbau-Zittau 699 144.851 207 24,2 13.475<br />
Gemeinde Großhennersdorf 22 1.559 71<br />
Stadt Neusalza-Spremberg 12 2.483 207<br />
Gemeinde Oppach 8 3.022 377<br />
Stadt Zittau 25 25.871 1.018<br />
17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 90<br />
Abbildung 14 : Regionale Verteilung der Fisch verarbeitenden und handelnden Betriebe<br />
17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 91<br />
abelle 11 :<br />
Kennzahlen der Fisch verarbeitenden Industrie 1995 - 2005 (nach fachlichen Betriebsteilen)<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Anzahl der Betriebsteile<br />
ABL 115 115 107 103 105 101 100 96 96 89 85<br />
NBL 21 21 22 21 24 26 28 25 27 26 29<br />
gesamt 136 136 129 124 129 127 128 121 123 115 114<br />
Beschäftigte<br />
ABL 9 053 8 998 8 332 8 091 7 920 9 048 8 708 8 034 7 537 7 310 6 679<br />
NBL 1 363 1 257 1 302 1 335 1 384 1 582 1 445 1 310 1 335 1 415 1 540<br />
gesamt 10 416 10 255 9 634 9 426 9 304 9 794 10 153 9 345 8 872 8 725 8 219<br />
Umsatz<br />
ABL 1 352 424 1 345 491 1 244 364 1 319 811 1 345 294 1 391 571 1 572 408 1 507 238 1 428 906 1 428 269 1 501 905<br />
NBL 121 600 124 350 138 140 149 801 155 539 166 072 185 058 186 056 189 733 207 973 270 982<br />
gesamt 1 474 024 1 469 841 1 382 504 1 469 612 1 500 833 1 557 643 1 757 466 1 693 294 1 618 639 1 636 242 1 772 887<br />
Inlandsumsatz<br />
ABL 1 125 459 1 112 345 1 005 002 1 043 474 1 062 870 1 134 319 1 309 120 1 229 823 1 230 441 1 163 762 1 195 139<br />
NBL 104 192 108 513 118 307 130 203 141 804 153 856 176 792 179 757 183 493 189 475 211 371<br />
gesamt 1 229 651 1 220 858 1 123 309 1 173 677 1 204 675 1 288 175 1 485 912 1 409 580 1 331 652 1 353 237 1 436 759<br />
Auslandsumsatz<br />
ABL 226 965 233 146 239 362 276 337 282 424 257 252 263 288 277 415 280 747 264 507 306 766<br />
NBL 17 408 15 837 19 834 19 599 13 734 12 216 9 111 6 299 6 240 18 498 29 386<br />
gesamt 244 373 248 983 259 196 295 935 296 158 269 468 271 554 283 714 286 987 283 005 336 134<br />
Exportquote<br />
ABL 16,8 17,3 19,2 20,9 21,0 18,5 16,7 18,4 19,6 18,5 20,4<br />
NBL 14,3 12,7 14,4 13,1 8,8 7,4 4,9 3,4 3,3 8,9 10,8<br />
gesamt 16,6 16,9 18,7 20,1 19,7 17,3 15,5 16,8 17,7 17,3 19,0<br />
Produktivität<br />
ABL 149 390 149 532 149 348 163 121 169 860 153 799 180 571 187 607 189 586 195 386 224 870<br />
NBL 89 215 98 926 106 099 112 211 112 383 104 976 128 068 142 027 142 122 146 977 175 962<br />
gesamt 141 515 143 329 143 503 155 910 161 311 159 041 173 098 181 198 182 444 187 535 215 706<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 92<br />
Tabelle 12 : Entwicklung der Industriellen Erzeugung nach Produktgruppen Fisch, 2002 - 2005<br />
Produktionsmenge (t) Produktionswert (1000 €)<br />
% Veränderung<br />
2005 zu 2002<br />
% Anteile<br />
(Ø 2002-2005)<br />
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005<br />
Mengenbasis<br />
Mengenbasis<br />
Wertebasis<br />
Wertebasis<br />
Fischfilets, -stäbchen, roh, ledig.m.Teig umhüllt 136 725 131 541 156 303 155 908 343 652 336 741 357 080 394 800 14 15 33 24<br />
Heringe, zub.od.haltbar gemacht, ganz od.in Stücken 78 354 73 143 90 684 90 340 243 946 239 453 249 260 255 151 15 5 19 16<br />
Pazif.Lachs, Atlant.Lachs u.Donaulachs, geräuchert 18 628 14 883 17 794 13 785 162 346 186 307 165 949 134 378 -26 -17 4 11<br />
Fischfilets, gefroren 34 707 37 943 44 103 54 490 141 369 129 504 151 984 158 370 57 12 10 10<br />
Andere zubereitete oder haltbar gemachte Fische 37 947 44 658 39 943 38 322 139 993 117 114 117 352 111 464 1 -20 9 8<br />
Fische,i.and.Weise zub.od.haltbar gemacht,Fischsalat 37 318 31 160 32 852 30 416 112 740 124 555 119 625 120 439 -18 7 8 8<br />
And.Fische,zub.od.haltbar gemacht,ganz od.in Stücken 28 887 46 868 26 995 27 586 140 731 86 285 75 391 78 347 -5 -44 8 6<br />
Andere geräucherte Fische (einschl. Filets) 8 593 9 226 7 044 5 379 67 983 69 116 61 396 49 479 -37 -27 2 4<br />
Lebensmittelzubereitungen von Krebstieren u.s.w. 3 629 2 428 3 938 7 631 27 098 39 119 38 949 67 841 110 150 1 3<br />
Lachs, zub.od.haltbar gemacht, ganz od.in Stücken 14 216 5 387 11 905 2 989 36 101 63 443 47 196 18 017 -79 -50 2 3<br />
Fischfilets u.a. Fischfleisch, frisch oder gekühlt 6 247 7 737 7 855 8 060 47 535 37 672 32 262 36 175 29 -24 2 3<br />
Kaviarersatz aus Fischeiern 802 1 730 1 456 1 252 28 795 17 224 26 885 17 939 56 -38 0 2<br />
Krebs-, Weich- u.a.wirbellose Wassertiere, zuber. 2 704 3 155 2 462 1 971 21 929 18 970 18 894 14 327 -27 -35 1 1<br />
Seefische, gefroren 3 599 3 615 6 102 5 276 16 053 15 853 17 399 18 922 47 18 1 1<br />
Makrelen, zub.od.haltbar gemacht, ganz od.in Stücken 1 232 1 704 1 165 418 8 809 5 716 5 395 2 394 -66 -73 0 0<br />
Heringe, geräuchert 911 936 1 355 1 670 3 504 3 546 6 436 8 587 83 145 0 0<br />
Krebstiere, gefroren 401 278 446 568 . 5 063 5 747 6 891 42 36 0 0<br />
Anderes Fischfleisch, gefroren 0 0 0 2 013 0 0 0 8 873 . . 0 0<br />
Thunfisch u.echter Bonito, zub.od.haltbar gemacht 0 0 0 700 0 0 0 1 544 . . 0 0<br />
Fischfilets, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake 0 0 0 199 0 0 0 771 . . 0 0<br />
Sardinen,Sardinellen od.Sprotten,zub.od.haltb.gem. 607 . 578 483 . . . 0 -20 . 0 0<br />
Total 415 508 416 394 452 980 449 457 1 542 584 1 495 681 1 497 200 1 504 709 8 -2 100 100<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 93<br />
Tabelle 13 : Außenhandel mit Fisch und Krebs- und Weichtieren, Fanggewicht (t) 2000-2005<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005v<br />
Frostfisch, einschl. Lachs, ohne Hering und verarb. Produkte des KN-Code 1604, Fanggewicht<br />
Import 713 431 845 661 825 490 800 815 836 467 826 005<br />
Export 194 723 213 633 213 417 198 208 205 281 220 434<br />
Heringsrohware<br />
Import<br />
frisch 43 777 58 628 39 365 52 031 55 673 60 309<br />
gefroren 110 565 128 943 100 107 89 364 88 623 99 832<br />
total 154 342 187 572 139 472 141 395 144 296 160 141<br />
Export<br />
frisch 5 346 5 911 11 320 9 964 8 202 7 214<br />
gefroren 22 889 22 794 23 500 19 883 64 500 32 723<br />
total 28 235 28 706 34 820 29 847 72 703 39 937<br />
Frischfisch, einschl. Lachs, ohne Hering<br />
Import 181 561 168 963 159 612 148 072 180 733 160 971<br />
Export 82 011 57 362 50 235 41 960 56 790 46 202<br />
Süßwasserfische, ohne Lachs<br />
Import<br />
frisch 27 301 30 725 31 099 27 678 30 123 34 423<br />
darunter<br />
Forellen 11 055 11 897 10 310 6 561 7 243 8 365<br />
Karpfen 4 432 3 943 4 372 4 708 3 511 2 414<br />
gefroren 23 495 31 441 28 374 26 441 37 648 53 399<br />
darunter<br />
Forellen 5 901 7 798 7 544 5 782 6 173 5 690<br />
Karpfen 182 83 21 97 130 20<br />
total 50 797 62 167 59 473 54 119 67 772 87 822<br />
darunter<br />
Forellen 16 957 19 694 17 854 12 343 13 416 14 055<br />
Karpfen 4 614 4 026 4 393 4 805 3 641 2 435<br />
Export<br />
frisch 2 697 4 415 5 721 6 070 6 675 9 356<br />
darunter<br />
Forellen 460 944 611 272 613 911<br />
Karpfen 343 190 353 330 313 82<br />
gefroren 5 669 6 155 5 620 5 008 7 769 11 484<br />
darunter<br />
Forellen 1 424 1 985 1 560 2 068 1 543 656<br />
Karpfen 3 0 0 0 0 0<br />
total 8 366 10 570 11 341 11 078 14 445 20 840<br />
darunter<br />
Forellen 1 884 2 929 2 171 2 340 2 156 1 567<br />
Karpfen 346 190 353 330 313 82<br />
Krebs- und Weichtiere<br />
Import 62 679 72 555 55 925 55 364 70 380 64 031<br />
Export 34 645 20 172 17 112 38 863 38 520 20 390<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 94<br />
Tabelle 14: Selbstversorgungsgrad für Deutschland nach Produktgruppen 2000-2005<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 v<br />
Frischfisch<br />
Anlandungen 24 402 23 143 17 439 14 573 15 428 18 306<br />
Import 181 561 168 963 159 612 148 072 153 856 160 971<br />
Export 82 011 57 362 50 235 41 960 53 466 46 202<br />
Verfügbare Menge 123 952 134 744 126 816 120 685 115 818 133 074<br />
Selbstversorgungsgrad 19,7 17,2 13,8 12,1 13,3 13,8<br />
Frostfisch<br />
Anlandungen 19 220 29 205 20 974 17 488 29 020 29 502<br />
Import 713 431 845 661 825 490 800 815 819 380 826 005<br />
Export 194 723 213 633 213 417 198 208 179 015 220 434<br />
Verfügbare Menge 537 928 661 232 633 047 620 095 669 385 635 073<br />
Selbstversorgungsgrad 3,6 4,4 3,3 2,8 4,3 4,6<br />
Heringsrohware<br />
Anlandungen 15 583 16 966 18 219 35 429 45 743 46 418<br />
Import 154 342 187 572 139 472 141 395 134 003 160 141<br />
Export 28 235 28 706 34 820 29 847 43 425 39 937<br />
Verfügbare Menge 141 690 175 832 122 871 146 977 136 320 166 623<br />
Selbstversorgungsgrad 11,0 9,6 14,8 24,1 33,6 27,9<br />
Krebs- und Weichtiere<br />
Anlandungen 30 912 18 637 21 356 37 635 31 414 24 742<br />
Import 62 679 72 555 55 925 55 364 63 456 64 031<br />
Export 34 645 20 172 17 112 38 863 33 538 20 390<br />
Verfügbare Menge 58 946 71 020 60 169 54 136 61 332 68 383<br />
Selbstversorgungsgrad 52,4 26,2 35,5 69,5 51,2 36,2<br />
Süßwasserfische<br />
Anlandungen 1 333 1 436 1 387 1 504 1 258 1 404<br />
Binnenfischerei 39 991 54 011 36 697 35 037 35 037 36 631<br />
Gesamt 41 324 39 309 38 084 36 541 36 295 38 035<br />
Import 50 797 62 167 59 473 54 119 67 449 87 822<br />
Export 8 366 10 570 11 341 11 078 13 868 20 840<br />
Verfügbare Menge 83 755 90 905 86 216 79 582 89 876 105 017<br />
Selbstversorgungsgrad 49,3 43,2 44,2 45,9 40,4 36,2<br />
über Alles<br />
Anlandungen 91 450 89 387 79 375 106 629 122 863 120 372<br />
Binnenfischerei 39 991 54 011 36 697 35 037 35 037 36 631<br />
Gesamt 131 441 143 398 116 072 141 666 157 900 157 003<br />
Import 1 162 809 1 336 917 1 239 973 1 199 764 1 238 144 1 298 971<br />
Export 347 980 330 443 326 926 319 955 323 313 347 803<br />
Verfügbare Menge 946 270 1 133 734 1 029 119 1 021 475 1 072 731 1 108 171<br />
Selbstversorgungsgrad 13,9 12,6 11,3 13,9 14,7 14,2<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 95<br />
Tabelle 15 : Zollbelastungen für Grundfische für Importe nach Deutschland, 2004 und 2005<br />
Gesamtimportmenge (t) Gesamtimportwert (1000 €) Importmengen (t) mit Zoll Durchschittszollbelastung in %<br />
Produktgruppe 2004 2005 Diff. 05-04 2004 2005 Diff. 05-04 2004 2005 Diff. 05-04 2004 2005 Diff. 05-04<br />
ganz, frisch 177 094 168 877 -8 217 387 222 393 486 6 264 56 446 56 137 -309 3,83 3,82 0,00<br />
ganz, gefroren 186 340 171 637 -14 703 369 591 382 461 12 870 95 134 82 171 -12 963 4,45 3,43 -1,02<br />
Subtotal, ganz 363 434 340 514 -22 920 756 813 775 946 19 133 151 579 138 307 -13 272 4,13 3,63 -0,50<br />
Filet, frisch 18 993 22 084 3 091 126 042 161 252 35 210 2 521 2 807 286 1,93 2,20 0,28<br />
Filet, gefroren 567 356 570 239 2 883 1 374 638 1 491 807 117 169 201 831 189 199 -12 632 1,60 1,73 0,13<br />
Subtotal, Filet 586 350 592 323 5 974 1 500 680 1 653 059 152 379 204 352 192 007 -12 345 1,63 1,78 0,15<br />
Fleisch, gefroren 53 604 49 562 -4 042 80 991 74 814 -6 177 21 530 21 859 329 1,49 1,88 0,40<br />
Subtotal, Fleisch 53 604 49 562 -4 042 80 991 74 814 -6 177 21 530 21 859 329 1,49 1,88 0,40<br />
getrocknet, gesalzen 111 521 108 218 -3 303 613 095 624 548 11 453 36 317 33 044 -3 273 4,35 4,15 -0,20<br />
Subtotal getrocknet,<br />
gesalzen 111 521 108 218 -3 303 613 095 624 548 11 453 36 317 33 044 -3 273 4,35 4,15 -0,20<br />
Total 1 114 908 1 090 617 -24 291 2 951 578 3 128 367 176 789 413 778 385 217 -28 561 2,83 2,71 -0,12<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 96<br />
Abbildung 15 : NATURA-2000 - Schutzgebietsmeldungen innerhalb und außerhalb der AWZ<br />
der Ost- und Nordsee (Stand 28.4.2004)<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 97<br />
Abbildung 16 : Vorgeschlagene FFH-Gebiete<br />
Quelle: http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/karte_ffh2005.<strong>pdf</strong><br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 98<br />
Abbildung 17 : Vorgeschlagene Vogelschutzgebiete<br />
Quelle:<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 99<br />
Abbildung 18: Flussgebietseinheiten in Deutschland nach der Wasserrahmenrichtlinie<br />
Quelle: http://www.bmu.de/files/bilder/allgemein/image/gif/flussgebietseinheiten.gif<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 100<br />
Abbildung 19: Konkurrierende Meeresnutzung in niedersächsischen Küstengewässern<br />
Quelle: Die Küstenfischerei in Niedersachsen - Stand und Perspektiven -, 2004, cofad, 170 S.,Polykopie<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 101<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 102<br />
8.3 Indikatoren nach Zielen und Prioritäten<br />
Bereits in den Vorläuferprogrammen wurden Indikatoren definiert (VO (EG) Nr. 366/2001) und in der<br />
Infosys-Datenbank entsprechend implementiert. Diese haben sich als zeitnahes Programm<br />
begleitendes Monitoringsystem bewährt. Sie nehmen jedoch primär Bezug auf die geförderten<br />
Vorhaben selbst und können nur begrenzt eine Vorstellung über allgemeine und längerfristige<br />
Entwicklung in den einzelnen Sektoren der <strong>Fischerei</strong> und Fischwirtschaft geben. Sie dienen so vor<br />
allem der Beurteilung der unmittelbaren Wirkungen der Maßnahmen. Die Palette dieser Infosys-<br />
Indikatoren wird im Wesentlichen beibehalten, jedoch durch einige Angaben ergänzt, um den<br />
effektiven Mitteleinsatz und den Fortschritt im Verlauf des Programms als auch ex post besser<br />
beurteilen zu können. Insbesondere ist dies eine kurze Projektbeschreibung mit Angaben zu<br />
Investitionsschwerpunkten.<br />
Die im <strong>NSP</strong>-Arbeitspapier angeregte Erweiterung um sogenannte Grundsatz-/Zusatzindikatoren wird<br />
aufgegriffen. Sie sollen dazu dienen, die im <strong>NSP</strong> formulierten Ziele und Prioritäten im Kontext der<br />
Entwicklung des gesamten <strong>Fischerei</strong>sektors einheitlich und länderübergreifend besser bewerten zu<br />
können. Die Kausalkette der finanziellen Unterstützung über das EFF-Instrument und deren Wirkung<br />
auf den Sektor insgesamt wird jedoch nur in Ausnahmefällen schlüssig gelingen, da zum einen der<br />
Einfluss der Förderung begrenzt ist und nicht abgekoppelt von allgemeinwirtschaftlichen<br />
Entwicklungen betrachtet werden kann und zum anderen Wirkungen bei Strukturfördermaßnahmen<br />
eher mittel- und langfristig zu erwarten sind. In Teilen scheint der Zeit- und Personalaufwand<br />
unangemessen groß, so dass die Berechnung der Indikatoren nur in größeren Zeitabständen evtl. im<br />
Rahmen der Bewertungen der Programme (ex ante, Halbzeit, ex post) erfolgen soll.<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 103<br />
8.3.1 <strong>Fischerei</strong>liche Nutzung (Bezug Kapitel. 4.3.1)<br />
Indikator Merkmal Quellen Zielgröße<br />
<strong>Fischerei</strong>aufwand Fangmenge je kW / BRZ Anlandestatistik<br />
Nat. Flottenregister<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
konstant<br />
<strong>Fischerei</strong>kapazitäten im<br />
Fünfjahresablauf<br />
Ressourcenüberwachung<br />
Anzahl, BRT, kW nach <strong>NSP</strong><br />
<strong>Fischerei</strong>en<br />
Forschungsschiffsreisetage<br />
und Seemeilen<br />
Ressourcenüberwachung Anzahl Kontrollen /<br />
Beanstandungen,<br />
Seereisen, sm von<br />
Kontrollschiffen<br />
Ressourcenschutz<br />
nachhaltige<br />
Bewirtschaftung<br />
Anteil der Anlandungen<br />
Menge/Wert die keiner<br />
Quotierung unterliegen oder<br />
innerhalb sicherer<br />
biologischer Grenzen sind<br />
Nat. Flottenregister<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
Bundesforschungsanstalt<br />
für <strong>Fischerei</strong><br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
Offizialstatistiken<br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
Anlandestatistik<br />
Logbuch<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
8.3.2 Versorgung und Gleichgewicht der Märkte (Bezug Kapitel 4.3.2)<br />
- 1 % p.a.<br />
konstant<br />
konstant<br />
konstant<br />
Indikator Merkmal Quelle Zielgröße<br />
Versorgungsbilanz positiv<br />
entwickeln<br />
Marktrücknahmen<br />
verringern<br />
Wachstum<br />
Mengen Wert : Export /<br />
Import<br />
Vom Markt genommene<br />
Mengen<br />
Wert = Umsatz der<br />
verarbeiteten / vermarkteten<br />
Produkte<br />
Außenhandelsstatistik<br />
DESTATIS<br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
Offizialstatistiken<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
Offizialstatistiken<br />
Verarbeitendes<br />
Gewerbe, 15.2<br />
Seefischerei<br />
konstant,<br />
Aquakultur<br />
steigern um<br />
1 % p.a.<br />
unter 1 %<br />
+ 1 % p.a.<br />
(nominal)<br />
real konstant<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 104<br />
8.3.3 Fortentwicklung einer nachhaltige Binnenfischerei und Aquakultur (Bezug Kapitel<br />
4.3.3)<br />
Indikator Merkmal Quelle Zielgröße<br />
Produktion steigern<br />
(Konsumfisch)<br />
Produktion steigern<br />
(Satzfische)<br />
Nachhaltige Produktion &<br />
Umweltschutz<br />
Gesamtmenge /<br />
Gesamtwert nach<br />
Fischarten<br />
Gesamtmenge /<br />
Gesamtwert nach<br />
Fischarten<br />
Anzahl<br />
Höchstmengenüberschreitungen<br />
bei<br />
Rückstandsuntersuchungen<br />
im Rahmen des nationalen<br />
Kontrollplans<br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
Binnenfischereierhebung<br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
Binnenfischereierhebung<br />
Berichte zum nationalen<br />
Kontrollplan<br />
+ 1 % p.a.<br />
+ 1 % p.a.<br />
8.3.4 Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftszweiges (Bezug Kapitel 4.3.4)<br />
Indikator Merkmal Quelle Zielgröße<br />
Wettbewerbsfähigkeit der<br />
Flotte<br />
Wettbewerbsfähigkeit der<br />
Flotte<br />
Wettbewerbsfähigkeit der<br />
Flotte<br />
Wettbewerbsfähigkeit der<br />
Aquakultur /<br />
Binnenfischerei<br />
Wettbewerbsfähigkeit der<br />
Verarbeitung (sindustrie)<br />
Wettbewerbsfähigkeit der<br />
Verarbeitung (sindustrie)<br />
Gesamtmenge /<br />
Gesamtwert je<br />
Fahrzeugeinheit nach<br />
<strong>Fischerei</strong>en<br />
Gesamtmenge /<br />
Gesamtwert je Arbeitsplatz<br />
bzw. Besatzungsmitglied<br />
und nach <strong>Fischerei</strong>en<br />
Durchschnittliche<br />
Quotennutzung gewichtet<br />
über Mengen / Umsatz nach<br />
<strong>Fischerei</strong>en<br />
Jahresfang/erzeugung je<br />
Haupterwerbsbetrieb bzw.<br />
Gesamtbetriebszahl<br />
Produktionswert /<br />
Bruttowertschöpfung je<br />
Arbeitsplatz (Betrieb mit<br />
mehr als 10 Beschäftigten)<br />
Exportanteil / -menge,<br />
Wettbewerbsfähigkeit im<br />
internationalen Vergleich<br />
(Betrieb mit mehr als 10<br />
Beschäftigten)<br />
Anlandestatistik<br />
Nat. Flottenregister<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
Anlandestatistik<br />
Nat. Flottenregister<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
Anlandestatistik<br />
Nat. Flottenregister<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
TAC (ICES)<br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
Offizialstatistiken<br />
DESTATIS und<br />
Statistische .<br />
Landesämter<br />
Offizialstatistiken<br />
DESTATIS und<br />
Statistische .<br />
Landesämter<br />
0<br />
+ 1 % p.a.<br />
(real) auf<br />
Mengen- bzw.<br />
Wertebasis<br />
+ 1 % p.a.<br />
(real) auf<br />
Mengen- bzw.<br />
Wertebasis<br />
konstant<br />
konstant<br />
+ 1 % p.a.<br />
(real) auf<br />
Wertebasis<br />
konstant,<br />
langfristiger<br />
Anstieg<br />
/Trend von<br />
0,1 % p.a.<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc
<strong>Nationaler</strong> <strong>Strategieplan</strong> <strong>Fischerei</strong> 105<br />
8.3.5 Sozioökonomische Dimension der <strong>Fischerei</strong> (Bezug Kapitel 4.3.6)<br />
Indikator Merkmal Quelle Zielgröße<br />
Arbeitsplätze Flotte Erwerbstätige nach<br />
<strong>Fischerei</strong>en und regionaler<br />
Gliederung<br />
Nat. Flottenregister<br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
SeeBerufsGenossenschaft<br />
(SEEBG)<br />
Arbeitsplätze Verarbeitung Erwerbstätige Offizialstatistiken<br />
DESTATIS und<br />
Statistische .<br />
Landesämter<br />
Ausbildung / Qualifikation<br />
Struktur und Entwicklung<br />
der <strong>Fischerei</strong>häfen<br />
Struktur des Sektors<br />
Regionalentwicklung und<br />
<strong>Fischerei</strong>gebiete<br />
Regionalentwicklung und<br />
<strong>Fischerei</strong>gebiete<br />
Regionalentwicklung und<br />
<strong>Fischerei</strong>gebiete<br />
Anzahl Abschlüsse Fischwirt<br />
nach <strong>Fischerei</strong>en<br />
Anlandungen (Menge/Wert)<br />
nach <strong>Fischerei</strong>häfen<br />
Eigenanlandungen zu<br />
Gesamtanlandungen<br />
deutscher<br />
<strong>Fischerei</strong>fahrzeuge<br />
(Menge/Wert)<br />
BIP je Erwerbstätiger auf<br />
NUTS III Ebene in<br />
fischereiabhängigen<br />
Gebieten<br />
Entwicklung der Anzahl<br />
Arbeitsplätze auf NUTS III<br />
Ebene in<br />
fischereiabhängigen<br />
Gebieten<br />
Entwicklung der<br />
Arbeitslosigkeit auf NUTS III<br />
Ebene in<br />
fischereiabhängigen<br />
Gebieten<br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
Meldungen der<br />
Ausbildungsstätten<br />
Anlandestatistik<br />
Nat. Flottenregister<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
Anlandestatistik<br />
Nat. Flottenregister<br />
Bundesanstalt für<br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung<br />
Offizialstatistiken<br />
DESTATIS und<br />
Statistische .<br />
Landesämter<br />
Offizialstatistiken<br />
DESTATIS und<br />
Statistische .<br />
Landesämter<br />
Bundesagentur für Arbeit<br />
Offizialstatistiken<br />
DESTATIS und<br />
Statistische .<br />
Landesämter<br />
Bundesagentur für Arbeit<br />
Rückgang<br />
nicht höher<br />
als die %<br />
Veränderunge<br />
n der<br />
Anlandungen<br />
Rückgang<br />
maximal 1 %<br />
p.a.<br />
konstant<br />
konstanter bis<br />
leicht<br />
steigender<br />
Anteil der<br />
wichtigsten<br />
Häfen<br />
konstant<br />
Vergleich mit<br />
Entwicklung<br />
auf Bundes<br />
und<br />
Länderebene<br />
Vergleich mit<br />
Entwicklung<br />
auf Bundes<br />
und<br />
Länderebene<br />
Vergleich mit<br />
Entwicklung<br />
auf Bundes<br />
und<br />
Länderebene<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc 17.12.2007
8. Anhang : Tabellen, Abbildungen und Indikatoren 106<br />
8.3.6 Gewässerschutz (Bezug Kapitel 4.3.7)<br />
Unter/Spez. Ziele Merkmal Quelle Zielgröße<br />
Schutzgebiete<br />
Km 2 Fläche in<br />
Schutzgebieten (wie. z.B.<br />
Natura 2000) im maritimen<br />
Bundesministerium für<br />
Umwelt, Naturschutz und<br />
Reaktorsicherheit<br />
konstant<br />
und terrestrischen Bereich<br />
Bundesamt für<br />
oder andere Gebiete mit<br />
Naturschutz<br />
(fischereilichen)<br />
Nutzungsbeschränkungen Landesministerien bzw.<br />
-ämter für <strong>Fischerei</strong><br />
Schutzgebiete<br />
Gewässergüte<br />
Marine temporäre<br />
Nullnutzungszonen im<br />
Rahmen von<br />
Managementplänen der EU<br />
als km 2 -Tage<br />
Karte / Anteil guter<br />
Gewässerqualität nach EU-<br />
WasserRahmenRichtlinie<br />
(WRRL)<br />
8.3.7 Gute Governance der GFP (Bezug Kapitel 4.3.8)<br />
Bundesministerium für<br />
Umwelt, Naturschutz und<br />
Reaktorsicherheit<br />
Bundesamt für<br />
Naturschutz<br />
Landesministerien bzw.<br />
-ämter für <strong>Fischerei</strong><br />
Bundesministerium für<br />
Umwelt, Naturschutz und<br />
Reaktorsicherheit<br />
Bundesamt für<br />
Naturschutz<br />
konstant<br />
„Guter<br />
Zustand“ aller<br />
Oberflächeng<br />
ewässer bis<br />
2015<br />
Unter/Spez. Ziele Indikator/Merkmal Quelle Zielgröße<br />
Organisationsgrad<br />
Anteil Fahrzeuge / Betriebe<br />
nach <strong>Fischerei</strong>en, die in<br />
Zusammenschlüssen<br />
organisiert sind<br />
Ressourcenüberwachung Anzahl Kontrollen /<br />
Beanstandungen<br />
Nat. Flottenregister<br />
Landesministerien bzw.<br />
-ämter für <strong>Fischerei</strong><br />
Bundesministerium für<br />
Gesundheit und Frauen<br />
Jahresbericht über die<br />
deutsche Fischwirtschaft<br />
konstant<br />
konstant<br />
C:\temp-ie\Temporary Internet Files\OLKA5\<strong>NSP</strong> Stand 04 12 2007.doc