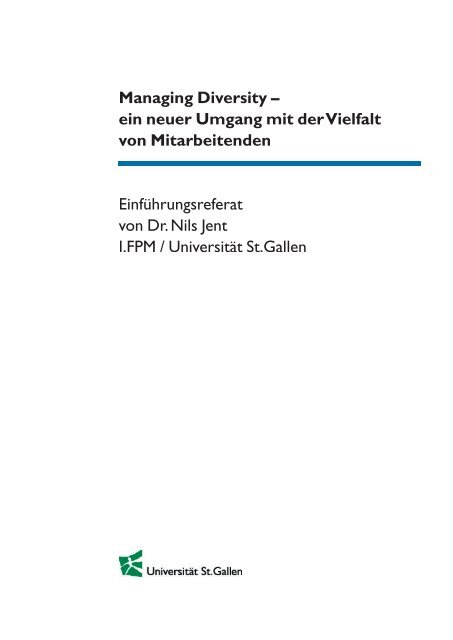Referat von Nils Jent - Profil
Referat von Nils Jent - Profil
Referat von Nils Jent - Profil
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Managing Diversity –<br />
ein neuer Umgang mit der Vielfalt<br />
<strong>von</strong> Mitarbeitenden<br />
Einführungsreferat<br />
<strong>von</strong> Dr. <strong>Nils</strong> <strong>Jent</strong><br />
I.FPM / Universität St.Gallen
Betrachten wir die Gesellschaften Europas und der Schweiz, so stellt sich die<br />
Frage nach den Werthaltungen und Einstellungen sowie nach dem Paradigma, auf<br />
dem diese Werthaltungen und Einstellungen basieren. Untersucht man dazu die<br />
hiesigen Unternehmen, so kristallisiert sich heraus, dass fast einhellig dem<br />
Paradigma des „Defizit orientierten Ansatzes“ Folge geleistet wird. Die Problematik<br />
dieses „Defizit orientierten Ansatzes“ ist seinethnozentrisches Verständnis, ähnlich<br />
jenem der „Equal-Opportunity-Bewegung“ aus den USA, wonach formelhaft gilt:<br />
„Gleichwertig ist, wer Gleichartig ist“ oder mit Georg Orwell’s Worten in „Animal-<br />
Farm“: „Alle Tiere sind gleich. Aber einige sind gleicher.“<br />
Mit einem solchen Verständnis wird unwillkürlich eine Zweiteilung in eine Idealtypologie<br />
und eine Nichtidealtypologie vollzogen. Drei Phänomene sind im<br />
Zusammenhang mit Personen, oder Mitarbeitenden, der nichtidealtypischen<br />
Gruppe <strong>von</strong> Bedeutung:<br />
· In Gesellschaften, und noch eklatanter in Unternehmungen, ist die Summe aller<br />
nichtidealtypischen Personen in der Regel grösser als die Zahl der idealtypischen<br />
Personen.<br />
· Nichtidealtypische Personen unterliegen häufig einem erheblichen Anpassungsdruck.<br />
Dadurch entsteht zusätzlicher Stress und natürliche Ressourcen werden<br />
unterdrückt.<br />
· Die stereotypische Abgrenzung, wer einem idealtypischen <strong>Profil</strong> entspricht und<br />
wer eben nicht, ist zumindest überdenkenswert.<br />
Zu diesem dritten und letzten Phänomen möchte ich mit Ihnen zur Verdeutlichung<br />
gerne eine kleine, verblüffende Übung machen.<br />
(Übung mit den Brillenträgern)<br />
Behinderung, oder besser, Gesundheitsstatus, Nationalität, Alter, Geschlecht, usw.<br />
sind so genannte soziale Daten eines Menschen. Die Typologisierung geschieht<br />
also nicht auf der individuellen Ebene der Persönlichkeitsdaten eines Menschen,<br />
sondern eben auf der Ebene seiner „Sozialen Daten“. Diese Ebene definieren wir<br />
in der Betriebswirtschaftslehre als die Ebene der Mitarbeiterkategorien.<br />
Halten wir also fest: Die innerbetrieblich neue und zusätzliche Personalführungs-<br />
Ebene der Mitarbeiterkategorien ist eng auf die sozialen Daten fokussiert.<br />
Wie Unternehmen – oder auch Gesellschaften, die dem traditionellen „Defizit<br />
orientierten Ansatz“ verpflichtet sind, sich im Zusammenhang mit ihren Mitarbeiterkategorien<br />
verhalten, lässt sich anhand der Zielscheibengraphik veranschaulichen.<br />
© by <strong>Nils</strong> <strong>Jent</strong> 1
Nr. 1<br />
Das Zielscheibenprinzip<br />
Das Zielscheibenprinzip veranschaulicht das traditionelle Verfahren im Umgang mit sozialen<br />
Daten in Unternehmungen. Je „exotischer“ das soziale Datum, desto nicht idealtypischer die<br />
betreffenden Mitarbeitenden und desto unan gepasster sind die Werkzeuge der Personalarbeit.<br />
Bei der Rekrutierung sind die idealtypischen Mitarbeitenden die Erstgesuchten, die nichtidealtypischsten<br />
Mitarbeitenden die Letztgesuchtesten.<br />
Beim Outplacement verhält es sich entsprechend umgekehrt.<br />
Die Zielscheibengrafik verdeutlicht, dass es sich beim „Defizitorientierten Ansatz“<br />
um einen typischen Vertreter der konjunkturell bedingten „Schönwetter-/<br />
Schlechtwetter-Philosophie“ handelt. Dieser defizitorientierte Ansatz diskriminiert<br />
nicht nur bestimmte soziale Daten, sondern berücksichtigt ebenso wenig<br />
die auf dem jeweiligen sozialen Datum beruhenden besonderen Befähigungen.<br />
Diese besonderen Befähigungen bezeichnen wir in der Betriebswirtschaftslehre<br />
als die so genannten „Komparativen Kompetenzen“ eines Menschen.<br />
© by <strong>Nils</strong> <strong>Jent</strong> 2
Was die „Komparative Kompetenz“ einzelner sozialer Daten ist, zeigen Ihnen<br />
auszugsweise die folgenden zwei Abbildungen.<br />
Nr. 2<br />
Altersdiversity<br />
Nr. 3<br />
Genderdiversity nach Fisher<br />
Durch die mangelnde Berücksichtigung dieser „sozialdatengebundenen“ komparativen<br />
Kompetenzen können diese <strong>von</strong> den Unternehmungen schliesslich auch<br />
nicht erfolgswirksam genutzt werden. Genau hier setzt der konstruktive Umgang<br />
mit Diversity an.<br />
© by <strong>Nils</strong> <strong>Jent</strong> 3
Nr. 4<br />
Definition „Managing Diversity“<br />
„Managing Diversity“ ist der konstruktive Umgang mit der Vielfalt und Verschiedenartigkeit<br />
<strong>von</strong> Menschen“ zum Nutzen aller Anspruchsgruppen, die für ein System bedeutend sind.<br />
Diversity ist also ein sozialpolitisches Werteverständnis zur gezielten Nutzung der Verschiedenartigkeit<br />
<strong>von</strong> Menschen sowie der Unterschiedlichkeit ihrer sozialen Daten.<br />
„Managing Diversity“ ist der konstruktive Umgang mit der Vielfalt und Verschiedenartigkeit<br />
<strong>von</strong> Menschen“ zum Nutzen aller Anspruchsgruppen, die für ein<br />
System bedeutend sind. Damit dieser Nutzen aus der Vielfalt und Verschie denartigkeit<br />
<strong>von</strong> Menschen gleichsam extrahiert werden kann, ist ein völlig neues<br />
Verständnis des Grundsatzes zur Antidiskriminierung unerlässlich. Soll der<br />
Grundsatz zur Antidiskriminierung im Sinne des „Managing Diversity“ greifen,<br />
ist die Tendenz zur Uniformität – beruhend auf dem Axiom „gleichwertig = gleichartig“<br />
– aufzuheben. Es muss ohne jegliche Diskriminierung absolut selbstverständlich<br />
werden, als Frau, Senior, Ausländer oder ebenso auch als Behinderter,<br />
nicht mit Vorbehalten konfrontiert zu werden.<br />
Allerdings behebt der gesellschaftspolitische Quantensprung der selbstverständlichen<br />
Antidiskriminierung <strong>von</strong> Vielfalt und Verschiedenartigkeit noch immer<br />
nicht die ebenso zum Diskriminierungsphänomen gehörende materielle Benachteiligung<br />
resp. Übervorteilung ganzer Gruppen bestimmter sozialer Daten.<br />
Noch immer bleibt beispielsweise die Umsetzung <strong>von</strong> „gleicher Lohn für gleiche<br />
Arbeit resp. Leistung“ für Frauen häufig blosses Wunschdenken. Und dies,<br />
obwohl die Gleichberechtigung <strong>von</strong> Frau und Mann angeblich längst vollzogen<br />
ist. Dies macht deutlich, dass ein neuer, dem konstruktiven Umgang mit Vielfalt<br />
und Verschiedenartigkeit verpflichteter Grundsatz zur Antidiskriminierung<br />
endlich zweidimen sional auszugestalten ist.<br />
© by <strong>Nils</strong> <strong>Jent</strong> 4
Nr. 5<br />
Die Zweidimensionalität des Diskriminierungsphänomens<br />
Legende<br />
X-Achse: Besserstellungsgrad<br />
Y-Achse: Privilegierungsgrad<br />
Quadrant 1: Privilegierung mit Übervorteilungstendenz<br />
Quadrant 2: Privilegierung aber mit Benachteiligungstendenz<br />
Quadrant 3: Diskriminierung mit Benachteiligungstendenz<br />
Quadrant 4: Diskriminierung aber mit Übervorteilungstendenz<br />
(Vorteil durch Mitleids- oder Sozialgefühl)<br />
A = Lenkungstyp A baut die Diskriminierung ab<br />
B = Lenkungstyp B baut die Benachteiligung ab<br />
C = Lenkungstyp C baut die Übervorteilung ab<br />
D = Lenkungstyp D baut die Privilegierung ab<br />
Eine moderne, zweidimensionale Ausgestaltung der Antidiskriminierung greift<br />
also nicht nur auf der immateriellen Ebene der Gleichberechtigung sondern<br />
gleichzeitig auch auf der Ebene der materiellen Gleichstellung. Lebt dieses neue,<br />
zweidimensionale Verständnis der Antidiskriminierung, und greifen seine<br />
Lenkungsinstrumente im Bemühen zu einem dynamischen Gleichgewicht hin zur<br />
Gleichberechtigung und Gleichstellung, so ist eine <strong>von</strong> drei Voraussetzungn<br />
geschaffen für ein erfolgswirksames „Managing Diversity“.<br />
© by <strong>Nils</strong> <strong>Jent</strong> 5
Halten wir fest: Während beim „Defizitorientierten Ansatz“ ein möglichst sozialverträgliches<br />
Nebeneinander der Unterschiedlichkeit angestrengt wird, so konzentrieren<br />
sich sämtliche Strategien und Instrumente des „Managing Diversity“<br />
auf den Nutzen – oder Mehrwert – gezielten Miteinanders der Vielfalt und Verschiedenartigkeit.<br />
Mit dem Wechsel unserer Gesellschaft hin zur Konzeption des „Managing<br />
Diversity“ erhalten auch die vormals nichtidealtypischen Mitglieder, wie z.B. ich<br />
als Mensch mit Behinderung, die Chance, ihre komparativen Kompetenzen<br />
weitgehend ohne Barrieren und strukturelle Hemmnisse einzubringen. Dies zum<br />
Nutzen aller, wie auch zum eigenen Nutzen, zur eigenen Zufriedenheit und<br />
Motivation.<br />
© by <strong>Nils</strong> <strong>Jent</strong> 6