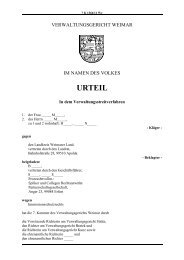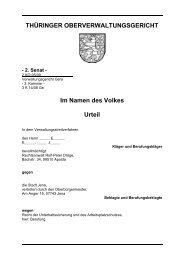BESCHLUSS - Verwaltungsgericht Weimar
BESCHLUSS - Verwaltungsgericht Weimar
BESCHLUSS - Verwaltungsgericht Weimar
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
VERWALTUNGSGERICHT GERA<br />
<strong>BESCHLUSS</strong><br />
In dem Verwaltungsrechtsstreit<br />
der Frau _____ F_____,<br />
F_____, _____ F_____<br />
- Antragstellerin -<br />
gegen<br />
die Fachhochschule Jena,<br />
vertreten durch den Rektor,<br />
Carl-Zeiss-Promenade 2, 07745 Jena<br />
- Antragsgegnerin -<br />
wegen<br />
Hochschulrechts<br />
hier: Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO<br />
hat die 2. Kammer des <strong>Verwaltungsgericht</strong>s Gera durch<br />
Richterin am <strong>Verwaltungsgericht</strong> Pohlan als Einzelrichterin<br />
am 27. August 2004 beschlossen:<br />
Der Antrag wird abgelehnt.<br />
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens.<br />
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.500,00 Euro festgesetzt.
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
Gründe<br />
I.<br />
Die Antragstellerin wendet sich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens gegen<br />
einen Bescheid der Antragsgegnerin, mit dem ihr die Zahlung von Studiengebühren ab dem<br />
Wintersemester 2004/2005 aufgegeben wird.<br />
Die Antragstellerin studierte zunächst 8 Semester an der Ernst-Moritz-Arndt Universität<br />
Greifswald und 3 Semester an der Freien Universität Berlin. Sie begann sodann ihr Studium<br />
bei der Antragsgegnerin im 2. Fachsemester als Quereinsteigerin im Fach Betriebswirtschaft.<br />
Im Wintersemester 2004/2005 studiert die Antragstellerin im 5. Fachsemester.<br />
Unter dem 29. März 2004 beantragte die Antragstellerin den Erlass der<br />
Langzeitstudiengebühr für das 5. Fachsemester aufgrund unzumutbarer Härte wegen<br />
besonderer Umstände des Einzelfalls. Dazu gab sie an, sie beziehe 400,00 € monatliche<br />
Einnahmen von ihren Eltern. Ihre monatlichen Mietausgaben würden 204,50 € betragen. Von<br />
den ihr damit noch zur Verfügung stehenden 195,50 € zur Bestreitung der<br />
Lebenshaltungskosten müsse sie 82,00 € für eine monatliche Heimfahrt aufwenden. Eine<br />
künftige Mehrbelastung von 500,00 € pro Semester sei ihr in ihrer derzeitigen finanziellen<br />
Lage unzumutbar und würde zu einer privaten Verschuldung führen. Die Aufnahme eines<br />
Kredites komme für sie nicht in Betracht, da sie als Studentin mit geringen Einkünften nicht<br />
kreditwürdig sei. Die Aufnahme eines Nebenjobs, um diese Summe zu finanzieren, würde ihr<br />
Studium nur weiter in die Länge ziehen und zu einer weiteren Verschuldung führen. So wie es<br />
aussehe, müsse sie mitten im Studium wegen Zahlungsunfähigkeit abbrechen.<br />
Am 30. April 2004 berechnete die Antragsgegnerin, dass für die Antragstellerin eine<br />
Langzeitstudiengebührenpflicht ab dem Wintersemester 2004/2005 eintrete.<br />
Mit Bescheid vom 17. Juni 2004 verlangte die Antragsgegnerin von der Antragstellerin auf<br />
der Grundlage des § 107a Abs. 1 ThürHG i.V.m. § 4 Abs. 1 der Allgemeinen<br />
Gebührenordnung der Fachhochschule Jena vom 29. März 2004 eine Langzeitstudiengebühr<br />
in Höhe von 500,00 € pro Semester ab dem Wintersemester 2004/2005.<br />
2
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
Hiergegen legte die Antragstellerin am 19. Juli 2004 Widerspruch ein und beantragte die<br />
Aussetzung der Vollziehung.<br />
Den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung lehnte die Antragsgegnerin unter dem<br />
20. Juli 2004 ab.<br />
Am 18. August 2004 hat die Antragstellerin beim <strong>Verwaltungsgericht</strong> Gera um vorläufigen<br />
Rechtsschutz nachgesucht.<br />
Die Antragsgegnerin hat mit Widerspruchsbescheid vom 19. August 2004 den Widerspruch<br />
der Antragsstellerin gegen den Bescheid vom 17. Juni 2004 zurückgewiesen. Wegen des<br />
genauen Inhalts des Bescheides wird auf die Blätter 21 bis 25 der Verwaltungsakte Bezug<br />
genommen.<br />
Mit Bescheid vom 20. August 2004 hat die Antragsgegnerin den Härtefallantrag der<br />
Antragstellerin abgelehnt. Wegen des genauen Inhalt des Bescheides wird auf Blatt 20 der<br />
Verwaltungsakte Bezug genommen.<br />
Die Antragstellerin hat inzwischen die Studiengebühr in Höhe von 500,00 Euro für das<br />
Wintersemester 2004/2005 an die Antragsgegnerin gezahlt.<br />
Der Rechtsstreit ist mit Beschluss der Kammer vom 26. August 2004 auf die<br />
Berichterstatterin als Einzelrichterin übertragen worden.<br />
Die Antragstellerin trägt vor: Die Erhebung der Langzeitstudiengebühr verstoße gegen<br />
Art. 12 Abs. 1 GG und verletze das Rückwirkungsverbot. Durch die Gewährleistung in<br />
§ 107 Abs. 1 ThürHG auf ein gebührenfreies Studium sei für sie ein konkreter<br />
Vertrauenstatbestand geschaffen worden, auf den sie sich bei ihrer Studienplanung<br />
eingerichtet habe. Außerdem sei die Erhebung von Langzeitstudiengebühren unsozial. Sie<br />
hätten einen regelnden Effekt nämlich nur für die Studierenden, die sich die Studiengebühren<br />
nicht leisten könnten. Es sei aber mit dem Sozialstaatsgebot nicht vereinbar, eine<br />
Hochschulausbildung ab einem bestimmten Semester nur noch Kindern begüterter Eltern zu<br />
ermöglichen. Sie verfüge zudem nicht über die finanziellen Möglichkeiten, die<br />
Langzeitstudiengebühr zu zahlen. Die Gebühr führe für sie zu einem nicht zu bewältigenden<br />
Kostenfaktor und zu einer unbilligen Härte.<br />
3
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
Die Antragstellerin beantragt ausdrücklich,<br />
die Aussetzung der Vollziehung,<br />
was sie per e-Mail am 25. August 2004 dahingehend klargestellt hat, dass sie die Anordnung<br />
der aufschiebenden Wirkung beantragt.<br />
Die Antragsgegnerin beantragt,<br />
den Antrag abzulehnen.<br />
Sie ist der Ansicht, der Antrag sei unbegründet. Wegen des genauen Vorbringens wird auf die<br />
Antragserwiderung vom 20. August 2004, Blätter 19 bis 22 der Gerichtsakte, Bezug<br />
genommen.<br />
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der<br />
Gerichtsakte und der beigezogenen Behördenvorgänge der Antragsgegnerin (1 Heftung)<br />
verwiesen.<br />
II.<br />
Die Entscheidung ergeht durch die Berichterstatterin als Einzelrichterin, weil ihr der<br />
Rechtsstreit mit Beschluss der Kammer vom 26. August 2004 gemäß § 6 Abs. 1 der<br />
<strong>Verwaltungsgericht</strong>sordnung – VwGO – zur Entscheidung übertragen worden ist.<br />
Der Antrag der Antragstellerin ist gemäß § 88 VwGO dahingehend auszulegen, dass sie die<br />
Anordnung der aufschiebenden Wirkung der gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom<br />
17. Juni 2004 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 19. August 2004 zu erhebenden<br />
Anfechtungsklage begehrt.<br />
Der Antrag ist auch schon vor Erhebung der Anfechtungsklage gemäß § 80 Abs. 5,<br />
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO statthaft und auch im Übrigen zulässig. Bei der in Streit stehenden<br />
Studiengebühr handelt es sich um eine öffentliche Abgabe im Sinne von<br />
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO, bei deren Anforderung die aufschiebende Wirkung der<br />
Anfechtungsklage entfällt. Der gemäß § 80 Abs. 6 Satz 1 VwGO erforderliche Antrag auf<br />
Aussetzung der Vollziehung ist mit Schreiben vom 19. Juli 2004 von der Antragstellerin<br />
4
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
gestellt und von der Antragsgegnerin unter dem 20. Juli 2004 abgelehnt worden. Das<br />
Rechtsschutzbedürfnis für den Antrag besteht trotz der Zahlung der Gebühr an die<br />
Antragsgegnerin, weil sich der Verwaltungsakt hierdurch nicht erledigt hat. Die<br />
Antragstellerin könnte nämlich bei Erfolg ihrer Klage die Rückgängigmachung der<br />
Vollziehung verlangen.<br />
Der Antrag ist indes unbegründet. Das öffentliche Interesse am Sofortvollzug des<br />
angefochtenen Bescheides überwiegt das private Interesse der Antragstellerin an einer<br />
vorläufigen Aussetzung der Vollziehung. Es bestehen nach der in dem vorliegenden<br />
Verfahren allein vorzunehmenden summarischen Prüfung weder ernstliche Zweifel an der<br />
Rechtmäßigkeit des Bescheides, noch hätte dessen Vollziehung eine unbillige, nicht durch<br />
überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte für die Antragstellerin zur Folge (vgl.<br />
§ 80 Abs. 4 Satz 3 VwGO). Die bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten<br />
die Aussetzung der Vollziehung rechtfertigenden ernstlichen Zweifel bestehen dann, wenn die<br />
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit eines Bescheides derart überwiegen, dass ein Erfolg des<br />
Rechtsmittels im Hauptsacheverfahren wahrscheinlicher ist als ein Unterliegen (vgl.<br />
ThürOVG, Beschluss vom 23. April 1998 – 4 EO 6/97 –, ThürVBl. 1998, 184, 186 m.w.N.).<br />
Nach summarischer Prüfung ist davon auszugehen, dass die Anfechtungsklage der<br />
Antragstellerin gegen den Bescheid vom 17. Juni 2004 in der Gestalt des<br />
Widerspruchsbescheides vom 19. August 2004 aller Voraussicht nach keinen Erfolg haben<br />
wird.<br />
Die Erhebung der Studiengebühr durch die Antragsgegnerin beruht auf § 107a des Thüringer<br />
Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Thüringer<br />
Hochschulgesetzes und des Thüringer Gesetzes über die Aufhebung der Pädagogischen<br />
Hochschule Erfurt vom 10. April 2003 (GVBl. Seite 213) i.V.m. § 4 der Allgemeinen<br />
Gebührenordnung der Fachhochschule Jena vom 29. März 2004 (Verkündungsblatt der<br />
Fachhochschule Jena 2/2004). Gemäß § 107a Abs. 1 ThürHG erheben die Hochschulen<br />
Gebühren in Höhe von 500,00 Euro für jedes weitere Semester von Studierenden, die die<br />
Regelstudienzeit eines Studiengangs, der zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss<br />
führt, um mehr als vier Semester (Nr. 1) oder eines postgradualen Studiengangs um mehr als<br />
zwei Semester (Nr. 2) überschritten haben. Gemäß § 107a Abs. 2 Satz 1 bestimmt sich die<br />
Regelstudienzeit nach der jeweiligen Prüfungsordnung oder der jeweiligen<br />
Approbationsordnung des gegenwärtig gewählten Studiengangs. § 107a Abs. 3 ThürHG<br />
bestimmt, dass ein einmaliger Wechsel des Studiengangs bis zum Abschluss des zweiten<br />
5
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
Semesters bei der Erhebung von Gebühren nach Abs. 1 Nr. 1 unberücksichtigt bleibt (Satz 1).<br />
Im Übrigen werden alle Studienzeiten an Hochschulen im Geltungsbereich des<br />
Hochschulrahmengesetzes angerechnet (Satz 2). Gemäß § 107a Abs. 6 ThürHG kann die<br />
Gebühr auf Antrag im Einzelfall teilweise oder ganz erlassen werden, wenn ihre Einziehung<br />
zu einer unbilligen Härte führen würde (Satz 1). Eine unbillige Härte liegt in der Regel vor bei<br />
studienzeitverlängernden Auswirkungen einer Behinderung oder schweren Erkrankungen<br />
(Nr. 1), studienzeitverlängernden Folgen als Opfer einer Straftat (Nr. 2) oder einer<br />
wirtschaftlichen Notlage in zeitlich unmittelbarer Nähe zum letzten Abschnitt der<br />
Abschlussprüfung (Nr. 3) (Satz 2). Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Gebührenerhebung<br />
aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls für den Studierenden eine unzumutbare Härte<br />
darstellen würde (Satz 3). Gemäß § 4 Abs. 1 der Allgemeinen Gebührenordnung der<br />
Fachhochschule Jena haben Studierende aufgrund des Überschreitens der Regelstudienzeit um<br />
einen bestimmten in § 107a Abs. 1 bis 5 ThürHG festgelegten Zeitraum Gebühren in Höhe<br />
von 500,00 Euro pro Semester zu entrichten, sofern nach Maßgabe von Absatz 2 die<br />
Gebührenerhebung auf Antrag nicht hinausgeschoben oder die Gebühr auf Antrag nicht ganz<br />
oder teilweise erlassen wurde. § 4 Abs. 2 der Allgemeinen Gebührenordnung der<br />
Fachhochschule Jena regelt hierzu, dass die Gebührenpflicht nach Abs. 1 auf Antrag nach<br />
Maßgabe von § 107a Abs. 4 ThürHG hinausgeschoben werden oder im Einzelfall ganz oder<br />
teilweise erlassen werden kann, wenn die Gebühreneinziehung zu einer unbilligen Härte<br />
(§ 107a Abs. 6 Satz 2 ThürHG) führt oder die Gebühreneinziehung eine unzumutbare Härte<br />
(§ 107a Abs. 6 Satz 3 ThürHG) darstellt (Satz 1). Der Antrag nach Satz 1 ist unter<br />
Verwendung des hierfür vorgesehenen Formulars beim Studentensekretariat zu stellen<br />
(Satz 2). Gemäß § 4 Abs. 3 der Allgemeinen Gebührenordnung der Fachhochschule Jena gibt<br />
sich die Fachhochschule Jena allgemeine Grundsätze zur Anwendung und Auslegung der<br />
Gebührenerhebung nach Absatz 1 und des Hinausschiebens der Gebührenpflicht oder des<br />
Gebührenerlasses nach Absatz 2.<br />
Die genannten Vorschriften sind entgegen der Ansicht der Antragstellerin nicht wegen<br />
Verstoßes gegen Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes – GG –, dass aus dem Rechtsstaatsprinzip<br />
folgende Rückwirkungsverbot oder das Äquivalenzprinzip nichtig bzw. wegen Verstoßes<br />
gegen § 27 Abs. 4 Satz 1 des Hochschulrahmengesetzes (HRG) in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Art. 1 des<br />
6. Änderungsgesetzes vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3138) oder § 107 Abs. 1 ThürHG<br />
rechtswidrig.<br />
6
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistet allen Deutschen das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und<br />
Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung, wozu auch die Ausbildungsausübung<br />
gehört, kann gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes<br />
geregelt werden, wobei sich diese Regelungsbefugnis auch auf die Berufs- bzw.<br />
Ausbildungswahl erstreckt (BVerfG, Urteil vom 11. Juni 1958 – 1 BvR 596/56 -, BVerfGE 7,<br />
377 ff.).<br />
Die Gewährleistung des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG umfasst für sich genommen nicht den<br />
Anspruch auf ein kostenloses Studium, der durch die Regelung des § 107a ThürHG bzw. des<br />
§ 4 der Allgemeinen Gebührenordnung verkürzt sein könnte. Es bestehen keine<br />
Anhaltspunkte dafür, dass der Verfassungsgeber die herkömmliche und erst im Jahre 1970<br />
abgeschaffte Erhebung von Studiengebühren unterbinden und Studierenden einen<br />
entsprechenden Leistungsanspruch einräumen wollte (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Juli 2001<br />
– 6 C 8/00 –, zitiert nach juris).<br />
Die in § 107a ThürHG normierte Pflicht, nach Ablauf der Regelstudienzeit zuzüglich vier<br />
weiterer Hochschulsemester die Studiengebühr zu entrichten, berührt auch nicht das aus<br />
Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG i.V.m. dem Gleichheitssatz und dem Sozialstaatsprinzip<br />
herzuleitende Recht des Einzelnen auf Zulassung zum Hochschulstudium seiner Wahl. Dieses<br />
Recht steht unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne<br />
vernünftigerweise von der Gesellschaft verlangen kann. Dies hat in erster Linie der<br />
Gesetzgeber in eigener Verantwortung zu beurteilen, der bei seiner Haushaltswirtschaft auch<br />
andere Gemeinschaftsbelange zu berücksichtigen hat. Dementsprechend erstreckt sich der<br />
verfassungsrechtliche Zulassungsanspruch nicht auf die Kostenfreiheit des gewählten<br />
Studiums. Der Gesetzgeber ist durch den genannten Zulassungsanspruch nicht an der<br />
Entscheidung gehindert, unter Rückgriff auf den Grundsatz, dass die Inanspruchnahme<br />
staatlicher Ressourcen durch einen eingeschränkten Nutzerkreis in der Regel eine<br />
Gebührenpflicht auslöst, bestimmte öffentliche Leistungen der Berufsausbildung künftig nicht<br />
mehr auf Dauer kostenlos anzubieten (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Juli 2001 – 6 C 8/00,<br />
a.a.O., m.w.N.).<br />
Durch § 107a ThürHG wird auch nicht das in Art. 12 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG und<br />
dem Sozialstaatsprinzip verankerte Recht verletzt, ein für jedermann tragbares bzw. ein um<br />
ein finanzielles Ausbildungsförderungssystem ergänztes Ausbildungsangebot in Anspruch<br />
nehmen zu können, das eine Sonderung der Studierenden nach den Besitzverhältnissen der<br />
Eltern verhindert. Der Gesetzgeber ermöglicht jedem Studierenden ein Studium für die Dauer<br />
7
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
der Regelstudienzeit zuzüglich 4 weiterer Semester ohne Studiengebühren. Ferner sind in<br />
§ 107a Abs. 2 Satz 3 auch Aufbau- und Zweitstudien unter bestimmten Voraussetzungen von<br />
der Gebührenpflicht ausgenommen. Eine darüber hinausgehende Kostenfreiheit des Studiums<br />
ist verfassungsrechtlich nicht verankert (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 25. Juli 2001 –<br />
6 C 8/00 –, a.a.O.).<br />
Soweit die Langzeitstudiengebühr das Verhalten der Studierenden in der Weise lenken soll,<br />
dass sie zu einem zügigen Abschluss ihres Studiums angehalten werden sollen und damit zur<br />
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Effizienz der Hochschulen beigetragen werden<br />
soll, greift § 107a ThürHG zwar in den Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG ein.<br />
Dieser Eingriff ist aber verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Prüfung der<br />
verfassungsrechtlichen Rechtfertigung der Einschränkung des Grundrechts aus<br />
Art. 12 Abs. 1 GG durch § 107a ThürHG ist anhand der Stufentheorie vorzunehmen. Da in<br />
§ 107a ThürHG Berufsausübungsregelungen zu sehen sind (1. Stufe, vgl. BVerwG, Urteil<br />
vom 25. Juli 2001 – 6 C 8/00 –, a.a.O.), weil dadurch die Studienbedingungen gestaltet<br />
werden, müssen vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls die Regelung als zweckmäßig<br />
erscheinen lassen.<br />
Eine solche Rechtfertigung der Studiengebühr durch vernünftige Erwägungen des<br />
Gemeinwohls ist vorliegend festzustellen. Die Absicht des Gesetzgebers, Studierende zu<br />
einem stringenteren und ergebnisorientierteren Studium zu veranlassen (vgl.<br />
Landtagsdrucksache 3/2847, Seite 2), verfolgt ein legitimes Gemeinwohlanliegen.<br />
Die Studiengebühr ist in diesem Rahmen auch verhältnismäßig. Die Einführung einer<br />
Studiengebühr für Studierende, die die Regelstudienzeit um mehr als 4 Semester überschritten<br />
haben, ist ein geeignetes Mittel, um für die Studierenden einen Anreiz zu bilden, das Studium<br />
zielstrebig und zügig abzuschließen. Weniger einschneidende, aber gleich wirksame<br />
Regelungen sind nicht ersichtlich. Insoweit beeinträchtigen etwa Immatrikulationsverbote als<br />
verhaltslenkende Maßnahmen die Ausbildungsfreiheit stärker. Außerdem tragen sie nicht zu<br />
der weiter mit der Einführung der Studiengebühr erfolgten Zielsetzung, zur Finanzierung der<br />
öffentlichen Einrichtung beizutragen (vgl. § 107a Abs. 9 ThürHG), bei.<br />
Die gesetzliche Regelung setzt die Studierenden auch keinen unzumutbaren Belastungen aus.<br />
Die gebührenfreien Semester lassen ausreichend Zeit für ein Erststudium. Darüber hat der<br />
Gesetzgeber Studierenden auch die Möglichkeit eröffnet, ohne Anrechnung auf die<br />
gebührenpflichtige Studienzeit, einmalig den Studiengang bis zum Abschluss des<br />
8
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
2. Semesters zu wechseln (vgl. § 107a Abs. 3 Satz 1 ThürHG). Ferner ist nichts dafür<br />
ersichtlich, dass die grundsätzliche Zumutbarkeit der umstrittenen Langzeitstudiengebühr<br />
dadurch in Frage gestellt wird, dass eine große Anzahl von Studierenden neben dem Studium<br />
einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Insoweit durfte der Gesetzgeber zulässigerweise davon<br />
ausgehen, dass das Unterhaltsrecht und das Recht der Ausbildungsförderung den<br />
Studierenden im Regelfall eine hinreichende wirtschaftliche Grundlage dafür verschaffen, das<br />
Studium innerhalb des zeitlichen Rahmens, für den eine Gebührenfreiheit gilt, abzuschließen.<br />
Die insoweit vorgenommene Verlängerung der Regelstudienzeit um 4 weitere gebührenfreie<br />
Semester bietet zudem einen Puffer für etwaige Verzögerungen des Studiums. Der<br />
Gesetzgeber war nicht verpflichtet, die gebührenfreie Zeit großzügiger zu bemessen. Es hätte<br />
der Zielsetzung des Gesetzes widersprochen, in weitergehendem Umfang ein Verhalten zu<br />
privilegieren, dass mit einem ordnungsgemäßen Studium nicht vereinbar ist und dem die<br />
Einführung der Studiengebühr entgegensteuern soll (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom<br />
25. Juli 2001 – 6 C 8/00 -, a.a.O.).<br />
Durch die Regelung der Studiengebühr bei Überschreitung der Regelstudienzeit in<br />
§ 107a ThürHG wird auch nicht gegen das aus dem Rechtsstaatsprinzip herzuleitende<br />
Rückwirkungsverbot verstoßen.<br />
Eine echte Rückwirkung, d.h. der nachträglich ändernde Eingriff eines Gesetzes in<br />
abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Sachverhalte bzw. deren erstmalig belastende<br />
Regelung (vgl. BVerfG, 1. Senat, Beschluss vom 5. Mai 1987 – 1 BvR 724/81 u.a. -, zitiert<br />
nach juris) bzw. eine Rückbewirkung von Rechtsfolgen insoweit, dass die Rechtsfolgen einer<br />
Norm bereits für einen bestimmten Zeitraum eintreten sollen, der vor ihrer Verkündung liegt<br />
(vgl. BVerfG, 2. Senat, Beschluss vom 30. September 1987 – 2 BvR 933/82 -, zitiert nach<br />
juris), liegt hier nicht vor. Studiengebühren für die Vergangenheit werden nicht erhoben.<br />
Unbeachtlich ist insoweit, dass eine Anrechnung von Studienzeiten, die vor dem Inkrafttreten<br />
des Gesetzes absolviert wurden, bei der Berechnung der Studiengebühr erfolgt. Es kommt für<br />
die Frage einer Rückwirkung allein auf die Gebührenpflicht an, die für das am 25. April 2003<br />
in Kraft getretene Gesetz erstmals für das Wintersemester 2004/2005 (vgl.<br />
§ 135b Abs. 6 ThürGH) und damit nicht rückwirkend besteht. Die Berechnung der<br />
Voraussetzungen der Gebühr und damit die Anrechnung der zurückliegenden Semester stellt<br />
keine eigenständige Belastung der Studenten dar.<br />
§ 107a ThürHG bewirkt indes auch keine unzulässige unechte Rückwirkung bzw.<br />
tatbestandliche Rückanknüpfung. Von einer unechten Rückwirkung ist dann auszugehen,<br />
9
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
wenn ein Gesetz auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte für die Zukunft<br />
einwirkt und damit zugleich eine betroffene Rechtsposition nachträglich entwertet (vgl.<br />
BVerfG, 1. Senat, Beschluss vom 5. Mai 1987 – 1 BvR 724/81 u.a. -, a.a.O.). Bei der<br />
tatbestandlichen Rückanknüpfung knüpft die Norm für künftige Rechtsfolgen in ihrem<br />
Tatbestand an Gegebenheiten aus der Zeit vor ihrer Verkündung an (vgl. BVerfG, 2. Senat,<br />
Beschluss vom 30. September 1987 – 2 BvR 933/82 -, a.a.O.). Eine derartige Rückwirkung ist<br />
verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Anderes kann aber aus rechtsstaatlichen<br />
Grundsätzen des Vertrauensschutzes, der Rechtssicherheit und der Verhältnismäßigkeit<br />
folgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn bei der gebotenen Abwägung zwischen dem<br />
enttäuschten Vertrauen des Betroffenen und der Bedeutung der Neuregelung für das Wohl der<br />
Allgemeinheit den Interessen des Betroffenen ein höheres Gewicht einzuräumen ist. Ein<br />
solches höheres Gewicht des enttäuschten Vertrauens der Antragstellerin ist hier nicht<br />
festzustellen.<br />
Der Gesetzgeber hatte ein berechtigtes Interesse daran, die mit dem Gesetz verfolgten<br />
Zwecke, insbesondere dessen verhaltslenkende Wirkung, möglichst bald zur Geltung zu<br />
bringen. Die Entscheidung des Gesetzgebers, ein kostenfreies Hochschulstudium nur noch in<br />
begrenztem Umfang anzubieten, hätte an Überzeugungskraft eingebüßt, wenn die Regelung<br />
des ThürHG nicht alsbald auf die im Geltungsbereich des Gesetzes befindlichen<br />
Langzeitstudierenden erstreckt worden wäre. Außerdem war es ein legitimes Anliegen, gerade<br />
auch diesen Kreis der Studierenden durch die absehbare Gebührenpflichtigkeit dazu zu<br />
bewegen, ihr Studium zügig abzuschließen. Darüber hinaus konnte kein Studierender darauf<br />
vertrauen, ein überlanges gebührenfrei begonnenes Studium ohne eine Gebührenbelastung<br />
beenden zu können. Es musste sich jedem Studierenden aufdrängen, dass der weit über die<br />
Regelstudienzeit hinausgehenden Inanspruchnahme der Hochschule auf Kosten der<br />
Allgemeinheit ohne eigenen Beitrag jederzeit Grenzen gesetzt werden konnte. Der Einzelne<br />
hatte auch ca. 1 ½ Jahre Zeit, sich auf die Gebührenpflichtigkeit einzustellen, weil das am<br />
25. April 2003 in Kraft getretene Gesetz eine erstmalige Studiengebührenpflicht für das<br />
Wintersemester 2004/2005 bewirkt (vgl. hierzu BVewG, Urteil vom 25. Juli 2001 –<br />
6 C 8/00 -, a.a.O.).<br />
Darüber hinaus verstößt § 107a ThürHG auch nicht gegen das Äquivalenzprinzip. Dieses<br />
Prinzip ist nach der ständigen Rechtsprechung erst verletzt, wenn die Höhe der Gebühr und<br />
der Wert der Gegenleistung außer Verhältnis stehen, weil diese für den Begünstigten wertlos<br />
ist, die Gebühr so hoch festgesetzt ist, dass sie von der Inanspruchnahme der Gegenleistung<br />
10
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
abzuschrecken geeignet ist oder erdrosselnd wirkt. Keiner dieser Gesichtspunkte kommt bei<br />
der Regelung der Studiengebühr in § 107 a ThürHG zum Tragen. Das Studium ist für die<br />
Studierenden nicht wertlos und eine Studiengebühr, die erst nach der Regelstudienzeit<br />
zuzüglich 4 weiterer Semester erhoben wird, ist auch nicht geeignet, Studierende vom<br />
Studium abzuhalten. Insoweit dürfte außer Frage stehen, dass die Hochschulen den<br />
Studierenden eine besonders qualifizierte Ausbildung vermitteln, die sie in die Lage versetzt,<br />
zum eigenen Nutzen in führenden Positionen in Staat und Gesellschaft tätig zu werden (vgl.<br />
VG Karlsruhe, Beschluss vom 17. September 1998 – 7 K 1742/98 –, zitiert nach juris).<br />
Außerdem dürfte die Gebühr tatsächlich weit unter den Kosten liegen, die selbst das<br />
kostengünstigste Studium an einer Hochschule während eines Semesters verursacht.<br />
§ 107a ThürHG verstößt auch nicht gegen § 27 Abs. 4 Satz 1 HRG, der durch Art. 1 des<br />
6. Änderungsgesetzes vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3138) eingefügt wurde und wonach<br />
das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und das Studium in einem<br />
konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt,<br />
studiengebührenfrei ist. Zum einen sind gemäß § 72 Abs. 1 Satz 8 HRG die Landesgesetze an<br />
diese Vorschrift erst innerhalb von 3 Jahren nach dem am 15. August 2002 erfolgten<br />
Inkrafttreten dieser Norm anzupassen. Diese Frist ist noch nicht abgelaufen. Zum anderen<br />
lässt § 27 Abs. 4 Satz 2 HRG in besonderen Fällen Ausnahmen von der grundsätzlichen<br />
Gebührenfreiheit zu. Eine solche zulässige Ausnahme für den besonderen Fall des<br />
Langzeitstudierenden, der mehr als die Regelstudienzeit zuzüglich 4 weiterer Semester<br />
Studienzeiten im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes absolviert hat, ist in<br />
§ 107a ThürHG geregelt.<br />
Entgegen der Ansicht der Antragstellerin verstößt die Erhebung von Langzeitstudiengebühren<br />
auch nicht gegen § 107 Abs. 1 ThürHG, wonach Studiengebühren sowie Gebühren für<br />
Hochschulprüfungen und für staatliche Prüfungen nicht erhoben werden. Wie bereits<br />
ausgeführt, handelt es sich bei der Regelung in § 107a lediglich um eine Ausnahmevorschrift.<br />
In dem dort geregelten Rahmen ist es zulässig, das weitere Studium an die Erhebung von<br />
Studiengebühren zu knüpfen.<br />
Dass die Voraussetzungen des § 107a ThürHG für die Erhebung der Studiengebühr bei der<br />
Antragstellerin vorliegend erfüllt sind, ist zwischen den Beteiligten unstreitig, so dass der<br />
Bescheid der Antragsgegnerin auch aus diesem Grund nicht zu beanstanden ist. Das<br />
Vorliegen der Voraussetzungen für einen Erlass der Gebühr gemäß § 107a Abs. 6 ThürHG<br />
bzw. § 4 Abs. 2 der Allgemeinen Gebührenordnung der Fachhochschule Jena sind im<br />
11
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen. Ein Erlass ist in einem selbständigen Verfahren<br />
geltend zu machen. Dies ist vorliegend durch den mit Schreiben vom 29. März 2004<br />
gestellten Antrag der Antragstellerin, den die Antragsgegnerin unter dem 20. August 2004<br />
abgelehnt hat, geschehen. Die Rechtmäßigkeit des Gebührenbescheides hängt nicht davon ab,<br />
ob ein Erlass der Gebühr geboten ist.<br />
Die Vollziehung des Gebührenbescheides, gegen dessen Rechtmäßigkeit wie ausgeführt keine<br />
ernstlichen Zweifel bestehen, hätte für die Antragstellerin auch keine unbillige, nicht durch<br />
überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge<br />
(§ 80 Abs. 4 Satz 3 2. Alternative VwGO). Eine unbillige Härte setzt voraus, dass durch die<br />
Zahlung dem Betroffenen wirtschaftliche Nachteile entstehen, die über die eigentliche<br />
Zahlung hinausgehen und nicht oder nur schwer wieder gut zu machen sind (vgl.<br />
Kopp/Schenke, VwGO, 12. Auflage, § 80 Rn. 116). Das Vorliegen dieser Voraussetzungen<br />
hat die Antragstellerin nicht glaubhaft gemacht. Insbesondere ihre im Anhörungsschreiben<br />
vom 29. März 2004 ausgeführte Mutmaßung, wohl mitten im Studium wegen<br />
Zahlungsunfähigkeit abbrechen zu müssen, bzw. der Vortrag in der Antragsschrift, gar nicht<br />
über die finanziellen Möglichkeiten zu verfügen, die Gebühr zu zahlen, stehen im<br />
Widerspruch zu dem Umstand, dass die Antragstellerin die Gebühr inzwischen bezahlt hat.<br />
Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.<br />
Die Festsetzung des Streitwertes findet ihre rechtliche Grundlage in den §§ 39 Abs. 1, 40,<br />
52 Abs. 3, 53 Abs. 3 Nr. 2 des Gerichtskostengesetzes – GKG – in der Fassung des Gesetzes<br />
zur Modernisierung des Kostenrechts vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718). Ausgehend von<br />
Ziffer 2.1 des Streitwertkataloges für die <strong>Verwaltungsgericht</strong>sbarkeit in der Fassung vom<br />
Januar 1996 wäre bei der hier für jedes Semester verlangten Gebühr zwar grundsätzlich der<br />
fünffache Jahresbetrag im Hauptsacheverfahren, d.h. 5.000,- Euro, als Streitwert festzusetzen.<br />
Weil aber davon auszugehen ist, dass die voraussichtliche Belastungsdauer bei der<br />
Antragstellerin geringer sein wird, da sie im WS 2004/2005 bereits das fünfte Fachsemester<br />
besucht, geht das Gericht von einem im Hauptsacheverfahren festzusetzenden Wert in Höhe<br />
der dreifachen Jahresgebühr aus. Der sich damit ergebende Streitwert i.H.v. 3.000,- Euro ist<br />
für das vorliegende Eilverfahren zu halbieren.<br />
12
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
Rechtsmittelbelehrung<br />
Gegen diesen Beschluss, mit Ausnahme der Streitwertentscheidung, kann innerhalb von<br />
zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde eingelegt werden. Die<br />
Beschwerde ist bei dem<br />
<strong>Verwaltungsgericht</strong> Gera,<br />
Postfach 15 61, 07505 Gera,<br />
Hainstraße 21, 07545 Gera,<br />
schriftlich einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb<br />
der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht.<br />
Die Beschwerde gegen Beschlüsse des <strong>Verwaltungsgericht</strong>s in Verfahren des vorläufigen<br />
Rechtsschutzes (§§ 80, 80 a und 123 VwGO) ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe<br />
der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der<br />
Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht einzureichen. Sie muss<br />
einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung<br />
abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung<br />
auseinandersetzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als<br />
unzulässig zu verwerfen.<br />
In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben,<br />
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt (§ 146 Abs. 3 VwGO).<br />
Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt,<br />
durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer Deutschen Hochschule im Sinne des<br />
Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten<br />
lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch<br />
Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-Juristen im höheren<br />
Dienst vertreten lassen. Gebietskörperschaften können sich auch durch Beamte oder<br />
Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des<br />
jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören,<br />
vertreten lassen.<br />
Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von<br />
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht,<br />
Kaufstraße 2-4, 99423 <strong>Weimar</strong>, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 Abs. 1 GKG<br />
n.F.).<br />
Die Beschwerde ist bei dem<br />
<strong>Verwaltungsgericht</strong> Gera,<br />
Postfach 15 61, 07505 Gera,<br />
Hainstraße 21, 07545 Gera,<br />
schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten,<br />
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich<br />
anderweitig erledigt hat, einzulegen.<br />
13
2 E 1089/04 Ge<br />
Aktenzeichen<br />
Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes<br />
200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG n.F.).<br />
Pohlan<br />
14