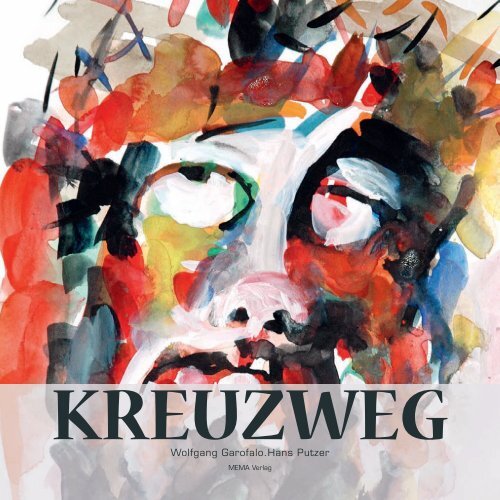Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KREUZWEG<br />
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Garofalo</strong>.<strong>Hans</strong> <strong>Putzer</strong><br />
MEMA Verlag
Die Arbeiten an meinem ersten Kreuzweg gehen<br />
bis ins Jahr 1996 zurück. Zum einen wollte ich<br />
nach vielen Einzelarbeiten auch endlich einen Zyklus<br />
gestalten, zum anderen ist das Thema Kreuzweg<br />
eine der spannendsten Anfragen an jedes menschliche<br />
Leben. Vieles wurde in den letzten Jahren verworfen.<br />
Ich bat darum, eine weitere Chance zu erhalten, bei<br />
einer Reise nach Rom diesen Kreuzweg zu vollenden.<br />
Und ich behielt Recht. Ich hatte in dieser Zeit derartig<br />
viele Inspirationen wie in meiner ganzen künstlerischen<br />
Laufbahn nicht und tauschte die Hälfte dieses schon<br />
abgeschlossenen Werkes gegen völlig neu gemalte<br />
Bilder. Ich musste dabei an Michelangelo denken, der,<br />
als er seinen ersten Versuch der Sixtinischen Kapelle<br />
zerstörte, sagte:<br />
„Wenn der Wein sauer ist, schütte ihn weg.“<br />
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Garofalo</strong><br />
KREUZWEG<br />
Der Künstler<br />
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Garofalo</strong>
Kreuzwege gehören zum unverzichtbaren Bestand<br />
unserer Volksfrömmigkeit ebenso wie zur<br />
Gebrauchskunst in unseren Kirchen. Der langen<br />
europäischen Tradition des Stationen-Dramas folgend<br />
sind sie gerade hierzulande auch Teil der kollektiven religiösen<br />
Kindheitserinnerungen. Hier wird der erzählte<br />
überlieferte Glaube so konkret erfahrbar wie sonst wohl<br />
zu keinem Zeitpunkt im Kirchenjahr.<br />
Natürlich ist der Kreuzweg auch immer ein Brennpunkt<br />
der Glaubensreflexion gewesen. An ihm lassen sich die<br />
unzähligen „Kreuzwege“ geknechteter Völker und bis in<br />
den Tod verfolgter Menschen nacherzählen.<br />
Die Texte dieses Kreuzweges – jeder Überlegung ist ein<br />
Zitat aus einem Werk Johann Sebastian Bachs vorausgestellt<br />
– verstehen sich aber als persönliche Anfragen.<br />
Sie versprachlichen an keiner Stelle die Bilder, und sie<br />
wollen auch keine theologischen Lektionen vermitteln.<br />
Im Gegenteil: So wie jedes Bild erst vom Betrachter und<br />
der Betrachterin zu Ende geschaut werden muss, die<br />
Leerstellen in eigener Verantwortung auszufüllen sind,<br />
so wollen die Texte von den Leserinnen und Lesern fertig<br />
geschrieben werden. Und sie wollen eines erreichen:<br />
helfen, sich angesichts des Kreuzweges selbst (den<br />
richtigen Fragen) zu stellen.<br />
<strong>Hans</strong> <strong>Putzer</strong><br />
KREUZWEG<br />
Der Autor<br />
<strong>Hans</strong> <strong>Putzer</strong>
Liebster Gott,<br />
wann werd<br />
ich sterben?<br />
Jedes Sterben, dem wir begegnen, verweist uns<br />
auf die Unvermeidlichkeit des eigenen Todes. Der<br />
Mensch ist zum Tod verurteilt. Wir sind alle, jeder<br />
Einzelne, zum Tod verurteilt. Der Tod, dieses scheinbar<br />
letzte unüberwindbare Rätsel des Daseins, passt so<br />
gar nicht in unsere augenblicksverliebte Welt. Entledigt<br />
jeglicher Wahrnehmung von Herkunft und Zukunft<br />
und hypnotisiert vom Schein der Lebensbenutzeroberflächen,<br />
wird zwar der tausendfach gespielte und auch<br />
real erlittene Tod auf die Bildschirme in unsere Kinderzimmer<br />
gebracht, dafür werden aber die Sterbenden in<br />
den Familien vor jeder unmittelbaren Begegnung noch<br />
rechtzeitig verbracht; ja: verbracht.<br />
Jesus wird am Ende seines Kreuzweges noch „vollbracht“<br />
sagen können. Wir dagegen haben meist die<br />
Frequenzen des Sterbens aus unserem Empfangsbereich<br />
gelöscht.<br />
Wir tun dies, weil wir es in unserer Augenblicksverliebtheit<br />
verlernt haben, hoffend zu leben. Und Hoffnung ist<br />
zuallererst einmal die Bereitschaft, an ein Besseres zu<br />
glauben, das nicht nur unserem eigenen Geschick anheim<br />
gestellt ist.<br />
BWV 7<br />
Christ unser Herr zum Jordan kam<br />
Kantate zu Johannis<br />
Von Eschatologie sprechen die Theologen – übrigens<br />
viel zu selten –, wenn sie von der Heiligkeit der „letzten<br />
Dinge“ reden. Ohne den Glauben an eine Vollendung, an<br />
ein Größeres, als das, was hier sein kann, hat der Tod<br />
aber keinen Sinn.<br />
KREUZWEG Jesus wird zum Tode verurteilt Station I
Gib uns Geduld<br />
in Leidenszeit,<br />
Gehorsam sein<br />
in Lieb und Leid.<br />
Schon bei dieser zweiten Station regen sich die ersten<br />
Widerstände kampfbereiter Gerechtigkeitsverfechter.<br />
Kaum vorstellbar, dass hier ein TV-Serienhelden-geeichtes<br />
Kind nicht aufstampft und seinem<br />
Jesus zurufen will: Wehr dich! Er, der Kranke geheilt,<br />
Blinde sehend gemacht hat und über das Wasser gegangen<br />
ist, soll nun plötzlich nicht mehr in der Lage sein,<br />
dem pharisäisch-römischen Komplott Herr zu werden;<br />
noch dazu, wo die Stadt voll ist mit seinen Anhängern<br />
und wo Unzählige aus den unterschiedlichsten Motiven<br />
und Gruppierungen nur darauf warten, die verhassten<br />
Römer aus der Heiligen Stadt zu vertreiben.<br />
Die Antwort der Theologen fällt scheinbar einfach aus:<br />
Jesus musste diesen Weg gehen, er war unverzichtbar<br />
im Ganzen der Heilsgeschichte.<br />
Heute, angesichts unserer fast endlosen Unheilsgeschichte<br />
des Verwechselns von Hörigkeit mit Gehorsam<br />
und den damit verbundenen Schuldverstrickungen, hat<br />
das Fühlen eine ungleich größere Attraktivität bekommen<br />
als das Hören. Jeder noch so unreflektierten Ich-<br />
Regung vertrauen wir mehr als den Angeboten, die sich<br />
aus einem verantworteten Hinhören eröffnen. Wie wir<br />
für ein gelingendes Leben ein Miteinander von Freiheit<br />
und Bindung brauchen, muss es ein rechtes Maß für<br />
Gehorsam und Ungehorsam geben.<br />
BWV 245<br />
Johannespassion<br />
KREUZWEG Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern<br />
Station II
Drum muss<br />
uns sein<br />
verdienstlich<br />
Leiden<br />
Recht bitter<br />
und doch<br />
süße sein.<br />
Bleiben wir bei den beiden Zeilen aus der Gethsemane-Szene<br />
der Matthäuspassion: bitter und süß<br />
– wie soll das zusammengehen? „Sein Trauren<br />
machet mich voll Freuden“ heißt es im Text unmittelbar<br />
davor, und noch ein paar Zeilen früher: „Er leidet alle<br />
Höllenqualen.“<br />
Dichter lässt sich das Geheimnis des Kreuzes nicht<br />
zum Ausdruck bringen. Jesus stirbt unsretwegen; und<br />
zugleich erlöst er uns damit. Wir stehen am Beginn<br />
seines Kreuzweges, er am Beginn unseres Weges zum<br />
Leben.<br />
Wir könnten dieses Geschehen aber auch ganz innerweltlich<br />
deuten: Eine klarere Absage an die Eskalationsspirale<br />
der Gewalt ist kaum vorstellbar. Ein „verdienstvolles“<br />
Leiden – „nützlich“ würden wir heute wohl sagen<br />
– ist ein Ja-Sagen zum eigenen Zurückstehen im Interesse<br />
eines größeren Ganzen. Das bittere Ich verwandelt<br />
sich auf dem Weg zum Du ins Süße.<br />
Keine Ich-AGs sozusagen,<br />
sondern Du-Fonds sind gefragt!<br />
BWV 244<br />
Matthäuspassion<br />
KREUZWEG Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz<br />
Station III
Meinem Jesum<br />
lass ich nicht,<br />
Bis mich erst<br />
sein Angesicht<br />
wird erhören<br />
oder segnen.<br />
Drei Begegnungen hat Jesus auf seinem Kreuzweg<br />
zwischen dem ersten und zweiten Fallen unterm<br />
Kreuz. Die Evangelien berichten allerdings nur<br />
von Simon von Cyrene. Maria, die Mutter Jesu, so die<br />
Überlieferung, hat mit anderen Frauen der Hinrichtung<br />
nur aus der Ferne zugesehen. Ob sie zuvor in den engen<br />
Gassen Jerusalems an der Seite gestanden ist, wissen<br />
wir nicht, auch wenn es gut möglich sein könnte.<br />
In der Tradition der Kreuzwegsandachten ist das jedoch<br />
eine dramaturgisch spannende Szene. Kein Zufall, dass<br />
sie auch in den meisten Verfilmungen zitiert wird.<br />
Viele – auch gläubige Katholiken – haben so ihre Probleme<br />
mit Maria. Zwischen magischer Vergottung auf<br />
der einen Seite und biologischer Beckmesserei angesichts<br />
des Geheimnisses der Empfängnis auf der anderen<br />
Seite spannt sich eine wenig hilfreiche Glaubensund<br />
Unglaubenspraxis.<br />
Was dieser Frau in ihrem Leben widerfahren ist, übersteigt<br />
jedes Maß menschlichen Verstehens. Die „Magd<br />
des Herren“, die als junges Mädchen die Mutterschaft<br />
Gottes angenommen hat, muss nun zusehen, wie ihr<br />
Sohn unschuldig hingerichtet wird.<br />
Was noch auffällt: Wenn die Frauen am Ostermorgen<br />
angesichts des leeren Grabes eine erste Ahnung vom<br />
Auferstandenen bekommen, ist die Mutter des Herrn<br />
nicht dabei. Eigentlich wenig überraschend, sie hat ja<br />
ihr Glaubensbekenntnis schon vor der Geburt Jesu ausgesprochen,<br />
sie glaubt nicht wegen dem, was geschah,<br />
sondern darauf, was kommen wird.<br />
BWV 98<br />
Was Gott tut, das ist wohlgetan<br />
Kantate zum 21. Sonntag nach Trinitatis<br />
„Was Gott tut, das ist wohlgetan.“ Anders ist Maria<br />
nicht zu verstehen. Jeder Glaube, dem diese Konsequenz,<br />
dieses Vertrauen fehlt, bleibt immer nur ein Dafürhalten.<br />
KREUZWEG<br />
Jesus begegnet seiner Mutter<br />
Station IV
Gerne will ich<br />
mich bequemen,<br />
Kreuz und Becher<br />
anzunehmen,<br />
Trink ich<br />
doch dem<br />
Heiland nach.<br />
Kreuz und Becher, Martersäule und Opferschale<br />
sind zentrale Begriffe der Matthäuspassion; und<br />
sie werden ausdrücklich und an prominenter Stelle<br />
in einem Atemzug genannt. Das Passionsgeschehen<br />
ist mit dem Letzten Abendmahl, der Karfreitag mit dem<br />
Gründonnerstag in einen untrennbaren Zusammenhang<br />
gestellt.<br />
„Den Kelch vorübergehen lassen“ ist eine alltägliche Redewendung<br />
geworden, ebenso „das Kreuz auf sich nehmen“.<br />
Die von den Römern erzwungene Hilfe des Simon von<br />
Cyrene scheint auf den ersten Blick unbedeutend. Was<br />
ist schon das Tragen des Kreuzes im Vergleich zur bevorstehenden<br />
grausamen Hinrichtung.<br />
Doch gerade dieses Denken entlarvt uns als das, was<br />
wir geworden sind: Ökonomen der Empathie. Mitleid –<br />
schade, dass es das Wort „Mitliebe“ nicht gibt – muss<br />
sich aber nicht rechnen.<br />
BWV 244<br />
Matthäuspassion<br />
Jesus, und dafür gibt es in den Passionsgeschichten<br />
der Evangelisten genügend Hinweise, hat den Weg zum<br />
Kreuz als Mensch zutiefst durchlitten. Selbst von Gott<br />
hat er sich am Kreuz verlassen gefühlt. Doch mit ein<br />
paar Schritten und Handgriffen, für ein paar Augenblicke<br />
ist Simon von Cyrene ein unveräußerliches Vorbild<br />
in der Heilsgeschichte der Menschen mit Gott geworden.<br />
Zwischen dem Kelch, der Einsetzung der eucharistischen<br />
Communio, und dem Kreuz, dem Opfer- und<br />
Erlösungstod für die Welt, zeigt gerade diese vermeintlich<br />
kleine Geste des Kreuztragens die Nähe zwischen<br />
Mensch und Gott.<br />
KREUZWEG Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen Station V
Auch mit<br />
gedämpften<br />
schwachen<br />
Stimmen<br />
Wird Gottes<br />
Majestät<br />
verehrt.<br />
BWV 36<br />
Schwingt freudig euch empor<br />
Kantate zum 1. Advent.<br />
Die dritte Begegnung, sie scheint fast noch lächerlicher<br />
als die zuvor mit Simon von Cyrene. Als<br />
eine gut gemeinte Geste könnte dieses Reichen<br />
des Schweißtuches rasch abgetan werden. Fast eine<br />
Art Hilflosigkeit. Noch ist der Weg zur Kreuzigungsstätte<br />
weit, mit jedem Schritt wird das Kreuz schwerer.<br />
Jahrhunderte später werden Tücher von allzu frommen,<br />
aber auch von allzu geschäftstüchtigen Reliquienvermehrern<br />
auftauchen, die vorgeben, Veronikas Schweißtuch<br />
zu besitzen.<br />
„Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt,<br />
habt ihr auch mir getan“ hat Jesus dem Matthäusevangelium<br />
nach unmittelbar vor seinem Martyrium gepredigt.<br />
„Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet“<br />
heißt es hier auch, fast wie in einer Vorwegnahme des<br />
Kreuzweges, der Jesus zum Geringsten unter allen auf<br />
diesem Weg hinauf nach Golgotha hat werden lassen.<br />
Und an einer anderen Stelle im Evangelium sind ihm<br />
einzelne verlorene Schafe zumindest ebenso wichtig wie<br />
die gesicherte Herde.<br />
Gott misst uns mit einem recht eigensinnigen Maß.<br />
Andererseits: Das oft zur Sprache gebrachte menschliche<br />
Maß hört immer dort auf, „menschlich“ zu sein,<br />
wo es Schwächen nicht zulässt, dem Geringen keinen<br />
Raum gibt. Überall dort, wo Menschen sich vergöttern<br />
lassen, geht jedes Maß verloren, werden nicht selten<br />
die Grenzen des Lebens niedergetreten. Bei Gott reimt<br />
sich schon ringen auf gelingen.<br />
KREUZWEG Veronika reicht Jesus das Schweißtuch<br />
Station VI
Ich will hier<br />
bei dir<br />
stehen,<br />
Verachte<br />
mich doch<br />
nicht.<br />
Ich bin klein, mein Herz ist rein, lass nur das Jesuskind<br />
hinein“ heißt es in einem Kindergebet, das heute<br />
– hoffen wir es wenigstens – schon viel von seiner<br />
Beliebtheit verloren hat.<br />
Das Gebet ist nicht nur ein pädagogischer Unfug, ins<br />
Herz gehören die Eltern, die Großeltern, die Geschwister,<br />
ja auch der Teddybär, es ist darüber hinaus auch<br />
sprachlich problematisch: „rein“ weckt gerade in der<br />
Kleinkinderziehung meist völlig andere Assoziationen.<br />
Vor allem aber kommt hier ein hanebüchenes Verständnis<br />
von Gott und Glaube zum Vorschein. Generationen<br />
von Christen sind mit der immerwährenden Drohbotschaft<br />
eines allmächtigen, rachsüchtigen und kontrollwütigen<br />
Gottes groß geworden.<br />
Wo, wenn nicht am Kreuzweg, ist Gott so sehr zur<br />
Antithese all dieser verschrammten Gottesbilder geworden?<br />
BWV 159<br />
Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem<br />
Kantate zu Estomihi<br />
Wo, wenn nicht im Fallen unter dem Kreuz, ist er uns<br />
Zweiflern und Suchenden jemals näher gekommen? Der<br />
strauchelnde Gottessohn, in diesem historischen Moment<br />
sicherlich ungleich mehr verachtet als verehrt, ist<br />
hier zuallererst ein Ohnmächtiger. Er steht wieder auf,<br />
aber nur, um sich selbst noch mehr dieser Ohnmacht<br />
auszuliefern. Weil auch er gefallen ist, können wir leichter<br />
zu ihm stehen.<br />
Gott ist hier ganz klein, und so können wir an ihn selbst<br />
dann, wenn auch wir ganz unten sind, „auf Augenhöhe“<br />
glauben.<br />
KREUZWEG Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuz Station VII
Ich freue mich auf<br />
meinen Tod,<br />
Ach! Hätt er<br />
sich schon<br />
eingefunden.<br />
Da entkomm ich<br />
aller Not,<br />
Die mich noch auf<br />
der Welt gebunden.<br />
Das Leben sei eine Anstrengung, die einer besseren<br />
Sache würdig wäre, hat Karl Kraus gemeint,<br />
und ein anderes Mal konnte er, der große Sprachverliebte,<br />
auch nicht dem Wortspiel „Menschsein ist irrig“<br />
widerstehen.<br />
Nur Lukas erzählt in seinem Evangelium von den wehklagenden<br />
Frauen. Die Aufforderung von Jesus ist, nicht<br />
über ihn, sondern über sich und ihre Kinder zu weinen.<br />
Und er verbindet diese mit einer Art Fluch gegen jene<br />
Kultur des Todes, die nun auch an ihm exekutiert wird.<br />
Wenn wir auch darauf vertrauen können, dass mit dem<br />
Kreuz der Tod als letztes Wort überwunden worden ist,<br />
verliert er nichts von seinem Schrecken. Wer ihn selbst<br />
im gut gemeinten Glauben an ein besseres Jenseits<br />
verharmlost oder dem diesseitigen Leben gar seinen<br />
unwiederbringlichen Eigenwert nimmt, hat den Kern<br />
der Botschaft Jesu missverstanden.<br />
In einer Kultur des Lebens ist das Menschsein nie und<br />
nimmer ein Irrtum. Und die Anstrengung, die jedes Leben<br />
mit sich bringt, ist dieses Leben immer und immer<br />
wieder von neuem wert. Denn wir haben nichts Kostbareres<br />
als unser Leben!<br />
BWV 82<br />
Ich habe genung<br />
Kantate zum Fest Mariä Reinigung<br />
KREUZWEG<br />
Jesus begegnet den weinenden Frauen Station VIII
Wie kann<br />
ich dir<br />
denn deine<br />
Liebestaten<br />
Im Werk<br />
erstatten?<br />
In der Johannespassion greift Bach die Frage der<br />
westlichen Theologie schlechthin auf; die Frage, an<br />
der sich der nun schon Jahrhunderte alte Graben<br />
zwischen Katholizismus und Protestantismus aufgetan<br />
hat: Wie kann der Mensch vor Gott – im Sinne von Gott<br />
gegenüber – gerecht sein, gottgemäß handeln?<br />
„Keines Menschen Herze mag indes ausdenken, was dir<br />
zu schenken“, gibt der Passionstext sich ohnehin selbst<br />
die Antwort.<br />
„No deal“ ist man fast geneigt, den Halbtitel eines Unterhaltungsformats<br />
mit hohem Risikofaktor aus dem<br />
Programm vieler Fernsehstationen zu zitieren. Mit Gott<br />
sind keine Geschäfte zu machen. Auch die täglich gute<br />
Tat mag zwar reichen, ein ordentlicher Pfadfinder zu<br />
sein, in der Suche nach Gott bringt uns das wenig weiter.<br />
Als Menschen, die wir daran glauben, das größte<br />
Geschenk – unser Leben – von Gott erhalten zu haben,<br />
sind wir zu keiner vergleichbaren Gegenleistung fähig.<br />
Aber wir haben nicht nur das Leben erhalten, sondern<br />
auch die Freiheit, es nach unseren Möglichkeiten autonom<br />
zu gestalten. Und diese Freiheit löst die Spannung<br />
zwischen Liebe und Werke auf. Einfacher gesagt: Christsein<br />
heißt, liebend tätig werden und tätig zu lieben.<br />
BWV 245<br />
Johannespassion<br />
KREUZWEG Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuz<br />
Station IX
Duld ich schon<br />
hier Spott<br />
und Hohn,<br />
dennoch bleibst<br />
du auch<br />
im Leide,<br />
Jesu<br />
meine Freude.<br />
Glaube macht Freude, an nichts glauben macht<br />
Spaß oder steht zumindest keinem Spaß im Wege.<br />
Selbst in der Bach-Mottete – und die ist immerhin<br />
bald 300 Jahre alt, der Text von Johann Franck<br />
stammt sogar von 1653 – wird die Freude des Glaubens<br />
mit Leid und Spott und Hohn in Verbindung gebracht. In<br />
vielen Ohren mag es wie ein frommer Wunsch klingen,<br />
wie hier der „Freudenmeister“ Jesu als Antwort auf die<br />
„Trauergeister“ des Lebens herbeigesungen wird.<br />
Gut, die Zeiten einer Religionskritik, die vor allem auf<br />
das Lächerlichmachen der Gläubigen abzielt, scheinen<br />
hierzulande vorbei. Über Minderheiten macht man sich<br />
halt nicht lustig. Den Armen zieht man nicht noch das<br />
letzte Hemd aus.<br />
Der Einspruch ist schon hörbar: Bei uns gibt es sie<br />
doch noch, die Volkskirche mit beinahe flächendeckender<br />
Sakramenten-Versorgung an den Wendepunkten<br />
des Lebens, Religionsunterricht und eine weitgehende<br />
Akzeptanz der Anerkennung des Christentums als Kultur<br />
stiftender Unterbau.<br />
Das Abendland mag ja christlich sein, aber sind es auch<br />
noch die Abendländer? Reicht es, als gesellschaftspolitisches<br />
und/oder individualpsychologisches Ferment<br />
ernst- und wahrgenommen zu werden? Sprechen wir<br />
nicht alle viel zu oft vom Christentum und viel zu selten<br />
von Christus?<br />
BWV 227<br />
Mottete: Jesu, meine Freude<br />
KREUZWEG<br />
Jesus wird seiner Kleider beraubt<br />
Station X
Ich will den<br />
Kreuzstab<br />
gerne tragen,<br />
Er kommt<br />
von Gottes<br />
lieber Hand.<br />
Papst Benedikt XVI. schreibt in seinem Jesus-Buch:<br />
„Die Lehre Jesu kommt nicht aus dem menschlichen<br />
Lernen, welcher Art auch immer. […] Sie<br />
ist Sohneswort. Ohne diesen inneren Grund wäre sie<br />
Vermessenheit.“<br />
Auch am Kreuzweg, da, wo Jesus alle Tiefen des<br />
Menschseins durchleidet, kann die Gottesfrage nicht<br />
weggeblendet werden.<br />
Wir können uns um zentrale Punkte der christlichen<br />
Verkündigung nicht hinwegschwindeln, ohne damit das<br />
Ganze zu leugnen. Auswahlchristentum ist und bleibt<br />
Folklore.<br />
Was heißt das?<br />
Wir Menschen – die Ebenbilder Gottes – sind von Jesus<br />
– dem Sohn Gottes – berufen, sagen wir es heutiger:<br />
eingeladen, den Weg des Lebens zu gehen. Der Auftrag,<br />
Jesus nachzufolgen, gehört zu diesen Kernbotschaften<br />
des christlichen Glaubens.<br />
BWV 56<br />
Ich will den Kreuzstab gerne tragen<br />
Kantate zum 19. Sonntag nach Trinitatis<br />
Den „Kreuzstab gerne tragen“ ist zwar der unausweichliche<br />
Ernstfall jedes menschlichen Lebens, die radikalste<br />
Anfrage an die Kraft des Glaubens. Aber für sich allein<br />
gestellt ist das Kreuz sinnlos. Jesus nachzufolgen muss<br />
vielmehr heißen, mitzuhelfen, möglichst oft Kreuze aus<br />
unserer Welt fernzuhalten. Es bleiben ohnehin noch viel<br />
zu viele übrig.<br />
KREUZWEG Jesus wird ans Kreuz geschlagen Station XI
Die Müh<br />
ist aus,<br />
die unsre<br />
Sünden ihm<br />
gemacht.<br />
Wir Menschen sind die Zumutung Gottes<br />
schlechthin. Wie sonst wäre der Opfertod<br />
Christi am Kreuz zu erklären? Nichts ist so<br />
einfach, wie die Geschichte der Menschheit als eine einzige<br />
große Unheilsgeschichte zu erzählen. Im Rückblick<br />
auf das 20. Jahrhundert erscheint selbst das „finstere<br />
Mittelalter“ als eine Zeit mit Zukunftspotential. Seit<br />
Auschwitz wissen wir, dass der Mensch den Menschen<br />
industriell zu vernichten imstande ist. Seit Hiroshima haben<br />
wir das Potential, dies in wenigen Augenblicken zu<br />
bewerkstelligen. Und seit den Siebzigerjahren chen wir global nicht mehr nur die Zinsen der Natur,<br />
verbrausondern<br />
auch ihr Kapital. Tendenz: stark zunehmend.<br />
Die Menschenrechte haben wir längst geteilt. Fremde<br />
werden unter Generalverdacht gestellt, und in den<br />
Tanks der amerikanischen Limousinen verbrennt das<br />
Brot der Menschen südlich des „Tortilla Curtain“.<br />
Moslems sind Terroristen, Schwarzafrikaner Drogendealer,<br />
Hauptsache, wir sind die Guten. Unsere Fernstenliebe<br />
ist unermesslich, und bei Licht ins Dunkel erkaufen<br />
wir uns den Weihnachtsfrieden. Ja, und das Geselchte<br />
im Fleischweihkörberl kommt von einem Schwein, das<br />
möglicherweise mit Soja aus Lateinamerika gefüttert<br />
worden ist, Rodung des Regenwaldes und Vertreibung<br />
indigener Dorfgemeinschaften inbegriffen. Aber wenigstens<br />
die Wertschöpfung pro Hektar stimmt!<br />
BWV 244<br />
Matthäuspassion<br />
KREUZWEG Jesus stirbt am Kreuz<br />
Station XII
Herz und Mund<br />
und Tat<br />
und Leben<br />
Muss von<br />
Christo<br />
Zeugnis geben.<br />
BWV 147<br />
Herz und Mund und Tat und Leben<br />
Kantate zum Fest Mariä Heimsuchung<br />
Golgotha reimt sich auf Hum-Ta-Ta. Wer diesen<br />
Satz als blasphemische Provokation sieht, sollte<br />
das nächste Mal Widerstand leisten, wenn im<br />
Gottesdienst der Vier-Akkorde-Klassiker „Sing mit mir<br />
ein Halleluja“ angestimmt wird. Da wird doch in der dritten<br />
Strophe im launige Glückseligkeit verströmenden<br />
Rhythmus „Für das Wunder, das geschah, dort am<br />
Kreuz auf Golgotha, als er starb, damit ich leben kann“<br />
gesungen. Der Text, der den Kern durchaus zur Sprache<br />
bringt, wird von einem musikalischen Holladaro in<br />
die unterste Schublade geselliger Scheinbetroffenheit<br />
gezwängt. Martin Mosebach hat im größeren Zusammenhang<br />
die Formulierung von der „Häresie der Formlosigkeit“<br />
geprägt.<br />
Das Heilige ist in allen Kulturen immer mit dem Bereich<br />
des Schönen eng verbunden. Glaubensfeier verlangt<br />
nach ästhetischem Ebenbild. Der Glanz Gottes,<br />
von dem die heiligen Schriften aller Kulturen immer<br />
wieder erzählen, verlangt nach unserer besten Musik,<br />
nach Kirchenräumen, die der Zeit ebenso gerecht<br />
werden wie der Zeitlosigkeit der Heilsgeschichte, und<br />
nach einer Sprache, die immer wieder von neuem das<br />
in ihr vorhandene gestalterische Potenzial ausschöpft.<br />
„Von Christo Zeugnis geben“, wie es in der Kantate<br />
heißt, darf ruhig – oder besser: unruhig – anspruchsvoll<br />
sein. Der historisch wichtigste Kulturträger des Abendlandes,<br />
die Kirche, hat nicht nur ein großes Erbe zu<br />
verwalten. Wenn ihr die Zukunft gehören will, muss sie<br />
auch den Mut haben, mit den Kreativen im spannungsvollen<br />
Dialog vorauszugehen.<br />
KREUZWEG Jesus wird vom Kreuz abgenommen Station XIII
Euer Grab und<br />
Leichenstein<br />
Soll dem<br />
ängstlichen<br />
Gewissen<br />
Ein bequemes<br />
Ruhekissen<br />
Und der Seelen<br />
Ruhstatt sein.<br />
Angesichts des Todes sei alles lächerlich, hat Thomas<br />
Bernhard einmal gemeint. Der Karsamstag<br />
ist der einzige Tag im Kirchenjahr, an dem kein<br />
Gottesdienst gefeiert wird. Nietzsches „Gott ist tot“<br />
wird für einen Tag auch für die Gläubigen erfahrbare<br />
Realität.<br />
Viel ist heute vom abwesenden Gott die Rede, von der<br />
„metaphysischen Unbehaustheit“ des modernen Menschen.<br />
Dem Jesuswort am Kreuz „Mein Gott, mein<br />
Gott, warum hast du mich verlassen?“ ist in der Moderne<br />
kein „Mein Gott, mein Gott, warum hab ich dich<br />
verlassen?“ gefolgt. Dabei hätten wir zu dieser Fragestellung<br />
gute Gründe genug.<br />
Aber wo das Leben vom Glauben nicht mehr gekreuzt<br />
wird, dort fehlt auch die Wahrnehmung für den Mangel,<br />
der daraus erwächst. Die Abwesenheit Gottes wird<br />
nicht als brennende Frage, sondern als gemütlicher Zustand<br />
erfahren.<br />
Der Karfreitag erschließt sich uns in der Leuchtkraft<br />
der Bilder des Leidens, der Ostermorgen im Halleluja<br />
der Hoffnung auf das Leben. Wir sollten künftig im<br />
Wartezimmer Karsamstag weniger gelangweilt und orientierungslos<br />
herumsitzen.<br />
BWV 244<br />
Matthäuspassion<br />
KREUZWEG Jesus wird ins Grab gelegt Station XIV
Adam muss<br />
in uns verwesen,<br />
Soll der neue<br />
Mensch genesen,<br />
[…]<br />
Lass, dass dein<br />
Heiland in dir lebt,<br />
An deinem Leben<br />
merken!<br />
Es s gibt keine größere Eitelkeit des Menschen als<br />
zu meinen, dass Gott nicht ist. Bloß diese Eitelkeit<br />
wird dort kaum geringer, wo Menschen ganz<br />
genau zu wissen meinen, wer Gott sei. Zur Erinnerung:<br />
„Eitel“ hat in seiner ursprünglichen Wortbedeutung neben<br />
dem auch heute noch gebräuchlichen Sinn immer<br />
auch „leer“ gemeint.<br />
Der Gegensatz zu einem eitlen ist ein erfülltes Leben.<br />
„Lass, dass dein Heiland in dir lebet, an deinem Leben<br />
merken!“ heißt es in der Bach-Kantate. Und Rilke hat geschrieben:<br />
„Alle, welche dich suchen, versuchen dich. Und<br />
die, die dich finden, binden dich an Bild und Gebärde.“<br />
Wir können an den auferstandenen<br />
Christus glauben oder auch nicht.<br />
Wir können diese Auferstehung feiern<br />
oder auch nicht.<br />
Wir können mit ihr den Kreuzweg zu einem guten<br />
Ende kommen lassen oder auch nicht.<br />
Nicht, dass diese Unterschiede<br />
gering zu schätzen wären.<br />
BWV 31<br />
Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret.<br />
Kantate zum 1. Ostertag<br />
Doch worum es geht, ist mehr, viel mehr. Die Auferstehung<br />
ernst nehmen heißt, sein Leben als ein Bekenntnis<br />
zu dieser Auferstehung zu leben: Jeder Kreuzweg,<br />
jedes Sterben hat Sinn, weil damit nie das letzte Wort<br />
gesprochen wird.<br />
KREUZWEG<br />
Auferstehung
Bilder – <strong>Wolfgang</strong> <strong>Garofalo</strong><br />
Autor – <strong>Hans</strong> <strong>Putzer</strong><br />
Fotografien – Christian Jungwirth<br />
Verlag, Gestaltung und Satz:<br />
MEMA Medien Marketing GmbH [cz], 8010 Graz,<br />
Reitschulgasse 5, Tel. 0316/81 70 90<br />
Druck: Druckhaus Thalerhof, Feldkirchen bei Graz<br />
Copyright © 2008<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form<br />
(durch Fotografie, Mikrofilm oder anderes Verfahren)<br />
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter<br />
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.<br />
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.<br />
ISBN: 978-3-9502161-3-4<br />
KREUZWEG