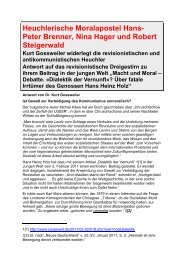Fernstudium II.pdf - auf den Webseiten der DKP OWL
Fernstudium II.pdf - auf den Webseiten der DKP OWL
Fernstudium II.pdf - auf den Webseiten der DKP OWL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ll.Thema:<br />
Die Grundbedingungen <strong>der</strong> kapitafistischen Produktionsweise<br />
Ware-Wert-Geld<br />
Bedeutung und lnhalt des Themas:<br />
- Das Thema ist die Grundlage für das Verständnis des gesamten Studienabschnitts.<br />
Eine gründliche Bearbeitung ist erfor<strong>der</strong>lich, um die nachfolgen<strong>den</strong> Themen zu<br />
verstehen. Es geht um das wissenschaftliche Fundament des gesamten Gebäudes.<br />
lm Vorwort des ,,Kapitals" schreibt Karl Marx:<br />
.,Aller Anfang ist schwer, gilt in je<strong>der</strong> Wissenschaft. Das Verständnis des ersten<br />
Kapitels, namentlich des Abschnitts, <strong>der</strong> die Analyse <strong>der</strong> Ware enthält, wird daher die<br />
meiste Schwierigkeit machen. Was nun näher die Analyse <strong>der</strong> Wertsubstanz und <strong>der</strong><br />
Wertgröße betrifft, so habe ich sie möglichst popularisiert. Die Wertform, <strong>der</strong>en fertige<br />
Gestalt die Geldform. ist sehr inhaltslos und einfach. Dennoch hat <strong>der</strong> Menschengeist sie<br />
seit mehr als 2000 Jahren vergeblich zu ergnin<strong>den</strong> gesucht, während andrerseits die<br />
Analyse viel inhaltsvollerer und komplizierterer Formen wenigstens annähernd gelang.<br />
Warum? Weil <strong>der</strong> ausgebildete Körper leichter zu studieren ist als die Körperzelle".<br />
( NGW 23, S. 11 ff.)<br />
- Karl Marx analysiert die einfache Warenproduktion, aus <strong>der</strong> die kapitalistische<br />
Warenproduktion als höchste Form <strong>der</strong> Warenproduktion hervorging und in <strong>der</strong> sie<br />
<strong>auf</strong>gehoben ist.<br />
Die einfache Warenproduktion ist keine eigenständige Produktionsweise. Sie beginnt in<br />
<strong>der</strong> Endphase <strong>der</strong> Urgesellschaft und wir fin<strong>den</strong> sie auch noch im Kapitalismus und<br />
selbst beim Übergang zum Sozialismus wird sie nicht verschwun<strong>den</strong> sein.<br />
- Um <strong>den</strong> Einruck eines,,Automatismus" in <strong>der</strong> politischen Okonomie vorzubeugen, sei<br />
dar<strong>auf</strong> verwiesen, dass ökonomische Gesetze sich nur durch das Handeln von<br />
Menschen durchsetzen, Wesen und Erscheinungen nicht zusammenfallen. Deshalb<br />
gleich zu Anfang folgendes Zitat aus dem Vierundzwanzigsten Kapitel des l. Bandes<br />
des Kapitals:<br />
,,ln <strong>der</strong> wirklichen Geschichte'spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord,<br />
kurz Gewalt die große Rolle. In <strong>der</strong> sanften politischen Ökonomie herrschte von jeher<br />
die ldylle. Recht und "Arbeit" waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel,<br />
natürlich mit jedesmaliger Ausnahme von "diesem Jahr".<br />
{MEW, 23 Seite 742}<br />
Warum beoinnt die Analvse des Kapitalismus mit <strong>der</strong> Ware?<br />
Trotz Aktienspektakel und Sharehol<strong>der</strong>-Value-Euphorie kann nichts darüber hinweg<br />
täuschten, die Menschen müssen durch Arbeit ihre nötigen Existenzmittel erzeugen.<br />
Wer nicht Selbstversorger ist - und wer ist das schon im Kapitalismus - <strong>der</strong> kann seine<br />
Existenzmittel nur durch <strong>den</strong> K<strong>auf</strong> von Waren erlangen.<br />
wenn man/frau untersuchl, wie die ware produziert wird, erkennen sie <strong>den</strong><br />
gesellschaftlichen Charakter <strong>der</strong> Produktivkräfte und die Form <strong>der</strong><br />
Produktionsverhältnisse, sowie die dialektischen Wechselbeziehungen zwischen<br />
bei<strong>den</strong>.<br />
I<br />
a*--<br />
E---<br />
E=<br />
&:<br />
?'-<br />
ts-<br />
l=-<br />
E<br />
&=<br />
s.=<br />
5;<br />
F<br />
&-<br />
.E:<br />
E<br />
ä--<br />
t--<br />
.5=<br />
.L<br />
.5=<br />
.5=<br />
.E=<br />
.5-<br />
.F<br />
L-<br />
I=<br />
I;<br />
I=<br />
I:<br />
I:<br />
t=<br />
I:<br />
I=<br />
-t=<br />
f
----<br />
---<br />
=-4<br />
----..-l:<br />
:<br />
-<br />
Wir wollen klären:<br />
1 Wie ein Produkt zur Ware wird? Welche historischen Bedingungen dazu<br />
erfor<strong>der</strong>lich sind.<br />
2. Dass die Ware einen Doppelcharakter hat, in dem <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>spruch<br />
zwischen privater und gesellschaftlicher Arbeit zum Ausdruck kommt.<br />
3. Dass die Wareproduzierende Arbeit Einheit von abstrakter- und konkreter<br />
Arbeit ist und die Entdeckung <strong>der</strong> abstrakten Arbeit durch Max <strong>der</strong><br />
Springpunkt <strong>der</strong> maxistischen Werttheorie ist.<br />
4. Dass die abstrakte Arbeit die einzige Wertsubstands ist, die durch die Zeit<br />
gemessen wird.<br />
Der Einfluss <strong>der</strong> Arbeitsproduktivität <strong>auf</strong> die Wertgröße.<br />
5. Dass <strong>der</strong> Wert ein gesellschaftliches Verhältnis ist, das unter <strong>den</strong> konkreten<br />
Gebrauchswert <strong>der</strong> Dinge verborgen ist.<br />
6. Dass Geld ein gesellschaftliches Verhältnis zum Ausdruck bringt und das<br />
Ergebnis <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Warenproduktion und des Warenaustausches<br />
ist.<br />
v<br />
Funktionen <strong>den</strong> Kapitalismus hervorbringt.<br />
-- 1. Die Ware - Gebrauchswert und Wert<br />
Lesetexte aus dem. ..Kapitall:<br />
,,Der Reichtum <strong>der</strong> Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise<br />
herrscht, erscheint als eine "ungeheure Warensammlung", die einzelne Ware als seine<br />
Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Ware.<br />
Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine<br />
Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser<br />
Bedürfnisse, ob sie z.B. dem Magen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Phantasie entspringen, än<strong>der</strong>t nichts an<br />
<strong>der</strong> Sache. Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche<br />
Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d.h. als Gegenstand des<br />
Genusses, o<strong>der</strong> <strong>auf</strong> einem Umweg, als Produktionsmittel.<br />
Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier usw., ist unter doppelten Gesichtspunkt zu<br />
betrachten, nach Quatität und Quantität. Jedes solches Ding ist ein Ganzes vieler<br />
Eigenschaften und kann daher nach verschie<strong>den</strong>en Seiten nützlich sein. Diese<br />
verschie<strong>den</strong>en Seiten und daher die mannigfachen Gebrauchsweisen <strong>der</strong> Dinge zu<br />
entdecken ist geschichtliche Tat. So die Findung gesellschaftlicher Maße für die<br />
Quantität <strong>der</strong> nützlichen Dinge. Die Verschie<strong>den</strong>heit <strong>der</strong> Warenmaße entspringt teils aus<br />
<strong>der</strong> verschie<strong>den</strong>en Natur <strong>der</strong> zu messen<strong>den</strong> Gegenstände, teils aus Konvention.<br />
schwebt nicht in <strong>der</strong> Luft. Durch die Eigenschaften des Warenkörpers bedingt, existiert<br />
sie nicht ohne <strong>den</strong>selben. Der Warenkörper selbst, wie Eisen, Weizen, Diamant usw., ist<br />
daher ein Gebrauchswert o<strong>der</strong> Gut. Dieser sein Charakter hängt nicht davon ab, ob die<br />
Aneignung seiner Gebrauchseigenschaften dem Menschen viel o<strong>der</strong> wenig Arbeit
10<br />
lcostet. Bei Betrachtung <strong>der</strong> Gebrauchswerte wird stets ihre quantitative Bestimmtheit<br />
\/orausgesetzt, wie Dutzend Uhren, Elle Leinwand, Tonne Eisen usw. Die<br />
Gebrauchswerte <strong>der</strong> Waren liefern das Material einer eignen Disziplin, <strong>der</strong> Warenkunde.<br />
Der Gebrauchswert verwirklicht sich nur im Gebrauch o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Konsumtion,<br />
Gebrauchswerte bil<strong>den</strong> <strong>den</strong> stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine<br />
gesellschaftliche Form sei. ln <strong>der</strong> von uns zu betrachten<strong>den</strong> Gesellschaftsform bil<strong>den</strong><br />
sie zugleich die stofflichen Träger des - Tauschwerts.<br />
ifer Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin<br />
sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte an<strong>der</strong>er Art austauschen, ein<br />
Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwert scheint daher<br />
etwas Zufälliges und rein Relatives, ein <strong>der</strong> Ware innerlicher, immanenter Tauschwert<br />
(valeur intrinsäque) also eine contradictio in adjecto. Betrachten wir die Sache näher.<br />
Eine gewisse Ware, ein Quarter Weizen z.B. tauscht, sich mit x Stiefelwichse o<strong>der</strong> mit y<br />
Seide o<strong>der</strong> mit z Gold usw., kurz mit an<strong>der</strong>n Waren in <strong>den</strong> verschie<strong>den</strong>sten<br />
Proportionen. Mannigfache Tauschwerte also hat <strong>der</strong> Weizen statt eines einzigen. Aber<br />
rla x Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold usw. <strong>der</strong> Tauschwert von einem<br />
Quarter Weizen ist, müssen y Stiefelwichse, y Seide, z Gold usw. durch einan<strong>der</strong><br />
ersetzbare o<strong>der</strong> einan<strong>der</strong> gleich große Tauschwerte sein. Es folgt daher erstens. Die<br />
gültigen Tauschwerte <strong>der</strong>selben Ware drücken ein Gleiches aus. Zweitens aber: Der<br />
Tauschwert kann überhaupt nur die Ausdrucksweise, die "Erscheinungsform" eines von<br />
ihm unterscheidbaren Gehalts sein. (MEW 23, S. 49 * 51)<br />
l\ls Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedner Qualität, als Tauschwerte<br />
l,lönnen sie nur verschiedner Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert.<br />
$ieht man nun vom Gebrauchswert <strong>der</strong> Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine<br />
tiigenschaft, die von Arbeitsprodukten. JeCoch ist uns auch das Arbeitsprodukt bereits<br />
in <strong>der</strong> Hand verwandelt. Abstrahieren wir von seinern Gebrauchswert, so abstrahieren<br />
wir auch von <strong>den</strong> körperlichen Bestandteilen und Formen, die es zum Gebrauchswert<br />
rnachen. Es ist nicht länger Tisch o<strong>der</strong> Haus o<strong>der</strong> Garn o<strong>der</strong> sonst ein nützlich. Alle<br />
seine sinnlichen Beschaffenheiten sind ausgelöscht. Es ist auch nicht länger das<br />
Produkt <strong>der</strong> Tischlerarbeit o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bauarbeit o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Spinnarbeit o<strong>der</strong> sonst einer<br />
irestimmten produktiven Arbeit. Mit dem nützlichen Charakter <strong>der</strong> Arbeitsprodukte<br />
verschwindet <strong>der</strong> nützlicher Charakter <strong>der</strong> in ihnen dargestellten Arbeiten, es<br />
verschwin<strong>den</strong> also auch die verschie<strong>den</strong>en konkreten Formen dieser Arbeiten, sie<br />
unterschei<strong>den</strong> sich nicht länger, son<strong>der</strong>n sind allzusamt reduziert <strong>auf</strong> gleiche<br />
"nenschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit.<br />
iletrachten wir nun das Residuum <strong>der</strong> Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen<br />
ibriggeblieben als dieselbe gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße Gallerte<br />
rrnerschiedsloser menschlicher Arbeit, d.h. <strong>der</strong> Verausgabung menschlicher Arbeitskraft<br />
,:'hne Rücksicht <strong>auf</strong> die Form ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar,<br />
,Jaß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit<br />
i<strong>auf</strong>gehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte -<br />
'lVarenwerte.<br />
lm Austauschverhältnis <strong>der</strong> Vüaren selbst erschien uns ihr Tauschwert als etwas von<br />
ilrren Gebrauchswerten durchaus Unabhängiges. Abstrahiert man nun wirklich vom<br />
tliebrauchswert <strong>der</strong> Arbeitsprodukte, so erhält man ihren Wert, wie er eben bestimmt<br />
'trard. Das Gemeinsame, was sich im Austauschverhältnis o<strong>der</strong> Tauschwert <strong>der</strong> Ware<br />
ilarstellt, ist also ihr Wert. Der Fortgang <strong>der</strong> Untersuchung wird uns zurückführen zum<br />
'l-auschwert als <strong>der</strong> notwendigen Ausdrucksweise o<strong>der</strong> Erscheinungsform des Werts,<br />
tvelcher zunächst jedoch unabhängig von dieser Form zu betrachten ist.<br />
liiin Gebrauchswert o<strong>der</strong> Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit
in ihm vergegenständlicht o<strong>der</strong> materialisiert ist. (MEW 23,51- 53)<br />
11<br />
Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. Es ist dies <strong>der</strong> Fall, wenn sein<br />
Nutzen für <strong>den</strong> Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräulicher Bo<strong>den</strong>,<br />
natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz usw. Ein Ding kann nützlich und Produkt<br />
menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein. Wer durch sein Produkt sein eignes<br />
Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware. Um Ware zu<br />
produzieren, muß er nicht nur Gebrauchswert produzieren, son<strong>der</strong>n Gebrauchswert für<br />
andre, gesellschaftliche Gebrauchswert. {Und nicht nur für andre schlechthin. Der<br />
mittelalterlichen Bauer produzierte das Zinskorn für <strong>den</strong> Feudalherrn, das Zehntkorn für<br />
<strong>den</strong> Pfaffen. Aber we<strong>der</strong> Zinskorn noch Zehnkorn wur<strong>den</strong> dadurch Ware, daß sie für<br />
andre produziert waren. Um Ware zu wer<strong>den</strong>, muß das Produkt dem an<strong>der</strong>n, dem es<br />
als Gebrauchswert dient, durch <strong>den</strong> Austausch übertragen wer<strong>den</strong>.) Endlich kann kein<br />
Ding Wert sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. lst es nutzlos, so ist auch die in<br />
ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert. ( 55)<br />
Alle Waren sind Nicht-Gebrauchswerte für ihre Besitzer, Gebrauchswerte für ihre Nicht-<br />
Besitzer. Sie müssen also allseitig die Hände wechseln. Aber dieser Händewechsel<br />
bildet ihren Austausch, und ihr Austausch bezieht sie als Werte <strong>auf</strong>einan<strong>der</strong> und<br />
realisiert sie als Werte. Die Waren müssen sich daher als Werte realisieren, bevor sie<br />
sich als Gebrauchswerte realisieren können.<br />
Andrerseits müssen sie sich als Gebrauchswerte bewähren, bevor sie sich als Werte<br />
realisieren können. Denn die <strong>auf</strong> sie verausgabte menschliche Arbeit zählt nur, soweit<br />
sie in einer für andre nützlichen Form verausgabt ist. Ob sie andren nützlich, ihr Produkt<br />
daher fremde Bedürfnisse befriedigt, kann aber nur ihr Austausch beweisen.<br />
Je<strong>der</strong> Warenbesitzer will seine Ware nur veräußern gegen andre Ware, <strong>der</strong>en<br />
Gebrauchswert sein Bedürfnis befriedigt. Sofern ist <strong>der</strong> Austausch für ihn nur<br />
individueller Prozeß. Andrerseits will er seine Ware als Wert realisieren, also in je<strong>der</strong><br />
ihm beliebigen andren Ware von demselben Wert, ob seine eigne Ware nun für <strong>den</strong><br />
Besitzer <strong>der</strong> andren Ware Gebrauchswert habe o<strong>der</strong> nicht. $ofern ist <strong>der</strong> Austausch für<br />
ihn allgemein gesellschaftlicher Prozeß. Aber <strong>der</strong>selbe Prozeß kann nicht gleichzeitig<br />
für alle Warenbesitzer nur individuell und zugleich nur allgemein gesellschaftlich sein."<br />
{MEW 23, 100 | 1O1)<br />
2. Die Warenproduzierende Arbeit und ihr DotpellghAIaklel<br />
,,Ursprünglich erschien uns die Ware als ein Zwieschlächtiges, Gebrauchswert und<br />
Tauschwert. Später zeigte sich, daß auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist,<br />
nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten<br />
zukommen. Diese zwieschlächtige Natur <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst<br />
von mir kritisch nachgewiesen wor<strong>den</strong>. Da dieser Punkt <strong>der</strong> Springpunkt ist, um <strong>den</strong><br />
sich das Verständnis <strong>der</strong> politischen Ökonomie dreht, soll er hier näher beleuchtet<br />
wer<strong>den</strong>.<br />
Nehmen wir zweiWaren, etwa einen Rock und 10 Ellen Leinwand. Der erster habe <strong>den</strong><br />
zweifachen Wert <strong>der</strong> letzteren, so daß, wenn 10 Ellen Leinwand = W, <strong>der</strong> Rock = 2W"<br />
Der Rock ist ein Gebrauchswert, <strong>der</strong> ein beson<strong>der</strong>es Bedürfnis befriedigt. Um ihn<br />
hervorzubringen, bedarf es einer bestimmten Art produktiver Tätigkeit. Sie ist bestimmt<br />
durch ihren Zweck, Operationsweise, Gegenstand, Mittel und Resultat. Die Arbeit, <strong>der</strong>en<br />
Nützlichkeit sich so im Gebrauchswert ihres Produkts o<strong>der</strong> darin darstellt, daß ihr<br />
Produkt ein Gebrauchswert ist, nennen wir kurzweg nützliche Arbeit. Unler diesem
Gesichtspunkt wird sie stets betrachtet mit Bezug <strong>auf</strong> ihren Nutzeffekt<br />
12<br />
Wie Rock und Leinwand qualitativ verschiedne Gebrauchswerte, so sind<br />
'!'ermitteln<strong>den</strong><br />
die ihr Dasein<br />
Arbeiten qualitativ verschie<strong>den</strong> - Schnei<strong>der</strong>ei und Weberei. Wären jene<br />
Dinge nicht qualitativ verschiedne Gebrauchswerte und daher Produkte qualitativ<br />
'v'erschiedner nützlicher Arbeiten, so könnten sie sich überhaupt nicht als Waren<br />
$egenübertreten. Rock tauscht sich nicht aus gegen Rock, <strong>der</strong>selbe Gebrauchswert<br />
nicht gegen <strong>den</strong>selben Gebrauchswert.<br />
In <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> verschie<strong>den</strong>artigen Gebrauchswerte o<strong>der</strong> Warenkörper erscheint<br />
'eine Gesamtheit ebenso mannigfaltiger, nach Gattung, Art, Familie, Unterart, Varietät<br />
'u'erschiedner nützlicher Arbeiten * eine gesellschaftliche Teilung <strong>der</strong> Arbeit. Sie ist<br />
lEixistenzbedingung <strong>der</strong> Warenproduktion, obgleich Warenprooüt
.--:<br />
----+ 13<br />
-__-<br />
'--<<br />
Die Ware<br />
Produkt menschlicher Arbeit, das für <strong>den</strong> Austausch erzeugt wird. Die Ware<br />
hat einen Doppetcharakter und existiert in <strong>der</strong> Einheit von Gebrauchswert<br />
und Wert.<br />
Gebrauchswert<br />
Nützliche Eigenschaften, mit <strong>der</strong> die<br />
Ware menschliche Bedürfnisse<br />
materieller, geistiger o<strong>der</strong> ästhetischer<br />
Art befriedigt.<br />
Wert<br />
Gesellschafrliches Verhältnis <strong>der</strong><br />
privaten WarenProduzenten, das in<br />
dinglicher Form im Tauschwert <strong>der</strong><br />
Waren erscheint.<br />
Verschie<strong>den</strong>e Qual'ttät<br />
Verschie<strong>den</strong>e Quantitäl<br />
Warenproduzierende Arbeit<br />
Konkrete Arbeit<br />
Zweckbestimmte Tätigkeit. Zum<br />
Beispiel des Schnei<strong>der</strong>s, des Bäckers'<br />
des Schlossers usw.<br />
Mittelund<br />
Abstrakte Arbeit<br />
Verausgabung menschlicher<br />
Arbeitskraft (Muskeln. Nerv,<br />
Hirn) als Teil<strong>der</strong><br />
gesellschafilichen<br />
Gesamtarbeit. Weübit<strong>den</strong>de<br />
Arbeit unter bestimrnten<br />
Produktionsprozess<br />
Arbeitsprozess i<br />
W"rtbildungsprozess<br />
Sioffwechsel von Mensch und Natur - I Beziehungen <strong>der</strong> Menschen<br />
ewige Naturbedingungen des<br />
menschlichen Lebens. I untereinan<strong>der</strong> unter bestimmten<br />
Herstellung von Gebrauchswerten.<br />
historischen Bedingungen.<br />
von Wert.<br />
Der produktionsprozess von Waren ist Einheit von Arbeits- und Wertbildungsprozess<br />
,,Ein Gebrauchswert o<strong>der</strong> Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit<br />
in ihm vergegenständlicht o<strong>der</strong> materialisiert ist. Wie nun die Größe seines Werts<br />
messen? Öuicn das Quantum <strong>der</strong> in ihm enthaltenen "wertbil<strong>den</strong><strong>den</strong> Substanz", <strong>der</strong><br />
Arbeit. Die euantität <strong>der</strong> Arbeit selbst mißt sich an ihrer Zeitdauer, und die Arbeitszeit<br />
besitzt wie<strong>der</strong> ihren Maßstab an bestimmten Zeitteilen, wie Stunde, Tag usw.<br />
Es könnte scheinen, daß, wenn <strong>der</strong> Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion<br />
verausgabte Ar6eitsquenturl bestimnrt ist, je fauler o<strong>der</strong> ungeschickter einlvfanrl des{c<br />
wertvoller seine Ware, *,eil er desto mehr ieit zu ihrer Verfertigung braucht. Die Ärbeit jedoch"<br />
welche die Substanz <strong>der</strong> Werte bildet, ist -eleiche<br />
menschliche Arbeit, Verausgabung <strong>der</strong>selben<br />
menschlichen Arbeitskraft, Die gesamte Artreitskr aft <strong>der</strong> Gesellschaft, die sich in <strong>den</strong> Weruien <strong>der</strong>
!\/arenwelt darstellt" gilt hier als eine und dieseibe menschlic.he Arbeitskraft, obgleich sie aus<br />
zi*rllosen individuellen Arbeitskräften besteht. Jede dieser individuellen Arbeitskräfte ist<br />
dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die an<strong>der</strong>e, soweit sie <strong>den</strong> Charakter einer<br />
gesellschaftlichen Durchschnitts-Arbeitskraft besitx und als solche gesellschaftliche<br />
Durchschnitts-Arbeitskraft wirkt, also in <strong>der</strong> Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt<br />
notwendige o<strong>der</strong> gesellschaftlich notw'endige Arbeitszeit braucht. Gesellschaftlich notwendige<br />
lrrbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt, um irgendeinen Gebrauchswert mit <strong>den</strong> vorhan<strong>den</strong>en<br />
gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen<br />
Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität <strong>der</strong> Arbeit darzustellen. Nach <strong>der</strong> Einführung des<br />
flampfivebstuhls in England z.B" genügte vielleicht halb so viel Arbeit als vorher, um ein<br />
gegebenes Quantum Garn in Gewebe zu verwandeln. Der englische Handweber brauchte zu<br />
dieser Verwandlung in <strong>der</strong> Tat nach wie vor dieselbe Arbeitszeit, aber das Produkt seiner<br />
individuellen Arbeitsstunde stellte jetzt nur noch eine halbe gesellschaftliche Arbeitsstunde dar<br />
und fiel daher <strong>auf</strong> die Hälfte seines füihern Werts. Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich<br />
notwendiger Arbeit o<strong>der</strong> die zur Herstellung eines Gebrauchsw-erts gesellschaftlich notwendige<br />
l,rbeitszeit, welche seine Wertgröße bestimmt. Die einzelne Ware gilt hier überhaupt als<br />
Durchschnittsexemplar ihrer Art.Waren, worin gleich große Arbeitsquanta enthalten sind o<strong>der</strong><br />
die in <strong>der</strong>selben Arbeitszeit hergestellt wer<strong>den</strong> können, haben daher dieselbe WertgrÖße. Der<br />
Vv'ert einer Ware verhält sich zum Wert je<strong>der</strong> andren Ware wie die zur Produktion <strong>der</strong> einen<br />
notwendige Arbeitszeit zu <strong>der</strong> fur die Produktion <strong>der</strong> andren notwendigen Ateitszeit' "Als<br />
!!'erte sind alle Waren nur bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit." (MEW 23,53 | 54)<br />
Die Wertgröße <strong>der</strong> Ware<br />
illenge cler für die produktion <strong>der</strong> Wmen <strong>auf</strong>gervendeten gleichen menschlichen Arbeit. die sich in ilmen als<br />
V/ertsubstanz r,'erkörPert<br />
= unter <strong>den</strong>en die Masse einer bestimmten Warenart wird<br />
ffinichtdurchdasQuantumwirklichinihrvergegenständ|ichter,<br />
son<strong>der</strong>n durch das Quantum <strong>der</strong> zu ihrer Produktion notwendigen lebendigen Arbeit<br />
bestimmt".<br />
(MEW 8d.23, S.55e)<br />
*<br />
= die erfor<strong>der</strong>lich ist, um irgendeinen Gebrauchswert unter <strong>den</strong> jeweiligen normalen<br />
gesellschaftlichen Produktionsbedingungen und durchschnittlichem Geschick sowie<br />
durchschnittlicher I ntensität hezustellen<br />
Gruppen von<br />
Warenproduzenten<br />
tl<br />
ill<br />
I<br />
I<br />
It<br />
ilt<br />
Gesellschaftlich normale Produktionsbedingungen<br />
Aufwendungen an<br />
Arbeitszeit für die<br />
Produktion einerWare A<br />
(Stun<strong>den</strong>)<br />
b<br />
6<br />
10<br />
6<br />
8<br />
10<br />
Bei<br />
Stückzahlen <strong>der</strong><br />
Ware A, die von<br />
je<strong>der</strong> einzelnen<br />
Gruppe <strong>der</strong><br />
Warenproduzenten<br />
<strong>auf</strong><strong>den</strong><br />
Markt gebracht<br />
we<strong>den</strong><br />
100<br />
1 000<br />
200<br />
100<br />
200<br />
1000<br />
Die<br />
gesellschaftlic<br />
hnotwendige<br />
Arbeitszeit, die<br />
die Höhe des<br />
Wertes einer<br />
Ware A<br />
bestimmen<br />
(Stun<strong>den</strong>)<br />
B<br />
10<br />
14<br />
t#<br />
EF<br />
F<br />
l:=<br />
LF<br />
ts=<br />
[-<br />
E<br />
E:<br />
E<br />
ts;<br />
ts*<br />
E<br />
E=<br />
ts;<br />
E<br />
t<br />
E=<br />
^E:<br />
f=<br />
ts-<br />
ts-<br />
.f-<br />
.E:<br />
.E<br />
F<br />
E
.l c.<br />
IJ<br />
.-.--::a<br />
Der Unterschied zwischen einfacher und komplizierter Afb_eit<br />
,,Wie nun in <strong>der</strong> bürgerlichen Gesellschaft ein General o<strong>der</strong> Bankier eine große, <strong>der</strong><br />
Mensch schlechthin dagegen eine sehr schäbige Rolle spielt, so steht es auch hier mit<br />
<strong>der</strong> menschlichen Arbeit. Sie ist Verausgabung einfacher Arbeitskraft, die im<br />
Durchschnitt je<strong>der</strong> gewöhnliche Mensch, ohne beson<strong>der</strong>e Entwicklung, in seinem<br />
leiblichen Organismus besitzt. Die einfache Durchschnittsarbeif selbst wechselt zwar in<br />
verschiednen Län<strong>der</strong>n und Kulturepochen ihren Charakter, ist aber in einer vorhandnen<br />
Gesetlschaft gegeben. Kompliziertere Arbeit gilt nur als patenzie,rfe o<strong>der</strong> vielmehr<br />
multiplizie,rfe einfache Arbeit, so daß ein kleineres Quantum komplizierter Arbeit gleich<br />
einem größeren Quantum einfacher Arbeit. Daß diese Reduktion beständig vorgeht,<br />
zeigt die Erfahrung. Eine Ware mag das Produkt <strong>der</strong> kompliziertesten Arbeit sein, ihr<br />
Wert setzl sie dem Produkt einfacher Arbeit gleich und stellt daher selbst nur ein<br />
bestimmtes Quantum einfacher Arbeit dar. Die verschiednen Proportionen, worin<br />
verschiedne Arbeitsarten <strong>auf</strong> einfache Arbeit als ihre Maßeinheit reduziert sind, wer<strong>den</strong><br />
durch einen gesellschaftlichen Prozeß hinter dem Rücken <strong>der</strong> Produzenten festgesetzt<br />
und scheinen ihnen daher durch das Herkommen gegeben. Der Vereinfachung halber<br />
gilt uns im Folgen<strong>den</strong> jede Art Arbeitskraft unmittelbar für einfache Arbeitskraft, wodurch<br />
nur die Mühe <strong>der</strong> Reduktion erspart wird." (l,mw 8d.23.39)<br />
4. Die Entwicklunq <strong>der</strong>Wertformen<br />
lWaren kommen zur Welt in <strong>der</strong> Form von Gebrauchswerten o<strong>der</strong> Warenkörpern, als<br />
Eisen. Leinwand, Weizen usw. Es ist dies ihre hausbackene Naturalform. Sie sind<br />
jedoch nur Waren, weil Doppeltes, Gebrauchsgegenstände und zugleich Wertträger. Sie<br />
erscheinen daher nur als Waren o<strong>der</strong> besitzen nur die Form von Waren, sofern sie<br />
Doppelform besitzen, Naturalform und Wertform...<br />
Je<strong>der</strong>mann weiß, wenn er auch sonst nichts weiß, daß die Waren eine mit <strong>den</strong> bunten<br />
Naturalformen ihrer Gebrauchswerte höchst frappant kontrastierende, gemeinsame<br />
Wertform besitzen - die Geldform. Hier gilt es jedoch zu leisten, was von <strong>der</strong><br />
bürgerlichen Ökonomie nicht einmal versucht ward, nämlich die Genesis dieser<br />
Geldform nachzuweisen, also die Entwicklung des im Wertverhältnis <strong>der</strong> Waren<br />
enthaltenen Wertausdrucks von seiner einfachsten unscheinbarsten Gestalt bis zur<br />
blen<strong>den</strong><strong>den</strong> Geldform zu verfolgen. Damit verschwindet zugleich das Geldrätsel."<br />
(ww Bd.23.62)<br />
Die einfache Wertform<br />
"Das Geheimnis aller Wertform steckt in dieser einfachen Wertform. lhre Analyse<br />
bietet daher die eigentliche Schwierigkeit." (wwBd.23. 63)<br />
"Die einfache Wertform einer Ware ist enthalten in ihrem Wertverhältnis zu einer<br />
verschie<strong>den</strong>artigen Ware o<strong>der</strong> im Austauschverhältnis mit <strong>der</strong>selben. Der Wert <strong>der</strong><br />
Ware A wird qualitativ ausgedrückt durch die unmittelbare Austauschbarkeit <strong>der</strong> Ware B<br />
mit <strong>der</strong> Ware A. Er wird quantitativ ausgedrückt durch die Austauschbarkeit eines<br />
bestimmten Quantums <strong>der</strong> Ware B mit dem gegebenen Quantum <strong>der</strong> Ware A. In andren<br />
Worten: Der Wert einer Ware ist selbständig ausgedrückt durch seine Darstellung als<br />
"Tauschwert". Wenn es im Eingang dieses Kapitels in <strong>der</strong> gang und gäben Manier hieß:<br />
Die Ware ist Gebrauchswert und Tauschwert, so war dies, genau gesprochen, falsch.<br />
Die Ware ist Gebrauchswert o<strong>der</strong> Gebrauchsgegenstand und'Wert". Sie stellt sich dar<br />
als dies Doppelte, was sie ist, sobald ihr Wert eine eigne, von ihrer Naturalform<br />
verschie<strong>den</strong>e Erscheinungsform besitzt, die des Tauschwerts, und sie besitzt diese<br />
Form niemals isoliert betrachtet. son<strong>der</strong>n stets nur im Wert- o<strong>der</strong> Austauschverhältnis
16<br />
z:tJ einer zweiten, verschie<strong>den</strong>artigen Ware...<br />
Die nähere Betrachtung des im Wertverhältnis zur Ware B enthaltenen Wertausdrucks<br />
ch3r Ware A hat gezeigt, daß innerhalb desselben die Naturalform <strong>der</strong> Ware A nur als<br />
Gestalt von Gebrauchswert, die Naturalform <strong>der</strong> Ware B nur als Wertform o<strong>der</strong><br />
lVertgestalt gilt. Der in <strong>der</strong> Ware eingehüllte innere Gegensatz von Gebrauchswert und<br />
lVert wird also dargestellt durch einen äußeren Gegensatz, d.h. durch das Verhältnis<br />
zweier Waren, worin die eine Ware, <strong>der</strong>en Wert ausgedrückt wer<strong>den</strong> soll, unmittelbar<br />
nur als Gebrauchswert, die andre Ware hingegen, warin Wert ausgedrückt wird,<br />
unmittelbar nur als Tauschwert gilt. Die einfache Wertform einer Ware ist also die<br />
e,iinfache Erscheinungsform des in ihr enthaltenen Gegensatzes von Gebrauchswert und<br />
VVert.<br />
llas Arbeitsprodukt ist in allen gesellschaftlichen Zustän<strong>den</strong> Gebrauchsgegenstand,<br />
eiller nur eine historisch bestimmte Entwicklungsepoche, welche die in <strong>der</strong> Produktion<br />
e'ines Gebrauchsdings verausgabte Arbeit als seine "gegenständliche" Eigenschaft<br />
C;arstellt, d.h. als seinen Wert, verwandelt das Arbeitsprodukt in Ware. Es folgt daher,<br />
cliaß die einfache Wertform <strong>der</strong> Ware zugleich die einfache Warenform des<br />
Arbeitsprodukts ist, daß also auch die Entwicklung <strong>der</strong> Warenform mit <strong>der</strong> Entwicklung<br />
<strong>der</strong> Wertform zusammenfällt." (usw 8d.23, 74-76)<br />
llie entfaltete o<strong>der</strong> totale Wertform<br />
llDie Wert einer Ware, <strong>der</strong> Leinwand 2.8., ist jetzt ausgedrückt in zahllosen andren<br />
E:lementen <strong>der</strong> Warenwelt...<br />
In <strong>der</strong> ersten Form: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock kann es zufällige Tatsache sein, daß<br />
diese zweiWaren in einem bestimmten quantitativen Verhältnisse austauschbar sind. In<br />
<strong>der</strong> zweiten Form leuchtet dagegen sofort ein von <strong>der</strong> zufälligen Erscheinung wesentlich<br />
utrterschiedner und sie bestimmen<strong>der</strong> Hintergrund durch. Der Wert <strong>der</strong> Leinwand bleibt<br />
gleich groß, ob in Rock o<strong>der</strong> Kaffee o<strong>der</strong> Eisen etc. dargestellt, in zahllos verschiednen<br />
Waren, <strong>den</strong> verschie<strong>den</strong>sten Besitzern angehörig. Das zufällige Verhältnis zweier<br />
irtdividueller Warenbesitzer fällt fort Es wird offenbar, daß nicht <strong>der</strong> Austausch die<br />
V\/ertgröße <strong>der</strong> Ware, son<strong>der</strong>n umgekehrt die Wertgröße <strong>der</strong> Ware ihre<br />
F,ustauschverhältnisse reguliert." (tvßw 8d,.23, 77 | 78)<br />
,,Allgemeine Wertform<br />
1 Rock =<br />
10 Pfd Tee =<br />
40 Pfd. Kaffee = I<br />
1 Qrtr. Weizen = |zo ftt*n Leinwand<br />
2 Unzen Gold = '<br />
llz Tonne Eisen =<br />
xWareA=<br />
usw. Ware =<br />
Ve rä nde rte r C h ara kter de r We rtform<br />
Drie Waren stellen ihre Werte jetzt 1. einfach dar, weil in einer einzigen Ware und 2.<br />
einheitlich, weil in <strong>der</strong>selben Ware. lhre Wertform ist einfach und gemeinschaftlich,<br />
daher allgemein...<br />
tile neugewonnene Form drückt die Werte <strong>der</strong> Warenwelt in einer und <strong>der</strong>selben von ihr<br />
abgeson<strong>der</strong>ten Warenart aus, z.B. in Leinwand, und stellt so die Werte aller Waren dar<br />
durch ihre Gleichheit mit Leinwand. Als Leinwandgleiches ist <strong>der</strong> Wert jetzt nicht nur von<br />
ifrrem eignen Gebrauchswert unterschie<strong>den</strong>, son<strong>der</strong>n von allem Gebrauchswert, und<br />
ebendadurch als das ihr mit allen Waren Gemeinsame ausgedrückt. Erst diese Form<br />
--<br />
!--<br />
L--<br />
Lf;-<br />
r<br />
L-.<br />
F<br />
r<br />
F<br />
E-<br />
F<br />
l*:<br />
l#<br />
t:<br />
F<br />
G<br />
tr=<br />
lr<br />
E<br />
E=<br />
tr=<br />
E=<br />
E<br />
r-<br />
F<br />
F-:<br />
F<br />
F<br />
3-<br />
F- ü-<br />
tr-<br />
L-<br />
f--<br />
I_<br />
ÄF-<br />
L-<br />
b-<br />
e-
ezieht daher wirklich die Waren <strong>auf</strong>einan<strong>der</strong> als Werte o<strong>der</strong> läßt sie einan<strong>der</strong> als<br />
Tauschwerte erscheinen." (unw 8d.23. 79 /s0)<br />
17<br />
Übergang aus <strong>der</strong> allgemeinen Wertform zur Geldform<br />
.-.--"?<br />
,,Die allgemeine Aquivalentform ist eine Form des Werts überhaupt. Sie kann also je<strong>der</strong><br />
Ware zukommen. Andrerseits befindet sich eine Ware nur in allgemeiner Aquivalentform<br />
(Form lll), weil und sofern sie durch alle andren Waren als Aquivalent ausgeschlossen<br />
wird. Und erst vom Augenblick, wo diese Ausschließung sich endgültig <strong>auf</strong> eine<br />
spezifische Warenart beschränkt, hat die einheitliche relative Wertform <strong>der</strong> Warenwelt<br />
objektive Festigkeit und allgemein gesellschaft liche Gültigkeit gewonnen.<br />
Die spezifische Warenart nun, mit <strong>der</strong>en Naturalform die Aquivalentform gesellschaftlich<br />
verwächst, wird zur Geldware o<strong>der</strong> funktioniert als Geld. Es wird ihre spezifisch<br />
gesellschaftliche Funktion, und daher ihr gesellschaftliches Monopol, innerhalb <strong>der</strong><br />
Warenwelt die Rolle des allgemeinen Aquivalents zu spielen. Diesen bevorzugten Platz<br />
hat unter <strong>den</strong> Waren, welche in Forrn ll als besondre Aquivalente <strong>der</strong> Leinwand<br />
figurieren und in Form lll ihren reiativen Wert gemeinsam in Leinwand ausdrücken eine<br />
bestimmte Ware historisch erobert, das Gold. Setzen wir daher in Forrn lll die Ware<br />
Gold an die Stelle <strong>der</strong> Ware Leinwand. so erhalten wir:<br />
Geldform<br />
20 Ellen Leinwand =<br />
1 Rock =<br />
10 Pfd. Tee = .r<br />
it[:#:5: = )z<br />
'/z Tonne Eisen =<br />
xWareA=<br />
unzen coro<br />
Es fin<strong>den</strong> wesentliche Verän<strong>der</strong>ungen statt beim Übergang von Form I zu Form ll, von<br />
. Form ll zu Form lll. Dagegen unterscheidet Form lV sich durch nichts von Form lll,<br />
außer daß jetzt statt Leinwand Gold die allgemeine Aquivalentform besitzt. Gold bleibt in<br />
Form lV, was die Leinwand in Form lll war - allgemeines Aquivalent. Der Fortschritt<br />
besteht nur darin, daß die Form unmittelbarer allgemeiner Austauschbarkeit o<strong>der</strong> die<br />
allgemeine Aquivalentform jetzt durch gesellschaftliche Gewohnheit endgültig mit <strong>der</strong><br />
spezifischen Naturalform <strong>der</strong> Ware Gold verwachsen ist." (MEW 8d.23, S3 /84)<br />
Der oesel lschaft | iche Charakter <strong>der</strong> privat se le isteten Warenproduktion<br />
-<br />
,,Der Wertbegriff ist <strong>der</strong> allgemeinste und daher umfassendste Ausdruck <strong>der</strong><br />
ökonomischen Bedingungen <strong>der</strong> Warenproduktion" lm Wertbegriff ist daher <strong>der</strong> Keim<br />
enthalten, nicht nur des Geldes, son<strong>der</strong>n auch aller weiter entwickelten Formen <strong>der</strong><br />
Warenproduktion und des Warenaustausches. Darin, daß <strong>der</strong> Wert <strong>der</strong> Ausdruck <strong>der</strong> in<br />
<strong>den</strong> Privatprodukten enthaltnen gesellschaftlichen Arbeit ist, liegt schon die Möglichkeit<br />
<strong>der</strong> Differenz zwischen dieser und <strong>der</strong> im selben Produkt enthaltnen Privatarbeit.<br />
Produziert also ein Privatproduzent nach alter Weise weiter, während die<br />
gesellschaftliche Produktionsweise fortschreitet, so wird ihm diese Differenz empfindlich<br />
fühlbar. Dasselbe geschieht, sobald die Gesamtheit <strong>der</strong> Privatanfertiger einer
estimmten Warengattung ein <strong>den</strong> gesellschafti ichen Bedarf überschießendes Quantum<br />
d;rvon produziert. Darin, daß <strong>der</strong> Wert einer Ware nur in einer an<strong>der</strong>n Ware ausgedrückt<br />
und nur im Austausch gegen sie realisiert wer<strong>den</strong> kann, liegt die Möglichkeit, daß <strong>der</strong><br />
A,ustausch überhaupt nicht zustande kommt o<strong>der</strong> doch nicht <strong>den</strong> richtigen Wert<br />
realisiert." (Friedrich Engels, MEW, 20, Seite 289)<br />
"liirst innerhalb ihres Austauschs erhalten die Arbeitsprodukte eine von ihrer sinnlich<br />
velrschiednen Gebrauchsgegenständlichkeit getrennte, gesellschaftlich gleiche<br />
Vüertgegenständlichkeit. Diese Spaltung des Arbeitsprodukts in nützliches Ding und<br />
Vr,tertding betätigt sich nur praktisch, sobald <strong>der</strong> Austausch bereits hinreichende<br />
A,usdehnung und Wichtigkeit gewonnen hat, damit nützliche Dinge für <strong>den</strong> Austausch<br />
produziert wer<strong>den</strong>, <strong>der</strong> Wertcharakter <strong>der</strong> Sachen also schon bei ihrer Produktion selbst<br />
in Betracht kommt. Von diesem Augenbtick erhalten die Privatarbeiten <strong>der</strong> Produzenten<br />
teltsächlich einen doppelten gesellschaftlichen Charakter. Sie müssen einerseits als<br />
bestimmte nützliche Arbeiten ein bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen<br />
und sich so als Glie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gesamtarbeit, des naturwüchsigen Systems <strong>der</strong><br />
gesellschaftlichen Teilung <strong>der</strong> Arbeit, bewähren. Sie befriedigen andrerseits nur die<br />
nrannigfache Bedürfnisse ihrer eignen Produzenten, sofern jede besondre nützliche<br />
Privatarbeit mit je<strong>der</strong> andren nützlichen Art Privatarbeit austauschbar ist, also ihr<br />
gleichgilt. Die Gleichheit toio coelo verschiedner Arbeiten kann nur in einer<br />
Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit bestehn, in <strong>der</strong> Reduktion <strong>auf</strong> <strong>den</strong><br />
germeinsamen Charakter, <strong>den</strong> sie als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, abstrakt<br />
ffrenschliche Arbeit, besitzen." {turw 8d.23, az I aa)<br />
,,[]ter Fetischcharakter <strong>der</strong> Ware und sein Geheimnis<br />
tllas Oie Produktenaustauscher zunächst praktisch inieressiert, ist die Frage, wieviel<br />
fremde Produkte sie für das eigne Produkt erhalten, in welchen Proportionen sich also<br />
dur: Produkte austauschen. Sobald diese Proportionen zu einer gewissen<br />
gr+wohnheitsmäßigen Festigkeit herangereift sind, scheinen sie aus <strong>der</strong> Natur <strong>der</strong><br />
Arbeitsprodukte zu entspringen, so daß z. B. eine Tonne Eisen und 2 Unzen Gold<br />
gleichwertig, wie ein Pfund Gold und ein Pfund Eisen trotz ihrer verschiednen<br />
pl'rysikalischen und chemischen Eigenschaften gleich schwer sind. In <strong>der</strong> Tat befestigt<br />
sich <strong>der</strong> Wertcharakter <strong>der</strong> Arbeitsprodukte erst durch ihre Betätigung als Wertgrößen.<br />
Die letzteren wechseln beständig, unabhängig vom Willen, Voruuissen und Tun <strong>der</strong><br />
Ailstauschen<strong>den</strong>. lhre eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer<br />
Bewegung von Sachen, unter <strong>der</strong>en Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Es<br />
br+darf vollständig entwickelter Warenproduktion, bevor aus <strong>der</strong> Erfahrung selbst die<br />
wissenschaftliche Einsicht herauswächst, daß die unabhängig voneinan<strong>der</strong> betriebenen,<br />
aber als naturwüchsige Glie<strong>der</strong> <strong>der</strong> gesellschaftlichen Teilung <strong>der</strong> Arbeit allseitig<br />
voneinan<strong>der</strong> abhängigen Privatarbeiten fortwährend <strong>auf</strong> ihr gesellschaftlieh<br />
prcportionelles Maß reduziert wer<strong>den</strong>, weil sich in <strong>den</strong> zufälligen und stets<br />
schwanken<strong>den</strong> Austauschverhältnissen ihrer Produkte die zu <strong>der</strong>en Produktion<br />
g{:rsellschaftlich notwendige Arbeitszeit als regelndes Naturgesetz gewaltsam<br />
durchsetzt, wie etwas das Gesetz <strong>der</strong> Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf<br />
zusammenpurzelt. Die Bestimmung <strong>der</strong> Wertgröße durch die Arbeitszeit ist daher ein<br />
urirter <strong>den</strong> erscheinen<strong>den</strong> Bewegungen <strong>der</strong> relativen Warenwerte verstecktes<br />
Geheimnis. Seine Entdeckung hebt <strong>den</strong> Schein <strong>der</strong> bloß zufälligen Bestimmung <strong>der</strong><br />
\Afertgrößen <strong>den</strong> Arbeitsprodukte <strong>auf</strong>, aber keineswegs ihre sachliche Form."<br />
(nmw 8d 23. Be)<br />
18<br />
F<br />
F<br />
E_<br />
F<br />
F<br />
E<br />
E<br />
EFEEFE<br />
b*<br />
E<br />
Lg<br />
b-<br />
ß-_-<br />
IF=<br />
l==<br />
l\-<<br />
l=-<br />
E<br />
L:*<br />
F--<br />
L-<br />
t=-<br />
t_-<br />
L--<br />
ß-€<br />
l=-<br />
F-J<br />
I--<br />
ß_-<br />
I!-<br />
ß_-<br />
l=-<br />
lrl-<br />
a-<br />
lF-<br />
ts-<br />
l--<br />
:
,,Der Austauschprozeß<br />
19<br />
,,Die Waren können nicht selbst zu Markte gehn und sich nicht selbst austauschen. Wir<br />
müssen uns also nach ihren Hütern umsehn, <strong>den</strong> Warenbesitzern. Die Waren sind<br />
Dinge und daher wi<strong>der</strong>standslos gegen <strong>den</strong> Menschen. Wenn sie nicht willig, kann er<br />
Gewalt brauchen, in andren Worten, sie nehmen. Um diese Dinge als Waren<br />
<strong>auf</strong>einan<strong>der</strong> zu beziehn, müssen die Warenhüter sich zueinan<strong>der</strong> als Personen<br />
verhalten, <strong>der</strong>en Willen in jenen Dingen haust, so daß <strong>der</strong> eine nur mit dem Willen des<br />
andren, also je<strong>der</strong> nur vermittelst eines, bei<strong>den</strong> gemeinsamen Willensakts sich die<br />
fremde Ware aneignet, indem er die eigne veräußert. Sie müssen sich daher<br />
wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen Form<br />
<strong>der</strong> Vertrag ist, ob nun legal entwickelt o<strong>der</strong> nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich<br />
das ökonomische Verhältnis wi<strong>der</strong>spiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- o<strong>der</strong><br />
Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die<br />
Personen existieren hier nur füreinan<strong>der</strong> als Repräsentanten von Ware und daher als<br />
Warenbesitzer. Wir wer<strong>den</strong> überhaupt im Fortgang <strong>der</strong> Entwicklung fin<strong>den</strong>, daß die<br />
ökonomischen Charaktermasken <strong>der</strong> Personen nur die Personifikationen <strong>der</strong><br />
ökonomischen Verhältnisse sind, als <strong>der</strong>en Träger sie sich gegenübertreten. (gg l 100)<br />
Seine Ware hat für ihn keinen unmittelbaren Gebrauchswert. Sonst führte er sie nicht zu<br />
Markt. Sie hat Gebrauchswert für andre. Für ihn hat sie unmittelbar nur <strong>den</strong><br />
Gebrauchswert, Träger von Tauschwert und so Tauschmittel zu sein. Darum will er sie<br />
veräußern für Ware, <strong>der</strong>en Gebrauchswert ihm Genüge tut. Alle Waren sind Nicht-<br />
Gebrauchswerte für ihre Besitzer, Gebrauchswerte für ihre Nicht-Besitzer. Sie müssen<br />
also allseitig die Hände wechseln. Aber dieser Händewechsel bildet ihren Austausch,<br />
und ihr Austausch bezieht sie als Werte <strong>auf</strong>einan<strong>der</strong> und realisiert sie als Werte. Die<br />
Waren müssen sich daher als Werte realisieren, bevor sie sich als Gebrauchswerte<br />
realisieren können.<br />
Andrerseits müssen sie sich als Gebrauchswerte bewähren, bevor sie sich als Werte<br />
realisieren können. Denn die <strong>auf</strong> sie verausgabte menschliche Arbeit zählt nur, soweit<br />
sie in einer für andre nützlichen Form verausgabt ist. Ob sie andren nützlich, ihr Produkt<br />
daher fremde Bedürfnisse befriedigt, kann aber nur ihr Austausch beweisen."<br />
(wwBd.23,1oo / 101)<br />
"ln ihrer Verlegenheit <strong>den</strong>ken unsre Warenbesitzer wie Faust. lm Anfang war die Tat.<br />
$ie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben" Die Gesetze <strong>der</strong><br />
Warennatur betätigten sich im Naturinstinkt <strong>der</strong> Warenbesitzer. Sie können ihre Waren<br />
nur als Werte und darum nur als Waren <strong>auf</strong>einan<strong>der</strong> beziehen, indem sie dieselben<br />
gegensätzlich <strong>auf</strong> irgendeine andre Ware als allgemeines Aquivalent beziehen. Das<br />
ergab die Analyse <strong>der</strong> Ware, Aber nur die gesellschaftliche Tat kann eine bestimmte<br />
Ware zum allgemeinen Äquivalent machen. Die gesellschaftliche Aktion aller andren<br />
Waren schließt daher eine bestimmte Ware aus, worin sie allseitig ihre Werte darstellen.<br />
Dadurch wird die Naturalform Ware gesel{schaftlich gültige Aquivalentform. Allgemeines<br />
Aquivalent zu sein wird durch <strong>den</strong> gesellschaftlichen Prozeß zur spezifisch<br />
gesellschaftlichen Funktion <strong>der</strong> ausgeschlossenen Ware. $o wird sie - Geld.<br />
Der Geldkristall ist ein notwendiges Produkt des Austauschprozesses, worin<br />
verschie<strong>den</strong>artige Arbeitsprodukte einan<strong>der</strong> tatsächlich gleichgesetzt und daher<br />
tatsächlich in Waren verwandelt wer<strong>den</strong>. Die historische Ausweitung und Vertiefung des
20<br />
Au:;tausches entwickelt <strong>den</strong> in <strong>der</strong> Warennatur schlummern<strong>den</strong> Gegensatz von<br />
Gebrauchswert und Wert. Das Bedürfnis, diesen Gegensatz für <strong>den</strong> Verkehr äußerlich<br />
darzustellen, treibt zu einer selbständigen Form des Warenwerts und ruht und rastet<br />
nicht, bis sie endgültig erzielt ist durch die Verdopptung <strong>der</strong> Ware in Ware und Geld. In<br />
<strong>der</strong>:nselben Maße daher, worin sich die Verwandlung <strong>der</strong> Arbeitsprodukte in Waren,<br />
vollzieht sich die Verwandlung von Ware in Geld."( MEw 8d.23. 1ü t 1az)<br />
Die Funktionen,des GeldeE<br />
- Maß <strong>der</strong> Werte<br />
"lcl'r setze überall in dieser Schrift, <strong>der</strong> Vereinfachung halber, Gold als die Geldware<br />
vori:lus.<br />
Die erste Funktion des Goldes besteht darin, <strong>der</strong> tf'larenwelt das Material ihres<br />
Wertausdrucks zu liefern o<strong>der</strong> die Warenwerte als gleichnamige Größen, qualitativ<br />
gleiche und quantitativ vergleichbare, darzustellen. So funktioniert es als allgemeines<br />
Malii <strong>der</strong> Werte, und nur durch diese Funktion wird Gold, die spezifische<br />
Aquivalentware, zunächst Geld.<br />
Die Waren wer<strong>den</strong> nicht durch das Geld kommensurabel. Umgekehrt. Weil alle Waren<br />
als Werte vergegenständlichte menschliche Arbeit, daher an und für sich<br />
konrmensurabel sind, können sie ihre Werte gemeinschaftlich in <strong>der</strong>selben spezifischen<br />
Ware messen und diese dadurch in ihr gemeinschaftliches Wertmaß o<strong>der</strong> Geld<br />
venruandeln. Geld als Wertmaß ist notwendige Erscheinungsform des immanenten<br />
Wertmaßes <strong>der</strong> Waren, <strong>der</strong> Arbeit.<br />
Der Wertausdruck einer Ware in Gold - x Ware A = Y Geldware - ist ihre Geldform o<strong>der</strong><br />
ihr l:'reis. Eine vereinzelte Gleichung, wie 1 Tonne Eisen = 2Unzen Gold, genugt jetzt,<br />
urn <strong>den</strong> Eisenwert gesellschaftlich gültig darzustellen. Die Gleichung braucht nicht<br />
iänger in Reih und Glied mit <strong>den</strong> Wertgleichungen <strong>der</strong> andren Waren <strong>auf</strong>zumarschieren,<br />
weil die Aquivalentware, das Gold, bereits <strong>den</strong> Charakter von Geld besitzt. Die<br />
allgemeine relative Wertform <strong>der</strong> Waren hat daher jetzt wie<strong>der</strong> die Gestalt ihrer<br />
ursg:,rünglichen, einfachen o<strong>der</strong> einzelnen relativen Wertform. Andrerseits wird <strong>der</strong><br />
ent{ialtete relative Wertausdruck o<strong>der</strong> die endlose Reihe relativer Wertausdrucke zur<br />
spe:rifisch relativen Wertform <strong>der</strong> Geldware. Diese Reihe ist aber jetzt schon<br />
gesellschaftlich gegeben in <strong>den</strong> Warenpreisen. Man lese die Quotationen eines<br />
Preiskurants rückwärts und man findet die Wertgröße des Geldes in allen möglichen<br />
Wanen dargestellt. Geld hat dagegen keinen Preis. Um an dieser einheitlichen relativen<br />
Wertiorm <strong>der</strong> andren Waren teilzunehmen, müßte es <strong>auf</strong> sich selbst als sein eignes<br />
Aquivalent bezogen wer<strong>den</strong>.<br />
Der Preis o<strong>der</strong> die Geldform <strong>der</strong> Waren ist, wie ihre Wertform überhaupt, eine von ihrer<br />
hanrigreiflich reellen Körperforrn unterschiedne, also nur ideelle o<strong>der</strong> vorgestellte Form.<br />
Der Wert von Eisen, Leinwand, Weizen usw. existiert, obgleich unsichtbar, in diesen<br />
Dinl;1en selbst; er wird vorgestellt durch ihre Gleichheit mit Gold, eine Beziehung zum<br />
Gold, die sozusagen nur in ihren Köpfen spukt. Der Warenhuter muß daher seine Zunge<br />
in ifrren Kopf stecken o<strong>der</strong> ihnen Papierzettel umhängen, um ihre Preise <strong>der</strong> Außenwelt<br />
mitz:ruteilen. Da <strong>der</strong> Ausdruck <strong>der</strong> Warenwerte in Gold ideell ist, ist zu dieser Operation<br />
auch nur vorgestelltes o<strong>der</strong> ideelles Gold anwendbar. Je<strong>der</strong> Warenhüter weiß, daß er<br />
seine Waren noch lange nicht vergoldet, wenn er ihrem Wert die Form des Preises o<strong>der</strong><br />
vorgestellte Goldform gibt, und daß er kein Quentchen wirkliches Gold braucht, um<br />
Millir:nen Warenwerte in Gold zu schätzen. ln seiner Funktion des Wertmaßes dient das<br />
Gel,C daher - als nur vorgestetltes o<strong>der</strong> ideelles Geld. Dieser Umstand hat die tollsten<br />
Theorien veranlaßt. Obgleich nur vorgestelltes Geld zur Funktion des Wertmaßes dient,<br />
hängt <strong>der</strong> Preis ganz vom reellen Geldmaterial ab. Der Wert, d.h. das Quantum<br />
=<br />
_ L_<br />
F<br />
E--<br />
r-<br />
F<br />
E<br />
F<br />
E<br />
L<br />
L=-<br />
Lrts:<br />
E;<br />
E;<br />
E;<br />
tr<br />
E<br />
E<br />
E<br />
tr<br />
t-<br />
tr<br />
tr<br />
tr<br />
tr<br />
E<br />
tr<br />
tr<br />
E<br />
tr<br />
tr<br />
fr
21<br />
menschlicher Arbeit, das z.B. in einer Tonne Eisen enthalten ist, wird ausgedrückt in<br />
einem vorgestellten Quantum <strong>der</strong> Geldware, welches gleich viel Arbeit enthält. Je<br />
nachdem also Gold, Silber o<strong>der</strong> Kupfer zum Wertmaß dienen, erhält <strong>der</strong> Wert <strong>der</strong> Tonne<br />
Eisen ganz verschiedne Preisausdrucke o<strong>der</strong> wird in ganz verschiednen Quantitäten<br />
Gold, Silber o<strong>der</strong> Kupfer vorgestellt." (vrwnd.23.109 - 111)<br />
- Zirkulationsmittel<br />
"Der Austauschprozeß <strong>der</strong> Ware vollzieht sich also in folgendem Formwechsel:<br />
Ware-Geld-Ware.<br />
w- G -w.<br />
Nach ihrem stofflichen Inhalt ist die Bew-egung W - W, Austausch von Ware gegen Ware,<br />
Stoffuechsel <strong>der</strong> gesellschaftlichen Arbeit, in dessen Resultat <strong>der</strong> Prozeß selbst erlischt. (lugw<br />
Bd.z3, LzA)<br />
... Keiner kann verk<strong>auf</strong>en, ohne daß ein andrer k<strong>auf</strong>t. Aber keiner braucht unmittelbar zu k<strong>auf</strong>erl<br />
weil er selbst verk<strong>auf</strong>t hat. Die Zirkulation sprengt die zeitlichen, örtlichen und individuellen<br />
Schranken des Produktenaustausches ebendadurch, daß sie die hier vorhandne unmittelbare<br />
I<strong>den</strong>titat zwischen dem Austausch des eignen und dem Eintausch des frem<strong>den</strong> Arbeitsprodukts in<br />
<strong>den</strong> Gegensatz von Verk<strong>auf</strong> und K<strong>auf</strong> spaltet. Daß die selbständig einan<strong>der</strong> gegenübertreten<strong>den</strong><br />
Prozesse eine innere Einheit bil<strong>den</strong>, heißt ebensosehr, daß ihre innere Einheit sich in äußeren<br />
Gegensätzen bewegt. Geht die äußerliche Verselbständigung <strong>der</strong> innerlich Unselbständigen, weil<br />
einan<strong>der</strong> ergtinzen<strong>den</strong>, bis zu einem gewissen Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam<br />
geltend durch eine - Krise. Der <strong>der</strong> Ware immanente Gegensatz von Gebrauchswert und Wert,<br />
von Privatarbeit, die sich zugleich als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit darstellen muß, von<br />
besondrer konkreter Arbeit, die zugleich nur als abstrakl allgemeine Arbeit gilt, von<br />
Personifizierung <strong>der</strong> Sache und Versachlichung <strong>der</strong> Personen - dieser immanente Wi<strong>der</strong>spruch<br />
erhtilt in <strong>den</strong> Gegensätzen <strong>der</strong> Warenmetamorphose seine entwickelten Bewegungsformen. Diese<br />
Formen schließen daher die Möglichkeit, aber auch nur die Möglichkeit <strong>der</strong> Krisen ein. Die<br />
Endwicklung dieser Möglichkeit zur Wirklichkeit erfor<strong>der</strong>t einen ganzen Umkreis von<br />
Verhältnissen, die vom Standpunkt <strong>der</strong> einfachen Warenzirkulation noch gar nicht existieren.<br />
Als Vermittler <strong>der</strong> Warenzirkulation erhalt das Geld die Funktion des Zirkulationsmittels."<br />
{uew 8d.23, 127 / rzs)<br />
--t<br />
"Der umtaurdes Geldes zeigt u..tanoiei:i##lä:iff:oTlffi", desselben prozesses Die<br />
Ware steht stets <strong>auf</strong> Seite des Verkäufers, das Geld stets <strong>auf</strong> Seite des Käufers, als K<strong>auf</strong>mittel. Es<br />
funktioniert als K<strong>auf</strong>mittel, indem es <strong>den</strong> Preis <strong>der</strong> Ware realisiert. Indem es ihn realisiert,<br />
übertragt es die Ware aus <strong>der</strong> Hand des Verkäufers, während es sich gleichzeitig aus <strong>der</strong> Hand<br />
des Käufers in die des Verkäufers entfernt, um <strong>den</strong>selben Prozeß mit einer andren Ware zu<br />
wie<strong>der</strong>holen. Daß diese einseitige Form <strong>der</strong> Geldbewegung aus <strong>der</strong> doppelseitigen<br />
Formbewegung <strong>der</strong> Ware entspringt, ist verhüllt. Die Natur <strong>der</strong> Warenzirkulation selbst erzeugf.<br />
<strong>den</strong> entgegengesetzten Schein. Die erste Metamorphose <strong>der</strong> Ware ist nicht nur als Bewegung des<br />
Geldes, son<strong>der</strong>n als ihre eigne Bewegung sichtbar, aber ihre zlveite Metamorphose ist nur als<br />
Bewegung des Geldes sichtbar. In ihrer ersten Zirkulationshalfte wechselt die Ware <strong>den</strong> Platz mit<br />
dem Geld. Damit ftillt zugleich ihre Gebrauchsgestalt <strong>der</strong> Zirkulation heraus, in die Konsumtion.<br />
Ihre Wertgestalt o<strong>der</strong> Geldlarve tritt an ihre Stelle. Die zweite Zirkulationshäifte durchläuft sie<br />
nicht mehr in ihrer eignen Naturalhaut, son<strong>der</strong>n in ihrer Goldhaut. Die Kontinuität <strong>der</strong> Bewegung<br />
ftillt damit garu <strong>auf</strong> die Seite des Geldes und dieselbe Bewegung, die für die Ware zwei<br />
entgegengesetzte Prozesse einschließt, schließt als eigne Bewegung des Geldes stets <strong>den</strong>selben<br />
Prozeß ein, seinen Stellenwechsel mit stets andrer Ware. Das Resultat <strong>der</strong> Warenzirkulation.<br />
Ersatz von Ware durch andre Ware, erscheint nicht durch ihren eignen Formwechsel vermittelt,<br />
son<strong>der</strong>n durch die Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel, welches die an und für sich<br />
bewegungslosen Waren zirkuliert, sie aus <strong>der</strong> Hand, worjn sie Nicht-Gebrauchswerte" in die<br />
Hand überträgt, worin sie Gebrauchswerte, stets in entgegengesetzter Richtung zu seinem eignen
t-*<br />
22<br />
Larrf. Es entfernt die Waren beständig aus <strong>der</strong> Zirkulatianssphäre, indem es beständig an ihre<br />
Zirt:rilationsstelle tritt und sich damit von seinem eignen Ausgangspunkt entfernt. Obgleich daher<br />
die Geldbewegung nur Ausdruck <strong>der</strong> Warenzirkulation, erscheint umgekehrt die<br />
Warenzirkulation nur als Resultat <strong>der</strong> Geldbewegung. (l\GW 23, tzg- 130) (Preissumme <strong>der</strong><br />
Waren) / (Uml<strong>auf</strong>sanzahl gleichnamiger Geldstücke): Masse des als Zirkulationsmittel<br />
funlctionieren<strong>den</strong> Geldes. Dies Gesetz gilt allgemein.( MEW 23,133)<br />
F--<br />
L_<br />
b-<br />
b*<br />
Gm = Ps-K+{Z-Az<br />
n<br />
Gm = die ein für <strong>den</strong> gegebenen Zeitraum (2. B. 1 Jahr) für<br />
die Zirkulation erfor<strong>der</strong>liche Geldmenge.<br />
Ps = Preissumme <strong>der</strong> in dem gegebenen Zeitraum<br />
zirkulieren<strong>den</strong> Waren.<br />
K = Preissumme <strong>der</strong> in dem gegebenen Zeitraum<br />
<strong>auf</strong> Kredit verk<strong>auf</strong>ten Waren.<br />
tZ = Preissumme <strong>der</strong> in dem gegebenen Zeitraum<br />
fälligen Zahlungen für früher <strong>auf</strong> Kredit gek<strong>auf</strong>te Waren.<br />
Az = Preissumme <strong>der</strong>Waren, <strong>der</strong>en Zahlungen sich<br />
durch gegenseitige Lieferungen ausgleichen<br />
n = durchschnittliche Uml<strong>auf</strong>zahl gleichnamiger<br />
Geldstücke<br />
"\fy'enn <strong>der</strong> Gelduml<strong>auf</strong> selbst <strong>den</strong> Realgehalt vom Nominalgehalt <strong>der</strong> Münze scheidet,<br />
ihr Metalldasein von ihrem funktionellen Dasein, so enthält er die Möglichkeit latent, das<br />
Metallgeld in seiner Münzfunktion durch Marken aus andrem Material o<strong>der</strong> Symbole zu<br />
ersetzen...<br />
Der Metallgehalt <strong>der</strong> Silber- o<strong>der</strong> Kupfermarken ist willkürlich durch das Gesetz<br />
bestimmt. lm Uml<strong>auf</strong> verschleißen sie noch rascher als die Goldmünze. lhre<br />
Münzfunktion wird daher faktisch durchaus unabhängig von ihrem Gewicht, d.h. von<br />
alle,m Wert. Das Münzdasein des Goldes scheidet sich völlig von seiner Wertsubstanz.<br />
Relativ wertlose Dinge, Papierzettel, können also an seiner Statt als Münze<br />
funlltionieren. ln <strong>den</strong> metallischen Geldmarken ist <strong>der</strong> rein symbolische Charakter noch<br />
einigermaßen versteckt. lm Papiergeld tritt er augenscheinlich hervor." (140 - 141)<br />
- Geld als Schatz und Akkumulationsmittel<br />
,,Mir <strong>der</strong> ersten Entwicklung <strong>der</strong> Warenzirkuiation selbst entwickelt sich die<br />
Notwendigkeit und die Lei<strong>den</strong>schaft, das Produkt <strong>der</strong> ersten Metamorphose, die<br />
venrvandelte Gestalt <strong>der</strong> Ware o<strong>der</strong> ihre Goldpuppe festzuhalten. Ware wird verk<strong>auf</strong>t,<br />
nicht um Ware zu k<strong>auf</strong>en, son<strong>der</strong>n um Warenform durch Geldform zu ersetzen. Aus<br />
blolSer Vermittlung des Stoffwechsels wird dieser Formwechsel zum Selbstzweck. Die<br />
entiiußerte Gestalt <strong>der</strong> Ware wird verhin<strong>der</strong>t, als ihre absolut veräußerliche Gestalt o<strong>der</strong><br />
nur verschwin<strong>den</strong>de Geldform zu funktionieren. Das Geld versteinert damit zum Schatz.<br />
uncl <strong>der</strong> Warenverkäufer wird Schatzbil<strong>der</strong>.<br />
Gre,de in <strong>den</strong> Anfängen <strong>der</strong> Warenzirkulation verwandelt sich nur <strong>der</strong> überschuß an<br />
Gebrauchswerten in Geld. Gold und Silber wer<strong>den</strong> so von selbst zu gesellschaftlichen<br />
Aus;rlfllsgsn des Überflusses o<strong>der</strong> des Reichtums. (vnw 8d.23.144)<br />
F<br />
F<br />
F<br />
F<br />
E=<br />
F<br />
s--<br />
F-<br />
e=--<br />
F-<br />
t--<br />
h-<br />
F-<br />
L:<br />
F<br />
r-<br />
L-<br />
f--<br />
-<br />
i.-<br />
ts-<br />
!-<br />
L_<br />
t-<br />
=-<br />
Dierzur Zirkulation notwendige Geldmenge wird durch das Getduml<strong>auf</strong>gesetz bestimmt<br />
l---<br />
r:-<br />
s'-
23<br />
Der Trieb <strong>der</strong> Schatzbildung ist von Natur maßlos. Qulalitativ o<strong>der</strong> seiner Form nach<br />
ist das Geld schrankenlos, d.h. allgemeiner Repräsentant des stofflichen Reichtums,<br />
weil in jede Ware unmittelbar umsetzbar. Aber zugleich ist jede wirkliche Geldsumme<br />
quantitativ beschränkt, daher auch nur K<strong>auf</strong>mittel von Uesinränkter Wirkung. Dieser<br />
\M<strong>der</strong>spruch zwischen <strong>der</strong> quantitativen schranke und <strong>der</strong> qualitativen<br />
Schrankenlosigkeit des Geldes treibt <strong>den</strong> Schatzbildner stets zurück zur Sisyphusarbeit<br />
<strong>der</strong> Akkumulation. Es geht ihm wie dem Welteroberer, <strong>der</strong> mit jedem neuen Land nur<br />
eine neue Grenze erobert.<br />
Um das Gold als Geld festzuhalten und daher als Element <strong>der</strong> Schatzbildung, muß es<br />
verhin<strong>der</strong>t wer<strong>den</strong> zu zirkulieren o<strong>der</strong> als K<strong>auf</strong>mittel sich in Genußmittel <strong>auf</strong>zulösen. Der<br />
Schatzbildner opfert daher dem Goldfetisch seine Fleischeslust. Er macht Ernst mit dem<br />
Evangelium <strong>der</strong> Entsagung. Andrerseits kann er <strong>der</strong> Zirkulation nur in Gefd entziehn,<br />
was er ihr in Ware gibt. Je mehr er produziert, desto mehr kann er verk<strong>auf</strong>en.<br />
Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Geiz bil<strong>den</strong> daher seine.Kardinaltugen<strong>den</strong>, viel<br />
verk<strong>auf</strong>en, wenig k<strong>auf</strong>en, die summe seiner politischen ökonomie. -<br />
Neben <strong>der</strong> unmittelbaren Form des Schatzes läuft seine ästhetische Form, <strong>der</strong> Besitz<br />
von Gold- und Silberwaren. Er wächst mit dem Reichtum <strong>der</strong> bürgerlichen<br />
Gesellschaft"..<br />
Es bildet sich so teils ein stets ausgedehnterer Markt für Gold und Silber, unabhängig<br />
von ihren Geldfunktionen, teils eine latente Zufuhrquelle des Geldes, die namenlich in<br />
gesellschaftlichen Sturmperio<strong>den</strong> fließt.<br />
!19 Schatzbildung erfüllt verschiedne Funktionen in <strong>der</strong> ökonomie <strong>der</strong> metallischen<br />
Zirkulation. Die nächste Funktion entspringt aus <strong>den</strong> Uml<strong>auf</strong>sbedingungen <strong>der</strong> Goldo<strong>der</strong><br />
Silbermünze. Man hat gesehn, wie mit <strong>den</strong> beständigen Schwänküngen <strong>der</strong><br />
Warenzirkulation in Umfang, Preisen und Geschwindigkeit Oie Uml<strong>auf</strong>smasse des<br />
Geldes rastlos ebbt und flutet. Sie muß also <strong>der</strong> Kontäktion und Expansion fähig sein.<br />
Bald muß Geld als Münze attrahiert, bald Münze als Geld repelliert wer<strong>den</strong>. Damit die<br />
wirklich uml<strong>auf</strong>ende Geldmasse dem Sättigungsgrad <strong>der</strong> Zirkulationssphäre stets<br />
entspreche, muß das in einem Lande befindliche Gold- o<strong>der</strong> Silberguantum größer sein<br />
als das in Münzfunktion begriffene. Diese Bedingung wird erfüllt duich die Schatzform<br />
des Geldes. Die Schatzreservoirs dienen zugleiCh ais Abfuhr- und Zufuhrkanäfe des<br />
zirkulieren<strong>den</strong> Geldes, welches seine Uml<strong>auf</strong>skanäle daher nie überfüllt.,,<br />
(MEW 23, 147 | 148)<br />
In <strong>der</strong> bisher betrachteten unmittelbaren Form <strong>der</strong> Warenzirkulation war dieselbe<br />
Wertgröße stets doppelt vorhan<strong>den</strong>, Waren <strong>auf</strong> dem einen pol, Geld <strong>auf</strong> dem Gegenpol.<br />
Die Warenbesitzer traten daher nur in Kontakt als Repräsentanten wechselseitig<br />
vorhandner Aquivalente. Mit <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Waienzirkulation entwickeln süh<br />
jedoch Verhältnisse, wodurch die Veräußerung <strong>der</strong> Ware von <strong>der</strong> Realisierung ihres<br />
Preises zeitlich getrennt wird. Es genügt, die einfachsten dieser Verhältnisse hier<br />
anzudeuten. Die eine Warenart erheischt längere, die an<strong>der</strong>e kürzere Zeitdauer zu ihrer<br />
Produktion- Die Produktion verschiedner Waren ist an verschiedne Jahreszeiten<br />
geknüpft. Die eine Ware wird <strong>auf</strong> ihrem Marktplatz geboren, die andre muß zu<br />
entferntem Markt reisen. Der eine Warenbesiüer känn daher als Verkäufer <strong>auf</strong>treten,<br />
bevor <strong>der</strong> andre als Käufer. Bei steter Wie<strong>der</strong>kehr <strong>der</strong>selben Transaktionen unter<br />
<strong>den</strong>selben Personen regeln sich die Verk<strong>auf</strong>sbedingungen <strong>der</strong> Waren nach ihren<br />
Produktionsbedingungen. Andrerseits wird die Benutzung gewisser Warenarten, z.B.<br />
eines Hauses, für einen bestimmten Zeitraum verk<strong>auf</strong>t. Erst nach Abl<strong>auf</strong> des Termins<br />
hat <strong>der</strong> Käufer <strong>den</strong> Gebrauchswert <strong>der</strong> Ware wirklich erhalten. Er k<strong>auf</strong>t sie daher, bevor<br />
er sie zahlt. Der eine Warenbesitzer verk<strong>auf</strong>t vorhandne Ware, <strong>der</strong> andre k<strong>auf</strong>t als<br />
bloßer Repräsentant von Geld o<strong>der</strong> als Repräsentant von künftigem Gelde. Der
24<br />
Verkäufer wird Gläubiger, <strong>der</strong> Käufer Schuldner. Da die Metamorphose <strong>der</strong> Ware<br />
ocler die Entwicklung ihrer Wertform sich hier verän<strong>der</strong>t, erhält auch das Geld eine<br />
andre Funktion. Es wird Zahlungsmittel. (lvmwBd.23, 148 / 149)<br />
Kehren wir zur Sphäre <strong>der</strong> Warenzirkulation zurück. Die gleichzeitige Erscheinung <strong>der</strong><br />
Aquivalente Ware und Geld <strong>auf</strong> <strong>den</strong> bei<strong>den</strong> Polen des Verk<strong>auf</strong>sprozesses hat <strong>auf</strong>gehört.<br />
Das Geld funktioniert jetzt erstens als Wertmaß in <strong>der</strong> Preisbestimmung <strong>der</strong> verk<strong>auf</strong>ten<br />
V/are. lhr kontraktlich festgesetzter Preis mißt die Obligation des Käufers, d.h. die<br />
G,,:l6rr**e, die er an bestimmtem Zeittermin schuldet. Es funktioniert zweitens als<br />
icl,eelles K<strong>auf</strong>mittel. Obgleich es nur im Geldversprechen des Käufers existiert, bewirkt<br />
es; <strong>den</strong> Händewechsel <strong>der</strong> Ware. Erst am fälligen Zahlungstermin tritt das<br />
Zahlungsmittel wirklich in Zirkulation, d.h. geht aus <strong>der</strong> Hand des Käufers in die des<br />
Verkäufers über. Das Zirkulationsmittel verwandelte sich in Schatz, weil <strong>der</strong><br />
Zirkulationsprozeß mit <strong>der</strong> ersten Phase abbrach o<strong>der</strong> die verwandelte Gestalt <strong>der</strong> Ware<br />
<strong>der</strong>r Zirkulation entzogen wurde. Das Zahlungsmittel tritt in die Zirkulation hinein, aber<br />
nachdem die Ware bereits aus ihr ausgetreten ist. Das Geld vermittelt nicht mehr <strong>den</strong><br />
Prozeß. Es schließt ihn selbständig ab, als absolutes Dasein des Tauschwerts o<strong>der</strong><br />
allgemeine Ware. Der Verkäufer verwandelte Ware in Geld, um ein Bedürfnis durch das<br />
G,eld zu befriedigen, <strong>der</strong> Schatzbildner, um die Ware in Geldform zu präservieren, <strong>der</strong><br />
sr:'huldige Käufer, um zahlen zu können. Zahlt er nicht, so fin<strong>den</strong> Zwangsverkäufe seiner<br />
Habe statt. Die Wertgestalt <strong>der</strong> Ware, Geld, wird also jetzt zum Selbstzweck des<br />
Verk<strong>auf</strong>s durch eine <strong>den</strong> Verhältnissen des Zirkulationsprozesses selbst entspringende,<br />
g'irsellschaftliche Notwendigkeit. (unw 8d.23, 1 50)<br />
Betrachten wir nun die Gesamtsumme des in einem gegebnen Zeitabschnitt<br />
urnl<strong>auf</strong>en<strong>den</strong> Geldes, so ist sie, bei gegebner Uml<strong>auf</strong>sgeschwindigkeit <strong>der</strong> Zirkulationsurrd<br />
Zahlungsmittel, gleich <strong>der</strong> Summe <strong>der</strong> zu realisieren<strong>den</strong> Warenpreise plus <strong>der</strong><br />
Summe <strong>der</strong> fälligen Zahlungen, minus <strong>der</strong> sich ausgleichen<strong>den</strong> Zahlungen, minus<br />
errdlich <strong>der</strong> Anzahl Umläufe, worin dasselbe Geldstück abwechselnd bald als<br />
Zinkulations-, bald als Zahlungsmittel funktioniert. (MEW 23, 153)<br />
Die Entwicklung des Geldes als Zahlungsmittet ernötigt Geldakkumulationen für die<br />
Verfalltermine <strong>der</strong> geschuldeten Summen. Während die Schatzbildung als selbständige<br />
Bereicherungsform verschwindet mit dem Fortschritt <strong>der</strong> bürgerlichen Gesellschaft,<br />
wlichst sie umgekehrt mit demselben in <strong>der</strong> Form von Reservefonds <strong>der</strong><br />
Zahlungsmittel." (MEW 23, 156)<br />
- Weltgeld<br />
,,[tllit dem Austritt aus <strong>der</strong> innern Zirkulaiionssphäre streift das Geld die dort<br />
ar-rfschießen<strong>den</strong> Lokalformen von Maßstab <strong>der</strong> Preise, Münze, Scheidemünze und<br />
Vllertzeichen, wie<strong>der</strong> ab und fällt in die ursprüngliche Barrenform <strong>der</strong> edlen Metalle<br />
zurrück. lm Welthandel entfalten die Waren ihren Wert universell. lhre selbständige<br />
\Älertgestalt tritt ihnen daher hier auch gegenüber als Weltgeld. Erst <strong>auf</strong> dem Weltmarkt<br />
furrrktioniert das Geld in vollem Umfang als die Ware, <strong>der</strong>en Naturalform zugleich<br />
ur^rmittelbar gesellschaftliche Venvirklichungsform <strong>der</strong> menschlichen Arbeit in abstracto<br />
ist. Seine Daseinsweise wird seinem Begriff adäquat.<br />
Dils Weltgeld funktioniert als allgemeines Zahlungsmittel, allgemeines K<strong>auf</strong>mittel und<br />
al:solut gesellschaftliche Materiatur des Reichtums überhaupt (universal wealth). Die<br />
Fr-rnktion als Zahlungsmittel, zur Ausgleichung internationaler Bilanzen, herrscht vor.<br />
Daher das Losungswort des Merkantilsystems - Handelsbilanz! Zum internationalen<br />
K<strong>auf</strong>mittel dienen Gold und Silber wesentlich, sooft das herkömmliche Gleichgewicht<br />
dr:rs Stoffwechsels zwischen verschiednen Nationen plötzlich gestört wird. Endlich als<br />
ahisolut gesellschaftliche Materiatur des Reichtums, wo es sich we<strong>der</strong> um K<strong>auf</strong> noch<br />
Zrahlung handelt, son<strong>der</strong>n um Übertragung des Reichtums von einem Land zum andren,<br />
und wo diese Übertragung in Warenform entwe<strong>der</strong> durch die Konjunkturen des<br />
=--<br />
--<br />
=-<br />
L-<br />
r<br />
F<br />
=<br />
L<br />
F-<br />
-<br />
L-<br />
b<br />
ts.-<br />
F<br />
t-<br />
tr<br />
E<br />
E<br />
F<br />
l--<br />
F<br />
E:<br />
tr<br />
t:<br />
ts<br />
E<br />
ts<br />
E<br />
L-<br />
l=<br />
E<br />
E
25<br />
Warenmarkt o<strong>der</strong> <strong>den</strong> zu erfüllen<strong>den</strong> Zweck selbst ausgeschlossen wird.<br />
Wie für seine innere Zirkulation, braucht jedes Land für die Weltmarktszirkulation einen<br />
Reservefonds. Die Funktionen <strong>der</strong> Schätze entspringen also teils aus <strong>der</strong> Funktion des<br />
Geldes als inneres Zirkulations- und Zahlungsmittel, teils aus seiner Funktion als<br />
Weltgeld. In <strong>der</strong> letzteren Rolle ist stets die wirkliche Geldware, leibhaftes Gold und<br />
Silber, erheischt..." (N{Ew8d.23, 157 - 1s9)<br />
Die Funktionen des Geldes<br />
als<br />
Maß aller Werte:<br />
' Gesellscha$liche<br />
Verkörperung <strong>der</strong><br />
menschlichen Arbeit.<br />
" Verwandlung <strong>der</strong><br />
unsichtbaren<br />
Warenwerte in sichtbare<br />
Zirkulationsmittel:<br />
. VermittJung<br />
<strong>der</strong> Warenzirkulation.<br />
W-G-W<br />
(Verhältnis, Verkäufer-<br />
Käufer).<br />
Zahlungsmittel:<br />
.Arbeitslohn,<br />
nSteuern<br />
'Verhältnis Gläubiger -<br />
Schultner<br />
Schatzbildung<br />
*Mittel für die<br />
\kkumulation<br />
-Mittel fur die<br />
)pekulation<br />
Weltgeld<br />
"Banengold<br />
Preise.<br />
' Maßstab <strong>der</strong> Preise<br />
4. Warenproduktion und Wertqesetz<br />
Ausgehend von dieser Wertbestimmung durch die Arbeitszeit, entwickelte sich nun die ge{rze<br />
Warenproduktion und mit ihr die mannigfachen Beziehungen, in <strong>den</strong>en die verschiednen Seiten<br />
des Wertgesetzes sich geltend machen, wie sie im ersten Abschnitt des ersten Buchs des<br />
"Kapital" dargelegt sind; also namentlich die Bedingungen, unter <strong>den</strong>en allein die Arbeit<br />
r..,'ertbil<strong>den</strong>d ist. Und zwar sind dies Bedingungen, die sich durchsetzerl ohne <strong>den</strong> Beteiligten<br />
zum Bewußtsein zu kommen, und die selbst erst durch mühsame theoretische Untersuchung aus<br />
<strong>der</strong> alltaglichen Praxis abstrahiert wer<strong>den</strong> können, die also nach Art von Naturgesetzen wirken,<br />
wie dies Marx auch als notwendig aus <strong>der</strong> Natur <strong>der</strong> Warenproduktion folgend nachgewiesen<br />
hat. Der wichtigste und einschnei<strong>den</strong>dste Fortschritt war <strong>der</strong> thergang zum Metallgeld, <strong>der</strong> aber<br />
auch die Folge hattg daß nun die Wertbestimmung durch die Arbeitszeit nicht langer <strong>auf</strong> <strong>der</strong><br />
Oberfiäche des Warenaustausches sichtbar erschien. Das Geld wurde für die praktische<br />
Auffassung <strong>der</strong> entschei<strong>den</strong>de Wertmesser, und dies um so mehr, je mannigfaltiger die in <strong>den</strong><br />
Handel kommen<strong>den</strong> Waren wur<strong>den</strong>, je mehr sie entlegnen Län<strong>der</strong>n entstammten, je weniger also<br />
die zu ihrer Herstellung nötige Arbeitszeit sich kontrollieren ließ. Kam doch das Geld anfünglich<br />
selbst meist aus <strong>der</strong> Fremde, auch als Edelmetall im Lande gewonnen wurde, war <strong>der</strong> Bauer und<br />
Handwerker teils nicht imstande, die dar<strong>auf</strong> verwandte Arbeit annähernd abzuschätzen, teils war<br />
ihm selbst schon das Bewußtsein von <strong>der</strong> wertmessen<strong>den</strong> Eigenschaft <strong>der</strong> Arbeit durch die<br />
Gewohnheit des Geldrechnens ziemlich verdunkelt; das Geld begann in <strong>der</strong> Volksvorstellung <strong>den</strong><br />
absoluten Wert zu repräsentieren. Mit einem Wort: das Marxsche Wertgesetz gtlt allgemein,<br />
soweit überhaupt ökonomische Gesetze gelten, für die ganze Periode <strong>der</strong> einfachen<br />
Warenproduktion, also bis zur Zeh, wo diese durch <strong>den</strong> Eintritt <strong>der</strong> kapitalistischen<br />
Produktionsform eine Modifikation erführt. Bis dahin gravitieren die Preise nach <strong>den</strong> durch das<br />
Marxsche Gesetz bestimmten Werlen hin und oszillieren um diese Werte, so daß, je voller die<br />
einfache Warenproduktion zur Entfaltung kommt, desto mehr die Durchschnittspreise längerer,<br />
nicht durch äußre gewaltsame Störungen unterbrochener Perio<strong>den</strong> innerhalb <strong>der</strong><br />
Vernachlässigungsgrenzen mit <strong>den</strong> Werten zusammenfallen, Das Marxsche Wertgesetz hat also
26<br />
ölconomisch-allgemeine Gültigkeit für eine Zeitdauer, die vom Anfang des die Produlce in<br />
!\iaren verwandeln<strong>den</strong> Austausches bis ins fünfzehnte Jahrhun<strong>der</strong>t unsrer Zeitrechnung dauert.<br />
fler Warenaustausch aber datiert von einer Zeit, die vor aller geschriebnen Geschichte iieE, die<br />
in Agypten <strong>auf</strong> mindestens drittehalbtausend, vielleicht fünftausend, in Babylonien <strong>auf</strong><br />
viertausend, vielleicht sechstausend Jahre vor unsrer Zeitrechnung zurückführt; das Wertgesetz<br />
hat also geherrscht während einer Periode von fünf bis sieben Jahrtausen<strong>den</strong>."<br />
(',F. Engels, MEW 25, Seite 908 - 909)<br />
"Die letzteren (die Wertgroßen, d. kls) wechseln beständig, unabhangig vom Willen, Vorwissen<br />
und Tun <strong>der</strong> Austauschen<strong>den</strong>. Ihre eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form<br />
einer Bewegung von Sachen, unter <strong>der</strong>en Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Es<br />
bedarf vollständig entwickelter Warenproduktion, bevor aus <strong>der</strong>Erfahrung selbst die<br />
viissenschaftliche Einsicht herauswächst, daß die unabhängig voneinan<strong>der</strong> betriebenerl aber als<br />
naturwüchsige Glie<strong>der</strong> <strong>der</strong> geselischaftlichen Teilung <strong>der</strong> Arbeit allseitig voneinan<strong>der</strong><br />
abhängigen Privatarbeiten fortwälrend <strong>auf</strong> ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert<br />
vier<strong>den</strong>, weil sich in <strong>den</strong> zufrilligen und stets schwanken<strong>den</strong> Austauschverhältnissen ihrer<br />
Produlcte die zu <strong>der</strong>en Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als regelndes<br />
Ftraturgesetz gewaltsam durchsetzt, wie etwas das Gesetz <strong>der</strong> Schwere, wenn einem das Haus<br />
über dem Kopf zusammenpurzelt (tvmrv 8d.23, 89)<br />
il,war suchen sich die verschiednen Froduktionssphären beständig ins Gleichgewic.ht zu setzen,<br />
indem einerseits je<strong>der</strong> Warenproduzent einen Gebrauchswert produzieren, also ein besondres<br />
gesellschaftliches Bedurfnis betiiedigen muß, <strong>der</strong>Umfang dieser Bedürfnisse aber quantitativ<br />
verschie<strong>den</strong> ist und ein innres Band die verschiednen Bedürfnismassen zu einem naturnüchsigen<br />
$,r'stem verkettet; indem andrerseits das Wertgesetz <strong>der</strong> Waren bestimmt, wieviel die<br />
Ciesellschaft von ihrer ganzen disponiblen Arbeitszeit <strong>auf</strong> die Produktion je<strong>der</strong> besondren<br />
Vv'arenatt verausgaben kann. Aber diese beständige Ten<strong>den</strong>z <strong>der</strong> verschiednen<br />
Produktionssphären, sich ins Gleichgewicht zu setzen, betätigt sich nur als Reaktion gegen die<br />
berständige Aufhebung dieses Gleichge*,ichts. Die bei <strong>der</strong> Teilung <strong>der</strong> Arbeit im fnnern <strong>der</strong><br />
Vv'erkstatt a priori und planmäßig befolgte Regel wirkt bei <strong>der</strong> Teiiung <strong>der</strong> Arbeit im Innern <strong>der</strong><br />
Ciesellschaft nur a posteriori als innre, stumme, im Barometerwechsel <strong>der</strong> Marktpreise<br />
wahrnehmbare, die regellose Willlnir <strong>der</strong> Warenproduzenten überwältigende<br />
llaturnotwendi skeit. " frrmr,v Bd. 23. 3'? 6 / 3'7 7 \<br />
Das Wertgesetz und seine Funktionen<br />
,,[J,as Wertgesetz ist das ökonomische Gesetz <strong>der</strong> Warenprodulction, wonach <strong>der</strong> Wert einer Ware<br />
gemessen wird durch die in ihr enthältene gesellschaftlich notwendige Arbeit.'o<br />
(Frie<strong>der</strong>ich Engels MEW 8d.20. Seite 97/98)<br />
Ursachen für das Abweichen des Preises <strong>der</strong> Ware von ihrem Wert<br />
tt<br />
Warennachfrage<br />
Warenangebot<br />
T<br />
l<br />
F<br />
F_<br />
* L_<br />
F<br />
F_<br />
F<br />
FF<br />
E=<br />
ts=<br />
F<br />
E<br />
E<br />
E<br />
E<br />
F<br />
E=<br />
E<br />
E=<br />
E<br />
C=<br />
E=<br />
F<br />
EEE<br />
E:<br />
Nachfrage<br />
o<br />
=a<br />
Angebot<br />
Preis<br />
t<br />
Wert<br />
a<br />
o<br />
lm Maßstab <strong>der</strong> Gesellschaft ist die<br />
Wertsumme<br />
Preissumme aller Waren gleich <strong>der</strong><br />
aller Waren<br />
F<br />
FF
-.--:<br />
''-:7 27<br />
Funktionen des Wertgesetzes<br />
Es wirkt blind als Regulator <strong>der</strong> privaten Warenproduktion:<br />
* Der individuelle Arbeits<strong>auf</strong>wand wird <strong>auf</strong> <strong>den</strong> gesellschaftlich<br />
d u rchsch n ittl iche n Arbeits<strong>auf</strong>wa nd red uziert.<br />
* Spontane Entwicklung <strong>der</strong> Produktivkräfte und Erhöhung <strong>der</strong><br />
Produktivität <strong>der</strong> gesellschaftlichen Arbeit.<br />
* Soziale Differenzierung <strong>der</strong> Warenproduzenten.<br />
Ausqan spunkt für die kapitalistische Warenproduktion.