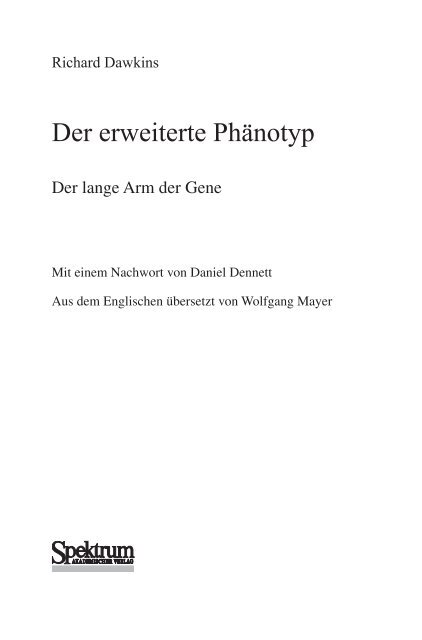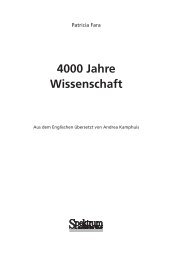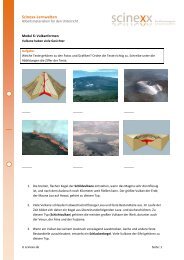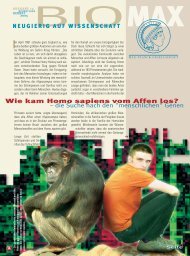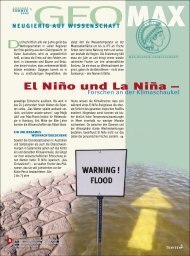Der erweiterte Phänotyp - Scinexx
Der erweiterte Phänotyp - Scinexx
Der erweiterte Phänotyp - Scinexx
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Richard Dawkins<br />
<strong>Der</strong> <strong>erweiterte</strong> <strong>Phänotyp</strong><br />
<strong>Der</strong> lange Arm der Gene<br />
Mit einem Nachwort von Daniel Dennett<br />
Aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Mayer
Titel der Originalausgabe:<br />
The Extended Phenotype – The Long Reach of the Gene<br />
Die englische Originalausgabe ist erschienen bei Oxford University Press Oxford New York<br />
© Richard Dawkins 1982, 1999<br />
Afterword: © Daniel Dennett 1999<br />
Aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Mayer<br />
Wichtiger Hinweis für den Benutzer<br />
<strong>Der</strong> Verlag, der Autor und der Übersetzer haben alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und<br />
akkurate Informationen in diesem Buch zu publizieren. <strong>Der</strong> Verlag übernimmt weder Garantie<br />
noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen,<br />
für deren Wirtschaftlichkeit oder fehlerfreie Funktion für einen bestimmten Zweck. <strong>Der</strong><br />
Verlag übernimmt keine Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren, Programme usw. frei<br />
von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen<br />
usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu<br />
der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung<br />
als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. <strong>Der</strong> Verlag hat<br />
sich bemüht, sämtliche Rechteinhaber von Abbildungen zu ermitteln. Sollte dem Verlag gegenüber<br />
dennoch der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche<br />
Honorar gezahlt.<br />
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.<br />
Springer ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media<br />
springer.de<br />
© Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg 2010<br />
Spektrum Akademischer Verlag ist ein Imprint von Springer<br />
10 11 12 13 14 5 4 3 2 1<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb<br />
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig<br />
und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Planung und Lektorat: Dr. Ulrich Moltmann, Dr. Christoph Iven<br />
Redaktion: Dr. Peter Wittmann<br />
Herstellung und Satz: Crest Premedia Solutions (P) Ltd, Pune, Maharashtra, India<br />
Umschlaggestaltung: wsp design Werbeagentur GmbH, Heidelberg<br />
Titelbilder: © Getty Images; © Sebastian Kaulitzki, Fotolia.com<br />
ISBN 978-3-8274-2706-9
Vorwort zur deutschen Ausgabe von<br />
<strong>Der</strong> <strong>erweiterte</strong> <strong>Phänotyp</strong><br />
<strong>Der</strong> <strong>erweiterte</strong> <strong>Phänotyp</strong> ist aus einem Vortrag entstanden, den ich ursprünglich in<br />
Deutschland gehalten habe. Deshalb ist es für mich eine besondere Freude, das Vorwort<br />
für die deutsche Ausgabe dieses Buches zu schreiben. Die International Ethological<br />
Conference, gegründet 1952 durch Konrad Lorenz und Nico Tinbergen, tritt<br />
alle zwei Jahre zusammen. 1977 war die Universität Bielefeld die Gastgeberin und<br />
ich empfand es als große Ehre, dass Professor Klaus Immelmann, der Organisator<br />
der Konferenz, mich zu einem Plenarvortrag einlud. Mein erstes Buch Das egoistische<br />
Gen war kurz davor erschienen und ich beschloss, meinen Vortrag zu nutzen,<br />
um den Hauptgedanken in eine unerwartete – aber durchaus logische – Richtung<br />
weiterzuentwickeln. Ich gab ihm die Überschrift: „Replikatorauslese und der Erweiterte<br />
<strong>Phänotyp</strong>“; er wurde in der Zeitschrift für Tierpsychologie veröffentlicht,<br />
die von Wolfgang Wickler, dem Nachfolger von Konrad Lorenz, herausgegeben<br />
wurde. Man kann dieses Buch als Erweiterung und Entwicklung dieses Aufsatzes<br />
betrachten.<br />
Auf dieses Buch bin ich aus mehreren Gründen besonders stolz. Mit Sicherheit<br />
kann ich damit den Anspruch erheben, einen eigenständigen Beitrag sowohl zur<br />
Philosophie als auch zur Biologie geleistet zu haben, besonders in den letzten vier<br />
Kapiteln, in denen der Gedanke des <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong>s entwickelt wird. Als ich<br />
1989 gebeten wurde, eine zweite Ausgabe des Egoistischen Gens herauszubringen,<br />
ließ ich den ursprünglichen Text unverändert, aber fügte zwei neue Kapitel hinzu,<br />
von denen das eine, „<strong>Der</strong> lange Arm der Gene“, eine Kurzfassung der letzten vier<br />
Kapitel des Erweiterten <strong>Phänotyp</strong>s waren. Ich glaube, diese Zusammenfassung war<br />
zu knapp, um meiner Idee gerecht zu werden. Das ist ein weiterer Grund für meine<br />
Freude darüber, dass die englische Originalausgabe von <strong>Der</strong> Erweiterte <strong>Phänotyp</strong><br />
weiterhin ohne Unterbrechung lieferbar ist (und sich weiterhin sehr gut verkauft),<br />
und dass ich die Gelegenheit habe, jetzt eine neue deutsche Ausgabe vorzustellen.<br />
Seit dem Jahr, als <strong>Der</strong> Erweiterte <strong>Phänotyp</strong> erschienen ist, hat es viele neue<br />
Entwicklungen gegeben. Mag sein, dass ich voreingenommen bin, aber ich glaube,<br />
dass diese die Hauptthese meines Buches eher gestärkt als angegriffen haben. So<br />
ist zum Beispiel das Kapitel über „Outlaws und Modifikatoren“ durch jede Menge<br />
Schriften über „egoistische genetische Elemente“ bestätigt worden, mit denen sich<br />
Austin Burt und Robert Trivers in ihrem 2008 erschienen Buch Genes in Conflict:<br />
v
vi<br />
Vorwort zur deutschen Ausgabe von <strong>Der</strong> Erweiterte <strong>Phänotyp</strong><br />
the biology of selfish genetic elements in hervorragender Weise auseinandergesetzt<br />
haben.<br />
<strong>Der</strong> Philosoph Kim Sterelny, Herausgeber von Biology and Philosophy , veranlasste<br />
eine spezielle Rückschau auf den <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong> . Dazu wurden drei<br />
Autoren aufgefordert, einen Rückblick auf die zwei Jahrzehnte zu geben, die seit<br />
der Publikation vergangen waren, und ich wurde eingeladen, darauf zu antworten.<br />
Als erster versuchte Kevin Alard mit „Extending the Extended Phenotype“ [Die Erweiterung<br />
des <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong>s] den Gedanken des <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong>s zu<br />
verallgemeinern, um „Niche Construction“ [Die Einrichtung seiner ökologischen<br />
Nische durch den Organismus selbst] in dem Sinn einzubeziehen, wie er und Odling-Smee<br />
ihn entwickelt hatten, in Übereinstimmung mit anderen, wie etwa R. C.<br />
Lewontin. Als zweiter nutzte J. Sott Turner in „Extended Phenotypes and Extended<br />
Organisms“ [Erweiterte <strong>Phänotyp</strong>en und Erweiterte Organismen] seine eigene<br />
Arbeit über Termiten, um seine Auffassung des „<strong>erweiterte</strong>n Organismus“ zu erläutern.<br />
In „From Replicators to Heritably Varying Phenotypic Traits: The Extended<br />
Phenotype Revisited” [Von Replikatoren zu erblich variierenden phänotypischen<br />
Eigenschaften: Eine Wiederbegegnung mit dem <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong>] betrachtete<br />
als dritte Eve Jablonka neue Entwicklungen in der Entwicklungsgenetik, darunter<br />
sogenannte „epigenetische“ Wirkungen und ihre Bedeutung für die „Replikator/<br />
Vehikel“-Unterscheidung, welche Kapitel 5 und 6 in diesem Buch beherrschen.<br />
Meine Antwort auf diese drei wohl durchdachten Beiträge unter dem Titel „The<br />
Extended Phenotype – But Not Too Extended“ [<strong>Der</strong> <strong>erweiterte</strong> <strong>Phänotyp</strong> – aber<br />
nicht zu stark erweitert] nahm ihre Kritik zur Kenntnis, aber ließ, wie ich glaube,<br />
die Kernthese des Buches unangetastet. Meiner Meinung nach habe ich namentlich<br />
den fundamentalen Unterschied zwischen dem <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong> und „niche<br />
construction“ deutlich gemacht. Meine Abhandlung kann unter folgendem Link gelesen<br />
werden:<br />
http://www.scribd.com/doc/351530/Richard-Dawkins-Extended-Phenotype .<br />
Meine Antwort habe ich abgeschlossen mit der fantastischen Vision von einem<br />
zukünftigen Luftschloss, der pompösen Eröffnung des „EPI, Extended Phenotypics<br />
Institute (also des Instituts für Erweiterte <strong>Phänotyp</strong>en) in einer unserer großen<br />
Universitätsstädte. Nach der formellen Eröffnung durch einen Nobelpreisträger<br />
(gekrönte Häupter würden als nicht gut genug erachtet) würde den beeindruckten<br />
Gästen das neue Gebäude vorgeführt. Es bestünde aus drei Flügeln, dem Zoological<br />
Artefact Museum (ZAM, Museum für zoologische Artefakte), dem Parasite Extended<br />
Genetics (PEG, Laboratorium für <strong>erweiterte</strong> Genetik der Parasiten) und dem<br />
Centre for Action at a Distance (Zentrum für Wirkung auf Distanz, CAD).“ Diese<br />
Bezeichnungen und ihre Abkürzungen sind nur für diejenigen verständlich, die die<br />
Kap. 11, 12 und 13 gelesen haben. Vielleicht können sie den Appetit des Lesers auf<br />
das Buch selbst steigern.<br />
In gewisser Weise stellten sie das Gerüst für eine faszinierende Konferenz dar,<br />
zu welcher der irische Biologe David Hughes im November 2008 unter der Schirmherrschaft<br />
der European Science Foundation an einen wunderschönen Ort bei Kopenhagen<br />
einlud. Hughes und seine Mitorganisatoren Jacobus Boomsma und Fréderic<br />
Thomas versammelten eine illustre Gruppe internationaler Wissenschaftler zu
Vorwort zur deutschen Ausgabe von <strong>Der</strong> Erweiterte <strong>Phänotyp</strong><br />
vii<br />
einer Diskussion über „The New Role of the Extended Phenotype in Evolutionary<br />
Biology“ [Die neue Rolle des <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong>s in der Evolutionsbiologie]. Sie<br />
leiteten die Konferenz mit folgenden Worten ein: „<strong>Der</strong> <strong>erweiterte</strong> <strong>Phänotyp</strong> ist ein<br />
bedeutendes Konzept in der Evolutionsbiologie. Unser ESF-Workshop wird eine<br />
hochangesehene Gruppe von Evolutionsbiologen aus verschiedenen Unterdisziplinen<br />
zusammenführen, um sich einigen neueren Herausforderungen zu stellen und<br />
über die neue Rolle des Erweiterten <strong>Phänotyp</strong>s in der Evolutionsbiologie zu debattieren.“<br />
Die Konferenz war höchst anregend und ein großer Erfolg, wie man das im<br />
Bericht der Ausgabe der Medical News Today von 22. Januar 2009 ( http://www.<br />
medicalnewstoday.com/articles/136278.php ) und im EMBO-Bericht von Philipp<br />
Hunter (2009) nachlesen kann. Wichtige Themen wurden verdeutlicht, zum Beispiel<br />
der Unterschied zwischen dem <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong> und „niche construction“<br />
(siehe oben). Einer der besten Aspekte der Konferenz war, dass sie Vorfreude auf<br />
künftige Forschungsarbeit weckte.<br />
Im ursprünglichen Vorwort für The Extended Phenotyp habe ich um Nachsicht<br />
dafür gebeten, dass dieses Buch eine Art Verteidigung darstellt – eher einen Versuch,<br />
unsere Denkweise zu verändern, als eine exakte Theorie, die überprüfbare<br />
Voraussagen machte. Vielleicht war es ein Beitrag ebenso zur Philosophie wie zur<br />
Biologie, ein Gesichtspunkt, den Daniel Dennett in seinem wunderbaren Nachwort<br />
zur Ausgabe der Neuauflage dieses Buches von 1999 bei Oxford University<br />
Press aufnahm. Nach der Kopenhagener Konferenz dachte ich, dass ich weniger<br />
um Nachsicht hätte bitten sollen, sondern lieber stärker auf meinen Anspruch hätte<br />
pochen sollen. Ich verließ Kopenhagen mit dem angenehmen und ermutigenden<br />
Gefühl, dass die Idee des <strong>erweiterte</strong>n <strong>Phänotyp</strong>s ein Spätzünder war, deren Zeit nun<br />
gekommen war.<br />
Burt, A & R. Trivers (2006). Genes in Conflict: the biology of selfish genetic elements. Harvard<br />
University Press, Cambridge, Mass.<br />
Dawkins, R. (1978) Replicator Selection and the Extended Phenotype. Zeitschrift für Tierpsychologie<br />
47, 61–76.<br />
Dawkins, R. (1994). Das egoistische Gen. Spektrum, Heidelberg.<br />
Hunter, P. (2009). Extended Phenotype Redux. Embo Reports, 10, 212–215. ( http://www.nature.<br />
com/embor/journal/v10/n3/full/embor200918.html )<br />
Sterelny, K. (2004, Ed). The Extended Phenotype at Twenty one: a Retrospective. Biology and<br />
Philosophy, 19, 313–396.
Inhalt<br />
1 Necker-Würfel und Büffel ........................................................................ 1<br />
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus ............... 11<br />
3 Beschränkungen der Perfektion .............................................................. 33<br />
Zeitliche Verzögerungen ............................................................................. 38<br />
Entwicklungsgeschichtliche Beschränkungen ............................................ 42<br />
Verfügbare genetische Variation .................................................................. 45<br />
Beschränkungen der Kosten und Materialien ............................................. 50<br />
Unvollkommenheiten auf einer Ebene als Folge der Selektion<br />
auf einer anderen Ebene .............................................................................. 54<br />
Fehler aufgrund von umweltbedingten Unwägbarkeiten oder<br />
„Böswilligkeit“ ............................................................................................ 57<br />
4 Wettrüsten und Manipulation ................................................................. 59<br />
5 <strong>Der</strong> aktive Keimbahn-Replikator ............................................................ 87<br />
6 Organismen, Gruppen und Meme: Replikatoren oder Vehikel? ......... 103<br />
7 Egoistische Wespe oder egoistische Strategie? ....................................... 125<br />
8 Outlaws und Modifikatoren ..................................................................... 141<br />
„Gene, die das System sprengen“ ............................................................... 144<br />
Modifikatoren .............................................................................................. 145<br />
Geschlechtsabhängige Outlaws ................................................................... 147<br />
Egoistisches Sperma .................................................................................... 150<br />
Grünbärte und Achselhöhlen ....................................................................... 152<br />
9 Egoistische DNA, springende Gene und ein lamarckistisches<br />
Schreckgespenst ........................................................................................ 167<br />
Egoistische DNA ......................................................................................... 167<br />
xv
xvi<br />
Inhalt<br />
Ein lamarckistisches Schreckgespenst ...................................................... 176<br />
Die Schwäche des Präformationismus ...................................................... 185<br />
10 Eine Quälerei in fünf Akten [An Agony in Five Fits] .......................... 191<br />
Fitness zum Ersten .................................................................................... 193<br />
Fitness zum Zweiten ................................................................................. 194<br />
Fitness zum Dritten ................................................................................... 195<br />
Fitness zum Vierten ................................................................................... 197<br />
Fitness zum Fünften .................................................................................. 199<br />
11 Die genetische Evolution tierischer Artefakte ...................................... 209<br />
12 Wirtsphänotypen von Parasitengenen .................................................. 223<br />
13 Wirkung auf Distanz ............................................................................... 243<br />
14 Die Wiederentdeckung des Organismus ............................................... 267<br />
Nachwort .......................................................................................................... 283<br />
Glossar .............................................................................................................. 289<br />
Kurzbiographien ............................................................................................. 305<br />
Literatur ............................................................................................................ 307<br />
Sachverzeichnis ............................................................................................... 323
Kapitel 2<br />
Genetischer Determinismus und<br />
genetischer Selektionismus<br />
Noch lange nach seinem Tod hielten sich zähe Gerüchte, dass Adolf Hitler munter<br />
und vergnügt in Südamerika oder in Dänemark gesehen worden sei, und jahrelang<br />
hat eine erstaunlich große Zahl von Leuten, die ihm keineswegs nahe standen, nur<br />
widerwillig zugegeben, dass er wirklich tot war (Trevor-Roper 1972). Im ersten<br />
Weltkrieg kam eine Geschichte weithin in Umlauf, dass hunderttausend russische<br />
Soldaten bei der Landung in Schottland beobachtet worden seien „mit Schnee an<br />
ihren Stiefeln“ – wahrscheinlich gerade, weil das Bild von diesem Schnee sich<br />
so lebendig einprägt (Taylor 1963). Auch in unserer Zeit sind uns solche Mythen<br />
schon sprichwörtlich bekannt, wie die von Computern, die beharrlich Rechnungen<br />
für Haushaltsstrom über eine Million Pfund verschicken (Evans 1979), oder wie<br />
die von gutbetuchten Wohlfahrtsschnorrern, die vor ihrer mit öffentlichen Geldern<br />
bezahlten Sozialwohnung zwei Luxusautos stehen haben. Es gibt da also einige<br />
Unwahrheiten oder Halbwahrheiten, die in uns offenbar den starken Drang erwecken,<br />
sie zu glauben und weiterzugeben, obwohl wir sie unerfreulich finden oder<br />
– vertrackterweise – manchmal auch, weil wir sie unerfreulich finden.<br />
Computer und elektronische „Chips“ tragen ungebührlich viel zu dieser Mythenbildung<br />
bei, vielleicht weil die Computertechnologie mit einer geradezu erschreckenden<br />
Geschwindigkeit fortschreitet. Ich kenne einen älteren Herrn, der von<br />
einem guten Gewährsmann weiß, dass „Chips“ menschliche Fähigkeiten in einem<br />
Ausmaß an sich reißen, dass sie nicht nur „Traktoren steuern“ sondern auch „Frauen<br />
befruchten“. Gene sind, wie ich zeigen werde, die Quelle einer Geschichte, welche<br />
die Mythen der Computer weit übertrifft. Man stelle sich das Ergebnis vor, wenn<br />
diese beiden mächtigen Mythen verbunden werden, der Gen-Mythos und der Computer-Mythos!<br />
Ich glaube, dass ich unbeabsichtigt in den Köpfen einiger weniger<br />
Leser meines vorigen Buches so eine unglückselige Verbindung hergestellt habe,<br />
und das Ergebnis war ein komisches Missverständnis. Glücklicherweise waren diese<br />
Missverständnisse nicht sehr weit verbreitet, aber ich will mich bemühen, so<br />
etwas in diesem Buch zu vermeiden, und das ist der Zweck dieses Kapitels. Ich<br />
werde den Mythos des genetischen Determinismus entlarven und erklären, warum<br />
man eine Sprache benutzen muss, die unglücklicherweise als genetischer Determinismus<br />
missverstanden werden kann.<br />
11
12<br />
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
Ein Rezensent von Wilsons (1978) Über die menschliche Natur schrieb: „…<br />
auch wenn er bei der Annahme geschlechtsspezifischer Gene für ‚Schürzenjägerei’<br />
nicht so weit geht wie Richard Dawkins ( The Selfish Gene …), haben für Wilson<br />
männliche Menschen einen genetisch bedingten Hang in Richtung Vielweiberei<br />
und weibliche zur Beständigkeit (schimpft nicht mit euren Partnern, meine Damen,<br />
wenn sie fremdgehen, sie können nichts dafür, sie sind genetisch programmiert).<br />
<strong>Der</strong> genetische Determinismus schleicht sich immer wieder durch die Hintertüre<br />
herein“ (Rose 1978). Die klare Folgerung des Rezensenten lautet, dass die besprochenen<br />
Autoren an das Bestehen von Genen glauben, welche Menschenmänner<br />
dazu zwingen, unheilbare Schürzenjäger zu sein, die deshalb nicht wegen ehelicher<br />
Untreue getadelt werden dürfen. <strong>Der</strong> Leser wird mit dem Eindruck zurückgelassen,<br />
dass diese Autoren Vorkämpfer in der „Anlage-oder-Umwelt“-Auseinandersetzung<br />
sind und, noch darüber hinaus, in der Wolle gefärbte Vertreter der Vererbungslehre<br />
mit Neigungen zum männlichen Chauvinismus.<br />
Tatsächlich war meine Aussage über schürzenjagende Männchen gar nicht auf<br />
Menschen gemünzt. Es war das einfache mathematische Modell eines nicht näher<br />
bestimmten Tieres (in meiner Vorstellung war es ein Vogel – aber das tut hier nichts<br />
zur Sache). Es war nicht ausdrücklich (siehe unten) ein genetisches Modell, und<br />
wenn es von Genen gehandelt hätte, dann eher von geschlechtsunabhängigen als<br />
von geschlechtsspezifischen Genen. Es war ein Modell von „Strategien“ im Sinne<br />
Maynard Smith’ (1974). Die „Schürzenjäger “-Strategie wurde nicht vorausgesetzt<br />
als die Art, wie Männer sich verhalten, sondern als eine von zwei hypothetischen<br />
Möglichkeiten, wobei die andere die Treuheits-Strategie war. Das einfache Modell<br />
sollte lediglich aufzeigen, unter welchen Bedingungen entweder die Schürzenjägerei<br />
von der natürlichen Auslese bevorzugt oder aber Treue belohnt würde. Es wurde<br />
nicht davon ausgegangen, dass Schürzenjägerei bei Männern wahrscheinlicher wäre<br />
als Zuverlässigkeit. Tatsächlich ergab sich nämlich aus dem dargestellten Simulationsdurchlauf<br />
eine gemischte männliche Population mit einem leichten Übergewicht<br />
für Treue (Dawkins 1976a, S. 165 siehe auch Schuster & Sigmund 1981). Rose irrt<br />
nicht nur in einem Punkt, in seinen Bemerkungen offenbart sich ein ganzes Bündel<br />
von Missverständnissen. Da gibt es ein wollüstiges Verlangen nach Missverstehen.<br />
Es trägt den Abdruck von schneebedeckten russischen Soldatenstiefeln, von kleinen<br />
schwarzen Mikrochips, welche die Rolle der Männer an sich reißen und unsere<br />
Traktorfahrerjobs stehlen. Es ist die Erscheinung eines gewaltigen Mythos, in diesem<br />
Fall des großen Gen-Mythos.<br />
<strong>Der</strong> Gen-Mythos ist zusammengefasst in Roses beiläufig erzähltem Scherz von<br />
den werten Damen, die ihre Männer nicht tadeln sollen, weil sie fremdgehen. Es ist<br />
der Mythos des genetischen Determinismus. Offenkundig ist für Rose genetischer<br />
Determinismus ein Zwang im philosophischen Sinn, unumstößlich und unvermeidbar.<br />
Er nimmt an, dass die Existenz eines Gens „für“ X bedeutet, dass X nicht vermieden<br />
werden kann. Gould (1978, S. 238) kritisiert den „genetischen Determinismus“<br />
mit den Worten: „Wenn wir zu dem programmiert sind, was wir sind, dann<br />
sind diese Züge unabwendbar. Im besten Fall könnten wir sie bändigen, aber wir<br />
können sie nicht ändern, weder durch Willen, noch durch Erziehung, noch durch<br />
Kultur.“
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
13<br />
Über die deterministische Sichtweise und ihre Tragweite für die moralische<br />
Verantwortlichkeit eines Individuums für sein Handeln streiten Philosophen und<br />
Theologen seit Jahrhunderten, und sie werden wohl auch noch in hundert Jahren<br />
darüber streiten. Ich vermute, dass sowohl Rose als auch Gould insofern Deterministen<br />
sind, als sie an eine physikalische, materialistische Grundlage für alle<br />
unsere Handlungen glauben. Ich teile diese Auffassung. Und wahrscheinlich stimmen<br />
wir drei auch darin überein, das menschliche Nervensystem als so komplex<br />
anzusehen, dass wir in der Praxis den Determinismus vergessen und uns so verhalten<br />
können, als ob wir einen freien Willen besäßen. Neuronen können Verstärker<br />
für grundlegend undeterminierte physikalische Vorgänge sein. Ich möchte<br />
darauf hinweisen, dass es – wie immer man zum Determinismus steht – keinerlei<br />
Unterschied macht, wenn man das Wörtchen „genetisch“ hinzufügt. Als überzeugter<br />
Determinist wird man glauben, dass alle Handlungen durch physikalische<br />
Ursachen in der Vergangenheit vorherbestimmt sind, und man kann die Ansicht<br />
vertreten oder auch nicht, dass man deshalb keine Verantwortung für seine sexuellen<br />
Treulosigkeiten trägt. Aber wie dem auch sei, welchen Unterschied würde<br />
es machen, wenn einige dieser physikalischen Ursachen genetisch sind? Warum<br />
hält man genetische Determinanten für noch schwerer vermeidbar als „umweltbedingte“?<br />
<strong>Der</strong> Glaube, dass Gene im Unterschied zu Umweltursachen gewissermaßen<br />
superdeterministisch wirken, ist ein kaum auszurottender Mythos, der zu einer<br />
ernsthaften psychischen Belastung führen kann. Ich war mir dessen nicht deutlich<br />
bewusst – bis ich an einem Treffen der American Association for the Advancement<br />
of Science 1978 teilnahm. Eine junge Frau fragte den Referenten, einen bekannten<br />
„Soziobiologen“, ob es irgendeinen Beweis für die Verschiedenheit der Geschlechter<br />
in der Psychologie des Menschen gäbe. Ich hörte die Antwort des Dozenten<br />
kaum, so erstaunt war ich über die Erregung, mit der die Frage gestellt wurde. Die<br />
Frau schien der Antwort größtes Gewicht beizulegen und war den Tränen nah. Nach<br />
einem Augenblick echter und unschuldiger Verblüffung kam mir schlagartig die<br />
Erleuchtung. Etwas oder jemand, aber bestimmt nicht der bedeutende Soziobiologe<br />
selbst, hatte sie glauben gemacht, dass genetische Bestimmung endgültig sei; sie<br />
glaubte ernsthaft daran, dass ein „Ja“ auf ihre Frage sie als weibliches Wesen zu<br />
einem Leben mit weiblichen Beschäftigungen verdammte, für immer eingesperrt<br />
in Küche und Kinderzimmer. Aber wenn sie, anders als die meisten von uns, eine<br />
Deterministin in diesem strengen calvinistischen Sinn wäre, müsste sie gleichermaßen<br />
aufgebracht sein, sei es, dass die Ursachen dafür genetisch, sei es dass sie<br />
„umweltbedingt“ sind.<br />
Was bedeutet es denn letztlich zu behaupten, dass irgendetwas determiniert würde<br />
durch irgendetwas? Philosophen machen, vielleicht mit Recht, viel Wind um den<br />
Begriff der Kausalität , aber für einen Biologen in der Praxis ist Kausalität eher ein<br />
einfaches statistisches Konzept. In der Realität lässt sich nicht beweisen, dass ein<br />
bestimmter beobachteter Vorgang C ein bestimmtes Ergebnis R verursacht hat, auch<br />
wenn ein kausaler Zusammenhang oft für wahrscheinlich gehalten wird. Was Biologen<br />
in der Praxis üblicherweise tun, ist statistisch nachzuweisen, dass Ereignisse<br />
der Klasse R zuverlässig Ereignissen der Klasse C folgen. Dazu benötigen sie eine
14<br />
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
größere Zahl miteinander verbundener Einzelfälle: Ein einmaliger Vorgang reicht<br />
dafür nicht aus.<br />
Selbst die Beobachtung, dass R-Ereignisse dazu neigen, C-Ereignissen innerhalb<br />
eines bestimmten Zeitraums zu folgen, liefert nur die Arbeitshypothese, dass R-Vorgänge<br />
durch C-Vorgänge verursacht werden. Die Hypothese gilt – statistisch – erst<br />
dann als bestätigt, wenn die C-Ereignisse nicht nur von einem Beobachter notiert<br />
werden, sondern wenn ein Experimentator sie auslöst und diese dann immer noch<br />
zuverlässig von R-Vorgängen gefolgt sind. Dabei ist es weder unbedingt nötig, dass<br />
jedem C ein R folgt, noch dass jedem R ein C vorausgeht (wer hätte sich noch nicht<br />
mit einem Argument von der Art herumschlagen müssen: „Rauchen kann keinen<br />
Lungenkrebs verursachen, weil ich einen Nichtraucher kannte, der daran gestorben<br />
ist, und einen starken Raucher, der noch im neunzigsten Lebensjahr topfit ist“?).<br />
Statistische Methoden helfen uns, bis zu einem bestimmbaren Grad von erwartbarer<br />
Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, ob die Ergebnisse, die wir erhalten, wirklich auf<br />
einen kausalen Zusammenhang hinweisen.<br />
Wenn es also zuträfe, dass der Besitz eines Y-Chromosoms einen ursächlichen<br />
Einfluss, etwa auf musikalische Begabung oder eine Vorliebe für das Stricken ausübt,<br />
was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, dass in einer bestimmten Population<br />
und in einer bestimmten Umgebung ein Beobachter, der das Geschlecht<br />
einer Person kennt, in der Lage wäre, eine statistisch genauere Vorhersage über die<br />
musikalischen Fähigkeiten dieser Person abzugeben als ein Beobachter, der nicht<br />
über das Geschlecht der Person Bescheid weiß. Die Betonung liegt auf dem Wort<br />
„statistisch“ – und lassen sie uns für eine gute Messung noch einfügen „wenn alle<br />
anderen Bedingungen gleich sind“. Würden dem Beobachter zusätzliche Informationen<br />
vorliegen, etwa über die Ausbildung oder die Erziehung einer Person, könnten<br />
diese ihn veranlassen, seine auf der Kenntnis des Geschlechts beruhende Voraussage<br />
zu überdenken oder gar ins Gegenteil zu verkehren. Wenn Frauen mit höherer<br />
statistischer Wahrscheinlichkeit als Männer Freude am Stricken haben, bedeutet das<br />
nicht, dass alle Frauen Freude am Stricken haben, und es heißt nicht einmal, dass<br />
das bei der Mehrheit der Frauen so ist.<br />
Das deckt sich mit der Ansicht, dass Frauen deshalb Freude am Stricken haben,<br />
weil die Gesellschaft sie zur Freude am Stricken erzieht. Wenn die Gesellschaft<br />
systematisch Kinder ohne Penisse zum Stricken und zum Spielen mit Puppen konditioniert<br />
und Kinder mit Penissen zum Spielen mit Waffen und Plastiksoldaten,<br />
sind alle sich daraus ergebenden geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den<br />
Vorlieben streng genommen genetisch determinierte Unterschiede: Sie sind gesellschaftlich<br />
bestimmt durch die Tatsache des Besitzes oder Nichtbesitzes eines Penis<br />
– und damit (sofern nicht chirurgisch oder mit Hormonen eingegriffen wird) durch<br />
Geschlechtschromosomen.<br />
Anhänger dieser Sichtweise dürften erwarten, dass die normalen Vorlieben leicht<br />
umzukehren sind, indem Jungen zum Spielen mit Puppen und Mädchen zum Spielen<br />
mit Waffen erzogen würden. Das wäre ein interessanter Versuch, denn es könnte<br />
sich herausstellen, dass Mädchen auch dann Puppen und Jungen noch immer Waffen<br />
bevorzugen. Wäre das so, könnte uns das einiges über die Beharrlichkeit eines<br />
genetischen Unterschiedes angesichts einer bestimmten Beeinflussung der Umge-
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
15<br />
bung verraten. Aber alle genetischen Ursachen müssen in Zusammenhang mit einer<br />
irgendwie gearteten Umwelt wirken. Macht sich ein genetischer Geschlechtsunterschied<br />
nur auf dem Weg über ein geschlechtsbezogenes Erziehungssystem bemerkbar,<br />
so handelt es sich dennoch um einen genetischen Unterschied. Tritt dieser aufgrund<br />
irgendeiner anderen Bedingung zutage und wird durch einen Eingriff in das<br />
Erziehungssystem nicht beeinflusst, handelt es sich im Prinzip genauso um einen<br />
genetischen Unterschied wie im vorigen Beispiel für einen erziehungsabhängigen<br />
Vorgang. Zweifellos könnte irgendein anderer Umweltfaktor gefunden werden, der<br />
ihn gestört hätte .<br />
Psychologische Eigenschaften des Menschen unterscheiden sich in fast ebenso<br />
vielen Aspekten, wie Psychologen messen können. Das ist in der Praxis schwierig<br />
(Kempthorne 1978), aber im Prinzip lassen sich diese Unterschiede auf eine ganze<br />
Reihe potentieller Kausalfaktoren zurückführen, zum Beispiel Alter, Größe, Bildungsniveau,<br />
Erziehung, Geschwisterzahl, Geburtsrangfolge, die Augenfarbe der<br />
Mutter oder das Geschick des Vaters als Hufschmied und natürlich auf Geschlechtschromosomen.<br />
Wir könnten auch Wechselwirkungen zwischen jeweils zwei dieser<br />
Faktoren oder zwischen allen Faktoren untersuchen. Für unsere Zwecke ist der entscheidende<br />
Punkt, dass die Unterschiedlichkeit, die wir erklären wollen, viele Ursachen<br />
hat, und dass diese Ursachen sich auf komplexe Art gegenseitig beeinflussen.<br />
Genetische Vielfalt ist ohne Frage eine bedeutende Ursache von phänotypischer<br />
Vielfalt der beobachteten Populationen, aber die Auswirkungen genetischer Vielfalt<br />
könnten durch andere Ursachen aufgehoben, verändert, verstärkt oder umgekehrt<br />
werden. Gene sind in der Lage, die Auswirkungen anderer Gene wie auch von Umwelteinflüssen<br />
abzuändern. Innere wie äußere Umwelteinflüsse könnten die Auswirkungen<br />
der Gene und die Auswirkungen anderer Umwelteinflüsse variieren.<br />
Kaum jemand zweifelt an der Veränderungskraft „umweltbedingter“ Wirkungen<br />
auf die menschliche Entwicklung. Wenn ein Kind schlechten Mathematikunterricht<br />
hatte, wird zugestanden, dass die daraus folgende Schwäche durch besonders guten<br />
Unterricht im Folgejahr ausgeglichen werden kann. Aber jede Andeutung, dass die<br />
Schwäche des Kindes einen genetischen Ursprung haben könnte, stößt auf vehemente<br />
Ablehnung: Wenn es in den Genen liegt, dann „steht es geschrieben“, ist es<br />
„determiniert“ und unabänderlich; man könnte gleich den Versuch aufgeben, dem<br />
Kind Rechnen beizubringen. Das ist natürlich kompletter Unsinn und geradezu<br />
bösartig. Genetische Ursachen und umweltbedingte Ursachen unterscheiden sich<br />
grundsätzlich nicht voneinander. Bestimmte Einflüsse, ob genetische oder umweltbedingte,<br />
sind nur schwer umkehrbar, andere dagegen lassen sich leicht umkehren.<br />
Oft kommt es nur darauf an, das richtige Mittel einzusetzen. Entscheidend ist:<br />
Es existiert kein allgemeiner Grund für die Annahme, dass genetische Einflüsse<br />
schwieriger umzukehren sind als umweltbedingte.<br />
Wie haben die Gene sich diesen unheimlichen götzengleichen Ruf eingehandelt?<br />
Warum machen wir nicht ähnlich viel Aufhebens um die Krippenerziehung oder<br />
den Konfirmationsunterricht? Warum schreiben wir den Genen viel größere Macht<br />
zu als dem Fernsehen, Nonnen oder Büchern? Schimpft eure Partner nicht, meine<br />
Damen, weil sie fremdgehen, es ist nicht ihre Schuld, sie sind durch Pornographie<br />
erregt worden! Die scheinbare Anmaßung der Jesuiten , „Gebt uns das Kind für die
16<br />
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
ersten sieben Lebensjahre und wir geben euch den Mann“, könnte einige Berechtigung<br />
haben. Die Auswirkungen von Erziehung oder anderen kulturellen Einflüssen<br />
mögen unter bestimmten Umständen genauso unveränderlich und unumkehrbar<br />
sein, wie von Genen und „den Sternen“ gemeinhin gedacht wird.<br />
Ich vermute, das Schreckgespenst der deterministischen Gene ist auf eine Verwechslung<br />
zurückzuführen, die auf der bekannten Tatsache beruht, dass erworbene<br />
Merkmale nicht vererbbar sind. Noch im 19. Jahrhundert war die Auffassung verbreitet,<br />
Erfahrungen und andere Errungenschaften im Leben eines Individuums seien<br />
in dessen Erbsubstanz eingeprägt und würden an die Nachkommen weitergegeben.<br />
Die Überwindung dieses Glaubens durch Weismanns Lehre von der Stetigkeit des<br />
Keim-Plasmas und seine molekulare Entsprechung, das „Zentrale Dogma“, ist eine<br />
der größten Errungenschaften der modernen Biologie. Wenn wir bis in die Tiefen der<br />
Weismannschen Lehre vordringen, scheint es darin wirklich etwas Götzenhaftes und<br />
Unerbittliches bei den Genen zu geben. Sie marschieren durch Generationen, indem<br />
sie Gestalt und Verhalten einer aufeinander folgenden Zahl sterblicher Organismen<br />
beeinflussen, ohne dabei – mit Ausnahme seltener und unbestimmter Mutationswirkungen<br />
– selbst durch die Umwelteinwirkungen, denen diese ausgesetzt sind, jemals<br />
beeinflusst zu werden. Die Gene in mir stammen von meinen vier Großeltern; sie<br />
sind durch meine Eltern auf mich übergegangen, und nichts, was meine Eltern erreicht,<br />
erworben, erlernt oder erfahren haben, hatte auch nur die geringste Auswirkung<br />
auf diese Gene bei ihrer Durchreise. Das könnte in der Tat etwas Unheimliches<br />
haben. Aber so unerbittlich und bestimmend die Gene bei ihrem Marsch durch die<br />
Generationen auch sein mögen, so sind ihre Auswirkungen auf die Körper, die sie<br />
weitertragen, doch keineswegs unausweichlich. Wenn ich reinerbig für ein Gen G<br />
bin, dann kann, Mutation außer Acht gelassen, mich nichts davon abhalten, dass ich<br />
G an alle meine Kinder weitergebe. So viel ist unabänderlich. Aber ob meine Kinder<br />
oder ich die phänotypischen Auswirkungen, die man normalerweise mit dem Besitz<br />
von G verbindet, aufweisen oder nicht, kann in hohem Maße davon abhängen, wie<br />
wir aufgewachsen sind, wie wir uns ernährt haben oder erzogen wurden und welche<br />
anderen Gene wir besitzen. Von den beiden Auswirkungen der Gene – die Herstellung<br />
von Kopien ihrer selbst und die Beeinflussung von Erscheinungsformen – ist also nur<br />
die erste unveränderlich, wenn man von der seltenen Möglichkeit einer Mutation absieht;<br />
die zweite Eigenschaft kann dagegen äußerst variabel sein und zu vielfältigen<br />
Anpassungen führen. Ich denke, dass der Mythos des genetischen Determinismus zu<br />
einem Teil auf der Verwechslung von Evolution und Entwicklung beruht.<br />
Aber es gibt noch einen weiteren Mythos, der die Dinge erschwert. Ich habe ihn<br />
am Anfang des Kapitels bereits erwähnt. <strong>Der</strong> Computer-Mythos hat sich fast genauso<br />
tief in das moderne Denken eingenistet wie der Gen-Mythos. Man beachte,<br />
dass beide zitierten Abschnitte das Wort „programmiert“ enthalten. Rose hat zwar<br />
die untreuen Männer nur scherzhaft vor Tadel in Schutz genommen, weil sie genetisch<br />
programmiert sind. Gould aber sagt, wenn wir darauf programmiert sind, zu<br />
sein, was wir sind, dann sind diese Veranlagungen unvermeidbar. Und tatsächlich<br />
verwenden wir üblicherweise das Wort „programmiert“, um etwas Mechanisches<br />
und damit das Gegenteil von Freiheit zum Handeln zu beschreiben. Computer und<br />
„Roboter “ haben den Ruf, stur zu sein, Anweisungen buchstabengetreu ausführen,<br />
auch wenn die Folgen offenkundig unsinnig sind. Warum würden sie sonst die Mil-
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
17<br />
lionen-Pfund-Rechnungen versenden, die irgendein Bekannter von irgendjemandem<br />
immer bekommt? Ich hatte weder an den mächtigen Computer-Mythos noch<br />
an den hartnäckigen Gen-Mythos gedacht, sonst hätte ich besser aufgepasst, als<br />
ich von Genen innerhalb „riesiger, schwerfälliger Roboter …“ schrieb und von uns<br />
selbst als „Überlebensmaschinen – Robotervehikeln, blind darauf programmiert,<br />
die egoistischen Moleküle zu bewahren, die als Gene bekannt sind“ (Dawkins<br />
1976a). Triumphierend, als Beleg für einen blindwütigen Determinismus , wurden<br />
diese Sätze immer wieder zitiert, oft aus zweiter und sogar dritter Hand (z. B. Nabi<br />
1981). Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich das Bild der Robotertechnik benutzt<br />
habe. Ich würde es ohne zu zögern wieder tun. Aber mir ist klar geworden,<br />
dass man es erläutern muss.<br />
Aus der Erfahrung von dreizehn Jahren, in denen ich in der Lehre im Zusammenhang<br />
mit der natürlichen Auslese von einer „Überlebensmaschine für egoistische<br />
Gene“ spreche, weiß ich, dass dieses Bild die Gefahr von Missverständnissen<br />
in sich birgt. Das Bild des intelligenten Gens, das berechnet, wie es sein eigenes<br />
Überleben am besten sichert (Hamilton 1972), ist kraftvoll und einleuchtend. Aber<br />
es kann leicht dazu verführen, den Genen einsichtsvolle Klugheit und „strategischen“<br />
Weitblick zuzuschreiben. Mindestens drei von zwölf Missverständnissen<br />
der Verwandtenselektion (Dawkins 1979a) sind auf diesen Irrtum zurückzuführen.<br />
Immer wieder haben Nichtbiologen versucht, eine Art Gruppenselektion vor mir<br />
zu rechtfertigen, indem sie den Genen Voraussicht unterstellen. „Die langfristigen<br />
Interessen eines Gens verlangen die durchgängige Existenz der Art; muss man deshalb<br />
nicht von Anpassungen ausgehen, die das Aussterben einer Art verhindern,<br />
selbst auf Kosten des kurzfristigen Fortpflanzungserfolgs eines Einzelnen?“ Weil<br />
ich solche Irrtümer ausschließen wollte, habe ich die Sprache der Automation und<br />
Robotertechnik gewählt und das Wort „blind“ benutzt, um auf die genetische Programmierung<br />
hinzuweisen. Aber natürlich sind es die Gene, die blind sind, und<br />
nicht die Lebewesen, welche durch sie programmiert werden. Nervensysteme können<br />
genauso wie von Menschen erbaute Computer hinreichend komplex sein, um<br />
Intelligenz und Weitblick an den Tag zu legen.<br />
Symons (1979) macht den Computer-Mythos deutlich:<br />
Ich möchte darauf hinweisen, dass Dawkins’ Unterstellung – durch die Verwendung<br />
von Wörtern wie „Roboter“ und „blind“ – dass die Evolutionstheorie zum<br />
Determinismus neigt, absolut unbegründet ist … Ein Roboter ist ein geistloser<br />
Automat. Vielleicht sind einige Tiere Roboter (es gibt keine Möglichkeit, das<br />
herauszufinden); wie auch immer, Dawkins bezieht sich nicht auf einige Tiere,<br />
sondern auf alle Tiere und in diesem Fall speziell auf Menschen. Nun kann man<br />
mit Stebbing „Roboter“ als Gegensatz zum „denkenden Wesen“ betrachten oder<br />
den Begriff im übertragenen Sinn benutzen, um eine Person zu bezeichnen,<br />
die mechanisch zu handeln scheint. Aber es gibt keine im allgemeinen Sprachgebrauch<br />
begründete Bedeutung des Begriffs „Roboter“, aufgrund derer die<br />
Behauptung sinnvoll wäre, dass alle Lebewesen Roboter sind (S. 41).<br />
Worauf es Stebbing in dem von Symons zitierten Abschnitt ankam, ist die vernünftige<br />
Überlegung, dass X ein unnützes Wort ist, wenn es nicht einige Dinge gibt,<br />
die nicht X sind. Wenn alles ein Roboter ist, dann hat das Wort Roboter keinerlei
18<br />
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
Aussagekraft. Aber mit dem Wort Roboter verbinden sich auch andere Assoziationen,<br />
und starre Unveränderlichkeit war nicht die Assoziation, an welche ich gedacht<br />
hatte. Ein Roboter ist eine programmierte Maschine, und ein wesentlicher Aspekt<br />
von Programmierung ist, dass sie bereits vor der eigentlichen Ausführung des Verhaltens<br />
stattgefunden hat und unabhängig von diesem abgeschlossen wurde. Ein<br />
Computer ist programmiert, um ein Verhalten wie die Berechnung einer Quadratwurzel<br />
oder ein Schachspiel auszuführen. Die Beziehung zwischen einem Schach<br />
spielenden Computer und der Person, die ihn programmiert hat, ist nicht eindeutig<br />
und damit offen für Missverständnisse. Man könnte denken, dass der Programmierer<br />
den Verlauf des Spiels beobachtet und die Anweisungen Zug für Zug in den<br />
Computer eingibt. Tatsächlich ist aber die Programmierung in jedem Fall abgeschlossen,<br />
bevor das Spiel beginnt. <strong>Der</strong> Programmierer bemüht sich, Zusammenhänge<br />
vorherzusehen und baut bedingte Anweisungen von großer Komplexität ein.<br />
Aber wenn das Spiel einmal begonnen hat, darf er nicht mehr eingreifen und dem<br />
Computer keine neuen Hinweise geben. Würde er während des Spiels eingreifen,<br />
wäre er kein Programmierer, sondern Mitspieler und sein Eingriff würde beim Wettkampf<br />
für unzulässig erklärt. In der von Symons kritisierten Arbeit habe ich den<br />
Vergleich mit Computerschach benutzt, um zu erläutern, dass Gene das Verhalten<br />
nicht in dem Sinn beeinflussen, dass sie in dessen Ausführung eingreifen. Sie kontrollieren<br />
das Verhalten nur in dem Sinn, wie man Maschinen vor dessen Ausführung<br />
programmiert. Diese Assoziation, und nicht die mit geistloser Sturheit, wollte ich<br />
mit dem Begriff Roboter wecken.<br />
Was die Assoziation mit geistloser Sturheit betrifft, so hätte sie vielleicht noch<br />
eine gewisse Berechtigung zu der Zeit gehabt, als das Steuerungssystem einer<br />
Schiffsmaschine mit Nocken und Wellen den Höhepunkt der Automation darstellte<br />
und Kipling „McAndrew’s Hymn“ schrieb:<br />
Vom Kupplungsflansch zur Spindelführung sehe ich Deine Hand, o Gott –<br />
Vorherbestimmung im Zuge dieser Pleuelstange.<br />
John Calvin könnte das Gleiche geschmiedet haben –<br />
Aber das war 1893, als Dampfmaschinen modernste Technologie waren. Heute leben<br />
wir im Zeitalter der Elektronik. Wenn man Maschinen jemals mit der Vorstellung<br />
von eiserner Starrheit in Verbindung gebracht hat – und ich gebe zu, dass das<br />
so war – ist es jetzt wirklich an der Zeit, sich von dieser Vorstellung zu verabschieden.<br />
Es gibt heute Computerprogramme, die Schach auf dem Niveau internationaler<br />
Großmeister spielen (Levy 1978), die in korrektem Englisch von hoher Komplexität<br />
Gespräche führen und argumentieren (Winograd 1972), die auf elegante und<br />
ästhetisch befriedigende Art neue Beweise mathematischer Theoreme ermöglichen<br />
(Hofstadter 1979), die Musik komponieren und Krankheiten diagnostizieren; und<br />
es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich das rasante Tempo, mit dem auf diesem<br />
Gebiet Fortschritte erreicht werden, verlangsamen könnte (Evans 1979). Auf dem<br />
Gebiet der fortgeschrittenen Programmierung, bekannt als Künstliche Intelligenz,<br />
herrschen Bewegung und Zuversicht (Boden 1977). Von denjenigen, die sich hier<br />
auskennen, würde kaum einer dagegen wetten, dass innerhalb der nächsten zehn<br />
Jahre ein Computerprogramm die stärksten Großmeister im Schach besiegt. Dominiert<br />
heute in der öffentlichen Meinung noch das Bild eines schwachsinnigen, un-
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
19<br />
beirrbaren Zombies mit ruckenden Gliedern, wird die Bezeichnung Roboter eines<br />
Tages zu einem Inbegriff von Flexibilität und rascher Auffassungsgabe werden.<br />
Unglücklicherweise habe ich den zitierten Satz wohl etwas voreilig formuliert.<br />
Ich habe ihn unmittelbar nach dem Besuch einer aufschlussreichen und anregenden<br />
Tagung über die Programmierung künstlicher Intelligenz aufgeschrieben und<br />
vergaß in meiner ehrlichen und unschuldigen Begeisterung, dass man Roboter gemeinhin<br />
für stupide Idioten hält. Ich muss außerdem für die Tatsache um Nachsicht<br />
bitten, dass auf dem Einband der deutschen Ausgabe des Egoistischen Gens das<br />
Bild einer menschlichen Puppe dargestellt ist, die an den Enden von Fäden hängt,<br />
die von dem Wort „Gen“ ausgehen, und dass auf dem Umschlag der französischen<br />
Ausgabe kleine Männer mit Melonenhüten abgebildet sind, in deren Rücken ein<br />
Uhrwerkschlüssel steckt – beides ist ohne mein Wissen entstanden. Ich habe Dias<br />
beider Titelbilder zusammengestellt, um zu veranschaulichen, was ich nicht ausdrücken<br />
wollte.<br />
Symons hat mit vollem Recht etwas kritisiert, wovon er dachte, ich hätte es behauptet,<br />
dabei habe ich etwas ganz anderes darstellen wollen (Ridley 1980a). Zweifellos<br />
kann man mir eine Teilschuld an dem Missverständnis geben, aber wir sollten<br />
jetzt vorgefasste Meinungen beiseite lassen („… die meisten Leute haben nicht die<br />
geringste Ahnung von Computern“ – Weizenbaum 1976 S. 9) und uns stattdessen<br />
auf einige faszinierende neuere Bücher über Robotik und Computerintelligenz stürzen<br />
(z. B. Boden 1977; Evans 1979; Hofstadter 1979).<br />
Abermals könnten sich Philosophen über die letztendliche Beschränktheit von<br />
Computern streiten, die dazu programmiert wurden, sich in künstlich intelligenter<br />
Weise zu verhalten. Wenn wir uns auf dieses Niveau der Philosophie begeben,<br />
könnten viele der vorgebrachten Argumente auch auf die menschliche Intelligenz<br />
zutreffen (Turing 1950). Sie würden fragen: Was ist denn ein Gehirn anderes als<br />
ein Computer, und ist Erziehung nicht eine Art von Programmierung? Es ist sehr<br />
schwierig, eine nicht-übernatürliche Erklärung des menschlichen Gehirns, menschlicher<br />
Gefühle und scheinbar freien Willens zu geben, ohne das Gehirn in gewisser<br />
Weise als eine Entsprechung zu einer programmierten, sich selbst steuernden Maschine<br />
zu betrachten. <strong>Der</strong> Astronom Sir Fred Hoyle (1964) drückt sehr lebendig aus,<br />
was, wie mir scheint, jeder Evolutionist über Nervensysteme denken muss:<br />
Wenn ich [auf die Evolution] zurückblicke, bin ich von dem Eindruck überwältigt,<br />
wie die Chemie nach und nach der Elektronik Platz gemacht hat. Es ist nicht unangemessen,<br />
die ersten lebenden Geschöpfe als chemisch geprägt zu beschreiben.<br />
Während elektrochemische Prozesse für Pflanzen wichtig sind, kommt Elektronik<br />
im Sinne der Datenverarbeitung in der Pflanzenwelt schlechterdings nicht vor.<br />
Aber einfache Elektronik kommt sofort ins Spiel, wenn wir es mit einem Lebewesen<br />
zu tun haben, das sich im Raum fortbewegt … Die ersten elektronischen<br />
Systeme, die in primitiven Tierorganismen arbeiteten, waren im Wesentlichen<br />
Orientierungssysteme, logische Entsprechungen von Sonar und Radar. Sehen wir<br />
uns höher entwickelte Tiere an, finden wir elektronische Systeme, die nicht nur<br />
der Orientierung dienen, sondern auch der Navigation zu einer Futterquelle …<br />
Man kann die Situation mit einem Lenkgeschoss vergleichen, dessen Zweck es<br />
ist, andere Lenkgeschosse abzufangen und zu zerstören. In unserer Welt werden
20<br />
2 Genetischer Determinismus und genetischer Selektionismus<br />
die Methoden von Angriff und Verteidigung immer ausgeklügelter, und genau<br />
das Gleiche passierte bei den Tieren. Und mit zunehmender Raffinesse werden<br />
immer bessere elektronische Systeme notwendig. Was in der Natur geschah,<br />
zeigt eine deutliche Parallele zu den Entwicklungen der Elektronik moderner<br />
militärischer Systeme … Ich halte es für einen ernüchternden Gedanken,<br />
dass wir ohne die Zahn-und-Klauen-Existenz im Urwald unsere intellektuellen<br />
Fähigkeiten nicht besäßen, wir wären nicht in der Lage, die Struktur des Universums<br />
zu untersuchen, und nicht imstande, eine Symphonie von Beethoven zu<br />
würdigen … In diesem Licht betrachtet hat die mitunter gestellte Frage – können<br />
Computer denken? – etwas Ironisches. An dieser Stelle meine ich natürlich die<br />
Computer, die wir selbst aus anorganischen Materialien herstellen. Was in aller<br />
Welt glauben eigentlich diejenigen, die so fragen, was sie selbst sind? Einfach<br />
Computer, nur unendlich komplizierter als irgendeiner, den wir bisher zu bauen<br />
gelernt haben. Man bedenke, dass unsere Computerindustrie gerade einmal zwei<br />
oder drei Jahrzehnte existiert, während wir das Ergebnis einer Entwicklung von<br />
Hunderten Millionen Jahren sind (S. 24–26).<br />
Andere könnten diese Schlussfolgerung ablehnen, aber ich denke, dass die einzigen<br />
Alternativen dazu religiöser Natur sind. Wohin diese Debatte auch führen mag, sie berührt<br />
– um auf die Gene und das Hauptanliegen diese Kapitels zurückzukommen – in<br />
keiner Weise den Gegensatz zwischen Vorherbestimmung und freiem Willen , egal, ob<br />
man eher die Gene als ursächliche Kräfte ansieht oder eher die Umweltbedingungen.<br />
Zur Verteidigung sei aber gesagt, es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Funktionsorientierte<br />
Verhaltensforscher und „Soziobiologen“ müssen etwas gesagt haben,<br />
wofür sie verdienen, mit genetischen Deterministen in einen Topf geworfen zu werden.<br />
Oder wenn das alles ein Missverständnis ist, muss es eine gute Erklärung dafür<br />
geben, denn derart weit verbreitete Missverständnisse entstehen nicht ohne Grund,<br />
selbst dann nicht, wenn ihnen kulturelle Mythen Vorschub leisten, die so mächtig<br />
sind wie der Gen-Mythos und der Computer-Mythos in ihrer unheiligen Allianz. Ich<br />
spreche für mich, wenn ich sage, dass ich den Grund zu kennen glaube. Das Missverständnis<br />
hat seine Ursache in der Art und Weise, wie wir über ein ganz anderes<br />
Thema sprechen: das der natürlichen Auslese. Auslese auf der Ebene der Gene, was<br />
eine Art ist, über Evolution zu sprechen, wird missverstanden als genetischer Determinismus,<br />
was eine Art ist, Entwicklung zu betrachten. Leute wie ich nehmen andauernd<br />
Gene „für“ dies und Gene für das an. Man könnte glauben, wir wären von<br />
Genen und „genetisch programmiertem“ Verhalten geradezu besessen. Ist es ein<br />
Wunder, dass wir beschuldigt werden, Deterministen zu sein, wenn man Parallelen<br />
zieht zu dem bekannten Mythos der calvinistischen Vorherbestimmtheit durch Gene<br />
und durch „programmiertes“ Verhalten, dem das Bild einer Marionette entspricht?<br />
Warum sprechen denn so viele funktionsorientierte Verhaltensforscher von Genen?<br />
Weil wir uns für die natürliche Auslese interessieren und natürliche Auslese<br />
das unterschiedliche Überleben von Genen ist. Wenn wir schon so weit sind, über<br />
die Möglichkeit zu diskutieren, dass sich Verhaltensmuster durch natürliche Auslese<br />
entwickeln, dann müssen wir auch genetische Vielfalt annehmen im Hinblick<br />
auf den Hang oder die Fähigkeit, dieses Verhaltensmuster auszuführen. Damit wird