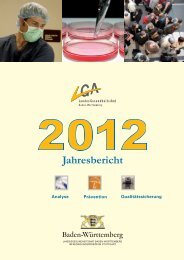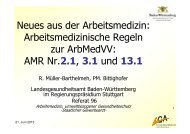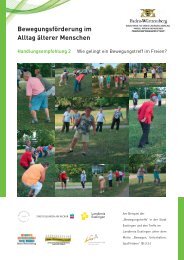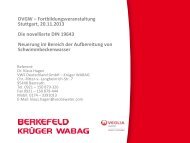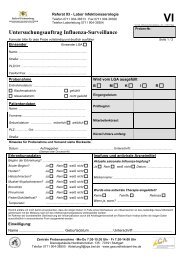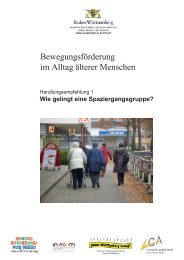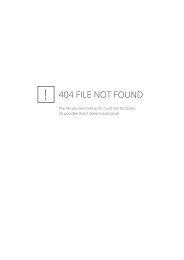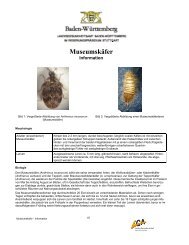Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg<br />
In Zusammenarbeit mit<br />
• Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart<br />
• Schafherdengesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg<br />
Erforderliche Maßnahmen beim Auftreten von<br />
humanen Q-<strong>Fieber</strong>-Epidemien<br />
Teil 1:<br />
Q-<strong>Fieber</strong>: Erreger, Krankheitsbild, Epidemiologie<br />
Das Q-<strong>Fieber</strong> (Query-<strong>Fieber</strong>), in Deutschland auch als Balkangrippe oder Krimfieber<br />
bekannt, wird durch Coxiella burnetii, ein gramnegatives Bakterium (systematisch<br />
neuerdings zu den Legionellen gestellt), übertragen. Coxiella burnetii lebt intrazellulär<br />
parasitisch und tritt in 2 Formen auf (Abb. 1):<br />
Abb. 1<br />
Entwicklungszyklus von<br />
Coxiella burnetii<br />
Coxiellen treten in 2 Formen<br />
auf, größere vegetative Formen<br />
und kleine, sehr resistente,<br />
sporenähnliche Formen,<br />
die von diesen am Polende<br />
gebildet und unter Auflösung<br />
der Mutterzelle freigesetzt<br />
werden. Beide Formen können<br />
sich durch Zweiteilung weiter<br />
vermehren.<br />
Abb.: Bergey`s manual 1984<br />
Wiederholdstraße 15 Telefon 0711/1849-247 E-Mail: poststelle@lga.bwl.de LZB Stuttgart<br />
70174 Stuttgart Fax 0711/1849-242 X400: S=Poststelle, 0=LGA, BLZ 600 000 00<br />
www.landesgesundheitsamt.de P=BWL, A=DBP, C=DE Konto-Nr. 600 015 05
2<br />
Die größeren Formen weisen den Aufbau einer vegetativen Bakterienzelle auf; am<br />
Polende können diese kleinere sporenähnliche Formen bilden, die unter Auflösung<br />
der Mutterzelle freigesetzt werden. Diese sporenartigen Körperchen sind in<br />
erster Linie für die hohe Tenazität von Coxiella burnetii verantwortlich, die bis zu<br />
1,5 Jahren betragen kann.<br />
Beim Menschen verursacht eine Infektion mit Coxiella burnetii bei vollausgeprägtem<br />
Krankheitsbild eine atypische Pneumonie mit hohem <strong>Fieber</strong> und heftigem retroorbitalen<br />
Kopfschmerz; häufig verläuft die Infektion jedoch ohne Symptome oder äußert<br />
sich „nur“ in Form einer Sommergrippe mit <strong>Fieber</strong> und Gliederschmerzen.<br />
Beim Q-<strong>Fieber</strong> handelt es sich um eine Zoonose mit einem außerordentlich großen<br />
Wirtsspektrum . Als Überträger fungieren Zecken; weltweit kommen über 50 Zeckenarten<br />
in Frage, in Mitteleuropa ist die Schafzecke Dermacentor marginatus der<br />
weitaus wichtigste Vektor. Als Wirtstiere kommen Nager, Wild, Vögel die meisten<br />
Haustiere und der Mensch in Betracht. Die Übertragungswege beim Q-<strong>Fieber</strong> sind<br />
außerordentlich vielfältig und verzweigt (Abb.2).<br />
Abb. 2<br />
Infektionskreislauf von Coxiella<br />
burnetii<br />
Der basale Infektionskreislauf von C.<br />
burnetii entwickelt sich zwischen<br />
Larven und Nymphen der Dermacentor-Zecken<br />
und kleinen Nagern.<br />
Zweimal im Jahr, mit Auftreten der<br />
adulten Stadien, erfährt der Kreislauf<br />
eine Erweiterung, wobei dann größere<br />
Wildtiere sowie Haustiere befallen<br />
werden. Zusätzlich erfolgt die<br />
Verbreitung der Coxiellen auf aerogenem<br />
Wege über eingetrockneten<br />
Zeckenkot und kontaminierten<br />
Staub.<br />
Abb.: Prof. Dr. Liebisch, Tierärztliche<br />
Hochschule, Hannover<br />
Zwischen den Larven und Nymphen von Dermacentor und deren Wirtstieren, kleinen<br />
Nagern, entwickelt sich ein basaler Kreislauf, der indessen zweimal im Jahr, in<br />
Deutschland in März -April und im August-September eine Erweiterung erfährt. Zu<br />
dieser Zeit nämlich treten die adulten Dermacentor-Zecken auf und befallen dann<br />
ihre Wirte - größere Wildtiere wie Rotwild und Füchse aber auch Haustiere wie
3<br />
Schafe, Ziegen ,Rinder. Dies führt zu einer erheblichen Intensivierung der Coxiellen-Übertragung.<br />
Die adulten Zecken geben in das Fell der Tiere Kot ab (Abb.3).<br />
Abb. 3<br />
Zecken und Zeckenkot im Schaf-Vlies.<br />
Der Erreger-haltige Zeckenkot kann über<br />
Wochen im Vlies verbleiben und als Staub<br />
aerogen verbreitet werden; auf diese Weise<br />
können Schafe zu passiven Vektoren werden,<br />
ohne selbst erkrankt zu sein.<br />
Abb.: Dr. Steng, SHGD, Stuttgart<br />
Dieser enthält große Mengen an Erregern und wird nach dem Eintrocknen als Staub<br />
verbreitet, was zur aerogenen Infektion weiterer Tiere sowie des Menschen führen<br />
kann. Die hohe Resistenz der Coxiellen sowie die Abgabe großer Erregerzahlen bei<br />
gleichzeitig nur geringer Infektionsdosis führt zu einer außerordentlich hohen Kontagiosität<br />
dieser Infektion. Dies wird noch durch den Umstand verstärkt, daß Coxiellen-Infektionen<br />
v.a. bei Schafen zu Aborten führen. Die Fruchthäute des Abortmaterials<br />
enthalten dann massenhaft Erreger, die zu einer weiteren Verbreitung führen.<br />
Eingetrocknete Fruchthäute, die auf der Weide verbleiben, können zu einer monatelangen<br />
„Verseuchung“ des Geländes führen. Nichtsdestoweniger spielen die Zecken<br />
als Reservoir die größte Rolle, die Bildung von Naturherden ist mit ihrem Vorkommen<br />
verbunden. Naturherde finden sich v.a. in warmen und trockenen Klimazonen;<br />
in Deutschland kommt diese Infektion ganz überwiegend in Bayern, Baden-<br />
Württemberg und den angrenzenden Bundesländern vor, wohingegen sie nach Norden<br />
zu zunehmend seltener wird. In Mitteleuropa sind menschliche Q-<strong>Fieber</strong> -<br />
Erkrankungen am häufigsten in Verbindung mit Schafen bekannt geworden, in<br />
Deutschland kommt es speziell im Bereich der Triebwege von Wanderschafen bzw.<br />
im Gebiet der Winterquartiere dieser Haustiere zu Epidemien; dabei wurde über eine<br />
aerogene Übertragung der Erreger über großen Strecken berichtet.<br />
Einen Höhepunkt von Q-<strong>Fieber</strong>-Fällen gab es in den 40-er bis 60er Jahren. In dieser<br />
Zeit wurden in der Bundesrepublik 3868 humane Fälle von Q-<strong>Fieber</strong> registriert. Seither<br />
ist die Zahl der Fälle gesunken, möglicherweise ist aber auch die Aufmerksamkeit<br />
geringer geworden. Bei aktiver Suche nach Q-<strong>Fieber</strong>- Epidemien wurden in den<br />
letzten 2 Jahren mehrfach Q-<strong>Fieber</strong>-Epidemien mit bis zu 100 Erkrankten aufgedeckt.<br />
Mit einer erheblichen Dunkelziffer von Infektionen ist zu rechnen.<br />
Derzeit (Stand Juli 2000) ist die Erkrankung und der Tod an Q-<strong>Fieber</strong> meldepflichtig<br />
(§ 3 BseuchG). Nach Inkrafttreten des IfSG wird der direkte oder indirekte Nachweis<br />
von Coxiella burnetii meldepflichtig sein, soweit der Nachweis auf eine akute Infektion<br />
hindeutet.
4<br />
Teil 2:<br />
Maßnahmen-Katalog beim Auftreten von Q-<strong>Fieber</strong>-<br />
Epidemien<br />
Beim Q-<strong>Fieber</strong> handelt es sich um eine Zoonose, von der Tiere und Menschen gleichermaßen<br />
betroffen sein können. Dies bedeutet, daß hier eine Kooperation der<br />
verantwortlichen medizinischen und veterinärmedizinischen Behörden erforderlich<br />
ist. Isolierte Maßnahmen etwa nur im medizinischen Bereich sind nur wenig<br />
effektiv.<br />
Oberstes gemeinsames Ziel ist es, die Q-<strong>Fieber</strong>-Epidemie zu stoppen und ein Wiederaufflackern<br />
zu vermeiden.<br />
Bei Verdacht auf einen Ausbruch von Q-<strong>Fieber</strong> sollte nach einem einheitlichen<br />
Schema vorgegangen werden. Die erforderlichen und möglichen Maßnahmen wurden<br />
von Vertretern des MLR, SM, LGA, CVUA sowie der Schafherden-<br />
Gesundheitsdienste BW in einer Besprechung am 19.11. 99 im MLR erarbeitet und<br />
sollen als Richtschnur für die Vertreter der medizinischen und veterinärmedizinischen<br />
Behörden dienen.<br />
1. Sicherung der Diagnose „Q-<strong>Fieber</strong>“ bzw. Abklärung des Verdachts<br />
(atypische Pneumonie) durch Laboruntersuchungen<br />
Die Diagnose einer Q-<strong>Fieber</strong>-Infektion wird auf serologischem Wege unter Verwendung<br />
von Coxiella-Phase I und -Phase II-Antigenen gestellt. Im Falle eines Q-<br />
<strong>Fieber</strong> Verdachts muß von den Erkrankten Serum an ein geeignetes Labor gesandt<br />
werden. Mit dem Auftreten von Antikörpern ist ab der 2. Woche post infectionem<br />
zu rechnen.<br />
2. Beim Auftreten von zwei und mehr humanen Fällen Klärung der<br />
Situation vor Ort mit Methoden der aufsuchenden Epidemiologie<br />
Fragen zur Erkrankung<br />
Suche nach möglichen Infektionsquellen (Schafe, Rinder, Damwild, Hunde)<br />
Befragung der Hirten bzw. der Besitzer nach: Verlammen, Verkalben<br />
Frage nach Zeckenbefall<br />
3. Aktive Suche nach weiteren humanen Fällen in der betroffenen<br />
Region, Abklärung der verdächtigen Erkrankungen durch Laboruntersuchungen<br />
Erfahrungsgemäß wird - wenn überhaupt - nur ein Teil der Q-<strong>Fieber</strong>-Infektionen<br />
auf dem regulären Meldeweg bekannt. Bei der Q-<strong>Fieber</strong>-Epidemie in Freiburg<br />
1998 wurden nur 8 Fälle über Meldung an das Gesundheitsamt ermittelt. Nach<br />
aktiver Fallsuche erhöhte sich die Zahl der Erkrankten auf ca 100. Eine möglichst<br />
weitgehende Erfassung der Erkrankungsfälle ist die Grundlage für eine effektive<br />
Durchführung von Punkt 4.
5<br />
4. Befragung des erweiterten betroffenen Personenkreises, ggf.<br />
Fall-Kontroll-Studie<br />
Die Befragung des betroffenen Personenkreises erfolgt mittels standardisierter<br />
Fragebögen; die anschließende Auswertung dient der Ermittlung der wahrscheinlichen<br />
Infektionsquelle und der Einleitung geeigneter Schutzmaßnahmen.<br />
5. Eingrenzung von Großtieren als möglicher Infektionsquelle<br />
Coxiella burnetii hat ein sehr breites Wirtsspektrum und führt bei zahlreichen<br />
Säugetierarten zur Infektion. Von den Haustieren sind am häufigsten Wiederkäuer<br />
betroffen, dagegen nur selten Einhufer und Schweine; Schafherden sind in jedem<br />
Fall in die Untersuchungen zur epidemiologischen Klärung einzubeziehen.<br />
Eine Verbreitung der Coxiellen durch Schafherden kann über zwei unbedingt zu<br />
unterscheidende Wege zustandekommen:<br />
A. Passive Vektor-Funktion: Hierbei sind die Schafe selbst nicht klinisch erkrankt,<br />
tragen aber infektiösen Zeckenkot im Vlies, der zu aerogenen Infektionen<br />
z.B. des Menschen führen kann.<br />
B. Aktive Vektor-Funktion: Hierbei sind die Schafe selbst in das Krankheitsgeschehen<br />
einbezogen; über ein Q-<strong>Fieber</strong>-bedingtes Abortgeschehen kommt es zu<br />
einer Vermehrung und Verbreitung der Coxiellen durch infizierte Feten, Plazenten<br />
und Lochialsekrete in der Umwelt<br />
Abklärung der Infektionsquelle Schaf<br />
A. Ermittlung der aktiven Vektor-Funktion<br />
Serologische Untersuchungen:<br />
Schafe, die sich mit Coxiella burnetii infiziert oder sogar verlammt haben, bilden<br />
in der KBR und im ELISA nachweisbare Antikörper. Bei der Auswertung der Serologie<br />
deuten KBR-Titerstufen ≥ 1:40 auf eine kürzlich stattgefundene Infektion<br />
und Titerstufen von < 1:40 auf eine länger zurückliegende Infektion oder auf den<br />
Beginn einer Infektion hin. Es ist hierbei zu bedenken, daß KBR-Titerstufen beim<br />
Schaf innerhalb von ca einem halben Jahr abfallen können.<br />
Die Auswertung der Serologie ist auf die gesamte Schafherde zu beziehen: Bei<br />
einer Herde mit aktueller Infektion weist wenigstens die Hälfte aller Tiere Titerstufen<br />
≥1:20 in der KBR oder positive Ergebnisse im ELISA auf. Zur Ermittlung<br />
einer Herden-Infektion ist ein Stichprobenumfang von 5-10% der Tiere erforderlich.<br />
Beim Vorkommen nur einzelner Seroreagenten (i. d. R. Titerstufen < 1:40 in<br />
der KBR) ist von einer Coxiellen-Ausscheidung durch die untersuchte Herde<br />
nicht auszugehen.<br />
Ein negatives Ergebnis der Serologie (Titerstufen < 1:10 in der KBR) schließt nur<br />
ein akutes Infektionsgeschehen innerhalb der Schafherde aus; eine Aussage hinsichtlich<br />
der passiven Vektorenrolle der Schafe läßt sich hingegen anhand der<br />
Serologie nicht treffen.<br />
Mikrobiologische Untersuchungen:<br />
Bei infizierten Schafen ist ein direkter Nachweis von Coxiellen mit Hilfe von Färbeverfahren<br />
(Stamp-Färbung)sowie durch Antigennachweis möglich; als Untersuchungsmaterial<br />
eignen sich Nachgeburten sowie Genitalabstriche. Auch bei letz-
6<br />
teren führen die Teste nur zur Zeit des Ablammens und bis zu 4-6 Wochen danach<br />
zu verwertbaren Ergebnissen.<br />
B. Ermittlung der passiven Vektor-Funktion<br />
Treten in der Umgebung einer Schafherde gehäufte menschliche Erkrankungen<br />
auf, und sind die Tiere serologisch unauffällig, ist die Beobachtung von Zeckenkot<br />
im Vlies (dunkle Verfärbungen im tieferen Vlies, Abb. 3) als hinreichender Verdacht<br />
für eine Vektorrolle der Schafe zu werten.<br />
Darüberhinaus sind folgende Untersuchungen grundsätzlich möglich, derzeit sind<br />
sie jedoch nur als flankierende Maßnahme zu betrachten. Grundsätzlich ist die<br />
Durchführung erforderlicher Maßnahmen schon bei hinreichendem Verdacht<br />
angezeigt.<br />
Untersuchung des Zeckenkots auf den Schafen mit Hilfe der PCR:<br />
Dieses Verfahren hat sich in ersten Untersuchungen als praktikabel erwiesen; bei<br />
bestehendem Verdacht sind entsprechende Untersuchungen von zeckenkothaltigen<br />
Vliesproben angezeigt. Positive Ergebnisse sind auch Wochen nach dem<br />
Verschwinden der adulten Dermacentor-Zecken noch zu erwarten.<br />
Untersuchung von adulten Zecken auf Coxiellen<br />
Adulte Zecken lassen sich mit Hilfe der PCR und von Zellkulturen auf Coxiellen<br />
untersuchen. Dieses Verfahren ist zum Zeitpunkt des Auftretens der adulten<br />
Dermacentor-Zecken zum Eingrenzen der Endemiegebiete sinnvoll.<br />
Untersuchung von Staub des Weidelandes auf Coxiellen:<br />
Eine Untersuchung von Staub mit Hilfe der PCR ist prinzipiell möglich; entsprechende<br />
methodische Untersuchungen werden derzeit vorgenommen, mit der E-<br />
tablierung des Verfahrens ist in Bälde zu rechnen.<br />
6. Maßnahmen nach Ermittlung von Großtieren, speziell Schafen,<br />
als wahrscheinlicher Infektionsquelle<br />
A. Maßnahmen bei aktiver Vektor-Funktion<br />
Maßnahmen zur Verringerung des Erregereintrags in die Umwelt:<br />
Verbringung der hochtragenden Schafe in den Stall zum Ablammen<br />
Nachgeburtbeseitigung (Absammeln in festen Behältern, Entsorgung durch die<br />
Tierkörperbeseitigungsanstalt)<br />
Metaphylaktische Tetrazyklinbehandlung<br />
Mit einer Tetrazyklinbehandlung wird es kaum gelingen, den Erreger aus der<br />
Herde zu eliminieren. Dagegen ist ein Tetrazyklineinsatz geeignet, bei hochtragenden<br />
Schafen die Aborte zu reduzieren<br />
Kontrollierte Akarizidbehandlung<br />
Dieses Verfahren stellt eine prophylaktische Maßnahme dar und ist i.d.R. nicht<br />
geeignet, die aktuelle Situation zu beeinflussen; sie ist folgendermaßen einzusetzen:<br />
a. In den Herden, von denen mutmaßlich eine Infektion ausging vor der nächsten<br />
Zeckenbefalls –Saison
7<br />
b. bei Herden in den bekannten Dermacentor-Biotopen alljährlich zu Beginn<br />
einer Dermacentor-Befallszeit<br />
Für eine Akarizid-Behandlung existieren derzeit 3 Applikationsverfahren:<br />
Pour on – Verfahren mit Pyrethroiden<br />
Kamm-Verfahren mit Organophosphaten<br />
Injektions-Verfahren mit makrozyklischen Laktonen<br />
Impfung gegen Coxiellen:<br />
Derzeit ist nur der gegen Chlamydien/Coxiellen gerichtete französische Impfstoff<br />
Chlamyvax FQ verfügbar. Da er für Rinder vorgesehen ist, ist er nicht in praxisgerechter<br />
und kostengünstiger Abpackung für Schafe verfügbar. Indikationen:<br />
a. Impfung zur Reduktion der Aborte vor der nächsten Deckzeit<br />
b. Impfung der Schafe in den Q-<strong>Fieber</strong>-Endemiegebieten<br />
Eine generelle Impfung der Schafe in den Q-<strong>Fieber</strong> –Endemiegebieten ist zur<br />
Eindämmung der Infektionen zwar sehr wünschenswert, sie dürfte aus praktischen<br />
Gründen indessen bis zur Verfügbarkeit eines geeigneten Impfstoffes<br />
schwer durchzusetzen sein; gleichwohl sollte eine Coxiellen-Impfung zumindest<br />
auf lange Sicht angestrebt werden.<br />
B. Maßnahmen bei passiver Vektor-Funktion<br />
Desinfektion der infektiösen Schafherde:<br />
Das Verfahren ist als Sofortmaßnahme gegen die Verbreitung weiterer Infektionen<br />
in Betracht zu ziehen. Voraussetzung hierfür ist begründeter Verdacht der<br />
Infektiosität der Tiere.<br />
(Humane Erkrankungen/Zeckenkot im Vlies; ggf. positive PCR aus Zeckenkot)<br />
Derzeit existieren keine ausgewerteten Feldversuche zur Feststellung der Wirksamkeit.<br />
Nichtsdestoweniger ist bei Anwendung eines gegen Coxiellen wirksamen<br />
Desinfekionsmittels zumindest mit einer Reduktion der Keimbelastung zu<br />
rechnen.<br />
Die Desinfektion kann mit einer geeigneten Anlage vorgenommen werden; hierbei<br />
empfiehlt sich die Hinzuziehung des Schafgesundheitsdienstes.<br />
Akarizidbehandlung vor der nächsten Zeckenbefalls-Saison:<br />
Indikation und Durchführung s.o.<br />
Weitere Maßnahmen:<br />
Je nach Situation und je nach Untersuchungsergebnissen sind folgende weitere<br />
Maßnahmen in Betracht zu ziehen:<br />
Unterbinden von Publikumsverkehr auf kontaminierten Standorten mit erhöhtem<br />
Risiko<br />
Bei Verlammen auf begrenzten Standort ist diese Maßnahme in Betracht zu ziehen<br />
Scheren in geschlossenen Räumen<br />
Bei Schafen, die mit begründetem Verdacht als passive Vektoren anzusehen<br />
sind, ist das Scheren in geschlossenen Räumen vorzunehmen. Die kontaminierte<br />
Wolle ist unschädlich (z.B. Verbrennen) zu beseitigen
8<br />
Sperren von Weiden in Wohngebieten<br />
Diese Maßnahme ist nach Durchführung der oben angegebenen Maßnahmen<br />
i.d.R. nicht erforderlich.<br />
Erteilung von Triebgenehmigungen<br />
Die Erteilung von Triebgenehmigungen soll von der Durchführung der oben angegebenen<br />
Maßnahmen abhängig gemacht werden.<br />
Stuttgart, 1. Juli 2000<br />
Prof. Dr. Dr. Kimmig, Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg , Stuttgart<br />
Dr. Pfaff, Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg , Stuttgart<br />
Dr. Sting, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt, Stuttgart<br />
Dr. Steng, Schafherdengesundheitsdienst Stuttgart der Tierseuchenkasse BW