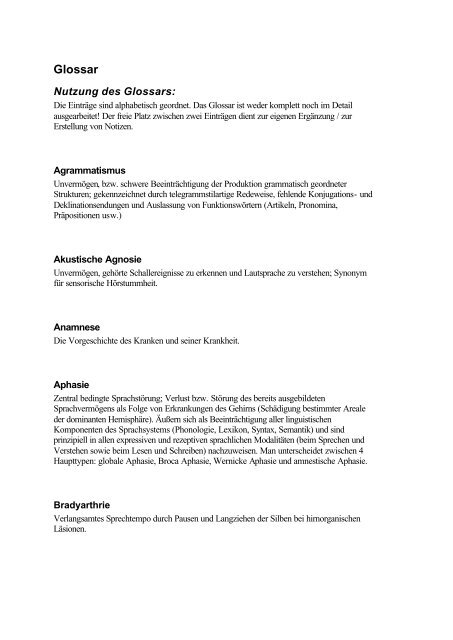Glossar - pascal
Glossar - pascal
Glossar - pascal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Glossar</strong><br />
Nutzung des <strong>Glossar</strong>s:<br />
Die Einträge sind alphabetisch geordnet. Das <strong>Glossar</strong> ist weder komplett noch im Detail<br />
ausgearbeitet! Der freie Platz zwischen zwei Einträgen dient zur eigenen Ergänzung / zur<br />
Erstellung von Notizen.<br />
Agrammatismus<br />
Unvermögen, bzw. schwere Beeinträchtigung der Produktion grammatisch geordneter<br />
Strukturen; gekennzeichnet durch telegrammstilartige Redeweise, fehlende Konjugations- und<br />
Deklinationsendungen und Auslassung von Funktionswörtern (Artikeln, Pronomina,<br />
Präpositionen usw.)<br />
Akustische Agnosie<br />
Unvermögen, gehörte Schallereignisse zu erkennen und Lautsprache zu verstehen; Synonym<br />
für sensorische Hörstummheit.<br />
Anamnese<br />
Die Vorgeschichte des Kranken und seiner Krankheit.<br />
Aphasie<br />
Zentral bedingte Sprachstörung; Verlust bzw. Störung des bereits ausgebildeten<br />
Sprachvermögens als Folge von Erkrankungen des Gehirns (Schädigung bestimmter Areale<br />
der dominanten Hemisphäre). Äußern sich als Beeinträchtigung aller linguistischen<br />
Komponenten des Sprachsystems (Phonologie, Lexikon, Syntax, Semantik) und sind<br />
prinzipiell in allen expressiven und rezeptiven sprachlichen Modalitäten (beim Sprechen und<br />
Verstehen sowie beim Lesen und Schreiben) nachzuweisen. Man unterscheidet zwischen 4<br />
Haupttypen: globale Aphasie, Broca Aphasie, Wernicke Aphasie und amnestische Aphasie.<br />
Bradyarthrie<br />
Verlangsamtes Sprechtempo durch Pausen und Langziehen der Silben bei hirnorganischen<br />
Läsionen.
Dysarthrien<br />
Dysarthrien sind Störungen der Artikulation, der Stimmgebung und der<br />
Sprechatmung, hervorgerufen durch Erkrankungen der zentralen Bahnen<br />
und Kerne der am Sprechvorgang beteiligten motorischen Nerven. Im<br />
Gegensatz zu Aphasien ist bei den Dysarthrien immer nur die expressive<br />
Seite (Sprechmotorik) betroffen.<br />
Dysgnathie<br />
Zahn- und Kieferfehlstellung & daraus resultierende Sprechstörungen<br />
Dyslalie<br />
Unter Dysialien (Stammeln, Psellismus) versteht man Störungen der Artikulation, bei denen<br />
einzelne Laute oder Lautverbindungen entweder völlig fehlen, durch andere ersetzt oder<br />
abartig gebildet werden. Die Artikulatoren selbst sind jedoch bei dieser Störung intakt.<br />
Dyslogie<br />
Sprach-, Sprech- und Stimmauffälligkeiten bei geistigen Entwicklungsstörungen.<br />
Dyspnoe<br />
Atemnot & daraus resultierende Stimmstörung<br />
Dyspraxie<br />
Mangelnde Fähigkeit, Körperteile zweckmäßig zu bewegen & daraus resultierende<br />
Sprechstörungen.<br />
Dysprosodie<br />
Störung der prosodischen Elemente der Sprache, d.h. Störung der Sprechmelodie, des<br />
Sprechrhythmus, des Sprechtempos; meist monotone oder abgehackte Sprechweise<br />
(Skandieren).<br />
Dysphasie<br />
Eine Entwicklungsstörung, bei der die Sprachfähigkeit unter des eigenen Intelligenz<br />
angemessenen Nivaus liegt.
Dysphonie<br />
Dysphonie ist der Oberbegriff für alle Arten von Stimmstörungen. Hauptsymptome sind der<br />
gestörte Stimmklang, d. h. die Heiserkeit, und die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der<br />
Stimme. Beispiele wären die psychogene Dysphonie, die Spastische Dysphonie und die<br />
hyper- / hypofunktionelle Dysphonie.<br />
Dysphrasie<br />
Veränderungen der Sprache und der sprachlichen Ausdrucksweise, die<br />
Rückschlüsse auf das Vorliegen einer Psychose zulassen, bezeichnet man<br />
als Dysphrasien. Psychosen sind seelische Störungen, bei denen der Realitätsbezug gestört<br />
ist. Man unterscheidet endogene, d. h. hauptsächlich anläge- und entwicklungsbedingte,<br />
und exogene, d. h. körperlich begründbare Psychosen.<br />
Entwicklungsbedingte Sprachstörungen<br />
Auch Entwicklungsdysphasie genannt – diese Störungen werden durch Fehlprägungen bei der<br />
kindlichen Entwicklung auf und sind für gewöhnlich nicht organischen Ursprungs. Beispiele<br />
wären Dyslalie, Dysgrammatismus, Dyslogie und Lexikalische Erwerbsstörungen. Eine<br />
Ausnahme bildet z.B. die Lauterzeugung von Gehörlosen. Da die auditive Rückkopplung<br />
fehlt, werden die Laute falsch gebildet.<br />
Hyperfunktionelle Dysphonie<br />
Stimmstörung, die durch ein Übermaß an Spannung, an Muskelaktivität und / oder an<br />
Atemdruck am Stimmorgan und am Ansatzrohr hervorgerufen wird. Die Störung tritt bei<br />
unökonomischer Sprechweise auf und kann in eine hypofunktionelle Dysphonie übergehen.<br />
Sie ließe sich auch als „Party-Syndrom“ bezeichnen, da sie durch das Sprechen bei erhöhten<br />
Geräuschpegel, durch Rauchen, Trinken und Müdigkeit extrem begünstigt wird.<br />
Eine Person mit dieser Phonoponose klingt heiser und redet gepreßt.<br />
Hypofunktionelle Dysphonie<br />
Stimmstörung, die durch ein Mangel an Spannung, Muskelaktivität und Atemdruck am<br />
Stimmorgan und am Ansatzrohr hervorgerufen wird.<br />
Kommunikativ-Reaktive Sprachstörungen<br />
Hierunter fallen Stottern, Poltern, Logophobie, Mutismus usw. Die Ursachen für diese<br />
Störungen sind of im psychischen Bereich zu suchen.
Logoneurosen<br />
Eine Neurose ist eine primär umweltbedingte seelische Störung, der Realitätsbezug<br />
bleibt erhalten. Verliert der Betroffene aufgrund einer neurotischen<br />
Entwicklung die Willkürkontrolle über seine Phonations- und Artikulationsleistungcn.<br />
so bezeichnet man diese Störung als Logoneurose. Beispiele wären Stottern,<br />
Logophobie und Mutismus.<br />
Logophobie<br />
Schwere psychische Hemmung / Angst vor dem Sprechen. Oft auch in Verbindung mit<br />
Stottern oder Mutismus.<br />
Mutismus<br />
Selektivität des Sprechens, welche situations- und umfeldsbedingt ist. Man unterscheidet<br />
zwischen totalem Mutismus und selektiven Mutismus.<br />
Näseln / Rhinophonie<br />
Wenn der normale nasale Beiklang (Nasenresonanz) bei den nasalierten Lauten (im<br />
Deutschen/m/, /n/, /ng/) sowie einen gewissen nasalen Stimmbeiklang bei den Orallauten so<br />
weit verändert wird, daß die Verständlichkeit darunter leidet, spricht man von einer<br />
pathologischen Veränderung des Sprachschalls und nennt dies (in diesem Falle) Rhinophonie.<br />
Organisch verursachte Sprachstörungen<br />
Dazu gehören alle Störungen, die eine Fehlfunktion oder ein Defekt eines Lauterzeugenden,<br />
Lautempfangenden oder Verarbeitenden Organs als Hauptursprung haben. Darunter fallen<br />
zum Beispiel: Dyspnoe, Dysphonie, Dysgnathie, Dysglossie, Orofaziale Dysfunktion,<br />
Dysarthie, Sprechapraxie und Aphasie.<br />
Paragrammatismus<br />
Störung der syntaktischen Produktion, die durch falsche Flexionsformen und fehlerhafte<br />
Satzstrukturen aufgrund der Vermengung von verschiedenen Satzmustern gekennzeichnet ist.<br />
Phonoponose<br />
Überbegriff für Stimmstörungen, die aufgrund von fehlerhaftem Stimmgebrauchs entstehen.
Poltern<br />
Hohe Sprechgeschwindigkeit mit falscher Sprechflüssigkeit, das zur beeinträchtigten<br />
Verständlichkeit führt. Die Störung ist an bestimmte Persönlichkeitsmerkmale des Sprechers<br />
gebunden. Das Gesprochene klingt unregelmäßig und kommt in schnellen, ruckartigen Zügen.<br />
Prosodie<br />
Ist ein Überbegriff für die Unterscheidung folgender Merkmale des Sprechausdrucks:<br />
Intonation, Dynamik, Rhythmus, Stimmumfang, Lautstärke, Dauer, Flüssigkeit, Pausen,<br />
Qualität, Verbindung, Einteilung und Phrasenbildung. Prosodie läßt sich in zwei grobe Teile<br />
disponieren: Intonations- / Betonungsfaktoren und zeitliche / rhythmische Faktoren.<br />
Sprechablaufstörungen<br />
Es handelt sich dabei um Störungen des flüssigen Sprechablaufes, und zwar vom Entwurf bis<br />
zur Ausführung. Pathologische Sprechunflüssigkeiten bedeuten eine Einschränkung der<br />
kommunikativen Kompetenz und sind von normalen Unflüssigkeiten (Pausen etc.) zu<br />
unterscheiden.<br />
SSPM<br />
Das Sprech- und Sprachprozeßmodell dient als logopädisches Rahmenkonzept als<br />
Anhaltspunkt zur Lokalisierung von Störungen der Sprache / Sprechweise / Stimme. Es<br />
beschreibt den mündlichen Kommunikationsprozeß und soll dabei helfen, Störungen zu<br />
analysieren.<br />
Stottern<br />
Das Stottersyndrom (Balbuties) ist eine Kommunikationsstörung mit Unterbrechungen des<br />
Redeflusses, die plötzlich und unabhängig vom Willen des Sprechers, abhangig von<br />
Situationen und in sehr wechselnder Stärke auftreten. Die Störung manifestiert sich in den<br />
Bereichen Atmung, Stimmgebung und Artikulation. Man unterscheidet zwischen klonischem<br />
Stottern, tonischem Stottern und traumatischem Stottern.