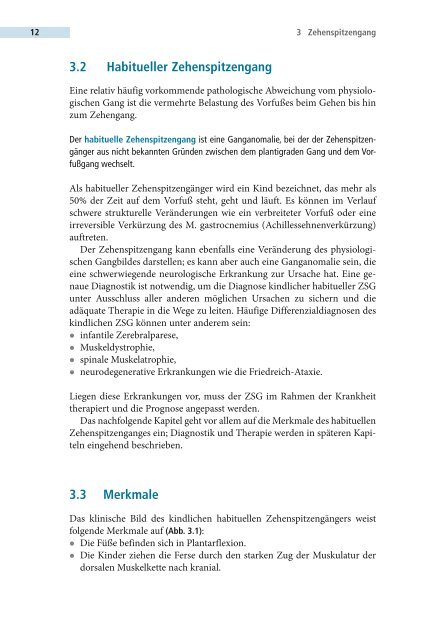3.2 HabituellerZehenspitzengang 3.3 Merkmale - Schattauer
3.2 HabituellerZehenspitzengang 3.3 Merkmale - Schattauer
3.2 HabituellerZehenspitzengang 3.3 Merkmale - Schattauer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12<br />
3 Zehenspitzengang<br />
3.2 Habitueller Zehenspitzengang<br />
Eine relativ häufig vorkommende pathologische Abweichung vom physiologischen<br />
Gang ist die vermehrte Belastung des Vorfußes beim Gehen bis hin<br />
zum Zehengang.<br />
Der habituelle Zehenspitzengang ist eine Ganganomalie, bei der der Zehenspitzengänger<br />
aus nicht bekannten Gründen zwischen dem plantigraden Gang und dem Vorfußgang<br />
wechselt.<br />
Als habitueller Zehenspitzengänger wird ein Kind bezeichnet, das mehr als<br />
50% der Zeit auf dem Vorfuß steht, geht und läuft. Es können im Verlauf<br />
schwere strukturelle Veränderungen wie ein verbreiteter Vorfuß oder eine<br />
irreversible Verkürzung des M. gastrocnemius (Achillessehnenverkürzung)<br />
auftreten.<br />
Der Zehenspitzengang kann ebenfalls eine Veränderung des physiologischen<br />
Gangbildes darstellen; es kann aber auch eine Ganganomalie sein, die<br />
eine schwerwiegende neurologische Erkrankung zur Ursache hat. Eine genaue<br />
Diagnostik ist notwendig, um die Diagnose kindlicher habitueller ZSG<br />
unter Ausschluss aller anderen möglichen Ursachen zu sichern und die<br />
adäquate Therapie in die Wege zu leiten. Häufige Differenzialdiagnosen des<br />
kindlichen ZSG können unter anderem sein:<br />
• zinfantile Zerebralparese,<br />
• zMuskeldystrophie,<br />
• zspinale Muskelatrophie,<br />
• zneurodegenerative Erkrankungen wie die Friedreich-Ataxie.<br />
Liegen diese Erkrankungen vor, muss der ZSG im Rahmen der Krankheit<br />
therapiert und die Prognose angepasst werden.<br />
Das nachfolgende Kapitel geht vor allem auf die <strong>Merkmale</strong> des habituellen<br />
Zehenspitzenganges ein; Diagnostik und Therapie werden in späteren Kapiteln<br />
eingehend beschrieben.<br />
3.3 <strong>Merkmale</strong><br />
Das klinische Bild des kindlichen habituellen Zehenspitzengängers weist<br />
folgende <strong>Merkmale</strong> auf (Abb. 3.1):<br />
• zDie Füße befinden sich in Plantarflexion.<br />
• zDie Kinder ziehen die Ferse durch den starken Zug der Muskulatur der<br />
dorsalen Muskelkette nach kranial.
3.3 <strong>Merkmale</strong> 13<br />
Abb. 3.1 Inspektion einer Zehenspitzengängerin<br />
• zDer Vorfuß hat eine breite Auflagefläche, da die Belastung ausschließlich<br />
auf dem Vorfuß liegt.<br />
• zDie Knie- und Hüftgelenke sind kompensatorisch flektiert, der Beckengürtel<br />
ist in der Sagittalebene flektiert und die Lendenwirbelsäule (LWS)<br />
ist hyperlordosiert.<br />
• zDie Brustwirbelsäule (BWS) wird in Mittelstellung gehalten und der<br />
Schultergürtel ist retrahiert.<br />
• zDer Kopf translatiert leicht nach ventral und die Halswirbelsäule (HWS)<br />
steht in einer lordosierten Stellung.<br />
Anhand des klinischen Bildes wird deutlich, dass der Zehenspitzengänger<br />
die für die physiologischen Gangphasen benötigten körperlichen Voraussetzungen<br />
nicht immer erfüllen kann (s. Tab. 2.1, S. 4). Aufgrund einer verstärkten<br />
Plantarflexion ist die Schrittlänge des habituellen Zehenspitzengängers<br />
verkürzt, wodurch sich seine Gehgeschwindigkeit reduziert. Durch die<br />
eingeschränkte Stabilität kann er eine aufrechte Körperhaltung nur begrenzt<br />
einnehmen. Außerdem wird in den Schwungphasen das freie Durchschwingen<br />
des Beines erschwert. Des Weiteren ist durch eine eingeschränkte<br />
Sprunggelenksbeweglichkeit das Abrollen nicht möglich und die Abdruckaktivität<br />
in der terminalen Standbeinphase ist aufgrund des flektierten
14<br />
3 Zehenspitzengang<br />
Beckengürtels nicht durchführbar. Der Körper reagiert auf diese Veränderungen<br />
mit kompensatorischen Ausweichbewegungen, die den Energieaufwand<br />
des Körpers erhöhen. Die körperlichen Strukturen werden funktionell<br />
anders belastet, so dass der physiologische, ökonomische Gangzyklus nur<br />
noch modifiziert ausgeführt wird. So sind bestimmte Muskelgruppen vermehrt<br />
aktiv, wodurch es beispielsweise zu Wadenkrämpfen kommen kann.<br />
Persistiert der Zehenspitzengang über einen längeren Zeitraum, kommt es<br />
aufgrund der veränderten Funktionen zu strukturellen Schäden des Bewegungsapparates.<br />
3.4 Ätiologie<br />
Der habituelle Zehenspitzengang ist eine Abweichung vom physiologischen<br />
Gang, die bei 15% aller Kinder über einen Zeitraum von drei Monaten intermittierend<br />
auftreten kann. Dabei laufen die Kinder nicht permanent auf<br />
Zehenspitzen, sondern wechseln situationsabhängig, beispielsweise bei Müdigkeit<br />
oder Aufregung, zwischen dem Vorfuß- und plantigraden Gang.<br />
3.5 Studien<br />
In der Literatur gibt es diverse Aussagen und Hypothesen zu den Ursachen<br />
des habituellen Zehenspitzenganges. Bisherige Untersuchungen weisen auf<br />
Zusammenhänge mit Muskeltonusstörungen, vestibulären und sensorischen<br />
Fehlfunktionen, Entwicklungsverzögerungen und familiäre Häufungen hin.<br />
Pomarino et al. (2011) haben in einer aktuellen Studie insbesondere genetische<br />
Faktoren als Ursachen für den Zehenspitzengang untersucht. Die Studie<br />
zeigte, dass der habituelle Zehenspitzengang bei ca. 42% der Zehenspitzengänger<br />
– statistisch nachweisbar – genetisch bedingt ist (Abb. 3.2).<br />
Um mehr über die Häufigkeit und die Ursachen des habituellen Zehenspitzenganges<br />
zu erfahren, befragten Pomarino et al. (2011) 900 Eltern mit<br />
Kindern im Kindergartenalter aus dem Hamburger Raum mithilfe eines<br />
Fragebogens: unter anderem zur Häufigkeit des Zehenspitzenganges, zum<br />
klinischen Bild und ob Arztbesuche und/oder therapeutische Maßnahmen<br />
aufgrund des Zehenganges unternommen wurden.<br />
193 Kinder waren habituelle Zehenspitzengänger, 707 Kinder Normalgänger.<br />
Ein prägnantes Ergebnis war, dass der Zehengang in den ersten vier Lebensjahren<br />
sehr oft vorkam, mit zunehmendem Alter aber wieder abnahm.
3.5 Studien 15<br />
ZSG<br />
mit familiärer Häufung<br />
42,3%<br />
Jungen<br />
67,1%<br />
Mädchen<br />
32,9%<br />
Abb. 3.2 Geschlechtsspezifische<br />
Häufigkeit<br />
des Zehenspitzenganges<br />
und Fami liarität<br />
Vater ist<br />
ZSG<br />
61,1%<br />
Mutter ist<br />
ZSG<br />
38,6%<br />
Vater ist<br />
ZSG<br />
55,7%<br />
Mutter ist<br />
ZSG<br />
44,3%<br />
Dabei bestand ein Zusammenhang zwischen der Entwicklung eines Zehenspitzenganges<br />
und der Nutzung eines Gehfreis, dem Vorliegen einer chronischen<br />
Atemwegserkrankung und familiärer Vorbelastung. Eine Hüftdysplasie<br />
korrelierte statistisch nicht mit einem Zehenspitzengang.<br />
Kinder mit einer solchen Gangabweichung sind in der neurologischen<br />
Untersuchung unauffällig; sie haben zeitgerecht laufen gelernt und zeigen im<br />
Gangbild keine Unsicherheiten (Pomarino et al. 2009).<br />
Eine weitere Studie von Pomarino aus dem Jahr 2011 mit 836 habituellen<br />
kindlichen Zehenspitzengängern ergab, dass bei gut der Hälfte (57%) aller<br />
Patienten die Wadenmuskulatur objektiv verkürzt war mit einer eingeschränkten<br />
passiven und aktiven Dorsalextension im oberen Sprunggelenk<br />
(OSG). Ferner konnte man bei knapp der Hälfte (49%) von 646 habituellen<br />
Zehenspitzengängern eine LWS-Lordose von mehr als 35 Grad beobachten<br />
und eine Hyperlordose von über 45 Grad bei 11% der untersuchten Kinder.<br />
Diese Werte liegen deutlich höher als bei Normalgängern (Abb. 3.3) (Pomarino<br />
et al. 2011).<br />
Bezüglich der Geschlechterverteilung besteht eine statistische Signifikanz,<br />
die in der oben genannten Studie nachgewiesen worden ist: 64% der habituellen<br />
Zehenspitzengänger waren männlich und nur 36% weiblich (Abb. 3.4).<br />
Bei über der Hälfte der Zehenspitzengänger (65%) besteht der ZSG, seit sie<br />
mit dem Laufen begonnen haben (Abb. 3.5).