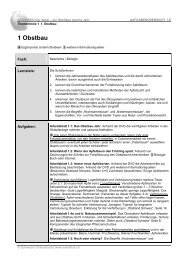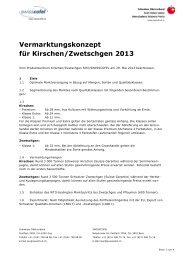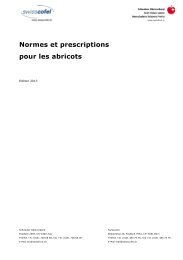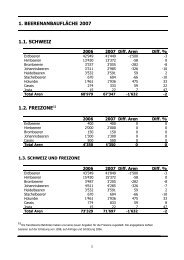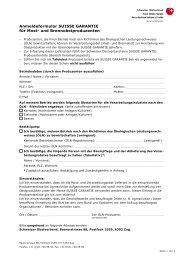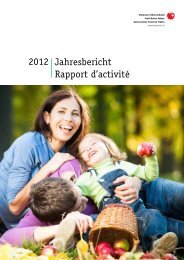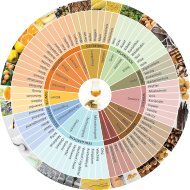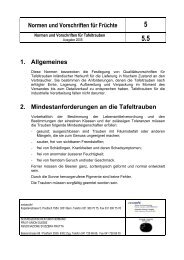Empfehlungen zur Obsteinlagerung 2013 (Früchte & Gemüse 8/13)
Empfehlungen zur Obsteinlagerung 2013 (Früchte & Gemüse 8/13)
Empfehlungen zur Obsteinlagerung 2013 (Früchte & Gemüse 8/13)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
xxx Forschung | xxx<br />
| Recherche<br />
<strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Obsteinlagerung</strong> <strong>20<strong>13</strong></strong><br />
Je nach Jahr und Sorte sind physiologische Schäden wie die Fleischbräune ein wichtiges Problem, dessen Ursachen<br />
sehr oft nicht genau eingegrenzt werden können. Zudem ist die Identifikation der Schäden in der Praxis nicht<br />
einfach. Bei Gala gab es in der Lagersaison zahlreiche Probleme.<br />
Franz Gasser, Séverine Gabioud Rebeaud, Agroscope Changins-Wädenswil ACW<br />
Bei den empfohlenen Ernterichtwerten gibt<br />
es seit der letzten Ausgabe keine Änderungen<br />
zu vermerken (siehe Tabelle Seite 23).<br />
Bei den Lagerempfehlungen bleiben die Temperatur-<br />
und CA-Werte gegenüber dem<br />
Vorjahr unverändert. Bei Topaz wurde die<br />
Empfehlung <strong>zur</strong> Anwendung von 1-MCP<br />
von «nicht getestet/keine Angaben» (?) auf<br />
«empfohlen» (J) gesetzt. Dies aufgrund der<br />
erfolgreichen Praxiserfahrungen und einem<br />
Bestätigungsversuch an der ACW.<br />
Die empfohlenen Ernterichtwerte und Lagerbedingungen<br />
stehen als PDF unter www.<br />
swissfruit.ch > Branche <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Zahlreiche Lagerprobleme bei der<br />
Sorte Gala<br />
Die Lagersaison 2012/<strong>20<strong>13</strong></strong> war gekennzeichnet<br />
durch zahlreiche Probleme mit der<br />
Sorte Gala. Insbesondere wurden Schäden<br />
wie Fleischbräune, Risse an der Stielgrube<br />
und übermässiger Verlust an Fruchtfleischfestigkeit<br />
während der Lagerung («mölsch»<br />
werden) festgestellt. Wie in den Jahren<br />
2003 und 2009 waren die hohen Temperaturen<br />
im August 2012 kurz vor der Ernte<br />
für den Schaden verantwortlich: Gemäss<br />
den Aufzeichnungen von Meteo Schweiz<br />
war der August 2012 je nach Region um<br />
2.5 bis 3.5 °C wärmer als der Referenzmittelwert<br />
der Jahre 1961 bis 1990.<br />
Wie allseits bekannt, wird die Ausfärbung,<br />
ein wichtiges Qualitätskriterium bei Gala,<br />
durch die Temperatur in der Nacht beeinflusst.<br />
Kühle nächtliche Temperaturen<br />
fördern die Bildung von Pigmenten beziehungsweise<br />
von Anthocyanen, welche für<br />
die Rotfärbung der <strong>Früchte</strong> verantwortlich<br />
sind. Im Jahre 2012 verlief die Ausfärbung<br />
der <strong>Früchte</strong> schleppend, während sich die<br />
klassischen Qualitätsparameter wie Fruchtfleischfestigkeit,<br />
Säuregehalt, Zucker und<br />
Risse in der Stielgrube bei Gala.<br />
Fissures au niveau de la cavité du pédoncule<br />
sur Gala.<br />
Photo: ACW<br />
Stärke weiter entwickelten. Aus diesem<br />
Grund wurde die Sorte Gala oft mit einer<br />
guten Ausfärbung, aber mit einer zu weit<br />
fortgeschrittenen Reife geerntet. Solche<br />
<strong>Früchte</strong> sind bezüglich Qualitätserhaltung<br />
schwierig zu lagern bzw. eignen sich nur<br />
für eine kurze Lagerung.<br />
MCP-Behandlung auch bei Topaz<br />
wirksam<br />
Bisher hatten wir uns im Herbstbrief in<br />
der Tabelle zu den empfohlenen Lagerbedingungen<br />
nicht dahingehend geäussert,<br />
ob bei Topaz eine Behandlung mit 1-MCP<br />
zu empfehlen sei oder nicht. In der Praxis<br />
wird die Sorte jedoch seit einigen Jahren<br />
erfolgreich behandelt. Wir führten deshalb<br />
an der ACW einen Lagerversuch durch, um<br />
die Wirksamkeit der Behandlung zu verifizieren.<br />
<strong>Früchte</strong> eines Pflückzeitpunktes<br />
wurden mit und ohne Behandlung während<br />
rund sieben Monaten unter ULO-Bedingungen<br />
(1.5 % CO 2<br />
, 1.0 % O 2<br />
) bei einer<br />
Temperatur von 1 °C gelagert.<br />
Die Unterschiede bezüglich Fruchtfleischfestigkeit<br />
zwischen der Kontrollvariante<br />
und den MCP-behandelten <strong>Früchte</strong>n wurden<br />
mit zunehmender Lagerdauer grösser.<br />
Die gleiche Tendenz bezüglich Fruchtfleischfestigkeit<br />
lässt sich am Ende der<br />
Nachlagerung (Shelf life) ausmachen: MCP<br />
verzögerte den Abbau der Fruchtfleischfestigkeit<br />
während der Nachlagerung (7 Tage<br />
bei Raumtemperatur) markant. Auch bei<br />
der Säure zeigten sich die Vorteile der MCP-<br />
Behandlung vor allem nach dem Shelf life.<br />
1-MCP reduzierte zudem das Auftreten von<br />
physiologischen Schäden wie Kernhausund<br />
Fleischbräune. Die ACW-Versuche bestätigten<br />
also die Wirksamkeit der Behandlung,<br />
vorausgesetzt, die <strong>Empfehlungen</strong> des<br />
Lieferanten Agrofresh bezüglich Reifegrad<br />
<strong>zur</strong> Ernte und Behandlungszeitpunkt werden<br />
eingehalten.<br />
Fleischbräune, einer der häufigsten<br />
physiologischen Lagerschäden<br />
Lagerkrankheiten sind Schäden an den<br />
<strong>Früchte</strong>n, welche zum Zeitpunkt der Ernte<br />
noch nicht sichtbar sind. Sie erscheinen<br />
während oder nach der Lagerung. Bei den<br />
Lagerkrankheiten werden zwei Gruppen<br />
von Schäden unterschieden – parasitäre<br />
Krankheiten, welche durch mikrobielle<br />
Schadenerreger verursacht werden, und<br />
physiologische Krankheiten, welche durch<br />
Probleme im Stoffwechsel der <strong>Früchte</strong> verursacht<br />
werden. Einer der häufigsten physiologischen<br />
Schäden ist die Fleischbräune.<br />
Die Ursachen für das Auftreten dieses<br />
Schadens sind vielfältig, einige lassen sich<br />
dem Vorerntebereich zuordnen, andere<br />
werden durch nicht optimale Lagerbedingungen<br />
verursacht.<br />
Vielfältige Ursachen führen zu<br />
Lagerschäden<br />
Im Allgemeinen können physiologische<br />
Krankheiten oft auf Faktoren im Vorernte-<br />
20<br />
<strong>Früchte</strong> & <strong>Gemüse</strong> 8/<strong>20<strong>13</strong></strong> Fruits & Légumes
Forschung | Recherche<br />
xxx | xxx<br />
bereich <strong>zur</strong>ückgeführt werden, wie z.B. die<br />
Kulturführung (Fruchtbehang, Düngung,<br />
Calciumversorgung, Baumgrösse etc.).<br />
<strong>Früchte</strong> z.B. von jungen Bäumen, welche<br />
schwach behangen sind und ein Calciumdefizit<br />
aufweisen, sind anfälliger auf solche<br />
Schäden. Neben den Anbaubedingungen<br />
spielen aber auch die klimatischen Bedingungen<br />
eine wichtige Rolle bei der Entstehung<br />
von physiologischen Schäden.<br />
Der Reifegrad der <strong>Früchte</strong> <strong>zur</strong> Ernte spielt<br />
ebenfalls eine wichtige Rolle, besonders bei<br />
den Krankheiten, die bei überreifen <strong>Früchte</strong>n<br />
auftreten, wie z.B. die Altersfleischbräune.<br />
Diese Krankheit tritt bei <strong>Früchte</strong>n<br />
auf, welche die klimakterische Phase, in<br />
der die Ethylenproduktion stark ansteigt,<br />
schon durchlaufen haben. Die Ethylenbildung<br />
fördert die Fruchtreifung mit den<br />
damit verbundenen Änderungen wie z.B.<br />
Abbau der Fruchtfleischfestigkeit und des<br />
Säuregehaltes, Bildung von Aromastoffen<br />
oder Chlorophyllabbau. Wenn die Reifephase<br />
beendet ist, kommen die <strong>Früchte</strong><br />
in die Phase der Seneszenz bzw. Alterung,<br />
in welcher insbesondere die Fleischbräune<br />
auftreten kann. Die Altersfleischbräune<br />
kann schon auf dem Feld auftreten, wenn<br />
die <strong>Früchte</strong> zu lange am Baum belassen<br />
werden, sie tritt aber auch während oder<br />
nach der Lagerung auf.<br />
Empfohlene Erntefenster unbedingt<br />
einhalten<br />
Normalerweise verzögern ULO-Bedingungen<br />
während der Lagerung die Fruchtreifung<br />
und damit das Erscheinen der Altersfleischbräune,<br />
während diese bei normal<br />
kühlgelagerten oder bei Raumtemperatur<br />
gehaltenen <strong>Früchte</strong>n schneller auftritt. Um<br />
das Auftreten dieses Schadens zu verhindern,<br />
sollten die <strong>Früchte</strong> in den von Agroscope<br />
empfohlenen sortenspezifischen<br />
Erntefenstern gepflückt werden. Andererseits<br />
sollten aber auch unsere <strong>Empfehlungen</strong><br />
<strong>zur</strong> Einstellung der CA-Atmosphäre<br />
und der Temperatur beachtet werden.<br />
Eine zu späte Ernte verbunden mit einer<br />
zu langen Lagerung oder nicht optimalen<br />
Lagerbedingungen erhöhen das Risiko<br />
des Auftretens von physiologischen Schäden.<br />
Da die Behandlung mit 1-MCP die<br />
Fruchtreifung verzögert, reduziert die Behandlung<br />
oft auch die Altersfleischbräune,<br />
sofern sie gemäss den <strong>Empfehlungen</strong> des<br />
Lieferanten durchgeführt wird (optimaler<br />
Pflückzeitpunkt, Behandlung innerhalb von<br />
7 Tagen nach der Ernte). Die Altersfleischbräune<br />
ist neben den Vorerntefaktoren<br />
auch stark sortenabhängig.<br />
Fleischbräune kann z.B. durch zu tiefe Lagertemperaturen<br />
verursacht werden. Die<br />
Sorte Jazz ® z.B. entwickelt solche Schäden<br />
bei Temperaturen von weniger als 3 °C,<br />
während Gala Temperaturen von 0.5 °C<br />
problemlos erträgt. Aus diesem Grund sind<br />
die sortenspezifischen Lagertemperaturen<br />
einzuhalten. Zu tiefe Lagertemperaturen<br />
können jedoch auch noch einen anderen<br />
physiologischen Schaden verursachen, den<br />
sogenannten «soft-scald» (weiche Schalenbräune;<br />
braune, leicht eingesunkene<br />
Flecken auf der Fruchthaut).<br />
Neue NIR-Messgeräte erleichtern<br />
die Detektion<br />
Neben der Lagertemperatur können noch<br />
andere Lagerfaktoren das Auftreten von<br />
Fleischbräune fördern, sofern sie nicht optimal<br />
eingestellt sind: So kann z.B. ein zu<br />
hoher Gehalt an Kohlendioxid im Lager zu<br />
Kernhausbräune und Kavernenbildung führen.<br />
Ebenso kann ein zu tiefer Sauerstoffgehalt<br />
zu Schäden führen, im schlimmsten<br />
Fall zu Fermentation im Fruchtfleisch. Die<br />
Empfindlichkeit gegenüber zu hohen Gehalten<br />
an Kohlendioxid nimmt übrigens<br />
mit abnehmendem Sauerstoffgehalt zu<br />
und ist zudem stark sortenabhängig.<br />
Die Veränderungen im Fruchtfleisch sind<br />
in qualitativer Hinsicht sehr wichtig, auch<br />
wenn die Fleischbräune die sensorisch<br />
wahrnehmbare Qualität nicht immer negativ<br />
beeinflusst und der Verzehr der <strong>Früchte</strong><br />
keine Gefahr für die Gesundheit der<br />
Konsumenten darstellt. Um solche inneren<br />
Schäden zu entdecken, müssen Kontrollen<br />
entlang der Wertschöpfungskette vom Lager<br />
bis zum Konsumenten durchgeführt<br />
werden. In der Praxis wird eine repräsentative<br />
Zahl von <strong>Früchte</strong>n eines Lots hälftig<br />
geschnitten, um Schäden entdecken zu<br />
können. Diese Methode hat den Nachteil,<br />
dass sie destruktiv ist. Zudem ist es nicht<br />
einfach, ein repräsentatives Muster zu ziehen.<br />
Oft ist es nämlich so, dass die Variabilität<br />
innerhalb eines Lots bzw. den <strong>Früchte</strong>n<br />
eines Produzenten oder zwischen verschiedenen<br />
Lots, welche im selben Raum gelagert<br />
werden, relativ gross ist. Die äussere<br />
Beurteilung der <strong>Früchte</strong> ist nicht geeignet,<br />
innere Schäden wie die Fleischbräune zu<br />
entdecken. Um die Detektion von Fleischbräune<br />
zu erleichtern, wurden neue Detektionsmethoden<br />
entwickelt. Insbesondere<br />
die Messung mittels NIR (Near infrared =<br />
nahes Infrarot-Spektrum) ist vielversprechend:<br />
die Messungen sind nicht destruktiv<br />
und schnell durchzuführen, und da alle<br />
bzw. ein hoher Anteil der <strong>Früchte</strong> eines<br />
Lots gemessen werden können, stellt sich<br />
die Frage der repräsentativen Probenahme<br />
nicht. Versuche an der Agroscope mit<br />
einem NIR-Laborgerät vom Lieferanten<br />
SACMI (Italien) und einem NIR-Modul einer<br />
Sortieranlage (Modul IFA von GREEFA,<br />
NL) zeigten, dass Äpfel der Sorte Braeburn<br />
mit Fleischbräune identifiziert und aussortiert<br />
werden konnten. Allerdings erfordert<br />
die Umsetzung einer solchen robusten und<br />
effizienten Methode in der Praxis einen relativ<br />
grossen Aufwand für die Kalibration<br />
der Geräte, indem <strong>Früchte</strong> verschiedener<br />
Herkünfte, verschiedener Jahre und Reifezeitpunkte<br />
getestet werden müssen. Diese<br />
Abklärungen sind immer noch im Gange.<br />
Diagnose des Fleischbräunetyps ist<br />
nicht immer einfach<br />
Die Bestimmung des Typs von Fleischbräune<br />
ist nicht immer einfach, besonders<br />
wenn die Symptome unterschiedlich sind.<br />
Dadurch wird die Ursachenermittlung<br />
insbesondere dann erschwert, wenn verschiedene<br />
Ursachen für die Entstehung des<br />
Schadens infrage kommen. Aus diesem<br />
Grund wird empfohlen, mehrere <strong>Früchte</strong><br />
eines Lots mit verschieden ausgeprägten<br />
Krankheitssymptomen zu analysieren.<br />
Gleichzeitig müssen alle verfügbaren Informationen<br />
zu den <strong>Früchte</strong>n, dem Anbau<br />
und <strong>zur</strong> Lagerung gesammelt und analysiert<br />
werden: Anbaubedingungen, Erntezeitpunkt,<br />
Reifebestimmung <strong>zur</strong> Ernte,<br />
Lagerbedingungen etc. Für die Analyse solcher<br />
Fälle ist es deshalb wichtig, dass diese<br />
Daten vorhanden sind, was in der Praxis oft<br />
leider nicht der Fall ist. n<br />
<strong>Früchte</strong> & <strong>Gemüse</strong> 8/<strong>20<strong>13</strong></strong> Fruits & Légumes<br />
21