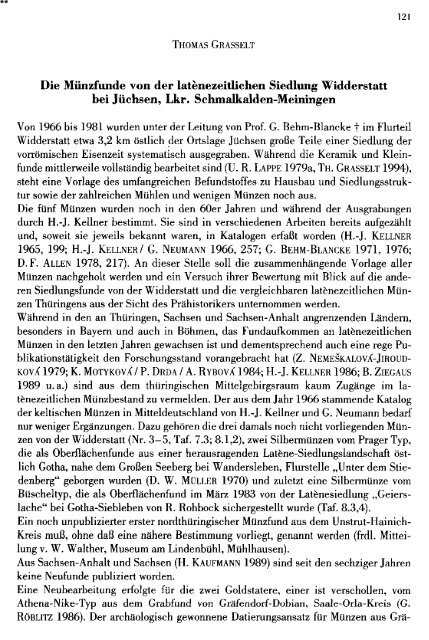THOMAS GRASSELT Die Münzfunde von der latènezeitlichen ...
THOMAS GRASSELT Die Münzfunde von der latènezeitlichen ...
THOMAS GRASSELT Die Münzfunde von der latènezeitlichen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
**<br />
<strong>THOMAS</strong> <strong>GRASSELT</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>Münzfunde</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>latènezeitlichen</strong> Siedlung Wid<strong>der</strong>statt<br />
bei Jüchsen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen<br />
Von 1966 bis 1981 wurden unter <strong>der</strong> Leitung <strong>von</strong> Prof. G. Behm- Blancke t im Flurteil<br />
Wid<strong>der</strong>statt etwa 3,2 km östlich <strong>der</strong> Ortsiage Jüchsen große Teile einer Siedlung <strong>der</strong><br />
vorrömischen Eisenzeit systematisch ausgegraben. Während die Keramik und Kleinfunde<br />
mittlerweile vollständig bearbeitet sind (U. R. LAPPE 1979a, TH. <strong>GRASSELT</strong>1994),<br />
steht eine Vorlage des umfangreichen Befundstoffes zu Hausbau und Siedlungsstruktur<br />
sowie <strong>der</strong> zahlreichen Mühlen und wenigen Münzen noch aus.<br />
<strong>Die</strong> fünf Münzen wurden noch in den 60er Jahren und während <strong>der</strong> Ausgrabungen<br />
durch H.-J. Kellner bestimmt. Sie sind in verschiedenen Arbeiten bereits aufgezählt<br />
und, soweit sie jeweils bekannt waren, in Katalogen erfaßt worden (H.-J. KELLNER<br />
1965, 199; H.-J. KELLNER! G. NEUMANN 1966, 257; G. BEHM-BLANCKE 1971, 1976;<br />
D. F. ALLEN 1978, 217). An dieser Stelle soll die zusammenhängende Vorlage aller<br />
Münzen nachgeholt werden und ein Versuch ihrer Bewertung mit Blick auf die an<strong>der</strong>en<br />
Siedlungsfunde <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt und die vergleichbaren <strong>latènezeitlichen</strong> Münzen<br />
Thüringens aus <strong>der</strong> Sicht des Prähistorikers unternommen werden.<br />
Während in den an Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt angrenzenden Län<strong>der</strong>n,<br />
beson<strong>der</strong>s in Bayern und auch in Böhmen, das Fundaufkommen an <strong>latènezeitlichen</strong><br />
Münzen in den letzten Jahren gewachsen ist und dementsprechend auch eine rege Publikat<br />
den Forschungsstand vorangebracht hat (Z. NEMESKALOVA-JIROUDKO<br />
1979; K. MOTYKOVÀ( P. DRDA! A. RYBOVI( 1984; H.-J. KELLNER 1986; B. ZIEGAUS<br />
1989 u. a.) sind aus dem thüringischen Mittelgebirgsraum kaum Zugänge im latènez<br />
Münzbestand zu vermelden. Der aus (1cm Jahr 1966 stammende Katalog<br />
<strong>der</strong> keltischen Münzen in Mitteldeutschland <strong>von</strong> H.-J. Kellner und G. Neumann bedarf<br />
nur weniger Ergänzungen. Dazu gehören die drei damals noch nicht vorliegenden Münzen<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt (Nr. 3-5, Taf. 7.3; 8.1,2), zwei Silbermünzen vom Prager Typ,<br />
die als Oberflächenfunde aus einer herausragenden Latène- Siedlungslandschaft östlich<br />
Gotha, nahe dem Großen Seeberg bei Wan<strong>der</strong>sleben, Flurstelle "Unter dem Stiedenbe<br />
geborgen wurden (D. W. MÜLLER 1970) und zuletzt eine Silbermünze vom<br />
Büscheltyp, die als Oberflächenfund im März 1983 <strong>von</strong> <strong>der</strong> Latènesiedlung "Geierslache"<br />
bei Gotha- Siebleben <strong>von</strong> R. Rohbock sichergestellt wurde (Taf. 8.3,4).<br />
Ein noch unpublizierter erster nordthüringischer Münzfund aus dem Unstrut-Hainich-Kreis<br />
muß, ohne daß eine nähere Bestimmung vorliegt, genannt werden (frdl. Mitteilung<br />
y. W. Walther, Museum am Lindenbühl, Mühlhausen).<br />
Aus Sachsen-Anhalt und Sachsen (H. KAUFMANN 1989) sind seit den sechziger Jahren<br />
keine Neufunde publiziert worden.<br />
Eine Neubearbeitung erfolgte für die zwei Goldstatere, einer ist verschollen, vom<br />
Athena- Nike- Typ aus dem Grabfund <strong>von</strong> Gräfendorf- Dobian, Saale- Orla- Kreis (G.<br />
RÖBLITZ 1986). Der archäologisch gewonnene Datierungsansatz für Münzen aus Grä
ern in Mitteleuropa (H. POLENZ 1982, 101f.) wird aufgenommen und mit geidgeschic<br />
Überlegungen zur Herkunft und Entstehungszeit <strong>der</strong> Statere verbunden.<br />
<strong>Die</strong> zuvor <strong>von</strong> K. CASTELIN (1981) vertretene Spätdatierung in die zweite Hälfte des<br />
2. Jh. y. u. Z. muß aufgegeben werden. <strong>Die</strong> zunächst vorgenommene relativchronologisehe<br />
Einordnung des Fundes in die Stufe Latène C2/D (H. KAUFMANN 1963a, 144)<br />
wird nach unten korrigiert. Nach den neuen Untersuchungen gehört <strong>der</strong> Grabfund an<br />
das Ende <strong>der</strong> Stufe Latène B und damit absolut noch in die erste Hälfte des 3. Jh. v.u.Z.<br />
(H. POLENZ 1982, 130).<br />
Mit Ausnahme <strong>der</strong> Stücke <strong>von</strong> Dobian, liegen aus dem mitteldeutschen Raum keine<br />
keltischen Münzen aus archäologisch datierbaren, geschlossenen Funden vor. Bei allen<br />
handelt es sich um Oberflächen-, Siedlungs- o<strong>der</strong> Einzelfunde mit oft gemin<strong>der</strong>tem<br />
Quellenwert, <strong>der</strong>en Datierung letztlich durch den Forschungsstand zu den einzelnen<br />
Geprägen bestimmt wird. Sie sind in Thüringen bei <strong>der</strong> gegenwärtigen Quellenlage als<br />
ortsfremde Erzeugnisse zu bewerten, die es gestatten, zusammen mit Latèneimportgut<br />
die Hauptrichtungen <strong>der</strong> Beziehungsfel<strong>der</strong> und ihre Reichweite in die Keltiké zu rekonst<br />
Neuere systematische Ausgrabungen auf latènezeitiichen Siedlungen <strong>von</strong> Großfahner,<br />
Lkr. Gotha (S. BARTHEL 1984), und Westgreußen, Lkr. Sömmerda (G. BEHM-BLANCKE<br />
1979), sowie eine Anzahl kleinerer Grabungen <strong>der</strong> archäologischen Denkmalpflege,<br />
beson<strong>der</strong>s im Raum Gotha (TH. HucK 1994), lieferten keine <strong>Münzfunde</strong>.<br />
Mit ihren fünf Münzen hat die Wid<strong>der</strong>statt als offene Siedlung im thüringischen Süden<br />
am Nordrand des Grabfeldes nahe <strong>der</strong> Steinsburg bei Römhild gelegen, quantitativ und<br />
qualitativ die führende Position in <strong>der</strong> keltischen Münzstatistik Thüringens inne. Man<br />
wird da<strong>von</strong> ausgehen müssen, daß dies keine allein im gegenwärtigen Forschungsstand<br />
begründete Zufälligkeit ist.<br />
Latènemünzen <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt<br />
1. Silbermünze vom "Prager Typ"<br />
Oberflächenfund <strong>von</strong> K. Heydenblut, 12.06. 1957, Fläche 7<br />
Gew.: 1,400 g; Dm.: 1,5 cm; Dicke (am Rand): 0,6-0,8 mm, (Mitte): 1,4 mm.<br />
Av. Kopf völlig aufgelöst, nach rechts (?), mehrere Kugelpaare.<br />
Rv. Pferd nach rechts, Beine abgeknickt, langer Schweif aus drei Strichen, vier Kugeln<br />
(anstelle <strong>der</strong> Mähne) über dem Hals und eine Kugel unter dem Kopf, dazu ein<br />
Ring mit Kugelenden.<br />
Lit: H.-J. KELLNER 1965, 199, Nr. 16; H.-J. KELLNER! G. NEUMANN 1966, 257, Nr.<br />
18; G. BEHM-BLANCKE 1971, 248; 1976, 108.<br />
mv. Nr. Museum Weimar: 568!64 (Taf. 7.1).<br />
2. Silbermünze (ähnlich 3.)<br />
Oberflächenfund <strong>von</strong> K. Heydenblut, 2.5. 1959, Fläche 9<br />
Gew.: 1,651 g; Dm.: 1,3 cm; Dicke (am Rand): 0,5-0,9 mm, (Mitte): 2,3 mm.
Av. Kopf stark stilisiert, nach rechts.<br />
Rv. Pferd nach links, Beine abgeknickt, wehende Mähne, Schweif nur angedeutet,<br />
unter dem Kopf vier Kugeln.<br />
Lit: H.-J. KELLNER! G: NEUMANN 1966, 257, Nr. 19; G. BEHM-BLANCKE 1971, 248;<br />
1976, 108; D. F. ALLEN 1978, 217.<br />
mv. Nr. Museum Weimar: 664/64 (Taf. 7.2).<br />
3. Silbermünze (ähnlich 2.)<br />
Grabung 1966, Schnitt I, im Aushub bei 17 m (Bachbereich)<br />
Gew.: 1,750 g; Dm.: 1,3 cm; Dicke (am Rand): 0,4-1,3 mm, (Mitte): 1,9 mm.<br />
Av. abgerundete erhabene Fläche, Kopf (?) zum Rand abgesetzt.<br />
Rv. Pferd nach links, Schweif angedeutet, anstelle <strong>der</strong> Beine vorn vier und hinten<br />
drei Kugeln mit Strichverbindung.<br />
Lit: G. BEHM-BLANCKE 1976, 108.<br />
mv. Nr. Museum Weimar: 502 /68 (Taf. 7.3).<br />
4. glattes Regenbogenschüsselchen (Viertelstater)<br />
Grabung 1968, Schnitt X, in <strong>der</strong> Kulturschicht bei 46 m, Tiefe: 0, 33 m.<br />
Gew.: 1,974 g; Dm.: 1,17 cm; Dicke (am Rand): 0,7-1,4 mm<br />
Av. konvex, erhabene runde Fläche zum Rand <strong>der</strong> Münze abgesetzt, glatt.<br />
Rv. konkav, im Zentrum einige Unebenheiten, kein eindeutiges Bild, sonst glatt.<br />
Lit: G. BEHM-BLANCKE 1971, 248; 1976, 108.<br />
mv. Nr. Museum Weimar: 663/68 (Taf. 8.1).<br />
5. Potinmünze (Leuker)<br />
Grabung 1966, Schnitt I, im Bachbereich bei 11,95 m, Tiefe: 0,65 m.<br />
Gew.: 4,080 g; Dm.: 1,66 cm; Dicke (am Rand): 1,0-1,9 mm, (Mitte): 3,2 mm.<br />
Av. kaum noch erkennbarer Kopf (?) nach links.<br />
Rv. stark stilisierte Eberfigur nach links.<br />
Lit: G. BEHM-BLANCKE 1971, 248; 1976, 108.<br />
mv. Nr. Museum Weimar: 719/66 (Taf. 8.2).<br />
Typologie, Chronologie und Verbreitung<br />
<strong>Die</strong> Münze vom Prager Typ (Taf. 7.1) wurde zusammen mit einem Neufund <strong>von</strong> <strong>der</strong> Alteburg<br />
bei Arnstadt (U. LAPPE 1964, 247) in einer Vorlage <strong>der</strong> Gepräge dieser Art<br />
durch H.-J. KELLNER (1965, 199) vorgestellt. Das Exemplar <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt wird<br />
durch das auf dem Revers abgebildete nach rechts springende Pferd zur häufigen Variante<br />
I gezählt. <strong>Die</strong> Vor<strong>der</strong>seite zeigt Kugeln, Ringe mit Kugelenden und Striche.<br />
<strong>Die</strong>se Symbolik läßt den auf dem Avers zu erwartenden Kopf völlig auf und zeigt zugleich<br />
die Distanz <strong>der</strong> Hersteller dieser Münzen zum ursprünglichen Bildinhalt. Auch<br />
die beiden Münzen <strong>von</strong> Wan<strong>der</strong>sleben tragen das Pferd nach rechts galoppierend mit
dem betont langen, dreifach längs geteilten Schweif und Kugeln sowie Ringen mit Kugelend<br />
als Beizeichen (D. W. MÜLLER 1970, Abb. 6,7). Von stempelgleichen Exemplaren<br />
kann bei diesen Neufunden <strong>von</strong> <strong>der</strong> gleichen Siedlungsstelle nicht die Rede<br />
sein. Als Vorbil<strong>der</strong> für den Typ werden Nachprägungen römischer Republikdenare mit<br />
beheimtem Romakopf auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>- und Pferd auf <strong>der</strong> Rückseite benannt (K. CASTE- LIN<br />
1985,42). In Frage kommen beson<strong>der</strong>s spätere Ausgaben <strong>der</strong> Denare ab 175 y. u. Z.<br />
Mit dem Auftreten früher Nachahmungen dieser Stücke im östlichen Mittelgallien<br />
wird eine ursprünglich westliche Abstammung <strong>der</strong> Münzen vom Prager Typ wahrschei<br />
<strong>Die</strong> Herstellung des Prager Typs muß, folgt man <strong>der</strong> Verbreitung, im<br />
böhmisch- mitteldeutschen Raum erfolgt sein (H.-J. KELLNER 1965, 195ff.). Aus<br />
Thüringen liegen, sicher lokalisiert aber im archäologischen Kontext nie näher datiert,<br />
sieben Prager Typen zwischen ca. 1,3 und 1,9 g Gewicht vor. Weitere acht Münzen aus<br />
dem Gothaer Münzkabinett, unter ihnen das einzige Exemplar <strong>der</strong> Variante 2 mit dem<br />
Pferd nach links, sind nach ihrem Fundort unsicher und in <strong>der</strong> Zuordnung zu einem<br />
Depotfund ebenfalls fraglich. Im Katalog <strong>der</strong> keltischen Münzen Mitteldeutschlands<br />
erscheinen diese bei H.-J. KELLNER (ebd., Abb. 12.20-27) noch abgebildeten Prager<br />
Typen nicht mehr. Es findet sich im Katalog lediglich eine Münze vom Prager Typ<br />
nördlich und damit deutlich außerhalb des west- und südthüringischen Verbreitungsschwe<br />
und zwar <strong>von</strong> Gödnitz, Lkr. Zerbst, als Siedlungsfund vom rechten Elbufer<br />
nahe Magdeburg nachgetragen (W. SCHULZ 1928, 46). Auch <strong>von</strong> den böhmischen<br />
Stücken sind vier Münzen nicht zu lokalisieren. Es bleiben eigentlich nur die beiden<br />
Prager Typen aus dem Depotfund <strong>von</strong> Prag- ZIZKOV; die bei <strong>der</strong> Erfassung des "Wangione<br />
(Typ 5) als Grabfund erscheinen (G. BEHRENS1950, 347) und eine weitere<br />
Einzelmünze aus Prag (H.-J. KELLNER 1965, 197 f.). <strong>Die</strong> meisten Stücke <strong>von</strong> einer<br />
Fundstelle in Böhmen erbrachte <strong>der</strong> Hradiste <strong>von</strong> Stradonice (J. L. PIC 1906, Taf. II,<br />
45). Zwischen den böhmischen und mitteldeutschen Fundmünzen vom Prager Typ verbinde<br />
nicht etwa sächsische Funde entlang des Elbelaufes, son<strong>der</strong>n wenige nordbayer<br />
Exemplare <strong>von</strong> Nürnberg, Müdesheim, Lkr. Main- Spessart, und vom Staffelber<br />
bei Staffelstein (B. ZIEGAUS 1989, 92; 124). <strong>Die</strong> Münze vom Staffelberg in südlicher<br />
und die <strong>von</strong> <strong>der</strong> Alteburg bei Arnstadt in nördlicher Richtung, bereits jenseits<br />
des Thüringer Waldes gefunden, sind die nächstliegenden Parallelen zum Jüchsener<br />
Stück (Abb. 1, S. 137).<br />
Das Fundaufkommen des Typs wäre außerdem mit einigen Münzen zu vervollständigen,<br />
die D. F. ALLEN (1978, 229) aus dem Cabinet des Medailles <strong>der</strong> Nationalbibliothek<br />
in Paris auflistet und abbildet, jedoch wegen <strong>der</strong> offenbar unbekannten Fundplätze<br />
nicht kartieren kann (ebd., Karte 2).<br />
<strong>Die</strong> Datierung des Prager Typs erfolgt nach numismatischen und archäologischen<br />
Überlegungen in das 1. Jh. y.u. Z. Grabfunde o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e geschlossene Funde, die solche<br />
Gepräge enthalten und exakt zu datieren gestatten, fehlen auch außerhalb Thüringens.<br />
Auch unter Beachtung historischer Ereignisse rechnet H.-J. Kellner, <strong>der</strong> den<br />
Prager Typ den Boiern zuschreibt, nicht mit einer Prägung bereits im 2. Jh. y. u. Z..<br />
Spätestens mit dem Ende <strong>der</strong> boischen Oppida müßten auch mögliche Werkstätten die<br />
Prägung <strong>von</strong> Münzen eingestellt haben. Das geschah bis kurz nach <strong>der</strong> Mitte des 1. Jh.
v. u. Z. im jüngsten Latènehorizont mit Schüsselfibeln und Almgren 65 (K. M0TYK0VX/<br />
P. DRDA/ A. RYB0VX 1978, 214; L. JANsovX 1988, 320).<br />
Ein weiterer Ansatz zur Datierung ist aus <strong>der</strong> typologischen Verwandtschaft <strong>der</strong> Münzen<br />
vom Prager Typ zum Büscheltyp abzuleiten (H.-J. KELLNER! G. NEUMANN 1966,<br />
255; D. F. ALLEN 1967). <strong>Die</strong>s kann eine annähernd gleiche zeitliche Einordnung für<br />
beide gestatten, zumal auch <strong>der</strong> gleiche Prototyp erwartet wird. <strong>Die</strong> Büschelquinare<br />
waren in großer Zahl in Süddeutschland im Umlauf und sind aus Schatzfunden und<br />
Siedlungen überliefert (H.-J. KELLNER 1990, 18ff., 35ff.). Beson<strong>der</strong>s die Vergesellschaft<br />
<strong>von</strong> Büschelmünzen mit aussagekräftigen Latènefunden in Siedlungsgruben<br />
<strong>von</strong> Manching eröffnet Datierungsmöglichkeiten. Es wird <strong>von</strong> einer unterschiedlichen<br />
Feindatierung <strong>der</strong> Büschelmünzenvarianten zwischen dem Ende des 2. und nach <strong>der</strong><br />
Mitte des 1. Jh. y. u. Z. ausgegangen. In die gleiche Zeitspanne gehört auch die Silbermünz<br />
vom Prager Typ aus Jüchsen. <strong>Die</strong> Büschelmünze vom Nordaufgang zur Alteburg<br />
<strong>von</strong> Arnstadt (A. GÖTzEIP. HÖFER/P. ZSCHIESCHE 1909, Taf. XVII. 255) gehört zur<br />
Gruppe A, Typus 9 bei U. FRIEDLÄNDER (1978, 36) und zu D. F. ALLEN5 Typ A <strong>der</strong><br />
schwäbischen Serie (1978, 217 u. Taf. 32). Das neu gefundene Stück <strong>von</strong> <strong>der</strong> "Geierslache"<br />
bei Gotha- Siebleben (Taf. 8.3) zählt zum Typ E <strong>der</strong> bayerischen Serie (ebd., Taf.<br />
34.64) und steht <strong>der</strong> Gruppe B, Typen 17-19, aus einem Schatzfund bei Nürnberg bestenfa<br />
nahe (U. FRIEDLÄNDER1978, 37). Das Büschel auf dem Avers geht ohne Richtungs<br />
<strong>von</strong> vier zentralen Punkten aus. Das Pferd auf <strong>der</strong> Rückseite ist mit an<strong>der</strong>en<br />
Beizeichen versehen als sie auf den Münzen aus dem Schatzfund <strong>von</strong> Nürnberg<br />
vorkommen.<br />
<strong>Die</strong> Münze läßt bei Vergrößerung (Taf. 8.4) auf dem Revers eine fast gleichmäßige, gerade<br />
Schnittspur erkennen. Nach <strong>der</strong> Ausführung des Schnittes ist sicher auszuschlie<br />
daß es sich um eine Hiebmarke handelt, wie auf den Goldmünzen <strong>von</strong> Dobian<br />
und Merseburg. Auch als Zeugnis für eine "Echtheitsprüfung" fällt die Spur zu<br />
schwach aus. Sehr wahrscheinlich ist, daß man die Münze teilen wollte, den Versuch<br />
dann aber aufgab.<br />
Vergleichbare Münzen enthielt <strong>der</strong> Versteckfund <strong>von</strong> Langenau, <strong>der</strong> durch zwei Paar<br />
bronzene Korallenfibeln vom Frühlatèneschema archäologisch datiert werden kann (H.<br />
REIM 1980). Korallenfibeln liegen aus Brandgräbern des Mittelelbe- und Saalegebietes<br />
vor und gehören nach Aussage <strong>der</strong> Fundvergesellschaftungen, soweit sicher, nach<br />
Latène Dl (R. MÜLLER 1985, 75 f.), könnten aber mit frühen Vertretern auch schon am<br />
Ende <strong>von</strong> Latène C in die Erde gelangt sein (W. WALTHER 1992, 287). <strong>Die</strong> Fibeldatierung<br />
bietet ausreichend Raum für die historische Erklärung einer Vergrabung des Geldes<br />
in <strong>der</strong> Zeit des Ariovist und des beginnenden Gallischen Krieges (D. MANNSPERGER<br />
1984, 236f.).<br />
Für die Büschelquinare aus Thüringen ist eine Datierung vorzunehmen, die <strong>der</strong> des<br />
Prager Typs<br />
entspricht.<br />
<strong>Die</strong> Silbermünzen Nr. 2 und 3 zählen auch zu den Quinaren. Sie stimmen in ihren Abmess<br />
0,1 g <strong>von</strong>einan<strong>der</strong> ab.<br />
weitestgehend überein und weichen auch im Gewicht nur etwas weniger als
H.-J. Kellner lag das Exemplar Nr. 2 bei <strong>der</strong> Katalogzusammenstellung zu den mitteldeutsc<br />
Keltenmünzen bereits zur Bestimmung vor (Taf. 7.2).<br />
"Das Stück wird durch gewisse Stileigentümlichkeiten mit dem süddeutschen Büschel<br />
aber auch mit dem "Prager Typ" und norischen Fundstücken <strong>von</strong> Karlstein<br />
und Umgebung verknüpft." (H.-J. KELLNER/ G. NEUMANN 1966, 257).<br />
Das zweite Exemplar weist im Münzbild nur geringe Unterschiede auf (Taf. 7.3). Das<br />
Pferd auf dem Revers ist vergleichbar, besitzt aber keine Mähne und noch weniger<br />
deutliche Beine, die vorn durch vier und hinten durch drei Kugeln - nur je zwei sind<br />
durch Striche miteinan<strong>der</strong> verbunden - angedeutet werden. <strong>Die</strong> Pferdekörper sind sehr<br />
plastisch wirkend aus zwei Kugeln zusammengesetzt und die Schweife bei beiden Reversb<br />
nur angedeutet. Während bei Exemplar Nr. 2 die Vor<strong>der</strong>seite stärker aufgeglie<br />
entfernt an die Büschelbildung erinnert, zeigt die Münze Nr. 3 eine kaum<br />
differenzierte, herausgehobene runde Fläche auf dem Avers.<br />
<strong>Die</strong>se Silbermünze fand sich zusammen mit <strong>der</strong> Potinmünze (Nr. 5, Taf. 8.2) im Uferbereic<br />
des Baches am Abfluß eines kleinen Quellsees mit vielen an<strong>der</strong>en Schmuckund<br />
Trachtteilen <strong>der</strong> frühen bis späten Latènezeit.<br />
Unter den zahlreichen Quinaren aus Manching sind nur zwei Münzen zu finden, die<br />
den beiden Jüchsener Exemplaren, beson<strong>der</strong>s dem im mitteldeutschen Katalog bereits<br />
enthaltenen Stück ähneln. Sie stammen aus den Ausgrabungen <strong>der</strong> Schnitte 695/1972<br />
und 822/1984. Beide sind mit Gewichten <strong>von</strong> 1,826 und 2,059 g deutlich schwerer als<br />
die Jüchsener Quinare (H.-J. KELLNER 1990, Taf. 5. 73,74). <strong>Die</strong> beiden Münzen <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Wid<strong>der</strong>statt liegen mit ihren Gewichten <strong>von</strong> 1,651 und 1,750 g nur knapp unter den<br />
Durchschnittsgewichten <strong>der</strong> Büschelquinare aller Gruppen (1,773 g) und dem <strong>der</strong><br />
Gruppe A (1,758 g) <strong>von</strong> Manching (H.-J. KELLNER 1990, 21f.). <strong>Die</strong> fast völlige Unkennt<br />
<strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite unterscheidet die beiden Jüchsener Münzen <strong>von</strong> den<br />
meisten Büscheltypen, die in <strong>der</strong> süddeutschen Quinarlandschaft im Umlauf waren<br />
und die vielleicht auch in Manching geprägt wurden (H.-J. KELLNER 1990, 10). <strong>Die</strong><br />
Pferdedarstellungen auf den o. g. zwei Beispielen aus Manching und einige Stücke aus<br />
Berching- Pollanten sind aber den Jüchsener Exemplaren durchaus stilistisch vergleich<br />
(H.-J. KELLNER 1990, Taf. 41. 956-958). Zu dieser Gruppe zunehmend "verwil<strong>der</strong><br />
Silberprägungen" (D. MANNSPERGER 1984, 233) könnten möglicherweise<br />
auch Quinare aus Baden, wie <strong>der</strong> <strong>von</strong> Kürnberg, Lkr. Lörrach, zusammen mit wenigen<br />
weiteren, nicht sicher bestimmbaren Stücken gezählt werden (F. WIELANDT 1964, Nr.<br />
22b, 30a, 41). Beide Münzen lassen sich nach den Münzbil<strong>der</strong>n auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>- und<br />
Rückseite nicht mit dem Prager Typ vergleichen. Es bleiben die Gewichte in <strong>der</strong> Nähe<br />
<strong>der</strong> Quinarstückelung, beim Prager Typ mit durchschnittlich 1,501 g (H.-J. KELLNER<br />
1965, 206) noch deutlich darunter, und nur formell die Pferdedarstellungen auf dem<br />
Revers. Gerade sie weichen aber wie<strong>der</strong> stilistisch erheblich <strong>von</strong>einan<strong>der</strong> ab und sind<br />
auch entgegengesetzt gerichtet (Taf. 7.1-3).<br />
<strong>Die</strong> Herstellung <strong>von</strong> Silbermünzen auf den Oppida <strong>von</strong> Stradonice, Zavist und Hrazany<br />
in Böhmen (L. JANSOVI( 1974; K. MOTYKOVt(/P. DRDA/ A. RYBOVJ(1984) gilt als sicher.<br />
Als heimische Gepräge werden, neben den Prager Typen, die Kleinsilbermünzen mit<br />
Pferdedarstellung genannt. <strong>Die</strong> Tüpfelplatten <strong>der</strong> Gruppe B vom Oppidum Zavist wuwur
den zur Produktion <strong>von</strong> Silberschrötlingen benutzt, die einen Durchmesser <strong>von</strong> meist<br />
8,0-9,0 mm aufwiesen und auf <strong>der</strong> Rückseite mit einem Pferd gestempelt wurden. Das<br />
Gewicht einer Münze <strong>von</strong> Zavist wird mit 0,408 g angegeben (L. JANSOVA1974, 24).<br />
Bei den zu vergleichenden norischen Prägungen handelt es sich um Kleinsilbermünzen<br />
des Pferdchentyps, die denen <strong>der</strong> böhmischen Oppida ähneln (R. GÖBL 1992). Auch sie<br />
tragen das Pferd auf <strong>der</strong> Rückseite (M. MENKE 1968, Taf. 2). <strong>Die</strong> Beine sind meist noch<br />
deutlich ausgeprägt. <strong>Die</strong> Vor<strong>der</strong>seiten weisen, wie das Jüchsener Stück Nr. 3 (Taf. 7.3),<br />
nur eine runde Erhebung auf.<br />
Der Vergleich <strong>der</strong> beiden Jüchsener Silberquinare mit an<strong>der</strong>em Silbergeld sollte helfen,<br />
das Entstehungs- und Umlaufgebiet näher einzuengen. Danach müßten beide<br />
Stücke in die Nähe des Büscheltyps gestellt werden. Mangels vergleichbarer südöstlicher<br />
Prägungen in <strong>der</strong> Stückelung des Quinars und trotz <strong>der</strong> Münzbildunterschiede, die<br />
vielleicht auch durch Stempelverschlechterung verursacht wurden, sind die Jüchsener<br />
Münzen <strong>der</strong> süddeutschen Quinarlandschaft zuzurechnen und D. F. ALLENS(1979, Taf.<br />
32) Gruppe A wenn auch mit Vorbehalten anzuschließen.<br />
Bei <strong>der</strong> einzigen Goldmünze <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt handelt es sich um ein glattes Regenbogen<br />
Der Viertelstater wurde 1968 aus <strong>der</strong> Kulturschicht in 0,35 m Tiefe<br />
geborgen. Bei <strong>der</strong> Münze fanden sich jüngerlatènezeitliche Keramik und eine unvollständi<br />
eiserne Drahtfibel vom Mittellatèneschema ähnlich <strong>der</strong> Variante Kostrzewski<br />
A (TH. <strong>GRASSELT</strong>1994, Taf. 3.18) sowie ein Glasarmringbruchstück <strong>der</strong> Gruppe 16<br />
nach TH. E. HAEVERNICK (1960,64). Das durchscheinend blaue Fragment mit fünf Rippen<br />
und <strong>der</strong> nach Art des laufenden Hundes aufgelegte Faden (U. R. LAPPE 1979 b, Taf.<br />
VII.157) ist nach jüngeren Bearbeitungen <strong>von</strong> Glasarmringen in Latène C 2 zu erwarten<br />
(R. GEBHARD 1989, 17). Auch nur wenige Meter entfernt befand sich die eingetiefte<br />
Hütte 62/68. Das aus <strong>der</strong> Hausgrubenfüllung geborgene Keramikmaterial, darunter<br />
auch Graphittonscherben, datiert etwa an den Übergang <strong>von</strong> <strong>der</strong> Mittel- zur Spätlatèneze<br />
(TH. <strong>GRASSELT</strong>1994, Taf. 62, Abb. 10). <strong>Die</strong> Münze und die genannten Kleinfunde,<br />
auch die eingetiefte Hütte, markieren mit ihrer Lage und Verteilung in <strong>der</strong> Ausgrabu<br />
den Standort eines möglicherweise hofartigen Gebäudekomplexes und<br />
datieren ihn.<br />
Goldene Statere und ihre Stückelungen sind die häufigsten keltischen Münzen im<br />
thüringischen Mittelgebirgsraum. Sie sind es auch, die die Forschung in Thüringen<br />
schon am Beginn des 19. Jh. beschäftigten. In das Jahr 1818 datiert die Veröffentlichung<br />
einer Meinungsäußerung J. W. y. Goethes zum Thema Regenbogenschüsselchen,<br />
die im Anschluß an einen Aufsatz seines Schwagers CH. A. VULPIUS (1818,25 if.)<br />
in den Weimarer Curiositäten abgedruckt worden ist. Bereits in diesen Arbeiten wird<br />
deutlich, daß <strong>der</strong> Münzgeldcharakter <strong>der</strong> Goldstücke stark diskutiert wurde und weitgehen<br />
Anerkennung fand.<br />
Bei Frhr. G. y. DONOP (1819, 27f., 104 ff.) findet sich die älteste, numismatisch korrekte,<br />
Ansprache keltischer Münzen des Grabfelds. Jahre später listet er im Zusammenhang<br />
mit geldgeschichtlichen Überlegungen eine ganze Reihe thüringische Regenbogenschüs<br />
mit lei<strong>der</strong> ungenauen Fundortangaben auf (1838, 40ff.). H.-J. KEKELLNER
und G. NEUMANN (1966) erfassen 37 keltische Goldmünzen für den mitteldeutschen<br />
Raum. Entlang <strong>von</strong> Elbe und Saale verteilen sich 18 Exemplare <strong>von</strong> sieben Fundplätzen,<br />
die aus dem Südosten ins Land gekommen sind, darunter <strong>der</strong> Schatzfund <strong>von</strong><br />
Thießen, bestehend aus sieben Goldstateren (H.-J. KELLNER/ G. NEUMANN 1966,<br />
Abb. 1). <strong>Die</strong> Masse <strong>der</strong> Goldmünzen, darunter auch die glatten Regenbogenschüsselchen,<br />
konzentriert sich in Mittel- und Südthüringen. Es dominieren die Statere. Ihre<br />
Viertel sind bisher überhaupt nur 8 mal gefunden worden. Von diesen Viertelstateren<br />
zählen sechs Münzen zur Gruppe <strong>der</strong> glatten Exemplare.<br />
In <strong>der</strong> ersten Bearbeitung <strong>der</strong> glatten Regenbogenschüsselchen durch K. CASTELINund<br />
H.-J. KELLNER 1963 werden bereits jene sechs südthüringischen Viertelstatere aus<br />
dem Raum Meiningen vorgelegt, die aus <strong>der</strong> Sammlung Frhr. G. y. Donops (1839)<br />
stammten und verschollen sind. <strong>Die</strong> Stücke wiegen zwischen 1,593 und 2,07 g und<br />
werden zusammen mit an<strong>der</strong>en Goldmünzen als Bestandteile eines Schatzfundes angesehen<br />
was allerdings nicht als gesichert gilt (H.-J. KELLNER! G. NEUMANN 1966, 258).<br />
Der bisher eher bescheidenen Fundausbeute glatter Viertelstücke aus dem thüringischen<br />
Grabfeldanteil steht eine mehrfach größere Fundmenge aus Franken gegenüber<br />
(B. ZIEGAUS 1989, 112). Dort stellen die glatten Typen (Gruppe V A) annähernd ein<br />
Drittel <strong>der</strong> Funde und konzentrieren sich im württembergisch- fränkischen Raum. Nach<br />
Norden und Nordosten zeigt die Karte eine deutlich abnehmende Funddichte (ebd.,<br />
Beilage 2). <strong>Die</strong> nächsten Parallelen zum Regenbogenschüsselchen <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt<br />
sind aus dem unterfränkischen Grabfeld <strong>von</strong> Bad Neustadt und Großeibstadt im Rhön- Grabfeldk<br />
sowie Arnshausen und Burkardroth im Lkr. Bad- Kissingen als Einzelund<br />
Oberflächenfunde überliefert. <strong>Die</strong>se unterfränkischen glatten Viertelstücke dürften<br />
mit einiger Sicherheit als Hinweise auf eine südwestliche Herkunft des Jüchsener<br />
Exemplars gelten und zeichnen den Weg nach, den das glatte Regenbogenschüsselchen<br />
bis auf die Wid<strong>der</strong>statt gegangen sein könnte. Als möglicher Herstellungsort<br />
wird das Oppidum Finsterlohr diskutiert und Manching weitgehend ausgeschlossen<br />
(K. CASTELIN/ H.-J. KELLNER 1963, 119; B. ZIEGAUS 1989, 127; H.-J. KELLNER 1990,<br />
10f.).<br />
Zur metallographischen Bestimmung des Goldes für die Schrötlinge, aus denen Regenbogen<br />
geprägt wurden, liegen Analysen vor. <strong>Die</strong> Untersuchungen A.<br />
HARTMANN5 (1976, Tab. 5b; 1990, 230ff.) an den glatten Viertelstateren zeigen Ähnlichke<br />
mit den 1/24<br />
Stateren.<br />
Glatte Viertelstatere werden seit dem Ende <strong>der</strong> Mittellatènestufe C geprägt und sind<br />
während <strong>der</strong> Stufe Latène Dl im Umlauf (B. OVERBECK 1986, 106 ff.; H.-J. KELLNER<br />
1990, 32 f.).<br />
<strong>Die</strong> Jüchsener Potinmünze (Taf. 8.2) fand sich im Bachbereich, inmitten einer großen<br />
Anzahl <strong>von</strong> Latènefibeln und Glasarmringresten, die zumindest zum Teil mit Absicht<br />
ins Wasser gelangten. Daneben wurden im Uferbereich des Baches aber auch reichlich<br />
Verlierfunde und Siedlungsabfall ausgegraben. Der nur schwer erkennbare Kopf auf<br />
<strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite blickt nach links. Das Haar ist in drei Strähnen aufgeteilt und durch<br />
ein breites Band vom Gesicht abgesetzt. Vom Gesicht sind Mund, Auge und Nase an-
gedeutet erkennbar. <strong>Die</strong> Eberdarstellung auf dem Revers zeigt ebenfalls nach links.<br />
Zwischen den Beinen stehen zwei Punkte. <strong>Die</strong> Münze paßt in die Typologie <strong>der</strong> Potinmünze<br />
<strong>der</strong> Leuker, bei <strong>der</strong> zwei Gruppen unterschieden werden (A. FURGER-GUNTI /<br />
H.-M. y. KAENEL 1976, 66). <strong>Die</strong> Münze <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt gehört zur zweiten Typengrupp<br />
Eine Kante <strong>der</strong> Münze als Rest des Steges zur nächsten zeigt, daß das Stück<br />
zusammen mit an<strong>der</strong>en in Reihe gegossen und dann abgetrennt wurde.<br />
In Südthüringen gibt es eine weitere Potinmünze <strong>von</strong> Herrenberg bei Siegmundsburg,<br />
einer befestigten Höhensiedlung, die etwas isoliert im ostthüringischen Schiefergebirge<br />
liegt (R. FEUSTEL! W. GALL 1965, 241). Aus Innerthüringen ist außerdem noch<br />
eine Potinmünze <strong>der</strong> Sequaner <strong>von</strong> einer ausgedehnten Oberflächenfundstelle in den<br />
Fluren <strong>von</strong> Wan<strong>der</strong>sieben und Seebergen im Lkr. Gotha bekannt (H.-J. KELLNER! G.<br />
NEUMANN 1966, 259). Bei dem Stück handelt es sich zugleich um die einzige thüringisehe<br />
Latènemünze mit einer Aufschrift (TocIRIx ?). Bei dieser ostgallischen Münze<br />
wird <strong>von</strong> einem Prägebeginn um 80 y. u. Z. ausgegangen (K. CASTELIN1985, 126).<br />
<strong>Die</strong> Potinmünzen erfuhren als keltisches "Kleingeld", wenn auch in kleineren Stückzahlen<br />
pro Fundstelle eine weit über die vermuteten gallischen Emmissionsgebiete<br />
hinausreichende Verbreitung im Mittelgebirgsraum (B. ZIEGAUS 1989, 125, Beil. 3; H.-J.<br />
KELLNER 1990, 28) bis nach Böhmen (K. CASTELIN1965, 131).<br />
<strong>Die</strong> dem Leuker-Potin auf <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt nächstgelegenen Fundstellen materialgleicher<br />
Münzen sind vom Staffelberg mit einer Nordhelvetier- Potinmünze und <strong>von</strong> Bimbach,<br />
Lkr. Kitzingen, mit einer Sequaner- Potinmünze aus dem Bereich einer Viereckschanz<br />
beide schon südlich des Mains, zu nennen (B. ZIEGAUS 1989; 81, 89ff.).<br />
Mit <strong>der</strong> weit streuenden Verbreitung <strong>der</strong> Potinmünzen in Richtung Ost und Nordost und<br />
ihrer großen Stückzahl im Oppidum <strong>von</strong> Manching verbindet sich auch <strong>der</strong> Verdacht,<br />
Produktionsstätten für solches Kleingeld außerhalb <strong>der</strong> ost- und mittelgallischen Stammesg<br />
erwarten zu können (H.-J. KELLNER 1990, 29). Neue Grabungen im süddeuts<br />
Raum auf dem Kegelriß bei Ehrenstetten, Kr. Breisgau- Hochschwarzwald<br />
liefern erstmals Hinweise auf eine Werkstatt, in <strong>der</strong> Potinmünzen gegossen wurden.<br />
Geprüft wird <strong>der</strong>zeit inwieweit ein solcher Standort für die Vorkommen <strong>von</strong> Potinmünzen<br />
umliegen<strong>der</strong> Fundplätze verantwortlich zeichnet und welche Varianten hergestellt<br />
wurden (A. BURKHARDT/R. DEHN 1993, 116 f.).<br />
Eine Leuker- Potinmünze mit datierendem archäologischen Fundgut liegt aus einer<br />
Siedlungsgrube <strong>von</strong> Manching zusammen mit bemalter Drehscheibenkeramik und<br />
einem republikanischem As des 2. Jh. y. u. Z. vor. Eine weitere Potinmünze stammt aus<br />
einer Grube, die in <strong>der</strong> Frühphase des Oppidums genutzt wurde (H.-J. KELLNER 1990,<br />
35f.).<br />
<strong>Die</strong> Potinmünze <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt und auch die <strong>von</strong> <strong>der</strong> Höhensiedlung "Herrenberg"<br />
gelangten wie die süddeutschen und gallischen Exemplare ohne jede zeitliche<br />
Verschiebung während <strong>der</strong> jüngeren Latènezeit in Umlauf (H. POLENZ 1982, 146 f.; H.-J.<br />
KELLNER 1990, 37) und bis spätestens kurz nach <strong>der</strong> Mitte des 1. Jh. y. u. Z. auch auf<br />
den beiden thüringischen Siedlungen in die Erde. Nach <strong>der</strong> Vorlage und dem Vergleich<br />
<strong>der</strong> Münzen <strong>von</strong> <strong>der</strong> offenen Latène Dl Siedlung Basel- Gasfabrik und dem später<br />
angelegten Oppidum Münsterhügel wäre es nach <strong>der</strong> stratigraphischen Position <strong>der</strong>
Leuker- Potinmünzen möglich, die beiden thüringischen Stücke nicht über die Mitte<br />
des 1. Jh. hinaus zu erwarten. Vergleichbare Münzen <strong>der</strong> Leuker erscheinen mit zehn<br />
Exemplaren in <strong>der</strong> Siedlung Gasfabrik zusammen mit 14 Sequaner A Potinmünzen.<br />
Auf dem Oppidum Münsterhügel, das bis in frühaugusteische Zeit besteht, gibt es lediglich<br />
in <strong>der</strong> untersten Latèneschicht noch eine Potinmünze <strong>der</strong> Leuker, ansonsten<br />
überwiegen die <strong>der</strong> Sequanergruppen B und C (A. FURGER-GuNTI/ H.-M. y. KAENEL<br />
1976; A. FuRGER-GuNTI 1979, 126ff). An diese archäologisch gewonnene Datierung<br />
schließt die Untersuchung <strong>der</strong> Potinmünzen <strong>von</strong> Breisach- Hochstetten an, die auch<br />
Hüfingen vergleicht (J. STORK 1984, 424 ff.). Danach wird eine frühe Datierung noch<br />
nach Latène C 2 für die Sequaner Al Münzen für möglich gehalten. <strong>Die</strong> Leuker- Potinmünzen<br />
würden dann ähnlich früh zu erwarten sein.<br />
Ergebnis<br />
<strong>Die</strong> fünf Münzen <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt bei Jüchsen stellen das bisher umfangreichste<br />
numismatische Fundaufkommen <strong>von</strong> einer Latène- Fundstelle Thüringens dar. Von <strong>der</strong><br />
offenen Siedlung wurde über zehn Jahre 11200 m2 Fläche systematisch ausgegraben.<br />
Drei Münzen wurden in den frühen Grabungsjahren 1966-1968 geborgen, zwei sind<br />
Oberflächenfunde. <strong>Die</strong> Inhalte <strong>von</strong> Gruben o<strong>der</strong> eingetieften Häusern sind während <strong>der</strong><br />
Grabungskampagnen auf Grund hoher Lehmanteile nicht systematisch gesiebt o<strong>der</strong><br />
ausgeschlämmt worden. <strong>Die</strong> Münzen gehören weitgehend übereinstimmend dem Zeithorizo<br />
<strong>der</strong> jüngeren Latènezeit an und sind in die Stufen C 2 bis Dl einzuordnen. Abweichu<br />
zwischen den einzelnen Typen sind innerhalb dieses oppidumzeitlichen<br />
Horizontes möglich. Sie gehen auf die innerhalb <strong>der</strong> Hauptverbreitungsgebiete <strong>der</strong> Typen<br />
gewonnen Feindatierungen zurück. <strong>Die</strong> Fundumstände innerhalb <strong>der</strong> Siedlung auf<br />
<strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt führen nicht darüber hinaus. Sie bestätigen erwartungsgemäß bestenfalls<br />
Bekanntes. <strong>Die</strong> Potinmünze <strong>der</strong> Leuker und das Regenbogenschüsselchen können<br />
noch am Ende <strong>von</strong> Latène C in <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 2. Jh. y.u. Z. in die Siedlung gelangt<br />
sein, sind aber auch während des 1. Jh. v. u.Z. zusammen mit den drei Silberquinar<br />
im Umlauf. <strong>Die</strong> Münzen wurden sicher nicht mehr nach <strong>der</strong> Mitte des 1. Jh.<br />
hergestellt. Eine Ausnahme könnte <strong>der</strong> Quinar vom Prager Typ darstellen. <strong>Die</strong> vorliegende<br />
Münzen leisten keinen Beitrag zur Enddatierung des Siedlungsplatzes. Im<br />
Fundmaterial <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt fehlen ausgesprochen späte Latènemünzen aus Potin,<br />
Bronze und Billon, die im Westen und Südwesten den Anschluß an die frühaugusteische<br />
Periode herstellen und römischen Geprägen unmittelbar vorausgehen. Der Platz<br />
wird nach <strong>der</strong> Mitte des 1. Jh. v.u. Z. aufgegeben.<br />
Neben den Münzen, nie direkt mit ihnen zusammen, kommt ein Fibelspektrum vor, daß<br />
sich aus ortsfremden Nauheimer Fibeln und einheimischen Variante A-, G- und K-Fibeln<br />
(J. KOSTRZEWSKI1919) zusammensetzt. Zumindest die Varianten G und K hatte<br />
schon H.-J. KELLNER (1965, 204 f.) zur Datierung des Prager Typs herangezogen. <strong>Die</strong><br />
Variante G wurde in Thüringen hergestellt und bereits am Ende <strong>der</strong> Mittellatènestufe<br />
C getragen. <strong>Die</strong> Nauheimer Fibel, eine Leitform <strong>der</strong> Stufe Latène Dl südlicher Herkunft,<br />
kommt am Ende des 2. Jh. y. u. Z. auf. <strong>Die</strong> Variante K, die häufigste Fibel auf
<strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt, ist <strong>der</strong> Nauheimer zeitgleich und wurde am Ort in einer Feinschmiedewer<br />
gefertigt. Späte Vertreter <strong>der</strong> Variante K stehen <strong>der</strong> geschweiften Fibel<br />
nahe und werden bis in die zweite Hälfte des 1. Jh. v. u.Z. getragen. Es ist <strong>der</strong> gleiche<br />
Typ wie er als Fremdform <strong>von</strong> Altenburg- Rheinau (F. FISCHER 1966, ff.), Manching<br />
(R. GEBHARD 1991, 91f.) und aus dem Grab 1242 <strong>von</strong> We<strong>der</strong>ath (A. MIRON 1989) überliefert<br />
ist. Mit diesen bereits leicht geschweiften Variante K- Fibeln, die auch zweimal<br />
aus Bronze vorkommen, endet die Siedlung auf <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt. Ein direkter Zusammenha<br />
zwischen den Münzen und den spätesten Variante K- Fibeln und wenigen<br />
späten Kleinfunden <strong>von</strong> <strong>der</strong> Siedlung ist nicht herzustellen.<br />
Bei drei Münzen handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Verlierfunde. <strong>Die</strong><br />
Potinmünze und einer <strong>der</strong> Quinare könnte wie zahlreiche Tracht- und Schmuckteile gewollt<br />
im Quellbach versenkt worden sein, was allerdings nicht zu beweisen ist.<br />
Mit einem Viertelstater, drei Quinaren und einer Potinkleinmünze liegt <strong>von</strong> <strong>der</strong> Siedlung<br />
Jüchsen ein kleiner Ausschnitt <strong>der</strong> in keltischen Siedlungslandschaften während<br />
des ausgehenden 2. und 1. Jh. v.u. Z. üblichen Stückelungen vor. Keinesfalls nur auf<br />
die Oppida konzentriert, son<strong>der</strong>n auch in offenen Siedlungen und zahlreichen Depotund<br />
Einzelfunden dokumentiert die Fundsituation in keltisch besiedelten Gebieten die<br />
frühe Phase einer stammesübergreifenden Geldwirtschaft mit regionalen Unterschieden<br />
(J. FILIP 1956, 542; D. MANNSPERGER1981; H. STEUER 1987). Der Raum nördlich<br />
des Mains mit <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt- Siedlung im Grabfeld liegt bereits außerhalb <strong>der</strong> Entwicklu<br />
keltischen Geldwesens. Angesicht <strong>der</strong> Entfernungen zu einigen möglichen<br />
Münzstättenstandorten (Finsterlohr ca. 120 km, Manching ca. 200 km, Kegelriß<br />
ca. 350 km; Stradonice ca. 240 km) sind Münzkonzentrationen wie auf <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt<br />
im Vergleich zum Umland und unter Berücksichtigung weiterer ortsfrem<strong>der</strong> Kleinfunde<br />
Ausdruck <strong>der</strong> Reichweite <strong>von</strong> Handels- und Verkehrsverbindungen sowie <strong>der</strong>en<br />
Hauptrichtungen.<br />
Zusammen mit einer noch immer steigenden Zahl <strong>von</strong> Glasarmringen, <strong>der</strong> Graphittonund<br />
<strong>der</strong> wenigen bemalten Keramik, den Nauheimer und an<strong>der</strong>en fremden Fibeln, zwei<br />
Zügelführungsringen und einer republikanischen Spatelsonde gehören die fünf Münzen<br />
zu einem umfangreichen und "internationalen" Importhorizont. Daneben bestimmen<br />
einheimische Fibeln, Trachtteile und die Keramik <strong>der</strong> thüringischen Kontaktzone<br />
die archäolgische Kultur des Platzes, bleibt <strong>der</strong> Unterschied zu Siedlungen, wie Altendorf,<br />
Münzen<br />
Berching- Pollanten<br />
deutlich.<br />
o<strong>der</strong> Breisach nicht zuletzt auch durch die geringe Anzahl <strong>der</strong><br />
Vier <strong>der</strong> Münzen kommen aus dem Südwesten. Das glatte Regenbogenschüsselchen<br />
stammt aus dem süddeutschen Raum. <strong>Die</strong> Potinmünze könnte aus Ostgallien über das<br />
Oberrheingebiet und Unterfranken nach Süddthüringen gelangt sein. <strong>Die</strong> Silberquinar<br />
mit Pferdedarstellung auf <strong>der</strong> Rückseite gelangten aus <strong>der</strong> süddeutschschweizerischen<br />
Quinarlandschaft nach Norden. Einzig die Münze vom Prager Typ ist böhmischer<br />
Herkunft und steht für den Südosten. Sie gelangte über Westböhmen und Nordbayern<br />
nach Südthüringen, einem Weg den auch ein Teil <strong>der</strong> Glasarmringimporte gegange<br />
sei dürfte. <strong>Die</strong> Münzen stützen die bestehende Auffassung, daß die Wid<strong>der</strong>statt<br />
in <strong>der</strong> Verkehrsgeographie <strong>der</strong> Mittelgebirgslandschaft eine bedeutende Rolle gespielt
hat und während <strong>der</strong> Blütezeit <strong>der</strong> Oppida eine wichtige Station am Weg ins Thüringer<br />
Becken<br />
gewesen sein kann.<br />
<strong>Die</strong> Karte des gesamtthüringischen und mitteldeutschen Aufkommens an Keltenmünzen<br />
zeigt auch bei Ergänzung <strong>der</strong> wenigen Neufunde die Randlage zu den Verbreitungsg<br />
<strong>der</strong> einzelnen Gepräge. Das deutliche Übergewicht an böhmischen<br />
Goldmünzen, die vor allem entlang <strong>von</strong> Elbe und Saale das Bild bestimmen, steht für<br />
den immer wie<strong>der</strong> zitierten böhmischen Einfluß während <strong>der</strong> Latènezeit in Thüringen<br />
(H.-J. KELLNER! G. NEUMANN 1966, 253f.).<br />
Für die mit ihren Münzkonzentrationen während <strong>der</strong> jüngeren Latènezeit bei<strong>der</strong>seits<br />
des Mittelgebirges deutlich herausragenden Räume des südthüringischen Grabfeldes<br />
mit dem oberen Werragebiet und dem nördlichen Thüringer Waldvorland zwischen<br />
Arnstadt und Gotha ist eine differenzierte Sicht nach <strong>der</strong> Aussage <strong>der</strong> Münzen möglich.<br />
Das Typenspektrum zeigt ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen Goldmünzen und<br />
Stückelungen aus Silber und Bronze und erfüllt damit eher ein Kriterium eines beschei<br />
Münzumlaufs in beiden über den Thüringer Wald miteinan<strong>der</strong> verbundenen<br />
Kleinräumen (ebd.; D. W. MÜLLER 1970). Mit den Neufunden wird dieses Bild weiter<br />
verdichtet. Auch die südliche und südwestliche Komponente ist im Münzmaterial<br />
<strong>der</strong> hervorgehobenen Siedlungskammern stärker vertreten. Es ist keinesfalls ein Zufall,<br />
daß die Münzkonzentrationen in Thüringen mit denen <strong>der</strong> importierten bemalten Keramik<br />
und Graphittonkeramik (K. PESCHEL 1966) und auch den Verbreitungsschwerpunkte<br />
<strong>der</strong> Glasarmringe (U. R. LAPPE 1979b) übereinstimmen. Zugleich ist in den<br />
<strong>der</strong>art auffallenden Räumen bei<strong>der</strong>seits des Mittelgebirges auf mehreren Siedlungsplätze<br />
ein fortgeschritten spezialisiertes Handwerk archäologisch nachgewiesen und<br />
<strong>der</strong> Beginn einer Warenproduktion auf sicher noch sehr niedrigem Niveau zu erwarten.<br />
Auf <strong>der</strong> Alteburg <strong>von</strong> Arnstadt wurden Mittellatènefibein <strong>der</strong> Variante G hergestellt (R.<br />
BEHREND 1969). In Gotha- Fischhaus (Sandgrube Kieser) produzierte eine Werkstatt<br />
qualitätvolle Drehscheibenkeramik (H. KAUFMANN 1963b) und bestand eine Bronzegieße<br />
(TH. HucK 1994). Im Süden sind auf <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>statt bei Jüchsen mindeste<br />
eine Feinschmiedewerkstatt, in <strong>der</strong> eiserne Fibeln gefertigt wurden (TH. GRAs- SELT<br />
1994), und auf <strong>der</strong> Steinsburg mehrere Grobschmieden (R. SPEHR 1971) durch<br />
entsprechendes archäologisches Fundmaterial nachgewiesen. Damit wird deutlich, daß<br />
die Münzen an wirtschaftliche Zentren gebunden auftreten und <strong>von</strong> diesen Zentren des<br />
Handels und Handwerks auch in die Umgebung gelangten, wenn dort das Wirtschaftsleben<br />
Münzgeld noch nicht benötigte.<br />
Der Halbierungsversuch am Büschelquinar <strong>von</strong> Gotha- Siebleben geschah wegen des<br />
Metallwertes, vielleicht auch mangels passen<strong>der</strong> Kleinsilbermünzen und sollte auch<br />
als Hinweis auf Handelstätigkeit im Zusammenhang mit fortgeschrittener handwerklicher<br />
Produktion gesehen werden. Insgesamt ähnelt die Situation bei <strong>der</strong> gegenwärtigen<br />
Quellenlage in Thüringen auch jener, die K. CASTELIN (1976) bei <strong>der</strong> Vorlage schlesischer<br />
Münzen<br />
charakterisierte.<br />
Eine Herstellung <strong>von</strong> Münzen in Thüringen ist bisher nicht belegt. <strong>Die</strong> Überlegungen<br />
H. PFEIFFERS (1985, 117ff.) zu Aussichten <strong>der</strong> Vermünzung thüringischen Goldes
durch die Kelten bedürfen, ohne daß die geologische Argumentation angezweifelt werden<br />
soll, einer archäologischen Prüfung in den infrage kommenden Kleinräumen, die<br />
auch zeitlich differenziert vorgenommen werden muß. Danach fehlen momentan frühund<br />
auch jüngerlatènezeitliche Fundstellen in den bezeichneten ostthüringischen Mittelgeb<br />
wie beispielsweise dem hervorgehobenen Schwarzatal o<strong>der</strong> im Orlagebiet<br />
Auch die möglichen Produktionsstätten (Seifen/Gruben) werden, wenn erfaßt,<br />
eher für mittelalterlich gehalten und sind mangels datierenden Fundgutes bisher nie<br />
ur- o<strong>der</strong> frühgeschichtlich eingeordnet worden. Es fehlen allerdings jegliche kontinuierlich<br />
Feldforschungen zu diesem Thema in den entsprechenden Mittelgebirgslagen.<br />
<strong>Die</strong> für Ostthüringen dabei zu diskutierende Frühlatènezeit mit ihren Körperflachgräbern<br />
kennt mit Ausnahme des Grabfundes <strong>von</strong> Dobian keine zeitgleichen Münzen. <strong>Die</strong><br />
vorliegenden Goldmünzen sind außerdem meist typologisch eindeutig dem bekannten<br />
Münzspektrum zuzuordnen. Sie gehören in <strong>der</strong> Mehrzahl bereits in den jüngerlatènezeitlich<br />
Siedlungshorizont, <strong>der</strong> an <strong>der</strong> oberen Saale nur sehr bescheiden vertreten ist.<br />
Bis heute stellt sich <strong>der</strong> auffällige Siedlungsverlust <strong>von</strong> <strong>der</strong> Frühlatène- zur jüngeren<br />
Latènezeit im Orlagebiet fast als Bruch dar (H. KAUFMANN 1963 a, 145 f).<br />
<strong>Die</strong> innerthüringischen o<strong>der</strong> auch die südthüringischen Münzen des 2. und 1. Jh.<br />
y. u. Z. gehören ebenfalls zu Typengruppen, <strong>der</strong>en Verbreitungsschwerpunkte außerhalb<br />
Thüringens liegen. Ein neuer, hier geschlagener Goldmünzentyp, gibt sich nicht<br />
zu erkennen. Wenn in <strong>der</strong> Latènezeit in Thüringen tatsächlich Gold geför<strong>der</strong>t wurde,<br />
müßte man auch einkalkulieren, daß es vielleicht außerhalb vermünzt wurde. Der Forschun<br />
in<strong>der</strong> prähistorischen Archäologie gestattet für Thüringen keine im Detail<br />
positive Beweisführung zur Auffassung H. PFEIFFERS (1985, 118). Jedenfalls ist<br />
auch die böhmische Forschung mit einer intensiven Geländearbeit und den daraus resultie<br />
Ergebnissen zur Goldför<strong>der</strong>ung und -verarbeitung während <strong>der</strong> Latènezeit<br />
dem hiesigen Stand deutlich voraus und deshalb kein Vergleich möglich (J. KUDRNAK/<br />
J. MICHALEK 1987).<br />
Als Fazit bleibt, daß sich seit <strong>der</strong> Münzvorlage H.-J. KELLNERS und G. NEUMANN5<br />
(1966) keine grundsätzlichen Neuheiten beim Fundbestand, son<strong>der</strong>n lediglich geringe<br />
Modifikationen bei seiner Interpretation bedingt durch den verbesserten Forschungsstand<br />
zur keltischen Numismatik ergeben haben. Der thüringische Süden und das Gotha<br />
- Arnstädter Gebiet sind durch einen bisher bescheidenen <strong>von</strong> Süd und Südost ausgehen<br />
Geldverkehr miteinan<strong>der</strong> verbunden. Mit <strong>der</strong> keltischen Geldwirtschaft in<br />
den Hauptverbreitungs- und Umlaufgebieten <strong>der</strong> im Mittelgebirgsraum vorkommenden<br />
Münztypen ist die Situation schon nordwärts des Mains, so wie sich die Quellenlage<br />
momentan darstellt, nicht mehr zu vergleichen. Teile Thüringens, Sachsens und auch<br />
Sachsen-Anhalts bleiben mit einem geringen Fundaufkommen an Münzen ganz außerhalb<br />
dieser Entwicklung.
Literaturverzeichnis<br />
ALLEN,D. F.: The Coinsfrom the Oppidumof Altenburgand the Bushel Series.- Germania56 (1978),<br />
190-229. Mainz.<br />
BARTHEL, S.: Latènesiediung<strong>von</strong> Großfahner,Kr. Erfurt. - Alt- Thüringen20 (1984), 81-139. Weimar.<br />
BEHM-BLANCKE,G.: Ein Zügelführungsring im Gebietdes Oppidums"Steinsburg"bei Römhild,Kr. Meininge<br />
- Ausgrab.u. Funde16 (1971), 247-255. Berlin.<br />
- Eine späthallstatt-und latènezeitiicheSiedlung<strong>von</strong> Jüchsenbeim "OppidumSteinsburg",Südthüringen.<br />
- Ausgrab.u. Funde21(1976), 107-109. Berlin.<br />
BEHREND, R.: <strong>Die</strong> bronze-und spätlatènezeitlicheBesiedlung<strong>der</strong> Alteburgbei Arnstadt.- Alt- Thüringen<br />
10 (1969), 97-142. Weimar.<br />
BEHRENS, G.: Keltenmünzenim Rheingebiet.- Praehist.Zschr.34/35 (1949/50), 336-354. Berlin, 1950.<br />
BURKHARDT, A./DEHN,R.: ProduktionsrestekeltischerPotinmünzenvom Kegelrißbei Ehrenstetten,Kreis<br />
Breisgau-Hochschwarzwald. - ArchäologischeAusgrabungenin Baden-Württemberg1992, 116-120.<br />
Stuttgart,1993.<br />
CASTELIN, K.: <strong>Die</strong> Goldprägungen<strong>der</strong> Keltenin den böhmischenLän<strong>der</strong>n.- Graz,1965.<br />
- KeltischeMünzen. Katalog<strong>der</strong> Sammlungim SchweizerischenLandesmuseumZürich.- Stäfa,I -<br />
1978; II-1985.<br />
- Zum keltischenTotenobulus<strong>von</strong>Dobian(Lkr. Pößneck,BezirkGera,DDR).- In: BeiträgezurUr- und<br />
FrühgeschichteTeil 1, 617-621. Berlin, 1981.<br />
- Keltenmünzenin Schlesien.- Arbeits-u. Forsch. ber. zur sächs. Bodendenkmalpflege 20/21 (1976),<br />
221-277. Berlin.<br />
CASTELIN, K.! KELLNER,H.-J.: <strong>Die</strong> glatten Regenbogenschüsselchen. - II). für Numismatikund Geldgeschi<br />
13 (1963), 105-130. Kallmünz/Opf.<br />
DoNop,G. Frhr. .: Das magusanischeEuropa.- Meiningen,1819.<br />
- Das ältesteGeld.- Blätterfür Münzkunde.Journal numismatiquede HannovreNo. 3 (1838), 38-44.<br />
Leipzig.<br />
FEUSTEL, R./GALL,W.: Eine keltischeWallanlageaufdem ThüringerWald.- Alt- Thüringen7 (1964/65),<br />
228-249. Weimar,1965.<br />
FILIP,J.: Keltovéve stfednfEvrope.- Praha, 1956.<br />
FISCHER, F.: Das Oppidum<strong>von</strong> Altenburg-Rheinau.- Germania44 (1966), 286-312. Berlin.<br />
FRIEDLÄNDER, U.: Ein Fund keltischer Silbermünzenaus Franken.- SchweizerMünzblätter28 (1978),<br />
21-38. Bern.<br />
FURGER- GL vii. A.: OppidumBasel-Münsterhügel.- Jb. <strong>der</strong> SchweizerischenGesellschaftfür Ur- und<br />
Frühgeschichte58 (1974/75), 77-111. Basel,1975.<br />
- <strong>Die</strong> Ausgrabungenim BaselerMünsterI. - Derendingen,1979.<br />
FURGER- GUNT!,A. KAENEL,H.-M. y.: <strong>Die</strong> keltischenFundmünzenaus Basel.- SchweizerischeNumismatisch<br />
Rundschau55 (1976), 35-76. Bern.<br />
GEBHARD, R.: Der Glasschmuckaus dem Oppidum<strong>von</strong> Manching.- Stuttgart,1989.<br />
- <strong>Die</strong> Fibeln ausdem Oppidum<strong>von</strong> Manching.- Stuttgart,1991.<br />
GÖBL,R.: Numismatik- Grundrißund wissenschaftlichesSystem.- München,1987.<br />
- Münzprägungund Geldverkehr<strong>der</strong> Kelten in Österreich.- Ostern-Akademie<strong>der</strong> Wissenschaften,<br />
Phil.-Hist. Kl., Sitzungsber.597. Veröffentlichungen<strong>der</strong> NumismatischenKommission28 (1992),<br />
3-24. Wien.<br />
GÖTZE,A./HÖFER,P. /ZSCHIESCHE, P.: <strong>Die</strong> vor- und frühgeschichtlichenAltertümerThüringens. - Würzburg<br />
1909.<br />
GRASMANN, G./JANSSEN, W./BRANDT,M. (Hrsg.):KeltischeNumismatikund Archäologie- Numismatique<br />
celtiqueet Archeologie.- Veröffentlichung<strong>der</strong> Referatedes KolloquiumskeltischeNumismatikvom<br />
4. bis8. Februar 1981 in Würzburg.- Oxford,1984.<br />
<strong>GRASSELT</strong>, TH.: <strong>Die</strong> Siedlungsfunde<strong>der</strong> vorrömischenEisenzeit <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wid<strong>der</strong>stattbei Jüchsenin<br />
Südthüringen. - Weimarer Monographienz. Ur- u. Frühgesch.31(1994), Stuttgart.<br />
HAEVERNICK, TH. E.: <strong>Die</strong> Glasarmringeund Ringperlen<strong>der</strong> Mittel- und Spätlatènezeitauf dem europäische<br />
Festland.- Bonn,1960.<br />
HARTMANN, A.: ErgebnissespektralanalytischerUntersuchungenan keltischenGoldmünzenaus Hessen<br />
und Süddeutschland. - Germania54 (1976), 102-134. Mainz.
- Naturwissenschaftliche Untersuchungenan Schrötlingsformen und Goldmünzen. - In: <strong>Die</strong> <strong>Münzfunde</strong><br />
<strong>von</strong>Manchingund die keltischenFundmünzenaus Südbayern.230-246. - Stuttgart,1990.<br />
HUCK,TH.: Neue spätlatènezeitlicheFunde<strong>von</strong><strong>der</strong> SiedlungGotha-Fischhaus(KiesgrubeKieser).- Alt- Thüring<br />
28 (1984). Vorliegen<strong>der</strong>Band.<br />
JANSOVX, L.: Hrazany- Das keltischeOppidumin Böhmen,II. - Prag,1988.<br />
- Zur Münzprägungaufdem OppidumZavist- Mincovnictvina Hradistinad Zavisti.- Pamatkyarchéol.<br />
65 (1974), 1-33. Praha.<br />
JOCKENHÖVEL, A.: Keltische<strong>Münzfunde</strong>.- In: <strong>Die</strong> VorgeschichteHessens,292-294. Stuttgart,1990.<br />
KADE,C.: KeltischeMünzenund römischeFundeaus dem Gebiet<strong>der</strong> Gleichbergebei Römhild.- Alt- Thüring<br />
6 (1962/63), 467-472. Weimar, 1963.<br />
KAPPEL, I.: Der Münzfund<strong>von</strong> Mardorf und an<strong>der</strong>ekeltischeMünzen aus Nordhessen.- Germania54<br />
(1976), 75-101. Mainz.<br />
KAUFMANN, H.: <strong>Die</strong> vorgeschichtlicheBesiedlungdes Orlagaues.Text. Berlin, 1963a.<br />
- Ein latènezeitlicherTöpferofenam Fischhausbei Gotha.- Alt- Thüringen5 (1962/63), 436-454. Weimar,<br />
1963b.<br />
- KeltischeMünzennördlich<strong>von</strong> Elbsandsteingebirge und LausitzerBergland.- Ausgrab.und Funde<br />
34 (1989), 26-29. Berlin.<br />
KELLNER, H.-J.: <strong>Die</strong> keltischenSilbermünzenvom "PragerTypus".- Jb. für Numismatikund Geldgeschi<br />
15 (1965), 195-207. Kallmünz/Opf.<br />
- <strong>Die</strong> Forschungssituation zum Münzwesen<strong>der</strong> Kelten.- In: Geschichteund Kultur<strong>der</strong> Kelten- Vorberei<br />
25.-28. Oktober1982 in Bonn, 216-233. - Heidelberg,1986.<br />
- <strong>Die</strong> <strong>Münzfunde</strong><strong>von</strong> Manchingunddie keltischenFundmünzenaus Südbayern. - Stuttgart,1990.<br />
KELLNER, H.-J. /NEUMANN, G.: <strong>Die</strong> keltischen<strong>Münzfunde</strong>in Mitteldeutschland. - Ausgrab.u. Funde11<br />
(1966), 253-260. Berlin.<br />
KOSTRZEWSKI, J.: <strong>Die</strong> ostgermanischeKultur <strong>der</strong> Spätlatènezeit. - Leipzig, 1919.<br />
KUDRNAC, J./ MICHALEK, J.: ArchäologischeForschungenzur Erhellung<strong>der</strong> Anfänge<strong>der</strong> Goldgewinnung<br />
Südböhmen. - OstbairischeGrenzmarken29 (1987), 9-19. Passau.<br />
LAPPE,U.: Neue metallzeitlicheFunde<strong>von</strong><strong>der</strong> Alteburgbei Arnstadt.- Ausgrab.und Funde9 (1964),<br />
245-247. Berlin.<br />
LAPPE,U. R.: <strong>Die</strong> Funde<strong>der</strong> keltischenSiedlungJüchsen.- In: Keltenforschung in Südthüringen(1979a),<br />
82-94. Weimar.<br />
- Keltische Glasarmringeund Ringperlenaus Thüringen.- Alt- Thüringen16 (1979b), 84-111. Weimar.<br />
MANNSPERGER, D.: Münzenund <strong>Münzfunde</strong>.- In: <strong>Die</strong> Keltenin Baden-Württemberg,228-247. Stuttgart,<br />
1981.<br />
- KeltischeMünzenaus Baden-Württemberg.Neue Aspekteund Funde.- In: Keltische Numismatik<br />
und Archäologie,230-253. Oxford,1984.<br />
MENKE,M.: Schrötlingsformen für keltischesSilbergeldaus Karlstein,Lkr. Berchtesgaden(Oberbayern). -<br />
Germania46 (1968), 27-35. Mainz.<br />
MIRON,A.: Das Frauengrab1242. Zur chronologischenGlie<strong>der</strong>ung<strong>der</strong> StufeLatèneD2. - In: Gräber-<br />
Spiegeldes Lebens(A. Haffner- Ausstellungskatalog). - Trier, 1989.<br />
MOTYKOVX, K. DRDA,P. /RYBDVf,A.: Zavist- Keltskehradiste ve sffednfchCechach.- Praha,1978.<br />
- Srovnaninalezuminci se sidelni koncentraciy Cechachy dobeoppid (Vergleich<strong>der</strong> <strong>Münzfunde</strong>mit<br />
<strong>der</strong> Siedlungskonzentration in Böhmenzur Zeit <strong>der</strong> Oppida).- Slovenskanumizmatika8 (1984),<br />
147-170. Nitra.<br />
MÜLLER,D. W.: Beitragzum spät<strong>latènezeitlichen</strong>Münzumlaufim GothaerLande.- Abhandlungenund<br />
Berichtezur Regionalgeschichte, 71-75. Gotha,1970.<br />
MÜLLER,R.: <strong>Die</strong> Grabfunde<strong>der</strong> Jastorf-und Latènezeitan untererSaaleund Mittelelbe.- Berlin, 1985.<br />
NEMESKALOVA-JIROUDKOVA, Z.: Das keltischeMünzwesenin Mitteleuropa.- In: A surveyof numismaticresearc<br />
InternationalNumismaticCommission,139-154. Brno, 1979.<br />
OVERBECK, B.: Neufunde sogenannter"glatter Regenbogenschüsselchen" aus Unterfranken.- In: Aus<br />
FrankensFrühzeit,106-1 12. Würzburg,1986.<br />
PESCHEL, K.: SpätkeltischerkeramischerImportin Thüringen.- Alt- Thüringen8 (1966), 231-258. Weimar.
PFEIFFER, H.: Das thüringischeGoldalsTeil einer kaledonischenGoldprovinzEuropasunddie Frageortständ<br />
keltischerMünzprägungen. - HercyniaN.F. 22 (1985), 113-123. Leipzig.<br />
Pie,J. L.: Le Hradischtde Stradonitzen Boheme.- Leipzig,1906.<br />
POLENZ, H.: Münzenin <strong>latènezeitlichen</strong>GräbernMitteleuropasaus<strong>der</strong>Zeit zwischen300 und50 vorChristi<br />
Geburt.- BayerischeVorgeschichtsblätter 47 (1982), 27-222. München.<br />
REIM,H.: Ein Versteckfund<strong>von</strong> Münzenund Fibeln aus <strong>der</strong> Spätlatènezeitbei Langenau,Alb- Donau- Kreis.<br />
- ArchäologischeAusgrabungen1979, 50-53. Stuttgart,1980.<br />
RÖBLITZ, G.: Zur Beschaffenheit,Herkunftund Entstehungszeit <strong>der</strong> Goldstatereaus dem latènezeitiichen<br />
Grab<strong>von</strong> Dobian.- Alt- Thüringen21(1986), 228-237. Weimar.<br />
SCHIRWITZ, K.: Griechische,keltischeund römischeMünzen aus Mitteldeutschland.- Germania30<br />
(1952), 46-55. Mainz.<br />
SCHULZ,W.: <strong>Die</strong> BevölkerungThüringensim letzten Jhd. vor Christusauf Grund<strong>der</strong> Bodenfunde. -<br />
Jahresschrift für die Vorgeschichte<strong>der</strong> sächsischthüringischenLän<strong>der</strong>16<br />
(1928). Halle.<br />
SPEHR,R.: <strong>Die</strong> Rolle <strong>der</strong> Eisenverarbeitungin <strong>der</strong> Wirtschaftsstrukturdes Steinsburg-Oppidums.- Archeo<br />
rozhl.23 (1971), 486-503. Prag.<br />
STEUER,H.: Gewichtsgeldwirtschaften im frühgeschichtlichenEuropa.- In: Untersuchungenzu Handel<br />
und Verkehr<strong>der</strong> vor- und frühgeschichtlichenZeit in Mittel- und NordeuropaIV, 405-527. Göttingen,<br />
1987.<br />
STORK, I.: Überlegungenzur ChronologiespätlatènezeitlicherPotinmünzenam südlichenOberrhein.- In:<br />
KeltischeNumismatikund Archäologie,420-430. Oxford,1984.<br />
STREBER, F.: Ueberdie sogenanntenRegenbogenschüsselchen. - Abhandlungen<strong>der</strong>Philos.-Philol. Classe<br />
<strong>der</strong> Königl.-Bayer. Akademie<strong>der</strong> Wissenschaften9 (1860/1862). München.<br />
VULPIUS, CH. A.: <strong>Die</strong> Regenbogenschüsselchen. - Curiositäten7 (1818), 25-36. Weimar.<br />
WALTHER,W.: Zu den Aufgabendes Wissenschaftsbereiches Ur- und Frühgeschichte/Bodendenkmalp<br />
an den MühlhäuserMuseenin den Jahren1991 und 1992.- MühlhäuserBeiträge15 (1992),<br />
19-44. Mühlhausen.<br />
WIELANDT, F.: Keltische Fundmünzenaus Baden.- Jb. für Numismatikund Geldgeschichte14 (1964),<br />
97-115. Kallmünz/Opf.<br />
ZIEGAUS,B.: Der latènezeitiicheMünzumlaufin Franken.- Bayerische Vorgeschichtsblätter 54 (1989),<br />
69-135. München.<br />
- Das keltischeMünzwesen. - In: Das keltischeJahrtausend(AusstellungskatalogRosenheim). - Mainz,<br />
1993.<br />
ZWICKER,U.: Analytischeund metallographischeUntersuchungenzu den Fundmünzenaus Manching.-<br />
In: <strong>Die</strong> <strong>Münzfunde</strong><strong>von</strong> Manchingund die keltischenFundmünzenaus Südbayern,247-261. Stuttgart,<br />
1990.<br />
Zeichnung:H. Spranger,Fotos:B. Stefan,beide ThüringischesLandesamtfür ArchäologischeDenkmalpfleg<br />
Weimar
Abb. 1 VerbreitungausgewählterspätlatènezeitlicherMünztypenim Mittelgebirgsraum.<br />
<strong>Die</strong> Kartierungkann nur für Thüringen Vollständigkeitanstreben(H.-J. KELLNER/G.NEUMANN1966 ergänzt<br />
HessennachI. KAPPEL1976 und A. JOCKENHÖVEL 1990, BayernnachB. ZIEGAUS1989, Böhmen<br />
nachJ. FILIP1956 und K. MoTyKovX/P.DRDA/A. RYBOVJ(1984 dazu H.-J. KELLNER1965, K. CASTE- LIN/H. -J.<br />
KELLNER1963 undD. F. ALLEN1979