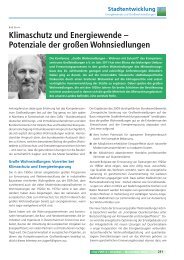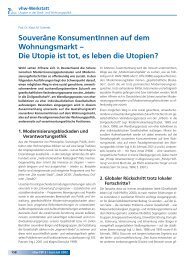Segregation(sforschung) – quo vadis? - VHW
Segregation(sforschung) – quo vadis? - VHW
Segregation(sforschung) – quo vadis? - VHW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Stadtentwicklung<br />
<strong>Segregation</strong><strong>sforschung</strong> <strong>–</strong> <strong>quo</strong> <strong>vadis</strong>?<br />
unter sehr spezifi schen Bedingungen einen integrationshemmenden<br />
Einfl uss. 1 Erst wenn<br />
❏ eine statusniedrige soziale Lage (keinen oder einen niedrigen<br />
Bildungsabschluss, mangelnde Kenntnis der Landessprache,<br />
Arbeitslosigkeit, niedriges und unregelmäßiges Einkommen)<br />
❏ mit einem fremden ethnischen Status (fremde Kultur, andere<br />
religiöse Praktiken, andere Rollen und soziale Umgangsformen)<br />
❏ in einem zusätzlich benachteiligenden Wohngebiet (schlechte<br />
Wohnungsausstattung, fehlende oder schlechte Infrastruktur<br />
<strong>–</strong> insbesondere Sozialisationsinstanzen wie Kindergärten,<br />
Schulen, Volkshoch- und Elternschulen, Bibliotheken <strong>–</strong>,<br />
schlechte Erreichbarkeit, hohe Immissionen, schlechtes Image<br />
etc.) zusammentreffen,<br />
wirken sich solche Gebiete als „Sackgasse“ und damit als „Falle“<br />
aus (vgl. Dangschat 2008).<br />
Ob eine räumliche Konzentration sozialer Gruppen in diesem<br />
Sinne „problematisch“ ist, lässt sich aus Anteilswerten beispielsweise<br />
der Menschen mit Migrationshintergrund allein<br />
nicht ablesen. Die wissenschaftlichen Versuche, die Effekte<br />
der Nachbarschaft auf (des)integratives Verhalten zu ermitteln,<br />
kommen eher zu ernüchternden Ergebnissen: Die negativen<br />
Einfl üsse sind sehr gering, wenn sie sich überhaupt nachweisen<br />
lassen; mehr noch, Atkinson & Kintrea (2004) kommen nach<br />
einer Analyse unterschiedlicher Studien im angelsächsischen<br />
Sprachraum zu dem Schluss, dass die Tatsache, ob (negativ<br />
wirkende) Nachbarschaftseffekte ermittelt werden können, von<br />
den theoretischen Annahmen, den vorhandenen Daten und den<br />
gewählten Methoden abhängen (vgl. zu weiteren Beispielen aus<br />
Deutschland den Beitrag von Häußermann in diesem Heft). Es<br />
kommt daher weniger auf die strukturelle Zusammensetzung<br />
von Bewohnern an (Kompositionseffekt), sondern vor allem darauf,<br />
wie die unterschiedlichen Gruppen vor Ort agieren, wie sie<br />
sich wechselseitig anerkennen, ob sie das Gefühl haben, in den<br />
wesentlichen Bereichen des Alltags integriert zu sein etc.<br />
Damit ist eindeutig: Auf die traditionelle <strong>Segregation</strong><strong>sforschung</strong><br />
kann verzichtet werden, weil sie fragwürdige Ergebnisse liefert<br />
und keine Handlungsrelevanz hat. An der traditionellen <strong>Segregation</strong><strong>sforschung</strong>,<br />
die sich im Übrigen von den ursprünglichen<br />
Annahmen Parks deutlich entfernt hat, gibt es eine Reihe von<br />
Kritikpunkten:<br />
❏ der gemessene Indexwert ist eine Mittelwertaussage, die<br />
nichts über die Art der Abweichung einzelner Quartiere vom<br />
städtischen Durchschnitt aussagt,<br />
1 Spätestens an dieser Stelle müsste eine Aussage stehen, was mit „Integration“ in<br />
diesem Fall überhaupt gemeint ist. Ich denke, dass damit vor allem gemeint ist,<br />
dass die Gruppen sich in der Lage fühlen, in zivilen Parallelgesellschaften zu leben,<br />
sich zumindest vorübergehend einen gemeinsamen Ort teilen und sich in ihrem<br />
So-Sein gegenseitig weder erschrecken und verängstigen noch diskriminieren. Das<br />
ist sicherlich eine sehr reduzierte Sichtweise, erscheint mir aber hierfür dennoch<br />
ausreichend, da die sozial-räumlichen Phänomene der <strong>Segregation</strong> lediglich sichtbare<br />
Erscheinungsformen von (Des-)Integration in anderen Dimensionen sind, resp. die<br />
Ursachen und ‚driving forces‘ für (Des-)Integration auf der Makro-Ebene und daher<br />
eher außerhalb des Quartiers liegen.<br />
❏ die Werte sind stark abhängig von der Größe der Teilgebiete<br />
und der Größe der betrachteten sozialen Gruppe, was eine<br />
vergleichende <strong>Segregation</strong><strong>sforschung</strong> unsinnig macht,<br />
❏ die <strong>Segregation</strong>swerte werden häufi g mathematisch falsch<br />
(Wert ist eine Aussage für den Anteil der Gruppe A, die umziehen<br />
müsste …) und hochgradig normativ interpretiert (…<br />
damit eine Gleichverteilung erreicht wird),<br />
❏ im Mittelpunkt stehen die relativen Lagen der Wohnstandorte<br />
als Interpretation der sozialen Distanz sozialer Gruppen, was<br />
voraussetzt, dass der Wohnstandort die zentrale räumliche<br />
Integrations- und Distinktionseinheit ist; das wird in dem<br />
Maße fragwürdig, wie Informationen, soziale Netze und<br />
Aktionsräume nicht (mehr) an das Wohnquartier gebunden<br />
sind.<br />
❏ Schließlich nimmt diese Art von <strong>Segregation</strong><strong>sforschung</strong><br />
Erkenntnisse der Ungleichheit<strong>sforschung</strong> und Handlungstheorie<br />
nicht wahr: Erstere geht hinsichtlich der sozialen<br />
Positionierungen längst nicht mehr von einzelnen Merkmalen<br />
sozialer Ungleichheit aus (wie Schicht, Alter oder Geschlecht),<br />
sondern von Syndromen mehrerer Merkmalsausprägungen<br />
sozialer Ungleichheit. In der Handlungstheorie hat sich<br />
längst die Vorstellung von mehreren relevanten Ebenen<br />
durchgesetzt, die vermittelnd zwischen den Struktur- und<br />
Handlungsmerkmalen stehen (s. Abbildung 2). So haben<br />
Heitmeyer & Anhut (2000) deutlich herausgearbeitet, dass<br />
es bei der Auswirkung der Ausländeranteile auf die (Des-)<br />
Integration von anderen Ethnien auf die vermittelnden Faktoren<br />
des politischen und sozialen Klimas, der Intergruppen-<br />
Kontakte sowie der gegenseitigen Anerkennungsmuster in<br />
unterschiedlich gelagerten Konfl ikten ankommt.<br />
Der aus der Marktwirtschaft stammende Ansatz von Sinus<br />
Sociovision 2 (s. den Beitrag von Beck und Perry in diesem Heft)<br />
Abb. 1: <strong>Segregation</strong><strong>sforschung</strong> <strong>–</strong> <strong>quo</strong> <strong>vadis</strong>? (Quelle: www.fl ickr.com)<br />
2 Dieser Ansatz blendet jedoch sowohl die Ober- als auch die Unterschicht aus, gibt<br />
also nur einen Ausschnitt aus der gesellschaftlichen Realität wieder. Weiterhin wird<br />
bei der Milieu-Konstruktion der traditionelle und den Strukturmerkmalen zuzuordnende<br />
Schichtungsaspekt defi nitorisch einem bestimmten Abschnitt in der Werte-/<br />
Modernisierungsskala zugeordnet; eine Unabhängigkeit von sozialer Schicht und<br />
sozialem Milieu würde bedeuten, dass man den statistischen Zusammenhang und<br />
dessen Wandel <strong>–</strong> der an verschiedenen Teilen der Gesellschaft enger oder weiter sein<br />
resp. unterschiedlich dynamisch sein dürfte <strong>–</strong> ermitteln könnte. Schließlich stellt die<br />
Ermittlung der Milieustruktur ein lang erarbeitetes Betriebskapital des Unternehmens<br />
dar, entsprechend „undurchsichtig“ ist der Zugang für die Anwender in Wissenschaft<br />
und Praxis.<br />
vhw FW 3 / Juni <strong>–</strong> Juli 2008 127