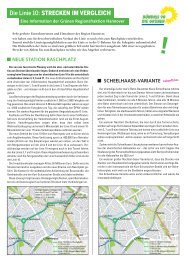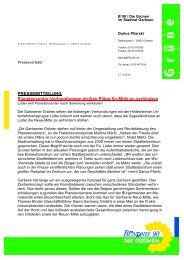Waldökologische Bestandsanalyse
Waldökologische Bestandsanalyse
Waldökologische Bestandsanalyse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dietmar Drangmeister Hannover, den 23.05.2012<br />
Mitglied des Eilenriedebeirats<br />
Antrag zu TOP … der 182. Sitzung des Eilenriedebeirats<br />
(<strong>Waldökologische</strong> <strong>Bestandsanalyse</strong>)<br />
Der Eilenriedebeirat empfiehlt als Grundlage zur Umsetzung der für die<br />
„Forsteinrichtung 2012 – 2022“ genannten Ziele sowie für weitere Ziele, die dem<br />
Eilenriedebeirat satzungsgemäß obliegen, eine entsprechende waldökologische<br />
<strong>Bestandsanalyse</strong> durchzuführen (1.).<br />
Die waldökologische <strong>Bestandsanalyse</strong> sollte mindestens umfassen:<br />
1.a eine aktuelle flächendeckende Waldbiotopkartierung nach vegetationskundlichen<br />
Kriterien einschließlich der Erfassung der gesetzlich geschützten<br />
Biotope sowie der Lebensraumtypen nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie<br />
der EU<br />
1.b eine systematische, aktuelle Erfassung aller schützenswerten Habitatbäume<br />
einschließlich der „Uraltbäume“ und der stehenden Totholzbäume<br />
1.c eine systematische Kartierung und Bewertung der Waldränder und<br />
Waldrandbereiche<br />
Zudem wird die systematische Einrichtung vegetationskundlicher Untersuchungsflächen<br />
(Monitoringflächen) zur Kontrolle der Waldentwicklung empfohlen (2.).<br />
Der genaue Untersuchungsumfang sollte auf der Basis einer Auswertung aller Vorinformationen<br />
und als Ergänzung der im Zuge der Forsteinrichtung 2012 – 2022 durchgeführten<br />
Analyse konzipiert werden. Der Eilenriedebeirat bietet an, bei der Festlegung<br />
von Art und Methodik der Untersuchungen mitzuwirken.<br />
Die Verwaltung wird gebeten, die erforderlichen Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr<br />
2013 anzumelden.<br />
Begründung<br />
Zu 1.<br />
Die Forsteinrichtung 2012 – 2022 legt für die nächsten 10 Jahre die Grundzüge der<br />
Bewirtschaftung und Pflege des Waldes fest. Sie stellt somit das zentrale Instrument<br />
der Forstplanung in der Eilenriede dar. Eine Planung ist aber nur so gut wie die<br />
<strong>Bestandsanalyse</strong>, auf der sie fußt. Es wird davon ausgegangen, dass für die<br />
Einrichtung wesentliche forstliche Parameter wie Baumartenzusammensetzung,<br />
Stammstärken etc. in den verschiedenen Abteilungen des Stadtwaldes<br />
aufgenommen werden. Es sind darüber hinaus aber auch waldökologische<br />
Untersuchungen erforderlich, weil die naturschutzfachlichen und waldästhetischen<br />
Ziele, die die Stadt beschlossen hat, sonst nicht systematisch und nachvollziehbar<br />
umgesetzt werden können.<br />
Zu 1.a
Eine flächendeckende aktuelle Biotopkartierung nach einem anerkannten<br />
Kartierschlüssel (z.B. Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen des NLWKN<br />
– v. Drachenfels 2011) ist erforderlich, um Veränderungen gegenüber 2002<br />
feststellen zu können und auch um für die Zukunft eine Vergleichsbasis zu haben.<br />
Eine entsprechende Kartierung ist 2002 durch das „Büro für angewandte<br />
Waldökologie – Knut Sturm“ durchgeführt worden. Die „Haltbarkeit“ solcher<br />
Kartierungen wird i.allg. mit 5 Jahren angegeben. Auch wenn im Wald i.d.R. eine<br />
größere Konstanz der Biotopverhältnisse (im Vergleich zu Biotopen am Stadtrand<br />
oder in der Feldflur) festzustellen ist, so sollte die Biotopkartierung nach 10 Jahren<br />
hier unbedingt wiederholt werden.<br />
Die Erfassung gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 BNatSchG) ist auch deshalb<br />
geboten, weil durch die Wiedervernässung von Teilen der Eilenriede die Bereiche mit<br />
Erlen-Eschenwald oder auch mit nassen Eichen-Hainbuchenwäldern, die als „Sumpfoder<br />
Auwälder“ geschützt sind, sich möglicherweise schon vergrößert haben.<br />
Zudem gewinnt der europäische Naturschutz immer stärker an Bedeutung.<br />
Bestimmte Waldtypen, die in der Eilenriede vorkommen, sind nach der EU-FFH-<br />
Richtlinie geschützt, z.B. Waldmeister-Buchenwald, Bodensaurer Buchenwald mit<br />
Stechpalme und verschiedene Typen des Eichen-Hainbuchenwalds. Auch außerhalb<br />
des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 dürfen diese Wälder nicht<br />
geschädigt werden, weil sonst Verstöße gegen das Umweltschadensgesetz<br />
vorliegen. Diese Waldtypen sind im Gelände zu erfassen und abzugrenzen, damit sie<br />
wirksam geschützt werden können. Die Ansprache dieser Waldtypen erfolgt v.a.<br />
anhand der Bodenvegetation, also z.B. der Kräuter und Gräser; eine Abgrenzung<br />
anhand der vorherrschenden Baumarten ist dafür nicht ausreichend.<br />
Zu 1.b<br />
Im Jahr 2003 ist von dem „Büro für angewandte Waldökologie – Knut Sturm“ eine<br />
systematische Erfassung und Kartierung der Alt- und Totholzbäume in der Eilenriede<br />
vorgenommen worden. Es wurde dabei unterschieden zwischen „schützenswertem<br />
Zielstärkenbaum“, „Habitatbaum“, „Stehendem Totholzbaum“, „Liegendem<br />
Totholzbaum“ und „Baum mit Rankgewächsen“. Zumindest die drei erstgenannten<br />
Kategorien sind von Interesse. Eine Aktualisierung ist unbedingt geboten: Zum einen<br />
ist darzulegen, inwieweit die 2003 festgestellten Bäume noch vorhanden sind. Neben<br />
natürlichen Verlusten (Sturmbruch, Blitzschlag etc.) kommen auch Fällungen im<br />
Zuge der Verkehrssicherungspflicht in Betracht. Darüber hinaus dürften inzwischen<br />
weitere Bäume in einen schützenswerten Zustand hineingewachsen oder auch<br />
abgestorben sein.<br />
Erfassung und systematischer Schutz einer möglichst großen Zahl an Altbäumen, die<br />
dann auch für jedermann nachvollziehbar dokumentiert werden sollten, ist sicherlich<br />
eine Voraussetzung, um bei den interessierten Bürgern für die - etwa aus Gründen<br />
der Verkehrssicherungspflicht - unvermeidlichen Fällungen alter Bäume Verständnis<br />
zu finden.<br />
Zu 1.c<br />
Die ökologische und ästhetische Bedeutung von Waldrändern ist bekanntermaßen<br />
groß; sie lässt sich vielfach auch an der Eilenriede noch verbessern. Im Zuge einer<br />
erforderlichen Biotopkartierung sollten die verschiedenen Typen von Waldrändern<br />
erfasst (nach Kartierschlüssel v. Drachenfels 2011) und hinsichtlich ihrer<br />
ökologischen und ästhetischen Bedeutung bewertet werden. Dabei sind auch alle<br />
direkt an den Wald angrenzenden Freiflächen zu betrachten, zunächst einmal<br />
unabhängig von baurechtlichen Festsetzungen.
§ 1 der Satzung über die Erhaltung der Eilenriede legt neben dem Erhalt und der<br />
sorgsamen Pflege des Stadtwaldes auch fest, dass seine Erweiterung anzustreben<br />
ist. Insofern sind der Rat der Stadt und der Eilenriedebeirat, der den Rat in diesen<br />
Fragen berät, gehalten, sich auch mit den Randbereichen der Eilenriede zu<br />
befassen. Dies bekommt besondere Bedeutung vor dem Hintergrund der<br />
Erkenntnisse des systematischen Gebietsschutzes (Stichwort „Biotopverbund“),<br />
wonach ein ökologisch funktionierender Wald der Pufferung und der Vernetzung<br />
bedarf. Dies gilt für einen Stadtwald, der vielfältigen Beeinträchtigungen und<br />
Belastungen ausgesetzt ist, in besonderem Maße.<br />
Zu 2.<br />
Die Bewertung eines Waldes in seiner naturschutzfachlichen Bedeutung macht sich<br />
außer an Art und Alter der Bäume an der Ausprägung der Krautschicht fest. Dies<br />
geht vielfach mit der Bedeutung für die Erholung einher: Der Frühjahrsaspekt mit<br />
blühenden weißen und gelben Buschwindröschen, Lerchensporn, Maiglöckchen,<br />
Waldmeister und Lungenkraut erfreut das Auge mehr und ist von höherem<br />
naturschutzfachlichen Wert als ein monotoner Unterwuchs aus Brombeergestrüpp.<br />
Von der Vielfalt an charakteristischen Kraut-, Gras- und Straucharten lebt auch eine<br />
entsprechende Vielzahl an charakteristischen Kleintierarten des Waldes, also z.B.<br />
Schmetterlinge, Käfer, Wanzen etc. Zudem ist die Bodenflora ein feinerer Indikator<br />
als die Baumartenzusammensetzung - für Veränderungen des Nährstoffhaushalts,<br />
des Wasserhaushalts, der klimatischen Verhältnisse sowie weiterer Standortfaktoren<br />
und auch von Beeinträchtigungen durch den Menschen.<br />
Insofern ist es sinnvoll, die Bodenvegetation systematisch zu untersuchen und zwar<br />
nicht nur einmalig sondern über mehrere Jahre hinweg. Dies erfolgt mit Hilfe von<br />
Dauerbeobachtungsflächen und wird auch als Monitoring bezeichnet.<br />
Solche Untersuchungen sind insbesondere dort geboten, wo Maßnahmen des<br />
Naturschutzes durchgeführt werden wie z.B. in den Naturwaldparzellen und den<br />
Wiedervernässungsflächen, um die Veränderungen zu dokumentieren und den<br />
Erfolg der Maßnahmen nachzuweisen. Es sollte zur guten Praxis der „Hauptstadt der<br />
Biodiversität“ werden, nicht nur anspruchsvolle Naturschutzmaßnahmen durchzuführen<br />
sondern auch deren Wirksamkeit durch wissenschaftliche Untersuchungen zu<br />
belegen. Generell ist es verwunderlich, dass die letzte systematische und<br />
vollständige Veröffentlichung zur Vegetation der Eilenriede aus dem Jahr 1971 (H.<br />
Ellenberg, H. Haeupler und K. Wöldecke in der Eilenriede-Festschrift) datiert.<br />
Es seien noch vier weitere Gründe für die Einrichtung von Monitoring-Flächen<br />
genannt:<br />
1. Es haben sich in den vergangenen Jahren in der Eilenriede einige Pflanzenarten,<br />
die für die mitteleuropäischen Laubwälder eigentlich untypisch sind, ausgebreitet,<br />
und das vermutlich zu Lasten der charakteristischen heimischen Frühjahrsblüher. Es<br />
handelt sich dabei insbesondere um die Träufelspitzen-Brombeere (Rubus<br />
pedemontanus), den Eigenartigen Lauch (Allium paradoxum) und die Silberblättrige<br />
Goldnessel (Lamium argentatum). Inwieweit diese sehr ausbreitungsfähigen<br />
Neophyten in der Lage sind, die Vielfalt der Bodenflora zu reduzieren, sollte durch<br />
ein mehrjähriges Monitoring untersucht werden.<br />
2. In vielen, auch naturnahen Laubwaldpartien besteht der Gehölzjungwuchs nicht<br />
aus Buchen, Hainbuchen und Eichen, wie es zu erwarten wäre, sondern aus<br />
Bergahorn, Spitzahorn und Esche, also den charakteristischen Pionierholzarten auf<br />
reicheren Standorten. Was dies für die Naturverjüngung - auch in den Naturwaldparzellen<br />
- bedeutet, könnte in Dauerbeobachtungsflächen untersucht werden.
3. Der Stadtwald der Eilenriede ist ebenso wie andere Wälder einer allmählichen<br />
Nährstoffanreicherung ausgesetzt. Stickstoffeinträge aus der Luft, aber auch<br />
Gartenabfälle, Hundekot und nicht zuletzt das im Wald abgelagerte, nicht<br />
marktfähige Schwachholz, das aus der forstlichen Bewirtschaftung stammt, bewirken<br />
eine Ausbreitung stickstoffliebender Pflanzen wie Giersch (Aegopodium podagraria),<br />
Große Brennnessel (Urtica dioica), Kletten-Labkraut (Galium aparine) und<br />
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata). Ein Monitoring könnte dazu beitragen, diese<br />
Prozesse besser zu verstehen und ihnen nach Möglichkeit entgegenzuwirken.<br />
4. Der Klimawandel führt auch zu einer Veränderung der Vegetation. Die Tendenz<br />
zur Erwärmung der Erdatmosphäre dürfte sich in einem Stadtwald verstärkt<br />
auswirken. Durch systematische mehrjährige Untersuchungen in<br />
Dauerbeobachtungsflächen lassen sich frühzeitig entsprechende Veränderungen<br />
erkennen und dokumentieren.