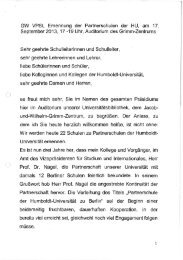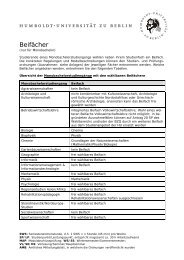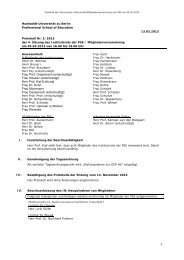Deutsch - Humboldt-Universität zu Berlin
Deutsch - Humboldt-Universität zu Berlin
Deutsch - Humboldt-Universität zu Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Genetikerin und erste Privatdozentin<br />
Paula Hertwig wird als Tochter des Uni-versitätsprofessors<br />
Oskar Hertwig und seiner Frau Marie in <strong>Berlin</strong> geboren.<br />
Nach ihrem Studium der Zoologie, Botanik, Chemie<br />
und Philosophie promoviert sie an der Friedrich-Wilhelms-Universität.<br />
Von 1915 bis 1918 arbeitet sie als Volontärassistentin<br />
am Anatomisch-Biologischen Institut ihres Vaters und führt Untersuchungen<br />
<strong>zu</strong>r Strahlengenetik durch.<br />
Als erste Frau habilitiert Paula Hertwig an der Friedrich-<br />
Wilhelms-Universität und wird Privatdozentin für Allgemeine<br />
Biologie und Vererbungslehre an der Philosophischen Fakultät.<br />
Sie wird Mitarbeiterin bei Prof. Erwin Baur und ab 1921<br />
Assistentin an seinem Institut für Vererbungswissenschaften<br />
der Landwirtschaftlichen Hochschule <strong>Berlin</strong>.<br />
Sie wird nichtbeamteter außerordentlicher Professor an<br />
der Medizinischen Fakultät der <strong>Berlin</strong>er Universität. Sie<br />
bleibt weiterhin Assistentin an der Landwirtschaftlichen Hochschule.<br />
berufen.<br />
Gegen den drohenden „Ent<strong>zu</strong>g der Lehrbefugnis“ protestiert<br />
Paula Hertwig erfolgreich.<br />
Sie wird auf den Lehrstuhl für Allgemeine Biologie an<br />
der Medizinischen Fakultät der Universität in Halle/S.<br />
Mitglied der <strong>Deutsch</strong>en Akademie der Naturforscher,<br />
Leopoldina, der ältesten Akademie der Wissenschaften<br />
in <strong>Deutsch</strong>land.<br />
Übersiedlung nach Villingen (Schwarzwald).<br />
Paula Hertwig stirbt in Villingen.<br />
Physikerin und Professorin<br />
Mathematikerin und Privatdozentin<br />
Hilda Geiringer wird in Wien in einer Kaufmannsfamilie<br />
geboren.<br />
Studium der Mathematik an der Universität Wien und<br />
anschließende Promotion.<br />
Katharina Schiff wird in Wien als Tochter des Universitätsprofessors<br />
Walter Karl und Alice Friederike Schiff von Mises am Institut für Angewandte Mathematik der<br />
Hilda Geiringer arbeitet als Assistentin bei Prof. Richard<br />
geboren.<br />
<strong>Berlin</strong>er Universität. Sie heiratet den Mathematiker Felix Pollaczek,<br />
1922 wird ihre Tochter Magda geboren.<br />
Studium der Physik und Mathematik in Wien und Göttingen.<br />
Habilitation im Fach Angewandte Mathematik. Sie wird<br />
die erste Privatdozentin für Mathematik an der <strong>Berlin</strong>er<br />
Universität und neben Emmy Noether (Universität Göttingen) die einzige<br />
in der Weimarer Republik.<br />
Nach der Promotion in Wien wird sie wissenschaftliche<br />
Assistentin im 1. Chemischen Universitätslaboratorium<br />
bei Prof. Philipp Gross.<br />
Entwicklung der heute als Geiringer-Gleichungen bekannten<br />
Formel <strong>zu</strong>r Deformation von Plastik. Als einzige<br />
Frau wird sie Mitglied des wissenschaftlichen Prüfungsamtes für<br />
Auf Grund ihrer jüdischen Herkunft und ihrer Mitgliedschaft<br />
in der KPD flüchtet sie nach England. Sie wird in<br />
Mathematiklehrer in <strong>Berlin</strong>.<br />
unterschiedlichen Instituten als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig,<br />
u.a. bei Prof. John D. Bernal. Sie wirkt an der Aufklärung der Struktur Auf Grund des so-genannten „Gesetzes <strong>zu</strong>r Wiederherstellung<br />
des Berufs-beamtentums“ wird ihr die<br />
des Insulin-Moleküls mit.<br />
„Lehrbefugnis entzogen“. Sie geht ins Exil, über Brüssel und Istanbul,<br />
1939 in die USA.<br />
Mit Hilfe von Stipendien kann sie bei Prof. Nevill F.<br />
Mott und später bei Prof. Dorothy Hodgkin-Crowfoot<br />
wissenschaftlich arbeiten. Sie heiratet Paul Dornberger, ihre zwei Söhne<br />
werden 1943 und 1946 geboren.<br />
College und an der Brown University, jedoch hat sie als<br />
Hilda Pollaczek-Geiringer unterrichtet am Bryn Mawr<br />
Frau keine Aussicht auf eine ordentliche Professur.<br />
Katharina Dornberger kommt mit ihrer Familie nach<br />
Sie heiratet Richard von Mises und erhält eine Mathematikprofessur<br />
am Wheaton College. Nach dem Tod<br />
<strong>Deutsch</strong>land. Zunächst lehrt sie als Dozentin für Physik<br />
und Mathematik an der Hochschule für Baukunst in Weimar und<br />
ihres Mannes 1953 gibt sie seine Arbeiten heraus.<br />
geht anschließend nach <strong>Berlin</strong> (Ost).<br />
Ehrendoktorwürde am Wheaton College.<br />
Leiterin des Laboratoriums für Kristallstrukturanalyse<br />
der Abteilung Biophysik am Institut für Medizin und<br />
Biologie der <strong>Deutsch</strong>en Akademie der Wissenschaften in <strong>Berlin</strong>-Buch.<br />
Hilda Pollaczek-Geiringer-von Mises stirbt in Santa<br />
Barbara.<br />
Sie gründet die selbständige Arbeitstelle für Kristallstrukturanalyse.<br />
1952 heiratet sie den Mathematiker Dr.<br />
Ludwig Boll.<br />
Habilitation an der <strong>Humboldt</strong>-Universität <strong>zu</strong> <strong>Berlin</strong>.<br />
Von 1954 bis 1956 nebenamtliche Dozentur.<br />
Sie wird Professorin mit Lehrauftrag, erst 1960 Professorin<br />
mit vollem Lehrauftrag an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen<br />
Fakultät der <strong>Humboldt</strong>- Universität.<br />
Dank ihrer Durch-set<strong>zu</strong>ngskraft entsteht das Institut<br />
für Strukturforschung. Katharina Boll-Dornberger ist<br />
bis 1968 die Direktorin.<br />
weiter.<br />
Emeritierung und Berufung <strong>zu</strong>r ordentlichen Professorin<br />
für Spezialgebiete der Physik. Sie arbeitet in Teilzeit<br />
Katharina Boll-Dornberger stirbt in <strong>Berlin</strong>.<br />
Aktuell<br />
Seite 2 HUMBOLDT · 20. Mai 2010<br />
Frauen in den<br />
Naturwissenschaften<br />
PoStERauSStELLuNG<br />
Physikerin und erste außerordentliche Professorin*<br />
„Frauen in den Naturwissenschaften“<br />
Elsa Neumann engagiert sich für die Förderung<br />
–<br />
des<br />
so lautet der Titel einer Posterausstellung, die auf dem Frauen in den Campus<br />
Naturwissenschaften<br />
1900 Frauenstudiums und gründet den „Verein <strong>zu</strong>r Gewährung<br />
zinsfreier (1893 Darlehen - 1973) an studierende Frauen“. Sie wird erste Vorsit-<br />
1981<br />
4. Hilda Pollaczek-Geiringer<br />
Mathematikerin zende, und dann Privatdozentin<br />
Ehrenmitglied dieses Vereins. Sie beteiligt sich auch an<br />
der Luftfahrtforschung und führt Auftragsforschungen für den <strong>Deutsch</strong>en<br />
Luftschifferverband<br />
Adlershof am 31. Mai 2010 feierlich<br />
aus.<br />
eröffnet wird. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Universität<br />
erinnert Chemikerin und die Privatdozentin Ausstellung 1902 „Zeppelin“. an Im selben hervorragende Jahr verunglückt Elsa Neumann Wissenschaftlerinnen, die in der Vergangenheit an der<br />
5. Gertrud Kornfeld (1891 - 1955)<br />
Im Juni unternimmt sie eine Fahrt mit dem Luftschiff<br />
Frauen in den Naturwissenschaften<br />
bei einem Unfall im Chemischen Labor tödlich.<br />
Universität in Mathematik 6. Clara von Simson (1897 stiftet und - 1983) ihre Mutter an der Naturwissenschaften <strong>Berlin</strong>er Universität <strong>zu</strong>m Andenken<br />
den „Elsa-Neumann-Preis“ für die beste ma-<br />
1904 tätig waren. Von Elsa Neumann bis Katharina<br />
Physikerin und FDP-Politikerin<br />
thematische oder physikalische Arbeit eines Jahres. Dieser sollte ausdrücklich<br />
unabhängig vom Geschlecht vergeben werden, dennoch war<br />
Frauen in den Naturwissenschaften<br />
unter den zwölf Preisträgern keine Frau.<br />
Boll-Dornberger, insgesamt zwölf Wissenschaftlerinnen zeigt die von Márta Gutsche, Projektleiterin<br />
7. Elisabeth Schiemann (1881 - 1972)<br />
Genetikerin und Professorin<br />
Das Stipendium für die Nachwuchs-förderung des <strong>Berlin</strong>er<br />
Senats heißt „Elsa-Neumann-Stipendium“.<br />
von „Frauen in den Naturwissenschaften 2010 am Campus Adlershof“ (Finca), konzipierte Ausstellung.<br />
8. Bluma Zeigarnik (1901 - 1988)<br />
Psychologin und Neuropsychologin<br />
Eröffnung: 31. Mai 2010, 14.30 Uhr, Erwin-Schrödinger-Zentrum, Konferenzsaal 0`119,<br />
9. Luise Holzapfel (1900 - 1963)<br />
Rudower Chemikerin Chaussee und Dozentin 26, 12489 <strong>Berlin</strong>.<br />
Abb./Montage: Archiv/unicom<br />
Herausgeber: Der Präsident<br />
Frauen in Adlershof<br />
Physkerin und <strong>Berlin</strong>s erstes „Fräulein Doktor“<br />
Elsa Neumann<br />
23.8.1872 - 23.7.1902<br />
Anlässlich des 200jährigen Jubiläums der Universität Unter den Linden<br />
soll diese Posterausstellung in Adlershof an hervorragende Wissenschaftlerinnen<br />
erinnern, die an unserer Universität tätig waren und herausragende<br />
Beiträge <strong>zu</strong>r Mathematik, bzw. den Bio- und Naturwissenschaften<br />
geleistet haben.<br />
Neben der Würdigung ihrer Leistungen ist es auch ein Anliegen dieser<br />
Ausstellung, Schülerinnen, Studentinnen und junge Wissenschaftlerinnen<br />
<strong>zu</strong>m Studium der Mathematik und den Naturwissenschaften an<strong>zu</strong>regen<br />
und wissenschaftlich tätig <strong>zu</strong> werden.<br />
Die Ausstellung ist mit der freundlichen Unterstüt<strong>zu</strong>ng der Wissenschaftshistorikerin<br />
Frau Dr. Annette Vogt sowie den ergänzenden Vorschlägen<br />
von Angehörigen der Adlershofer Institute der <strong>Humboldt</strong>-<br />
Universität <strong>zu</strong> <strong>Berlin</strong> entstanden. Allen Beteiligten sei für die Mitarbeit<br />
gedankt.<br />
Wir hoffen, dass die Ausstellung einen Einblick in die Leistungen einiger<br />
Naturwissenschaftlerinnen gibt, die an unserer Universität gewirkt haben.<br />
Wir wünschen, dass die Ausstellung Anregungen gibt, Interesse weckt<br />
und Mut macht, wissenschaftlich <strong>zu</strong> arbeiten.<br />
Prof. Dr. Peter Frensch<br />
Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II Elsa Neumann wird in der Familie des Privatiers Max<br />
und seiner Frau Anna Neumann in <strong>Berlin</strong> geboren.<br />
1872<br />
1890<br />
1894<br />
Paula Hertwig<br />
11.10.1889 - 31.3.1983<br />
1889<br />
1916<br />
1919<br />
Sie legt die Lehrerinnenprüfung ab und nimmt Privatunterricht<br />
in den naturwissenschaftlichen Fächern.<br />
1920<br />
1927<br />
1939<br />
1946<br />
Als Gasthörerin wird Elsa Neumann an den Universitäten<br />
Göttingen und <strong>Berlin</strong> für Physik, Mathematik, Chemie<br />
und Philosophie <strong>zu</strong>gelassen.<br />
1. Elsa Neumann (1872 - 1902)<br />
Physikerin und <strong>Berlin</strong>s erstes „Fräulein Doktor“<br />
Bevor Frauen offiziell an der Universität in <strong>Berlin</strong> studieren<br />
können, promoviert sie mit Ausnahmegeneh-<br />
1899<br />
2. Paula migung Hertwig im Fach (1889 Physik - 1983) mit der Arbeit „Ueber die Polarisationscapacität<br />
umkehrbarer<br />
Genetikerin und erste Privatdozentin<br />
Elektroden“. Elsa Neumann wird das erste weibliche<br />
Mitglied der Physikalischen Gesellschaft. Die <strong>Berlin</strong>er Tageszeitungen<br />
berichten voller Stolz über das „erste Fräulein Doktor“. Da für Frauen<br />
eine Universitäts-Anstellung nicht möglich ist, arbeitet sie in dem privaten<br />
Chemie-Laboratorium von Arthur Rosenheim und Richard Joseph<br />
3. Lise Meitner (1878 - 1968)<br />
Meyer.<br />
1953<br />
1972<br />
1983<br />
<strong>Berlin</strong>er<br />
10. Iris Runge (1888 - 1966)<br />
Archivguide<br />
Industriephysikerin und Professorin<br />
11. Else Knake (1901 - 1973)<br />
Zellforscherin und erste Dekanin<br />
12. Katharina Boll-Dornberger (1909- 1981)<br />
Physikerin und Professorin<br />
*Noch bis in die 1960er Jahre wurde für Frauen die<br />
Bezeichnung “Professor” usw. verwendet.<br />
Preis für Gute Lehre ermöglicht Publikation<br />
Frauen in den Naturwissenschaften<br />
Die im Wintersemester von Riem Spielhaus<br />
und Katrin Schütz mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
durch Frank Drauschke vom historischen<br />
Frauen in den Naturwissenschaften<br />
Forschungsinstitut Facts & Files am Institut<br />
für Asien- und Afrikawissenschaften<br />
durchgeführte Lehrveranstaltung „Archive<br />
in <strong>Berlin</strong>“ erhielt den Preis für Gute Lehre<br />
der Philosophischen Fakultät III.<br />
Frauen in den Naturwissenschaften am Campus Adlershof (FiNCA)**<br />
<strong>Humboldt</strong>-Universität <strong>zu</strong> <strong>Berlin</strong>, Institut für Informatik, Rudower Chaussee 25, Haus IV,<br />
Raum 108, 12489 <strong>Berlin</strong> (Tel: 2093-5468), E-Mail: gutsche@informatik.hu-berlin.de<br />
* * U n t e r s t ü t z t d u r c h d a s B e r l i n e r P r o g r a m m z u r F ö r d e r u n g d e r C h a n c e n g l e i c h h e i t f ü r F r a u e n<br />
i n F o r s c h u n g u n d L e h r e<br />
Die praxisorientierte Lehrveranstaltung<br />
„Archive in <strong>Berlin</strong>“ ermöglichte Studierenden<br />
nicht nur einen Einblick in das Tätigkeitsfeld<br />
Archivarbeit. Sie regte <strong>zu</strong>dem die<br />
Erstellung einer Handreichung für Studierende<br />
an und begleitete deren Erstellung.<br />
Mit der nun vorgelegten Broschüre möchten<br />
Studierende ihre „positiven Erfahrungen<br />
an Interessierte weitergeben und so<br />
auf die bisher studentisch eher weniger erschlossenen<br />
Recherchequellen fernab von<br />
Universitätsbibliothek und Internet aufmerksam<br />
machen“, heißt es in dem Guide.<br />
Inhalt der studentischen Publikation sind<br />
neben Tipps für die Archivarbeit eine Übersicht<br />
über besonders relevante Archive in<br />
<strong>Berlin</strong> und Europa sowie Hinweise <strong>zu</strong> an<br />
den Universitätsabschluss anschließenden<br />
Seit Mai gilt für alle Besucherinnen und Besucher<br />
eine neue Arbeitsplatzregelung im<br />
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum. Aufgrund<br />
des hohen Zuspruchs seit der Eröffnung<br />
– durchschnittlich 70 Neuanmeldungen<br />
pro Tag – ist die Bibliothek weit über ihre<br />
Kapazitäten hinaus ausgelastet. Trotz der<br />
Verdoppelung der Arbeitsplätze gegenüber<br />
den Vorgängerbibliotheken reicht die gegebene<br />
Anzahl an Arbeitsplätzen derzeit nicht<br />
aus. Dies hat bereits da<strong>zu</strong> geführt, dass Studierende<br />
der HU Schwierigkeiten hatten,<br />
ihre Hausarbeiten rechtzeitig ab<strong>zu</strong>geben<br />
oder sich auf ihre Modulabschlussprüfungen<br />
vor<strong>zu</strong>bereiten. Daher wird künftig ein<br />
Teil des Gebäudes ausschließlich für Stu<br />
Redaktion: Heike Zappe (verantw.),<br />
Constanze Haase, Ljiljana Nikolic,<br />
Thomas Richter, Silvio Schwartz (online)<br />
Unter den Linden 6, 10099 <strong>Berlin</strong><br />
Tel. (030) 2093-2948, Fax -2107<br />
hu-zeitung@uv.hu-berlin.de<br />
www.hu-berlin.de/pr/zeitung<br />
Layout, Anzeigenverwaltung:<br />
Unicom Werbeagentur GmbH<br />
hello@unicommunication.de<br />
www.unicommunication.de<br />
Tel.: (030) 509 69 89 - 0<br />
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16 vom<br />
01.02.2005, www.hochschulmedia.de<br />
Impressum<br />
Katharina Boll-Dornberger<br />
2.11.1909 - 27.7.1981<br />
1909<br />
1928<br />
1934<br />
Erscheinungsweise: semestermonatlich<br />
Auflage: 10.000 Ex.<br />
Für unverlangt eingesandte Beiträge wird<br />
keine Haftung übernommen. Gezeichnete<br />
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung<br />
des Herausgebers oder der Redaktion wieder.<br />
Bei Nachdruck Quellenangabe und Beleg<br />
erbeten.<br />
HUMBOLDT erscheint wieder am<br />
17. Juni 2010<br />
(Redaktionsschluss: 1. Juni 2010)<br />
Hilda Pollaczek-Geiringer<br />
28.9.1893 - 22.3.1973<br />
Ausbildungsmöglichkeiten für eine Laufbahn<br />
als Archivar. Die Broschüre ist an<br />
Studierende aller Fächer gerichtet.<br />
Der Fakultätspreis für gute Lehre war auf<br />
Initiative des Vizepräsidenten für Studium<br />
und Internationales ausgeschrieben worden.<br />
2009 stand der Bereich berufsfeldbezogene<br />
Zusatzqualifikation und damit<br />
Anwendungsorientierung und Praxisbe<strong>zu</strong>g<br />
der Studieninhalte im Mittelpunkt der<br />
Preisvergabe. Mit dem Preis konnten eine<br />
Honorarkraft für die Endredaktion und der<br />
Druck der Broschüre finanziert werden.<br />
Frauen und Männer sollen sich von dieser Publikation<br />
gleichermaßen angesprochen fühlen.<br />
Allein <strong>zu</strong>r besseren Lesbarkeit werden häufig<br />
geschlechterspezifische Formulierungen auf<br />
die maskuline Form beschränkt.<br />
1937<br />
1939<br />
1946<br />
1948<br />
1951<br />
1953<br />
1956<br />
1958<br />
Die Broschüre findet sich im Bestand der<br />
Zweigbibliothek Asien- und Afrikawissenschaften<br />
und des Jacob-und-Wilhelm-<br />
Grimm-Zentrums. Der <strong>Berlin</strong>er Archivguide<br />
kann heruntergeladen werden unter:<br />
http://fakultaeten.hu-berlin.de/philfak2/<br />
praxisorientierung/downloads<br />
Außerdem ist sie in begrenzter Anzahl<br />
in gedruckter Version bei der Praxiskoordinatorin<br />
Katrin Schütz erhältlich: Dorotheenstraße<br />
24, Raum: 3.409, Telefon:<br />
2093-9722.<br />
„HU-Homezone“<br />
im Grimm-Zentrum<br />
dierende und Mitarbeiter der HU reserviert.<br />
Werktags zwischen 8 und 19 Uhr sowie an<br />
den Wochenenden sind ab sofort alle Arbeitsplätze<br />
im 2., 3. und 4. Obergeschoss<br />
HU-Angehörigen vorbehalten. Sie werden<br />
gebeten, den Studierendenausweis bzw. die<br />
orangefarbene Mitarbeiter-Lesekarte deutlich<br />
sichtbar auf den Arbeitstischen <strong>zu</strong> platzieren.<br />
Für alle anderen Benutzer der Bibliothek<br />
sind in dieser Zeit die Arbeitsplätze<br />
im Erdgeschoss, 1., 5. und 7. Obergeschoss<br />
vorgesehen.<br />
Die Computerarbeitsplätze in den PC-Sälen<br />
und die Gruppenarbeitsräume sind von dieser<br />
Regelung nicht betroffen. Dies ist eine<br />
temporäre Maßnahme.<br />
1970<br />
1893<br />
1917<br />
1921<br />
1927<br />
1930<br />
1933<br />
1942<br />
1944<br />
1960<br />
1973<br />
Alexander von <strong>Humboldt</strong>-<br />
Professur<br />
Bundesforschungsministerin<br />
Prof. Dr.<br />
Annette Schavan<br />
und Prof. Dr. Helmut<br />
Schwarz, Präsident<br />
der Alexander<br />
von <strong>Humboldt</strong>-<br />
Stiftung, verliehen<br />
am 11. Mai die Alexander von <strong>Humboldt</strong>-<br />
Professur an Prof. Dr. Philip van der Eijk,<br />
der am Institut für Klassische Philologie<br />
der <strong>Humboldt</strong>-Universität als Professor<br />
für Klassische Altertumswissenschaften<br />
und Wissenschaftsgeschichte lehrt und<br />
forscht. Van der Eijk gilt international<br />
als Ausnahmeforscher auf seinem Fachgebiet<br />
der Medizingeschichte. In seinen<br />
Forschungen vereint er wichtige Aspekte<br />
der Klassischen Philologie, der Philosophie<br />
und der Wissenschaftsgeschichte.<br />
Seine internationale Reputation erlangte<br />
er durch Arbeiten <strong>zu</strong>r antiken Philosophie<br />
und Naturwissenschaft sowie insbesondere<br />
<strong>zu</strong>r Geschichte der antiken Medizin.<br />
Mit diesem höchstdotierten internationalen<br />
Preis für Forschung in <strong>Deutsch</strong>land<br />
zeichnet die <strong>Humboldt</strong>-Stiftung führende<br />
und im Ausland tätige Wissenschaftler<br />
aller Disziplinen aus. Er soll den Preisträgern<br />
ermöglichen, langfristig <strong>zu</strong>kunftsweisende<br />
Forschung an deutschen Hochschulen<br />
durch<strong>zu</strong>führen. Zum ersten Mal<br />
sind in diesem Jahr auch Geisteswissenschaftler<br />
unter den Preisträgern. Für die<br />
Finanzierung der ersten fünf Jahre stehen<br />
jeweils fünf Millionen Euro für experimentell<br />
und dreieinhalb Millionen Euro<br />
für theoretisch arbeitende Forscher <strong>zu</strong>r<br />
Verfügung.<br />
<br />
Foto: AvH-Stiftung/David Ausserhofer<br />
Königliche Auszeichnung<br />
Das Seminar für Ländliche Entwicklung<br />
(SLE) bildet in einem einjährigen interdisziplinären<br />
Postgraduierten-Studium<br />
Fach- und Führungskräfte für das Berufsfeld<br />
der Internationalen Entwicklungs<strong>zu</strong>sammenarbeit<br />
aus.<br />
Die Inhalte der Ausbildung sind konsequent<br />
an den Erfordernissen dieses<br />
Berufsfeldes orientiert. Planungs-, Management-<br />
und Kommunikationsmethoden<br />
sind neben aktuellen entwicklungspolitischen<br />
Themen zentraler Bestandteil des<br />
Programms. Erfahrungslernen steht im<br />
Vordergrund. Methoden werden eingeübt<br />
und praktisch angewandt. Lernprozesse<br />
werden durch das SLE-Team intensiv<br />
Personalia<br />
Königin Elisabeth II. hat dem langjährigen<br />
Direktor des Großbritannien-Zentrums,<br />
Prof. Dr. Jürgen Schlaeger, den hohen<br />
Orden „Commander of the Order of<br />
the British Empire“ (CBE) verliehen. Der<br />
Orden wurde ihm vom Britischen Botschafter,<br />
Sir Michael Arthur, im Rahmen<br />
eines feierlichen Dinners überreicht. Mit<br />
dem Verdienstorden würdigt die britische<br />
Königin Professor Schlaegers vielfältiges<br />
zivilgesellschaftliches und akademisches<br />
Engagement für die deutsch-britischen<br />
Beziehungen. Von 1995 bis 2008 leitete<br />
er das von ihm mitbegründete Großbritannien-Zentrum<br />
(GBZ) der <strong>Humboldt</strong>-<br />
Universität <strong>zu</strong> <strong>Berlin</strong>. Das GBZ ist ein<br />
interdisziplinäres Forschungsinstitut, an<br />
dem seit zehn Jahren erfolgreich der internationale<br />
Studiengang „Master in British<br />
Studies“ unterrichtet wird. Durch regelmäßige<br />
öffentliche Veranstaltungen hat<br />
es sich als Ort des deutsch-britischen Austauschs<br />
in <strong>Berlin</strong> fest etabliert. Auch nach<br />
seiner Emeritierung im Herbst 2008 ist<br />
Jürgen Schlaeger der <strong>Humboldt</strong>-Universität<br />
verbunden geblieben; er koordiniert<br />
das Jubiläumsjahr.<br />
Nachruf<br />
„Man stirbt nicht, wenn man in den Herzen<br />
der Menschen weiterlebt, die man verlässt.“<br />
Am 25. April 2010 wurde unser allseits<br />
geschätzter und bei uns allen beliebter<br />
Kollege und Mitarbeiter<br />
Daniel Hornig,<br />
geboren am<br />
4. Juli 1971, unerwartet<br />
mitten aus<br />
dem Leben gerissen.<br />
Daniel Hornig<br />
hat seit dem<br />
1. April 2000 an der <strong>Humboldt</strong>-Universität<br />
als Fahrer für das Präsidium gearbeitet,<br />
<strong>zu</strong>vor war er in der Charité tätig.<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der<br />
<strong>Humboldt</strong>-Universität, insbesondere der<br />
Technischen Abteilung und des Präsidialbereiches,<br />
betrauern den plötzlichen<br />
Tod dieses jungen Menschen sehr. Daniel<br />
Hornig war in seinem Team wegen seines<br />
Engagements und seiner Freundlichkeit<br />
und Hilfsbereitschaft sehr geschätzt und<br />
beliebt. Er war ein sympathischer, einfühlsamer<br />
und jederzeit <strong>zu</strong>verlässiger Mitarbeiter<br />
und Kollege und wurde für viele von<br />
uns <strong>zu</strong>m guten Freund. Er hinterlässt eine<br />
große Lücke, wir vermissen ihn sehr und<br />
trauern mit seiner Familie.<br />
Die Trauerfeier für Daniel Hornig findet<br />
am 25. Mai 2010 um 10 Uhr auf dem Dorotheenstädtischen<br />
Friedhof in der Chausseestraße<br />
126 in Mitte statt.<br />
Klaus Gadow und die Kolleginnen<br />
und Kollegen der Technischen Abteilung<br />
Das Präsidium<br />
Das Büro des Präsidenten<br />
Der Präsidialbereich<br />
Nachwuchspreis<br />
Für ihre Abschlussarbeit im Statistik-Masterprogramm<br />
mit dem Titel: „Stochastische<br />
Bevölkerungsvorausberechnung für<br />
<strong>Deutsch</strong>land und ihre Bedeutung für ein<br />
<strong>zu</strong>künftiges Rentenmodell“ erhielt Alena<br />
Myšičková den Gauss Nachwuchspreis<br />
2009 der <strong>Deutsch</strong>en Gesellschaft für<br />
Versicherungs- und Finanzmathematik<br />
(DGVFM) und der <strong>Deutsch</strong>en Aktuarvereinigung<br />
(DAV). Derzeit ist die Preisträgerin<br />
Doktorandin an der „International<br />
Max Planck Research School for Computational<br />
Biology & Scientific Computing“<br />
und arbeitet am Max-Planck Institut für<br />
molekulare Genetik.<br />
Bewerbung für<br />
Postgraduierten-Studium<br />
Mit dem Intensivtraining Fast Track will<br />
die Robert Bosch Stiftung zwanzig promovierte<br />
Nachwuchswissenschaftlerinnen<br />
der Geisteswissenschaften (Sprach- und<br />
Kulturwissenschaften) auf ihrem Weg an<br />
die Spitze in Wissenschaft und Forschung<br />
unterstützen. Mehrtägige Intensivseminare,<br />
Netzwerkbildung mit Führungs<br />
begleitet. Wichtiger Bestandteil der Ausbildung<br />
sind dreimonatige Auslandsprojekte,<br />
die das SLE finanziert. 90 Prozent<br />
der Teilnehmer finden nach Abschluss<br />
einen Arbeitsplatz im In- oder Ausland.<br />
Vorausset<strong>zu</strong>ngen sind unter anderem ein<br />
abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium<br />
sowie die Staatsangehörigkeit<br />
eines EU-Mitgliedslandes oder<br />
eines Transformations- bzw. Entwicklungslandes.<br />
Kursdauer: Januar bis Dezember, Bewerbungsschluss<br />
ist der 31. Juli 2010. Bewerbungsunterlagen:<br />
www.berlinerseminar.de,<br />
sle@agrar.hu-berlin.de<br />
Intensiv-Training Fast Track<br />
kräften sowie ein Stipendium für karrierefördernde<br />
Maßnahmen sind die zentralen<br />
Inhalte des Programms.<br />
Informationen <strong>zu</strong>m Programm und <strong>zu</strong>r<br />
Bewerbung unter www.bosch-stiftung.de/<br />
fasttrack<br />
Who is Who<br />
an der <strong>Humboldt</strong>-Universität<br />
York Wüst<br />
Mitarbeiter des Computer- und<br />
Medienservice, Abteilung Medienservice<br />
Gewisse Situationen im Arbeitsleben von<br />
York Wüst erfordern einen kühlen Kopf. Wie<br />
bei jener Adlershofer Großveranstaltung,<br />
als die Präsentation des Gastredners kurz<br />
vor Beginn der Veranstaltung neu formatiert<br />
werden musste und dabei noch die<br />
Datei des Preisträgers abstürzte. „Aber <strong>zu</strong>m<br />
Glück liefen die Präsentationen bei Veranstaltungsbeginn,<br />
und keiner der Besucher<br />
hat die Schweißperlen auf meiner Stirn<br />
bemerkt“, erinnert sich der Mitarbeiter des<br />
Computer- und Medienservice, Abteilung<br />
Medienservice, mit einem Schmunzeln auf<br />
den Lippen. „Zum Glück sind viele der<br />
Anfragen, die uns tagtäglich erreichen, mit<br />
weniger Stress <strong>zu</strong> lösen.“<br />
Zusammen mit einem Kollegen ist Wüst,<br />
der in den 1990er Jahren ein Toningenieur-Studium<br />
an der Hochschule für Film<br />
und Fernsehen in Potsdam Babelsberg absolvierte,<br />
für die Wartung, Instandhaltung<br />
und Neubeschaffung der Medientechnik<br />
in Adlershof <strong>zu</strong>ständig. Da<strong>zu</strong> gehört die<br />
mediale Ausrüstung der Hörsäle im Erwin-<br />
Schrödinger-Zentrum und des Lehrraumgebäudes<br />
Physik/Chemie auf dem Campus<br />
Adlershof. Zum Job gehören auch die technische<br />
Begleitung von Videokonferenzen<br />
und die Beratung der Hörsaalbeauftragten<br />
der Adlershofer Institute, wenn es beispielsweise<br />
um die Neubeschaffung von Beamer,<br />
DVD-Player, Mikrophon oder Videokamera<br />
geht. Auch wenn Wissenschaftler mit der<br />
elektronischen Mediensteuerung in den<br />
Hörsälen nicht weiterkommen, genügt ein<br />
Anruf – die Telefonnummer steht auf dem<br />
Bildschirm. Zweimal im Semester werden<br />
Schulungen angeboten, in denen Wüst Lehrende<br />
und Vortragende mit der Mediensteuerung<br />
der Hörsäle, mit der sich nicht<br />
nur die technischen Geräte, sondern auch<br />
Raumfunktionen wie Licht und Jalousien,<br />
bedienen lassen, vertraut macht.<br />
Dieser Tage muss noch eine weitere Zielgruppe<br />
gebrieft werden. Die Mitstreiter<br />
der Langen Nacht der Wissenschaften, die<br />
die Hörsäle und Seminarräume im Erwin-<br />
Schrödinger-Zentrum nutzen werden,<br />
erhalten das nötige Know-how. „Bereits<br />
jetzt trifft das Rüstzeug der Teilnehmer ein,<br />
das wir im Schrödinger-Zentrum bis <strong>zu</strong>m<br />
5. Juni lagern müssen“, erklärt der freundliche<br />
Mitarbeiter, der seit 1981 an der <strong>Humboldt</strong>-Universität<br />
ist und langjähriger Mitarbeiter<br />
der heute nicht mehr existierenden<br />
Zentraleinrichtung Audiovisuelle Lehr- und<br />
Lernmaterialen (ZAL) war. Aber nicht nur<br />
die Unterbringung der angelieferten Pakete<br />
muss organisiert werden. Wer braucht<br />
einen Stand, wie müssen die Tische im<br />
Foyer des Schrödinger-Zentrums platziert<br />
werden, welche technischen Anforderungen<br />
haben die einzelnen Teilnehmer? Viele<br />
organisatorische Fragen halten den Medienarbeiter<br />
im Vorfeld der Langen Nacht<br />
auf Trab. Es sind nicht nur Mitarbeiter der<br />
<strong>Humboldt</strong>-Universität, sondern auch der<br />
Adlershofer Standortpartner Igafa e.V. und<br />
Wista Management GmbH, die erwarten,<br />
dass alles wie am Schnürchen läuft. Trotz<br />
gezielter Vorbereitung: Vor Überraschungen<br />
sind die Mitarbeiter des Medienservice<br />
nie gefeit. Am Tag der Veranstaltung fällt<br />
manchem Teilnehmer noch Wichtiges ein,<br />
was unbedingt gebraucht wird und nicht<br />
bestellt wurde. Vom Mittag bis <strong>zu</strong>m Abbau<br />
mitten in der Nacht sind York Wüst und<br />
seine Kollegen unterwegs und tragen da<strong>zu</strong><br />
bei, dass die Veranstaltung weiterhin eine<br />
Erfolgsgeschichte bleibt. Erfahrungsgemäß<br />
ist nach der Langen Nacht vor der Langen<br />
Nacht: „Am nächsten Arbeitstag reservieren<br />
wir bereits die Räume für die längste Nacht<br />
2011.“ Ljiljana Nikolic