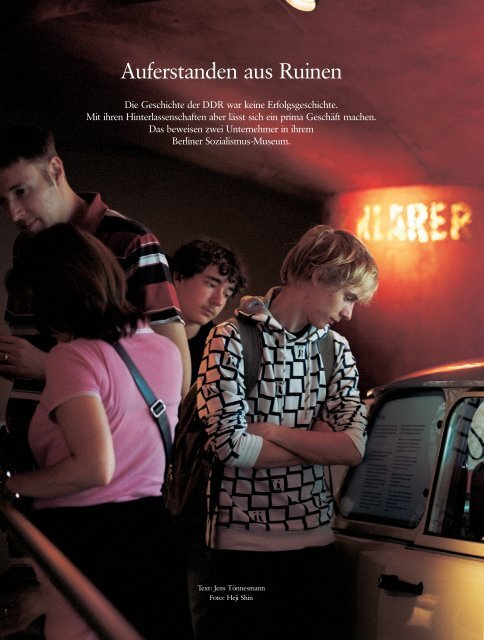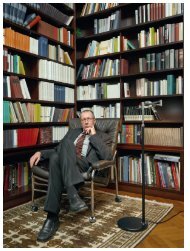Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins
Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins
Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Auferstanden</strong> <strong>aus</strong> <strong>Ruinen</strong><br />
Die Geschichte der DDR war keine Erfolgsgeschichte.<br />
Mit ihren Hinterlassenschaften aber lässt sich ein prima Geschäft machen.<br />
Das beweisen zwei Unternehmer in ihrem<br />
Berliner Sozialismus-Museum.<br />
Text: Jens Tönnesmann<br />
Foto: Heji Shin
WAS MENSCHEN BEWEGT _PRIVATMUSEUM<br />
• Ein Gerippe und ein paar Schutthaufen – mehr ist vom Palast<br />
der Republik in Berlin-Mitte nicht übrig geblieben. Die Ausleger<br />
dreier Kräne schwenken über die Ruine, unten schieben Bagger<br />
die Reste zusammen. Rückbau Ost: Wie viele andere Spuren des<br />
Sozialismus verschwindet auch der Palast, in dem einst die Volkskammer<br />
der DDR tagte, langsam von der Bildfläche.<br />
Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Spree, kommt<br />
vom Lärm der B<strong>aus</strong>telle nur ein leises R<strong>aus</strong>chen an. Es mischt sich<br />
mit dem Glockengeläut der Schiffskapitäne, die Tickets für Ausflugsfahrten<br />
verkaufen wollen, und dem Stimmengewirr einer<br />
Gruppe Jugendlicher, die sich in einem großen Pulk um eine Tür<br />
drängeln. Hinter dieser Tür wurde, während man sie gegenüber<br />
zerlegte, die DDR wieder aufgebaut. Als Museum, von den Unternehmern<br />
Peter Kenzelmann und Robert Rückel. Sie wollten eine<br />
Ausstellung schaffen, um den Besuchern die Alltagskultur im<br />
sozialistischen Osten nahezubringen und Geld zu verdienen – ohne<br />
staatliche Subventionen. Beides traute ihnen anfangs niemand zu.<br />
„Wir wurden angefeindet, und man hat uns unterstellt, es gehe<br />
uns nur um Profite und nicht um wissenschaftliches Arbeiten“,<br />
sagt der Museumsdirektor Rückel. „Es war wie im Sozialismus,<br />
den wir thematisieren: In der Museumsszene ist alles, was von<br />
Privaten kommt, erst mal verdächtig.“<br />
In Deutschland gibt es mehr als 6000 Museen, die jährlich<br />
rund 100 Millionen Besucher anlocken, Tendenz zuletzt leicht<br />
sinkend. Nur die wenigsten können sich ohne Fördermittel und<br />
Sponsoren behaupten, geschweige denn Überschuss erwirtschaften.<br />
„Zwar gründen immer wieder Privatleute Museen“, sagt<br />
Mechtild Kronenberg, Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbunds.<br />
„Aber viele merken schnell: Das ist ein Zuschussgeschäft.“<br />
Auf wie viel Geld sich die Subventionen insgesamt<br />
summieren, wird Kronenberg zufolge nirgendwo erfasst. Aber in<br />
aller Regel beteiligen sich Kommunen, öffentliche Institutionen<br />
und Stiftungen an den Investitions- und Unterhaltskosten.<br />
So wundert es nicht, dass ein Museum, das darauf verzichtet,<br />
misstrauisch beäugt wird. „Das ist kaum zu machen“, sagt Gisela<br />
Weiß, Professorin für Museologie an der Hochschule für Technik,<br />
Wirtschaft und Kultur in Leipzig. „Museen müssen Ausstellungsstücke<br />
lagern, restaurieren, inventarisieren; mitunter in speziellen<br />
Räumen und mit speziellem Personal. Und das ist teuer.“<br />
Kurz: Wenn Museen das tun, was sie nach den Standards für Museen<br />
des Deutschen Museumsbunds sollen, nämlich Originale<br />
sammeln, bewahren, dokumentieren, erforschen und präsentieren,<br />
dann müssen sie mit hohen Kosten rechnen. Und die lassen sich<br />
über Eintrittspreise und Verkaufserlöse nur zum Teil decken.<br />
„Außerdem stehen Museen heutzutage unter einem wahnsinnigen<br />
Konkurrenzdruck“, sagt Gisela Weiß. Sie müssen sich<br />
nicht nur gegenüber anderen öffentlichen Einrichtungen im Wettstreit<br />
um Fördergelder behaupten, sondern konkurrieren mit<br />
allen möglichen Freizeiteinrichtungen um Besucher. Manche<br />
Museen hat dieser Druck in die Knie gezwungen. Andere haben<br />
dar<strong>aus</strong> gelernt: „Viele Museen haben in den vergangenen Jahren<br />
erkannt, dass sie besucherfreundlicher werden müssen“, sagt<br />
Hannelore Kunz-Ott, erste Vorsitzende des Bundesverbandes<br />
Museumspädagogik, „sie müssen den Menschen etwas bieten.“<br />
Das Schlagwort „Besucherorientierung“ treibt die Museen um –<br />
heute müssen sie sich mehr denn je an ihren Gästen orientieren<br />
und sich immer wieder neue Vermittlungskonzepte einfallen<br />
lassen. „Viele Museen setzen inzwischen auf das interaktive und<br />
informelle Lernen mit mehreren Sinnen“, sagt die Leipziger<br />
Museologin Weiß. „Erlebnis ist im Museumsbereich inzwischen<br />
der Begriff schlechthin.“<br />
Ein hart umkämpfter Markt also, hohe laufende Kosten und<br />
eine anspruchsvolle, wählerische Kundschaft – das sind die Gründe,<br />
warum man einem Museum, das Profite erzielen und zugleich<br />
Wissen vermitteln will, erst einmal nicht über den Weg traut.<br />
Die DDR ist Geschichte, und viele Leute<br />
fragen sich: Wie war’s da eigentlich?<br />
Wenn Robert Rückel und Peter Kenzelmann die Geschichte ihres<br />
Museums erzählen und von all den Hürden berichten, die sie<br />
überwinden mussten, dann kommt es häufig vor, dass der eine<br />
einen Satz beginnt und der andere ihn beendet. Etwa wenn sie<br />
von ihrer ersten Begegnung erzählen, im Jahr 2005, als das Museum<br />
noch eine fixe Idee war, die dem Freiburger Peter Kenzelmann<br />
nicht mehr <strong>aus</strong> dem Kopf ging. Auf der Suche nach einer<br />
Ausstellung zum Alltag in der DDR war der Unternehmer in Berlin<br />
auf ein Museum in Amsterdam verwiesen worden. „Da habe<br />
ich gedacht: Wenn das in Berlin keiner macht, dann muss ich es<br />
eben selber machen. Und von da an hat mich die Idee nicht mehr<br />
losgelassen.“<br />
In einem Internetforum lernte Kenzelmann Rückel kennen,<br />
damals freiberuflicher Kulturmanager. „Wir haben uns angeschrieben<br />
…“, sagt Kenzelmann, „… und <strong>aus</strong>get<strong>aus</strong>cht über das,<br />
was wir sonst so machen …“, sagt Rückel und grinst, „… haben<br />
einige Verbindungen zwischen uns festgestellt …“, sagt Kenzelmann<br />
und lacht verschmitzt, „… und dann haben wir gesagt:<br />
Jetzt packen wir es an!“<br />
Drei Tage nach ihrem ersten Treffen weihten Kenzelmann und<br />
Rückel das Büro ein und erarbeiteten einen Businessplan. Denn<br />
für ihre frisch gegründete Firma brauchten sie Geld: „Wir wollten<br />
nicht einfach ein paar Erinnerungsstücke zusammentragen<br />
oder auf der Ostalgiewelle mitschwimmen“, sagt Rückel. „Wir<br />
wollten etwas Einmaliges. Wir wollten das interaktivste Museum<br />
in Europa werden.“ Anfangs veranschlagten Rückel und Kenzelmann<br />
die Kosten auf rund 100 000 Euro – tatsächlich sollten es<br />
bis zur Eröffnung rund 700 000 werden. Noch größer als die<br />
Bedenken mancher Fachleute waren die Zweifel möglicher Geldgeber:<br />
Bei Banken und Business Angels fiel die Idee glatt durch.<br />
„Ich bin durch Deutschland gepilgert, von einer Bank zur ande-<br />
144 BRAND EINS 02/08
WAS MENSCHEN BEWEGT<br />
Stolz auf ihr Werk: die Gründer Rückel und Kenzelmann<br />
Foto vorige Seiten: Jugend bestaunt Rennpappe (Trabbi)<br />
ren“, erinnert sich Kenzelmann, „aber Geld war nicht zu holen.“<br />
Auch bei einem Berliner Investorenclub wurde er vorstellig, um<br />
für seine Geschäftsidee zu werben. Ohne Erfolg. Da half es auch<br />
nicht, dass Kenzelmann seit Jahren eine eigene Beratungsfirma in<br />
Freiburg betreibt und schon während seines Soziologie- und Völkerkunde-Studiums<br />
eine kleine Bäckereikette managte. Außer ihm<br />
selbst und Partner Rückel konnte sich keiner den unternehmerischen<br />
Erfolg eines DDR-Museums vorstellen. „Es gibt eben in<br />
Deutschland einen großen Vorbehalt: Der Staat muss die Kultur<br />
finanzieren“, sagt Rückel. „Dass man damit sogar Geld verdienen<br />
kann, glaubt einfach niemand.“<br />
Also verkaufte Kenzelmann „alles, was nicht niet- und nagelfest<br />
war“. Seine Eltern nahmen eine Hypothek auf, Freunde und<br />
Verwandte gewährten großzügig Kredit. „Wenn man es deutlich<br />
formuliert“, sagt er, „dann habe ich jeden um Geld angebettelt.<br />
Im Nachhinein ist das ein Gefühl, das ich nie wieder haben will.“<br />
Und doch zweifelten die Gründer nicht an ihrer Idee, mieteten<br />
einen 400 Quadratmeter großen Ausstellungsraum gegenüber<br />
der Berliner Museumsinsel, schrieben einen Architektenwettbewerb<br />
<strong>aus</strong> und stellten Mitarbeiter ein. Anfang 2006, als am anderen<br />
Spreeufer die Bagger anrollten, um den Palast der Republik<br />
abzureißen, begannen die Bauarbeiten im DDR-Museum.<br />
Von nun an geschah alles gleichzeitig: Rückel überwachte die<br />
B<strong>aus</strong>telle, verlegte selbst Kabel, traf sich mit Historikern und<br />
machte sich auf die Suche nach Exponaten; Kenzelmann besorgte<br />
frisches Geld, wenn wieder ein Girokonto bis zum Limit überzogen<br />
war. So lernten die beiden nicht nur viel über die DDR,<br />
sondern auch über den realen Kapitalismus hierzulande. Dass<br />
Banken lieber in amerikanische Hypotheken investieren als in<br />
deutsche Museen; dass Baumaterialien heutzutage <strong>aus</strong> aller Welt<br />
kommen und mitunter lange Lieferzeiten haben. Dass Handwerker<br />
immer später fertig werden als verabredet und dass die Berliner<br />
Senatsverwaltung nicht so recht weiß, wie sie private Museen<br />
behandeln soll.<br />
Im Sommer 2006 wurde die Ausstellung eröffnet – und kann<br />
sich seither vor Besuchern kaum retten. Genau 268 348 hat<br />
Rückel bis Anfang November 2007 gezählt, im Schnitt sind es<br />
rund 1000 pro Tag. Besonders stolz sind Rückel und Kenzelmann<br />
darauf, dass es ihnen anscheinend gelingt, auch weniger Kulturbeflissene<br />
ins Museum zu locken. Rückel hat nicht nur die Zahl<br />
der Besucher genau erfasst, sondern rund 7100 von ihnen befragt.<br />
Das Ergebnis: Etwa zwei Drittel von ihnen waren in den<br />
vergangenen zwölf Monaten in keinem oder nur wenigen Museen<br />
gewesen, fast die Hälfte war unter 30 Jahre alt. „Junge 3<br />
BRAND EINS 02/08<br />
145
WAS MENSCHEN BEWEGT _PRIVATMUSEUM<br />
Platte zum Anfassen und ein Mauer-Diorama: nur keine Berührungsängste!<br />
Leute, die nicht von der Schule gezwungen werden, gehen meist<br />
nicht ins Museum“, sagt Rückel, „das wollen wir ändern.“<br />
Rund 60 Prozent der Gäste können das Abitur oder einen<br />
Hochschulabschluss vorweisen und gehören damit zur klassischen<br />
Klientel. In anderen Berliner Museen liegt der Anteil zwischen<br />
70 und 80 Prozent, wie eine Untersuchung des Instituts für<br />
Museumsforschung <strong>aus</strong> dem Jahr 2006 zeigt. Schließlich bewerteten<br />
rund neun von zehn Besuchern die DDR-Ausstellung mit<br />
„sehr gut“. Und etwa drei von vier waren der Ansicht, „etwas<br />
Neues“ gelernt zu haben – ein Punkt, der dem Museumsdirektor<br />
Rückel besonders wichtig ist: „Wir wollten kein Museum machen<br />
für den DDR-Historiker, der eh schon alles weiß, sondern eines,<br />
das Leute neugierig macht und ihnen Gelegenheit gibt, etwas zu<br />
lernen, auch wenn ihnen das Vorwissen möglicherweise fehlt.“<br />
Rumpelmännchen, Rennpappe und kollektives<br />
Töpfchengehen: So putzig war der Sozialismus!<br />
Es ist ein Mittwochmorgen im Herbst. Robert Rückel und Peter<br />
Kenzelmann haben den Eingang zum Museum aufgeschlossen<br />
und den roten Teppich <strong>aus</strong>gerollt. Die Gruppe Neuntklässler <strong>aus</strong><br />
Berlin-Marzahn, die sich eben noch am Eingang gedrängelt hat,<br />
ist in das Museum geströmt und hat sich um einen Tisch in der<br />
Mitte verteilt, über dem ein großer Bildschirm hängt. Im interaktiven<br />
Museumsspiel schlüpfen die Schüler in die Rolle einer<br />
Gruppenführerin der „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ) oder eines<br />
typischen „Gammlers“ und lösen Aufgaben, singen alte DDR-Lieder<br />
und beantworten Fragen zu den Themenbereichen der Ausstellung.<br />
„Hier lernt man was dazu“, sagt Schüler Daniel Rühl,<br />
„wir sind ja keine Zeitzeugen und stecken im Geschichtsunterricht<br />
noch immer bei der Französischen Revolution.“<br />
Dass sich die Ausstellung vor allem um den sozialistischen Alltag<br />
dreht und nur am Rande Ulbricht und Honecker, SED und<br />
politische Verfolgung thematisiert, ist von den Machern gewollt:<br />
„Wir wollen zeigen, dass die Diktatur nicht nur durch Mauer und<br />
Stasi geprägt war, sondern auch durch die Menschen, die in ihr<br />
lebten“, sagt Direktor Rückel, „und die haben sich in den 40 Jahren<br />
natürlich auch einen privaten Freiraum erkämpft.“<br />
Nachdem der Besucher eine Mini-Grenzanlage mit Todesstreifen<br />
passiert hat, begleitet er einen mehr oder weniger typischen<br />
DDR-Bürger durch sein Leben, das in Plattenbauten im Kleinformat<br />
<strong>aus</strong>gestellt ist. Man trifft auf das „Rumpelmännchen“,<br />
das empfiehlt, Rohstoffe zu sparen. Ein Stundenplan und Fotos<br />
erzählen, wie es in den DDR-Bildungseinrichtungen zuging und<br />
vom Kita-Ritual des „kollektiven Töpfchengehens“.<br />
In einem alten „Pionierauftrag“ gelobt ein junger Pionier in<br />
sauberer Schreibschrift, Ordnung in der Schulmappe zu halten und<br />
sich mit „Kampf und Leben von Antifaschisten“ zu beschäftigen.<br />
Man erfährt etwas über die FDJ und die Jubelkundgebungen am<br />
1. Mai, aber auch über die DDR-Punk-Bewegung, die Bockbier<br />
trank und sich mit „Florena Action“ eincremte. Es geht vorbei an<br />
einer Original-Druckmaschine, auf der die Opposition im Untergrund<br />
Protestschriften herstellte, hin zu nachgebildeten Ostsee-<br />
Stränden und Fotos von der ostdeutschen Freikörperkultur. Wer<br />
146 BRAND EINS 02/08
WAS MENSCHEN BEWEGT<br />
So klang die DDR: O-Töne <strong>aus</strong> dem Arbeiter- und Bauernstaat<br />
möchte, kann alte Cottino-Jeans befühlen, in Modeprospekten<br />
blättern, sich Zeitzeugenberichte oder DDR-Hits anhören. „Wir<br />
wollen Neugier wecken und belohnen“, sagt Rückel. „Wer im<br />
nachgebauten Wohnzimmer den Telefonhörer abhebt oder den<br />
Fernseher einschaltet, hört auch was.“<br />
So reist man durch die DDR im Kleinformat, steuert einen<br />
echten Trabbi durch das Rostock der achtziger Jahre und fühlt sich<br />
zurückversetzt in die Zeit des Kalten Kriegs, in der es trotzdem<br />
viel menschliche Wärme gegeben hat – und bekommt eine Ahnung<br />
davon, dass hinter dem Eisernen Vorhang eben nicht nur<br />
bespitzelt und verfolgt, sondern auch gelebt wurde.<br />
Dennoch bemüht sich die Ausstellung, den Alltag nicht zu verklären<br />
und den Besuchern auch die wenig angenehmen wirtschaftlichen<br />
und gesellschaftlichen Lebensbedingungen zu vermitteln.<br />
Alte Zeitungen zeigen, wie gleichgeschaltet die DDR-Medien berichteten,<br />
und das Mangeltagebuch einer Frau <strong>aus</strong> Bautzen erzählt<br />
von den Engpässen, die in der sozialistischen Planwirtschaft an<br />
der Tagesordnung waren: „Ab zehn Uhr Brötchen <strong>aus</strong>verkauft.“<br />
Auf der „Straße der Besten“ erfahren DDR-Unkundige, dass die<br />
„Helden der Arbeit“ meist nicht die leistungsstärksten Arbeiter,<br />
sondern die regimetreuesten waren und dass Diplomingenieure<br />
kaum besser bezahlt wurden als Maurer.<br />
In einer dunklen Ecke des Museums steht ein hölzerner<br />
Schreibtisch, auf dem sich Aktenordner aneinanderreihen und<br />
Kassettendecks stapeln; an der Wand hängt ein Porträt Erich<br />
Honeckers. Wer neugierig ist, kann sich hier einen Kopfhörer aufsetzen<br />
– und bekommt dann zu hören, worüber sich andere<br />
Museumsbesucher im Wohnzimmer gerade unterhalten. Denn<br />
das ist verwanzt. „Das empört zwar manche Besucher“, sagt<br />
Rückel, „aber so wird jedem klar, wie es ist, abgehört zu werden.<br />
Das gehörte eben auch zum Alltag in der DDR.“<br />
In der nachgebildeten Küche, in der Gleichberechtigung in<br />
der DDR thematisiert wird, stehen Manfred, Kerstin und Ute<br />
Reßler <strong>aus</strong> Wittstock. „Wir haben die Zeit ja durchgemacht“, sagt<br />
Manfred Reßler, zu DDR-Zeiten von Beruf Zerspaner. „Es gibt<br />
viele Sachen, die wir hier wiedererkannt haben, und es ist schön,<br />
dass man die hier bewahrt.“ Auch im Gästebuch findet sich beim<br />
schnellen Durchblättern neben vielen Lobeseinträgen nur einer,<br />
der die Oberflächlichkeit der Ausstellung beklagt.<br />
Damit die Ausstellung auch pädagogisch sinnvoll ist, haben<br />
die beiden Gründer einen Historiker und DDR-Forscher als wissenschaftlichen<br />
Leiter engagiert. „Wir wollen hier ganz bewusst<br />
auf neue Erkenntnisse der Museumspädagogik reagieren und das<br />
Museum immer auf den neuesten Stand bringen“, sagt Kenzelmann.<br />
„Also auch jetzt, wo es so gut läuft, nicht sagen: Das war’s,<br />
jetzt ziehen wir nur noch Geld r<strong>aus</strong>“, ergänzt Rückel.<br />
Das könnten die beiden nämlich: Der Jahresumsatz liegt inzwischen<br />
bei mehr als einer Million Euro; das Museum hat zehn<br />
Arbeitsplätze geschaffen und erwirtschaftet seit gut einem Jahr<br />
Gewinn. Und Peter Kenzelmann konnte beginnen, seine Schulden<br />
zurückzuzahlen. „Ich gehe davon <strong>aus</strong>“, sagt er, „dass wir Ende<br />
2008 endlich schuldenfrei sein können.“ Dann übrigens, wenn am<br />
gegenüberliegenden Spreeufer die letzten Reste der Palastruine<br />
abgeräumt sind. -<br />
BRAND EINS 02/08<br />
147