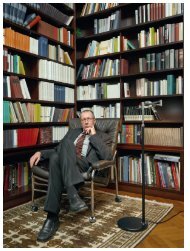Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins
Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins
Auferstanden aus Ruinen - Brand Eins
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WAS MENSCHEN BEWEGT _PRIVATMUSEUM<br />
• Ein Gerippe und ein paar Schutthaufen – mehr ist vom Palast<br />
der Republik in Berlin-Mitte nicht übrig geblieben. Die Ausleger<br />
dreier Kräne schwenken über die Ruine, unten schieben Bagger<br />
die Reste zusammen. Rückbau Ost: Wie viele andere Spuren des<br />
Sozialismus verschwindet auch der Palast, in dem einst die Volkskammer<br />
der DDR tagte, langsam von der Bildfläche.<br />
Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Spree, kommt<br />
vom Lärm der B<strong>aus</strong>telle nur ein leises R<strong>aus</strong>chen an. Es mischt sich<br />
mit dem Glockengeläut der Schiffskapitäne, die Tickets für Ausflugsfahrten<br />
verkaufen wollen, und dem Stimmengewirr einer<br />
Gruppe Jugendlicher, die sich in einem großen Pulk um eine Tür<br />
drängeln. Hinter dieser Tür wurde, während man sie gegenüber<br />
zerlegte, die DDR wieder aufgebaut. Als Museum, von den Unternehmern<br />
Peter Kenzelmann und Robert Rückel. Sie wollten eine<br />
Ausstellung schaffen, um den Besuchern die Alltagskultur im<br />
sozialistischen Osten nahezubringen und Geld zu verdienen – ohne<br />
staatliche Subventionen. Beides traute ihnen anfangs niemand zu.<br />
„Wir wurden angefeindet, und man hat uns unterstellt, es gehe<br />
uns nur um Profite und nicht um wissenschaftliches Arbeiten“,<br />
sagt der Museumsdirektor Rückel. „Es war wie im Sozialismus,<br />
den wir thematisieren: In der Museumsszene ist alles, was von<br />
Privaten kommt, erst mal verdächtig.“<br />
In Deutschland gibt es mehr als 6000 Museen, die jährlich<br />
rund 100 Millionen Besucher anlocken, Tendenz zuletzt leicht<br />
sinkend. Nur die wenigsten können sich ohne Fördermittel und<br />
Sponsoren behaupten, geschweige denn Überschuss erwirtschaften.<br />
„Zwar gründen immer wieder Privatleute Museen“, sagt<br />
Mechtild Kronenberg, Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbunds.<br />
„Aber viele merken schnell: Das ist ein Zuschussgeschäft.“<br />
Auf wie viel Geld sich die Subventionen insgesamt<br />
summieren, wird Kronenberg zufolge nirgendwo erfasst. Aber in<br />
aller Regel beteiligen sich Kommunen, öffentliche Institutionen<br />
und Stiftungen an den Investitions- und Unterhaltskosten.<br />
So wundert es nicht, dass ein Museum, das darauf verzichtet,<br />
misstrauisch beäugt wird. „Das ist kaum zu machen“, sagt Gisela<br />
Weiß, Professorin für Museologie an der Hochschule für Technik,<br />
Wirtschaft und Kultur in Leipzig. „Museen müssen Ausstellungsstücke<br />
lagern, restaurieren, inventarisieren; mitunter in speziellen<br />
Räumen und mit speziellem Personal. Und das ist teuer.“<br />
Kurz: Wenn Museen das tun, was sie nach den Standards für Museen<br />
des Deutschen Museumsbunds sollen, nämlich Originale<br />
sammeln, bewahren, dokumentieren, erforschen und präsentieren,<br />
dann müssen sie mit hohen Kosten rechnen. Und die lassen sich<br />
über Eintrittspreise und Verkaufserlöse nur zum Teil decken.<br />
„Außerdem stehen Museen heutzutage unter einem wahnsinnigen<br />
Konkurrenzdruck“, sagt Gisela Weiß. Sie müssen sich<br />
nicht nur gegenüber anderen öffentlichen Einrichtungen im Wettstreit<br />
um Fördergelder behaupten, sondern konkurrieren mit<br />
allen möglichen Freizeiteinrichtungen um Besucher. Manche<br />
Museen hat dieser Druck in die Knie gezwungen. Andere haben<br />
dar<strong>aus</strong> gelernt: „Viele Museen haben in den vergangenen Jahren<br />
erkannt, dass sie besucherfreundlicher werden müssen“, sagt<br />
Hannelore Kunz-Ott, erste Vorsitzende des Bundesverbandes<br />
Museumspädagogik, „sie müssen den Menschen etwas bieten.“<br />
Das Schlagwort „Besucherorientierung“ treibt die Museen um –<br />
heute müssen sie sich mehr denn je an ihren Gästen orientieren<br />
und sich immer wieder neue Vermittlungskonzepte einfallen<br />
lassen. „Viele Museen setzen inzwischen auf das interaktive und<br />
informelle Lernen mit mehreren Sinnen“, sagt die Leipziger<br />
Museologin Weiß. „Erlebnis ist im Museumsbereich inzwischen<br />
der Begriff schlechthin.“<br />
Ein hart umkämpfter Markt also, hohe laufende Kosten und<br />
eine anspruchsvolle, wählerische Kundschaft – das sind die Gründe,<br />
warum man einem Museum, das Profite erzielen und zugleich<br />
Wissen vermitteln will, erst einmal nicht über den Weg traut.<br />
Die DDR ist Geschichte, und viele Leute<br />
fragen sich: Wie war’s da eigentlich?<br />
Wenn Robert Rückel und Peter Kenzelmann die Geschichte ihres<br />
Museums erzählen und von all den Hürden berichten, die sie<br />
überwinden mussten, dann kommt es häufig vor, dass der eine<br />
einen Satz beginnt und der andere ihn beendet. Etwa wenn sie<br />
von ihrer ersten Begegnung erzählen, im Jahr 2005, als das Museum<br />
noch eine fixe Idee war, die dem Freiburger Peter Kenzelmann<br />
nicht mehr <strong>aus</strong> dem Kopf ging. Auf der Suche nach einer<br />
Ausstellung zum Alltag in der DDR war der Unternehmer in Berlin<br />
auf ein Museum in Amsterdam verwiesen worden. „Da habe<br />
ich gedacht: Wenn das in Berlin keiner macht, dann muss ich es<br />
eben selber machen. Und von da an hat mich die Idee nicht mehr<br />
losgelassen.“<br />
In einem Internetforum lernte Kenzelmann Rückel kennen,<br />
damals freiberuflicher Kulturmanager. „Wir haben uns angeschrieben<br />
…“, sagt Kenzelmann, „… und <strong>aus</strong>get<strong>aus</strong>cht über das,<br />
was wir sonst so machen …“, sagt Rückel und grinst, „… haben<br />
einige Verbindungen zwischen uns festgestellt …“, sagt Kenzelmann<br />
und lacht verschmitzt, „… und dann haben wir gesagt:<br />
Jetzt packen wir es an!“<br />
Drei Tage nach ihrem ersten Treffen weihten Kenzelmann und<br />
Rückel das Büro ein und erarbeiteten einen Businessplan. Denn<br />
für ihre frisch gegründete Firma brauchten sie Geld: „Wir wollten<br />
nicht einfach ein paar Erinnerungsstücke zusammentragen<br />
oder auf der Ostalgiewelle mitschwimmen“, sagt Rückel. „Wir<br />
wollten etwas Einmaliges. Wir wollten das interaktivste Museum<br />
in Europa werden.“ Anfangs veranschlagten Rückel und Kenzelmann<br />
die Kosten auf rund 100 000 Euro – tatsächlich sollten es<br />
bis zur Eröffnung rund 700 000 werden. Noch größer als die<br />
Bedenken mancher Fachleute waren die Zweifel möglicher Geldgeber:<br />
Bei Banken und Business Angels fiel die Idee glatt durch.<br />
„Ich bin durch Deutschland gepilgert, von einer Bank zur ande-<br />
144 BRAND EINS 02/08