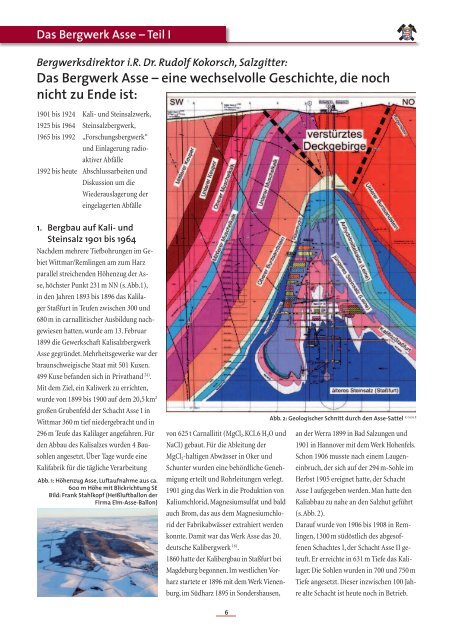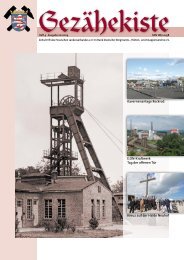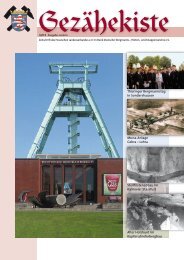Ausgabe 1 / 2010 - Hessischer Landesverband
Ausgabe 1 / 2010 - Hessischer Landesverband
Ausgabe 1 / 2010 - Hessischer Landesverband
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Bergwerk Asse – Teil I<br />
Bergwerksdirektor i.R. Dr. Rudolf Kokorsch, Salzgitter:<br />
Das Bergwerk Asse – eine wechselvolle Geschichte, die noch<br />
nicht zu Ende ist:<br />
1901 bis 1924 Kali- und Steinsalzwerk,<br />
1925 bis 1964 Steinsalzbergwerk,<br />
1965 bis 1992 „Forschungsbergwerk“<br />
und Einlagerung radioaktiver<br />
Abfälle<br />
1992 bis heute Abschlussarbeiten und<br />
Diskussion um die<br />
Wiederauslagerung der<br />
eingelagerten Abfälle<br />
1. Bergbau auf Kali- und<br />
Steinsalz 1901 bis 1964<br />
Nachdem mehrere Tiefbohrungen im Gebiet<br />
Wittmar/Remlingen am zum Harz<br />
parallel streichenden Höhenzug der Asse,<br />
höchster Punkt 231 m NN (s. Abb.1),<br />
in den Jahren 1893 bis 1896 das Kalilager<br />
Staßfurt in Teufen zwischen 300 und<br />
680 m in carnallitischer Ausbildung nachgewiesen<br />
hatten, wurde am 13. Februar<br />
1899 die Gewerkschaft Kalisalzbergwerk<br />
Asse gegründet. Mehrheitsgewerke war der<br />
braunschweigische Staat mit 501 Kuxen.<br />
499 Kuxe befanden sich in Privathand 24) .<br />
Mit dem Ziel, ein Kaliwerk zu errichten,<br />
wurde von 1899 bis 1900 auf dem 20,5 km 2<br />
großen Grubenfeld der Schacht Asse I in<br />
Wittmar 360 m tief niedergebracht und in<br />
296 m Teufe das Kalilager angefahren. Für<br />
den Abbau des Kalisalzes wurden 4 Bausohlen<br />
angesetzt. Über Tage wurde eine<br />
Kalifabrik für die tägliche Verarbeitung<br />
Abb. 1: Höhenzug Asse, Luftaufnahme aus ca.<br />
600 m Höhe mit Blickrichtung SE<br />
Bild: Frank Stahlkopf (Heißluftballon der<br />
Firma Elm-Asse-Ballon)<br />
von 625 t Carnallitit (MgCl 2 .KCI.6 H 2 O und<br />
NaCI) gebaut. Für die Ableitung der<br />
MgCl 2 -haltigen Abwässer in Oker und<br />
Schunter wurden eine behördliche Genehmigung<br />
erteilt und Rohrleitungen verlegt.<br />
1901 ging das Werk in die Produktion von<br />
Kaliumchlorid, Magnesiumsulfat und bald<br />
auch Brom, das aus dem Magnesiumchlorid<br />
der Fabrikabwässer extrahiert werden<br />
konnte. Damit war das Werk Asse das 20.<br />
deutsche Kalibergwerk 16) .<br />
1860 hatte der Kalibergbau in Staßfurt bei<br />
Magdeburg begonnen. Im westlichen Vorharz<br />
startete er 1896 mit dem Werk Vienenburg,<br />
im Südharz 1895 in Sondershausen,<br />
an der Werra 1899 in Bad Salzungen und<br />
1901 in Hannover mit dem Werk Hohenfels.<br />
Schon 1906 musste nach einem Laugeneinbruch,<br />
der sich auf der 294 m-Sohle im<br />
Herbst 1905 ereignet hatte, der Schacht<br />
Asse I aufgegeben werden. Man hatte den<br />
Kaliabbau zu nahe an den Salzhut geführt<br />
(s. Abb. 2).<br />
Darauf wurde von 1906 bis 1908 in Remlingen,<br />
1300 m südöstlich des abgesoffenen<br />
Schachtes I, der Schacht Asse II geteuft.<br />
Er erreichte in 631 m Tiefe das Kalilager.<br />
Die Sohlen wurden in 700 und 750 m<br />
Tiefe angesetzt. Dieser inzwischen 100 Jahre<br />
alte Schacht ist heute noch in Betrieb.<br />
Abb. 2: Geologischer Schnitt durch den Asse-Sattel 4) Seite 8 Abb. 3: Blockbild Grubengebäude Asse 5)<br />
links: Steinsalzabbaue im Leinesteinsalz<br />
Mitte: Steinsalzabbaue im Älteren Steinsalz<br />
rechts: Carnallitabbaue im Staßfurtlager<br />
rot: Einlagerungskammern<br />
Wenig Glück war auch dem Schacht Asse<br />
III in Klein-Vahlberg, weitere 3000 m südöstlich<br />
des Schachtes II, beschieden, mit<br />
dessen Teufarbeiten 1911 begonnen worden<br />
war und in dem 1912 in der Teufe von<br />
400 m ein starker Wassereinbruch auftrat.<br />
Der Krieg unterbrach die Sümpf- und Teufarbeiten,<br />
der Schacht soff ab.<br />
1911, 10 Jahre nach Inbetriebnahme des<br />
Werkes, förderte die Grube rund 120.000 t<br />
carnallitisches Kalisalz aus dem Nordflügel<br />
des über 20 m mächtigen Staßfurtlagers.<br />
Der Absatz betrug 25.000 t Rohsalz,<br />
9.000 t Kalifabrikate, 400 t Kieserit und<br />
32.000 kg Brom. Heute wird auf dem Kaliwerk<br />
Sigmundshall in Bokeloh diese Produktionsmenge<br />
in 10 Tagen erreicht. 1911<br />
führte sie zu einem Betriebsgewinn von<br />
1,2 Mio RM 19) . 1914 stand das Werk mit<br />
einer Beteiligungsquote von 8,1169 Promille<br />
an 51. Stelle von insgesamt 167 Kalischächten<br />
im Deutschen Reich.<br />
Zusätzlich zur Kaliförderung wurde am<br />
1.1.1916 auch mit der Förderung von<br />
Steinsalz aus dem Schacht II begonnen<br />
(s. Abb. 3). Für das Werk Asse wird 1925 vom<br />
Deutschen Steinsalzsyndikat eine Beteiligungsziffer<br />
von 2,7653 % ausgewiesen 19) .<br />
Mitte 1918 veräußerte der braunschweigische<br />
Staat seine 501 Kuxe an das Bankhaus<br />
Gumpel in Hannover. Unter Führung<br />
von Hermann Gumpel waren zu Beginn<br />
des Jahrhunderts die Hannoverschen Kaliwerke<br />
AG gegründet worden. Zu diesem<br />
Unternehmen gehörten u. a. die Werke<br />
Siegfried Giesen bei Hildesheim, Friedrichroda<br />
bei Salzgitter-Flachstöckheim,<br />
Königshall-Hindenburg bei Göttingen,<br />
Reinhardsbrunn bei Northeim und ab<br />
1918 auch das Werk Asse.<br />
Unter dem neuen Eigentümer wurden 1920<br />
die Abteufarbeiten am Schacht Asse III wieder<br />
aufgenommen, der Schacht gesümpft,<br />
zu Ende geteuft und in 600 m, 675 m und<br />
725 m Teufe drei Sohlen angesetzt. Schacht<br />
III erfüllte die Forderung der Bergbehörde<br />
nach einem 2. fahrbaren Ausgang, außerdem<br />
trachtete der Bergwerksbesitzer danach,<br />
mit dem zusätzlichen Schacht eine<br />
höhere Förderquote zu erreichen.<br />
Der wirtschaftliche Umbruch der deutschen<br />
Kaliindustrie in den 20er Jahren des vorigen<br />
Jahrhunderts führte jedoch dazu, dass<br />
dieser Schacht III nie in Betrieb ging, sondern<br />
die Kaliproduktion des Werkes Asse<br />
am 31.12.1925 ganz eingestellt wurde. Das<br />
Werk war seither ohne Unterbrechungen bis<br />
1964 produzierendes Steinsalzwerk, gehörte<br />
Abb. 4: Asse II – Grundriß der 750 m Sohle 8)<br />
bis 1928 zur Gumpel-Gruppe und wurde<br />
nach Liquidierungsbeschluss der Gewerkschaft<br />
Asse am 12.12.1928 an die Burbach-<br />
Kaliwerke AG veräußert.<br />
Als die Steinsalzförderung am 31.3.1964<br />
endgültig eingestellt wurde, besaß das<br />
Grubengebäude unter dem Schacht Asse<br />
II außer Schächten, Strecken und Nutzräumen<br />
folgende Abbauhohlräume<br />
18, 24)<br />
(s. Abb. 3, 4 u. 5):<br />
Abb. 5: Schematischer Schnitt durch den Asse-<br />
Sattel 5)<br />
links: Steinsalzabbaue im Leinesteinsalz in<br />
der Südflanke<br />
Mitte: Steinsalzabbaue im Älteren Steinsalz<br />
im Sattelkern<br />
6<br />
7