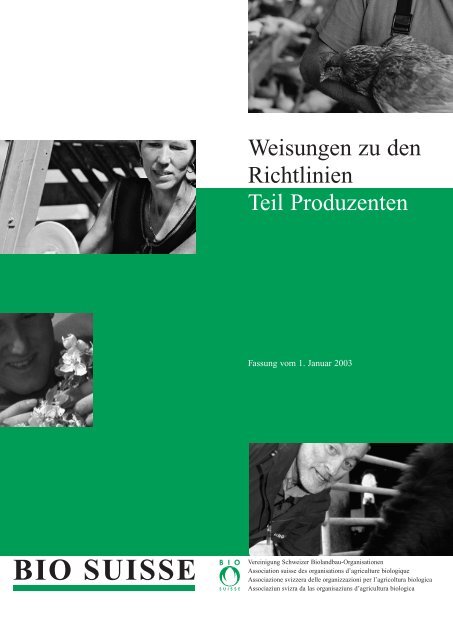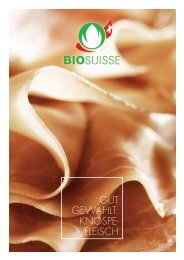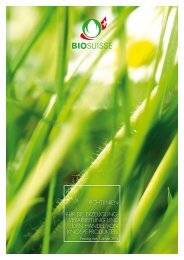Weisungen BIO SUISSE Stand 1.1.2001
Weisungen BIO SUISSE Stand 1.1.2001
Weisungen BIO SUISSE Stand 1.1.2001
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Weisungen</strong> zu den<br />
Richtlinien<br />
Teil Produzenten<br />
Fassung vom 1. Januar 2003<br />
<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen<br />
Association suisse des organisations d’agriculture biologique<br />
Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica<br />
Associaziun svizra da las organisaziuns d’agricultura biologica
3 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Einleitung<br />
Grundlage für die Erzeugung von Knospe-Produkten bilden die Richtlinien der <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong>. Zu deren Präzisierung und Ergänzung können die Gremien (Markenkommissionen<br />
«Anbau» MKA, «Import» MKI und «Verarbeitung/Handel» MKV) <strong>Weisungen</strong><br />
erlassen. Diese sind den Richtlinien untergeordnet. Bei allfälligen Widersprüchen<br />
zwischen Richtlinien und <strong>Weisungen</strong> gilt somit im Zweifelsfall was die<br />
Richtlinien vorschreiben.<br />
Die <strong>Weisungen</strong> müssen immer zusammen mit den Richtlinien angewendet werden.<br />
Für allfällige Verbesserungsvorschläge von Seiten der Praxis ist die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
selbstverständlich immer dankbar. Nur so kann ein optimales Arbeitsinstrument zur<br />
Verfügung gestellt werden.<br />
Die <strong>Weisungen</strong> sind alphabetisch angeordnet.<br />
Der Teil Verarbeitung/Handel enthält zusätzlich die folgenden <strong>Weisungen</strong>, die bei<br />
der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> angefordert oder vom Internet (www.bio-suisse.ch) im PDF-<br />
Format heruntergeladen werden können:<br />
• Allgemeine Anforderungen zur Verarbeitung nach <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>-Richtlinien<br />
• Milch und Milchprodukte<br />
• Fleisch und Fleischerzeugnisse<br />
• Obst und Gemüse<br />
• Getreide und Getreideprodukte<br />
• Alkoholika und Essig<br />
• Pflanzliche Öle und Fette<br />
• Eier und Eiprodukte<br />
• Gastronomie<br />
• Schaderregerkontrolle<br />
• Gewürze, Würze, Boullion, Suppen und Saucen<br />
• Futtermittel<br />
Bemerkung:<br />
Die produktespezifischen Anforderungen sind auch für Hofverarbeiter verbindlich!
4 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Verzeichnis der Abkürzungen<br />
AK<br />
Aufsichtskommission (Vorgängergremium des ! LG)<br />
AKB<br />
Aussenklimabereich<br />
AT<br />
Alterstag<br />
BioV<br />
Bio-Verordnungen (Verordnung über die biologische<br />
Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter<br />
Erzeugnisse und Lebensmittel SR 910.18 sowie<br />
Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft<br />
SR 910.181)<br />
BLW<br />
Bundesamt für Landwirtschaft<br />
BTS-Verordnung Verordnung über besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme<br />
(SR 910.132.4)<br />
BVET<br />
Bundesamt für Veterinärwesen<br />
FiBL<br />
Forschungsanstalt für biologischen Landbau in 5070 Frick<br />
GSchV Gewässerschutzverordung (SR 814.201)<br />
GVO<br />
Gentechnisch veränderte Organismen<br />
JH<br />
Junghennen<br />
LBL<br />
Landwirtschaftliche Beratungszentrale in 8315 Lindau<br />
LG<br />
Lenkungsgremium (ehemaliges Kontrollgremium der Zertifizierungstätigkeit<br />
der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>, aufgelöst)<br />
LH<br />
Legehennen<br />
LMV Lebensmittelverordung (SR 817.02)<br />
LN<br />
Landwirtschaftliche Nutzfläche<br />
LPK<br />
Lizenz-Prüfungs-Kommission der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> (Vorgängergremium<br />
der ! MKV)<br />
MG<br />
Mastgeflügel<br />
MKA<br />
Markenkommission Anbau der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
MKV<br />
Markenkommission Verarbeitung und Handel der <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong><br />
nicht-biologisch aus konventioneller oder IP-Produktion; häufig (z.B. in der<br />
Deklaration von Lebensmitteln) wird dafür auch nur der<br />
Begriff «konventionell» verwendet<br />
PAK<br />
Produzenten-Anerkennungs-Kommission der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
(Vorgängergremium der ! MKA)<br />
RAP Eidgenössische Forschungsanstalt für Nutztiere in 1725<br />
Posieux<br />
RAUS-Verordnung Verordnung über den regelmässigen Auslauf von Nutztieren<br />
im Freien (SR 910.132.5)<br />
RL<br />
<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien für die Erzeugung, Verarbeitung<br />
und den Handel von Erzeugnissen Bio-Produkten<br />
Die Richtlinien werden folgendermassen zitiert: (RL Art.<br />
6.1.2) oder (RL 6.1.2)<br />
TSchV Tierschutzverordung (SR 455.1)<br />
Alle Bundesgesetze und -verordnungen können bestellt werden bei der EDMZ, 3003<br />
Bern, Tel. 031 325 50 50, oder im Internet heruntergeladen werden unter<br />
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
5 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Alpen - Auszeichnung mit der Knospe...................................................................................6<br />
Anforderungen zur Kennzeichnung von Produkten und Werbemitteln mit der<br />
Knospe ..........................................................................................................................................8<br />
Betriebs- und Tierhaltungsgemeinschaften und überbetriebliche Zusammenarbeit21<br />
Betriebsdefinition für Knospe-Betriebe ...............................................................................23<br />
Bienenhaltung auf Knospe-Betrieben...................................................................................25<br />
Direktvermarktung..................................................................................................................27<br />
Futtermittel................................................................................................................................32<br />
Fütterung ohne Anwendung von Gentechnologie..............................................................36<br />
Geflügelhaltung.........................................................................................................................39<br />
Hofverarbeitung und Zukauf von Bioprodukten...............................................................46<br />
Jungpflanzenanzucht im biologischen Gemüse- und Kräuteranbau.............................49<br />
Kaninchenhaltung ....................................................................................................................51<br />
Lenkungsabgaben beim Jungtierzukauf .............................................................................54<br />
Lohnverarbeitung von Lebens- und Futtermitteln............................................................58<br />
Nährstoffversorgung................................................................................................................60<br />
Neulandantritt...........................................................................................................................67<br />
Produzierender Gartenbau - Zierpflanzenanbau..............................................................69<br />
Schafhaltung - Milch und Fleisch..........................................................................................72<br />
Schrittweise Umstellung im Pflanzenbau ............................................................................73<br />
Schweinehaltung.......................................................................................................................75<br />
Speisefischproduktion..............................................................................................................76<br />
Speisepilzproduktion................................................................................................................81<br />
Tiermehlverbot in der biologischen Tierhaltung ...............................................................83<br />
Ziegenhaltung............................................................................................................................84<br />
Merkblätter Teil Produzenten ...........................................................................................85<br />
Einsatz von fremden Maschinen auf dem Biobetrieb .......................................................85<br />
Mindestsortiervorschriften für Bioobst................................................................................88<br />
Saatgut, vegetatives Vermehrungsmaterial und Jungpflanzen.......................................92<br />
Wachtelhaltung.........................................................................................................................97<br />
Schrittweise Umstellung in der Tierhaltung..................................................................... 101
6 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 2, 3, 4, 6, 7<br />
Alpen - Auszeichnung mit der Knospe<br />
Weisung der PAK vom 18. 2. 1997<br />
1 ALLGEMEINES<br />
Dieser Weisung unterstehen alle Sömmerungsbetriebe (gemäss landwirtschaftlicher<br />
Begriffsverordnung) welche gemeinschaftlich oder genossenschaftlich genutzt<br />
werden und somit nicht einem einzelnen Betrieb oder einer Betriebsgemeinschaft<br />
zuzuordnen sind.<br />
Der Produzentenvertrag wird immer mit dem Bewirtschafter des Sömmerungsbetriebes<br />
(gemäss landwirtschaftlicher Begriffsverordnung) abgeschlossen. Innerhalb<br />
einer Korporation können einzelne Sömmerungsbetriebe umgestellt werden<br />
und andere nicht; diese müssen jedoch räumlich klar voneinander getrennt sein.<br />
Auf einem Bio-Sömmerungsbetrieb müssen, damit dieser als solcher anerkannt<br />
werden kann, mindestens 80 % der gesömmerten Milchkühe aus Knospe-<br />
Betrieben stammen 1 .<br />
Private Sömmerungsbetriebe werden zum Landwirtschaftsbetrieb des Bewirt-<br />
mit privaten oder für eine bestimmte Zeit<br />
schafters gerechnet und zusammen mit diesem kontrolliert. Diese müssen biologisch<br />
bewirtschaftet werden (Grundsatz der gesamtbetrieblichen Umstellung). Ein Sömmerungsbetrieb<br />
ist eine Privatalp, wenn die Gebäude im Eigentum oder in Pacht<br />
eines Betriebes/einer Betriebsgemeinschaft stehen oder wenn Gebäude und Land<br />
aufgrund anderer Rechte über unbeschränkte Zeit ausschliesslich von einem Betrieb<br />
genutzt werden. Für private Sömmerungsbetriebe gelten nur die Abschnitte 1 bis 5<br />
dieser Weisung.<br />
Auf Sömmerungsbetrieben einem<br />
Bewirtschafter fest zugeteilten Gebäuden und gemeinsamen Sömmerungsweiden<br />
gilt folgende Regelung: Das Senntum kann nur anerkannt werden, wenn auf der<br />
gesamten Gemeinschaftsweide ein umfassendes und vertraglich festgelegtes Verbot<br />
für chemisch-synthetische Düngemittel und Herbizide besteht. Bei rotierenden Weiderechten<br />
und damit der dazugehörenden Gebäude entscheidet die MKA über Ausnahmebewilligungen<br />
in der Tierhaltung und über den Betriebsstatus.<br />
2 TIERHALTUNG<br />
Die Vorschriften der TSchV (v.a. die Lägermasse und die Lichtverhältnisse) und der<br />
RAUS-Verordnung müssen auf Bioalpen vollumfänglich eingehalten werden. Aus-<br />
müssen vorhanden und<br />
genommen davon sind Alpen mit Ganztagesweide.<br />
Alpschweine müssen Weidegang oder mindestens freien Zugang zu 5 m 2 permanent<br />
zugänglichen Auslaufs pro Tier haben. Wühlmöglichkeiten<br />
die Liegeflächen eingestreut oder trocken und gut isoliert sein. Jedem Tier muss<br />
mindestens 30 cm Trogbreite zur Verfügung stehen. Bei permanentem Auslauf darf<br />
der Stall «dunkel» sein.<br />
Die Fütterung muss richtlinienkonform erfolgen (insbesondere dürfen nicht mehr als<br />
10 % des Trockensubstanzbedarfs bei Wiederkäuern und 20 % bei Nichtwiederkäu-<br />
müssen vom<br />
ern aus nicht-biologischem Anbau stammen).<br />
Es gelten die tiermedizinischen Vorschriften der Richtlinien. Vorbeugende Behandlungen<br />
wie Entwurmen, Bekämpfung der Moderhinke und Panaritium<br />
Tierarzt begleitet sein.<br />
1 Die 80%-Regelung ist nur im Jahr 2001 und auf begründetes Gesuch beim BLW hin möglich!
7 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
3 HOFDÜNGERLAGERUNG<br />
Ab 600 Alpstosstagen muss auf dem jeweiligen Stafel eine befestigte Mistplatte und<br />
eine genügend grosse Sickersaftgrube oder ausreichende Güllegrube vorhanden sein.<br />
Kann die Schotte nicht verwertet werden, so ist diese in die Sickersaftgrube zu leiten.<br />
Stafel mit weniger als 600 Alpstosstagen sind nur dann von dieser Pflicht befreit,<br />
wenn keine Gewässerverschmutzung zu befürchten ist.<br />
Lässt die Erschliessung des jeweiligen Stafels keine Sanierung der Hofdüngerlagerung<br />
zu, so kann die MKA bei Sömmerungsbetrieben mit Ganztagesweide unter<br />
folgenden Bedingungen eine Ausnahmebewilligung erteilen:<br />
• Es darf keine unmittelbare Gefahr einer Gewässerverschmutzung bestehen.<br />
• Die Mistmiete ist laufend abzudecken und muss während derselben Vegetationsperiode<br />
ausgebracht werden.<br />
• Die Ausnahmebewilligung gilt nur unter der Voraussetzung, dass das zuständige<br />
kantonale Gewässerschutzamt keinen Einspruch dagegen erhebt.<br />
4 DÜNGUNG<br />
Der Import von Nährstoffen - Hofdüngerimport aus Talbetrieben und Einsatz biokonformer<br />
Handelsdünger - bedarf der Bewilligung durch die MKA. Die Verwendung<br />
von Klärschlamm ist verboten.<br />
5 MOORSCHUTZ<br />
Die Einzäunung aller Moorflächen wird empfohlen, weil so die Gefahr des Parasitenbefalls<br />
verringert werden kann. Es gelten zudem die Auflagen des jeweiligen<br />
kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzes.<br />
6 KONTROLLE UND ANERKENNUNG<br />
Bio-Sömmerungsbetriebe werden jährlich kontrolliert. Für jeden Sömmerungsbetrieb<br />
muss von der Genossenschaft oder der Korporation eine verantwortliche<br />
Person (Alpmeister) bestimmt werden. Diese Person muss die Richtlinien kennen<br />
und sollte sich in den Belangen des Biolandbaus weiterbilden. Für Sömmerungsbetriebe<br />
gilt eine Umstellzeit von zwei Jahren.<br />
7 VERMARKTUNG DER PRODUKTE AUS <strong>BIO</strong>-<br />
SÖMMERUNGSBETRIEBEN<br />
Für die Vermarktung von Alpprodukten gilt immer der Status des Sömmerungsbetriebes.<br />
Der auf dem Sömmerungsbetrieb produzierte Käse muss mit einer Kaseinmarke<br />
versehen sein, auf welcher die Knospe gemäss der Weisung «Anforderungen<br />
zur Kennzeichnung von Produkten und Werbemitteln mit der Knospe» zu<br />
sehen ist.<br />
Lebende Tiere und Fleischprodukte dürfen nur unter der Knospe vermarktet werden,<br />
wenn das betreffende Tier vor und nach der Alpung auf einem Knospe-Betrieb<br />
gehalten worden ist.
8 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 6.1.1ff<br />
Anforderungen zur Kennzeichnung von Pro-<br />
dukten und Werbemitteln mit der Knospe<br />
Weisung der MKV, Fassung vom 01.01.2003, gültig für Lizenznehmer und Produzenten<br />
1. EINLEITUNG<br />
1.1 Grundlagen<br />
Die aktuellen <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien für die Erzeugung, Verarbeitung und den Handel<br />
von Erzeugnissen aus biologischer (ökologischer) Produktion sind die Grundlage dieser<br />
Weisung.<br />
Verpackungen und Werbematerialien, die das -Logo tragen, müssen vor ihrem Einsatz<br />
der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> rechtzeitig zur Genehmigung vorgelegt werden («Gut zum Druck»).<br />
Die Knospe darf nur von Unternehmen verwendet werden, die mit der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> in<br />
einem gültigen Vertragsverhältnis zur Nutzung der eingetragenen Marke Knospe (Verbandsmitglied<br />
oder Lizenznehmer) stehen.<br />
Es wird vorausgesetzt, dass die gesetzlichen Vorschriften zur Kennzeichnung, wie z.B. die<br />
Lebensmittelverordnung, eingehalten werden.<br />
Für die Gestaltung von Verpackungen und Werbematerialien mit der Knospe sind auch<br />
grafische Grundsätze zu berücksichtigen. Diese und die Anforderungen zur Kennzeichnung<br />
dieser Weisung sind zusammengefasst im «Corporate Design Manual der Knospe»<br />
(zu beziehen bei der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>).<br />
1.2 Aufbau der Weisung<br />
In jedem Kapitel der Weisung wird eine Frage zur Kennzeichnung erläutert. Die Kapitel<br />
sind wie folgt gegliedert:<br />
Artikel der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien<br />
Präzisierung des Richtlinienartikels<br />
Beispiel zur Anwendung<br />
Beispiele von Etiketten und Verpackungen finden sich im letzten Kapitel.<br />
2. KNOSPE-PRODUKTE<br />
Für Produkte, die zu mindestens 90 % aus in der Schweiz angebauten<br />
Rohstoffen bestehen, wird die Knospe mit dem Zusatz <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
verwendet (RL 6.1.2).<br />
Für Produkte, die zu weniger als 90 % aus in der Schweiz angebauten<br />
Rohstoffen bestehen, wird die Knospe mit dem Zusatz <strong>BIO</strong> verwendet<br />
(RL 6.1.3).<br />
2.1 Präzisierungen<br />
Die %-Berechnung bezieht sich auf die landwirtschaftlichen Zutaten zum Zeitpunkt der<br />
Verarbeitung. Besteht bei nicht-biologischen landwirtschaftlichen Zutaten Unklarheit über<br />
die Herkunft, gelten diese als ausländisch.
9 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
2.2 Beispiel zur Verwendung der Knospe<br />
Vollkornmehl<br />
3. DEKLARATIONS-KNOSPE PRODUKTE<br />
Die Verwendung der Deklarations-Knospe ist in den Richtlinien, Art. 6.1.4<br />
beschrieben.<br />
4. UMSTELLUNGS-KNOSPE PRODUKTE<br />
Produkte, die von Umstellungsbetrieben stammen, dürfen mit der Umstellungs-Knospe<br />
vermarktet werden (RL 6.1.5).<br />
Für Produkte, die zu mindestens 90 % aus in der Schweiz angebauten<br />
Rohstoffen bestehen<br />
Für Produkte mit mehr als 10 % ausländischen Rohstoffen<br />
4.1 VORGABEN DER <strong>BIO</strong>-VERORDNUNG UND DER <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong> RICHTLINIEN<br />
2.1.1 Umstellungsvermerk<br />
Auf allen Umstellungsprodukten muss folgender Satz vermerkt sein (gemäss BioV, Art.<br />
20):<br />
Deutsch: Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft<br />
Französisch: Produit dans le cadre de la reconversion à l’agriculture biologique<br />
Italienisch: Ottenuto nel quadro della conversione all’agricoltura biologica<br />
Englisch: Produced under the terms of conversion to organic farming<br />
Der Satz ist im Wortlaut obligatorisch.<br />
4.1.2 WEITERE VORGABEN<br />
Der Umstellungsvermerk (obligatorischer Satz) und Hinweise auf die biologische Landwirtschaft<br />
dürfen hinsichtlich Farbe, Grösse und Schrifttyp nicht auffallender sein als die<br />
Sachbezeichnung (RL 6.1.5).<br />
Die Worte «biologischer Landbau» dürfen nicht stärker hervorgehoben werden als die<br />
Worte «hergestellt im Rahmen der Umstellung auf» (RL 6.1.5).
10 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Bei Produkten mit mehreren landwirtschaftlichen Zutaten darf die Umstellungs-Knospe<br />
nicht im Sichtfeld der Sachbezeichnung verwendet werden. Die Umstellungs-Knospe muss<br />
in diesem Fall klar abgesetzt von der Sachbezeichnung verwendet werden (RL 6.1.5).<br />
Produkte mit der Umstellungs-Knospe gelten für den Export in die EU als nicht-biologisch<br />
(RL 6.1.5).<br />
4.2 Präzisierungen<br />
Die Umstellungs-Knospe darf nicht auffallender sein als der obligatorische Satz.<br />
Idealerweise bilden die Umstellungs-Knospe und der obligatorische Satz eine Einheit<br />
(Druckvorlagen können bei der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> angefordert werden).<br />
In der Sachbezeichnung darf ein Bezug auf die biologische Landwirtschaft nur erfolgen,<br />
wenn das Erzeugnis nicht mehr als eine Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs enthält<br />
Produkte mit der Umstellungs-Knospe gelten für den Export in die EU als nicht-biologisch<br />
(RL 6.1.5).<br />
4.3 Beispiele zur Kennzeichnung von Umstellungs-Knospe Produk-<br />
ten<br />
Inländisches Umstellungs-Knospe Produkt mit einer landwirtschaftlichen Zutat (Monoprodukt):<br />
(Umstellungshinweis bei der Sachbezeichnung)<br />
Karotten<br />
Hergestellt im Rahmen der Umstellung<br />
auf die biologische Landwirtschaft<br />
Importiertes Umstellungs-Knospe Produkt mit mehreren landwirtschaftlichen Zutaten:<br />
(Umstellungshinweis von der Sachbezeichnung abgesetzt<br />
5-Korn-Flocken<br />
Hergestellt im Rahmen der Umstellung<br />
auf die biologische Landwirtschaft<br />
Die Umstellungs-Knospe darf nicht im Sichtfeld der Sachbezeichnung aufgeführt sein.
11 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
5. LISTE DER ZUTATEN UND ZUSATZSTOFFE<br />
Neben den Zutaten müssen alle Zusatzstoffe zwingend mit der Gattungsbezeichnung plus<br />
entweder der entsprechenden E-Nummer oder der Einzelbezeichnung deklariert werden<br />
(RL 6.1.8).<br />
Nicht-biologisch erzeugte Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs sind als solche zu erwähnen 1<br />
(RL 6.1.8).<br />
Ein Umgehen der Deklaration aufgrund von Durchtrageeffekten (z.B. beim Auflisten von<br />
Zutaten oder Zusatzstoffen, die selbst aus mehr als einer Zutat zusammengesetzt sind) ist<br />
unzulässig (RL 6.1.8).<br />
Falls Kräuter und/oder Gewürze weniger als 2 Prozent des Gesamtgewichtes des Produktes<br />
ausmachen, können sie unter dem Gesamtbegriff Gewürze und/oder Kräuter aufgelistet<br />
werden (RL 6.1.9).<br />
Zusammengesetzte, würzende Zutaten (z.B. Bouillon, Gewürzzubereitung), die weniger<br />
als 2% des Gesamtgewichts betragen, können unter dem Gesamtbegriff aufgelistet werden.<br />
Kritische Komponenten (z.B. Hefe, Lecithin) oder Zusatzstoffe müssen immer deklariert<br />
werden.<br />
5.1 Präzisierungen<br />
Zusatzstoffe, die keiner Gattung angehören, sind mit der Einzelbezeichnung und der E-<br />
Nummer zu deklarieren.<br />
Nicht-biologisch erzeugte landwirtschaftliche Zutaten werden wie folgt deklariert:<br />
Zutat x (konventionell/nicht-biologisch) 2<br />
Zutat x aus konventioneller/nicht-biologischer Landwirtschaft 3<br />
Zutat<br />
x<br />
aus konventioneller/nicht-biologischer Landwirtschaft (am Schluss der Zutatenliste)<br />
Bei Platzmangel ist der Vermerk «konv.» 4 zulässig.<br />
Die Liste der Zutaten (Verzeichnis der Zusammensetzung) muss in Grösse und Schrift mit<br />
dem übrigen Informationstext übereinstimmen.<br />
Die Negativdeklaration von gemäss <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien und <strong>Weisungen</strong> unzulässigen<br />
Zusatzstoffen (z.B. ohne Farbstoffe) ist nicht erlaubt. Ein allgemeiner Hinweis auf die <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong> Anforderungen im Begleittext ist möglich.<br />
5.2 Beispiel zur Liste der Zutaten und Zusatzstoffe<br />
Zutaten: Kartoffeln, Zwiebeln, Butter, Reisstärke (konventionell), Gewürzzubereitung<br />
(Salz, Stärkesirup, Gemüse, Hefeextrakt, pflanzliches Fett, Gewürze), Verdickungsmittel<br />
(Johannisbrotkernmehl oder E 410)<br />
Die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien verbieten den Einsatz von Farbstoffen.<br />
1<br />
Wasser, Salz, Kulturen und Zusatzstoffe sind keine landwirtschaftlichen Zutaten. Ein Hinweis auf<br />
biologisch bzw. konventionell erübrigt sich.<br />
2 F: conventionnel; I: convenzionale; E: non organic<br />
3 F: de l’agriculture conventionnelle; I: proveniente dall‘agricoltura convenzionale; E: of non organic<br />
agriculture<br />
4 F: conv.; I: conv.; E: non organic
12 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
6. DEKLARATION DER HERKUNFT DER ROHSTOFFE<br />
Die Herkunft der Rohstoffe ist zu deklarieren.<br />
6.1 <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Knospe-Produkte<br />
Bei Produkten, die mit der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Knospe ausgezeichnet werden, ist keine weitere<br />
Herkunftsangabe nötig. Von dieser Regelung ausgenommen sind namensgebende, hervorgehobene<br />
oder wertbestimmende Zutaten.<br />
6.2 <strong>BIO</strong> Knospe-Produkte<br />
Die Deklaration der Herkunft der Rohstoffe bezieht sich auf die wesentlichen Zutaten<br />
landwirtschaftlichen Ursprungs.<br />
Bei Zutaten, die einen Anteil unter 5 % in der Zusammensetzung ausmachen, kann die<br />
Herkunftsangabe weggelassen werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind namensgebende,<br />
hervorgehobene oder wertbestimmende Zutaten.<br />
Für jede wesentliche Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs ist ein genaues Herkunftsland<br />
anzugeben.<br />
Bei Produkten mit mehreren Zutaten wird das Herkunftsland in der Liste der<br />
Zutaten in Klammern nach der entsprechenden Zutat deklariert. Wenn dies<br />
nicht möglich ist, können die Herkunftsländer auch unmittelbar nach der<br />
Liste der Zutaten in mengenmässig absteigender Reihenfolge deklariert<br />
werden.<br />
Die Herkunftsangabe kann auch in Form einer Tabelle erfolgen.<br />
Das Herkunftsland kann in Form der üblichen Abkürzung deklariert werden (z.B. CH =<br />
Schweiz, D = Deutschland).<br />
In begründeten Fällen können anstelle von einzelnen Ländern summarische Bezeichnungen<br />
verwendet werden. Die geographischen Räume werden unterteilt in Europa, Osteuropa,<br />
Asien, Afrika, Australien, Nordamerika, Mittelamerika und Südamerika. Wenn immer<br />
möglich ist auf die Verwendung von summarischen Begriffen zu verzichten.<br />
Die Verwendung von summarischen Bezeichnungen ist bei der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> mit einer<br />
Begründung zu beantragen.<br />
Die Deklaration der Herkunft der Rohstoffe muss in Grösse und Schrift mit den übrigen<br />
Informationen der Liste der Zutaten übereinstimmen.<br />
6.3 Deklarations-Knospe Produkte<br />
Die Herkunftsdeklaration bei Deklarations-Knospe Produkten erfolgt sinngemäss wie bei<br />
<strong>BIO</strong><br />
Knospe-Produkten.<br />
6.4 Umstellungs-Knospe Produkte<br />
Die Herkunftsdeklaration bei Umstellungs-Knospe Produkten erfolgt sinngemäss wie bei<br />
<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> oder <strong>BIO</strong> Knospe-Produkten.<br />
6.5 Beispiele der Deklaration der Herkunft der Rohstoffe<br />
Monoprodukt (Pfefferminztee)<br />
Zutaten:<br />
Pfefferminz-Blätter (Deutschland)<br />
Zusammengesetztes Produkt (Müesli)
13 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Zutaten:<br />
Haferflocken (CH), Sultaninen (Türkei), Zucker (Paraguay), Sesamöl (Peru),<br />
Weizenflocken (CH), Bananenchips (Panama), Haselnüsse (Italien), Kokosflocken<br />
(Sri Lanka)<br />
7. INFORMATION ÜBER<br />
VERARBEITUNGSVERFAHREN<br />
Die wichtigsten Verarbeitungsverfahren müssen auf dem Knospe-Produkt aufgeführt sein<br />
(RL 6.1.6).<br />
Bei starker Beeinträchtigung der Qualität müssen Rohstoffe, die zur Haltbarmachung vor<br />
der Verarbeitung tiefgefroren wurden, deklariert werden (RL 5.8.3).<br />
7.1 Präzisierungen<br />
Die deklarationspflichtigen Verfahren sind in den MKV-<strong>Weisungen</strong> zur Verarbeitung nach<br />
<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien im Teil «Produktespezifische Anforderungen», bei den einzelnen<br />
Produkten im Kapitel «Kennzeichnung» aufgeführt.<br />
Die Information über Verarbeitungsverfahren muss mindestens in gleicher Schriftgrösse<br />
erfolgen wie die Angaben in der Liste der Zutaten.<br />
Sind einzelne Zutaten eines Produktes einem deklarationspflichtigen Verfahren unterzogen<br />
worden, so erfolgt die Deklaration direkt bei der Zutat im Verzeichnis der Zutaten.<br />
Auf die Deklaration im Verzeichnis der Zutaten kann verzichtet werden, wenn das Endprodukt<br />
einem stärkeren, auch deklarationspflichtigen Verfahren unterzogen wird.<br />
Bei Unklarheiten entscheidet die MKV im Einzelfall über die Deklarationspflicht von<br />
Verarbeitungsverfahren.<br />
7.2 Beispiel zur Information über Verarbeitungsverfahren<br />
Apfel-Joghurt<br />
Zutaten: Homogenisierte und pasteurisierte Milch, Äpfel, Zucker (Paraguay)<br />
8. ADRESSE DES VERARBEITERS ODER<br />
INVERKEHRBRINGERS SOWIE<br />
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE<br />
Die Adresse des Verarbeiters oder Inverkehrbringers sowie die Zertifizierungsstelle<br />
müssen auf dem Knospe-Produkt aufgeführt sein (RL 6.1.6).<br />
8.1 Adresse des Verarbeiters oder Inverkehrbringers<br />
8.1.1 Lizenznehmer<br />
Der Verarbeiter oder der Inverkehrbringer ist mit Name, PLZ und Ort sowie dem Zusatz<br />
« Lizenznehmer: 1 » oder «Knospe-Lizenznehmer: 2 » zu nennen.<br />
Wird der Verarbeiter als Lizenznehmer genannt, so muss der Inverkehrbringer nicht über<br />
einen<br />
Lizenzvertrag mit der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> verfügen.<br />
1 F: Preneur de licence; I: Licenziatario; E: Licensee<br />
2 F: Preneur de licence bourgeon; I: Licenziatario Gemma; E: Bud Licensee
14 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Wird der Inverkehrbringer als Lizenznehmer genannt, so muss sowohl der Inverkehrbringer<br />
als auch der Verarbeiter über einen Lizenzvertrag mit der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> verfügen.<br />
In Ausnahmefällen kann bei Platzmangel auf den Zusatz «Knospe-Lizenznehmer:» ver-<br />
als Lizenznehmer genannt, so wird die Angabe des Verarbeiters<br />
zichtet werden. Name, PLZ und Ort des Lizenznehmers müssen auf jeden Fall genannt<br />
werden.<br />
Wird der Inverkehrbringer<br />
empfohlen.<br />
Weitere Firmen (z.B. Lohnverarbeiter) müssen nicht genannt werden.<br />
8.1.2 Hofverarbeiter<br />
Bei hofverarbeiteten Produkten muss der Knospe-Produzent (Landwirt) mit Name, PLZ<br />
und Ort auf dem Produkt aufgeführt sein.<br />
Wird das Produkt im Lohn durch einen Verarbeitungsbetrieb hergestellt, so wird die Anga-<br />
be des Lohnverarbeiters empfohlen.<br />
8.2 Zertifizierungsstelle<br />
Auf jedem Knospe-Produkt ist die Zertifizierungsstelle mit Name oder in Form der Codenummer,<br />
sowie mit dem Zusatz «Bio-Zertifizierung: 1 » anzugeben.<br />
Die Adresse (PLZ und Ort) der Zertifizierungsstelle kann zusätzlich angegeben werden.<br />
Die Zerti fizierungsstelle, welche für das Unternehmen zuständig ist, das den letzten Erzeu-<br />
sind, ist keine<br />
gungs- oder Aufbereitungsschritt durchgeführt hat, ist aufzuführen.<br />
Auf Düngern und Komposten, die mit der Hilfsstoff-Knospe ausgezeichnet<br />
Zertifizierungsstelle anzugeben. Anstelle der Zertifizierungsstelle kann der Satz «Nach den<br />
Richtlinien der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> geprüft und empfohlen» angebracht werden.<br />
8.2.1 In der Schweiz erzeugtes und/oder aufbereitetes Produkt 2<br />
Die Zertifizierungsstelle für in der Schweiz erzeugte und/oder aufbereitete Knospe-<br />
Produkte ist die bio.inspecta.<br />
Die Codenummer der bio.inspecta ist SCES 006.<br />
8.2.2 Im Ausland erzeugtes und/oder aufbereitetes Produkt<br />
Die im Ausland für den letzten Aufbereitungsschritt zuständige Zertifizierungsstelle ist<br />
anzugeben.<br />
Wird das Produkt in der Schweiz nochmals aufbereitet, so kommt Kapitel 8.2.1 zur An-<br />
wendung.<br />
8.3 Beispiele zur Angabe des Verarbeiters oder Inverkehrbringers<br />
und der Zertifizierungsstelle<br />
Adresse des Verarbeiters oder Inverkehrbringers:<br />
Lizenznehmer: Muster AG, 1234 Musterhausen<br />
oder:<br />
Knospe-Lizenznehmer: Muster AG, 1234 Musterhausen<br />
Adresse des Produzenten:<br />
Hans Muster, 5678 Musterwilen<br />
Angabe der Zertifizierungsstelle:<br />
Bio-Zertifizierung: bio.inspecta<br />
oder<br />
Bio-Zertifizierung: bio.inspecta, 5070 Frick<br />
1 F: Certification Bio; I: Certificazione Bio; E: Organic Certification<br />
2 Gemäss BioV wird unter Aufbereitung die Verarbeitung, die Haltbarmachung und die Verpackung<br />
eines Erzeugnisses verstanden
15 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
oder<br />
Bio-Zertifizierung: SCES 006<br />
Angabe der ausländischen Zertifizierungsstelle:<br />
Bio-Zertifizierung: Name der Kontrollstelle (Land) [z.B. ECOCERT (F)]<br />
oder<br />
Bio-Zertifizierung: Mitgliedstaat und Code der Kontrollstelle [z.B. DE-022]<br />
9. GEBINDE- UND PRODUKTEETIKETTEN<br />
Jedes Produkt muss bis zu seinem Produzenten identifizierbar sein. Werden Produkte<br />
verschiedener Herkunft im Lager oder im Verarbeitungsprozess gemischt, muss die Herkunft<br />
in der Buchhaltung ersichtlich sein (RL 7.3.2)<br />
9.1 Gebindeetikette von Früchte- und Gemüsegebinden (IFCO, G-<br />
Gebinde)<br />
Die Rückverfolgbarkeit muss anhand der Abpackjournale gewährleistet sein. Jede Stufe<br />
(Erzeuger, Händler und Abpacker der Ware), welche die Ware physisch durchläuft, muss<br />
so erfasst werden. Auf der Gebindeetikette müssen der Produzent und der Abpacker erfasst<br />
sein. Die Angaben können in Form von Codes oder per Namen erfolgen. Die Zertifizierungsstelle<br />
muss auf der Etikette angegeben sein.<br />
9.2 Produkteetikette von abgepackten Früchten und Gemüsen<br />
Die Rückverfolgbarkeit muss anhand der Abpackjournale gewährleistet sein. Jede Stufe<br />
(Erzeuger, Händler und Abpacker der Ware), welche die Ware physisch durchläuft, muss<br />
so erfasst werden. Auf der Produkteetikette müssen der Produzent und der Abpacker er-<br />
sein. Die Angaben können in Form von Codes oder per Namen erfolgen. Die<br />
fasst<br />
Zertifizierungsstelle muss auf der Etikette angegeben sein.<br />
Karotten<br />
Produzent: Paul Tester, 9876 Musterhausen<br />
Abpackbetrieb un d Knospe-Lizenznehmer: Muster AG, 1234 Musterlingen<br />
Bio-Zertifizierun g: SCES 006
16 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
10. RECHNUNGEN UND LIEFERSCHEINE<br />
10.1 Knospe-Kennzeichnung auf Lieferscheinen und Rechnungen<br />
Die Knospe-Produkte sind auch auf Rechnungen und Lieferscheinen zu deklarieren. Aus<br />
der Artikelbezeichnung muss hervorgehen, dass es sich um Knospe-Produkte handelt. Sind<br />
auf einem Lieferschein verschiedene Qualitäten (z.B. «Knospe», «Umstell-Knospe», kbA,<br />
IP, konventionell) aufgeführt, so muss jeder Artikel unverwechselbar gekennzeichnet<br />
werden.<br />
Auf Lieferscheinen und Rechnungen ist die Herkunft der Produkte analog Kapitel 6 dieser<br />
Weisung anzugeben.<br />
Die Verwendung der Knospe im Kopf von Rechnungen und Lieferscheinen ist nur zulässig,<br />
wenn diese ausschliesslich für Knospe-Produkte verwendet werden.<br />
Die Vorlagen sind der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> zum «Gut zum Druck» vorzulegen.<br />
10.2 Angabe der Lizenzgebühren<br />
Die Lizenzgebühren 1 sind auf Rechnungen anzugeben. Aus der Rechnung muss klar hervorgehen,<br />
bei welchen Produkten es sich um lizenzpflichtige Produkte handelt.<br />
Die Lizenzgebühren können auf zwei Arten angegeben werden:<br />
Die Lizenzgebühren sind nicht im Verkaufspreis inbegriffen. Die Lizenzgebühren werden<br />
als separater Posten in der Rechnung aufgeführt: «<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Lizenzgebühren<br />
CHF. 75.-»<br />
Die Lizenzgebühren sind im Verkaufspreis inbegriffen. Der Hinweis auf die Lizenzgebühren<br />
erfolgt in der Fusszeile mit dem Vermerk: «inkl. <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Lizenzgebühren»<br />
Der Prozentsatz (0.77 %) kann angegeben werden.<br />
Details zu den Lizenzgebühren sind in der<br />
Lizenzvertrag» geregelt.<br />
«Gebührenordnung zum Knospe-<br />
11.. VERWENDUNG DES VERBANDSNAMENS <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong><br />
Das Kürzel VSBLO (französisch und italienisch ASOAB) hat ausgedient. Die seit 1981<br />
bestehende Organisation nennt sich seit 1998 <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> (Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen)<br />
2 .<br />
11..1 Präzisierungen<br />
<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> wird in Grossbuchstaben und ohne Bindestrich geschrieben. Dies gilt auch<br />
im Lauftext.<br />
Wenn immer möglich soll <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> im Zusammenhang mit der Knospe verwendet<br />
werden.<br />
11..2 Beispiele zur Verwendung des Verbandsnamens<br />
Die Richtlinien der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> setzen einen hohen, streng kontrollierten <strong>Stand</strong>ard für die<br />
Vergabe des Knospe-Labels.<br />
1 F: taxes de licences; I: tasse di licenza; E: fees for the licensing<br />
2 F: <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> (Association suisse des organisations d’agriculture biologique), I: <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
(Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica), E: <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> (Association<br />
of the swiss organic farmers organisations)
17 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> als Dachorganisation der Schweizer Biobauern und Biobäuerinnen hat<br />
sich mit dem Knospe-Label höchster Qualität verschrieben.<br />
Die Knospe der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> steht für streng kontrollierte Bioprodukte.<br />
12.. Grafische Gestaltung der Knospe und von Verpackungen<br />
12..1 Schreibweise der Knospe<br />
Das Wort «Knospe» ist immer in der Einzahl zu verwenden. Substan-<br />
Wort «Knospe» ist nicht in Grossbuchstaben zu verwenden.<br />
tive werden mit Bindestrich an das Wort Knospe angehängt.<br />
Das<br />
„ Bio“ vor einem Substantiv wird mit diesem mit einem Bindestrich<br />
verbunden und nicht zusammengeschrieben.<br />
Beispiele:<br />
Die Knospe ist eines der bekanntesten Bio-Labels.<br />
Die Knospe-Produzentinnen und -Produzenten werden streng kontrolliert.<br />
12..2 Grafische Gestaltung<br />
12.2.1 Gestalterische Verwendung der Knospe<br />
Die Wort-Bildmarke darf nicht verändert werden.<br />
Das Knospe-Label soll gut erkennbar sein und harmonisch wirken. Die Knospe muss frei<br />
stehen und darf nicht in ein anderes Logo oder Label integriert werden. Der Hintergrund<br />
muss ruhig sein.Ein guter Kontrast (Packungsfarben!) ist in jedem Fall sicher zu stellen.<br />
Wird ein Produkt in verschiedenen Qualitäten (Knospe, IP, konventionell) angeboten, so<br />
müssen sich die Verpackungen der verschiedenen Qualitäten grafisch deutlich unterscheiden.<br />
Die Knospe-Produkte sind mit einer grossen Knospe zu kennzeichnen.<br />
12.2.2 Farbe der Knospe<br />
Die Originalfarbe der Knospe sowie der Zusätze «<strong>BIO</strong>», «<strong>SUISSE</strong>» «Hilfsstoffe» und<br />
«Umstellung» ist grün «Pantone 355» oder schwarz.<br />
.<br />
In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei sehr kleinen Auflagen, kann die <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong> Geschäftsstelle andere Farben oder die Verwendung des «Negativs» der Knospe<br />
bewilligen.<br />
12.2.3 Schrifttypen der Zusätze<br />
Für die Zusätzein/über/unter der Bildmarke wie «<strong>BIO</strong>», «<strong>SUISSE</strong>», «Hilfsstoffe» «Umstellung»<br />
(vgl. Kapitel 2) werden Futura Heavy Schrifttypen verwendet. Für den Umstellungsvermerk<br />
(hergestellt im Rahmen der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft)<br />
ist die Typographievorgabe Times New Roman bold zu verwenden, für den Claim (Verlass<br />
Dich drauf) Typographievorgabe Times New Roman.
18 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
13. Beispiele zur Gestaltung von Etiketten und Verpackungen<br />
13.1 Produkteetikette<br />
4-Korn-Flocken<br />
25 kg Art.-No. 12345<br />
Zutaten: Weizen-, Roggen-, Dinkel-, Haferflocken 1<br />
Mindestens haltbar bis: 01.01.2004<br />
Knospe-Lizenznehmer: Muster AG, 1234 Musterlingen<br />
Bio-Zertifizierung: SCES 006<br />
1 Da es sich um ein Schweizer Knospe-Produkt handelt (<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Knospe) ist keine Deklaration<br />
der Herkunft der Rohstoffe notwendig
19 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
12.2 Produkteverpackung<br />
"<br />
#<br />
)<br />
Dieses<br />
-Produkt<br />
stammt von biologisch<br />
wirtschaftenden Bauern-<br />
betrieben. Diese müssen<br />
die strengen Richtlinien<br />
der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> erfüllen,<br />
damit sie mit der<br />
gezeichnet werden.<br />
aus-<br />
RAVIOLI<br />
mit Fleischfüllung<br />
Zutaten:<br />
Teig: Hartweizen-<br />
griess (USA), Was-<br />
ser, Eier (CH), Kochsalz<br />
Füllung: Rindfleisch<br />
(CH), Paniermehl<br />
(CH), Gewürzzuberei-<br />
tung (Salz, Hefeex-<br />
trakt, Gemüse, Gewürze),<br />
Reisstärke<br />
(konventionell),<br />
Ka-<br />
To-<br />
rotten, Sonnenblu-<br />
menöl gedämpft,<br />
maten, Kräuter.<br />
Pasteurisiert<br />
%<br />
$<br />
&<br />
Lizenznehmer:<br />
Name, PLZ Ort<br />
'<br />
Bio-Zertifizierung:<br />
bio.inspecta, 5070<br />
Frick<br />
(<br />
Anmerkungen:<br />
" Richtiger Knospe-Typ bei der<br />
Sachbezeichnung<br />
# Liste der Zutaten und Zusatzstoffe<br />
in absteigender Reihenfolge<br />
$<br />
Deklaration von nichtbiologischen<br />
landwirtschaftlichen<br />
Zutaten mit dem Vermerk (konventionell)<br />
% Deklaration der Herkunft der<br />
Rohstoffe<br />
&<br />
'<br />
Information über Verarbeitungsverfahren<br />
Adresse des Verarbeiters oder<br />
Inverkehrbringers<br />
( Zertifizierungsstelle<br />
) Verwendung der Knospe und des<br />
Namens <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> in weitergehenden<br />
Informationen
20 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
12.3 Lieferschein<br />
Muster AG<br />
Am Rhein 23<br />
4050 Basel MWST-Nr. 6676<br />
Tel. 061 611 11 11<br />
Lieferschein<br />
___________________________________________________________<br />
für<br />
Gemüse AG Datum: ............<br />
Hofweg 59<br />
4051 Basel<br />
Artikel Einheit à Fr. Total CHF.<br />
__________________________________________________________<br />
<strong>BIO</strong> Karotten CH<br />
Knospe 100 kg 1.50 150.00 <br />
<strong>BIO</strong> Endivien IMPORT Italien<br />
Knospe 100 Stück 1.60 160.00 <br />
<strong>BIO</strong> Aubergine IMPORT Frankreich<br />
Umstellknospe 100 kg 2.60 260.00 <br />
<strong>BIO</strong> Orangen IMPORT Israel<br />
EU Bio 10 kg 3.00 30.00<br />
Tomaten<br />
konventionell 50 kg 4.00 200.00<br />
__________________________________________________________<br />
Warentotal exkl. MWST 800.00<br />
Lebensmittel Total MWST 2.40%: 800.00 = 19.20 19.20<br />
__________________________________________________________<br />
Total inkl. MWST 819.20<br />
__________________________________________________________<br />
inkl. <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Lizenzgebühren
21 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 4.1.1 ff<br />
Betriebs- und Tierhaltungsgemeinschaften<br />
und<br />
überbetriebliche Zusammenarbeit<br />
Weisung der MKA vom 28.11.2000, angepasst von der MKA am 18.06.2002<br />
1 EINLEITUNG<br />
Diese Weisung hat zum Ziel, die Gründung von Betriebs- und Tierhaltungsgemeinschaften<br />
(BG; THG) nicht unnötig zu erschweren, da derartige Zusammenschlüsse<br />
als effiziente Lösung zur Strukturanpassung erachtet werden. Andererseits soll aber<br />
eine vorsätzliche Umgehung der Umstellzeit durch Vortäuschung einer derartigen<br />
Gemeinschaft verhindert werden.<br />
2 BETRIEBSGEMEINSCHAFTEN (BG)<br />
2.1 Anmeldung<br />
Eine BG zwischen Knospe-Betrieben kann jederzeit gegründet werden. Die Gründung<br />
muss der Zertifizierungsstelle sofort nach der Unterzeichnung des BG-<br />
Vertrags gemeldet werden.<br />
Will ein Knospe-Betrieb mit einem nicht-biologischen Betrieb eine BG gründen, so<br />
muss sich der nicht-biologische Betrieb vor Ende des Kalenderjahres für die Umstellung<br />
auf biologischen Landbau anmelden. Die BG kann dann frühestens auf den<br />
Jahresbeginn des ersten Umstellungsjahres gegründet werden. Kann dieser Termin<br />
nicht eingehalten werden, gelten für die Zeit bis zum Beginn des ersten Umstellungsjahres<br />
des nicht-biologischen Betriebes die Regelungen betreffend Neulandantritt.<br />
BG-Verträge müssen über mindestens 4 Jahre abgeschlossen werden (vgl. auch<br />
Punkt 2.4 dieser Weisung).<br />
Vom Zeitpunkt des Vertragsbeginns an wird die BG für die Kontrolle, die Zertifizierung<br />
und die Labelanerkennung als ein einziger Betrieb behandelt.<br />
2.2 Formelle Anforderungen<br />
Die Betriebsgemeinschaft muss Artikel 10 der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung<br />
erfüllen.<br />
Der Betriebsleiter des vormals konventionellen Betriebs muss im Laufe des ersten<br />
Umstellungsjahres die in den RL Art. 4.1.3 vorgeschriebene Pflichtausbildung absolvieren.<br />
Die Parzellen behalten, wie bei Neulandantritt, den Anerkennungsstatus des vormaligen<br />
Betriebs. Parzellen des nicht-biologischen Teils müssen normal umgestellt<br />
werden (U1, U2).<br />
Aus dem Parzellenplan muss der Anerkennungsstatus der einzelnen Parzellen genau<br />
hervorgehen.<br />
Die Tiere behalten den Anerkennungsstatus des vormaligen Betriebs. Aus dem Tierbestandesjournal<br />
muss der Anerkennungsstatus der einzelnen Tiere genau hervorgehen.<br />
2.3 Vermarktungsstatus der Produkte<br />
Pflanzliche Produkte haben den Anerkennungsstatus der jeweiligen Parzelle. Bei
22 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Parallelproduktion auf Parzellen mit unterschiedlichem Anerkennungsstatus muss<br />
die ganze Produktion im jeweils tieferen Anerkennungsstatus vermarktet werden<br />
(entsprechend der Weisung «Neulandantritt»).<br />
Für den Vermarktungsstatus der tierischen Produkte ist der Anteil des Umstellfutters<br />
in der Ration massgebend, es gelten die Bestimmungen in Richtlinien Ar.t 3.1.8.<br />
Die Tiere behalten den jeweiligen Anerkennungsstatus. Sie können als Biotiere<br />
gerechnet werden, wenn sie die Bedingungen von Art. 3.1.10 der Richtlinien erfüllen.<br />
2.4 Auflösung der Betriebsgemeinschaft<br />
Die Auflösung der BG muss umgehend der Zertifizierungsstelle gemeldet werden.<br />
Wird die BG vor Ablauf von 4 Jahren ohne äussere Gründe wieder aufgelöst, muss<br />
die MKA untersuchen, ob es sich um einen Fall einer Umgehung der Umstellzeit<br />
und damit um eine unlautere Erschleichung von Bio-Mehrwerten handelt. Je nach<br />
Befund werden die erworbenen Mehrwerte von den Teilbetrieben zu proportionalen<br />
Teilen zurückverlangt.<br />
3 TIERHALTUNGSGEMEINSCHAFTEN (THG)<br />
Partnerbetriebe einer THG gelten im Gegensatz zu einer BG immer als zwei kontrollrechtlich<br />
unabhängige Betriebe. Es ist nicht mehr möglich, eine THG zwischen<br />
einem Knospe-Betrieb und einem nicht-biologischen Betrieb zu gründen. Die Partnerbetriebe<br />
müssen sich für die gleiche Kontrollfirma entscheiden.<br />
4 ANDERE ZUSAMMENARBEITSFORMEN<br />
Andere Zusammenarbeitsformen betreffend Fruchtfolge, Tierhaltung, Nährstoffaustausch<br />
und Ökoausgleichsflächen zwischen Knospe-Betrieben und nichtbiologischen<br />
Betrieben müssen zu Beginn des Kontrolljahres der Zertifizierungsstelle<br />
unter Beilage des entsprechenden Vertrags zwecks Beurteilung und Bewilligung<br />
gemeldet werden.<br />
Zusammenarbeitsformen zwischen Knospe-Betrieben müssen nur dann zur Beurteilung<br />
gemeldet werden, wenn bei der Zusammenarbeit Vorschriften der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
Richtlinien, des ökologischen Leistungsnachweises und/oder der Bio-Verordnung<br />
tangiert werden. Die Meldung muss bis 1. Januar erfolgen. Gemeinschaften von<br />
ökologischen Ausgleichsflächen sind nicht möglich. Bestehende Verträge sind bis<br />
31.12.2003 anzupassen.
23 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 4.1.1<br />
Betriebsdefinition für Knospe-Betriebe<br />
Weisung (Ausführungsbestimmung) der AK vom 22.11.1995 / angepasst am<br />
14.8.1996, 13.12.2001<br />
1. ZIELE<br />
Die Betriebsdefinition soll dazu beitragen, dass<br />
• der Biolandbau als gesamtbetriebliche Wirtschaftsweise glaubwürdig bleibt;<br />
• die Anforderungen des Biolandbaus kontrollierbar sind;<br />
• das Prinzip der gesamtbetrieblichen Umstellung gestärkt wird;<br />
• rein juristische Konstrukte zur Tarnung von Teilumstellungen verhindert werden.<br />
2. DEFINITION BETRIEB<br />
Als Landwirtschaftsbetrieb im Sinne des biologischen Landbaus gemäss <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong> Richtlinien gilt ein Unternehmen oder eine bzw. mehrere Produktionsstätten,<br />
welche<br />
a) eine Gesamtheit von Land, Gebäuden, Inventar und Arbeitskräften dar-<br />
stellt:<br />
Im Falle von Verbindungen zu Nicht-Biobetrieben muss die Grundgesamtheit<br />
zu Beginn der Umstellung eindeutig definiert werden, indem die Zuteilung<br />
von Gebäuden, Inventar und Arbeitskräften schriftlich festgehalten<br />
wird. Nachträgliche Flächenveränderungen zwischen den Partnerbetrieben<br />
sind nicht möglich, ausgenommen die Partnerbetriebe werden in eine<br />
schrittweise Umstellung gemäss <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien einbezogen. Der<br />
Hauptteil der Kulturarbeiten muss vom fest zugeteilten Mitarbeiterstamm geleistet<br />
werden. Die Mitarbeiter müssen die Richtlinien kennen und sich über<br />
Fragen des Biolandbaus weiterbilden.<br />
b) selbständig ist:<br />
Die Selbständigkeit ist gegeben, wenn der Betrieb einen von anderen landwirtschaftlichen<br />
Betrieben unabhängigen Warenfluss aufweist, über ein eigenes<br />
Rechnungswesen verfügt und von einem eigenverantwortlichen und<br />
fachkompetenten Betriebsleiter geführt wird, welcher daneben für keine<br />
nicht-biologisch bewirtschafteten Betriebe oder Produktionsstätten verantwortlich<br />
sein darf. Der Betrieb muss überdies nach aussen mit einem eigenen,<br />
unverwechselbaren Erscheinungsbild (Name, Briefpapier, Deklarations- und<br />
Verpackungsmaterial, Geschäftsadresse) erkennbar sein.<br />
Ehe- und Konkubinatspartner dürfen nicht an der Leitung eines nichtbiologischen<br />
Landwirtschaftsbetriebes beteiligt sein. Die von ihnen bewirtschafteten<br />
Produktionsstätten gelten daher immer als ein Betrieb. Als Konkubinatspaare<br />
gelten Partnerschaften, welche dauernd einen gemeinsamen<br />
Haushalt führen und ihr Leben gemeinsam gestalten, so dass sie sich von E-<br />
hepaaren nicht wesentlich unterscheiden.<br />
Betriebsteilungen und die Anerkennung von Produktionsstätten müssen vorgängig<br />
bewilligt werden. Dazu sind alle nötigen Unterlagen an die Zertifizierungsstelle<br />
einzureichen. Die Zertifizierungsstelle unterbreitet ein Dossier<br />
mit Antrag an die MKA.<br />
c) räumlich als solches erkennbar ist:<br />
Zur Erkennbarkeit gehören eine eigene, unverwechselbare Geschäftsadresse<br />
mit eigenständigen Gebäuden, definiert als Betriebszentrum.
24 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
d) ein Betriebszentrum hat:<br />
Als Betriebszentrum gilt der Ort, an dem sich die Hauptgebäude und das<br />
Schwergewicht der Betriebstätigkeit befinden. Am Betriebszentrum werden<br />
die wichtigsten operativen Entscheide getroffen (Arbeits- und Betriebsorganisation)<br />
und die Betriebsunterlagen bearbeitet und verwaltet (Anbaupläne,<br />
Kontrollunterlagen usw).<br />
Eine kantonale Anerkennung als Betrieb muss nicht zwingend von der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
übernommen werden.
25 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: keine<br />
Bienenhaltung auf Knospe-Betrieben<br />
Weisung der PAK vom 24.7.1997<br />
1 EINLEITUNG<br />
In den Richtlinien der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> sind die Bienen nicht erwähnt. Die PAK hat<br />
deshalb im Auftrag der AK, und in Zusammenarbeit mit interessierten Imkern, diese<br />
Weisung erarbeitet.<br />
2 DEKLARATION<br />
Der Honig von anerkannten Knospe-Betrieben darf mit folgendem Text deklariert<br />
werden:<br />
Honig aus Knospe-konformer Bienenhaltung.<br />
3 ZWECK UND ZIEL<br />
Durch artgerechte Haltung, verantwortungsvolle Pflege, sorgfältige Ernte und schonende<br />
Verarbeitung sollen Produkte von hoher Qualität erzeugt werden.<br />
4 ZUCHT<br />
Es dürfen nur Bienenrassen aus dem europäischen Raum gehalten werden. Die Zukäufe<br />
sind zu protokollieren.<br />
Durch Selektion (z.B. auf guten Putztrieb) ist eine bessere Verträglichkeit gegenüber<br />
der Varroamilbe zu fördern. Künstliche Besamung und der Einsatz von gentechnisch<br />
verändertem Erbgut sind verboten.<br />
5 HALTUNG / BAU DER BEUTEN<br />
Die Bienen sind artgerecht und ihren natürlichen Bedürfnissen entsprechend zu<br />
halten. Die Verjüngung durch Jungvolkbildung ist zu fördern.<br />
Es dürfen nur noch Beuten aus natürlichen Stoffen angeschafft werden (z.B. Massivholz,<br />
Stroh, Lehm). Kunststoffe sind für Begattungskästchen, Futtergeschirre und<br />
Kleinteile zugelassen. Als Schutzmittel in der Beute dürfen nur bieneneigene Mittel<br />
verwendet werden. Aussenbehandlungen der Beuten müssen unschädlich sein.<br />
6 WACHS<br />
Im Durchschnitt der Jahre sollten 25 Prozent der Waben im Brutraum erneuert werden.<br />
Altwachs darf zur Aufbereitung nicht mit solchem aus nicht-biologischer Produktion<br />
vermischt werden. Zugekaufter Wachs und Mittelwände dürfen nur von<br />
Betrieben stammen, die nach dieser Weisung imkern.
26 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
7 FÜTTERUNG<br />
Die Völkerzahl ist dem durchschnittlichen Trachtangebot anzupassen. Das Anwandern<br />
von nicht-biologisch bewirtschafteten Obstplantagen ist verboten.<br />
Zwischentrachtfütterung, Reizfütterung und die Fütterung von Schwärmen und<br />
Jungvölkern hat durch Futterwaben aus eigener Produktion oder Honigfutterteig zu<br />
erfolgen.<br />
8 TIERGESUNDHEIT/ BEHANDLUNGEN<br />
Die Reinigung und Desinfektion von Beuten und Geräten hat mechanisch, mit heissem<br />
Sodawasser und/oder durch Abflammen zu erfolgen. Zur Behandlung von Bienenkrankheiten<br />
und Schädlingen sind neben den vorbeugenden Massnahmen (Jungvolkbildung,<br />
Drohnenbrutschnitt u.s.w.) ausschliesslich folgende Mittel zugelassen:<br />
• Gegen Varrao-Milbe: Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure<br />
• Gegen Accarabis-Milbe: Ameisensäure<br />
• Gegen Wachsmotte: Essigsäure, Ameisensäure, Schwefel<br />
• Gegen Verstopfung: Glaubersalz<br />
• Bei Faulbrut / Sauerbrut sind die Anordnungen der Tierseuchenverordnung zu<br />
befolgen.<br />
• Zum Fernhalten<br />
der Bienen können Wasser, Rauch und Essig eingesetzt werden.<br />
9 LAGERUNG UND VERARBEITUNG<br />
Es gelten sinngemäss die Artikel 5.1.1 bis 5.9.2 der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien.
27 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 6.2.1 ff<br />
Direktvermarktung<br />
Weisung der MKV vom 28.4.1999<br />
1 EINLEITUNG UND ZWECK DIESER WEISUNG<br />
Die Direktvermarktung stellt für viele Knospe-Betriebe einen wichtigen Einkommenszweig<br />
dar. Zur Sortimentsabrundung werden häufig auch zugekaufte Produkte<br />
vermarktet. Dabei handelt es sich jedoch nicht immer um biologische Produkte.<br />
Immer häufiger vermarkten mehrere Produzenten zusammen ihre Produkte an Wochenmärkten<br />
usw. direkt. Bei diesen Produzentenzusammenschlüssen handelt es<br />
sich im Normalfall nicht ausschliesslich um Knospe-Produzenten.<br />
Die Vermarktung von nicht-biologischen Produkten durch Knospe-Produzenten soll<br />
unter gewissen, in dieser Weisung festgelegten Auflagen und nach Bewilligung<br />
durch die MKV möglich sein. Bei der Vermarktung von nicht-biologischen Produkten<br />
durch Knospe-Produzenten muss sichergestellt sein, dass der Konsument nicht<br />
getäuscht wird (Art. 6.2.3).<br />
In dieser Weisung werden<br />
• die allgemeinen Regelungen bei gleichzeitiger Vermarktung von Knospe- und<br />
nicht-biologischen Produkten präzisiert;<br />
• die konkreten Massnahmen festgelegt, die in einzelnen, ausgewählten Fällen zu<br />
beachten sind;<br />
• der Ablauf und die Anforderungen an eine Bewilligung zur Vermarktung von<br />
nicht-biologischen Produkten festgelegt.<br />
2 DEFINITIONEN<br />
Als Direktvermarktung im Sinne dieser Weisung gelten die folgenden Anbietungsinkl.<br />
Hauslieferdienst durch die Betriebsleiterfamilie;<br />
formen:<br />
• Verkauf ab Hof<br />
• die Betriebsleiterfamilie verkauft ihre Produkte auf dem Markt(stand);<br />
• kommerzielle Verpflegung von Gästen auf dem Hof.<br />
Nicht als Direktvermarktung gelten Lieferungen an den Detail- und Grosshandel<br />
sowie an alle Absatzwege, bei denen die Produkte anonymisiert werden, d.h. nicht<br />
mehr als vom Produzenten XY stammend bezeichnet werden.<br />
Als nicht-biologische Produkte gelten alle Erzeugnisse, die nicht den Anforderun-<br />
keine gesetzlichen Mindestanforderungen<br />
gen der BioV entsprechen.<br />
Solange für tierische Erzeugnisse noch<br />
für die biologische Produktion existieren, gelten alle tierischen Erzeugnisse als<br />
«nicht-biologisch», die nicht den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien entsprechen (Viehwirtschaft:<br />
Kapitel 3.2. - 3.11.; Verarbeitung: Kapitel 5) 1 .<br />
1 Neuregelung in Vorbereitung
28 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
3 Allgemeine Regelungen zur Direktvermarktung<br />
3.1 Zulässige Produkte und Produktegruppen in nicht-biologischer<br />
Qualität<br />
Die Direktvermarktung von nicht-biologischen tierischen Erzeugnissen ist ausdrücklich<br />
verboten 1 . Ausgenommen von dieser Regelung sind nur die im Anhang<br />
dieser Weisung aufgeführten Erzeugnisse.<br />
Das gleichzeitige Anbieten eines Produktes in biologischer und in nichtbiologischer<br />
Qualität ist verboten.<br />
Werden gleichartige Produkte, die auf dem Betrieb landwirtschaftlich erzeugt<br />
werden, in nicht-biologischer Qualität vermarktet, so muss eine Warenflusskontrolle<br />
und allenfalls Ernteschätzungen durchgeführt werden können. Zu diesem Zweck<br />
müssen die Verkäufe mengenmässig erfasst werden.<br />
Nicht-biologische Produkte dürfen nicht unter dem Namen des Knospe-Produzenten<br />
direkt vermarktet werden; der Lieferant/Erzeuger ist am Verkaufspunkt zu deklarieren.<br />
Vorbehalten bleibt das Vermarkten von deklassierter, selbst produzierter Ware.<br />
Die MKA legt im Einzelfall die Auflagen fest.<br />
3.2 Kennzeichnung / Anpreisung<br />
In Sortiments- und Preislisten sind die nicht-biologischen Produkten in einer separaten<br />
Rubrik anzugeben. In den Listen muss eindeutig darauf hingewiesen werden,<br />
dass es sich um nicht-biologische Produkte handelt.<br />
In den Sortiments- und Preislisten darf die Knospe in Form des Briefkopfes oder<br />
in ähnlicher Art und Weise nur verwendet werden, wenn mindestens 70 Prozent der<br />
angebotenen Produkte Knospe-Qualität aufweisen. Bei einem tieferen Anteil darf<br />
die Knospe nur bei den einzelnen Knospe-Produkten verwendet werden.<br />
Im Verkaufslokal/am Marktstand sind die nicht-biologischen Produkte klar gekennzeichnet<br />
und räumlich getrennt anzubieten. Die nicht-biologischen Produkte<br />
sind zudem postenweise mit der Negativdeklaration «nicht-biologisch/nicht aus<br />
biologischem Anbau» zu versehen. Hinweise wie «IP, umweltgerecht, Freiland»<br />
usw. sind nicht zulässig. Zusätzlich zur Deklaration «nicht-biologisch» ist für die<br />
nicht-biologischen Produkte jeweils der Lieferant/Erzeuger zu deklarieren.<br />
Beim Verkauf mit Rechnung/Lieferschein sind die nicht-biologischen Produkte mit<br />
einer klaren Negativdeklaration «nicht-biologisch» auf der Rechnung zu versehen,<br />
und die Lieferpapiere sind neutral zu gestalten. Sie dürfen, ausser bei den entsprechenden<br />
Produkten, keine Hinweise auf die Knospe, die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> und den<br />
Biolandbau enthalten. Falls auf den <strong>Stand</strong>ardlieferpapieren die Knospe vorhanden<br />
ist, so sind für die nicht-biologischen Produkte separate, neutrale Lieferpapiere zu<br />
erstellen.<br />
4 NICHT BEWILLIGUNGSPFLICHTIGE NICHT-<br />
<strong>BIO</strong>LOGISCHE PRODUKTE<br />
Nicht bewilligungspflichtig ist der Verkauf von zugekauften, vorverpackten und<br />
vorschriftsgemäss (LMV) gekennzeichneten nicht-biologischen Produkten (Achtung:<br />
Tierische Produkte, dürfen nicht in nicht-biologischer Qualität direkt vermarktet<br />
werden) 1 .<br />
Im Anhang dieser Weisung sind weitere Produkte und Produktegruppen sowie spezifische<br />
Auflagen aufgeführt. Für die im Anhang aufgeführten Produkte entfällt die<br />
Bewilligungspflicht.<br />
Die MKV führt diesen Anhang jährlich aufgrund der bewilligten Gesuche nach. Die<br />
Änderung des Anhangs untersteht dem Rekursrecht.<br />
1 Neuregelung in Vorbereitung
29 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
5 BEWILLIGUNGSVERFAHREN<br />
Die Direktvermarktung von nicht-biologischen Produkten, die weder in Punkt 4<br />
noch im Anhang dieser Weisung aufgeführt sind, ist durch die MKV bewilligungspflichtig.<br />
Die Bewilligung zur Direktvermarktung von nicht-biologischen Produkten<br />
ist bei der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> schriftlich zu beantragen.<br />
Für die Direktvermarktung nicht-biologischer Produkte muss spätestens ab dem<br />
1. 1. 2000 eine Bewilligung der MKV vorliegen. Entsprechende Gesuche sind möglichst<br />
frühzeitig an die MKV zu richten.<br />
6 GESUCH<br />
Dem Gesuch sind die folgenden Unterlagen beizulegen:<br />
• Sortimentslisten aller biologischen und nicht-biologischen Produkte;<br />
• Skizze (Grundriss) der Verkaufsräumlichkeiten. Aus der Skizze hat hervorzugehen,<br />
wo biologische und wo nicht-biologische Produkte vermarktet werden;<br />
• Muster von Etiketten und Verpackungsgestaltungen der biologischen und nicht-<br />
biologischen Produkte.<br />
Die<br />
MKV kann das Gesuch bewilligen, unter Auflagen bewilligen oder ablehnen.
30 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Anhang: Liste der ohne Bewilligungsverfahren zur Direktvermarktung zuge-<br />
lassenen nicht-biologischen Produkte<br />
Produkt / Produktegruppe<br />
Eigene Alpprodukte einer nicht-biologischen<br />
Alp<br />
Produkte zur Verpflegung von Feriengästen<br />
auf dem Hof<br />
Durch den Produzenten selbst gesammelte<br />
Wildpflanzen, gejagtes Wild<br />
und gefangene Wildfische<br />
Würste mit maximal 30 % nicht-biologischem<br />
Schweinespeck<br />
Produkte aus eigener Produktion, für die<br />
keine Richtlinien bestehen<br />
Honig aus eigener Erzeugung<br />
Zierpflanzen<br />
Auflagen bei der Direktvermarktung<br />
Auf der Preis- und Sortimentsliste sowie<br />
auf Lieferschein/ Rechnung ist der<br />
Vermerk «nicht-biologisch» anzubringen<br />
Direktvermarktung maximal im der<br />
eigenen Alpung entsprechenden Umfang<br />
Die Abgabe zur Verpflegung gilt nicht<br />
als Direktvermarktung<br />
Es ist eine Liste zu führen, welche Produkte<br />
in welcher Qualität geführt sind<br />
Die Abgabe ist eingeschränkt auf die<br />
Verpflegung auf dem Hof (kein Verkauf<br />
zum «Nach Hause nehmen»)<br />
Die Produkte sind entsprechend als<br />
Wildprodukte zu bezeichnen<br />
Die Produkte dürfen nicht mit der<br />
Knospe oder als biologisch angepriesen<br />
werden. Der Vermerk «nichtbiologisch»<br />
muss nicht angebracht werden<br />
Die Würste sind auf Preis- und Sorti-<br />
mentslisten sowie auf Lieferschein/<br />
Rechnung als «nicht-biologisch» zu<br />
kennzeichnen<br />
Der Hinweis auf die Knospe darf nur im<br />
Verzeichnis der Zutaten bei den biologischen<br />
Zutaten erscheinen<br />
Jede Wurst muss gemäss den Vorgaben<br />
der LMV etikettiert sein<br />
Die Vermarktung ist beschränkt bis zum<br />
31. 12. 2001<br />
Die Produkte dürfen nicht mit der<br />
Knospe oder als biologisch angepriesen<br />
werden. Der Vermerk «nichtbiologisch»<br />
muss jedoch nicht angebracht<br />
werden<br />
Vermarktung als « Honig aus Knospekonformer<br />
Bienenhaltung»<br />
Die Pflanzen sind mit dem Vermerk<br />
«nicht-biologisch» zu etikettieren und in<br />
einem separaten, gekennzeichneten<br />
Schlag zu lagern und anzubieten<br />
Pflanzgut für Dauerkulturen (Obst- Jede einzelne Pflanze ist mit dem Ver-<br />
Schlag zu lagern und<br />
bäume, Beeren)<br />
merk «nicht-biologisch» zu etikettieren.<br />
Die Pflanzen sind in einem separaten,<br />
gekennzeichneten<br />
anzubieten<br />
Assortierte Warenkörbe mit regionalen Jedes Produkt im Geschenksack ist<br />
Produkten aus Knospe und anderer vorverpackt und korrekt gemäss LMV<br />
Produktion<br />
gekennzeichnet (inbesondere Name und<br />
(z.B. Scarnuz Grischun)<br />
Adresse des Herstellers).<br />
Ausser auf den Knospe-Produkten,<br />
sowie in der Bezeichnung des Sackes<br />
dürfen keine Hinweise auf die Knospe,<br />
die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> sowie die biologische<br />
Landwirtschaft angebracht werden
31 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Produkt / Produktegruppe<br />
Weine<br />
Auflagen bei der Direktvermarktung<br />
Auf der Preis- und Sortimentsliste sowie<br />
auf Lieferschein/ Rechnung ist der<br />
Vermerk «nicht-biologisch» anzubringen<br />
Die nicht-biologischen Weine sind klar<br />
gekennzeichnet und räumlich getrennt<br />
anzubieten<br />
Die Kelterung und der Verkauf der<br />
nicht-biologischen Weine wird anlässlich<br />
der obligatorischen Kellerkontrolle<br />
überprüft
32 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.1.8f, Kap. 5 & 6<br />
Futtermittel<br />
Weisung der MKV, Fassung vom Oktober 2000, gültig für Lizenznehmer und Hofverarbeiter,<br />
angepasst am 13.8.2002<br />
1 GELTUNGSBEREICH UND DEFINITIONEN<br />
Die Weisung gilt für alle Futtermittel, welche mit der Knospe respektive der Hilfsstoff-Knospe<br />
gekennzeichnet und in Verkehr gebracht werden.<br />
Ebenfalls ist sie für Hofverarbeiter und Lohnmischer verbindlich, welche im Auftrag<br />
von Knospe- Produzenten Futter herstellen.<br />
Für die in der Weisung verwendeten Begriffe gelten die Definitionen der Futtermittel-Verordnung<br />
(SR 916.307) und der Futtermittelbuch-Verordnung (FMBV, SR<br />
916.307.1).<br />
Die Weisung gilt auch für Futtermittel für Haustiere (z.B. Hunde- und Katzenfutter,<br />
sog. Pet Food), die mit der Knospe respektive Hilfsstoff-Knospe ausgezeichnet<br />
werden sollen.<br />
2 LANGFRISTIGE ZIELSETZUNG<br />
Die Fütterung der Tiere soll artgerecht erfolgen. Die einwandfreie Qualität der Futtermittel<br />
muss jederzeit gewährleistet sein.<br />
Die Futtermittel sollen keine synthetischen Zusatzstoffe enthalten, einzig zur Bedarfsdeckung<br />
können diese Stoffe dem Futter beigemischt werden. Dosierungen, die<br />
einen zusätzlichen Effekt bewirken (Ruhigstellen, Leistungssteigerung) sind nicht<br />
zugelassen. Anstrengungen zur Ergänzung der Futtermittel mit natürlichen Vitaminen<br />
und Spurenelementen werden unterstützt.<br />
Langfristiges Ziel zur Fütterung auf Knospe-Betrieben ist es, den Anteil nichtbiologischer<br />
Komponenten auf ein Minimum zu reduzieren. Insbesondere sollen<br />
Komponenten in biologischer Qualität eingesetzt werden, wo sie in ausreichender<br />
Menge auf dem Markt verfügbar sind.<br />
3 SEPARIERUNG<br />
Werden biologische und nicht-biologische Futtermittelkomponenten in denselben<br />
Gebäuden und Anlagen verarbeitet, muss die Trennung der einzelnen Chargen durch<br />
geeignete organisatorische Massnahmen sichergestellt werden:<br />
• Räumliche Trennung, getrennte Anlagen oder<br />
• Zeitliche Trennung, wobei Reinigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen<br />
müssen, die eine Vermischung mit nicht-biologischen und gentechnisch veränderten<br />
Komponenten verunmöglichen.<br />
Die Lagerung der Chargen biologischer und nicht-biologischer Qualität muss so<br />
erfolgen, dass eine Vermischung oder Verwechslung ausgeschlossen werden kann.<br />
Eine gemeinsame Lagerung und der gemeinsame Transport sind nach erfolgter Verarbeitung<br />
und Verpackung mit der entsprechenden Kennzeichnung möglich.<br />
Für Loselieferungen gelten die Anforderungen zur Separierung sinngemäss.<br />
Weitergehende Ausführungen zur Separierung sind in den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien,<br />
Kapitel 5, sowie in den <strong>Weisungen</strong> «Fütterung ohne Anwendung von Gentechnologie»<br />
und «Allgemeine Anforderungen» der MKV geregelt.
33 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
4 VERARBEITUNGSVERFAHREN<br />
Die zur Herstellung von Futtermitteln für den Biolandbau zulässigen Verarbeitungsverfahren<br />
sind in der Futtermittelliste von <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>/RAP/FiBL in der Tabelle «3<br />
Bewilligte Verfahren aus der FMBV Anhang 1» abschliessend aufgeführt. Die Tabelle<br />
gilt sowohl für Produkte aus biologischer wie auch für Produkte aus nichtbiologischer<br />
Herkunft.<br />
5 FUTTERMITTELKOMPONENTEN UND<br />
ZUSAMMENSETZUNG DER FUTTERMITTEL<br />
5.1 Zugelassene Produkte<br />
Die für die Verfütterung im Biolandbau zugelassenen Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel<br />
sowie die Zusatzstoffe sind in der Futtermittelliste von <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong>/RAP/FiBL in den Tabellen «4 Positivliste der Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel<br />
sowie weiterer für die Tierernährung bewilligter Produkte aus Anhang<br />
1 der FMBV» und «5 Positivliste Zusatzstoffe für die Tierernährung» abschliessend<br />
aufgeführt.<br />
Bei der Zusetzung von Vitaminen und Mineralstoffen dürfen die Höchstgehalte der<br />
Futtermittelliste von <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>/RAP/FiBL nicht überschritten werden.<br />
Tiermehlverbot für Nutztiere: Der Einsatz von tiermehlhaltigen Futtermitteln ist im<br />
Biolandbau zur Zeit nicht zugelassen (gestützt auf die Verordnung des EVD über die<br />
biologische Landwirtschaft, Anhang 7)<br />
5.2 Einzelfuttermittel und Ausgangsprodukte<br />
Einzelfuttermittel und Ausgangsprodukte, die mit der Knospe gekennzeichnet werden,<br />
müssen zu 100 % aus Knospe-Rohstoffen bestehen.<br />
5.3 Mischfuttermittel<br />
Bei Mischfuttermitteln, die mit der Hilfsstoff-Knospe ausgezeichnet werden, müssen<br />
mindestens 80.0 % der organischen Trockensubstanz (org. TS) aus Komponenten in<br />
Knospe-Qualität bestehen.<br />
Zur Berechnung des prozentualen Anteils an der organischen Trockensubstanz werden<br />
die Werte der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Nutztiere (RAP, 1725<br />
Posieux) verwendet.<br />
Die gleiche Futterkomponente darf nicht gleichzeitig in biologischer und nichtbiologischer<br />
Qualität in einem Produkt verwendet werden.<br />
5.4 Ausgangsprodukte in Bio-Qualität<br />
Sind einzelne landwirtschaftliche Produkte nicht in ausreichender Menge und Qualität<br />
in Knospe-Qualität verfügbar, so kann die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> den Einsatz von Produkten,<br />
die der BioV, nicht jedoch den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien entsprechen, zulassen<br />
(nachfolgend Bio-Qualität genannt). Die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> definiert die entsprechenden<br />
Produkte jeweils vor Ende September für die Verwendung im Folgejahr.<br />
Die Komponenten in Bio-Qualität werden bei der Berechnung des prozentualen<br />
Anteils an der organischen Trockensubstanz zu den Knospe-Produkten gezählt.<br />
5.5 Produkte aus Umstellungsbetrieben<br />
Einzelkomponenten aus Umstellungsbetrieben können unbeschränkt eingesetzt<br />
werden. Beschränkungen und Deklarationsvorschriften seitens der BioV des Bundes<br />
zur Verwendung von Umstellungsprodukten werden entsprechend übernommen.
34 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Produkte aus Umstellungsbetrieben werden in der Berechnung des %-Anteils zu den<br />
Knospe-Produkten gezählt.<br />
5.6 Zusatzstoffe für die Tierernährung<br />
Die erlaubten Zusatzstoffe für die Tierernährung sind in der Futtermittelliste von<br />
<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>/RAP/FiBL in der Tabelle «5 Positivliste Zusatzstoffe für die Tierernährung<br />
(FMBV Anhang 2)» abschliessend aufgeführt.<br />
Die Zusatzstoffe dürfen keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) enthalten,<br />
beziehungsweise nicht mit Hilfe von gentechnisch veränderten Organismen<br />
(GVO) hergestellt worden sein. Dabei besonders zu beachten sind die Vitamine.<br />
Bei Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen dürfen die Höchstgehalte der Futtermittelliste<br />
von <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>/RAP/FiBL nicht überschritten werden.<br />
5.7 Fischfutter<br />
Aus Qualitäts- und Gesundheitsgründen darf der Fettgehalt des Futters 15 % nicht<br />
überschreiten.<br />
Als färbende Futterzusatzstoffe (Lachsforelle) sind natürliche Stoffe einzusetzen<br />
(z.B. Garnelenschalen, Phaffia-Hefe). Deren Einsatz muss beim Verkauf der Fische<br />
deklariert werden.<br />
Das Fischmehl und Fischöl im Forellenfutter muss entweder aus Abfällen der Spei-<br />
sefischverarbeitung hergestellt sein oder aus nachweislich nachhaltiger Fischereiwirtschaft<br />
stammen. Entsprechendes Fischmehl/-öl wird dabei dem biologischen<br />
Anteil zugerechnet. Im Gegenzug müssen alle pflanzlichen Bestandteile des Futters<br />
zwingend aus biologischem Landbau stammen.<br />
Futtermittelliste:<br />
Verarbeitungsverfahren: Bei der Fischfutterherstellung ist die Extrudertechnologie<br />
zugelassen.<br />
5.8 Haustiernahrung (PET-Food)<br />
Die Haustiernahrung wird nach den Kriterien von Lebensmitteln geprüft. 95 Prozent<br />
der Rohstoffe müssen Knospe-Qualität haben max. 5 Prozent der Rohstoffe können<br />
nicht-biologsiche landwirtschaftliche Zutaten nach Liste C der EVD-Verordnung<br />
910.181 sein.<br />
6 KENNZEICHNUNG UND DEKLARATION<br />
6.1 Nutztier- und Fischfutter<br />
Einzelfuttermittel und Ausgangsprodukte werden mit der Knospe bzw. der Umstel-<br />
lungs-Knospe gekennzeichnet, Mischfuttermittel mit der Hilfsstoff-Knospe.<br />
Die Weisung «Anforderungen zur Kennzeichnung von Produkten und Werbemitteln<br />
mit der Knospe» ist zu beachten. Die Kapitel 5 bis 7 der Weisung (Deklaration von<br />
Zutaten, Herkunft und Verfahren) gelten nicht für Futtermittel. Es gelten zudem die<br />
Anforderungen der Futtermittelgesetzgebung.<br />
Zusätzlich zu den Kennzeichnungsvorschriften der Futtermittelgesetzgebung und<br />
der oben erwähnten <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Weisung müssen folgende Informationen auf der
35 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Verpackung oder einer daran angebrachten Etikette, bei Loselieferungen auf den<br />
Begleitpapieren zur Lieferung oder auf der Rechnung, deklariert werden:<br />
• Gehalt der zugesetzten Spurenelemente Zink und Kupfer sowie der zugesetzten<br />
Vitamine A und E, beim Geflügel zusätzlich noch Vitamin D3;<br />
• Anwendungsempfehlung;<br />
• Prozentualer Anteil der biologischen, organischen Trockensubstanz;<br />
• Zertifizierungsstelle (Name und Adresse oder Nummer der Bio-<br />
Zertifizierungsstelle);<br />
• Knospe-Lizenznehmer.<br />
Beispiel einer Etikette für Hilfsstoff-Knospe Futter:<br />
458 Muttersauenalleinfutter<br />
Zusammensetzung:<br />
<strong>BIO</strong>-Anteil: 82.5 %<br />
Getreide, Getreideprodukte, Oelsaaten, Knollen und Wur-<br />
zeln,<br />
Mineralstoffe<br />
Gehalte an Inhaltstoffen pro kg Futter:<br />
Zugesetzte Stoffe pro<br />
kg Futter:<br />
Rohasche 60 g VES 12.7 MJ Vitamine A 6000<br />
IE<br />
Rohprotein 175 g Lysin 10.2 g Vitamin E 45 mg<br />
Rohfett 26 g Kupfer 6 mg<br />
Rohfaser 49 g Zink 75 mg<br />
Gebrauchsanweisung: Tragende: 2 - 3 kg /Tag, Säugende 5- 7 kg / Tag je nach<br />
Ferkelzahl<br />
Herstellungsdatum: 25. 2. 2000<br />
Mindestens 4 Monate haltbar<br />
Knospe-Lizenznehmer: Mühle, Hintertannen, 9999 Futterhausen<br />
Bio-Zertifizierung: SCES 006<br />
6.2 Haustiernahrung<br />
Die Haustiernahrung kann mit der Vollknospe ausgezeichnet werden.<br />
7 INKRAFTSETZUNG UND ÜBERGANGSFRISTEN<br />
Die Weisung tritt auf den 1. 1.2003 in Kraft.<br />
Futtermittel, die vor dem Inkrafttreten dieser Weisung von der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> lizenziert<br />
wurden und dieser Weisung nicht in allen Punkten entsprechen, dürfen noch bis zum<br />
31.12.03 gemäss den bewilligten Rezepturen hergestellt und in Verkehr gebracht werden.
36 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.1.9<br />
Fütterung ohne Anwendung von<br />
Gentechnologie<br />
Weisung der MKA und der MKV, Fassung Januar 2000, gültig für Produzenten und<br />
Lizenznehmer<br />
1 EINLEITUNG UND ZWECK<br />
Die Fütterung der Nutztiere auf Knospe-Betrieben hat grundsätzlich mit betriebseigenem<br />
Futter zu erfolgen. Zugekaufte Futtermittel sollen möglichst aus biologischem<br />
Anbau stammen. Langfristiges Ziel der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> und des Biolandbaus<br />
weltweit ist die ausschliessliche Fütterung der Nutztiere mit Futter aus kontrolliert<br />
biologischem Anbau.<br />
Zum jetzigen Zeitpunkt (Januar 2000) dürfen in der Fütterung der Nutztiere auf<br />
Knospe-Betrieben teilweise nicht-biologische Futtermittel eingesetzt werden. Der<br />
Anteil darf bei Wiederkäuern 10 % und bei übrigen Nutztieren 20 % des TS-<br />
Verzehrs nicht überschreiten.<br />
Durch die Verwendung von nicht-biologischen Futtermitteln besteht ein potenzielles<br />
Risiko der Verfütterung von GVO-Erzeugnissen an Knospe-Tiere.<br />
Die Anwendung von Gentechnologie, auch in der Fütterung von Nutztieren, ist nicht<br />
mit den Grundsätzen des biologischen Landbaus vereinbar. In den Richtlinien, Art.<br />
3.1.9, ist die Verfütterung von GVO-Erzeugnissen für den ganzen Knospe-Betrieb<br />
explizit verboten.<br />
Eine Fütterung ohne Anwendung von Gentechnologie kann durch ein konsequentes<br />
Vermeiden von kritischen Futtermittelkomponenten am besten, einfachsten und<br />
billigsten gewährleistet werden. Durch die Verwendung von Futtermitteln aus Gebieten<br />
mit nicht vorhandenem Risikopotential kann dies einfach umgesetzt werden.<br />
Zweck der Weisung ist es, den Eintrag von GVO-Erzeugnissen in der Fütterung von<br />
Knospe-Tieren auszuschliessen. Sie stellt eine Übergangsregelung dar, bis wissenschaftliche<br />
Resultate der offiziellen Stellen vorliegen, welche Verunreinigungen mit<br />
GVO-Erzeugnissen unvermeidbar sind, wenn sämtliche Massnahmen für eine vollständige<br />
Trennung der Warenflüsse getroffen worden sind. Wenn kritische Futtermittelkomponenten<br />
an Knospe-Tiere verfüttert werden, so müssen die in dieser<br />
Weisung definierten Qualitätssicherungs-Massnahmen getroffen werden.<br />
2 DEFINITIONEN<br />
GVO-Erzeugnisse: In dieser Weisung gelten für Futtermittel dieselben Definitionen<br />
wie sie in der «Verordnung über das Bewilligungsverfahren für GVO-Lebensmittel,<br />
GVO-Zusatzstoffe und GVO-Verarbeitungshilfsstoffe» (VBGVO des EDI vom<br />
19.11.96, SR 817.021.35) für Lebensmittel festgehalten sind:<br />
1 GVO-Lebensmittel, GVO-Zusatzstoffe und GVO-Verarbeitungshilfsstoffe sind<br />
GVO-Erzeugnisse.<br />
2 GVO-Erzeugnisse sind Erzeugnisse, die:<br />
a) gentechnisch verändert Organismen sind;<br />
b) aus gentechnisch veränderten Organismen hergestellt oder direkt (1. Generation)<br />
gewonnen werden, auch wenn sie vom Organismus abgetrennt und vom<br />
Erbmaterial gereinigt sind;<br />
c) mit gentechnisch veränderten Organismen vermischt sind;<br />
d) aus Kreuzungen gentechnisch veränderter Organismen oder gentechnisch<br />
veränderter mit unveränderten Organismen hervorgehen.<br />
Die Definitionen der VBGVO gelten sinngemäss auch für Futtermittel.
37 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Kritische Futtermittelkomponenten sind alle Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel,<br />
die auch in gentechnisch veränderter Qualität in der Schweiz zugelassen<br />
sind. Die zugelassenen Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel sind in der «Verordnung<br />
des BLW über die GVO-Futtermittelliste» (SR 916.307.11) aufgeführt.<br />
Biokonforme Ausgangsprodukte, Einzel- und Mischfuttermittel sind Futtermittel,<br />
die den Anforderungen der Futtermittelliste von <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>/RAP/FiBL entlassen.<br />
Die Weisung «Lohnverarbeitung<br />
sprechen, jedoch aus nicht-biologischen Ausgangserzeugnissen hergestellt wurden.<br />
Selbstmischer sind Knospe-Produzenten, die Mischfuttermittel selbst herstellen.<br />
Als Selbstmischer gelten auch Knospe-Produzenten, welche Mischfuttermittel im<br />
Auftrag bei einem Lohnmischer herstellen<br />
von Lebens- und Futtermitteln» ist zu beachten.<br />
Für Begriffe zu Futtermitteln (z.B. Ausgangserzeugnisse, Einzelfuttermittel usw.)<br />
gelten die Definitionen der Futtermittel-Verordnung sowie der Futtermittelbuch-<br />
Verordnung (FMBV).<br />
3 BESTÄTIGUNGEN UND ANALYSEN<br />
Bei kritischen Futtermittelkomponenten muss gewährleistet sein, dass es sich nicht<br />
um GVO-Erzeugnisse handelt. Es muss auch gewährleistet sein, dass keine Vermischung<br />
(absichtlich oder unabsichtlich) mit GVO-Erzeugnissen stattgefunden hat.<br />
Zur Sicherstellung dieser Anforderung müssen von jeder einzelnen kritischen Futtermittelkomponente,<br />
die an Knospe-Tiere verfüttert werden soll, folgende Dokumente<br />
vorhanden sein:<br />
• Bestätigung des Herstellers der kritischen Futtermittelkomponente, dass es sich<br />
nicht um ein GVO-Erzeugnis handelt. Die Bestätigung hat mit folgendem Wortlaut<br />
zu erfolgen:<br />
1) Pflanzliche oder tierische Erzeugnisse im natürlichen Zustand, frisch<br />
oder haltbar gemacht:<br />
«Bei der Herstellung dieses Produktes haben wir keinen gentechnisch veränderten<br />
Organismus (GVO) eingesetzt. Wir haben keine Information, die<br />
auf die Unrichtigkeit dieser Aussage hindeuten könnte.»<br />
2) Pflanzliche oder tierische Erzeugnisse, industriell verarbeitet:<br />
(a) «Bei der Herstellung dieses Produktes haben wir keinen gentechnisch<br />
veränderten Organismus (GVO) eingesetzt. Wir haben keine Information,<br />
die auf die Unrichtigkeit dieser Aussage hindeuten könnte.<br />
(b) «Für alle Produkte, die wir bei der Herstellung dieses Produktes einset-<br />
zen, liegen uns Bestätigungen von den Unternehmen, die diese herstellten,<br />
mit gleicher Reichweite und Inhalt wie (a) vor. Diese Erklärungen befinden<br />
sich in unseren Unterlagen und sind nicht abgelaufen oder widerrufen.»<br />
• Quantitativer oder qualitativer GVO-Nachweis mit der von der RAP vorge-<br />
oder empfohlenen Methode. Die Analysen müssen von einem akk-<br />
schriebenen<br />
reditierten Labor in der Schweiz durchgeführt werden. Bei kritischen Futtermit-<br />
zu<br />
telkomponenten, die keine DNA enthalten, ist das Erzeugnis im natürlichen Zustand<br />
analysieren.<br />
Für biokonforme Mischfuttermittel müssen die erwähnten Dokumente für jede kritische<br />
Futtermittelkomponente vorhanden sein.<br />
Bis weitere Erkenntnisse über unvermeidbare Verunreinigungen mit GVOinterpretieren:<br />
• Quantitativer GVO-Nachweis: Bei einem Resultat unter 0.5 % kann die Futter-<br />
Erzeugnissen vorliegen, sind die Resultate zum GVO-Nachweis folgendermassen zu<br />
mittelkomponente verwendet (verfüttert) werden.<br />
• Qualitativer GVO-Nachweis: Bei einem negativen Resultat kann die Futtermittelkomponente<br />
verwendet (verfüttert) werden.
38 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
4 VOLLZUG<br />
Kritische Futtermittelkomponenten können über verschiedene Wege an Knospe-<br />
Tiere verfüttert werden. Je nach Situation erfolgt die Umsetzung der in Kap. 3 dieser<br />
Weisung aufgeführten Anforderungen wie folgt:<br />
4.1 Hilfsstoff-Knospe Futtermittel<br />
Hersteller von Hilfsstoff-Knospe Futtermitteln haben die Dokumente gemäss Kap. 3<br />
dieser Weisung für jeden Wareneingang von kritischen Futtermittelkomponenten im<br />
Betrieb, der für die Fabrikation von Hilfsstoff-Knospe Futtermitteln verwendet wird,<br />
zu erbringen. Die Dokumente sind anlässlich der Jahresinspektion vorzulegen.<br />
4.2 Biokonforme Einzel- und Mischfuttermittel<br />
Hersteller von biokonformen Einzel- und Mischfuttermitteln haben die Dokumente<br />
gemäss Kap. 3 dieser Weisung für jeden Wareneingang von kritischen Futtermittelkomponenten<br />
im Betrieb, der für die Fabrikation von biokonformen Einzel- oder<br />
Mischfuttermitteln verwendet wird, zu erbringen. Die Dokumente können anlässlich<br />
der Inspektion des Knospe-Produzenten vom Hersteller der biokonformen Einzelund<br />
Mischfuttermittel eingefordert werden.<br />
Der Hersteller der biokonformen Einzel- und Mischfuttermittel bestätigt die Einhaltung<br />
dieser Weisung sowie der Futtermittelliste von <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>/RAP/FiBL gegenüber<br />
dem Knospe-Produzenten auf eine der folgenden Arten:<br />
1) Etikette: Auf der Verpackung oder einer daran angebrachten Etikette, bei Loselieferungen<br />
auf den Begleitpapieren zur Lieferung wird ein Hinweis mit folgendem<br />
Wortlaut gemacht: «Das Produkt entspricht der Futtermittelliste von <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong>/RAP/FiBL».<br />
2) Futtermittelbestätigung: Die «Futtermittelbestätigung für nicht-biologische<br />
Futtermittel und Mineralstoffmischungen mit Vitaminzusätzen» der<br />
bio.inspecta wird unterzeichnet.<br />
4.3 Selbstmischer und Lohnmischer<br />
Selbstmischer haben die Dokumente gemäss Kap. 3 dieser Weisung für jeden Wareneingang<br />
von kritischen Futtermittelkomponenten im Betrieb zu erbringen. Die<br />
Dokumente sind anlässlich der Jahresinspektion vorzulegen.<br />
5 INKRAFTSETZUNG UND ÜBERGANGSFRISTEN<br />
Die Weisung tritt auf den 1. 1. 2000 in Kraft. Ab dem 1. 1. 2000 müssen bei der<br />
Verfütterung von kritischen Futtermittelkomponenten die Anforderungen dieser<br />
Weisung eingehalten werden. Kritische Futtermittelkomponenten, die vor dem<br />
1. 1. 2000 nach den damals gültigen Anforderungen eingekauft oder kontraktiert<br />
wurden, dürfen noch bis zum 30. 6. 2000 an Knospe-Tiere verfüttert werden.
39 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.6.1 ff bis 3.8.1 ff<br />
Geflügelhaltung<br />
Weisung der MKA, verabschiedet an der GV vom 16.10.2002<br />
1 EINLEITUNG<br />
Der Weisung Geflügelhaltung liegen die Richtlinienartikel 3.6 ff bis 3.9 ff der <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong>, die Bio-Verordnung sowie die RAUS- und BTS-Verordnung des Bundes<br />
zu Grunde.<br />
Diese Weisung hat zum Ziel, sämtliche relevanten Anforderungen zur Geflügelhaltung<br />
in übersichtlicher und verständlicher Form für Geflügelhalter, Interessenten,<br />
Berater und Inspektionspersonen darzulegen.<br />
2 ALLGEMEINE WEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN<br />
2.1 Weisung Nährstoffversorgung<br />
Für die Planung grösserer Legehennenbestände ist neben den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>-<br />
Richtlinien und <strong>Weisungen</strong> insbesondere die Weisung bezüglich der Nährstoffversorgung<br />
zu berücksichtigen.<br />
2.2 Empfehlung<br />
Zur Planung grösserer Legehennen- , Junghennen- oder Mastgeflügelbestände sollte<br />
unbedingt schon vor Baubeginn ein spezialisierter Bioberater beigezogen werden.<br />
3 LEGEHENNEN UND JUNGHENNENAUFZUCHT<br />
3.1 Antrittskontrolle<br />
Ställe mit mehr als 450 Legehennen-, resp. mehr als 900 Junghennenplätze müssen<br />
durch einen spezialisierten Kontrolleur bezüglich Stallsystem, Tierbesatz und Auslauf<br />
abgenommen werden.<br />
3.2 Tierhaltung<br />
3.2.1 Herkunft<br />
Wenn vorhanden, müssen die Bruteier von Knospe-Elterntieren abstammen. Ab<br />
1.1.2004 dürfen nur noch in Ausnahmesituationen Bruteier von konventionell gehaltenen<br />
Elterntieren verwendet werden (Versuche mit neuen Legelinien, kurzfristiger<br />
Engpass an Bruteiern). Der Händler oder Aufzüchter muss den Nachweis erbringen,<br />
dass die Tiere in der Schweiz gebrütet wurden.<br />
3.2.2 Entmistung<br />
Alle anrechenbaren Rost- und Gitterflächen müssen über eine direkt darunterliegende<br />
Entmistungsvorrichtung verfügen (Kotbänder, Kotschieber oder Kotbretter mit<br />
Handentmistung u.ä.).
40 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Ställe mit mehr als 100 LH müssen spätestens alle 14 Tage entmistet werden mit<br />
Ausnahme der Scharrflächen und dem Aussenklimabereich (AKB). Der Junghennenstall<br />
muss spätestens 6 Wochen nach Einstallung entmistet werden.<br />
Bestehende Kotgrubenställe mit mehr als 100 LH müssen bis spätestens am<br />
31.12.2008 angepasst sein.<br />
3.2.3 Fütterung<br />
Den Legehennen (LH) muss dem Alter entsprechend täglich Körnergemisch verabreicht<br />
werden.<br />
Das Körnergemisch ist vorzugsweise am Abend ganzflächig im AKB oder Weideauslauf<br />
zu verabreichen.<br />
JH sind ab der 7. Alterswoche dem Alter entsprechend täglich mit Körnern zu füttern.<br />
Die Tiere müssen dem Alter entsprechende Magensteine aufnehmen können.<br />
3.2.4 Tränke<br />
Das Tränkesystem muss so konzipiert sein, dass die Tiere von einer offenen Wasserfläche<br />
Wasser aufnehmen können. Nippeltränken sind nur bei JH bis zum 42. Alterstag<br />
zusätzlich toleriert.<br />
3.2.5 Tageslicht<br />
Im Aktivitätsraum (Scharrfläche, Futter- und Wasserstellen) muss ausreichend Tageslicht<br />
von mindestens 15 Lux vorhanden sein.<br />
3.2.6 Hähne<br />
Es wird empfohlen, in jeder Herde pro 100 Hennen ein bis drei Hähne zu halten.<br />
3.3 Weideauslauf<br />
Es kann nur diejenige Fläche zum Auslauf gerechnet werden, welche von den Tieren<br />
auch effektiv genutzt wird. Um dies zu erreichen, muss der Auslauf den Bedürfnissen<br />
des Tieres angepasst, schützende Strukturen wie Büsche, Bäume, Schutznetze<br />
oder Unterstände und dergleichen enthalten.<br />
Den LH muss ab Mittag Auslauf und mindestens während 50 % des natürlichen<br />
Tages Weideauslauf gewährt werden. Die Auslaufzeit ist möglichst in die Abendstunden<br />
auszudehnen. Bei extremen Witterungsbedingungen kann der Weideauslauf<br />
zeitlich beschränkt oder ganz unterlassen werden.<br />
In der Junghennenaufzucht und im Legestall bis zum 144. Alterstag kann die Aktivitätszeit<br />
dem Lichtprogramm der Zuchtorganisationen angepasst werden. Die Bedingungen<br />
für den erhöhten Tierbesatz während der Nachtruhe sind immer einzuhalten.<br />
Als anrechenbare Fläche kann die Weide bis zu einer maximalen Entfernung von<br />
120 m angerechnet werden.<br />
3.4 Stallbau<br />
3.4.1 Nester<br />
Als Nesteinlagen sind weiche Kunststoffeinlagen oder Rasenteppiche (Referenz<br />
Astroturf soft) zugelassen.<br />
3.4.2 Berechnung des Tierbesatzes<br />
Es werden nur vom Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) definitiv oder befristet<br />
bewilligte Stallsysteme mit der entsprechenden BVET-Bewilligungsnummer akzeptiert.<br />
Eigenbauten müssen vor Inbetriebnahme auf ihre Tierschutzkonformität geprüft<br />
werden.<br />
Für die Berechnung der begehbaren Flächen gelten die Grundlagen des BVET mit<br />
folgenden Ausnahmen:<br />
• Anflugroste, -flächen und Sitzstangen vor den Nestern zählen nicht als anrechenbare<br />
begehbare Flächen.
41 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
• Bis zum 31.12.2002 erstellte Neuinstallationen von Systemen mit maximal<br />
10 % der systemnotwendigen und für den Tierbesatz relevante Rostflächen ohne<br />
Entmistungsanlage, werden noch bis zum 31.12.2012 toleriert.<br />
Übergangsregelung: Für vor dem 1.5.1999 in Betrieb genommene vom BVET be-<br />
Systeme werden bis zum 31.12.2008 20 % der Flächen ohne Entmistungs-<br />
anlage<br />
willigte<br />
toleriert.<br />
3.5 AUSSENKLIMABEREICH<br />
Der Aussenklimabereich (AKB) muss den LH während des ganzen Tages zugäng-<br />
Zugang zum AKB zu ge-<br />
lich sein. Den JH ist dem jeweiligen Alter entsprechend<br />
währen.<br />
Er bietet ausreichend Schutz vor Witterung und Feinden (Fuchs, Marder, Habicht<br />
usw.). Der AKB ist strukturiert und mit einem Staubbad sowie geeigneter Einstreu<br />
versehen. Eine gute Zirkulation der Tiere zwischen Stall und AKB muss immer<br />
gewährleistet sein.<br />
Er bietet eine minimale Kopffreiheit von 150 cm bei festen und 120 cm bei mobilen<br />
Ställen.<br />
Bei sehr tiefen Temperaturen sind mindestens 35 cm breite Stallöffnungen pro hundert<br />
LH offen zu behalten.<br />
3.5.1 Stallsysteme mit integriertem AKB<br />
Der AKB kann zur begehbaren Fläche gezählt werden, wenn er während der ganzen<br />
Aktivitätszeit (Hellphase, natürliches und künstliches Licht) für die Tiere über alle<br />
Stallöffnungen zugänglich ist und über automatische Schieberöffnungen und Beleuchtung<br />
verfügt. In der Nacht darf der maximale Tierbesatz 8 LH/m2 (15 JH/m2)<br />
nicht überschritten werden.<br />
Schwellen bei Stallöffnungen vom Stall zum AKB dürfen maximal 30 cm hoch sein.<br />
3.5.2 Stallsysteme mit tieferliegendem AKB<br />
Wenn der AKB tiefer liegt als der Stall, müssen folgende Kriterien eingehalten wer-<br />
den:<br />
• Die maximale Stufenhöhe beträgt 50 cm.<br />
• Bei Junghennenställen beträgt die maximale Niveaudifferenz 1,20 m.<br />
• Bei Niveauunterschieden in Legehennenställen von mehr als 1,5 m müssen bei<br />
den Stallöffnungen Balkone angebracht werden, welche mindestens 1 m tief<br />
und eingestreut sind. Der umfassende Rand muss mindestens 10 cm hoch sein.<br />
• Die Steig- und Abganghilfen müssen mindestens 35 cm Breite je 100 Tiere<br />
aufweisen.<br />
• Der Anteil dieser Balkone kann bis max. 20 % der AKB-Fläche angerechnet<br />
werden, wenn die darunterliegende Fläche eine lichte Höhe von mindestens<br />
60 % der Balkontiefe aufweisen (Beispiel: Ist der Balkon 1,5 m tief, so muss die<br />
darunter liegende Fläche mindestens 0.9 m hoch sein). Flächen deren Kopffreiheit<br />
unter den geforderten 60 % liegt oder weniger als 60 cm hoch sind, dürfen<br />
nicht angerechnet werden.<br />
• Die Anrechenbarkeit ist nur gegeben, wenn die Wintergartenbalkone zur Überwindung<br />
der Höhendifferenz zwischen Stall und AKB angebracht werden.<br />
3.5. 3 Stallsysteme mit höher liegendem AKB<br />
Wenn der AKB höher liegt als der Stall, müssen folgende Kriterien eingehalten<br />
werden:<br />
• Rostflächen, welche benötigt werden, damit die LH auf erhöhtem Niveau ins<br />
Freie gelangen können, müssen entmistet sein.<br />
• Die horizontale Distanz von der Volierenanlage zu Hilfsrostflächen darf höchstens<br />
120 cm betragen.<br />
• Bei Ausgängen durch die Decke müssen die Steig- und Abgangshilfen mindestens<br />
35 cm Breite je 100 Tiere aufweisen.
42 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
3.6 Bedingungen für mehrere Ställe<br />
Als Stalleinheit gelten ein oder mehrere Gebäude, in welchen insgesamt maximal<br />
2'000 LH (4'000 JH) gehalten werden. Es sind mehrere Stalleinheiten pro Betrieb<br />
zugelassen, wenn diese:<br />
a) freistehend mit mindestens 20 m Distanz zueinander stehen und<br />
b) deren Weideflächen durch eine von Geflügel nicht nutzbare Zone von mindestens<br />
10 m Breite getrennt sind.<br />
(Innerhalb einer Stalleinheit gelten keine Distanzvorschriften.)<br />
3.7 Kleinbestände<br />
Bei Haltungen bis 20 LH gilt eine sinngemässe Anwendung dieser Weisung.<br />
3.8 Knospe-Brüterei<br />
Jungtiere sollen vorzugsweise von einer anerkannten Knospe-Brüterei stammen.<br />
Alle relevanten Zahlen und Angaben für Legehennen und Aufzuchttiere sind in<br />
den <strong>Weisungen</strong> Tabelle 1 „Masstabelle für Legehennen und Aufzuchttiere“ zu<br />
finden.<br />
4 MASTGEFLÜGEL<br />
4.1 Linienwahl<br />
Die MKA erstellt eine Positivliste für die Knospe-Produktion zugelassenen Linien.<br />
(Liste im Anhang der Weisung)<br />
4.1.1 Mastpoulets<br />
Die Mindestmastdauer für Knospe-Mastpoulets beträgt 63 Tage.<br />
Die durchschnittliche Tageszunahme darf maximal 27,5 g betragen.<br />
4.1.2 Truten<br />
Die Kriterien für die Linienwahl bei den Truten werden mangels Erfahrung mit<br />
leichteren Mastlinien zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Dann werden auch die<br />
Masse in der Tabelle 2 festgelegt.<br />
4.2 Tierhaltung<br />
4.2.1 Herkunft<br />
Wenn vorhanden, müssen die Bruteier von Knospe-Elterntieren abstammen. Nach<br />
dem 1.1.2004 dürfen nur noch in Ausnahmesituationen Bruteier von konventionell<br />
gehaltenen Elterntieren verwendet werden (Versuche mit neuen Legelinien, kurzfristiger<br />
Engpass an Bruteiern). Der Händler oder Aufzüchter muss den Nachweis<br />
erbringen, dass die Tiere in der Schweiz gebrütet wurden.<br />
4.2.2 Tierbesatz Vormast Poulets<br />
Der Tierbesatz darf 40 Tiere/m2 bis maximal zum 28. Alterstag betragen. Werden<br />
die Tiere bereits am 21. Tag umgestallt, dann<br />
ist ein Tierbesatz bis 50 Tiere/m 2 mög-
43 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
lich.<br />
4.3 Weideauslauf<br />
Den Masttieren muss während mindestens 75 % des natürlichen Tages Weidezugang<br />
gewährt werden. Bei extremen Witterungsbedingungen kann dieser zeitlich beschränkt<br />
oder ganz unterlassen werden. Für den Weideauslauf sind die Morgen- oder<br />
Abendstunden zu bevorzugen.<br />
4.4 Auslauföffnungen<br />
Die Öffnungen zum AKB und Weideauslauf sind so zu bemessen und zu verteilen,<br />
dass die Tiere problemlos und uneingeschränkt zirkulieren können.<br />
4.5 Aussenklimabereich<br />
Der Aussenklimabereich (AKB) muss überdacht und soweit nötig windgeschützt<br />
und den Tieren während des ganzen Tages zugänglich sein.<br />
4.6 Staubbad<br />
Das Staubbad ist im AKB integriert und vor Nässe geschützt. Die Staubbadtiefe<br />
muss bei Mastbeginn 15 cm betragen. Während der Mast genügen 5 cm.<br />
4.7 Abnahme von Geflügelmastsystemen<br />
Serienmässig hergestellte Geflügelmastsysteme müssen zur Abnahme angemeldet<br />
werden.<br />
4.8 Bio-Brüterei<br />
Jungtiere sollen vorzugsweise von einer anerkannten Knospe-Brüterei stammen.<br />
Alle relevanten Zahlen und Angaben für Mastgeflügel sind in den <strong>Weisungen</strong><br />
Tabelle 2 „Masstabelle für Mastgeflügel“ zu finden.<br />
Übergangsbestimmungen:<br />
Bestehende Pouletausmastställe mit weniger als 50 % AKB werden bis zum<br />
31.12.2003<br />
toleriert.
44 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Tabelle 1: Masstabelle für Legehennen und Aufzuchttiere<br />
Junghennen 1.-42. Tag Junghennen 43.-126. Tag Legehennen<br />
Einrichtungen<br />
Fressplatz am Trog bei mechanischer Fütterung 4 cm 8 cm 10 cm<br />
Fressplatz am Trog ab erhöhten Sitzstangen 10 cm 12 cm<br />
Futterrinne Rundautomaten 2 cm 3 cm 4 cm<br />
Tränkenippel<br />
Zusätz. toleriert<br />
Cuptränken 25 Tiere 25 Tiere 20 Tiere<br />
Tränkerinne an Rundtränke 1 cm 1,5 cm 2 cm<br />
Sitzstangen 1<br />
Sitzstangen je Tier (min. 3,0 x 3,0 cm) 8 cm 14 cm 16 cm<br />
Abstand (waagrecht)<br />
Wandabstand (waagrecht, Achsmass)<br />
Einzel-Legenest<br />
20 cm<br />
10 cm<br />
Gruppen-Legenest 80 Legehennen / m²<br />
Tierbesatz / Begehbare Flächen 1<br />
Gitter oder Rost- und Scharrflächen 15 Tiere/ m² 8 Tiere/ m² 5 Tiere/ m²<br />
Tierbesatz im Stall mit integriertem AKB 15 Tiere/ m² 13 Tiere/ m² 8 Tiere/ m²<br />
Max. Tierbesatz je m 2 Stallgrundfläche 30 Tiere/ m² 24 Tiere/ m² 15 LH/ m²<br />
Anteil Scharrfläche im Stall mind. 50% mind. 33% mind.33%<br />
Tierbesatz im AKB (35 Tiere/ m²) 16 Tiere/ m² 10Tiere / m²<br />
Weideauslauf - 0,2 - 1 m²/ JH 5 m² / LH<br />
Licht<br />
Max. Tageslänge mit Kunstlicht 16 h 16 h 16 h<br />
Staubbad, mind. 15 cm tief 150 Tiere/ m 2 100 Tiere/ m 2<br />
Öffnungen zum AKB und Auslauf<br />
Minimale Breite 2 70 cm 70 cm<br />
Minimale Höhe 40 cm 40 cm<br />
cm je 100 Tiere 50 cm 70 cm<br />
LH = Legehennen AKB = Aussenklimabereich JH = Junghennen LG = Lebendgewicht<br />
25 cm<br />
20 cm<br />
30 cm<br />
20 cm<br />
5 LH<br />
1 Die Nest-Anflugroste, sowie Sitzstangen über der Scharrfläche dürfen zur Erfüllung der Anforderungen nicht angerechnet werden.<br />
2 Bei Kleinhaltungen unter 100 Tieren sind kleinere Öffnungen zulässig.
45 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Tabelle 2: Masstabelle für Mastgeflügel<br />
Poulets Vormast Poulets Ausmast Gänse, Enten<br />
Herdengrösse max. 1000 max. 500 max. 250<br />
Einrichtungen<br />
Fressplatz am Trog bei manueller Fütterung 4 cm/Tier 4 cm/kg LG 2 cm / kg LG<br />
Fressplatz am Trog bei mech. Fütterung 4 cm/Tier 2,5 cm/kg LG 2 cm / kg LG<br />
Futterrinne Rundautomaten 1 cm/Tier 1 cm/kg LG 1 cm / kg LG<br />
Futterteller 1 cm/Tier - -<br />
Cuptränken 25 Tiere 25 Tiere -<br />
Tränkerinne an Rundtränke 1 cm (analog Küken) 0,8 cm/kg LG 0,5 cm/kg LG<br />
Rinnentränke 1 cm (analog Küken) 1,25 cm/kg LG 1 cm/kg LG<br />
Sitzstangen<br />
Sitzstangen 3 cm/Tier 5 cm/kg LG Flugenten 3 cm/kg LG<br />
Mindestens über Boden 25 cm 30 cm<br />
Abstand (waagrecht) 20 cm 25 cm<br />
Wandabstand(waagrecht, Achsmass) 10 cm 15 cm<br />
Tierbesatz<br />
Gitter oder Rost- und Scharrflächen<br />
50 Tiere/m² (-21. Tag 20 kg LG /m 2 20 kg LG / m²<br />
40 Tiere/m 2 (-28. Tag)<br />
Anteil Scharrfläche im Stall mind. 50 % mind. 50 % mind. 50 %<br />
Weideauslauf je kg LG - 1 m 2 / kg LG 4 m²/kg LG Gänse<br />
1 m²/kg LG Enten<br />
Licht<br />
Max. Tageslänge mit Kunstlicht 16 h 16 h 16 h<br />
Staubbad - 500 kg LG/m 2 1)<br />
Öffnungen zum AKB und Weideauslauf<br />
Minimale Breite 70 cm 70 cm<br />
Minimale Höhe 40 cm 60 cm<br />
Breite, cm je 100 kg LG 30cm 30 cm<br />
Grundfläche AKB ab 22. Tag 50 % 50 % der Stallgrundfläche<br />
1) Wasserfläche an Stelle Staubbad: bis 50 Tiere mind. 3 m², pro weitere 50 Tiere 1 m² zusätzlich
46 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art 1.2.3, Kap 5 und 6, Art. 7.2.3<br />
Weisung der PAK und der LPK vom 26.5.1998<br />
1 EINLEITUNG<br />
Hofverarbeitung und Zukauf von Bioproduk-<br />
ten<br />
Produzenten, welche mit dem Handel von Knospe-Produkten einen wesentlichen<br />
Umsatz erzielen, müssen mit der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> einen Lizenzvertrag abschliessen (RL<br />
Art. 1.2.3). Im Sinne eines mitgliederfreundlichen Vollzuges sollen mittelgrosse<br />
Zukäufer von Bioprodukten und Hofverarbeiter, welche in erster Linie eigene Produkte<br />
verarbeiten, nicht mit einem ordentlichen Lizenzvertrag, sondern wo möglich<br />
anlässlich der Betriebskontrolle durch spezialisierte Kontrolleure erfasst werden.<br />
Derselbe Kontrolleur soll in diesen Fällen sowohl den Landwirtschaftsbetrieb als<br />
auch die Verarbeitung, respektive den Handel kontrollieren.<br />
Werden neben biologischen Produkten auch noch nicht-biologische Produkte ange-<br />
Selbstkelterer, welche bereits einer<br />
boten, so ist das gleichzeitige Anbieten des gleichen Produktes (gleiche Art im biologischen<br />
Sinn) aus biologischem und nicht-biologischem Anbau verboten (RL Art.<br />
6.1.8). Beispiel: Es ist nicht gestattet biologische Boskop- und nicht-biologische<br />
Granny-Smith-Äpfel parallel anzubieten.<br />
Ausgenommen von dieser Weisung sind<br />
speziellen Kellerkontrolle unterworfen sind.<br />
2 GELTUNGSBEREICH<br />
Diese Weisung gilt nur für Produzenten, welche entweder<br />
• Bioprodukte im Ankaufswert zwischen Fr. 15'000* und Fr. 75'000* zukaufen (ab<br />
Hof-Verkauf oder Verkauf ab Marktstand) oder<br />
• auf dem Betrieb Produkte (zugekaufte und selbstproduzierte) im Ankaufswert<br />
von über Fr. 15’000.- verarbeiten (Verkauf ab Hof oder Marktstand oder Lieferung<br />
an Detailhandel). Unter Verarbeitung ist jede Mischung und/oder mechanische<br />
oder mikrobiologische Veränderung von Lebensmitteln zu verstehen. Der<br />
Verkauf von Frischfleisch und das reine Verpacken von unverarbeiteten Ernteprodukten<br />
fällt nicht unter diese Weisung<br />
Betriebe, welche Knospe-Produkte im Ankaufswert von mehr als Fr. 75'000 zukau-<br />
fen*, müssen mit der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> einen Lizenzvertrag abschliessen.<br />
Produzenten, welche unter diese Weisung fallen, müssen keine Lizenzgebühren<br />
entrichten.<br />
*<br />
Vollzugshinweis: Verpackt zugekaufte und so weiterverkaufte Produkte können<br />
von diesem Betrag abgezogen werden. Im Falle von Harassen und anderen Offengebinden<br />
gilt dies nur, wenn die gesamte Lieferung unverändert harassenweise<br />
an die Endverbraucher verkauft wird, d.h. nichts von der Lieferung in den Offenverkauf<br />
gelangt.<br />
3 DURCHFÜHRUNG UND ORGANISATION DER<br />
KONTROLLE<br />
Die unter die Bestimmung dieser Weisung fallenden Landwirtschaftsbetriebe werden<br />
von speziell ausgebildeten Hofverarbeitungskontrolleuren kontrolliert. Dies
47 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
anlässlich der Kontrolle des Landwirtschaftsbetriebes. Ist die vollständige Kontrolle<br />
der Verarbeitung oder des Warenflusses anlässlich der ordentlichen Kontrolle nicht<br />
möglich, kann die Zertifizierungsstelle eine zusätzliche Kontrolle anordnen.<br />
Der Vorstand legt in Zusammenarbeit mit dem Kontrolldienst je eine nach Aufwand<br />
zu verrechnende Kontrollgebühr für Zukäufer von Bioprodukten, Marktfahrer und<br />
Hofverarbeiter fest, welche zusätzlich zur ordentlichen Betriebskontrollgebühr entrichtet<br />
werden muss. Betriebe, welche in mehr als einem der oben erwähnten Bereiche<br />
tätig sind, bezahlen 75 % der aufaddierten Summe. Allfällige Zusatz- und Nachkontrollen<br />
werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.<br />
Produzenten, welche unter diese Weisung fallen, müssen keine Lizenzgebühren<br />
entrichten.<br />
4 ANFORDERUNGEN AN DIE AUFZEICHNUNGEN<br />
BEIM HANDEL MIT ZUGEKAUFTEN KNOSPE-<br />
PRODUKTEN<br />
1. Für jeden einzelnen Zukauf (des gesamten Umsatzes) müssen Lieferscheine oder<br />
Rechnungen (Buchungsbelege) vorgelegt werden können, aus welchen Qualität<br />
(Knospe, Bio oder Nicht-Bio), Herkunft, Art und Menge hervorgehen. Die<br />
3.<br />
Buchhaltung (ohne Bilanz und Erfolgsrechnung) muss dem Kontrolleur inkl. allen<br />
Belegen vorgelegt werden.<br />
2. Es muss jederzeit eine aktuelle Sortimentsliste mit den aktuell gültigen Verkaufspreisen<br />
vorgelegt werden können.<br />
Marktfahrer müssen zudem belegen können, woher ihr gesamtes, am <strong>Stand</strong> angebotenes<br />
Sortiment stammt. Beim gleichzeitigen Anbieten von Knospe- und<br />
Nicht-Knospe-Produkten muss die Produktionsart (Bio-Knospe, Bio-Drittlabel,<br />
nicht-biologisch) für jedes Produkt deklariert sein. Die Herkunft der angebotenen<br />
Waren muss nachvollziehbar sein.<br />
5<br />
ANFORDERUNGEN AN DIE AUFZEICHNUNG BEI<br />
HOFVERARBEITUNG<br />
1. Die Rezepturen (mit qualitativen und quantitativen Angaben zu sämtlichen Inhalts-,<br />
Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffen) aller verarbeiteten Produkte müssen<br />
vorgelegt werden.<br />
2. Die Hofverarbeiter haben ein Verarbeitungsjournal zu führen, welches mindes-<br />
Rohstoffe, produzierte<br />
tens folgende Angaben enthält: Menge der verwendeten<br />
Mengen.<br />
3. Produkte, für die produktespezifische <strong>Weisungen</strong> der MKV vorliegen, die nur in<br />
diesen <strong>Weisungen</strong> aufgeführte Zutaten und Zusatzstoffe enthalten, sind automatisch<br />
bewilligt. Nicht aufgeführte Produkte, Produktgruppen und/oder Zutaten/Zusatzstoffe<br />
müssen vorgängig der MKV vorgelegt werden.<br />
Wird anlässlich der Kontrolle festgestellt, dass ein Produkt nicht richtlinienkonform<br />
produziert worden ist, resp. nicht biokonforme Zutaten enthält, so muss es vom<br />
Verkauf zurückgezogen werden.<br />
Wird ein bereits lanciertes Verarbeitungsprodukt nicht bewilligt, so erfolgt eine<br />
Sanktionierung nur dann, wenn durch den Verkauf des Produktes die Richtlinien<br />
übertreten worden sind. Dabei handelt es sich insbesondere um die Verletzung folgender<br />
Anforderungen:<br />
• Das Produkt enthält mehr als 5 % nicht-biologische Zutaten relativ zum Gewicht<br />
zum Zeitpunkt der Verarbeitung, resp. eine nicht in den produktespezifischen<br />
<strong>Weisungen</strong> erwähnte nicht-biologische Zutat (RL Art. 5.2.4). Zudem darf dieselbe<br />
Zutat nicht sowohl in biologischer als auch in nicht-biologischer Qualität<br />
verwendet werden.<br />
• Die namensgebende Zutat (z.B. Erdbeeren im Erdbeerjoghurt) stammt nicht aus<br />
biologischer Produktion.
48 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
• Das Produkt enthält nicht erlaubte Zusatzstoffe. Alle nicht in produktespezifischen<br />
<strong>Weisungen</strong> bei der entsprechenden Produktekategorie aufgeführten Zusatzstoffe<br />
müssen durch die MKV bewilligt werden.<br />
• Das Produkt enthält gentechnisch veränderte Komponenten oder Komponenten,<br />
welche mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen hergestellt worden<br />
sind.<br />
• Das Produkt enthält nicht-biologischen Mais oder nicht-biologischen Soja oder<br />
Zusatzstoffe, welche nicht-biologischen Mais oder nicht-biologischen Soja enthalten<br />
oder aus diesen hergestellt worden sind (z.B. Lecithin, Maizena). Achtung:<br />
Sämtliche Produkte, welche als gentechnisch verändertes Produkt (GVO)<br />
auf dem Markt sind, dürfen nur in Bioqualität eingesetzt werden.<br />
6<br />
ZERTIFZIERUNG<br />
Die Zertifizierung der Hofverarbeitung erfolgt anlässlich der Zertifizierung des<br />
Landwirtschaftsbetriebes. Vorgängig müssen sämtliche Verarbeitungsprodukte -<br />
falls nötig (siehe Punkt 5 dieser Weisung) - entweder durch den Kontrolleur oder<br />
durch die MKV bewilligt worden sein.<br />
7 SANKTIONEN<br />
Die MKA und die MKV erarbeiten gemeinsam ein Sanktionsreglement für die Hofverarbeitung<br />
und den Handel mit zugekauften Bioprodukten.
49 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 2.2.1 ff, 2.5.5 f<br />
Jungpflanzenanzucht im biologischen Ge-<br />
müse- und Kräuteranbau<br />
Weisung der PAK vom 11.11.1998 / Inkraftsetzung auf den 1.1.1999 angepasst von<br />
der MKA am 20.3.2002<br />
Begriffsdefinition: In der BioV (Art. 18b LwG) werden Gemüse- und Kräuterjungpflanzen<br />
mit dem Begriff «Pflanzgut» umschrieben. In den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien<br />
wurde bisher das Ausgangsmaterial im Obst-, Beeren- und Rebbau als Pflanzgut<br />
bezeichnet. Die Terminologie in Richtlinien und <strong>Weisungen</strong> wird derjenigen der<br />
BioV angepasst.<br />
Jungpflanzen im Sinne dieser Weisung sind Jungpflanzen gezogen aus Saatgut oder<br />
auch aus vegetativem Vermehrungsmaterial.<br />
1 GRUNDSATZ<br />
Grundsätzlich muss das im biologischen Gemüse- und Kräuteranbau verwendete<br />
Pflanzgut (Jungpflanzen) gemäss den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien produziert werden.<br />
Zu beachten ist dabei das Merkblatt der MKA «Saatgut, veg. Vermehrungsmaterial<br />
und Jungpflanzen» (gem. Art. 2.2.4).<br />
2 SUBSTRATE FÜR DIE PFLANZGUTPRODUKTION<br />
(JUNGPFLANZENSUBSTRATE)<br />
2.1 Zusammensetzung<br />
Reine Torfsubstrate sind in der Pflanzgutanzucht (Jungpflanzenanzucht) nicht zugelassen.<br />
Der Anteil der Torfersatzstoffe (Kompost, Rindenhumus, Nadelerde, Holzfasern<br />
usw.) muss mindestens 30 Volumenprozent betragen. Die Zusammensetzung<br />
von Substraten für Topfkulturen von Küchenkräutern ist in der Weisung «Produziender<br />
Gartenbau» geregelt.<br />
Die Aufbereitung der Torfersatzprodukte muss gemäss den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien<br />
erfolgen.<br />
2.2 Düngung<br />
Bio-Pflanzgutsubstrate (Jungpflanzensubstrate) können mit den in der Hilfsstoffliste<br />
des FiBL aufgeführten Produkten aufgedüngt werden.<br />
Die Beimischung von chemisch-synthetisch hergestellten Spurenelementdüngern in<br />
Substraten ist nicht erlaubt.<br />
2.3 Substratprüfung<br />
Es dürfen nur Substrate verwendet werden, die in der aktuellen Ausgabe der Hilfsstoffliste<br />
des FiBL enthalten sind.<br />
Betriebseigene Mischungen werden bei der Kontrolle beurteilt und können im Zweifelsfalle<br />
zur genauen Abklärung ans FiBL weitergeleitet werden.<br />
Bio-Pflanzgutsubstrate können mit der Hilfsstoffknospe ausgezeichnet werden.<br />
Hersteller erhalten bei der MKV die notwendigen Auskünfte.
50 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
3 PFLANZENSCHUTZ<br />
Der Pflanzenschutz in der Pflanzgutaufzucht erfolgt gemäss den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien.<br />
Vorbeugende Massnahmen, wie gute Klimaführung und die Wahl robuster<br />
Sorten stehen dabei im Vordergrund.<br />
4 HEIZUNG UND BELEUCHTUNG<br />
Gemäss dem Bedürfnis der Jungpflanzen (Pflanzgut) können Heizung und Beleuchtung<br />
ohne weitere Einschränkungen eingesetzt werden. Eine möglichst gute Wärmedämmung<br />
der Anzuchthäuser soll gewährleistet sein.<br />
5 VERWENDUNG VON NICHT KNOSPE-<br />
ZERTIFIZIERTEM PFLANZGUT (JUNGPFLANZEN)<br />
5.1 Einsatz von nicht Knospezertifizierten Jungpflanzen<br />
Jeder Knospe-Betrieb kann in begründeten Fällen ohne Ausnahmebewilligung bis<br />
maximal 5 % des jährlichen Pflanzgutbedarfs (Jungpflanzenbedarfs) aus nicht<br />
Knospe-zertifiziertem Anbau verwenden, sofern diese mindestens die EU-Bio-<br />
Verordnung (RatsVO 2092/91 EWG) erfüllen und entsprechend zertifiziert sind.<br />
Gegenüber dem Kontrolleur muss belegt werden können, dass die unter Artikel 5.2<br />
aufgeführten Kriterien für den Einsatz von nicht Knospe-zertifiziertem Pflanzgut<br />
erfüllt sind. Nüssler-Pflanzgut muss zur Berechnung der 5 %-Freimenge vom Jahresbedarf<br />
abgezogen werden.<br />
Bei voraussichtlicher Überschreitung der 5 %-Limite muss vorgängig bei der Zertifizierungsstelle<br />
eine Ausnahmebewilligung beantragt werden.<br />
Das im Rahmen dieser Ausnahmeregelung importierte Pflanzgut darf NIE per Flugzeug<br />
eingeführt werden (RL Art. 5.10.1).<br />
5.2 Kriterien für den Einsatz von nicht Knospezertifiziertem Pflanz-<br />
gut<br />
Nicht Knospezertifiziertes Pflanzgut darf eingesetzt werden/die Ausnahmebewilligung<br />
wird erteilt, wenn:<br />
• das bereits beschaffte/in eigener Anzucht Pflanzgut durch Witterung, Schädlings-<br />
oder Pilzkrankheiten oder äussere Gewalt vernichtet wurde (z.B. Hagel,<br />
Frost, Schneckenfrass, Wildschweineschaden usw.);<br />
• der Pflanzgutlieferant das bestellte Knospe-zertifizierte Biopflanzgut nicht liefern<br />
konnte (Ursachen wie oben) oder in der betriebseigenen Pflanzgutanzucht<br />
durch Ursachen, wie oben beschrieben, Ausfälle entstanden sind;<br />
• das rechtzeitig bestellte Pflanzgut bei der Lieferung die branchenüblichen Qualitätskriterien<br />
nicht erfüllt hat und deshalb zurückgewiesen werden musste.<br />
Das nicht Knospezertifizierte Pflanzgut darf nicht eingesetzt werden/die Ausnahmebewilligung<br />
kann nicht erteilt werden wenn der Pflanzgutzukauf zu kurzfristig<br />
geplant wurde, so dass die Zeitspanne zwischen Bestellung und Pflanzung kürzer<br />
als die übliche Anzuchtdauer des betreffenden Bioflanzgutes ist; d.h. eine Beschaffung<br />
bei einem Knospe-Pflanzgutproduzenten auf Bestellung gar nicht möglich<br />
gewesen wäre.
51 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.10.1 ff<br />
Kaninchenhaltung<br />
Weisung der PAK vom 26.5.1998, angepasst von der MKA am 20.3.2002<br />
1 HALTUNG<br />
Zuchttiere, Remonten und Mastkaninchen müssen in Gruppen (separate Gruppen<br />
oder Familiengruppen) gehalten werden.<br />
Eine Anlage für Kaninchen muss mindestens so gross sein, dass die artspezifischen<br />
Bewegungsweisen (Sprünge, Kapriolen) ungehindert ausgeführt werden können.<br />
Die Anlage muss über einen eingestreuten Bereich verfügen.<br />
Zum Nagen müssen ständig Nageobjekte (frische Äste, ungiftige Weichhölzer, getrocknete<br />
Maiskolben, Rüben, Heu- oder Strohpresslinge) vorhanden sein. Die Tiere<br />
müssen in der Lage sein, sich artgerecht zu verhalten. Sie dürfen keine züchtungsbedingten<br />
Anomalien aufweisen.<br />
Tiere in Aussenanlagen sollen vor Zugluft, Unwetter und direkter Sonneneinstrahlung<br />
geschützte Bereiche aufsuchen können. Dort soll der Boden trocken sein.<br />
2 ZUCHTGRUPPEN<br />
Eine Zuchtgruppe besteht aus maximal 5 Zibben, einem Zuchtbock und deren Junge<br />
bis zum Erreichen des Absetzalters. Alle Tiere müssen sich wahlweise aufsuchen<br />
oder meiden können. Dies ist durch Gliederung und Strukturierung des Raumes zu<br />
erreichen.<br />
Die Anlage<br />
muss über einen Futter-, einen Nest- und einen Aufenthaltsbereich verzwei<br />
Futterstellen aufweisen.<br />
fügen. Diese müssen räumlich getrennt sein (Sichtkontakt unterbrochen). Der Aufenthaltsbereich<br />
soll attraktive Liegeplätze und einen Unterschlupf als Rückzugsbereich<br />
für die Zibben aufweisen. Dagegen soll der Nestbereich keine für die Kaninchen<br />
attraktiven Elemente aufweisen.<br />
Bei restriktiver Fütterung muss der Futterbereich<br />
Eine Zuchtzibbe muss die Möglichkeit haben, in einem Nistkasten selbst ein Nest<br />
aus Heu und/oder Stroh zu bauen. Nach dem Werfen muss der Nesteingang für die<br />
Zibbe verschliessbar sein. Vor den Nesteingängen muss der Boden mit Stroh eingestreut<br />
sein. Pro Zuchtzibbe muss ein Nest zur Verfügung stehen. Für die Zuchtzibben<br />
müssen erhöhte Plätze vorhanden sein, welche die Jungen nicht oder nur schwer<br />
erreichen können.<br />
Sobald die Jungen das Nest verlassen, muss ihnen ein nur für sie zugänglicher Be-<br />
reich angeboten werden, welcher mindestens aus einem dunklen Ruhe- und einem<br />
hellen Futterbereich besteht.<br />
3 REMONTEN UND MASTKANINCHEN<br />
Eigene und zugekaufte Masttiere müssen alle Anforderungen von Kapitel 1 und 2<br />
dieser Weisung erfüllen. Remonten werden wie Masttiere aufgezogen.<br />
Jede Anlage muss über einen Rückzugsbereich (Sichtkontakt unterbrochen) mit<br />
festen Wänden verfügen, in den sich die Tiere zum Ruhen und bei Störungen zurückziehen<br />
können.<br />
Der Zukauf von bis zu 80 Tage alten Zuchtremonten ist bis zum 31. 12. 2001 gestat-<br />
pro Mastgruppe erlaubt. Für<br />
tet. Danach gilt Art. 3.1.10 der Richtlinien.<br />
Bis zum Alter von 60 Tagen sind maximal 60 Tiere<br />
ältere Mastkaninchen beträgt die maximale Gruppengrösse 15 Tiere.
52 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
4 ZOOTECHNIK<br />
Die Kastration der männlichen Tiere bei Mastgruppen ist verboten.<br />
5 FÜTTERUNG<br />
Allen Kaninchen soll jederzeit genügend Rauhfutter von guter Qualität zur Verfügung<br />
stehen.<br />
Die Tiere werden grundsätzlich nur mit pflanzlichen Produkten gefüttert. Kraft- und<br />
Mischfutter müssen den Anforderungen der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> entsprechen. Die Kaninchen<br />
verfügen jederzeit über sauberes und frisches Trinkwasser.<br />
Die Fütterungseinrichtungen müssen von den Tieren zum Fressen leicht erreichbar<br />
und so angebracht sein, dass sie möglichst wenig durch Kot oder Urin verschmutzt<br />
werden können und leicht zu reinigen sind. Die Tiere sollen sich nicht daran verletzen<br />
können.<br />
6 STALLFLÄCHEN OHNE AUSLAUF<br />
Erhöhte Flächen (Etagen) dürfen zu einem Drittel mitgerechnet werden.<br />
Tierkategorie<br />
Masttiere und Remonten<br />
bis zum Alter von 76 Tagen<br />
ab 77 Tagen<br />
Stallmasse<br />
mindestens 2 m 2 pro Gruppe<br />
mindestens 0,15 m 2 pro Tier<br />
mindestens 0,25 m 2 pro Tier<br />
Unterschlupf Alter bis 60 Tage: 0,03 m 2 pro Tier<br />
Alter ab 60 Tagen: 0,05 m 2 pro Tier<br />
Zuchtgruppen<br />
mindestens 1,6 m 2 pro Zibbe inkl. Platz<br />
für Jungtiere und Rammler<br />
7 STALLKLIMA<br />
Ställe für Kaninchen müssen mit Tageslicht versehen und gut belüftbar sein. Durchzug<br />
ist zu vermeiden.<br />
8 HALTUNG IN HERKÖMMLICHEN<br />
KANINCHENSTÄLLEN (KÄFIGHALTUNG)<br />
Die Haltung von Kaninchen in herkömmlichen Kaninchenställen auf Knospe-<br />
Betrieben wird nicht mehr toleriert. Für Kaninchenhaltungen die ausschliesslich als<br />
Hobby und für die Selbstversorgung dienen, müssen die BTS-Bedingungen sinngemäss<br />
erfüllt werden. Das heisst, für diese Bestände ist es möglich in einem herkömmlichen<br />
Stall durch Verbinden von 2 oder mehreren Abteilen und dem Einrichten<br />
einer erhöhten Fläche ein System zu erstellen, das den Anforderungen genügt.<br />
Die in Punkt 6 definierten Mindestmasse pro Tier müssen aber eingehalten werden.<br />
Die speziellen Anforderungen der Tierschutzverordnung für Kaninchen in Käfighaltung<br />
müssen mindestens eingehalten werden. Käfige müssen mit Einstreu versehen<br />
sein. Es bestehen keine Übergangsfristen. Die allgemeine Bestimmungen der <strong>BIO</strong>
53 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
<strong>SUISSE</strong> Richtlinien, Art. 3.1.7 bis 3.1.9 über die Fütterung müssen eingehalten<br />
werden.<br />
Den Tieren muss regelmässig, mindestens einmal wöchentlich ein Ort (Auslaufgitter<br />
auf Freiland oder unter Dach) für die freie Bewegung angeboten werden.<br />
Hinweis: Das Bundesamt für Veterinärwesen (www.bvet.ch/tierschutz gibt eine<br />
Broschüre mit wertvollen Empfehlungen zur Kaninchenhaltung heraus.
54 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 7.2.6<br />
Lenkungsabgaben beim Jungtierzukauf<br />
Weisung der PAK vom 30.3.1999 / Inkraftsetzung: 1.5.1999, angepasst von der<br />
MKA am 21.09.2001<br />
1 GRUNDLAGEN<br />
Gemäss Artikel 3.1.10 der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien müssen Junghennen und Ferkel<br />
zwingend aus Knospe-Produktion zugekauft werden.<br />
Die Verfügbarkeit ist sowohl im Bereich der Biojunghennen als auch in demjenigen<br />
der Bioferkel noch ungenügend. Nicht-biologische Junghennen und Ferkel dürfen<br />
deshalb nur dann eingestallt werden, wenn die Nichtverfügbarkeit von Knospe-<br />
Jungtieren von der Koordinationsstelle für Biojunghennen und Bioferkel (Adresse<br />
siehe Anhang 2) bestätigt worden ist.<br />
Die grosse Preisdifferenz zwischen biologischen und nicht-biologischen Jungtieren<br />
führt dazu, dass derjenige Landwirt welcher keine Biojungtiere zukaufen kann,<br />
einen grossen finanziellen Gewinn realisieren kann. Durch die Erhebung von Lenkungsabgaben<br />
soll diese Ungerechtigkeit beseitigt werden. Die aus der Lenkungsabgabe<br />
resultierenden Einnahmen kommen (abzüglich der Unkosten) wiederum der<br />
betreffenden Branche zu Gute, sei dies durch Verbilligung der biologischen Jungtiere<br />
oder durch Marktöffnungs- und Marketingmassnahmen. Die Geschäftsstelle legt<br />
gegenüber dem Vorstand und den betroffenen Fachkommissionen jährlich Rechenschaft<br />
über die Verwendung der Mittel ab.<br />
2 GELTUNGSBEREICH<br />
A) Junghennenzukauf<br />
Die Lenkungsabgabe muss ab einem Jahresbedarf von 20 Tieren entrichtet werden.<br />
Werden nicht-biologische Tiere eingestallt, so sind solche aus BTS-Aufzucht zu<br />
verwenden.<br />
B) Ferkelzukauf<br />
Die Lenkungsabgabe muss ab einem Jahresbedarf von 4 Tieren entrichtet werden.<br />
Sind keine Bioferkel verfügbar, so müssen Ferkel aus RAUS-konformer Haltung<br />
eingestallt werden. Sind keine solchen erhältlich, so muss dies gegenüber dem Kontrolleur<br />
mündlich begründet werden.<br />
Wenn pro Jahr nicht mehr als drei Mastschweine auf dem Betrieb ausgemästet werden,<br />
muss beim Zukauf nicht-biologischer Ferkel keine Lenkungsabgabe entrichtet<br />
werden.<br />
3 MITTELVERWENDUNG<br />
A) Ertrag aus der Lenkungsabgabe «Junghennenzukauf»<br />
Solange weniger als 80 % des geschätzten Bedarfes an Biojunghennen aus biologischer<br />
Produktion zur Verfügung stehen, soll der Ertrag aus der Lenkungsabgabe<br />
dazu verwendet werden, die verfügbaren Biojunghennen zu verbilligen. In den Genuss<br />
der Verbilligung kommen alle der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> im Voraus gemeldeten Lieferungen<br />
von Biojunghennen (gemäss Kap. 6 dieser Weisung).<br />
Dabei gelten folgende Grundsätze:
55 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
• die Höhe der Lenkungsabgabe wird so angesetzt, dass - unter Berücksichtigung<br />
des gemeldeten Angebotes an Biojunghennen und des geschätzten Bedarfes - der<br />
Einstandspreis für biologische und nicht-biologische Junghennen gleich gross<br />
ist. Die 6-wöchige Karenzfrist beim Einstallen von konventionellen Junghennen<br />
wird angemessen berücksichtigt.<br />
• Der Ertrag wird folgendermassen aufgeteilt:<br />
- 7.5 % für die Administration bei der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> (Eingangskontrolle und<br />
Rückverteilung, Grundlagenarbeiten zur Schätzung von Angebot und Nachfrage,<br />
Publikation und Auskunftserteilung) und zur Finanzierung der Koordinationsstelle;<br />
- 10 % der Lenkungsabgaben (aufgrund der Rundungsdifferenzen 8 bis 12 %)<br />
werden dem Lenkungsabgaben-Reservefonds zugewiesen. Übersteigt dieser<br />
den Betrag einer geschätzten Jahresausgabe für die Rückverteilung, so erfolgt<br />
keine weitere Äufnung mehr.<br />
Ab dem Moment, wo mindestens 80 % des geschätzten Junghennenbedarfs aus<br />
biologischer Produktion verfügbar ist, wird der Ertrag (abzüglich Unkosten) zur<br />
Absatzförderung im Bereich des Eiermarktes verwendet. Der Reservefonds wird<br />
aufgelöst und ebenfalls diesem Zweck zugeführt.<br />
B) Ertrag aus der Lenkungsabgabe «Ferkelzukauf»<br />
Über die Verwendung des Ertrages aus der Lenkungsabgabe Ferkelzukauf entscheiden<br />
die MKA und der Vorstand gemeinsam, nachdem die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> in der Handhabung<br />
des Instrumentes Lenkungsabgabe erste Erfahrungen gesammelt hat. Der<br />
Verwendungszweck muss im Interesse der Branche liegen.<br />
4 BERECHNUNG DER HÖHE DER LENKUNGSABGABE<br />
UND DER RÜCKVERTEILUNG<br />
A) Höhe der Lenkungsabgabe «Junghennenzukauf» und der damit<br />
verbundenen Rückverteilung<br />
Die Anbieter von Biojunghennen müssen jeweils bis am 15. Februar ihre geschätzte<br />
Produktion ab 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres melden. Nichtgemeldete<br />
Junghennen werden nicht subventioniert (Spielraum: 5 %).<br />
Aufgrund der Kontrolldaten des Vorjahres wird der Bedarf an Junghennen unter<br />
Berücksichtigung der geplanten Stallneubauten geschätzt.<br />
Die Höhe der Lenkungsabgabe und der Subvention der Biojunghennen wird anschliessend<br />
so festgelegt, dass eine nicht-biologische und biologische Junghenne<br />
gleich viel kostet (gemitteltes Preisniveau des Vorjahres). Gerundet wird jeweils auf<br />
10 Rappen.<br />
Sind einmal über 80 % des Bedarfes an Junghennen aus Bioproduktion erhältlich, so<br />
wird die auf Grund der Vorjahrespreise gemittelte Preisdifferenz zwischen biologischen<br />
und nicht-biologischen Junghennen abgeschöpft.<br />
Die Höhe der Lenkungsabgabe und die damit verbundene Rückverteilung werden<br />
jeweils auf den 1. Mai eines jeden Jahres auf Grund der formulierten Grundsätze neu<br />
festgelegt. Im April werden die Produzenten über das «bio aktuell» informiert. In<br />
Ausnahmesituationen (Veränderung von Angebot und Nachfrage, resp. der Preisrelationen)<br />
kann die Höhe der Lenkungsabgabe und die Rückverteilung mit einer<br />
Ankündigungsfrist von mindestens 2 Monaten geändert werden.<br />
B) Höhe der Lenkungsabgabe «Ferkelzukauf»<br />
Abgeschöpft wird die aktuelle Preisdifferenz zwischen biologischen und nichtbiologischen<br />
Ferkeln aus RAUS-konformer Haltung. Die Rundung erfolgt auf 10<br />
Rp. Die Lenkungsabgabe wird wöchentlich angepasst.
56 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
5 ADMINISTRATIVE HANDHABUNG FÜR<br />
PRODUZENTEN<br />
Grundsatz: Bei Bestellungen von Legehennen oder Ferkeln muss - sofern der Produzent<br />
keine Biojungtiere gefunden hat - bei der Koordinationsstelle für Junghennen<br />
und Ferkel angefragt werden, ob biologische Jungtiere verfügbar sind. Sind solche<br />
gemäss Bedingungen im Anhang dieser Weisung verfügbar, so müssen diese obligatorisch<br />
eingestallt werden.<br />
Sind keine biologischen Junghennen, respektive Ferkel verfügbar, so muss folgendermassen<br />
vorgegangen werden:<br />
1. Die Koordinationsstelle für Biojunghennen stellt eine Rechnung über die geschuldete<br />
Lenkungsabgabe aus.<br />
2. Der Produzent erhält nach Zahlungseingang die von der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> gegengezeichnete<br />
Nichtverfügbarkeitsbestätigung (im Doppel), welche als Ausnahmebewilligung<br />
für die Einstallung nicht-biologischer Junghennen gilt. Bei Nichtbezahlung<br />
der Lenkungsabgabe verliert der Betrieb die Berechtigung zu Knospe-Vermarktung.<br />
3. Dem Kontrolleur muss die von der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> gegengezeichnete Ausnahmebewilligung<br />
vorgelegt werden. Dieser zieht das Doppel der Ausnahmebewilligung<br />
ein (wird der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> zugestellt).<br />
Verspätete Erkundigungen nach der Verfügbarkeit von Junghennen und Ferkeln<br />
erschweren den Vollzug der Weisung. Säumige Produzenten werden mit Zuschlägen<br />
zu einer rechtzeitigen Erkundung des Angebotes angehalten. Junghennenbezüger<br />
bezahlen bis 99 Stück einen Zuschlag von Fr. 100.- pauschal, ab 100 Stück zusätzlich<br />
10 Rappen pro Stück. Ab 500 Junghennen muss die Verfügbarkeit mindestens<br />
22 Wochen vor der Einstallung abgeklärt werden.<br />
Ferkelbezüger bezahlen bei verspäteter Nichtverfügbarkeitsbestätigung bis 19 Stück<br />
einen Zuschlag von Fr. 50.- und ab 20 Stück einen Zuschlag von Fr. 100.-.<br />
6 ADMINISTRATIVE HANDHABUNG FÜR<br />
<strong>BIO</strong>JUNGHENNEN-PRODUZENTEN<br />
(RÜCKVERGÜTUNG)<br />
Grundsatz: Jede Lieferung von Biojunghennen wird beim Junghennenproduzenten<br />
subventioniert. Diese muss vollumfänglich an den Kunden weitergegeben werden.<br />
Der Junghennenproduzent muss zur Geltendmachung der Subvention folgendermassen<br />
vorgehen:<br />
1. Bis am 15. Februar muss jeweils die voraussichtliche Produktion ab 1. Mai bis<br />
zum 30. April des Folgejahres gemeldet werden. Nichtgemeldete Junghennen<br />
können später NICHT subventioniert werden (Toleranz: 5 %).<br />
2. Die Subvention wird in 2 Tranchen ausbezahlt. Zur Geltendmachung muss eine<br />
Liste über alle im Abrechnungszeitraum erfolgten Lieferungen erstellt werden<br />
(Betriebsnummer, Name und Adresse des Käufers, gelieferte Anzahl Tiere,<br />
Rechnungssumme). Der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> sind - auf Verlangen hin - die entsprechenden<br />
Rechnungskopien vorzulegen.<br />
Der Zeitpunkt der Geltendmachung der ersten Tranche kann vom Produzenten<br />
frei gewählt werden. Die zweite Tranche beinhaltet die Gesamtabrechnung des<br />
Geltungsjahres (1. Mai bis 30. April) und kann eingefordert werden, wenn alle<br />
im Vorjahr gemeldeten Junghennen ausgeliefert sind.<br />
Die Rückvergütung erfolgt entweder an den lizenzierten Händler oder bei Direktvermarktern<br />
an den Aufzüchter. Händler müssen die lückenlose Rückverfolgbarkeit<br />
gewährleisten und für jede Charge auf der Lieferliste neben den oben verlangten<br />
Angaben auch noch den Namen des Aufzüchters aufführen.<br />
Jeder Aufzüchter muss sich entscheiden, ob die Abrechnung a) über den Lizenznehmer<br />
als Vertragspartner oder b) über ihn als eigenständiger Selbstvermarkter<br />
läuft.
57 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Nach der Angebotserhebung und der Festlegung der Höhe der Rückvergütung werden<br />
die Aufzüchter und Lizenznehmer durch die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> über die administrative<br />
Handhabung der Rückvergütung schriftlich informiert.<br />
Die Fachkommission Geflügel publiziert Richtpreise für Biojunghennen. Wird eine<br />
Kostenbeteiligung im Rahmen der Weisung geltend gemacht, so dürfen diese Richtpreise<br />
gegenüber dem Endverbraucher (einstallender Legehennenhalter) nicht überschritten<br />
werden.<br />
7 REKURSINSTANZ<br />
Rekursinstanz für alle diese Weisung betreffenden Streitigkeiten ist der <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong> Vorstand.<br />
Anhang 1<br />
Erteilung der Nichtverfügbarkeitsbestätigung - Kriterien<br />
A) Junghennen<br />
Verfügbare Biojunghennen müssen dann vom einstallenden Landwirt übernommen<br />
werden, wenn diese in Abhängigkeit der gesuchten Postengrösse nicht weiter als<br />
über die folgenden Distanzen transportiert werden müssen:<br />
• bis 49 Tiere: 50 km<br />
• 50 - 449 Tiere: 100 km<br />
• ab 450 Tiere: ganze Schweiz<br />
B) Ferkel<br />
Verfügbare Bioferkel müssen dann vom einstallenden Landwirt übernommen werden,<br />
wenn diese in Abhängigkeit der gesuchten Postengrösse nicht weiter als über<br />
die folgenden Distanzen transportiert werden müssen:<br />
• Postengrösse =< 10 Tiere: 25 km Luftdistanz im Tal, 35 km Wegdistanz im<br />
Berggebiet<br />
• Postengrösse > 10 Tiere: 50 km Luftdistanz im Tal, 70 km Wegdistanz im<br />
Berggebiet<br />
In beiden Fällen müssen die Tiere nicht übernommen werden, wenn sie die branchenüblichen<br />
Qualitäts- und Hygienevorschriften nicht erfüllen.<br />
Anhang 2<br />
Telefonnummer der Koordinationsstelle für Biojunghennen und Bio-<br />
ferkel<br />
Tel. 01 7600 500<br />
Fax 01 7600 507<br />
Natel 079 662 90 35<br />
E-mail w.baumann@oeko-marketing.ch
58 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 7.3.1 ff und 7.4.1 ff<br />
Lohnverarbeitung von Lebens- und Futter-<br />
mitteln<br />
Weisung der MKA und MKV vom 18.5.1999<br />
1 DEFINITION DER LOHNVERARBEITUNG<br />
Unter diese Weisung fällt jede Verarbeitung von Lebens- und Futtermitteln, welche<br />
im Auftrag des Landwirtes durch nicht direkt auf dem Betrieb beschäftigte Drittpersonen<br />
und Drittfirmen erfolgt. Unter Verarbeitung ist dabei jedwelche Aufbereitung,<br />
Haltbarmachung und Verpackung von biologischen Lebens- und Futtermitteln zu<br />
verstehen. Diese Weisung gilt auch für die Lohnschlachtung.<br />
2 VERTRAGLICHE ANBINDUNG DES<br />
LOHNVERARBEITERS<br />
Der Lohnverarbeiter ist ein Auftragnehmer des Landwirtes; die Verantwortung für<br />
die Einhaltung der Richtlinien und <strong>Weisungen</strong> liegt somit ausschliesslich beim auftraggebenden<br />
Biobauern, welcher verpflichtet ist, den Lohnverarbeiter zu überwachen.<br />
Der Biobauer muss im eigenen Interesse dafür besorgt sein, dass der Lohnverarbeiter<br />
die Verarbeitungsrichtlinien und vor allem die Vorgaben bezüglich der<br />
Rezeptur einhält. Die Lohnverarbeitung ist somit kontrolltechnisch immer ein Bestandteil<br />
der Hofverarbeitung und muss durch den Hofverarbeitungskontrolleur<br />
(gemäss Weisung «Hofverarbeitung und Zukauf von Bioprodukten») kontrolliert<br />
werden.<br />
Der auftraggebende Landwirt muss mit dem Lohnverarbeiter einen Vertrag abschliessen,<br />
in welchem das Kontrollrecht geregelt ist (Musterverträge werden durch<br />
die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> zur Verfügung gestellt). Ausgenommen ist die Lohnverarbeitung<br />
zur ausschliesslichen Selbstversorgung.<br />
Die Regelung bezüglich Vertragspflicht gilt in folgenden Fällen:<br />
• Verkauf ab Hof (inkl. Hauslieferdienst durch die Betriebsleiterfamilie)<br />
• Verkauf ab eigenem Marktstand<br />
• Verkauf von vorverpackten und mit dem Namen des Produzenten gekennzeichneten<br />
Produkten an Detail- und Grosshandel.<br />
Werden verarbeitete Knospe-Produkte ohne namentliche Nennung des Knospe-<br />
Produzenten durch Dritte unter der Knospe verkauft, so muss der Verarbeiter einen<br />
Lizenzvertrag abschliessen.<br />
3 REZEPTUREN<br />
Entweder muss der Landwirt die genaue Rezeptur kennen oder der Lohnverarbeiter<br />
muss die Rezeptur auf Verlangen hin direkt der Kontrollstelle einreichen. Die Angaben<br />
werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Im Kontrollbericht wird nur<br />
festgehalten, ob die Rezeptur in Ordnung ist. Wenn Mängel bestehen, werden die<br />
Auflagen direkt gegenüber dem Lohnverarbeiter formuliert.<br />
Wenn der Lohnverarbeiter <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Lizenznehmer ist, so entfallen die Bestimmungen<br />
von Absatz 1. Es gelten die Bestimmungen des Lizenzvertrages.<br />
Die Rezepturen müssen die in Kapitel 5 der Weisung «Hofverarbeitung und Zukauf<br />
von Bioprodukten» formulierten Anforderungen erfüllen.
59 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
4 WARENFLUSSKONTROLLE<br />
Sämtliche biologischen Zutaten ausser Gewürze und Schweinespeck müssen dem<br />
Lohnverarbeiter durch den auftraggebenden Landwirt geliefert werden. Der Schweinespeck<br />
darf nur dann durch den Metzger beschafft werden, sofern dieser durch<br />
einen <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Lizenznehmer geliefert wird. Wird der Schweinespeck direkt<br />
von einem Biobauern zugekauft, so muss dieser immer durch den auftraggebenden<br />
Landwirt beschafft und dem Metzger geliefert werden.<br />
Vom Lohnverarbeiter gelieferte biologische Gewürze und Speck sind auf der Rechnung<br />
auszuweisen und zu deklarieren. Für die Gewürze genügt eine Sammelposition.<br />
Die Warenflusskontrolle findet immer auf dem Knospe-Betrieb statt. Die zugelassenen<br />
nicht-biologischen Zutaten dürfen direkt durch den Lohnverarbeiter beschafft<br />
werden. Es liegt dabei in der Verantwortung des Auftraggebers sicherzustellen,<br />
dass diese keine verbotenen Zusätze enthalten.<br />
5 KONTROLLRECHT BEIM LOHNVERARBEITER<br />
Die Kontrollstellen können beim Lohnverarbeiter stichprobeweise Kontrollen durchführen.<br />
Mit seiner Unterschrift unter den Lohnverarbeitungsvertrag erteilt der Lohnverarbeiter<br />
sein Einverständnis dafür.<br />
6 GEBÜHREN UND ZUSTÄNDIGKEITEN<br />
Die Kontrollgebühren werden gemäss Tarif der von der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> bezeichneten<br />
Kontrollorganisation beim auftraggebenden Landwirt erhoben.<br />
Zuständig für den Vollzug auf dem Knospe-Betrieb ist die MKA; für die Prüfung<br />
der Rezepturen und Verarbeitungsvorgaben die MKV.
60 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 2.1.4 ff<br />
Nährstoffversorgung<br />
Weisung der MKA, verabschiedet an der GV vom 16.10.2002<br />
1 GRUNDLAGEN<br />
Die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien, Art. 2.1.4 bis 2.1.8 und die Bio-Verordnung, Art. 12,<br />
regeln die Fragen rund um die Düngung und die Zufuhr von organischen Düngern,<br />
Komposten, Erden und Düngemitteln.<br />
2 STANDORTGERECHTE NÄHRSTOFFVERSORGUNG<br />
Im Zusammenhang mit der standortgerechten Nährstoffversorgung sind im Wesentlichen<br />
zwei Aspekte zu berücksichtigen: Die Begrenzung der Bewirtschaftungsintensität<br />
(die Obergrenze nach Düngergrossvieheinheiten (DGVE 1 ) und verfügbarem<br />
Stickstoff gemäss Punkt 2.1) und die Ausgeglichenheit zwischen Nährstoffbedarf<br />
und Nährstoffangebot (Nährstoffbilanz gemäss Punkt 2.2).<br />
2.1 Die Begrenzung der Bewirtschaftungsintensität<br />
Die Beg renzung der Bewirtschaftungsintensität ist abhängig von den <strong>Stand</strong>ort- und<br />
Klimabedingungen. Die Bewirtschaftungsintensität wird hauptsächlich durch das N-<br />
Angebot bestimmt. Die Höchstwerte werden deshalb in DGVE und kg Stickstoff<br />
(verfügbar) pro ha als Durchschnitt der gesamten düngbaren Fläche eines Betriebes<br />
angegeben. Es gelten folgende Höchstwerte:<br />
Erschwerniszonen<br />
Höchstwerte<br />
DGVE/ha DF2 kg N 3 verf /ha DF<br />
Ackerbau- und Übergangszonen<br />
2.5 135<br />
Voralpine Hügelzone 2.1 113<br />
Bergzone 1 1.8 97<br />
Bergzone 2 1.4 76<br />
Bergzone 3 1.2 65<br />
Bergzone 4 1.1 59<br />
In begründeten Fällen kann die Zertifizierungsstelle auf Antrag höhere Werte zulas-<br />
massgeblich ist eine ausgeglichene Nährstoffbilanz.<br />
sen. Bei der Bewertung der Anträge stützt sich die Zertifizierungsstelle auf folgende<br />
Kriterien: Klimatisch begünstigte Lagen in entsprechenden Zonen, Betriebe mit<br />
nachweislich hohem Anteil guter Böden (z. B. Ertragsnachweis, Vergleich mit dem<br />
Durchschnitt der Zone), keine Anzeichen von Überdüngung.<br />
Die Obergrenze von 2.5 DGVE/ha darf jedoch keinesfalls überschritten werden.<br />
Ausnahme: Im gedeckten Anbau ist die Bewirtschaftungsintensität nicht begrenzt;<br />
Nährstoffzufuhr für Jung- und Topfpflanzen, welche für den Verkauf bestimmt sind,<br />
werden nicht in die Nährstoffbilanz einbezogen.<br />
1 Eine DGVE entspricht 105 kg N und 35 kg P 2 O 5 gemäss Gewässerschutzgesetz<br />
2 DF = Düngbare Fläche (ohne ungedüngte Flächen wie Extensivwiesen, Bunt- und Rotationsbrachen)<br />
3 detaillierte Angaben zur Stickstoff-Verfügbarkeit siehe Kapitel 4.1; (Bsp. Rindvieh: 2.5 DGVE x<br />
105 kg N total –15 % unvermeidbare Verluste x 60 % Ausnützungsgrad = 135 kg N verf )
61 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
2.2 Nährstoffbilanzierung<br />
Gemäss Bio-Verordnung, Art. 12, Absatz 3, muss der Düngerbedarf auf Grund einer<br />
ausgeglichenen Nährstoffbilanz nachgewiesen werden. Der Phosphor- und Stickstoffhaushalt<br />
wird anhand der Methode Suisse-Bilanz der landwirtschaftlichen Beratungszentralen<br />
Lindau (LBL) und Lausanne (SRVA) in der jeweiligen aktuellen<br />
Version oder gleichwertiger Berechnungsmethoden beurteilt.<br />
Betriebe, welche keine N- oder P-haltigen Dünger zuführen und ausschliesslich 1<br />
raufutter-verzehrende Tiere halten, sind von der Berechnung der Suisse-Bilanz in<br />
der Regel befreit, wenn der Anteil der extensiven und wenig intensiven Wiesen<br />
unter 30 Prozent ist und der Viehbesatz pro Hektare düngbare Flächen folgende<br />
Werte nicht überschreitet:<br />
Ackerbauzone und Übergangszonen<br />
1.7 DGVE/ha düngbare Fläche<br />
Hügelzone<br />
1.4 DGVE/ha düngbare Fläche<br />
Bergzone 1<br />
1.2 DGVE/ha düngbare Fläche<br />
Bergzone 2<br />
1.0 DGVE/ha düngbare Fläche<br />
Bergzonen 3 und 4<br />
0.8 DGVE/ha düngbare Fläche<br />
a.) Phosphor<br />
Der Phosphorhaushalt darf höchstens ausgeglichen bilanziert werden (Planung für<br />
Hofdüngerabnahmeverträge, Tierbesatz usw. = max. 100 %) Im Vollzug werden<br />
10 % Fehlerbereich toleriert.<br />
Ein Überschreiten der 110 Prozent-Grenze ist in den folgenden Fällen möglich:<br />
1. Betriebe, die mit Bodenanalysen nach einer anerkannten Methode eines anerkannten<br />
Labors den Nachweis erbringen, dass die Böden unterversorgt sind, können<br />
mit Einbezug eines gesamtbetrieblichen Düngungsplanes einen höheren Bedarf<br />
auf den untersuchten Parzellen (gemäss Grundlagen für die Düngung im<br />
Acker- und Futterbau) geltend machen. Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen<br />
nicht aufgedüngt werden.<br />
2. Phosphor in Form von Kompost oder Ricokalk kann maximal auf drei Jahre<br />
verteilt werden. Die Überschussmengen des in dieser Form zugeführten Phosphors<br />
muss jedes Jahr in die Nährstoffbilanz des Folgejahres übertragen werden.<br />
b.) Stickstoff<br />
Der Stickstoffhaushalt darf höchstens ausgeglichen bilanziert werden (Planung für<br />
Hofdüngerabnahmeverträge, Tierbesatz etc. = max. 100 %). In Ausnahmefällen darf<br />
der Nährstoffanfall in 1 von 3 Jahren den Nährstoffbedarf um maximal 10 Prozent<br />
übersteigen.<br />
2.3 Nährstoffeigenversorgung<br />
Ein wichtiges Ziel der Fruchtfolgegestaltung im Biolandbau ist, einen Mindestanteil<br />
der Stickstoffeigenversorgung über genügend Kleegras und Leguminosen–Anbau<br />
sicherzustellen.<br />
Bis detaillierte Fruchtfolgeregeln in einer entsprechenden Weisung festgelegt sind,<br />
gelten folgende Fruchtfolgeregeln bezüglich Stickstoff-Eigenversorgung:<br />
Mindestens 20 Prozent der Fruchtfolgefläche muss ganzjährig begrünt sein mit<br />
Kunstwiese, Rotationsbrache oder Buntbrache oder mindestens 10 Prozent der<br />
Fruchtfolgefläche ist ganzjährig begrünt und der Bodenschutzindex gemäss Vorgaben<br />
des ÖLN erreicht mindestens 50 Punkte im Mittel bei Ackerkulturen und 30<br />
Punkte im Mittel bei Gemüsekulturen.<br />
Körnerleguminosenanbau zählt zur ganzjährig begrünten Fläche in der Fruchtfolge,<br />
sofern nach der Kultur eine Gründüngung angelegt wird, welche vor dem 15. September<br />
gesät und frühestens am 15. Februar des folgenden Jahres eingearbeitet wird.<br />
In diesem Fall muss der Bodenschutzindex bei Ackerkulturen im Mittel 60 Punkte<br />
und bei Gemüsekulturen im Mittel 40 Punkte betragen.<br />
1 ausgenommen Kleinbestände zur Selbstversorgung (max. 0.5 DGVE)
62 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
3 (QUALITÄTS-) ANFORDERUNGEN AN ZUGEFÜHRTE<br />
DÜNGEMITTEL<br />
3.1<br />
Hofdünger<br />
3.1.1 Hofdüngerzufuhr: Rückstände und Fremdstoffe<br />
Bei einer jährlichen Hofdüngerzufuhr von mehr als 1 DGVE pro Betrieb muss ein<br />
genehmigter Hofdüngerabnahmevertrag vorliegen.<br />
Hofdünger muss von anerkannten Biobetrieben stammen. Wo keine ausreichende<br />
Versorgung mit hofeigenen oder von Biobetrieben zugeführten Hofdüngern möglich<br />
ist, darf maximal die Hälfte des Bedarfs an Stickstoff resp. Phosphor 1 gemäss<br />
Suisse-Bilanz von nicht-biologischen Betrieben stammen.<br />
Besteht der Verdacht auf erhöhte Antibiotika-Werte oder Vorhandensein von genveränderten<br />
Organismen, kann die Kontrollstelle eine Rückstandsanalyse verlangen.<br />
Hofdüngerzufuhr ist nur von kontrollierten nicht biologischen Label Betrieben zugelassen,<br />
deren Richtlinien den Einsatz von Medizinalfutter und GVO-Futter verbieten.<br />
Die zugelassenen Labels werden jährlich von der MKA festgelegt und veröf-<br />
fentlicht.<br />
Von angestammten Käsereien mit Milchablieferungspflicht und von Pferde- und<br />
Schafhaltungsbetrieben, welche nicht einem Label angeschlossen sind, darf Hofdünger<br />
zugeführt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine GVO-<br />
Futtermittel und kein Medizinalfutter eingesetzt werden.<br />
Der Betrieb, von dem die Hofdünger stammen, muss in jedem Fall die Vorgaben des<br />
Gewässerschutzgesetzes (GschG), der Tierschutzverordnung (TschV) und falls Land<br />
bewirtschaftet wird, den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) erfüllen. Dies ist<br />
mit der Kopie eines gültigen Attestes zu belegen.<br />
3.1.2 Hofdüngerabgabe<br />
Ein Biobetrieb muss mindestens 50 Prozent des anfallenden Hofdüngers gemäss<br />
Suisse-Bilanz auf der hofeigenen Fläche ausbringen können. Es sind nur Hofdüngerabgabeverträge<br />
mit Biobetrieben zugelassen. Hofdüngerabgaben an Hobbygärtin<br />
der Nährstoffbilanz nicht abgezogen ner und Nicht-Biobetriebe dürfen<br />
werden.<br />
3.1.3 Hofdüngerzufuhr und -abgabe: Distanzlimiten und Energieaufwand<br />
Die maximale Luftdistanz, aus der Hofdünger zugeführt oder abgegeben werden<br />
dürfen, beträgt:<br />
Rinder-, Pferde- und Schweinemist 40 km<br />
Rinder-, Pferde- und Schweinegülle 20 km<br />
Hühnermist 80 km<br />
Wegen des hohen Energieverbrauchs bei der Trocknung dürfen getrocknete Hofdünger<br />
nicht zugeführt werden. Werden die Hofdünger mit erneuerbarer Energie<br />
oder Abwärme aus Produktionsprozessen getrocknet oder energiesparend hergestellt<br />
(Separierung), kann die Zertifizierungsstelle auf Antrag Ausnahmen zulassen.<br />
3.2 Kompost<br />
3.2.1 Rückstände und Fremdstoffe<br />
a) Zufuhr von Rohmaterial aus nicht-biologischem Anbau zur Kompostierung auf<br />
dem Betrieb:<br />
1 massgebend ist der Nährstoff, der die 50 Prozent Grenze als erster übersteigt.
63 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Für die Kompostierung sind nur natürliches, unbelastetes Grüngut, Haushalt- und<br />
Gartenabfälle, Holzschnitzel oder ähnliches zugelassen.<br />
Die Zertifizierungsstelle kann weitere organische und anorganische Materialien<br />
zulassen, wenn deren Unbedenklichkeit nachgewiesen ist. Dem Kompost zugefügte<br />
Hofdünger müssen die Qualitätsanforderungen für Hofdünger gemäss Punkt 3.1<br />
erfüllen. Hofdünger von Nicht-Biobetrieben werden beim nicht-biologischen Hofdüngeranteil<br />
gemäss Punkt. 3.1.1 angerechnet.<br />
Besteht der Verdacht auf erhöhte Schwermetall-Werte oder Vorhandensein von<br />
GVO, kann die Kontrollstelle eine Rückstandsanalyse verlangen.<br />
b) Zufuhr von Kompost:<br />
Zugeführter Kompost muss die Kriterien bezüglich Rohmaterial aus Abschnitt<br />
3.2.1a) erfüllen und die rechtlich verbindlichen Qualitätskriterien des Instituts für<br />
Umweltschutz und Landwirtschaft (IUL, heute FAL) erfüllen. Die in der Stoffver-<br />
(StoV) festgelegten Ausbringmengen (25 t TS/ha alle 3 Jahre) dürfen nicht<br />
ordnung<br />
überschritten werden.<br />
3.2.2 Distanzlimiten und Energieaufwand<br />
Kompost oder Kompost-Rohmaterial darf aus maximal 80 km Fahrdistanz zugeführt<br />
werden. Bezüglich den Distanzlimiten wird verbrauchtes Champignonsubstrat zum<br />
Kompost gerechnet.<br />
3.3 Handelsdünger<br />
Es dürfen nur Handelsdünger eingesetzt werden, die in der Hilfsstoffliste des FiBL<br />
aufgeführt sind. Für die Aufnahme von Handelsdüngern in die Hilfsstoffliste gelten<br />
folgende Kriterien: Richtlinien Art. 2.1.4 und 2.1.5 sowie Anhang 2 der Verordnung<br />
des EVD über die biologische Landwirtschaft.<br />
Zusätzliche Kriterien für die Aufnahme von Düngern in die Hilfsstoffliste:<br />
Düngergruppe<br />
Aufnahmekriterien<br />
A) Dünger aus Mist und Gülle Getrocknete Hofdünger sind nicht zugelassen.<br />
Im Ausnahmefall können getrocknete<br />
Hofdünger zugelassen werden, sofern<br />
diese alle Bedingungen gemäss Punkt 3.1<br />
dieser Weisung erfüllen.<br />
B) Dünger aus rein mechanisch aufbereiteten<br />
pflanzlichen Rohstoffen nicht vorhanden, aus konventionellem<br />
Erste Wahl aus biologischem Anbau, falls<br />
(Leguminosenmehle, Trester, Algen, Anbau.<br />
usw. )<br />
Nachweis der GVO-Freiheit bei kritischen<br />
Kulturen (Zulassung von GVO-Sorten der<br />
entsprechenden Kultur)<br />
Herkunft Europa und Mittelmeerraum;<br />
Herkunft Übersee nur im Ausnahmefall,<br />
wenn nachweislich kein gleichwertiges<br />
C) Dünger aus pflanzlichen Abfallprodukten<br />
(Filterkuchen von Ölfrüchten, Vinasse,<br />
Melasse, Schlempe und Schlempeextrakt,<br />
etc.)<br />
Produkt in Europa verfügbar ist.<br />
gleiche Kriterien wie unter B)<br />
zusätzlich Analyse von Verarbeitungsrückständen<br />
(Extraktionsmittel, Schmierstoffe,<br />
usw.)<br />
D) Nebenprodukte tierischen Ursprungs Erste Wahl aus biologischer Produktion,<br />
(Federmehl, Hornmehl, usw.)<br />
falls nicht vorhanden Zweite Wahl aus<br />
Label-Produktion und erst in dritter Wahl<br />
aus konventionellem Landbau.<br />
In der Schweiz nicht zugelassene Haltungssysteme<br />
müssen möglichst ausge-
64 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Düngergruppe<br />
E) mineralische Dünger<br />
(Rohphosphat, Kalisulfat, Kalimagnesia,<br />
usw.)<br />
Aufnahmekriterien<br />
schlossen werden (Käfighaltung usw.)<br />
Verbot von BSE-Risikobestandteilen<br />
Analyse von Verarbeitungsrückständen<br />
(Extraktionsmittel, Schmierstoffe usw.)<br />
Herkunft Europa und Mittelmeerraum;<br />
Herkunft Übersee nur im Ausnahmefall,<br />
wenn nachweislich kein gleichwertiges<br />
Produkt in Europa verfügbar ist.<br />
nur mechanisch-thermische Aufbereitung<br />
Herkunft Europa und Mittelmeerraum;<br />
Herkunft Übersee nur im Ausnahmefall,<br />
wenn nachweislich kein gleichwertiges<br />
Produkt in Europa verfügbar ist.<br />
Chemisch-synthetisch hergestellte Chelate<br />
sind verboten.<br />
4 ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN FÜR EINZELNE<br />
NÄHRSTOFFE<br />
4.1 Stickstoff<br />
Vo n den zugelassenen N-Düngemitteln werden folgende Anteile verfügbaren Stick-<br />
stoffs für die Bilanzierung angerechnet:<br />
Für die Berechnung des pflanzenbaulich wirksamen Stickstoffes in den Hofdüngern<br />
gelten die Vorgaben der Suisse-Bilanz.<br />
Vom Stickstoff aus organischen Handelsdüngern werden 70 Prozent als verfügbar<br />
angerechnet. Bei Grünabfallkompost werden 10 Prozent des Gesamtstickstoffes als<br />
verfügbar angerechnet, Mistkompost und Champignonkompost werden bezüglich<br />
N-Verfügbarkeit wie Stapelmist behandelt.<br />
4.2 Phosphor<br />
Die Düngung von Phosphor hat im Rahmen des Bedarfs nach der Suisse-Bilanz zu<br />
erfolgen. Eine Phosphordüngung in Form von Kompost oder Ricokalk darf in der<br />
Bilanz auf maximal drei Jahre verteilt werden.<br />
4.3 Kalium und Magnesium<br />
Für die Düngung von Kalimagnesia, Kalisulfat oder Magnesia-Kainit muss eine<br />
aktuelle Bodenprobe (nicht älter als 4 Jahre) eines anerkannten Labors vorliegen. In<br />
der Versorgungsstufe A darf maximal 75 Prozent, in B 50 Prozent und in C 25 Prozent<br />
des Pflanzenbedarfes mit den obigen Düngern gestreut werden.<br />
4.4 Spurenelemente<br />
4.4.1 Definition<br />
Für<br />
Spurenelementdünger und andere Dünger mit wasserlöslichen Salzen aus Bor,<br />
Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän und Zink, sowie für Ca- und Mg-Blattdünger<br />
gelten die nachfolgenden Regelungen:<br />
4.4.2 Einsatz
65 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Hofdüngerzufuhr<br />
Bis spätestens 31.12.2004 darf der Anteil zugeführter Hofdünger aus Nicht-<br />
Biobetrieben mehr als 50 Prozent des Bedarfes betragen, wenn bestehende Abnah-<br />
dazu verpflichten oder nicht genügend Hofdünger von Biobetrieben<br />
meverträge<br />
verfügbar ist.<br />
Abnahmeverpflichtungen mit Betrieben, welche keine der Anforderungen unter<br />
Punkt. 3.1.1 erfüllen, dürfen noch höchstens bis zum 31.12.2004 weitergeführt wer-<br />
den.<br />
Spurennährstoffe und leichtlösliche Blattdünger dürfen nur eingesetzt werden, wenn<br />
der Nährstoffbedarf der Pflanzen nicht auf andere Weise, d.h. durch Fruchtfolge,<br />
<strong>Stand</strong>ortwahl und Düngung mit organischen Düngemitteln sichergestellt werden<br />
kann.<br />
In diesem Fall dürfen unter den folgenden Bedingungen Spurennährstoffe und Blatt-<br />
• Der Bedarf muss nachgewiesen werden. Als Bedarfsnachweis gelten Boden-,<br />
dünger eingesetzt werden:<br />
Pflanzenanalysen oder sichtbare Mangelerscheinungen an den Kulturpflanzen<br />
• Ein Kontrollfenster ohne Behandlung muss ausgeschieden werden<br />
• Die Wirkung des Einsatzes muss dokumentiert sein<br />
4.4.3 Meldepflicht<br />
Der Einsatz von Spurennährstoffen und Blattdüngern muss bei der zuständigen<br />
Kontrollstelle vor dem Einsatz gemeldet werden. Die folgenden Angaben müssen<br />
dabei gemacht werden:<br />
• Name und Adresse des Betriebes<br />
• Kultur<br />
• Parzellenbezeichnung<br />
• Bedarfsnachweis<br />
• Welches Produkt soll in welcher Aufwandmenge eingesetzt werden<br />
• Art der Erfolgskontrolle<br />
Bei<br />
der Kontrollstelle kann ein spezielles Formular für die Meldung des Einsatzes<br />
vo n Spurennährstoffen und Blattdüngern bestellt werden.<br />
5 VERMEIDUNG VON NÄHRSTOFFVERLUSTEN<br />
4.4.4 Produkte<br />
Di e Spurennährstoffe und Blattdünger, die im Biolandbau unter den obengenannten<br />
Voraussetzungen und Auflagen eingesetzt werden dürfen, sind in der FiBL-<br />
Hilfsstoffliste aufgeführt.<br />
Bei der Lagerung von Hofdüngern, Kompost, Erden und Substraten im Freien sind<br />
geeignete Massnahmen vorzusehen, zur Vermeidung von Nährstoffauswaschung<br />
und –verlusten (Abdeckung usw.)<br />
Rasch wirksame Dünger (Gülle, Vinasse, usw.) müssen so eingesetzt werden, dass<br />
möglichst keine Verluste entstehen resp. in den Untergrund gelangen.<br />
6 ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN<br />
Nährstoffbilanz<br />
Die Zertifizierungsstelle kann Übergangsfristen festlegen für Betriebe, welche bisher<br />
keine Nährstoffbilanz rechnen mussten, wenn es auf Grund dieser Neuregelung<br />
zu Härtefällen kommt.
66 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Handelsdünger<br />
Bisher zugelassene Handelsdünger, welche die Zusatzkriterien gemäss Punkt. 3.3<br />
nicht erfüllen, dürfen noch bis spätestens 31.12.2004 eingesetzt werden.
67 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 4.1.1 ff<br />
Neulandantritt<br />
Weisung der PAK vom 21.11.1995 / angepasst am 13.7.1999, von der MKA am<br />
24.5.2002<br />
1. EINLEITUNG<br />
Diese Weisung regelt den Neuantritt von Land, das nicht mindestens nach Schweizer<br />
Bio-Verordnung bewirtschaftet wurde.<br />
2. STATUS DES BETRIEBES UND DEKLARATION DER<br />
PRODUKTE<br />
Der Neuantritt von Land, das bisher nicht-biologisch bewirtschaftet worden ist, hat<br />
grundsätzlich keinen Einfluss auf den Anerkennungsstatus eines Vollknospe-<br />
Betriebes. Die Produkte der Umstellungsflächen müssen jedoch immer als Umstellungsprodukte<br />
deklariert und auf dem Kontrollausweis entsprechend vermerkt werden.<br />
Bei Parallelproduktion gleicher Kulturen (auf Bio- und Umstellungsflächen), die<br />
äusserlich nicht eindeutig unterscheidbar sind, ist die gesamte Produktionsmenge als<br />
Umstellungsware zu deklarieren.<br />
3. AUFZEICHNUNGSPFLICHT<br />
Für Flächen, die in der offiziellen Betriebsdatenerhebung Anfang Mai registriert<br />
sind, ist das laufende Jahr erstes Umstellungsjahr. Aufzeichnungen und Pläne müssen<br />
ab Antritt des Landes vorhanden sein.<br />
4. AUSNAHMEN<br />
Für mehrjährige Kulturen ist eine Parallelproduktion (Umstell- und Vollknospe)<br />
grundsätzlich möglich, wenn Warenfluss und Rückverfolgbarkeit gewährleistet sind<br />
und vorgängig eine Bewilligung der Zertifizierungsstelle eingeholt worden ist.<br />
5. ANERKENNUNGSSTATUS DER PRODUKTE<br />
Neulandantritt im Laufe des Jahres:<br />
Fall1: Antritt von Grünland, Brachland, Grünbrache usw.<br />
Antritt bis 30. April:<br />
Raufutterertrag gilt als Umstellfutter<br />
Antritt ab 1. Mai: Raufutterertrag gilt als konventioneller Futterzukauf;<br />
Fläche darf nicht zur LN gezählt werden<br />
Fall 2: Anbau von Acker und/oder Spezialkulturen auf dem neu übernommenen<br />
Land, wobei die Aussaat der Kultur und die gesamte Feldbestellung im Kalenderjahr<br />
durch den Biobauern erfolgt.
68 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Antritt bis 30. April:<br />
Antritt ab 1. Mai:<br />
Vermarktung der Ernte unter der Umstellknospe.<br />
Wird dieselbe Kultur auch auf Vollknospe-Fläche<br />
angebaut, so muss die gesamte Ernte unter der<br />
Umstellknospe vermarktet werden (Verbot der Parallelproduktion).<br />
Ernteprodukte müssen konventionell vermarktet<br />
werden; Fläche darf nicht zur LN gezählt werden.<br />
Fall 3: Anbau von Acker- und/oder Spezialkulturen auf dem neu übernommenen<br />
Land, wobei die Aussaat bereits durch den konventionellen Vorgänger erfolgt<br />
ist.<br />
Antritt bis 30. April:<br />
Antritt ab 1. Mai:<br />
Fall 4: Übernahme von Gewächshäusern<br />
Konventionelle Vermarktung der Ernte.<br />
Ernteprodukte müssen konventionell vermarktet<br />
werden; Fläche darf nicht zur LN gezählt werden.<br />
Bodenabhängige Kulturen werden analog zu Spezialkulturen behandelt (Punkte 2<br />
und 3).<br />
Bodenunabhängige Kulturen (Topfkulturen): Für die Vermarktung gilt in jedem<br />
Fall der Status des Betriebes (analog Zupacht eines Stalles).
69 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art 2.5ff<br />
Weisung der PAK vom 31.1.1996, angepasst von der MKA am 20. 3. 2002<br />
1 EINLEITUNG<br />
In den Richtlinien der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> ist der Bereich des produzierenden Gartenbaus<br />
nicht geregelt. Diese Weisung legt die allgemeinen Richtlinienanforderungen bezüglich<br />
des produzierenden Gartenbaus aus.<br />
2 GELTUNGSBEREICH<br />
Dieser umfasst sämtliche kultivierten Pflanzen im Topfpflanzen-, Schnittblumen-,<br />
Baumschulen- und Staudenbereich.<br />
3 ERDEN UND SUBSTRATE (RL ART. 2.5.1/2.5.2)<br />
Ein weitgehender Verzicht auf Torf in der Anzucht wird angestrebt. Es gelten folgende<br />
Obergrenzen bezüglich des Torfgehaltes:<br />
maximaler<br />
halt<br />
Torfge-<br />
minimaler<br />
teil<br />
Anzuchtsubstrate 70 % --<br />
Kultursubstrate für Gruppenpflanzen<br />
und Stauden<br />
Kultursubstrate für Topfpflanzen<br />
(inkl. Kräuter)<br />
30 % 20 %<br />
50 % 10 %<br />
Produzierender Gartenbau - Zierpflanzenan-<br />
bau<br />
Kompostan-<br />
Zugekaufte Handelssubstrate müssen von der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> anerkannt sein. Betriebseigene<br />
Rezepturen werden bei der Kontrolle überprüft.<br />
4 DÜNGUNG (RL ART. 2.1.4 - 2.1.6)<br />
Erlaubt sind die in der Hilfsstoffliste des FiBL zugelassenen Düngemittel und Bodenverbesserer.<br />
Flüssige Düngung hat zurückhaltend zu erfolgen, um Nährstoffverluste<br />
zu vermeiden. Bei Topfkulturen ist auf ein zielgerichtetes Verfahren zu achten.<br />
5 PFLANZENSCHUTZ<br />
Im Vordergrund stehen vorbeugende Massnahmen wie eine gute Klimaführung,<br />
ausgewogene Düngung, Förderung der Nützlinge und Wahl geeigneter Sorten. Zugelassene<br />
Pflanzenbehandlungsmittel sind in der Hilfsstoffliste des FiBL aufgeführt.
70 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
6 AUSGANGSMATERIAL / ZUKAUF<br />
Saatgut, Stecklinge, und sonstiges Vermehrungsmaterial muss grundsätzlich aus<br />
biologischem Anbau stammen. Wenn kein biologisch angebautes Ausgangsmaterial<br />
in der gewünschten oder in ähnlicher Qualität erhältlich ist, so kann bei Saatgut und<br />
vegetativem Vermehrungsmaterial 1 bis zum 31.12.2003 von dieser Regelung abgewichen<br />
werden. Die Übergangsregelungen werden jährlich von der MKA festgelegt<br />
und im Merkblatt "Saatgut, Pflanzgut und vegetatives vermehrungsmaterial" festgehalten.<br />
Nicht-biologisches Saatgut muss in ungebeizter Qualität eingesetzt werden.<br />
Pflanzgut 2 (Jungpflanzen) muss zwingend aus biologischer Anzucht stammen.<br />
Pflanzgut von Küchenkräutern muss – weil diese für den menschlichen Verzehr<br />
bestimmt sind – gemäss den Anforderungen der Weisung «Jungpflanzen im Gemüse<br />
und Kräuteranbau» produziert werden.<br />
Für die Zwiebeltreiberei (Tulpen, Narzissen usw.) ist biologisches Ausgangsmaterial<br />
zwingend.<br />
Halbfertigware muss aus biologischem Anbau stammen, um nach Fertigkultivierung<br />
mit der Knospe vermarktet werden zu können.<br />
7 ANZUCHTLOKALE<br />
Im Winter (1.12. bis 28.2.) dürfen die Kulturflächen lediglich frostfrei (ca. 5°C)<br />
gehalten werden. Von dieser Regelung kann in folgenden Fällen abgewichen werden.<br />
a) Bei der Jungpflanzenanzucht;<br />
b) bei Gewächshäusern mit besonders umweltverträglichen Heizungstypen (z.B.<br />
Wärmekraft Koppelungssysteme, Wärmewechselpumpen, Biogas-Heizungen)<br />
oder mit bestmöglicher Isolation der Gebäudehülle. Im Minimum darf die Gebäudehülle<br />
den mittleren K-Wert von 2,4 W/m 2 K nicht übersteigen. Bei Sanierungen<br />
müssen besonders umweltverträgliche Heizungstypen und bestmögliche<br />
Isolationen gewählt werden.<br />
Diese Ausnahmeregelung gilt ausschliesslich für den produzierenden Gartanbau<br />
(Zierpflanzen) und nicht für den Gemüse- und Kräteranbau!<br />
Die generelle obere Heiztemperatur im Winter beträgt 18°C. Ausgenommen davon<br />
sind Keimräume und Pflanzensammlungen, die schulischen Zwecken dienen.<br />
8 ASSIMILATIONSBELEUCHTUNG<br />
Ausser bei der Jungpflanzenanzucht ist Assimilationsbeleuchtung verboten. Jungpflanzen<br />
im Sinne dieses Artikels sind Jungpflanzen für die Anpflanzung zum Zwecke<br />
der Pflanzenerzeugung.<br />
9 KRÄUTERPRODUKTION IN TÖPFEN<br />
Definition: Bodenunanbhängige Kulturen von Heil- und Küchenkräutern sind für<br />
den Verzehr bestimmte, in Behältern angebaute Kulturen, die zusammen mit dem<br />
Behälter verkauft und vermarktet werden. Dabei gelten folgende Präzisierungen,<br />
resp. Abweichungen von den Anforderungen an den biologischen Gemüsebau<br />
1 Definition «vegetatives Vermehrungsmaterial»: Pflanzenteile, die zu selbständigen Individuen<br />
heranwachsen, wie beispielsweise Stecklinge, bewurzelte Stecklinge usw.<br />
2 Definition «Pflanzgut» (bisher: Jungpflanze): Pflanzen, die aus Samen gezogen werden.
71 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
• Der Anbau von bodenunabhängigen Kulturen von Heil- und Küchenkräutern für<br />
den Schnitt von Bundware ist untersagt.<br />
• Die Anzuchtlokale dürfen ausserhalb der Vegetationsperiode (1.12. -1.3.) nur<br />
frostfrei (max. 5 Grad C.)) gehalten werden. Assimilationsbeleuchtung ist nur<br />
während des Jungpflanzenstadiums erlaubt.<br />
• Beheizung der Gewächshäuser ausserhalb der Vegetationsperiode ist nur während<br />
des Jungpflanzenstadiums erlaubt. Das Jungpflanzenstadium einer Topfkultur,<br />
beträgt gemäss Definition maximal die Hälfte der Zeitperiode von der Saat<br />
bis zum Verkaufszeitpunkt und darf zudem 5 Wochen nicht überschreiten. Beispiel:<br />
für eine Topfkultur Basilikum verlaufen von der Saat bis zum Verkauf 10<br />
Wochen. Während den ersten 5 Wochen ist die Pflanze eine Jungpflanze.<br />
• Der Verkauf von in Töpfen angebauten Kräutern als Bund- oder Schnittware ist<br />
untersagt.<br />
10 ANBAU VON SCHNITTBLUMEN IN TÖPFEN<br />
Der bodenunabhängige Anbau (Anbau in Behältern) von Schnittblumen für den<br />
Verkauf auch ohne Behälter, ist erlaubt.<br />
Hinweis:<br />
Anbieter von Biopflanzen und -blumen beachten das «Merkblatt für den Verkauf<br />
von Biopflanzen und Bioblumen mit der Knospe» der MKV.
72 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.3.1 ff<br />
Schafhaltung - Milch und Fleisch<br />
Weisung der PAK vom 13.5.1997<br />
1 STALLMASSE<br />
Mindestflächenmasse im Stall in m 2 pro Tier:<br />
Fleischschaf<br />
Milchschaf<br />
Ablammbucht Laufstall 2.5 2.5<br />
Aue ohne Lämmer 1.0 1.2<br />
Aue mit Lämmern 1.5 2.0<br />
abgesetzte Lämmer 0.6 0.6<br />
Bock 3 3<br />
2 FÜTTERUNG<br />
Gemäss Art. 3.3.4 der Richtlinien ist der Einsatz von Milchpulver auch in der<br />
Schafhaltung verboten.<br />
Beim Tod des Muttertieres, bei schwerer Erkrankung des Muttertieres und bei Drillingsgeburten<br />
(nur für das überzählige Lamm) dürfen in Abweichung von Art. 3.3.4<br />
bis zum Alter von drei Monaten maximal 10 kg Milchpulver je Lamm eingesetzt<br />
werden. Das Milchpulver darf keine gemäss Art. 3.1.9 verbotenen Zusätze enthalten.<br />
3 TIERMEDIZIN<br />
Die Behandlung der Räude oder anderer Ektoparasiten darf nur bei klaren Anzeichen<br />
und in Absprache mit dem Tierarzt erfolgen. Natürliche, nicht chemischsynthetische<br />
Mittel sind zu bevorzugen. Vor dem Alpauftrieb dürfen die behördlich<br />
vorgeschriebenen Mittel angewendet werden.<br />
4 ZOOTECHNISCHE MASSNAHMEN<br />
Das gemäss Art. 3.1.12 ausnahmsweise erlaubte Kupieren der Schwänze muss im<br />
Stalljournal zu Handen der Kontrolle dokumentiert werden.
73 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 4.2.1 ff<br />
Schrittweise Umstellung im Pflanzenbau<br />
Weisung der PAK vom 22.11.1995 / angepasst am 18.12.2000<br />
1 EINLEITUNG<br />
Gemäss den Richtlinien der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> muss grundsätzlich der gesamte Betrieb<br />
bzw. die gesamte Betriebsfläche auf biologischen Anbau umgestellt werden. Zu<br />
beachten sind Artikel 4.1.1 bis 4.1.3 der Richtlinien der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>.<br />
Auch in Zukunft soll weiter am Grundsatz der gesamtbetrieblichen Umstellung<br />
festgehalten werden. Auf Betrieben mit Wein-, Obst- oder Zierpflanzenanbau können<br />
bei der gleichzeitigen Umstellung aller Flächen sehr grosse Schwierigkeiten in<br />
der Produktionstechnik und der Vermarktung auftreten, die nur schwer lösbar sind.<br />
Aus diesem Grund kann die MKA für solche Betriebe eine schrittweise Umstellung<br />
bewilligen. Gemäss Art. 9 der BioV muss die schrittweise Umstellung auch vom<br />
BLW zugelassen werden.<br />
Die folgende Weisung stützt sich auf Artikel 4.2.1 bis 4.2.4 der Richtlinien der <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong>.<br />
2 ZWECK DER SCHRITTWEISEN UMSTELLUNG (RL<br />
ART. 4.2.1)<br />
Die Umstellung in Teilschritten (=schrittweise Umstellung) ist ein Instrument, um<br />
das umstellungsbedingte Risiko auf ein für den Betrieb verkraftbares Mass zu reduzieren,<br />
ohne dabei die Prinzipien der Glaubwürdigkeit und der Kontrollierbarkeit zu<br />
verletzen. In Frage kommen in der Regel Betriebe mit bedeutenden Anteilen an<br />
Wein-, Obst- oder Zierpflanzenanbau.<br />
3 UMSTELLUNGSPLAN<br />
Zum Umstellungsplan gehören die folgenden detaillierten und jährlich zu aktualisierenden<br />
Dokumentationen vom gesamten Betrieb:<br />
• Beratungsbericht des Bioberaters (die unter Punkt drei geforderten Angaben<br />
können in diesen Bericht integriert sein);<br />
• bisherige Bewirtschaftung (Kulturen, Fruchtfolge, Hilfsstoffeinsatz, IP-<br />
Programm usw.);<br />
• Zeitplan (welche Flächen, Kulturen, werden in welchem Jahr umgestellt);<br />
• Betriebsnachweis gemäss eidgenössischer Begriffsverordnung und Weisung<br />
«Betriebsdefinition für Knospe-Betriebe»;<br />
• Beschreibung der Produktions- und Lagerstätten;<br />
• Inventar der Maschinen und Applikationsgeräte, Lagerung der Hilfsstoffe (für<br />
die Bio-Parzellen müssen separate Applikationsgeräte und Hilfsstofflager vorhanden<br />
sein);<br />
• Parzellenpläne mit folgenden Angaben: angebaute Kultur, Sorte, Bewirtschaftungsweise,<br />
Fläche, Exposition und Hauptwindrichtung;<br />
• Produktionstechnik und Hilfsstoffeinsatz;<br />
• vorgesehene Vermarktung und Deklaration.
74 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
4 NOCH NICHT <strong>BIO</strong>LOGISCH BEWIRTSCHAFTETE<br />
FLÄCHEN<br />
Auf noch nicht biologisch bewirtschafteten Flächen gelten bezüglich Pflanzenschutz,<br />
Düngung und Unkrautregulierung die betriebsspezifischen Auflagen der<br />
MKA. Dabei gilt der Grundsatz: So rasch wie möglich, so biologisch wie möglich.<br />
Die Flächen müssen IP-kontrolliert sein.<br />
5 ABDRIFT<br />
Der Betriebsleiter ist verantwortlich, dass aus Flächen, die noch nicht biologisch<br />
bewirtschaftet werden, jegliche Abdrift verhindert wird.<br />
6 AUFZEICHNUNGEN<br />
Über die Kulturführung (Dünger-, Pflanzenschutzmitteleinsatz usw.), die Erträge<br />
und die Abnehmer sind genaue und lückenlose Aufzeichnungen zu machen. Dies<br />
gilt sowohl für die biologisch, als auch für die noch nicht biologisch bewirtschafteten<br />
Flächen.<br />
7 KONTROLLE<br />
Betriebe in schrittweiser Umstellung werden pro Jahr mindestens zweimal kontrolliert.<br />
Auch die noch nicht biologisch bewirtschafteten Flächen, Lagereinheiten usw.<br />
werden kontrolliert. Die Deklaration aller verkauften Produkte und Verkaufsstandorte<br />
ist bei der Kontrolle nachvollziehbar darzustellen. Bis die gesamtbetriebliche<br />
Umstellung vollzogen ist, wird zulasten des Betriebes von Knospe-Produkten jährlich<br />
eine Stichprobe von Blättern, Früchten oder Boden zur Rückstandsanalyse entnommen.<br />
Die Kosten setzen sich zusammen aus dem ordentlichen Kontrollbeitrag,<br />
einem zusätzlichen Beitrag für Betriebe in schrittweiser Umstellung und den Kosten<br />
für die Rückstandsanalyse.<br />
8 VORGEHEN FÜR DIE PRODUZENTEN, DIE IHREN<br />
BETRIEB SCHRITTWEISE UMSTELLEN WOLLEN<br />
1. Die in der Weisung geforderten Unterlagen (siehe RL Art. 4.2.2 Absatz 1) sind<br />
unter Mithilfe des Bioberaters zusammenzustellen.<br />
2. Alle Unterlagen sind der MKA zur Beurteilung termingerecht einzureichen (bis<br />
Ablauf der Anmeldefrist).<br />
3. Beurteilung der Unterlagen durch die MKA. Die MKA definiert die betriebsspezifischen<br />
Auflagen für Düngung, Pflanzenschutz und Unkrautregulierung (RL<br />
Art. 4.2.2 Abschnitt 2).<br />
4. Die Anerkennung als Umstellungsbetrieb erfolgt erst auf Grund des ersten Kontrollberichtes<br />
durch die Zertfizierungsstelle.
75 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.5.1 ff<br />
Schweinehaltung<br />
Weisung der PAK vom 13.5.1997 / angepasst von der MKA am 28.11.2000<br />
1 BUCHTENGRÖSSE<br />
Mindestliegeflächen für Buchten ohne separaten Kot- und Fressplatz:<br />
Ferkel (Jager) bis 25 kg<br />
Schweine 25 bis 60 kg<br />
Schweine 60 bis 110 kg<br />
0.4 m 2 pro Tier<br />
0.6 m 2 pro Tier<br />
1.1 m 2 pro Tier<br />
Mindestliegeflächen bei Buchten mit getrenntem Kot- und Fressplatz:<br />
Schweine bis 100 kg<br />
Galtsauen<br />
Eber<br />
0.6 m 2 pro Tier<br />
1.5 m 2 pro Tier<br />
6 m 2 pro Tier<br />
Reduktion der Liegefläche in Mehrflächenbuchten<br />
Eine proportionale Verkleinerung der Liegefläche relativ zum Gewicht der Schweine<br />
ist bei Mehrflächenbuchten (Zwei- und Dreiflächenbuchten) mit linear verstellbarer<br />
Liegeplatzfläche und getrenntem Liege-, Kot - und Fressplatz zulässig. Wichtig<br />
ist, dass den 100 kg schweren Schweinen, wie in der Weisung verlangt, effektiv<br />
auch 0.6 m 2 eingestreute Liegefläche zur Verfügung stehen.<br />
Reduktion der Liegeflächen in Nürdingerkisten<br />
Beim Einsatz von Nürdingerkisten ist eine Verkleinerung der darin enthaltenen<br />
Liegeflächen auf 1.1 m 2 möglich, sofern ausserhalb der Kiste weitere Liegeflächen<br />
existieren, wie dies bei der Installation von Nürdingerkisten der Fall ist. Alle<br />
Liegeflächen zusammen dürfen die oben festgeschriebene Mindestfläche von 1.5 m 2<br />
nicht unterschreiten.<br />
2 AUSLAUF (MINDESTFLÄCHEN)<br />
Eber<br />
Galtsauen<br />
Zuchtsauen mit Ferkeln<br />
Zuchtsauen mit Ferkeln in Gruppen ab 3<br />
Muttersauen<br />
Abgesetzte Ferkel<br />
Remonten und Mastschweine bis 60 kg<br />
LG<br />
Remonten und Mastschweine über 60<br />
kg LG<br />
Zuchtschweine/mitlaufende Eber<br />
4 m 2 pro Tier<br />
1.3 m 2 pro Tier<br />
6 m 2 pro Muttersau<br />
4 m 2 pro Muttersau<br />
0.3 m 2 pro Tier<br />
0.45 m 2 pro Tier<br />
0.65 m 2 pro Tier<br />
1.3 m 2 pro Tier<br />
Es darf jeweils maximal 50 % der Auslauffläche überdacht sein. Bei Offenfrontställen<br />
kann die eingestreute und überdachte Fläche zu 50 % an den Auslauf angerechnet<br />
werden.
76 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.11.1 ff<br />
Speisefischproduktion<br />
Weisung MKA vom 25.7.2000, angepasst am 13.8.2002<br />
1 ALLGEMEINE REGELUNGEN<br />
1.1 Vermehrung/Zucht<br />
a) Zugekaufte Jungfische und Eier müssen von Biobetrieben stammen. Jungfische<br />
müssen entweder in der Schweiz oder in direkten Nachbarländern produziert<br />
worden sein. Bis 31.12.2005 ist der Zukauf konventioneller Jungfische und Eier<br />
möglich. In diesem Fall muss vom Lieferanten eine Bestätigung vorliegen, dass<br />
die Jungfische den Bio-Anforderungen entsprechen (siehe Vorlage).<br />
b) Die Fische müssen mindestens die letzten 2/3 ihres Lebens auf dem Biobetrieb<br />
verbracht haben, damit sie mit der Vollknospe verkauft werden können.<br />
c) Warmbruthäuser (es muss ein Energiekonzept vorlegt werden, welches die wirtschaftlich<br />
tragbaren Sparmöglichkeiten und Möglichkeiten zum Einsatz erneuerbarer<br />
Energien vorsieht; geschlossene Wasserzyklen), kontrollierte Erbrütung<br />
und Anfütterung der Brut sind erlaubt.<br />
d) Die zugelassenen Betäubungsmittel für das Abstreifen sind in der „Hilfsstoffliste<br />
für die Fischzucht“ von FiBL und <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> aufgeführt.<br />
1.2 Teich/Anlage<br />
a) Die Anlage muss täglich betreut werden.<br />
b) Der Teich/die Anlage muss gegen Entkommen bzw. Einwandern von Fremdfischen<br />
gesichert sein, insbesondere bei nicht heimischen Fischarten (z.B. Regenbogenforelle).<br />
c) Fischzuchtbetriebe müssen analog zu Landwirtschaftsbetrieben 7% der Betriebsfläche<br />
als ökologische Ausgleichsflächen ausweisen (vgl. Art. 2.8.1 der <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong> Richtlinien). Als Betriebsfläche gilt die Fläche der gesamten Fischzuchtanlage<br />
abzüglich Gebäude, Strassen und Waldflächen. Bevorzugt sollten<br />
aquatische Ausgleichsflächen (z.B. Feuchtgebiete, Röhrichte, Froschtümpel) geschaffen<br />
werden. Netzgehegebetriebe im offenen Wasser sind von dieser Auflage<br />
ausgenommen.<br />
d) Der Teich/die Anlage muss mit Rückzugsmöglichkeiten und Unterständen ausgestattet<br />
sein und artgerechtes Verhalten der Fische (Schwarmbildung, Territorialverhalten)<br />
begünstigen. Becken können z.B. durch ins Wasser gehängte Blenden<br />
(können zur Reinigung leicht enfernt werden) strukturiert werden. Die Anforderungen<br />
an die Strukturierung der Teiche/Becken können aufgrund neuer e-<br />
thologischer Erkenntnisse weiter verschärft werden.<br />
e) Wird für die Teichbewirtschaftung Wasser aus einem Bach entnommen, müssen<br />
die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Restwassermengen eingehalten werden.<br />
Der Bach muss fischpassierbar bleiben bzw. bei Neubauten passierbar gemacht<br />
werden.<br />
1.3 Wasserqualität<br />
a) Zulauf: Der Zulauf darf nicht oder nur gering anthropogen belastet sein. In Zweifelsfällen,<br />
z.B. wenn der Zulauf aus landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten<br />
stammt, ist die Unbedenklichkeit mit Wasserproben nachzuweisen. In diesen<br />
Fällen muss die Wasserprobe die Parameter gemäss GSchV (Anhang 2, Anforde-
77 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
rungen an die Wasserqualität) plus Nitrit und Chlorid umfassen. Die MKA kann<br />
weitere Anforderungen an die Wasserqualität im Zulauf festlegen.<br />
b) Auslauf: Die Gewässergüte im Auslauf muss den Anforderungen der kantonalen<br />
und eidgenössischen 1 Gewässerschutzvorschriften genügen. Dazu muss ein gültiges<br />
Gewässerschutzattest des Kantons vorliegen. Gegebenenfalls müssen die<br />
Schwebestoffe in einem Absetzbecken aufgefangen werden.<br />
c) Anlage/Teiche: Temperatur, pH, Sauerstoff- und Ammoniakgehalt des Wassers<br />
müssen den artspezifischen Bedürfnissen der Fische entsprechen (Richtwerte für<br />
Forellen: Temperatur max. 16°C, pH zwischen 7 und 8, Sauerstoff mind. 6mg<br />
O 2 /l, Ammoniak max. 0.6 mg/l). Die Werte sind in regelmässigen, den Gegebenheiten<br />
angepassten Zeitabständen (mindestens einmal monatlich) und zu den<br />
sensiblen Tageszeiten zu messen. Dies gilt grundsätzlich für jeden einzelnen<br />
Teich oder einzelne Becken, falls nicht anlässlich der Erstkontrolle etwas anderes<br />
festgelegt wurde (z.B. genügt bei direkt zusammenhängenden Becken eine<br />
Analyse im letzten Becken).<br />
d) Zur Sauerstoffanreicherung des Einlaufs oder der Teiche/Becken sind folgende<br />
Massnahmen erlaubt: Kaskaden, Siebtürme, Wasserräder, Springbrunnen, Umwälzpumpen.<br />
Eine künstliche Belüftung der Anlage mit Flüssig-O 2 ist jedoch<br />
nicht zulässig und darf nur vorübergehend und in Ausnahmefällen bei extremer<br />
Witterung (Meldepflicht an die Zertifizierungsstelle), zu Transportzwecken oder<br />
bei der Aufzucht von Jungfischen in Bruthäusern durchgeführt werden.<br />
e) Sedimentierte Futterreste oder Fäkalien müssen selber verwertet oder an einen<br />
anderen Biobetrieb innerhalb 20 km Distanz abgegeben werden (wenn nicht von<br />
Gesetzes wegen eine anderweitige Verwertung vorgeschrieben wird). Falls sich<br />
innerhalb dieser Distanz kein biologischer Abnahmebetrieb findet, können die<br />
anfallenden Stoffe mit Bewilligung der Zertifizierungsstelle auch an einen nichtbiologischen<br />
Landwirtschaftsbetrieb oder einen weiter entfernten Biobetrieb abgegeben<br />
werden.<br />
1.4 Futter<br />
Es ist Knospe- oder Hilfsstoffknospe-zertifiziertes Futter einzusetzen.<br />
1.5 Hygiene und Gesundheit<br />
a) Für die Reinigung sind biologische und mechanisch-physikalische Verfahren<br />
(Hochdruckreinigung) vorzuziehen. Zur Desinfektion der Teiche/Becken darf<br />
Branntkalk (nur auf dem trockenen Teichboden) eingesetzt werden. Der Einsatz<br />
von Chlorkalk ist ausdrücklich verboten.<br />
b) Die zugelassenen Mittel für die Desinfektion von Behältnissen und Geräten<br />
sowie zur Selbstbehandlung der Fische sind in der „Hilfsstoffliste für die Fischzucht“<br />
von FiBL und <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> aufgeführt. Behandlungen mit nicht aufgeführten<br />
Mitteln dürfen nur in Absprache mit einem auf Fischwirtschaft spezialisierten<br />
Tierarzt, dem FIWI (Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität<br />
Bern) oder dem Fischgesundheitsdienst FGD des Verbandes Schweizerischer<br />
Fischzüchter vorgenommen werden (vgl. dazu auch Art. 3.1.11 der Richtlinien).<br />
Zur Reduktion der eingesetzten Medikamente-Menge sollte die Behandlung<br />
wenn immer möglich (d.h. wenn die nötigen Handlingmassnahmen für die<br />
Fische zumutbar sind und wenn eine isolierte Behandlung überhaupt sinnvoll<br />
und durchführbar ist) isoliert, in einem kleineren Becken erfolgen.<br />
c) Nach dem Einsatz von chemotherapeutischen Behandlungsmitteln sind folgende<br />
Wartefristen bis zur Knospe-Vermarktung der Fische einzuhalten: Bei den eingesetzten<br />
Wirkstoffen ist die in Tagesgraden angegebene Wartezeit zu verdoppeln.<br />
Ist keine Wartezeit angeführt, gilt eine generelle Wartefrist für alle eingesetzten<br />
Mittel von 1'000 Tagesgraden (das heisst bei einer Wassertemperatur von 10°C<br />
100 Tage und bei 15°C 66 Tage). Ist nur eine Wartezeit für Warmblütler ange-<br />
1 GSchV, Anhang 3.3, Anforderungen an Fischzuchanlagen
78 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
geben, so ist diese mit 36 (°C) zu multiplizieren, um auf die Wartezeit in Tagesgraden<br />
zu kommen. Bei Vermarktung innerhalb dieser Wartefristen müssen die<br />
Fische deutlich als konventionell ("nicht-biologisch aufgezogen") gekennzeichnet<br />
werden.<br />
d) Tote Fische müssen dem Teich/der Anlage unverzüglich entnommen werden.<br />
1.6 Haltung<br />
a) Sortier- und Handlingmassnahmen sowie die Verweildauer der Fische ausserhalb<br />
des Wassers sind auf ein Minimum zu beschränken. Der Einsatz von Sortiermaschinen<br />
ist zugelassen. Die Fische und alle sie berührenden Oberflächen und Geräte<br />
sind stets feucht zu halten.<br />
b) Die Fische müssen die Möglichkeit haben, beschattete Wasserzonen aufzusuchen.<br />
Mindestens 10 % der Wasserfläche jedes einzelnen Teiches/Beckens muss<br />
dauern beschattet sein. Bei grösseren Naturgewässern mit bestocktem Ufer und<br />
bei Teichen, die tiefer als 2 Meter sind, müssen keine zusätzlichen Beschattungsmassnahmen<br />
vorgenommen werden.<br />
c) Die Besatzdichte muss so reguliert werden, dass Gesundheit und artgemässes<br />
Verhalten der Fische nicht beeinträchtigt werden. Quantitative Besatzgrenzen<br />
sind in den (art)spezifischen Regelungen festgelegt (Kapitel 2 dieser Weisung).<br />
d) Eine lange Haltungsdauer der Fische ist von grosser Bedeutung für eine gute<br />
Fleischqualität der Fische und beugt einer zu intensiven Haltung vor. Deshalb ist<br />
in den (art)spezifischen Regelungen auch eine Mindesthaltungsdauer festgelegt.<br />
Diese bezieht sich auf das handelsübliche Schlachtgewicht. Werden unter- oder<br />
übergewichtige Fische vermarktet, ist die Haltungsdauer entsprechend anzupassen.<br />
1.7 Tötung<br />
Die Tötung der Fische hat im Wasser oder unverzüglich nach der Entnahme aus dem<br />
Wasser zu erfolgen. Insbesondere das Erstickenlassen ist verboten. Die Fische müssen<br />
nach der Tötung unverzüglich ausgenommen oder verarbeitet werden.<br />
1.8 Aufzeichnungen/Kontrolle<br />
a) Es ist ein Fischjournal zu führen. Darin sind alle Hygiene-, Behandlungs-, Sortier-<br />
und Handlingmassnahmen, die ermittelten Werte der Gewässergüte sowie<br />
Besatz- bzw. Abgangsdaten einzutragen. Die Angaben zur Besatzdichte müssen<br />
mindestens einmal pro Monat nachgeführt werden. Das Fischjournal muss jederzeit<br />
à jour sein und anlässlich der Kontrolle vorgelegt werden. Aus den Aufzeichnungen<br />
muss insbesondere die Einhaltung der in den artspezifischen Regelungen<br />
(Kap. 2 dieser Weisung) festgelegten maximalen Aufenthaltsdauer in<br />
künstlichen Behältnissen, der maximalen Besatzdiche für jeden Teich und der<br />
Mindesthaltungsdauer hervorgehen.<br />
b) Bei der Erstkontrolle werden die Kubikinhalte der Teiche/Becken und die entsprechenden<br />
Besatzobergrenzen ermittelt und festgehalten.<br />
1.9 Verarbeitung und Vermarktung<br />
a) Die Verarbeitung hat nach den Anforderungen im Kap. 5 der Richtlinien der <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong> und der Weisung „2. Fleisch und Fleischerzeugnisse“ der MKV zur<br />
Verarbeitung nach <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien zu erfolgen. Ebenfalls zu berücksichtigen<br />
sind insbesondere die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> <strong>Weisungen</strong> „Hofverarbeitung und<br />
Zukauf von Bioprodukten“, "Lohnverarbeitung" und „Direktvermarktung“.<br />
Der Einsatz von färben<br />
b) den Futterzusatzstoffen (für sog. "Lachsforellen") muss<br />
beim Verkauf der Fische deklariert werden.
79 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
2 (ART)SPEZIFISCHE REGELUNGEN<br />
2.1 Zucht von carnivoren See-/Meerfischen (Schwarmfische, z.B.<br />
Egli, Seesaibling) in Teichen/Becken und Netzgehegen<br />
a) Netzgehege: In Netzgehegen dürfen nur Arten des betreffenden Gewässers<br />
gehalten werden. Durch regelmässige Kontrollen ist sicherzustellen, dass die<br />
Makrofauna in der Umgebung des Netzgeheges intakt bleibt. Das Netz darf nicht<br />
mit chemisch-synthetische Mitteln imprägniert werden.<br />
b) Maximale Besatzdichte: 20kg/m 3<br />
c) Mindesthaltungsdauer: Egli 6 Monate, Salmoniden 18 Monate<br />
2.2 Zucht von carnivoren Fliessgewässerfischen (Salmoniden; z.B.<br />
Bachforelle, Regenbogenforelle, Flusssaibling) in Teichen/Becken<br />
a) Die Haltung hat wenn möglich in Naturteichen (d.h. zumindest mit vollständig<br />
natürlicher Bodenfläche) zu erfolgen. Die Haltung in künstlichen Behältnissen<br />
(Kunststoff- oder Betonbecken) ist maximal während der halben Lebensdauer<br />
der Fische zugelassen. Die Behältnisse müssen mit Habitatmassnahmen ausgestattet<br />
sein (Rückzugsmöglichkeiten, Fliess- und Totwasserzonen; vgl. dazu auch<br />
Punkt 1.2 d) dieser Weisung).<br />
b)<br />
Maximale Besatzdichte: 20kg/m 3 . In Fliesswasserteichen/-becken kann die Besatzdichte<br />
bis max. 30kg/m 3 erhöht werden, sofern maximal 100 kg Fisch pro<br />
l/sec Zufluss gehalten werden.<br />
c) Mindesthaltungsdauer: Salmoniden 18 Monate (handelsübliches Schlachtgewicht<br />
220 – 350 Gramm)<br />
2.3 Zucht von Cypriniden (Karpfenteichwirtschaft)<br />
a) Die Haltung hat in Naturteichen (inkl. natürliche Uferzonen) zu erfolgen. Lediglich<br />
der Aufenthalt der Brütlinge zur Anfütterung und die Hälterung von Speise-<br />
fischen ist in künstlichen Behältnissen zugelassen.<br />
b) Ein Besatz mit mehreren Fischarten ist anzustreben.<br />
d) Maximale Besatzdichten von Karpfen und Schleien: 3000K1/7000S1 bzw.<br />
600K2/2500S2 bzw. 1500S3 pro ha.<br />
c) Für eine allfällige Düngung ist ausschliesslich organischer Dünger aus biologischem<br />
Landbau zu verwenden. Ausnahmsweise darf auch Steinmehl oder kohle-<br />
saurer Kalk eingesetzt werden.<br />
e) Fütterung: Grundlage des Fischzuwachses ist die Eigenproduktion des Teiches.<br />
Mindestens 50 % des Zuwachses muss über das natürliche Nahrungsangebot erreicht<br />
werden. Für die ergänzende Zufütterung sind ausschliesslich folgende Futtermittel<br />
zugelassen:<br />
- Pflanzliche Knospe-Futtermittel. Bei Nichterhältlichkeit dürfen maximal 10 %<br />
Trockensubstanz (TS) der Gesamtration nicht-biologische Futtermittel eingesetzt<br />
werden.<br />
- In der Brutaufzucht und zur Konditionsfütterung darf Fischmehl/-öl bis maximal<br />
10 % TS der Gesamtration eingesetzt werden. Die Herkunft des Fischmehls<br />
muss Art. 3.11.5 der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien entsprechen. Die Brutaufzucht<br />
beschränkt sich auf den ersten Sommer, die Konditionsfütterung auf die<br />
Jugendphase (K1 und K2), während maximal 2 Wochen im Frühjahr und 3<br />
Wochen im Herbst (ausführliche Dokumentation im Fischjournal).
80 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Vorlage<br />
Bestätigung für nicht-biologische Jungfische und Eier<br />
Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigt der/die Lieferant/in, dass die<br />
gelieferten nicht-biologischen Jungfische/Eier keiner der untenstehenden Behandlungen<br />
unterzogen wurden bzw. keine der untenstehenden Merkmale aufweisen. Bei<br />
unwahren Angaben bzw. einer Verletzung der vorliegenden Vereinbarung, kann der<br />
Lieferant schadenersatzpflichtig werden. Der Lieferant haftet insbesondere für Schäden,<br />
wenn die Lieferung von nicht-konformen Jungfischen/Eiern Sanktionen gegen<br />
den Bezüger zur Folge hat.<br />
Nichtzugelassene Merkmale/Behandlungen:<br />
• gentechnisch veränderte, durch Polyploidisierung, durch Bestrahlung (Monosexing)<br />
oder durch Gynogenese entstandene Fische/Eier<br />
• Jungfische aus Ländern ausserhalb der Schweiz und ihren Nachbarländern<br />
• Prophylaktische Behandlung mit Chemotherapeutika, Antibiotika oder<br />
Hormonen<br />
• Fütterung mit Antibiotika, Wachstumsförderern, Hormonen, gentechnisch<br />
veränderten Futtermitteln, Futterkomponenten oder Zusatzstoffen<br />
Jungfische/Eier (Art) gelieferte Anzahl Lieferdatum Visum<br />
Jungfisch-/Eierbezüger:<br />
Vorname, Name: ..........................................................<br />
Betriebs Nr........................<br />
Adresse, Ort:.............................................<br />
Jungfisch-/Eierlieferant:<br />
Vorname, Name: ..........................................................<br />
Adresse, Ort:.....................................................................<br />
Ort, Datum und Unterschrift des Lieferanten:........................................<br />
Dieses Formular muss auf dem Betrieb aufbewahrt werden.
81 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 2.8.1 ff<br />
Speisepilzproduktion<br />
Weisung der PAK und der LPK vom 19.1.1999 / angepasst von der MKA am<br />
23.5.2000<br />
1 EINLEITUNG<br />
Die Speisepilzproduktion wird, unabhängig davon, ob diese im Freiland oder in<br />
gedeckten Hallen erfolgt, als Urproduktion behandelt. Sämtliche Speisepilzproduzenten<br />
werden somit wie Landwirtschaftsbetriebe kontrolliert und zertifiziert, und es<br />
gilt der Grundsatz der Gesamtbetrieblichkeit (vgl. «Betriebsdefinition für Knospe-<br />
Betriebe»). Speisepilzproduzenten können sich, wie alle übrigen Landwirtschaftsbetriebe,<br />
nur auf den 1. Januar anmelden (Anmeldefrist: 31. 8. des Vorjahres), und die<br />
Speisepilze müssen während den ersten 2 Jahren unter der Umstellungs-Knospe<br />
vermarktet werden.<br />
Die Grundsätze an die Produktionsvorschriften Pflanzenbau der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> (Kap.<br />
2 der Richtlinien) sind auch in der Speisepilzproduktion ab dem 1. Januar des ersten<br />
Umstellungsjahres vollumfänglich einzuhalten. Hingewiesen sei insbesondere auf<br />
das Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenbehandlungsmitteln und Düngern.<br />
2 SUBSTRAT<br />
Substrathersteller, welche Bio-Substrat an Dritte verkaufen, werden gemäss Weisung<br />
«Hofverarbeitung und Zukauf von Bioprodukten» kontrolliert und zertifiziert.<br />
Bei ausschliesslicher Eigenproduktion muss die Rezeptur des Substrates dem Kon-<br />
trolleur vorgelegt werden. Dieser nimmt im Zweifelsfalle Rücksprache mit der<br />
MKA. Der Warenfluss bezüglich Zufuhr der Substratbestandteile als auch der Wegfuhr<br />
des verbrauchten Substrates muss in einem Journal erfasst werden.<br />
Für den biologischen Pilzanbau dürfen nur organische und/oder mineralische Aus-<br />
bezogen auf die organische<br />
gangsstoffe verwendet werden, die gemäss <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien und gemäss der<br />
Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft, Anhang 2, Ziff. 4,<br />
zugelassen sind (RL Art. 2.8.1).<br />
Das Substrat und die Zusätze müssen, Trockensubstanz<br />
(der einzelnen Substratbestandteile), zu mindestens 80 % aus Bioproduktion stammen<br />
(RL Art. 2.8.2).<br />
Stroh im Substrat: Das Stroh im Substrat muss in erster Linie von Knospe-<br />
Betrieben (vollumgestellt oder in Umstellung), in zweiter Linie aus <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
anerkannten Biobetrieben im Ausland stammen. Für jede Charge importierten Strohs<br />
muss eine Knospe-Anerkennungsbestätigung vorliegen (vgl. Kap. 5.10 «Importierte<br />
Knospe-Produkte» der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien). Dies gilt auch für Produzenten,<br />
die Bio-Stroh importieren.<br />
Mist im Substrat: Der Mist im Substrat muss von Knospe-Betrieben stammen. Bei<br />
Nichtverfügbarkeit kann die MKA eine Ausnahmebewilligung für die Verwendung<br />
von nicht-biologischem Mist (bis zu einem Anteil von 20 %, bezogen auf die organische<br />
Trockensubstanz der einzelnen Substratbestandteile), Mist aus schweizerischen<br />
Bundesbiobetrieben oder grenznahen ausländischen Biobetrieben mit zertifizierter<br />
Tierhaltung erteilen.<br />
Ausnahmeregelung Pferdemist: Mit Ausnahmebewilligung der MKA darf unter den<br />
folgenden Bedingungen nicht-biologischer Pferdemist zum biologischen Substratanteil<br />
gerechnet werden:
82 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
• Der Pferdepensionsbetrieb setzt über das ganze Jahr zu 100 % Bio-Stroh ein<br />
(unter Einhaltung der im Kapitel «Stroh im Substrat» festgehaltenen Vorschriften).<br />
• Das Bio-Stroh muss in jedem Fall durch den Substrathersteller beschafft werden.<br />
Anhand dieser Belege wird vom Kontrolleur eine Warenflusskontrolle durchgeführt.<br />
Es obliegt der Verantwortung des Substratherstellers, die Richtlinieneinhaltung<br />
sicherzustellen.<br />
• Die Pferde müssen gemäss Art. 3.1.8 und 3.1.9 der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien<br />
gefüttert werden.<br />
• Die Bestimmungen dieser Übergangsregelung müssen zwischen dem Substrathersteller<br />
und dem Pferdepensonsbetrieb vertraglich geregelt werden. Im Vertrag<br />
muss der Pferdebetrieb ebenfalls das Kontrollrecht gewähren.<br />
Abgabe des verbrauchten Substrates: Aufgrund seiner Zusammensetzung wird<br />
das verbrauchte Substrat zu den Komposten gerechnet. Grundsätzlich soll das verbrauchte<br />
Substrat an den Mistlieferanten zurückgegeben werden. Ist dieser Grundsatz<br />
nicht einzuhalten, soll das verbrauchte Substrat bevorzugterweise an Knospe-<br />
Betriebe abgegeben werden. Wenn Mist mit Ausnahmebewilligung von einem<br />
grenznahen ausländischen Biobetrieb bezogen wird, so darf verbrauchtes Substrat<br />
im Umfang der gelieferten Mistmenge an den Lieferbetrieb zurückgegeben werden.<br />
Ansonsten ist ein Export ins Ausland verboten. Für den Transport des verbrauchten<br />
Substrates ist auch im Ausland nur eine an Schweizer Verhältnisse angepasste Distanz<br />
von maximal 200 – 300 km erlaubt.<br />
3 SPEISEPILZPRODUKTION<br />
Herkunft der Brut: Ab dem 1.1.2004 muss biologische Brut eingesetzt werden.<br />
Die MKA kann die Frist bei Nichtverfügbarkeit verlängern und Anforderungen an<br />
die Biobrut definieren.<br />
Reinigung: Bei der Produktion in Hallen (flächenunabhängig) dürfen zur Reinigung<br />
der Räume nur von der MKV zugelassene Reinigungsmittel eingesetzt werden.<br />
Energieeinsatz: Grundsätzlich darf ganzjährig in temperaturregulierten Hallen<br />
produziert werden. Die Hallen müssen dabei mit besonders umweltverträglichen<br />
Heizungstypen (z.B. Wärmekraft Koppelungssysteme, Wärmewechselpumpen,<br />
Biogas-Heizungen) oder mit bestmöglicher Isolation der Gebäudehülle ausgestattet<br />
sein. Im Minimum darf die Gebäudehülle den mittleren K-Wert von 2,4 W/m 2 K<br />
nicht übersteigen. Bei Sanierungen müssen besonders umweltverträgliche Heizungstypen<br />
und bestmögliche Isolationen gewählt werden. In diesem Fall muss der Pilzproduzent<br />
ein Energiekonzept vorlegen, welches die wirtschaftlich tragbaren Sparmöglichkeiten<br />
und Möglichkeiten zum Einsatz erneuerbarer Energien vorsieht. Bei<br />
bestehenden Anlagen kann die MKA eine Übergangsfrist für die energetische Sanierung<br />
festlegen.<br />
Deckerde: Die Verwendung von Torf in der Deckerde ist möglichst stark einzuschränken.<br />
In der Deckerde dürfen maximal 70 % Torf vorhanden sein (für Deckerde<br />
mit höherem Torfanteil ist bei der MKA eine Ausnahmebewilligung einzuholen).<br />
Die MKA kann weitere Anforderungen an die Deckerde definieren.
83 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.1.7<br />
Tiermehlverbot in der biologischen Tierhal-<br />
tung<br />
Beschluss des Vorstandes vom 25.4.1996 / angepasst von der MKA am 28.11.2000<br />
Das seit 1.6.1996 geltende Moratorium (Verbot) für den Einsatz von Fleischmehl<br />
aus Schlachtabfällen bei Schweinen und Geflügel (Anmerkung: Die Verwendung<br />
von Tiermehl in der Wiederkäuerernährung ist im biologischen Landbau schon seit<br />
jeher verboten) wird der ab <strong>1.1.2001</strong> geltenden BioV angepasst und durch ein generelles<br />
Verbot für alle Biotiere ersetzt:<br />
Der Einsatz von tiermehlhaltigen Futtermitteln ist im Biolandbau nicht zugelassen<br />
(gestützt auf die Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft,<br />
Anhang 7)
84 • <strong>Weisungen</strong> zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 3.4.1 ff<br />
Ziegenhaltung<br />
Weisung der PAK vom 13.1.1998, Rekursentscheid des LG vom 3. 4. 1998<br />
1 AUFSTALLUNG UND STALLMASSE<br />
Anbindehaltung:<br />
<strong>Stand</strong>platzbreite in cm<br />
<strong>Stand</strong>platzlänge in cm<br />
Einzelboxen in m 2<br />
Laufstallhaltung:<br />
Zicklein<br />
1 - 4 Mte.<br />
Haltung nur<br />
frei in<br />
Gruppen<br />
Fressplatzbreite in cm 20<br />
*<br />
0.5<br />
Gesamtfläche/Tier in<br />
m 2<br />
0.4<br />
Liegefläche/Tier in m 2<br />
Jungziegen<br />
4 - 10 Mte.<br />
45<br />
100<br />
* Bei Verwendung von Fressblenden genügen 35 cm Fressplatzbreite<br />
--<br />
Ziegen<br />
über 10 Mte.<br />
55<br />
120<br />
--<br />
Böcke<br />
über 10 Mte.<br />
Im Laufstall kann die gesamte Aktionsfläche (Liege-, Fress- und Laufbereich inkl.<br />
permanent zugänglicher Laufhof) zur Gesamtfläche gerechnet werden. Es müssen<br />
Möglichkeiten vorhanden sein, die Tiere bei Krankheit und über das Abgitzeln abzutrennen.<br />
Bei Beständen von über 10 Tieren müssen geeignete Rückzugsmöglichkeiten wie<br />
Liegenischen, ein permanent zugänglicher Auslauf oder Abschrankungen zur Verfügung<br />
gestellt werden.<br />
35<br />
1.5<br />
0.8<br />
40<br />
2<br />
1.2<br />
60<br />
120<br />
3.5<br />
55<br />
3.5<br />
1.5<br />
2 AUSLAUF<br />
Damit die Ziegen die Möglichkeit des Auslaufs auch effektiv nutzen, soll dieser -<br />
wenn baulich möglich - an einem sonnigen, windgeschützten und trockenen Ort<br />
sein. Eine teilweise Überdachung wird empfohlen. Bei Ganztagesweide sollte ein<br />
Witterungsschutz (Unterstand, Bäume, Felsvorsprünge etc.) vorhanden sein. Es wird<br />
empfohlen, Auslauf und Weide ziegengerecht zu strukturieren (erhöhte Flächen<br />
etc.). Die Ziegen dürfen beim Weidegang nicht angebunden werden. Bei sehr kalter<br />
und/oder sehr nasser Witterung genügt ein Laufhof.<br />
3 FÜTTERUNG<br />
Der Einsatz von Milchpulver ist in der Ziegenhaltung verboten.<br />
Beim Tod des Muttertieres, bei schwerer Erkrankung des Muttertieres und bei Drillingsgeburten<br />
(nur für das überzählige Zicklein) dürfen bis zum Alter von drei Monaten<br />
maximal 10 kg Milchpulver je Zicklein eingesetzt werden. Das Milchpulver<br />
darf keine gemäss Art. 3.1.9 verbotenen Zusätze enthalten.<br />
Die CAE-Sanierung mit Milchpulver ist gemäss Auflagen des kantonalen Veterinärdienstes<br />
gestattet.
85 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Merkblätter Teil Produzenten<br />
Einsatz von fremden Maschinen auf dem<br />
Biobetrieb<br />
Merkblatt der MKA vom 24.3.2001<br />
1 EINLEITUNG<br />
«Ist die Knospe drauf, ist Bio drin». Mit diesem Slogan werben die BioproduzentInnen<br />
für ihre Produkte. «...Ist Bio drin» heisst für den Konsumenten unter anderem,<br />
dass sich im Produkt keine Rückstände von verbotenen Hilfsstoffen befinden. Bioproduzenten<br />
verwenden zwar derartige Hilfsstoffe nicht. Diese Massnahme ist jedoch<br />
leider nicht ausreichend, um ein reines Produkt zu garantieren. Verunreinigungen<br />
und Fremdkontaminationen können durch Abdrift, Altlasten im Boden oder<br />
durch den Einsatz von fremden Maschinen und Geräten erfolgen.<br />
In letzter Zeit hat sich die Analysetechnik derart entwickelt, dass heute bereits mi-<br />
nime Spuren von Pestizidrückständen gefunden werden können. Bereits 1ppm, d.h.<br />
1 Tausendstel Milligramm pro kg kann nachgewiesen werden.<br />
Ziel dieses Merkblattes ist es, die BioproduzentInnen auf das mögliche Kontaminationsrisiko<br />
durch den Einsatz fremder Maschinen aufmerksam zu machen, die Problematik<br />
der Haftung darzustellen und mögliche Massnahmen zur Verminderung des<br />
Risikos aufzuzeigen.<br />
2 WAS SAGEN DIE RICHTLINIEN<br />
In der Präambel heisst es: «Der biologische Landbau bietet Lebensmittel von hohem<br />
gesundheitlichen Wert an», und: «...die Knospe bietet den KonsumentInnen Gewähr<br />
für gesunde, umweltgerecht produzierte Nahrungsmittel».<br />
Der Artikel 2.3.4 der RL lautet: «Die Verwendung chemisch-synthetischer und<br />
gentechnisch hergestellter Pflanzenschutzmittel ist untersagt. Deren Rückstände<br />
dürfen auf den Produkten nicht nachweisbar sein, sofern sie nicht auf eine allgemeine<br />
Umweltbelastung zurückzuführen sind. Parzellen, die der Gefahr einer starken<br />
Immission von chemisch-synthetischen oder gentechnisch hergestellten Pflanzenschutzmitteln<br />
ausgesetzt sind, können von der Knospe-Vermarktung ausgeschlossen<br />
werden bzw. es kann durch die MKA das Ergreifen von Massnahmen zur Verhinderung<br />
der Kontamination verlangt werden.»<br />
3 HEUTIGE PRAXIS<br />
Über Bioprodukte, in denen Rückstände von unerlaubte Hilfsstoffen nachgewiesen<br />
werden können, wird nach einer Fachbeurteilung je nach Situation eine Vermarktungssperre<br />
verhängt. In jedem Fall versucht die <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>, den Produzenten zu<br />
eruieren, um die Kontaminierungsursache ausfindig zu machen. Bei Verschulden<br />
des Produzenten kann dieser sanktioniert werden.<br />
Grossverteiler untersuchen regelmässig Bioprodukte auf Rückstände. Auch von<br />
Konsumentenorganisationen werden ab und zu derartige Tests in Auftrag gegeben.<br />
Vorfälle müssen unbedingt genau rückverfolgt werden, damit allfällig neue Massnahmen<br />
erarbeitet werden können.
86 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
4 HAFTUNG<br />
Die Verantwortung für die Qualität der Produkte liegt immer beim Produzenten.<br />
Auch bei unverschuldeter Kontamination ist es praktisch unmöglich, die Haftung<br />
auf den effektiven Verursacher abzuwälzen. In einem ganz klaren Fall von Abdrift<br />
im Weinbau wurde in einem Gerichtsverfahren dem Bioproduzenten die Haftung<br />
nicht abgenommen. Bei einem Fall der Kontamination durch Einsatz fremder Maschinen<br />
wird es sicher nicht möglich sein, dem Verursacher (z.B. dem Lohnunternehmer)<br />
eine Schuld nachzuweisen.<br />
5 IST DER EINSATZ VON FREMDEN MASCHINEN IM<br />
<strong>BIO</strong>LANDBAU VERBOTEN?<br />
Der überbetriebliche Einsatz von Maschinen ist sinnvoll und muss auch im Biolandbau<br />
möglich sein. Es gibt keine spezifischen Vorschriften in den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
Richtlinien darüber. Bei einer ganzen Reihe von Maschinen besteht auch kein Problem<br />
(Zugfahrzeuge, Bodenbearbeitung, Mistzettler, Güllefässer).<br />
6 BEI WELCHEN MASCHINEN BESTEHT EIN<br />
KONTAMINATIONSRISIKO?<br />
Maschinentyp<br />
Spritzen<br />
Sähmaschinen<br />
Düngerstreuer<br />
Dreschmaschinen<br />
Ballenpressen<br />
Risiko<br />
unerlaubte Pflanzenbehandlungsmittel<br />
Beizmittel (GVO)<br />
chemisch-synthetische Dünger<br />
GVO<br />
unerlaubte Silier- oder Heukonservie-<br />
rungsmittel<br />
7 MASSNAHMEN<br />
Kurzfristig<br />
Der Betriebsleiter muss den Lohnunternehmer bei der Auftragserteilung darauf<br />
aufmerksam machen, dass es sich um einen Biobetrieb handelt, und dass eine Kontamination<br />
mit unerlaubten Hilfsstoffen schwerwiegende Folgen haben kann. Eine<br />
den Umständen angepasste Reinigung ist zu fordern. Eventuelle Mehrkosten sind in<br />
Kauf zu nehmen.<br />
Folgende Reinigungsmassnahmen sind zu fordern:<br />
Maschinentyp<br />
Feldspritzen<br />
Sähmaschinen<br />
Zu fordernde Reinigungsmassnahme oder Handlung<br />
• nach vollständiger Entleerung auf dem vorhergehenden<br />
Feld den Tank kurz spülen;<br />
• den Tank bis 20 % des Totalvolumens mit Wasser<br />
und Reinigungsmittel füllen;<br />
• Rührwerk 10 Min. laufen lassen;<br />
• Reinigungswasser durch den Spritzbalken aussprühen;<br />
• zwischendurch Zapfen an den Enden des Spritzbalkens<br />
öffnen;<br />
• Filter reinigen;<br />
• Nachspülen.<br />
• altes Saatgut vollständig entleeren<br />
• mit Druckluft ausblasen
87 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Maschinentyp<br />
Düngerstreuer<br />
Dreschmaschinen<br />
Ballenpressen<br />
Zu fordernde Reinigungsmassnahme oder Handlung<br />
• chemisch-synthetische Dünger vollständig entleeren<br />
• mit Druckluft ausblasen<br />
Vorgehen wie bei Einsatz für Saatgut.<br />
Da GVO-Kontamination auch nach gründlicher<br />
Reinigung nicht auszuschliessen ist, wird dringend<br />
davon abgeraten, Lohndrescher anzustellen, welche<br />
auch im Ausland arbeiten.<br />
kontrollieren, dass der Versorgungshahnen des Siliermittels<br />
geschlossen ist<br />
Mittelfristig<br />
Es ist sicher anzustreben, dass, vor allem bei den Maschinen mit mehr Risiko (Feldspritzen),<br />
separate Applikationsgeräte verwendet werden.<br />
Maschinenringe unter Biobauern sollen unser Ziel sein.<br />
Die Markenkommission Anbau behält sich vor, weitere Massnahmen zur Verhinderung<br />
der Fremdkontamination zu verlangen, wie z.B. die Dokumentation der Reinigungprozesse<br />
von Lohnunternehmermaschinen oder die Einführung von Pufferstreifen<br />
zwischen biologischen und nicht-biologischen Parzellen.
88 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Mindestsortiervorschriften für Bioobst<br />
Merkblatt der FK Obst und Früchte, vom 03.12.2001<br />
1 ALLGEMEINES<br />
Diese Normen legen die Sortieranforderungen für Bioobst in- und ausländischer<br />
Herkunft, welches mit der Knospe ausgezeichnet ist, fest. Sie bestimmen die Anforderungen,<br />
denen das Obst nach erfolgter Ernte, Lagerung, Aufbereitung und Verpackung<br />
im Moment des Versandes bis zum Detailverkauf zu entsprechen hat. Obst<br />
für die industrielle Verarbeitung fällt nicht darunter. Bei nicht aufgelisteten Obstarten<br />
bzw. -sorten gelten als Richtwerte die Normen des Schweizerischen Obstverbandes<br />
(SOV).<br />
2 KERNOBST<br />
2.1 In Bezug auf Vollentwicklung, Reife und Gewährsmängel gelten grundsätzlich die<br />
Mindest-Normen des (SOV) Klasse II. Zu erfüllen sind folgende Anforderungen:<br />
• ganz und gesund;<br />
• im Stadium der Baumreife von Hand und mit Stiel gepflückt;<br />
• sortentypisch bezüglich Grösse, Form, Hautbeschaffenheit und Färbung;<br />
• vollentwickelt, weder unreif noch überreif;<br />
• sauber, sortenrein, einheitlich sortiert;<br />
• ohne Lagerschäden und -krankheiten wie Haut-, Fleisch- und Kernhausbräune<br />
oder Stippigkeit;<br />
• der Sorte entsprechend lager- und transportfähig;<br />
• ohne Fremdgeschmack und Spritzflecken.<br />
2.2 Für Bioäpfel und -birnen bestehen folgende Sortierungsklassen:<br />
• «Bio-Tafelobst»<br />
• «Bio-Haushaltobst»<br />
Die Vorschriften müssen eine hohe innere Qualität und<br />
appetitliche Erscheinung gewährleisten. Die Sortierung<br />
Bio-Tafelobst entspricht ungefähr der SOV-Klasse I<br />
bezüglich Farbe, Entwicklung und der SOV-Klasse II<br />
bezüglich tolerierter Mängel. Die Anforderungen an<br />
Fruchtgrösse und Ausfärbung sind in der Tabelle aufgelistet.<br />
Äussere Mängel über das Mass bei Bio-Tafelsortierung<br />
sind toleriert, wenn dadurch weder Essqualität noch<br />
Hygiene betroffen sind.<br />
• «Bio-Mostobst» Gleiche Normen wie beim SOV (Siehe 2.4).<br />
• «Bio-Industrieobst»<br />
Die Anforderungen sind mit den Abnehmern zu vereinbaren.
89 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
2.3 Bei Bio-Tafelobst gelten folgende Normen:<br />
Schalenflecken durch Schorf,<br />
Baumspot (Pseudomonas<br />
syr.), Lentizellenröte oder –<br />
verkorkung:<br />
Regenflecken, Russtau:<br />
Nicht sortentypische Beros-<br />
tung:<br />
(Sortentypisch bei Boskoop,<br />
Cox Orange, Kanada Reinet-<br />
te)<br />
Frass- und Stichstellen von<br />
Insekten, Frostnarben:<br />
Hautschäden durch Reibstel-<br />
len:<br />
• Bei rot und dunkelschaligen Sorten sind ma-<br />
ximal 8 Flecken toleriert, wovon maximal 4<br />
auf der hellen Seite.<br />
• Bei hellschaligen Sorten sind maximal 4 Flecken<br />
toleriert.<br />
• Die Gesamtfläche aller Flecken pro Frucht<br />
beträgt maximal 1 cm 2<br />
• Der Durchmesser pro Schorffleck beträgt<br />
maximal 5 mm<br />
• Keine Rissbildung<br />
• Bei rot- und dunkelschaligen Sorten beträgt<br />
die Toleranz 15 % der Fruchtoberfläche.<br />
• Bei hellschaligen Sorten beträgt die Toleranz<br />
5 % der Fruchtoberfläche.<br />
• Kompakte Berostung: maximal 1/3 der<br />
Fruchtoberfläche, nur leicht gerunzelt<br />
• Verteilte Berostung, fein genetzt: maximal<br />
1/2 der Fruchtoberfläche. Gut verkorkt, ohne<br />
Rissbildung<br />
Maximal 2 cm 2 , gut vernarbt, Fruchtform wenig<br />
beeinträchtigt.<br />
Maximal 1 cm 2 , ohne Verletzung der Schale und<br />
ohne wesentliche Beeinträchtigung des Frucht-<br />
fleisches.<br />
Maximal 1 cm 2 der Fruchtoberfläche, gut vernarbt<br />
und Fruchtform wenig beeinträchtigt<br />
(gleich wie SOV Klasse I)<br />
Leichter oberflächlicher Hagelschaden, dabei<br />
darf die Schale nicht verletzt sein, und das<br />
Fruchtfleisch darf nicht beeinträchtigt sein<br />
(gleich wie SOV Klasse I).<br />
Maximal 25 %, sofern die Schale in der Stielhöh-<br />
lung nicht verletzt ist.<br />
Keine Haut-, Frucht und Kernhausbräune, keine<br />
Stippigkeit oder Jonathan-Spot, wenig Glasig-<br />
keit, keine offensichtlichen pilzlichen Lagerkrankheiten,<br />
nur leichte Druckstellen ohne Schalen-<br />
oder Fruchtfleischverletzung.<br />
Mehrere der zulässigen Fehler auf einer Frucht<br />
sind erlaubt. Die Toleranzgrenze pro Einzelman-<br />
ein<br />
gel wird proportional verringert. Wenn also<br />
Fehler 100 % der Toleranz erreicht, werden keine<br />
zusätzlichen Mängel toleriert.<br />
Leichte Verbrennungen<br />
durch Sonne oder Behand-<br />
lungsmittel:<br />
Hagelschläge:<br />
Stiellose Früchte:<br />
Physiologische und mechani-<br />
sche Schäden sowie Lagerschäden<br />
Kumulation von verschiede-<br />
nen Mängeln<br />
2.4 Bei Bio-Mostobst sind für die drei Kategorien «Spezialmostäpfel», «gewöhnliche<br />
Mostäpfel» und «Mostbirnen» zum Zeitpunkt der Ablieferung im Verarbeitungsbetrieb<br />
folgende Kriterien zu erfüllen (identisch mit SOV-Vorschriften):<br />
• gesund, reif, sortentypisch;<br />
• ohne qualitätsbeeinträchtigende Zwischenlagerung;<br />
• frei von fremdem Geruch und Geschmack;<br />
• sauber, frei von Fremdstoffen.<br />
3 STEINOBST<br />
3.1 Grundsätzlich gelten für Kirschen und Zwetschgen als Richtwerte die Bestimmungen<br />
des SOV.
90 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
3.2 Da die Wirkung der im Bioobstbau zugelassenen Pflanzenschutzmittel niedriger ist<br />
als jene chemisch-synthetischer Mittel, gelten bei Tafel- und Konservensortierung<br />
folgende Abweichungen gegenüber den SOV-Vorschriften:<br />
• Kirschenfliegenmade: 6 % befallene Früchte beim Salzwasser-Test;<br />
• Pflaumenwicklermade: maximal 4 % befallene Früchte;<br />
• Wicklermaden bei Aprikosen: maximal 2 % befallene Früchte.<br />
4 BEERENOBST<br />
Bei Bio-Beerenobst gelten gegenüber den SOV-Normen folgende Abweichungen:<br />
• Im Sammelgebinde dürfen Früchte unterschiedlicher Sorte oder Art enthalten<br />
sein, sofern sich diese sichtbar voneinander unterscheiden.<br />
• Bio-Industrieware: Die Anforderungen sind mit den Abnehmern zu vereinbaren.<br />
• Himbeeren: Madenbefall maximal 3 %.<br />
Sorte<br />
Äpfel<br />
Frühsorten<br />
Mindest- und Maximalgrössen sowie Färbung (gemäss <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Sortiervor-<br />
schriften), 2001/2002:<br />
Mindestgrösse<br />
nach<br />
<strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong><br />
(in mm)<br />
Max.-<br />
Grösse<br />
nach <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong><br />
(in mm)<br />
Mindestanteil<br />
Deckfarbe<br />
nach<br />
<strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong><br />
Rotfärbung Rot- u.<br />
dunkel-<br />
schalige<br />
Sorten<br />
Hellschalige<br />
Sorten<br />
Discovery 60 80<br />
1/3 gestreift x<br />
Gra-<br />
60 85 1/10 gestreift x<br />
Primerouge vensteiner<br />
60 80 1/3 kompakt x<br />
Summerred 60 80 1/3 kompakt x<br />
Retina* 60 85 1/3 kompakt x<br />
Herbstsorten<br />
Cox Orange<br />
55 80 1/10 gestreift x<br />
Elstar 60 85 1/3 gestreift x<br />
Kidds 60 85 1/5 gestreift x<br />
Orange<br />
Resi* 55 80 1/2 gestreift x<br />
Rubinette 55 80 1/4 gestreift x<br />
Saturn 60 85 2/3 kompakt x<br />
Spartan 60 80 1/2 kompakt x<br />
Lagersorten<br />
Ariwa* 55 80 1/4 - x<br />
Arlet 60 85 1/3 gestreift x<br />
Boskoop 65 85 - - x<br />
(grün)<br />
Delbard 60 85 1/2 kompakt<br />
x<br />
Jubilé*<br />
Florina 60 85 1/2 gestreift x<br />
Gala- 55 80 1/3 gestreift x<br />
Gruppe<br />
Glockenap- 60 85 - - x<br />
fel<br />
Golden 65 85 - - x<br />
Delicious<br />
Goldrush 60 80 - - x<br />
Goldstar* 60 85 - - x<br />
Granny 65 85 - - x
91 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Sorte Mindestgrösse<br />
nach<br />
<strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong><br />
Max.-<br />
Grösse<br />
nach <strong>BIO</strong><br />
<strong>SUISSE</strong><br />
Mindestanteil<br />
Deckfarbe<br />
nach<br />
<strong>BIO</strong><br />
Rotfärbung Rot- u.<br />
dunkelschalige<br />
Sorten<br />
Hellschalige<br />
Sorten<br />
(in mm) (in mm) <strong>SUISSE</strong><br />
Smith<br />
Idared 65 85 1/2 kompakt x<br />
Jonagold- 65 85 1/3 gestreift<br />
x<br />
Gruppe<br />
Jonathan- 55 75 1/3 kompakt<br />
x<br />
Gruppe<br />
Kanada- 60.0 85 - - x<br />
Reinette<br />
Maigold 60 85 1/3 gestreift x<br />
Otava* 60 80 - x<br />
Raika* 60 85 1/2 kompakt x<br />
Renora* 60 85 2/3 gestreift x<br />
Resista* 60 80 1/4 - x<br />
Rewena* 60 80 1/2 kompakt<br />
x<br />
Roter 60 85 1/3 gestreift x<br />
Boskoop<br />
Rubinola* 60 85 1/2 kompakt<br />
x<br />
Topaz* 60 80 1/3 gestreift x<br />
Viktoria* 60 85 2/3 kompakt x<br />
Birnen<br />
Frühsorten<br />
Guyot 55 80 x<br />
Trévoux 55 80 x<br />
Herbstsorten<br />
Hardy 55 85<br />
x<br />
Wiliams 55 80<br />
x<br />
Lagersorten<br />
Comice 55 85 x<br />
Conférence 52.5 75<br />
x<br />
Gute Loui- 55 75 x<br />
se<br />
Kaiser<br />
Alexander<br />
55 85 x<br />
* = nicht mehr im SOV aufgeführte Sorten oder neu aufgeführte Sorten<br />
Mindestgrösse: Für nicht au f der Liste aufgeführte Sorten gelten dieselben Anforderungen bezüglich<br />
Kaliber und Färbung.<br />
Maximalgrösse: Übergrosse Früchte werden als Haushaltobst klassiert.
92 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 2.2.1ff<br />
Saatgut, vegetatives Vermehrungsmaterial<br />
und Jungpflanzen<br />
Merkblatt der MKA vom 20.03.02<br />
REGELUNG 2001/2002 – KONTROLLE 2002<br />
Gemäss <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien muss - sofern erhältlich - biologisches Saat- und<br />
Pflanzgut eingesetzt werden. Wenn nachweislich kein Biosaatgut oder vegetatives<br />
Vermehrungsmatieral erhältlich ist, so kann, befristet bis zum 31.12.2003, ungebeiztes<br />
konventionelles Saatgut oder veg. Vermehrungsmaterial bestellt werden.. Die<br />
Lieferung muss bis Ende Juni 2004 erfolgt sein. Während dieser Übergangsfrist ist<br />
die Markenkommission Anbau (MKA) für die Regelung dieser Nachweispflicht<br />
zuständig. Jungpflanzen (Pflanzgut) müssen zwingend aus biologischer Herkunft<br />
stammen.<br />
Handhabung in der Praxis<br />
1 GETREIDESAATGUT / SAATKARTOFFELN<br />
Landwirte, welche das Saatgut/veg. Vermehrungsmaterial der von ihnen gewünschten<br />
Getreide- resp. Kartoffelsorte nicht in Bioqualität erhalten konnten, dürfen auch<br />
weiterhin ungebeiztes konventionelles Saatgut/ veg. Vermehrungsmaterial einsetzen,<br />
sofern sie durch geeignete Massnahmen (Nachfrage bei mindestens zwei Anbietern<br />
für Biosaatgut) belegen können, dass die entsprechende Sorte nicht mehr in<br />
Bioqualität erhältlich war. Eins schriftliche Bestätigung ist dabei nicht nötig. Der<br />
Einsatz von gebeiztem Saatgut ist im Getreideanbau grundsätzlich verboten.<br />
Bei den Weizensorten der Klasse Top und I ist die Sortenfreiheit eingeschränkt.<br />
Wenn die gewünschte Sorte nicht in Bioqualität verfügbar ist, muss eine andere<br />
Biosorte dieser Klasse gewählt werden. In erster Priorität ist inländisches Knospe-<br />
Saatgut, in zweiter Priorität ausländisches Biosaatgut zu verwenden. Nur wenn weder<br />
in- noch ausländisches Biosaatgut erhältlich ist, darf konventionelles ungebeiztes<br />
Saatgut eingesetzt werden.<br />
2 GEMÜSE- UND KRÄUTERANBAU<br />
1. Jungpflanzen (Pflanzgut), müssen gemäss der Weisung «Jungpflanzenanzucht<br />
im biologischen Gemüse- und Kräuteranbau» angebaut werden.<br />
2. Im Gemüse- und Kräuteranbau muss grundsätzlich biologisches Saatgut<br />
eingesetzt werden. Ungebeiztes konventionelles Saatgut darf nur noch dann<br />
verwendet werden, wenn der Produzent die Nichtverfügbarkeit von biologischem<br />
Saatgut von der gewünschte Sorte und Qualität glaubhaft belegen kann.<br />
Auf jedem Lieferschein muss vermerkt sein, ob es sich um «biologisches» oder<br />
«ungebeiztes konventionelles» Saatgut handelt. Auch Produzenten von Pflanzgut<br />
müssen Biosaatgut gemäss obenstehender Regelung einsetzen.<br />
3. Im Zwiebelanbau ist die Verwendung von Knospe-Pflanzgut obligatorisch.<br />
Auch Steckzwiebeln müssen aus knospekonformem Anbau stammen.<br />
4. Fungizidgebeiztes Saatgut nur noch zum Ersatz von vorgängig durch Unwetinsektizidgebeiztem<br />
Saatgut ist grundsätzlich<br />
ter, Tierfrass oder Schädlingen zerstörte Kulturen eingesetzt werden, wenn<br />
nachweislich kein ungebeiztes Saatgut erhältlich ist (2 Absagen von Händlern).<br />
Der Einsatz ist vorgängig der Zertifizierungsstelle zu melden. Der Einsatz von<br />
verboten.
93 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
5.<br />
3 OBST-, BEEREN- UND STRAUCHBEERENANBAU<br />
Für Versuchszwecke (Anbau neuer Sorten auf kleinen Flächen) darf nach vorheriger<br />
Meldung an die Zertifizierungsstelle fungizidgebeiztes Saatgut eingesetzt<br />
werden.<br />
Grundprinzip: Grundsätzlich soll das Ausgangsmaterial während der Übergangs-<br />
periode bis 31.12.2003 «so biologisch wie möglich» sein (Bioedelreis gepfropft auf<br />
Biounterlagen ist «biologischer» als Bioedelreis gepfropft auf nicht biologischen<br />
Unterlagen).<br />
Ausnahmeregelungen: In begründeten Fällen, wie fehlendes Angebot auf dem<br />
Biopflanzgutmarkt kann Pflanzmaterial (veg. Vermehrungsmaterial) aus Nichtbio-<br />
Pflanzmaterial bemüht hat und dass die gewünschte Sorte und/oder<br />
produktion verwendet werden, sofern die untenstehenden Voraussetzungen erfüllt<br />
sind<br />
Der Produzent muss anlässlich der Kontrolle belegen können, dass er sich frühzeitig<br />
um biologisches<br />
Unterlage gemäss folgendem Kriterienkatalog nicht erhältlich war. Es müssen mindestens<br />
2 Biobaumschulen resp. Anbieter von Biopflanzmaterial angefragt worden<br />
sein.<br />
Im Obstbau kann die Ausnahmebewilligung erteilt werden wenn<br />
• die gewünschte Sorte nicht in biologischer Qualität erhältlich ist<br />
• die gewünschte Sorte, aber nicht auf der gewünschten Unterlage erhältlich ist<br />
für Äpfel Unterlagen:<br />
Unterlagen-Gruppe 1: Sehr schwachwachsende Unterlagen wie M27, J-TE-G,<br />
P22, M20 etc.<br />
Unterlagen-Gruppe 2: Mittelstarke Unterlagen wie M9, M9vf, Fleuren 56, J-<br />
TE-E, J-TE-F, JOH-A etc.<br />
Unterlagen-Gruppe 3: Stärkerwachsende (wie M26) und starkwachsenden Un<br />
terlagen, Cepiland, Supporte II<br />
Die Wahlfreiheit besteht zwischen den 3 Gruppen aber nicht innerhalb.<br />
• D ie gewünschte Sorte, gewünschte Unterlage aber nicht der gewünschte Typ<br />
erhältlich ist:<br />
Typ-Gruppe 1: «Schlafende Augen», Winterveredelungen (ohne Krone)<br />
Typ-Gruppe 2: Okulanten (einjährig), Winterhandveredelungen (mit einjähriger<br />
Krone)<br />
Typ-Gruppe 3. Okulanten (2- jährig), Winterhandveredelungen (mit 2-jähriger<br />
Krone), Knippbäume<br />
Typ-Gruppe 4: Containerpflanzgut<br />
Typ-Gruppe 5: Hochstämme, Halbstämme<br />
Die Wahlfreiheit besteht zwischen den 5 Typ-Gruppen aber nicht innerhalb.<br />
Im Rebbau kann die Ausnahmebewilligung erteilt werden wenn<br />
• die gewünschte Sorte nicht in biologischer Qualität erhältlich ist<br />
• die gewünschte Sorte, aber nicht auf der gewünschten Unterlage erhältlich ist<br />
für Weinreben Unterlagen:<br />
schwach 3309 (Riparia x Rupestrio)<br />
mittel 504 (Berlandieri x Riparia)<br />
125 AA (Berlandieri x Riparia)<br />
5 C (Berlandieri x Riparia)<br />
8 B (Berlandieri x Riparia)<br />
stark<br />
5 BB (Berlandieri x Riparia)<br />
Die Wahlfreiheit besteht zwischen den 3 Gruppen aber nicht innerhalb<br />
Im Strauchbeerenanbau kann die Ausnahmebewilligung erteilt werden wenn<br />
• die gewünschte Sorte nicht in biologischer Qualität erhältlich ist
94 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Im Erdbeerenanbau kann keine Ausnahmebewilligung erteilt werden (Pflanzmaterial<br />
muss zertifiziert biologischer Qualität sein).<br />
(Auszug aus dem Merkblatt des FiBL «Verwendung von biologischem Saatgut,<br />
Pflanzgut und vegetativem Vermehrungsmaterial im Bioobst-, Biobeerenbau und<br />
Rebbau»)<br />
Bestellrhythmus Bio-Beerenjungpflanzen<br />
Erdbeeren<br />
Bestellung spätestens bis Pflanzzeitpunkt<br />
Mitte Juli 2003 Juli-Aug. 2004<br />
Mitte Juli 2004 usw. Juli-Aug. 2005<br />
Himbeeren April 2003 Mai 2004<br />
April 2004 usw. Mai 2005<br />
Brombeeren Januar 2003 April – Juni 2004<br />
Januar 2004 usw. April – Juni 2005<br />
Johannisbeeren und<br />
Stachelbeeren<br />
Januar 2003 Okt. –Nov. 2004<br />
Januar 2004 usw. Okt. –Nov. 2005<br />
Heidelbeeren Januar 2003 Sept. 2004<br />
Januar 2004 usw. Sept. 2005<br />
Bezugsadressen für Bio-Erdbeerjungpflanzen:<br />
Beat Reller<br />
Wauwilermoos<br />
Schossenrietstrasse<br />
Alois Dubach<br />
9442 Berneck Strafanstalt<br />
6243 Egolzwil<br />
Tel: 071 744 43 09 Tel: 041 984 24 59<br />
Fax: 071 744 43 09 Fax: 041 784 24 45<br />
Bezugsadresse für Bio-Strauchbeeren (Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren,<br />
Stachelbeeren, Heidelbeeren):<br />
Emmental Bio-Baumschulen<br />
R+T Glauser<br />
Brunnacker<br />
3434 Obergoldbach<br />
Tel: 031 701 05 55<br />
Fax: 031 701 36 77<br />
Das FiBL führt eine umfassende Liste mit den Bezugsadressen für Biopflanzgut.<br />
4 ZIERPFLANZENBAU<br />
Definition Jungpflanzen (= Pflanzgut): eine aus Samen gezogene Kulturpflanze in<br />
einem frühen Entwicklungsstadium, die für die Auspflanzung am endgültigen<br />
<strong>Stand</strong>ort vorgesehen ist.<br />
Definition vegetatives Vermehrungsmaterial: Veg. Vermehrungsmaterial dient<br />
der ungeschlechtlichen Vermehrung. Es handelt sich um Pflanzenorgane oder Teile<br />
solcher Organe, die sich dadurch auszeichnen, dass sie zu selbständigen Individuen<br />
heranwachsen können. Aufgrund der ungeschlechtlichen Vermehrung sind alle<br />
Tochterpflanzen genetisch mit der Mutterpflanze gleich<br />
Jungpflanzen und Ausgangsmaterial für die Zwiebeltreiberei
95 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Jungpflanzen und Ausgangsmaterial für die Zwiebeltreiberei müssen zwingend aus<br />
biologischer Produktion (<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>, EU-Bio, IFOAM) stammen.<br />
Nichtbiologische Jungpflanzen und nichtbiologische Zwiebeln dürfen nur bei nachweisbarer<br />
Nichtverfügbarkeit von biologischem Ausgangsmaterial verwendet werden<br />
(schriftliche Bestätigung des Händlers und Angabe von Händlername und Datum<br />
einer zweiten, telefonischen Nachfrage). Diese Angaben müssen aus den Betriebsaufzeichnungen<br />
über den Zukauf ersichtlich sein. Produkte aus nichtbiologischen<br />
Jungpflanzen und nichtbiologischen Zwiebeln erhalten eine Vermarktungssperre<br />
(keine Vermarktung als biologische Pflanzen). Fehlt die Bestätigung der<br />
Nichtverfügbarkeit, können auch höhere Sanktionen ausgesprochen werden.<br />
Saatgut<br />
Der Einsatz von biologischem, konventionellem und/oder gebeiztem Saatgut wird<br />
analog zum Gemüsebau geregelt: Wenn verfügbar, muss biologisches Saatgut eingesetzt<br />
werden. Die Sortenfreiheit ist dabei gewährleistet. Wenn aber konventionelles<br />
Saatgut ohne Sortenbezeichnung angeboten wird, muss bei gleicher Farbe Biosaatgut<br />
vorgezogen werden. Ungebeiztes konventionelles Saatgut darf dann verwendet<br />
werden, wenn der Produzent die Nichtverfügbarkeit von biologischem Saatgut<br />
glaubhaft belegen kann. Grundlage bildet die aktuelle, durch die Fachkommission<br />
genehmigte Zierpflanzenliste, welche beim FiBL erhältlich ist.<br />
Fungizidgebeiztes Saatgut darf nur eingesetzt werden, wenn nachweislich kein ungbeiztes<br />
Saatgut erhältlich ist (schriftliche Bestätigung des Händlers und Angabe von<br />
Händlername und Datum einer zweiten, telefonischen Nachfrage) und eine der folgenden<br />
Bedingungen erfüllt ist:<br />
• zum Ersatz von vorgängig durch höheren Gewalt zerstörten Kulturen<br />
• im Rahmen eines Anbauversuches<br />
• wenn von den Behörden eine Beizung vorgeschrieben ist<br />
Der Einsatz von gebeiztem Saatgut ist vorgängig der Zertifizierungsstelle zu mel-<br />
von Biosaatgut auf einem Mindestanteil der Produktionsfläche ist für<br />
den.<br />
Der Einsatz<br />
das Jahr 2001 nicht vorgesehen.<br />
Vegetatives Vermehrungsmaterial<br />
Vegetatives Vermehrungsmaterial (inkl. Pflanzgut aus veg. Vermehrungsmaterial<br />
«mit minimalem Erdvolumen») muss grundsätzlich biologischer Herkunft sein.<br />
Nichtbiologisches vegetatives Vermehrungsmaterial darf nur dann eingesetzt werden,<br />
wenn glaubhaft belegt werden kann, dass biologisches veg. Vermehrungsmaterial<br />
in der gewünschten Sorte, Qualität und Farbe nicht erhältlich ist. Grundlage<br />
bildet die aktuelle, durch die Fachkommission genehmigte Zierpflanzenliste, welche<br />
beim FiBL erhältlich ist.<br />
Produkte aus konventioneller Halbfertigware dürfen nicht als Bioprodukte vermark-<br />
tet werden.<br />
Allgemeine Anforderungen<br />
Einkauf: Auf jedem Lieferschein muss erkenntlich sein, ob es sich um biologisches,<br />
konventionelles oder gebeiztes Saatgut, Pflanzgut oder vegetatives Vermehrungsmaterial<br />
handelt.<br />
Verkauf: Auf jedem Lieferschein uund/oder Rechnung muss ausdrücklich angege-<br />
ben werden, ob die gelieferte Ware als biologisch gekennzeichnet werden kann oder<br />
nicht.<br />
Für nicht aufgeführte Kulturen gilt dieselbe Regelung wie für den Gemüsebau, d.h.<br />
es muss grundsätzlich biologisches Saatgut eingesetzt werden. Ungebeiztes konventionelles<br />
Saatgut darf nur noch dann verwendet werden, wenn die Nichtverfügbarkeit<br />
von biologischem Saatgut von der gewünschte Sorte und Qualität glaubhaft<br />
belegt werden kann. Fungizidgebeiztes Saatgut darf nur noch zum Ersatz von vorgängig<br />
durch Unwetter, Tierfrass oder Schädlingen zerstörten Kulturen eingesetzt<br />
werden, wenn nachweislich kein ungebeiztes Saatgut erhältlich ist (2 Absagen von<br />
Händlern). Der Einsatz ist vorgängig der Zertifizierungsstelle zu melden. Der Ein-<br />
satz von insektizidgebeiztem Saatgut ist grundsätzlich verboten.
96 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003
97 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Wachtelhaltung<br />
Merkblatt der MKA vom 25.7.2000<br />
1 EINLEITUNG<br />
Die Anforderungen an die Haltung und Fütterung der Wachteln als kleinsten Hühnervogel,<br />
können grösstenteils von den Richtlinien und der Weisung Geflügel abgeleitet<br />
werden. Momentan ist die Haltung der leichteren Legewachtel und der Zweinutzungswachtel<br />
von Bedeutung. Mit der zusätzlichen Lebendgewichtsvorgabe trägt<br />
diese Weisung den grossen Gewichtsunterschieden genügend Rechnung.<br />
2 HALTUNG<br />
Die Gehege müssen so gebaut und eingerichtet sein, dass die Verletzungsgefahr<br />
gering ist und die Tiere nicht entweichen können. In einem strukturierten Mehrklimazonenstall<br />
sollen die Wachteln ihr angeborenes Verhalten möglichst frei entfalten<br />
können. Je Stallabteil dürfen maximal 150 Wachteln oder 33 kg LG gehalten werden.<br />
Ein Stallgebäude beherbergt max. 1500 Wachteln. Japanische Wachteln brauchen<br />
gemäss TSchV Schutz vor extremen Temperaturen. Nässe und Wind. Die hohe<br />
Staubelastung muss durch geeignete Luftführung und regelmässige Reinigung eingeschränkt<br />
werden.<br />
2.1 Licht<br />
Der Stall muss durch natürliches Tageslicht beleuchtet sein. Die Beleuchtungsstärke<br />
muss im Tierbereich mindestens 15 Lux betragen. Die Lichtphase darf nicht künstlich<br />
auf über 16 Stunden ausgedehnt werden.<br />
2.2 Tierbesatz<br />
Die gesamte Aktionsfläche eines Stallabteils mit gedecktem Aussenklimabereich<br />
muss, unabhängig von der Tierzahl mindestens 2,5 m 2 betragen.<br />
2.3 Im Stall<br />
Im Stall dürfen max. 15 Hennen oder 3.3 kg LG je m 2 gehalten werden.<br />
2.4 Im gedeckten Aussenklimabereich<br />
Im gedeckten Aussenklimabereich können max. 25 Hennen oder 5.5 kg LG je m 2<br />
gehalten werden.<br />
2.5 Im Mehrklimazonenstall mit integriertem Aussenklimabereich<br />
Im integrierten Mehrklimazonenstall mit, während der Aktivitätszeit permanent<br />
zugänglichem Aussenklimabereich können auf der gesamten Aktionsfläche ohne<br />
Grünauslauf 10 Wachtelhennen oder 2.2 kg LG je m 2 gehalten werden. Während der<br />
Dunkelphase sind maximal 20 Legewachtelhennen oder 4.4 kg LG je m 2 im Stall<br />
zulässig.<br />
2.6 Einstreu<br />
Der Einstreuanteil im Stall muss mindestens 50 % betragen. Als Einstreumaterial<br />
können natürliche Materialien wie Stroh, Strohhäcksel, Dinkel- oder Haferspelzen<br />
und ähnliches eingesetzt werden. Sand als grossflächiges Einstreumaterial sollte
98 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
wegen der Gefahr vor möglichen Fussballen und Zehenballengeschwüren nicht<br />
gebraucht werden.<br />
2.7 Staubbad<br />
Das Staubbad kann wegen der zusätzlichen Staubbelastung im Aussenklimabereich<br />
angeboten werden. Für 100 Wachteln oder 22 kg LG müssen 0.4 m 2 Staubbadefläche<br />
zur Verfügung stehen. Die Mindestfläche beträgt 30 x 35 cm. Für das mind. 5<br />
cm tiefe Staubad sind folgende Materialien sinnvoll: Feine Erde; feiner, trockener,<br />
ungewaschener Sand gemischt mit Feinerde und Holzasche.<br />
2.8 Geschützter Grünauslauf<br />
Der geschützte Grünauslauf ist mehrheitlich begrünt und hat sinnvolle Strukturen<br />
wie Büsche und grössere Steine und grössere Holzstücke. Zum Schutz der Tiere ist<br />
ein Gitter mit einer Maschenweite von 12 x 12 mm anzubringen. Um eine Pflege der<br />
Ausläufe zu ermöglichen, sollte das Abdeckgitter in 2 m Höhe montiert sein. Unabhängig<br />
von der Tierzahl beträgt die Mindestgrösse des geschützten Auslaufes 2.5 m 2<br />
100 Tieren oder 22 Kg LG sind 40 m 2 anzubieten oder 0.4 m 2 je Wachtel.<br />
(5 m 2 je Henne ! 10 – 12 Wachteln; ! 0.4 m 2 )<br />
2.9 Unterschlupf und Nester<br />
Als Rückzugsmöglichkeit müssen Unterschlupfmöglichkeiten eingerichtet werden;<br />
sind sie eingestreut werden sie auch als Legeorte angenommen. Werden für Zuchttiere<br />
und Legewachteln Legenester angeboten, so müssen diese mindestens teilweise<br />
abgedeckt und eingestreut sein. Die Mindesthöhe muss 16 cm und die Mindestfläche<br />
20 x 20 cm sein und reicht für 6 Tiere. Im eingestreuten Familiennest reichen 1 m 2<br />
für 175 Legehennen.<br />
2.10 Wachtelaufzucht<br />
Für die Aufzuchttiere sind dieAngaben und Abmessungen entsprechend anzupassen.<br />
3 FÜTTERUNGS- UND TRÄNKEEINRICHTUNGEN<br />
Für ausgewachsene Tiere (LG 220 g) soll die Fressplatzlänge am Rundtrog mind.<br />
2 cm, bei manueller Fütterung am Längsfuttertrog 5 cm und an der automatischen<br />
Futterkette 4 cm betragen. Für schwerere Linien werden entsprechend dem Körpergewicht<br />
mehr angeboten.<br />
Als Hühnervögel muss auch den Wachteln offenes Wasser angeboten werden. Cupoder<br />
Bechertränken eignen sich dafür. Je Stallabteil müssen mind. 2 Bechertränken<br />
zur Verfügung stehen oder für 25 Wachteln eine Bechertränke. Nippel können zu<br />
Beginn der Aufzucht eingesetzt werden, spätestens ab dem 28. Alterstag (AT) müssen<br />
aber die Tiere an die offene Wasseraufnahme gewöhnt werden. An der Rundtränke<br />
braucht es ein Angebot von 1cm je Tier.
99 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
ANHANG 1 ZUM MERKBLATT WACHTELHALTUNG<br />
<strong>BIO</strong>LOGISCHE MERKMALE DER DOMESTIZIERTEN<br />
JAPANWACHTEL<br />
(aus dem Entwurf der Richtlinie 800.111.15 Tierschutz des BVET von I. Schmid<br />
und Hans Oester)<br />
Wachteln sind die kleinsten Vertreterinnen der Familie der Hühnervögel. Es gibt<br />
von ihnen weltweit rund 40 verschiedene Arten. Domestiziert wurde nur die Japanwachtel,<br />
Coturnix japonica, welche irreführend auch als Europawachtel bezeichnet<br />
wird.<br />
Verhalten<br />
Domestizierte Japanwachteln, gehalten in Gruppen von acht bis neun Tieren in seminatürlicher<br />
Umgebung in Aussenvolieren halten sich bevorzugt in Deckung auf,<br />
verbringen viel Zeit mit Ruhen am Boden (stehend, sitzend oder liegend), aber auch<br />
mit Fortbewegen und Gefiederpflege. Sie scharren und picken regelmässig und<br />
baden in trockener feiner Erde. Die Eier werden zum grössten Teil an einen geschützten<br />
Platz gelegt. Geschlechtsreife Hähne können gegeneinander sehr aggressiv<br />
sein, was oft zu schweren Kopfverletzungen führt.<br />
Die Erfahrungen mit alternativen Haltungsformen zur bisher üblichen Käfighaltung<br />
zeigen, dass Wachteln kaum schreckhaft reagieren; manche werden im Gegenteil<br />
sogar beinahe handzahm. Die Schreckreaktion (schnelles, steiles Auffliegen) ist in<br />
strukturierten Gehegen sehr selten zu beobachten.<br />
Entwicklung<br />
Wachtelküken haben ein Gewicht von ca. 7 – 9 g und sind sehr lebhaft. Die Entwicklung<br />
geht sehr schnell vor sich. Bereits im Alter von etwa 3 Wochen ist die<br />
Bildung der Befiederung abgeschlossen und mit 4 – 5 Wochen ist die Geschlechtsbestimmung<br />
aufgrund des Brustgefieders möglich; beim Hahn ist dieses rötlichorange<br />
ohne Flecken, bei der Henne beige mit braunen oder schwarzen Flecken. Die<br />
Gewichtsentwicklung ist mit 8 bis 10 Wochen abgeschlossen.<br />
Die Geschlechtsreife, wird je nach Lichtprogramm, im Alter von 6 bis 10 Wochen<br />
erreicht. Die Legeleistung ist abhängig von Fütterung, Licht und Temperatur. Sinkt<br />
die Stalltemperatur längere Zeit unter 15° C, geht die Legeleistung zurück. Die Legeleistung<br />
schwankt zwischen 200 bis 300 Eier je Jahr. Mit Wärmeplatten innerhalb<br />
der Gehege können tiefere Stalltemperaturen aufgefangen werden.<br />
Gewicht und Bedarf<br />
Die ausgewachsene Henne der leichten Legelinien wiegt zwischen 130 – 160 g, der<br />
Hahn 100 – 130 g. Henne und Hahn der schweren Mastlinien wiegen 235 – 280 g.<br />
Bei den Zweinutzungslinien wiregen die Hennen 200 bis 240 g und die Hähne 180<br />
bis 220 g. Die Körperlänge liegt zwischen 120 mm – 180 mm.<br />
Der Futterbedarf der adulten Wachteln liegt bei 20 – 25 g Futter und ca. 30 ml Wasser.
100 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
ANHANG 2 ZUM MERKBLATT WACHTELHALTUNG<br />
ANFORDERUNGEN GEMÄSS RICHTLINIE 800.111.15 DES<br />
BVET<br />
Bewilligungspflicht<br />
Das gewerbsmässige Halten von Wachtel zur Eier- und Fleischerzeugung bedarf<br />
einer kantonalen Bewilligung.<br />
Tierpflege<br />
Wer eine gewerbsmässige Wachtelhaltung leitet oder für die Betreuung der Tiere<br />
verantwortlich ist, muss GeflügelzüchterIn mit eidg. Fähigkeitsausweis bzw. TierpflegerIn<br />
mit Fähigkeitsausweis sein oder über eine vergleichbare Ausbildung ausweisen<br />
können.<br />
Mindestanforderungen an Gehege und Einrichtung<br />
Domestizierte Japan Wachteln brauchen Schutz vor extremen Temperaturen, Nässe<br />
und Wind. Räume, in denen Tiere gehalten werden, müssen so gebaut, betrieben und<br />
belüftet werden, dass ein den Tieren angepasstes Klima erreicht wird (Art.7 Abs.1<br />
TSchV).<br />
Gehege müssen so bebaut und eingerichtet sein, dass die Verletzungsgefahr gering<br />
ist und die Tiere nicht entweichen können (Art. 5 Abs.2 TSchV) Wachtel sollen in<br />
strukturierten Gehegen gehalten werden. Die herkömmliche Käfighaltung auf Gitterboden<br />
und einem Flächenangebot von ca. 100 cm 2 ist als nicht tiergerecht abzulehnen.<br />
Die Mindestfläche eines Geheges soll unabhängig von der Tierzahl mindestens<br />
5'000 cm 2 betragen. Die Mindestfläche für eine Wachtel ab einem Alter von 6 Wochen<br />
darf 450 cm 2 nicht unterschreiten und das Gehege muss mindestens 40 cm<br />
hoch sein.<br />
Mindestens die Hälfte der verfügbaren Bewegungsfläche ist mit geeignetem, staubarmem<br />
Material einzustreuen. Der Gitteranteil des Boden darf max. 50 % betragen.<br />
Die Maschenweite sollte für erwachsene Wachtel nicht mehr als 12mm, bzw. 8 mm<br />
für Küken.<br />
Zur tierschutzkonformen Einrichtung gehören Futter- und Tränkevorrichtungen,<br />
Rückzugsmöglichkeiten, Staubbadegelegenheit und für Legehennen die Möglichkeit<br />
einer ungestörten Eiablage.<br />
Als Rückzugsmöglichkeit ist ein Unterschlupf einzurichten, der, wenn eingestreut,<br />
von den Hennen auch als Legeort angenommen wird. Werden Nester eingerichtet,<br />
müssen diese teilweise abgedeckt und mit Einstreu versehen sein. Ihre Mindesthöhe<br />
soll 16 cm und die Mindestfläche 20 x 20 cm betragen.<br />
Unverträgliche Tiere dürfen nicht in der gleichen Gruppe gehalten werden.
101 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
Grundlage RL: Art. 4.2.5 ff<br />
Schrittweise Umstellung in der Tierhaltung<br />
Merkblatt der MKA vom 12.11.2002<br />
ANLEITUNG FÜR DIE EINREICHUNG VON GESUCHEN<br />
2002<br />
EINLEITUNG<br />
Gemäss den Richtlinien der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> muss grundsätzlich der gesamte Betrieb, d.h. die<br />
gesamte Betriebsfläche und sämtliche Tierkategorien auf biologischen Lanbau umgestellt<br />
werden. Zu beachten sind Artikel 4.1.1 bis 4.1.7 der Richtlinien der <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>. Auch in<br />
Zukunft soll weiter am Grundsatz der gesamtbetrieblichen Umstellung festgehalten werden.<br />
Die Umstellung in Teilschritten (=Schrittweise Umstellung) ist ein Instrument, um das<br />
umstellungsbedingte Risiko auf ein für den Betrieb verkraftbares Mass zu reduzieren, ohne<br />
dabei die Prinzipien der Glaubwürdigkeit und der Kontrollierbarkeit zu verletzen. Ist die<br />
sofortige vollständige Umstellung der Nutztierhaltung nicht zumutbar, so kann die MKA<br />
ab 2003 dem Betrieb gestatten, die Tierhaltung innert drei Jahren schrittweise nach Tierkategorien<br />
umzustellen. Ein Umstellungsplan muss vor Ablauf der Anmeldefrist an die MKA<br />
eingereicht werden. Gemäss Art. 9 der BioV muss die schrittweise Umstellung auch vom<br />
BLW zugelassen werden.<br />
TIERKATEGORIEN, ANFORDERUNGEN<br />
Mit Ausnahme von Wiederkäuern und Pferden können sämtliche Tierkategorien schrittweise<br />
umgestellt werden. Nicht zulässig ist die Parallelproduktion von Tieren der gleichen<br />
Nutztierkategorie. Bei der Fütterung und beim Tierzukauf kann bei den bewilligten Tierkategorien<br />
von den Richtlinien abgewichen werden. Die Anforderungen an Haltung, Tierzucht<br />
und Tiergesundheit müssen ab Beginn der schrittweisen Umstellung vollumfänglich<br />
eingehalten werden.<br />
DAUER UND WARTEFRISTEN<br />
Während maximal drei Jahren nach Umstellungsbeginn müssen die bewilligten Tierkategorien<br />
noch nicht sämtliche Anforderungen der Richtlinien erfüllen. Alle Tierkategorien<br />
müssen bis Ende des dritten Jahres umgestellt sein. Die Wartefristen müssen also bis 31.<br />
Dezember abgeschlossen sein.<br />
Die Wartefristen für die einzelnen Nutztiere sind in den Richtlinien Art. 3.1.10 festgelegt.<br />
In Abweichung zur schrittweisen Umstellung im Pflanzenbau können die Wartefristen der<br />
einzelnen Tierkategorien unabhängig vom Kalenderjahr durchlaufen werden. Während der<br />
Wartefrist sind alle Bedingungen der Richtlinien vollumfänglich einzuhalten (inkl. Fütterung<br />
und Herkunft der Nutztiere). Nach Durchlaufen der Wartefrist können die Produkte<br />
als Umstell- oder Vollknospe-Produkte vermarktet werden, je nach Status des Gesamtbetriebes.<br />
Für Schweine beträgt die Wartefrist 4 Monate. Das Geflügel für die Eierproduktion muss<br />
eine Wartefrist von 6 Wochen durchlaufen und für die Fleischerzeugung 56 Tage.
102 • Merkblätter zu den <strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong> Richtlinien 1.1.2003<br />
UMSTELLUNGSPLAN<br />
Zum Umstellungsplan gehören die folgenden detaillierten und jährlich zu aktualisierenden<br />
Dokumentationen vom gesamten Betrieb:<br />
Beratungsbericht des Bioberaters oder gleichwertige Unterlagen (die folgenden Punkte<br />
können in diesen Bericht integriert sein);<br />
bisherige Bewirtschaftung (Flächenangaben, Tierbestände);<br />
Zeitplan (welche Tierarten werden zu welchem Zeitpunkt umgestellt);<br />
Betriebsnachweis gemäss eidgenössischer Begriffsverordnung und Weisung «Betriebsdefinition<br />
für Knospe-Betriebe»;<br />
Beschreibung der Produktions- und Lagerstätten;<br />
Lagerung der Futtermittel und Hilfsstoffe (Separation muss gewährleistet sein);<br />
Produktionstechnik und Hilfsstoffeinsatz;<br />
vorgesehene Vermarktung und Deklaration.<br />
AUFZEICHNUNGEN<br />
Über die Produktionstechnik, nicht-biologische Futtermittel, Lagerung des Futters, Tierzukäufe,<br />
Vermarktung und Abnehmer sind genaue und lückenlose Aufzeichnungen zu machen.<br />
KONTROLLE<br />
Betriebe in schrittweiser Umstellung werden pro Jahr mindestens zweimal kontrolliert.<br />
Auch die noch nicht biologisch bewirtschafteten Tierbestände, Lagereinheiten usw. werden<br />
kontrolliert. Die Deklaration aller verkauften Produkte und Verkaufsstandorte ist bei der<br />
Kontrolle nachvollziehbar darzustellen.<br />
VORGEHEN UND ABLAUF DES<br />
BEWILLIGUNGSVERFAHRENS<br />
1. Die in der Weisung geforderten Unterlagen sind wenn nötig mit einem Bioberater<br />
zusammenzustellen.<br />
2. Alle Unterlagen sind der MKA zur Beurteilung termingerecht einzureichen (bis<br />
Ablauf der Anmeldefrist).<br />
3. Beurteilung der Unterlagen durch die MKA. Die MKA definiert die betriebsspezifischen<br />
Auflagen.<br />
4. Die Anerkennung als Umstellungsbetrieb erfolgt erst auf Grund des ersten Kontrollberichtes<br />
durch die Zertifizierungsstelle.<br />
EINREICHUNG DES GESUCHES<br />
Gesuche müssen spätestens bis Ende August (Anmeldefrist Biolandbau) bei der MKA und<br />
dem BLW eingereicht werden. Ausnahmsweise wird für das Jahr 2003 eine schrittweise<br />
Umstellung auch für U2-Betriebe gewährt. Für das laufende Jahr werden keine Gesuche<br />
bewilligt.<br />
Gesuch einreichen bei:<br />
<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong>, MKA, Margarethenstrasse 87, 4053 Basel.<br />
BLW, Sektion Qualitäts- und Absatzförderung, Mattenhofstr. 5, 3003 Bern (eigenes Gesuchsformular)
<strong>BIO</strong> <strong>SUISSE</strong><br />
Margarethenstrasse 87<br />
4053 Basel<br />
Tel. 061 385 96 10<br />
Fax 061 385 96 11<br />
www.bio-suisse.ch<br />
E-mail bio@bio-suisse.ch<br />
Abdruck und Kopie nur mit<br />
ausdrücklicher Genehmigung der<br />
Herausgeberin