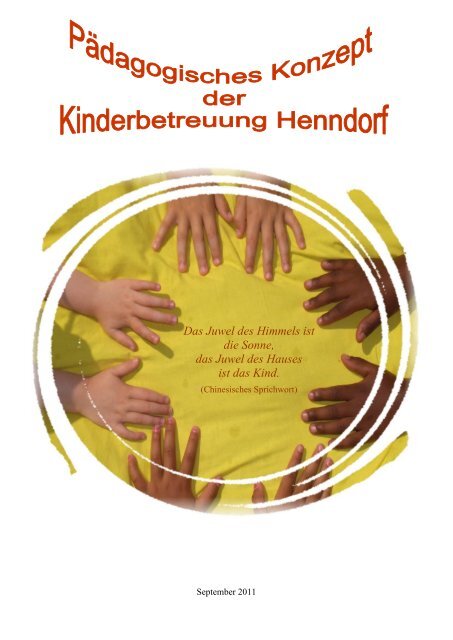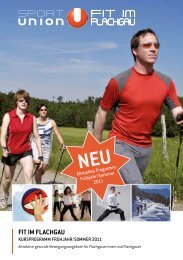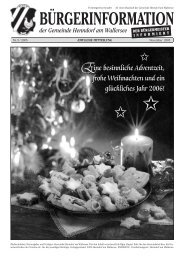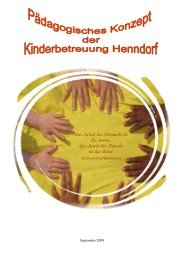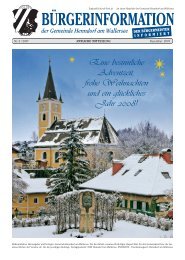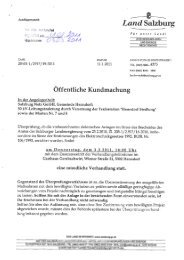(2,18 MB) - .PDF - Henndorf am Wallersee
(2,18 MB) - .PDF - Henndorf am Wallersee
(2,18 MB) - .PDF - Henndorf am Wallersee
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Juwel des Himmels ist<br />
die Sonne,<br />
das Juwel des Hauses<br />
ist das Kind.<br />
(Chinesisches Sprichwort)<br />
September 2011
Vorwort des Bürgermeisters<br />
Die Gemeinde <strong>Henndorf</strong> <strong>am</strong> <strong>Wallersee</strong> trägt dem steigenden Bedarf in<br />
der Kinderbetreuung Rechnung und erweiterte den Kindergarten um die<br />
entsprechenden Räume für die Betreuung von Kleinkindern und<br />
Schulkindern. Durch die Erweiterung entstand als Ges<strong>am</strong>tes ein „Haus<br />
für Kinder“, da jetzt die Krabbelgruppe, der Kindergarten und die<br />
Nachmittagsbetreuung der Volksschulkinder unter einem Dach<br />
untergebracht sind.<br />
Unsere Kinder sollen sich in den Gruppen geborgen fühlen und den<br />
Alltag positiv erleben. Die Gemeinde <strong>Henndorf</strong> ist daher nicht nur<br />
bemüht die entsprechenden Räume zu schaffen, sondern auch<br />
ausreichend geschultes Personal anzustellen. Unser fleißiges und<br />
engagiertes Te<strong>am</strong> ist der Garant für die hervorragende Kinderbetreuung<br />
in <strong>Henndorf</strong>. Gemeins<strong>am</strong> werden wir auch die zukünftigen<br />
Entwicklungen und die an uns gestellten Anforderungen in der<br />
Kinderbetreuung bewältigen.<br />
Für die Gemeinde<br />
Rupert Eder<br />
Bürgermeister<br />
2
Vorwort des Kindergartente<strong>am</strong>s<br />
Viele Veränderungen und Neuerungen haben die vergangenen Jahre in<br />
unserem Haus geprägt.<br />
Aufgaben haben sich verändert und erweitert, Krabbelgruppenkinder<br />
haben das Haus im Sturm erobert und die Kinder des Kindergartens und<br />
der Schulkindgruppe bereichern und beleben unsere Einrichtung jeden<br />
Tag aufs Neue.<br />
Wir sind ein Haus, in dem das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht.<br />
Unseren Kindern gerecht zu werden, verlangt von uns eine Vielzahl an<br />
pädagogischen Überlegungen, Koordination und Organisation.<br />
Dieses Konzept wird Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Institution<br />
ermöglichen und<br />
Ihnen unsere Überlegungen, Intentionen und Aufgaben verdeutlichen.<br />
Denn eines sollten wir immer bedenken:<br />
Glück ist kein Glück ohne Kinderund<br />
Kinder sind keine Kinder ohne Liebe.<br />
(Willy Breinholst)<br />
Für das Kindergartente<strong>am</strong><br />
Gollackner Agnes<br />
3
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Chronik der Kinderbetreuung <strong>Henndorf</strong> ..................................................................................... 5<br />
2 Organisation / Struktur ................................................................................................................. 6<br />
2.1 N<strong>am</strong>e und Adresse der Einrichtung ....................................................................................... 6<br />
2.2 Form der Einrichtung .............................................................................................................. 6<br />
2.3 Träger der Einrichtung ........................................................................................................... 6<br />
2.4 Anzahl der Gruppen ............................................................................................................... 6<br />
2.5 Öffnungszeiten ....................................................................................................................... 6<br />
2.6 Ferienregelungen ................................................................................................................... 6<br />
2.7 Reihungskriterien für die Aufnahme in unserer Einrichtung .................................................. 6<br />
2.8 Personalsituation .................................................................................................................... 7<br />
3 Ziele und Aufgaben unserer Einrichtung ................................................................................... 8<br />
4 Orientierungspunkte der pädagogischen Arbeit ....................................................................... 9<br />
4.1 Projekte und Jahresthema ..................................................................................................... 9<br />
4.2 Religiöser Festkreislauf .......................................................................................................... 9<br />
4.3 Jahreszeitenkreislauf ............................................................................................................. 9<br />
4.4 Bewegung .............................................................................................................................. 9<br />
5 Te<strong>am</strong>-Te<strong>am</strong>arbeit-Qualitätsentwicklung ........................................................................................... 10<br />
6 Planung und Dokumentation ..................................................................................................... 11<br />
6.1 Die Arbeitsdokumentation in unserer Einrichtung ................................................................ 11<br />
6.2 Der Stellenwert der Beobachtung in unserer Einrichtung .................................................... 11<br />
7 Integration ................................................................................................................................... 12<br />
8 Bild vom Kind .............................................................................................................................. 14<br />
9 Rahmenbedingungen/Hintergründe für die pädagogische Arbeit im Kindergarten ............ 15<br />
10 Raumkonzept .............................................................................................................................. 17<br />
11 Elternarbeit .................................................................................................................................. 22<br />
12 Kooperation mit verschiedenen Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit .............................. 23<br />
13 Die unterschiedlichen Betreuungsformen unserer Einrichtung ............................................ 25<br />
13.1 Krabbelgruppe: ..................................................................................................................... 25<br />
13.2 Kindergarten ......................................................................................................................... 27<br />
13.3 Schulkindgruppe: ................................................................................................................. 32<br />
4
1 Chronik der Kinderbetreuung <strong>Henndorf</strong><br />
Am 10.09.1967 wurde, unter der Leitung von Frau Barbara Wagner, im Gebäude der<br />
ehemaligen Volksschule (heute Trachtenmoden Sinnhofer) eine Kindergartengruppe mit 32<br />
Kindern eröffnet. Das Gebäude wurde im Jahr 1966 vom „Wiener Kinderrettungswerk“ als<br />
Erholungsheim für die Sommermonate gekauft. Der Gemeinde <strong>Henndorf</strong> standen 2 Räume<br />
für den Ortskindergarten zur Verfügung.<br />
Da es bis dahin keinen Kindergarten im Ort gab, war es für die Bevölkerung keine<br />
Selbstverständlichkeit, ihre Kinder in den Kindergarten zu schicken. Erst als die Eltern<br />
sahen, dass es sich um eine Bildungseinrichtung handelte, wurde das Angebot<br />
angenommen.<br />
10 Jahre später, im September 1972, besuchten bereits<br />
45 Kinder den noch immer 1-gruppigen<br />
Ortskindergarten. Darum stellte die Gemeinde eine<br />
Helferin als zusätzliche Kraft ein.<br />
Ab September 1975 wurde der Kindergarten bereits 2-<br />
gruppig geführt, und im September 1979 war die<br />
Notwendigkeit gegeben, 1 Gruppe für 6-jährige Kinder<br />
und 2 Gruppen für 3-5-jährige Kinder zu eröffnen. Die<br />
Räume wurden mit Kachelöfen beheizt, nur ein kleiner<br />
Garten stand zur Verfügung und die Sanitäranlagen<br />
erfüllten die Erfordernisse nicht.<br />
Bürgermeister Hans Esterer sprach bereits von Neubau.<br />
Im September 1984 gab es bereits 4<br />
Gruppen und auf Grund des hohen<br />
Bevölkerungswachstums in <strong>Henndorf</strong> wurde<br />
im September 1985 eine 5. Gruppe<br />
provisorisch eingerichtet.<br />
Im Frühling 1987 wurde unter Bürgermeister<br />
Franz Winklhofer der Spatenstich zum Bau<br />
des neuen Kindergartens gesetzt, bereits im<br />
September 1988 konnte das über viele Jahre<br />
zus<strong>am</strong>mengewachsene Te<strong>am</strong> in den neuen<br />
Kindergarten <strong>am</strong> jetzigen Standort<br />
einziehen.<br />
Im September 1995 war es notwendig eine 6. Gruppe provisorisch einzurichten. Der erhöhte<br />
organisatorische Aufwand brachte im Februar 1996 die Freistellung als Kindergartenleiterin<br />
von Frau Barbara Wagner mit sich. Unter Bürgermeister Rupert Eder wurde im September<br />
1998 ein Anbau eröffnet. Der Kindergarten <strong>Henndorf</strong> galt als größter Kindergarten des<br />
Landes Salzburg.<br />
Im darauffolgenden Jahr wurde im Bastelraum des Kindergartens eine Schulkindgruppe für<br />
die Nachmittagsbetreuung dieser Altersstufe eingerichtet. Bereits 2003 war die Nachfrage so<br />
gestiegen, dass eine 2. Schulkindgruppe notwendig wurde.<br />
Im Juli 2007 ging die langjährige Leiterin Frau Barbara Wagner in den Ruhestand und Frau<br />
Agnes Gollackner wurde zur neuen Leiterin bestellt.<br />
Im September 2008 hielt eine weitere Altersgruppe Einzug in unser Haus. Die Nachfrage für<br />
die Betreuung von unter 3 jährigen Kindern war in <strong>Henndorf</strong> so gestiegen, dass die<br />
Gemeinde beschloss, eine Krabbelgruppe einzurichten. Das Gebäude wird bis 2009 um eine<br />
Krabbelgruppe und eine alterserweiterte Gruppe vergrößert.<br />
Die vergangenen Jahre haben viele Veränderungen mit sich gebracht, doch eines bleibt<br />
immer bestehen: Das Wohl der Kinder liegt uns <strong>am</strong> Herzen.<br />
5
2 Organisation / Struktur<br />
2.1 N<strong>am</strong>e und Adresse der Einrichtung<br />
Kinderbetreuung <strong>Henndorf</strong><br />
Wiesmühlstraße 5<br />
5302 <strong>Henndorf</strong> <strong>am</strong> <strong>Wallersee</strong><br />
Tel.: 06214/8288<br />
e-mail: kindergarten@henndorf.at<br />
2.2 Form der Einrichtung<br />
o Krabbelgruppe<br />
o Kindergarten<br />
o Schulkindgruppe<br />
2.3 Träger der Einrichtung<br />
Gemeinde <strong>Henndorf</strong> <strong>am</strong> <strong>Wallersee</strong><br />
Hauptstraße 65<br />
5302 <strong>Henndorf</strong><br />
Tel.: 06214/8204<br />
e-mail: gemeinde@henndorf.at<br />
2.4 Anzahl der Gruppen<br />
2 Krabbelgruppen ( 8 Kinder pro Tag von 1 bis 3 Jahren)<br />
6 Kindergartengruppen (je 20-25 Kinder von 3-6 Jahren)<br />
3 Schulkindgruppen<br />
(2 Gruppen mit 16 Kindern und 1 Gruppe mit 13 Kindern im Volksschulalter)<br />
2.5 Öffnungszeiten<br />
Krabbelgruppe: 07.30 Uhr – 14.00 Uhr<br />
Kindergarten: 07.00 Uhr – 17.00 Uhr<br />
Schulkindgruppe – an Schultagen: 11.30 Uhr – 17.00 Uhr (Freitag – 16.00 Uhr)<br />
2.6 Ferienregelungen<br />
An gesetzlichen Feiertagen, in den Weihnachts- und Osterferien der<br />
allgemeinbildenden Pflichtschulen sowie zu Allerheiligen ist die Einrichtung<br />
geschlossen.<br />
5 Wochen Sommerferien im August. Bei Bedarf wird in den Osterferien und 2<br />
Wochen im August eine Betreuung für Kindergartenkinder von berufstätigen<br />
Eltern angeboten.<br />
2.7 Reihungskriterien für die Aufnahme in unserer Einrichtung<br />
o Kinder, bei denen aus sozialen oder erzieherischen Gründen die<br />
Ermöglichung des Besuches unserer Einrichtung geboten scheint<br />
o Kinder, die schon bisher die Einrichtung besucht haben oder deren<br />
Geschwister<br />
o Kinder die ihrem Alter nach dem Schuleintritt <strong>am</strong> Nächsten stehen<br />
6
2.8 Personalsituation<br />
1 freigestellte Leiterin<br />
Krabbelgruppen:<br />
je 1 gruppenführende Kindergartenpädagogin<br />
je 1 Assistentin für 2 Gruppen<br />
Kindergartengruppen: je 1 gruppenführende Kindergartenpädagoin<br />
je 1 Kindergartenpädagogin als Assistentin oder 1 Helferin<br />
ab 23 Kindern täglich ansonsten 2-3x/Woche<br />
1 Sonderkindergartenpädagogin für alle Gruppen<br />
Schulkindgruppen:<br />
je 1 gruppenführende Hortpädagogin<br />
1 Assistentin oder Helferin während der Lernzeit<br />
7
3 Ziele und Aufgaben unserer Einrichtung<br />
3.1 Schaffen einer angenehmen Atmosphäre in einer kindgerechten<br />
Umgebung<br />
‣ Orientierung <strong>am</strong> Kind und seiner Lebenssituation – kindgemäßes Arbeiten<br />
‣ Orientierung an der Lebenswelt der Kinder<br />
‣ Zeit-, Raum- und Regelstrukturen schaffen, die dem Entwicklungsstand,<br />
den Bedürfnissen und den Interessen der Kinder entsprechen<br />
‣ Entscheidungsfreiräume schaffen<br />
‣ Freiwilligkeit im Tun ermöglichen<br />
‣ Lernen im entspannten Feld<br />
‣ Vielfältige Spiel-, Arbeits- und Lösungsmöglichkeiten eröffnen<br />
3.2 Ganzheitliche Förderung in allen Bereichen (motorisch, kognitiv,<br />
sozial, emotional, kreativ, musikalisch,...)<br />
‣ Förderung der Ges<strong>am</strong>tpersönlichkeit und Individualität, dem<br />
Entwicklungsstand des Kindes entsprechend<br />
‣ Förderung und Erweiterung der Fähigkeiten und Kompetenzen des Kindes<br />
‣ Förderung der Selbsttätigkeit<br />
‣ Ganzheitliche Förderung beinhaltet auch:<br />
o Lernen durch Spiel<br />
o Lernen durch Bewegung<br />
o Lernen mit allen Sinnen<br />
o Lernen durch Entdecken, Forschen und Experimentieren<br />
o Lernen durch Mithilfe im Kindergartenalltag<br />
o Lernen durch Gestalten<br />
o Lernen durch Beobachten und Nachahmen<br />
o Lernen in der Gruppe<br />
3.3 Schaffen von Ritualen und besonderen Ereignissen, bei denen<br />
die Freude und der Spaß <strong>am</strong> gemeins<strong>am</strong>en Tun der Kinder im<br />
Vordergrund steht<br />
‣ Es ist uns ein Anliegen, dass die Sicherheit und das Vertrauen der Kinder<br />
durch Rituale im Kindergartenalltag gestärkt werden, denn dadurch kann<br />
sich die Ges<strong>am</strong>tpersönlichkeit des Kindes entwickeln.<br />
Z.B.: Morgenkreis, gemeins<strong>am</strong>e oder gleitende Jause, Aufräumen,...<br />
‣ Im Laufe des Jahres werden für die Kinder immer wieder<br />
gruppenübergreifende Highlights gesetzt, um vielfältige, soziale Gefüge<br />
entstehen zu lassen und das Gemeinschaftsgefühl in und zwischen den<br />
Gruppen zu stärken.<br />
Z.B.: Jahresfestkreis: Erntedank, Martinsfest, Advent,...<br />
Ausflüge: Zahngesundheitszentrum, Tiergarten,...<br />
Besondere Aktivitäten: Waldwoche, Spielzeugfreier Kindergarten,...<br />
8
4 Orientierungspunkte der pädagogischen<br />
Arbeit<br />
4.1 Projekte und Jahresthema<br />
Spezifische Projekte und die Wahl eines Jahresthemas ermöglichen die<br />
Vertiefung in eine bestimmte Thematik. Um ein individuelles Eingehen auf<br />
die Gruppe zu ermöglichen, werden diese Schwerpunkte von Gruppe zu<br />
Gruppe unterschiedlich gewählt und gestaltet und nicht für das ges<strong>am</strong>te<br />
Haus festgelegt. Beispiele: Spielzeugfreier Kindergarten, Raus-aus-dem-<br />
Haus-Tage, Activity Days, Waldkindergarten,…<br />
4.2 Religiöser Festkreislauf<br />
Die Feste des Kirchenjahres spielen in der Gemeinde an sich eine wichtige<br />
Rolle und so finden sie sich auch in unserer Kindergartenarbeit wieder.<br />
Wichtig ist uns hier, den Hintergrund des Festes näher zu bringen. Weiters<br />
wollen wir den Kindern wichtige gesellschaftliche Werte vermitteln und ihre<br />
sozialen Fähigkeiten stärken. Für uns wichtige Schwerpunkte: Erntedank, St.<br />
Martin, Advent, Weihnachten, Fastenzeit, Ostern.<br />
4.3 Jahreszeitenkreislauf<br />
Durch die Lage des Kindergartens nahe an der Natur und das Interesse der<br />
Kinder <strong>am</strong> Wechsel der Jahreszeiten ergibt sich für uns auch hier ein<br />
Schwerpunkt. Es besteht die Möglichkeit einer vielfältigen Förderung.<br />
Beispiele: Naturbegegnung, Natur mit allen Sinnen erfahren, Naturschutz,…<br />
4.4 Bewegung<br />
Wesentliche Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit sind die Förderung<br />
der Grob- und Feinmotorik. Zur Schulung der Grobmotorik gibt es in und<br />
rund um unser Haus vielfältige Bewegungsangebote. Beispiele: Zwei gut<br />
ausgestattete Bewegungsräume, groß angelegter Garten,<br />
Streetsoccerplatz, Motorikpark,…<br />
Um die Feinmotorik der Kinder zu fördern bieten wir ihnen unterschiedliche<br />
Materialien und Angebote. So nutzen wir Alltagssituationen wie z.B. Obst<br />
und Gemüse schneiden und Tische abwischen und setzen gezielte<br />
Angebote die diesen Bereich abdecken.<br />
9
5 Te<strong>am</strong>-Te<strong>am</strong>arbeit-Qualitätsentwicklung<br />
5.1 Organisation des Te<strong>am</strong>s:<br />
‣ Dienstplan des Te<strong>am</strong>s wird besprochen und von der Leiterin festgehalten<br />
‣ Verschiedene Funktionen der Kindergarten- und Hortpädagoginnen<br />
werden in einer Te<strong>am</strong>besprechung eingeteilt und auf einem Beiblatt zum<br />
Dienstplan beigefügt<br />
5.2 Te<strong>am</strong>besprechungen:<br />
‣ Termin: jeden Montag von 17. 00 Uhr bis 19. 00 Uhr<br />
‣ 1 Kindergarten- oder Hortpädagogin führt Protokoll<br />
‣ Einige Themen werden 1 Woche vorher von der Leiterin bekannt gegeben,<br />
d<strong>am</strong>it sich die Kindergarten- und Hortpädagoginnen vorbereiten und ihre<br />
Ideen dem Te<strong>am</strong> präsentieren können<br />
‣ Kleinte<strong>am</strong> - Besprechungen für die Pädagoginnen der Krabbel- bzw.<br />
Schulkindgruppen finden einmal im Monat mit der Leiterin statt<br />
5.3 Mitarbeitergespräche:<br />
‣ 1 x jährlich findet ein Mitarbeitergespräch mit der Leiterin statt<br />
‣ Anhand eines Besprechungsleitfadens können sich die Kindergarten- und<br />
Hortpädagoginnen und die Leiterin auf das Gespräch vorbereiten<br />
‣ Die Besprechungsbögen werden von der Leiterin aufbewahrt und<br />
ausgewertet, es wird ersichtlich wie sich die Kolleginnen im Einzelnen und<br />
das Te<strong>am</strong> im Ges<strong>am</strong>ten weiter entwickeln können<br />
5.4 Weiterbildung des Te<strong>am</strong>s<br />
‣ Verschiedenste den Interessen entsprechende Kurse aus dem<br />
Fortbildungskatalog für Kindergartenpädagoginnen werden in Anspruch<br />
genommen<br />
‣ Fachzeitschriften: z.B.: „Unsere Kinder“, „Kindergarten heute“<br />
‣ Fachbücher: z.B.:„Bausteine Kindergarten“, „Psychomotorikmappe“,<br />
„So wirkt Kneipp“,…<br />
5.5 Weitere Aktivitäten im Te<strong>am</strong>:<br />
‣ Regelmäßige Erste Hilfe Kurse im Kindergarten<br />
‣ Jährlicher gemeins<strong>am</strong>er Kulturausflug des Te<strong>am</strong>s<br />
10
6 Planung und Dokumentation<br />
6.1 Die Arbeitsdokumentation in unserer Einrichtung<br />
Alle Kindergarten- und Hortpädagoginnen orientieren sich <strong>am</strong><br />
Planungsformular C des Landes Salzburg.<br />
6.2 Der Stellenwert der Beobachtung in unserer Einrichtung<br />
‣ Stärken und Schwächen der Kinder werden aus der Beobachtung gut<br />
ersichtlich, diese beeinflussen wesentlich die Planung unserer<br />
pädagogischen Arbeit.<br />
‣ Freie Beobachtung findet während des ges<strong>am</strong>ten Kindergartenjahres und<br />
des ges<strong>am</strong>ten Tagesablaufes statt. Bei Auffälligkeiten folgt eine gezielte<br />
Beobachtung.<br />
‣ Die freie Beobachtung wird von jeder Kindergarten- und Hortpädagogin<br />
individuell dokumentiert.<br />
‣ Zwei Mal im Kindergartenjahr findet eine gezielte Beobachtung statt<br />
(Oktober/November, Februar/März).<br />
‣ Für die gezielte Beobachtung stehen Beobachtungsbögen zur Verfügung<br />
die jede Kindergarten- und Hortpädagogin individuell verwendet.<br />
‣ Inhalte des Beobachtungsbogens:<br />
o Wahrnehmung<br />
o Emotionale und soziale Entwicklung<br />
o Kreativität und Spontaneität<br />
o Sprachliche Entwicklung<br />
o Musikalisch-rhythmischer Bereich<br />
o Kognitive Entwicklung<br />
o Grob- und Feinmotorik<br />
o Spiel- und Arbeitsverhaltens<br />
o Stärken, Ressourcen, Eigenheiten, Besonderheiten, Interessen,<br />
Schwächen und Schwierigkeiten des Kindes<br />
o Notwendigkeit eines Elterngespräches<br />
‣ Eine weitere Form der Dokumentation der kindlichen Entwicklung sind<br />
individuell gestaltete Kindergartenabschiedsmappen, die alle<br />
Schulanfänger <strong>am</strong> Ende des letzten Kindergartenjahres von ihrer<br />
Kindergartenpädagogin erhalten.<br />
‣ Die Beobachtung nach dem Salzburger Beobachtungskonzept (SBK) bildet<br />
die Grundlage für die pädagogische Arbeit in der Krabbelgruppe. Durch die<br />
Beobachtung können wir erkennen, welche Bedürfnisse, Interessen,<br />
Vorlieben und Besonderheiten die Kinder mitbringen und darauf können<br />
wir in unsere Arbeit aufbauen. Dies ermöglicht auch ein individuelles<br />
Eingehen auf die Kinder.<br />
11
7 Integration<br />
Alle Kinder unabhängig von Herkunft, Können und Lebenslage sollen die Möglichkeit<br />
haben, den Kindergarten zu besuchen und entsprechend ihren Fähigkeiten und<br />
ihrem Entwicklungsstand gefördert zu werden.<br />
Integrative Arbeit bedeutet, die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten eines jeden<br />
einzelnen Kindes wahrzunehmen, diese in den Beobachtungen festzuhalten und in<br />
der Planung und Arbeit mit dem Kind darauf einzugehen mit dem Ziel der sozialen<br />
Integration.<br />
7.1 Arten und entsprechende Ziele der Integration:<br />
7.1.1 Kinder mit Beeinträchtigung<br />
Diese erfahren eine spezielle und fachspezifische Förderung durch die<br />
Unterstützung einer Sonderkindergartenpädagogin in der/den<br />
Integrationsgruppe(n), wobei vor allem das Ziel der ganzheitlichen Förderung<br />
und der Selbständigkeit angestrebt wird. Hauptziel aber ist die soziale<br />
Integration, das heißt, das Kind wird ermutigt, Fähigkeiten zu entwickeln, die<br />
soziale Kontakte ermöglichen und unterstützen.<br />
Im Vordergrund steht eine ressourcenorientierte Arbeit, d. h. wir setzen an den<br />
Stärken an und versuchen, dadurch die Schwächen zu verbessern.<br />
Durch einen „kindorientierten Ansatz“ wird das Kind dort „abgeholt“, wo es<br />
derzeit in seiner Entwicklung steht (laufende Beobachtung ist notwendig).<br />
Uns ist vor allem wichtig, dass keine Einzelfördersituationen entstehen, sondern<br />
Förderung im Spiel, in der Gruppe, im normalen Tagesgeschehen und in<br />
kleinen Kindergruppen stattfindet.<br />
7.1.2 Kinder mit Migrationshintergrund<br />
Integration von Kindern mit Migrationshintergrund wird in allen Gruppen gelebt,<br />
vor allem auch mit Schwerpunkt der Sprachförderung.<br />
Für die praktische Arbeit heißt es auch, andere religiöse Ausrichtungen zu<br />
akzeptieren und so weit als möglich darauf Rücksicht zu nehmen.<br />
7.1.3 Kinder mit besonderen Bedürfnissen<br />
In Form von situativen Ansätzen und kindorientierten Angeboten wird die<br />
Integration dieser Kinder in allen Gruppen umgesetzt.<br />
Für Unterstützung mit beratender Funktion, für spezielle Beobachtungen,…<br />
steht die Sonderkindergartenpädagogin jederzeit auch den anderen<br />
Kindergartengruppen zur Verfügung.<br />
12
7.2 Rahmenbedingungen:<br />
7.2.1 Personell:<br />
Die Sonderkindergartenpädagogin betreut die Kinder in den<br />
Integrationsgruppen und steht bspw. für die Unterstützung von Kindern mit<br />
Doppelzählung (d. h. sie werden hinsichtlich der Gruppengröße doppelt gezählt)<br />
und für Fragen der Pädagoginnen zur Verfügung.<br />
§ <strong>18</strong><br />
(1) In Integrationsgruppen sind Kinder mit erhöhtem Förderbedarf doppelt zu zählen.<br />
Die Zahl der Kinder mit schwerer Beeinträchtigung im Sinn des § 16 Abs 2 in einer<br />
Integrationsgruppe darf vier (nach Köpfen) nicht übersteigen. Auf den im Einvernehmen<br />
mit dem Rechtsträger des Kindergartens zu stellenden Antrag der Kindergartenleiterin<br />
oder des -leiters kann bei Integration von Kindern mit schwerer Beeinträchtigung im<br />
Sinn des § 16 Abs 2 die Kinderhöchstzahl von der Landesregierung im Einzelfall<br />
herabgesetzt werden. Dabei ist auf die Zahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf<br />
sowie auf die Art und den Grad des erhöhten Förderbedarfes der Kinder Bedacht zu<br />
nehmen.<br />
Die interdisziplinäre Zus<strong>am</strong>menarbeit erfolgt je nach Therapien, Ärzten, usw.<br />
des Kindes mit den jeweiligen Disziplinen, mit der Schule, mit der Frühförderung<br />
Seekirchen und Ergotherapeutinnen.<br />
7.2.2 Räumlich:<br />
Da unser Haus größtenteils ebenerdig ist, können auch Kinder mit einer<br />
körperlichen Beeinträchtigung unseren Kindergarten besuchen.<br />
13
8 Bild vom Kind<br />
14
9 Rahmenbedingungen/Hintergründe<br />
für die pädagogische Arbeit im Kindergarten<br />
9.1 Umfeld der Kinder<br />
Kinder werden in unserer Gesellschaft als selbstbestimmende Individuen<br />
angesehen, denen Rechte zugesprochen sind (Kinderrechte: www.kija.at).<br />
Die Kinder können in unserer Umgebung folgenden Belastungen ausgesetzt<br />
sein:<br />
o Wenig Halt durch fehlende Großf<strong>am</strong>ilien<br />
o F<strong>am</strong>ilienunfreundliche Arbeitszeiten der Eltern<br />
o Alleinerziehende Elternteile<br />
o Erfolgsdruck<br />
o Freizeitstress<br />
o Usw.<br />
9.2 Bedeutung von Elternschaft und Erziehung<br />
Elternschaft bedeutet, dass die Eltern in allen Bereichen für das Kind<br />
sorgen. Die Eltern sollen dem Kind Stützpfeiler und Vorbild sein. Sie sollen<br />
die Stärken und Schwächen ihrer Kinder sehen, erkennen und danach<br />
handeln.<br />
Erziehung bedeutet Verantwortung zu übernehmen, das gilt sowohl für<br />
Eltern als auch für Kindergarten- oder Hortpädagoginnen.<br />
9.3 Bedeutung der Erziehung in unserer Einrichtung im Vergleich zur<br />
f<strong>am</strong>iliären Erziehung<br />
Wir sehen es als unsere Aufgabe die Kinder in pädagogischen Prozessen zu<br />
begleiten und zu unterstützen. Wir wollen die Weiterentwicklung der Kinder<br />
positiv beeinflussen. Der Umgang mit Kindern in der Großgruppe<br />
unterscheidet sich wesentlich zum f<strong>am</strong>iliären Umfeld der Kinder in der<br />
Kleinf<strong>am</strong>ilie.<br />
Oftmals unterstützt der Kindergarten in verschiedenen Bereichen die<br />
Erziehungsaufgaben der Eltern.<br />
Beispiele: Esskultur, Setzen von Grenzen, Höflichkeitsformen,<br />
Sauberkeitserziehung,...<br />
15
9.4 Umfeldbedingungen des Hauses – Reaktionen darauf<br />
Wir richten uns bei der Betriebsführung, der Mitarbeiterqualifizierung und<br />
den pädagogischen Aufgaben nach den Auflagen und den gesetzlichen<br />
Vorgaben des Salzburger Landesgesetzblattes<br />
(www.salzburg.gv.at/kinderbetreuung).<br />
Da in unserer Gemeinde für die Eltern keine Wahlmöglichkeit zwischen<br />
mehreren Kinderbetreuungseinrichtungen besteht, sehen wir es als unsere<br />
Pflicht, auf die Bedürfnisse möglichst aller Eltern einzugehen.<br />
o Mittagstisch<br />
o Flexible Öffnungszeiten<br />
o Schulkindgruppe<br />
o Spielgruppe<br />
o Ferienbetreuung von Schulkindern<br />
o Krabbelgruppe<br />
o Sommerkindergarten<br />
o Integration<br />
o Montessori- und Kneipppädagogik<br />
Die Bedürfnisse werden durch Bedarfserhebungen, Gespräche bei der<br />
Einschreibung und Elternabenden abgeklärt. Vor allem wollen wir aber den<br />
Erwartungen in Bezug auf die ganzheitliche Erziehung (Körper, Geist und<br />
Seele) entsprechen.<br />
9.5 Besonderheit unserer Einrichtung<br />
Angesichts der Größe unseres Betriebes ist es uns ein großes Anliegen, für alle<br />
Kinder eine angenehme Umgebung zu schaffen und ihnen Geborgenheit zu<br />
vermitteln.<br />
Durch regelmäßige Fortbildungen ist es uns möglich, immer aktuelle<br />
pädagogische Kenntnisse in der Praxis umzusetzen.<br />
Die gute Zus<strong>am</strong>menarbeit im Te<strong>am</strong> führt dazu, den Kindern einen<br />
gruppenübergreifenden, stärkebezogenen und gut strukturierten Alltag zu<br />
bieten.<br />
16
10 Raumkonzept<br />
10.1 Spiel-, Erlebnis-, Entdeckungs-, Ruhe- und Rückzugsräume in<br />
unserer Einrichtung<br />
Alle Räumlichkeiten und Spielmaterialien sind auf die Bedürfnisse der<br />
jeweiligen Altersgruppe abgestimmt. Für Krabbelkinder steht ein großer<br />
gemütlicher Rückzugsbereich zur Verfügung. Die Kinder haben viel Raum<br />
um sich frei zu entwickeln. Für die Jause und das Mittagessen ist ein eigener<br />
Bereich in der Gruppe eingerichtet. Die Sanitäranlagen sind gemäß den<br />
Bedürfnissen der Kinder mit einem Wickelbereich ausgestattet.<br />
Durch die Aufteilung der einzelnen Gruppeneinheiten in verschiedene,<br />
flexible Spiel- und Raumteile können die Kinder ihren individuellen<br />
Interessen nachgehen. Sie haben genügend Freiraum um sich mit<br />
verschiedenen Materialien, Spielen und in verschiedenen Sozialformen<br />
(alleine, zu zweit, in kleinen Gruppen) zu beschäftigen.<br />
10.2 Die Raumteile einer Gruppeneinheit<br />
‣ Mal- und Basteltisch: Papier zum Malen, diverse Stifte, Klebstoff,…<br />
‣ Bauecke: verschiedenste Bau- und Konstruktionsmaterialien<br />
17
‣ Wohn- und F<strong>am</strong>ilienbereich: Puppen und Puppenbekleidung, Geschirr,…<br />
‣ Bilderbuchbereich: Bücher zu unterschiedlichen Themen, gemütliche<br />
Sitzmöglichkeiten<br />
‣ Spieltische:<br />
Geleitetes Spiel<br />
Freies Spiel<br />
<strong>18</strong>
‣ Waschraum<br />
10.3 Räume, die außerhalb der Gruppeneinheit mitgenutzt werden<br />
‣ Turnsaal/Rhythmikraum:<br />
Beide Räume sind mit verschiedensten Geräten, die zur Förderung<br />
unterschiedlichster Bewegungsarten dienen, ausgestattet.<br />
Der Rhythmikraum wird mittags zusätzlich als Rastraum für die jüngeren<br />
Ganztagskinder genützt. Der Turnsaal wird <strong>am</strong> Nachmittag von den<br />
Schulkindern genutzt.<br />
‣ Gang/Garderobe<br />
19
‣ Gartenbereich<br />
‣ Werk- bzw. Bastelraum<br />
‣ Bibliothek<br />
20
‣ Speiseraum<br />
Esstische für<br />
Kindergartenkinder<br />
Esstische für<br />
Schulkinder<br />
21
11 Elternarbeit<br />
11.1 Ziele der Elternarbeit<br />
‣ Informationsaustausch zwischen Kindergarten- und Hortpädagoginnen und<br />
Eltern zum Wohle des Kindes<br />
‣ Die Eltern zur Mitarbeit anregen<br />
‣ Präsentation der pädagogischen Arbeit<br />
‣ Gegenseitige Wertschätzung<br />
11.2 Formen der Elternarbeit<br />
‣ Elternabende<br />
Die Wahl des Elternbeirates und individuelles Kennen lernen der Gruppen<br />
findet beim 1. Elternabend statt.<br />
‣ Entwicklungsgespräche<br />
Einmal jährlich finden mit den Eltern aller Kinder Entwicklungsgespräche<br />
statt. Es ist uns ein Anliegen eine gute Vertrauensbasis mit den Eltern zu<br />
schaffen, d<strong>am</strong>it der Informationsaustausch über die Kinder auf ehrlicher<br />
Basis, zum Wohle der Kinder geschieht.<br />
‣ Elternbriefe<br />
‣ Allgemeine Informationen und Termine werden gut sichtbar und rechtzeitig<br />
ausgehängt.<br />
‣ Informationsbroschüren<br />
Verschiedene Informationsbroschüren und Telefonnummern von<br />
Therapeuten, verschiedenen Hilfsstellen und Ärzten liegen zur freien<br />
Entnahme im Eingangsbereich auf.<br />
‣ Informationsnachmittag für Kindergarten-und Krabbelgruppenanfänger<br />
(siehe 13.2.4)<br />
‣ Informationsveranstaltung für Eltern der Schulanfänger (siehe 13.2.8)<br />
‣ Präsentation der pädagogischen Arbeit<br />
Fotos, Zeichnungen und Bastelarbeiten der Kinder, Arbeiten der<br />
Schulanfänger oder Projektberichte werden im Garderobenbereich<br />
(Anschlagtafeln, Tischen, Mappen) den Eltern präsentiert.<br />
‣ Aktivitäten mit bzw. für Eltern<br />
Bei verschiedenen Anlässen werden die Eltern eingeladen bei einem Fest<br />
oder Projekt mitzuwirken und dabei zu sein. Beispiele: Martinsfest,<br />
Weihnachten, F<strong>am</strong>ilienaktivität im Frühling, Abschiedsfest der<br />
Schulanfänger, Waldtage, Besuche bei F<strong>am</strong>ilien, Kennen lernen von<br />
Berufen…<br />
‣ Eltern der Buskinder<br />
Anstatt der Tür- und Angelgespräche werden Informationen schriftlich<br />
oder bei einem vereinbarten Elterngespräch weitergegeben.<br />
‣ Jahresbericht<br />
Die Kindergarten- und Hortpädagoginnen arbeiten <strong>am</strong> Ende des<br />
Kindergartenjahres einen Jahresbericht aus, der im Eingangsbereich für<br />
die Eltern zur Ansicht aufliegt.<br />
22
12 Kooperation mit verschiedenen<br />
Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit<br />
12.1 Verschiedene Institutionen, mit denen unsere Einrichtung<br />
kooperiert<br />
‣ Gemeinde <strong>Henndorf</strong><br />
Wir erhalten große Unterstützung in organisatorischen Belangen von der<br />
Gemeinde (Bürgermeister, Amtsleiter, Sekretärin, Buchhaltung, Bauhof,...)<br />
‣ Referat für Kindergärten, Horte und Tagesbetreuung<br />
‣ Zentrum für Kindergartenpädagogik<br />
‣ Gemeindebücherei <strong>Henndorf</strong><br />
Es besteht jederzeit die Möglichkeit mit den Kindern die Bücherei zu<br />
besuchen und Bücher auszuleihen. Nach Vereinbarung können auch<br />
spezielle Angebote der Bücherei genutzt werden.<br />
‣ Pfarre <strong>Henndorf</strong><br />
Der Hr. Pfarrer besucht uns regelmäßig bei religiösen Festen und feiert mit<br />
den Kindern, außerdem gibt es die Möglichkeit die Kirche zu besuchen.<br />
‣ Volksschule <strong>Henndorf</strong><br />
Ein Informationsaustausch ist sowohl für die Arbeit mit den Schulanfängern<br />
als auch mit den Schulkindern notwendig.<br />
‣ Musikmittelschule <strong>Henndorf</strong><br />
Am Beginn des Schuljahres erhalten einige SchülerInnen die Möglichkeit<br />
bei Schnuppertagen den Kindergartenbetrieb kennen zu lernen und<br />
einen Einblick in das Berufsfeld als Kindergartenpädagogin bekommen.<br />
‣ Private Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik<br />
Einige SchülerInnen verbringen während ihrer Ausbildung ihre Praxiszeit in<br />
unserer Einrichtung.<br />
‣ Gebietskrankenkasse Salzburg<br />
Die Schulanfänger besuchen einmal jährlich das Zahngesundheitszentrum.<br />
‣ Katholisches Bildungswerk <strong>Henndorf</strong><br />
‣ AVOS<br />
Die Gesundheitserzieherinnen statten den Kindern im Herbst und im<br />
Frühling einen Besuch ab.<br />
‣ Freiwillige Feuerwehr und Polizeiinspektion <strong>Henndorf</strong><br />
Die Kinder können die Institutionen und ihre Besonderheiten kennen<br />
lernen.<br />
‣ Ärzte, Therapeuten, Frühförderung und F<strong>am</strong>ilienberatung.<br />
Eine Kooperation findet zum Wohle der Kinder bei Bedarf statt.<br />
‣ Spezielle Angebote anderer Institutionen (Beispiele: Musikschule,<br />
Fußballschule…)<br />
Kurse werden von 8. 00 Uhr bis 9. 00 Uhr vormittags oder nachmittags<br />
angeboten, um den regulären Kindergartenbetrieb nicht zu stören.<br />
23
12.2 Öffentlichkeitsarbeit<br />
Zusätzlich zu den Aktivitäten mit den o.g. Institutionen, durch die die Kinder<br />
viel in der Öffentlichkeit auftreten, schalten wir Berichte in der<br />
Bürgerinformation der Gemeinde <strong>Henndorf</strong>, die unsere pädagogische<br />
Arbeit der Öffentlichkeit präsentieren. Auf der Homepage der Gemeinde<br />
befinden sich allgemeine Informationen und <strong>am</strong>tliche Termine des<br />
Kindergartens.<br />
24
13 Die unterschiedlichen<br />
Betreuungsformen unserer Einrichtung<br />
13.1 Krabbelgruppe:<br />
13.1.1 Spezifische Ziele für diese Altersgruppe:<br />
‣ Die Förderung einer altersgemäßen Selbstständigkeit ist sehr wichtig. Wir<br />
ermutigen die Kinder vieles alleine zu machen und achten sehr genau darauf, die<br />
Kinder nicht zu unterfordern und auch nicht zu überfordern. Alltägliche Aufgaben,<br />
die die Kinder selber bewältigen können, werden von uns unterstützend<br />
sprachlich begleitet. Außerdem achten wir besonders darauf, die intrinsische<br />
Motivation der Kinder aufzugreifen und positiv zu verstärken.<br />
‣ Die Körperwahrnehmung spielt für Kinder dieser Altersgruppe eine wichtige Rolle,<br />
da sie in diesem Alter ihren Körper kennen lernen, Körpergrenzen bewusst<br />
wahrnehmen und lernen Körperteile zu benennen. Der ges<strong>am</strong>te Bereich der<br />
Körperwahrnehmung ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung aller<br />
anderen Bildungsbereiche (Sozialer Bereich, Emotionaler Bereich, Kognitiver<br />
Bereich, Sprachlicher Bereich….). Der Bereich der Körperwahrnehmung bildet<br />
eine wesentliche Grundlage für unsere pädagogische Arbeit.<br />
‣ In der Krabbelgruppe wird den Kindern ermöglicht, in einem überschaubaren,<br />
geschützten Bereich erste soziale Kontakte außerhalb ihrer F<strong>am</strong>ilie zu schließen.<br />
Da die Kinder hauptsächlich noch das Einzelspiel bevorzugen, entstehen häufig<br />
Konflikte. Die Kindergartenpädagoginnen unterstützen die Kinder in ihrer sozialen<br />
Entwicklung, indem sie den Kindern helfen, Konflikte zu beseitigen und<br />
Kompromisse einzugehen.<br />
‣ Die Sauberkeitserziehung wird individuell und ohne Druck mit den Kindern<br />
praktiziert. Wir sehen uns dabei als Unterstützung für die Eltern.<br />
13.1.2 Einstieg in die Krabbelgruppe<br />
‣ Der Besuchsnachmittag für Kinder, die im Herbst in der Krabbelgruppe beginnen<br />
und deren Eltern<br />
o Kennenlernen der Kindergartenpädagogin und des Gruppenraumes<br />
o Wichtige Informationen zur Krabbelgruppe werden weitergegeben<br />
o Vereinbaren von Schnupperterminen<br />
‣ Jedes Kind erhält die Möglichkeit gemeins<strong>am</strong> mit seinen Eltern in der Gruppe<br />
anzukommen. Es werden dazu Termine vergeben, die vor den Sommerferien<br />
stattfinden. Die Kinder sollen ohne Stress eine Beziehung zu den<br />
Kindergartenpädagoginnen aufbauen können. Eine enge Zus<strong>am</strong>menarbeit<br />
zwischen Eltern und Kindergartenpädagoginnen ist dabei sehr wichtig.<br />
‣ Beim Einstieg sollen die Kinder nur kurze Zeitspannen vor allem in der<br />
St<strong>am</strong>mgruppe verbringen und von den Eltern zu einem vereinbarten Zeitpunkt<br />
abgeholt werden.<br />
25
13.1.3 Der Tagesablauf in der Krabbelgruppe<br />
‣ Orientierungsphase: Die Kinder können ab 07.30 Uhr in ihre St<strong>am</strong>mgruppe<br />
gebracht werden.<br />
‣ Individuell gestaltete Spiel- und Lernphase: In dieser Zeit können die Kinder in<br />
beiden Gruppenräumen und den Nebenräumen mit dem angebotenen Material<br />
experimentieren und hantieren, sie spielen und lernen alleine oder miteinander.<br />
‣ Gemeinschaftskreis: Durch kurze gemeins<strong>am</strong>e Impulse werden die Kinder<br />
gefördert. Der Kreis findet nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder in den<br />
St<strong>am</strong>mgruppen statt.<br />
‣ Gemeinschaftsjause: Die Kinder nehmen die Jause gemeins<strong>am</strong> in den<br />
jeweiligen St<strong>am</strong>mgruppen ein.<br />
‣ Individuelle gestaltete Spiel- und Lernphase: Diese kann im Bewegungsraum,<br />
Garten oder den beiden Gruppenräumen stattfinden. Der Schwerpunkt liegt darin,<br />
den Bedürfnissen der Kinder entsprechende Möglichkeiten zu bieten.<br />
‣ Abschließende gemeins<strong>am</strong>e Jause/Mittagessen: Abhängig von der Dauer der<br />
Besuchszeit nehmen die Kinder eine Vit<strong>am</strong>injause oder das Mittagessen in der<br />
St<strong>am</strong>mgruppe ein.<br />
‣ Schlafen/Ausklangsphase: Die Kinder können sich mit einer<br />
Kindergartenpädagogin in der St<strong>am</strong>mgruppe beschäftigen bis sie von ihren Eltern<br />
abgeholt werden. Jene Kinder die über die Mittagszeit in der Krabbelgruppe<br />
bleiben dürfen in einem abgegrenzten Ruhebereich rasten.<br />
26
13.2 Kindergarten<br />
13.2.1 Spezifische Ziele für die Altersgruppe 3-4 Jahre / Jüngere<br />
‣ Den Kindern einen sanften Einstieg in den Kindergartenalltag bieten<br />
‣ Die Eingewöhnungs- und Kennenlernphase richtet sich nach den Bedürfnissen<br />
der Kinder<br />
‣ Durch eine fixe Bezugsperson und einem stabilen Betreuungsumfeld wird dem<br />
Kind Geborgenheit, emotionale Zuwendung, Sicherheit und Vertrauen vermittelt<br />
‣ Förderung des Selbstvertrauens um gestärkt in die Gruppe zu kommen<br />
13.2.2 Spezifische Ziele für die Altersgruppe 4-5 Jahre / Mittlere<br />
‣ Stärken des Selbstbewusstseins des Kindes durch Übernahme kleinerer Aufträge<br />
und Aufgaben im Kindergartenalltag<br />
‣ Gezielte Angebote für diese Altersgruppe, z.B. „Die Reise ins Entenland“<br />
‣ Ganzheitliche Förderung und Vorbereitung auf die Zeit als Schulanfänger –<br />
Ausdauer und Konzentration, Feinmotorik,...<br />
‣ Festigen der Persönlichkeit und einer altersentsprechenden Sozialkompetenz<br />
13.2.3 Spezifische Ziele für die Altergruppe 5-6 Jahre / Schulanfänger<br />
‣ Den Kindern Aufgaben geben, wodurch das Selbstbewusstsein, die<br />
Verlässlichkeit, das Vertrauen, die Wertschätzung und der Selbstwert der Kinder<br />
gefördert werden<br />
‣ Vorbereitung auf die Anforderungen der Schule durch gezielte Angebote: z.B.:<br />
Schulanfängertag, Schulanfängeraufgaben, Schulanfängerausflüge,<br />
Sprachförderungstag, Wochenplan, Schulanfängertisch,...<br />
13.2.4 Einstieg in den Kindergarten<br />
‣ Der Besuchsnachmittag für Kinder, die im Herbst im Kindergarten beginnen und<br />
deren Eltern<br />
o Kennenlernen der Kindergartenpädagogin und des Gruppenraumes<br />
o Wichtige Informationen zum Kindergarten werden weitergegeben<br />
o Vereinbaren von Schnupperterminen<br />
‣ Der Schnuppervormittag für Kinder die im Kindergarten beginnen ohne deren<br />
Eltern<br />
‣ Der Kindergartenstart im Herbst<br />
Der Übergang von der bisher vertrauten Umgebung in den Kindergarten sollte für<br />
die Kinder möglichst sanft ablaufen. Falls es jedoch für die Kinder in der neuen<br />
Umgebung trotzdem schwierig sein sollte, versuchen wir bestmöglich nicht nur<br />
das Kind, sondern auch die Eltern zu bestärken. Es besteht natürlich die<br />
Möglichkeit, dass die Kinder vertraute Gegenstände, die ihnen Sicherheit und<br />
Geborgenheit vermitteln, von zu Hause mitbringen. An den ersten Tagen sollte<br />
das Kind nach Möglichkeit nur wenige Stunden im Kindergarten bleiben.<br />
27
13.2.5 „Ein Tag im Kindergarten“ – Eine kurze Bildgeschichte<br />
Heute Morgen bringt meine M<strong>am</strong>a mich<br />
und meine Schwester ziemlich früh in den<br />
Kindergarten, weil sie in die Arbeit muss.<br />
Unsere Kindergärtnerin ist noch nicht da,<br />
also treffen wir uns mit einigen Freunden in<br />
der Gruppe 1.<br />
Ein wenig später kommt schon unsere<br />
Kindergärtnerin und wir gehen gemeins<strong>am</strong><br />
in unsere Gruppe. Jetzt schneiden wir die<br />
Vit<strong>am</strong>injause und stellen die Sessel<br />
herunter.<br />
Langs<strong>am</strong> kommen immer mehr Kinder und<br />
ich baue mit meiner besten Freundin etwas.<br />
Wer möchte kann an einem Tisch<br />
etwas mit der Kindergärtnerin basteln.<br />
Unsere Kindergärtnerin sagt uns, dass der<br />
Jausentisch gedeckt ist, und wir jederzeit<br />
jausnen gehen dürfen. Ich habe leider<br />
gerade keine Zeit – ich gehe erst später.<br />
Nach dem wir alle gejausnet haben, räumen<br />
wir gemeins<strong>am</strong> auf. Dann setzen wir uns zu<br />
den Tischen, wir singen ein paar Lieder und<br />
überlegen welche Kinder heute fehlen.<br />
28
Dann gehen wir gemeins<strong>am</strong> in den Turnsaal<br />
und spielen ein paar Spiele, das macht<br />
Spaß!<br />
Jetzt gehen wir Schulanfänger in den<br />
Schulkindraum und machen eine Reise ins<br />
Zahlenland. Derweil darf meine Schwester<br />
in unserer Gruppe ein neues Lied lernen.<br />
Danach treffen wir uns alle wieder im<br />
Garten, da ist es heute schon richtig warm<br />
und wir treffen auch die Kinder aus den<br />
anderen Gruppen.<br />
Meine Schwester und ich dürfen heute<br />
sogar im Kindergarten zu Mittag essen, das<br />
schmeckt lecker!<br />
Als die meisten Kinder abgeholt sind, gehe<br />
ich mit den anderen Schulanfänger in die<br />
obere Gruppe. Dort spielen wir <strong>am</strong> Tisch,<br />
und später liest und die Kindergärtnerin ein<br />
Buch in der Bücherei vor.<br />
Meine kleine Schwester geht derweil mit den<br />
jüngeren Kindern in den Rhythmikraum –<br />
dort hören sie ein Geschichte und rasten<br />
oder schlafen.<br />
29
Danach treffen wir uns alle wieder in der<br />
Gruppe in der wir in der Früh schon waren.<br />
Wir spielen noch ein wenig gemeins<strong>am</strong>. Und<br />
dann kommt schon unsere M<strong>am</strong>i. Wir<br />
räumen schnell auf und verabschieden uns!<br />
… Das war ein schöner Tag. Ich freu<br />
mich schon auf morgen!<br />
13.2.6 Grundsätzliches<br />
‣ Die Kinder werden grundsätzlich von den Eltern bzw. befugten Personen der<br />
Kindergartenpädagogin übergeben und bei dieser auch wieder abgeholt<br />
‣ Von 07.00 Uhr bis 07.30 Uhr ist eine S<strong>am</strong>melgruppe eingerichtet<br />
‣ Die Kinder sollen spätestens bis 09.00 Uhr in den Kindergarten gebracht werden<br />
‣ Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr können jene Kinder abgeholt werden die nur<br />
halbtags im Kindergarten bleiben<br />
Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr ist Mittagsruhe, anschließend können die<br />
in der bis 17.00 Uhr wieder abgeholt werden<br />
30
13.2.7 Besondere Tage und Aktivitäten<br />
‣ Geburtstage<br />
Das Geburtstagskind wird bereits beim Kommen in den Mittelpunkt gestellt. Der<br />
Tagesablauf wird so geplant, dass eine gemeins<strong>am</strong>e Geburtstagsjause und eine<br />
kleine Feier in der Gruppe stattfindet.<br />
‣ Altershomogene Gruppe<br />
Einmal in der Woche treffen sich die Schulanfänger zum Schulanfängertag im<br />
Raum einer Schulkindgruppe. Die altershomogene Gruppe ist in unserer<br />
Einrichtung eine beliebte und bewährte Form der Schulvorbereitung. Die<br />
Kindergartenpädagoginnen arbeiten an diesem Vormittag an verschiedensten<br />
Projekten zur Schulvorbereitung, durch die die Kinder auf vielfältige Art und<br />
Weise gefördert werden. Beispiele: Sprechzeichnen, Reise ins Zahlenland, Reise<br />
ins Buchstabenland, Verkehrserziehung,...<br />
Die jüngeren und mittleren Kinder verbringen den Vormittag in ruhiger<br />
Atmosphäre mit einer Kindergartenpädagogin in der St<strong>am</strong>mgruppe. Dadurch<br />
ergibt sich ein passender Rahmen, um auf die Bedürfnisse dieser Altersstufen<br />
einzugehen.<br />
13.2.8 Übertritt in die Schule<br />
Der Kindergarten organisiert Schulanfängerinformationsveranstaltungen, in denen<br />
den Eltern vermittelt wird, wie die Schulvorbereitung abläuft. Außerdem stehen<br />
alle Kindergartenpädagoginnen den Eltern für Elterngespräche jederzeit zur<br />
Verfügung. Die Eltern geben auch eine Einverständniserklärung ab, um Schule<br />
und Kindergarten einen Informationsaustausch über ihre Kinder zu ermöglichen.<br />
Am Ende des Kindergartenjahres wird ein Abschiedsfest für die Schulanfänger<br />
und deren Eltern veranstaltet.<br />
31
13.3 Schulkindgruppe:<br />
13.3.1 Spezifische Ziele der Altersgruppe 6-10 Jahre<br />
‣ Förderung der Individualität:<br />
Wir fördern die Individualität der Kinder durch altersadäquate Angebote im<br />
Bereich der Freizeitgestaltung und berücksichtigen Interessen und Neigungen,<br />
sowie emotionale und soziale Bedürfnisse.<br />
‣ Förderung der Lernmotivation:<br />
Durch gemeins<strong>am</strong>es Erledigen der Hausaufgaben und die Einbeziehung von<br />
didaktischem Material wird die Lernmotivation gesteigert.<br />
‣ Förderung der Gruppenfähigkeit:<br />
Durch unsere Betreuungssituation können die Kinder in unterschiedlichen<br />
Sozialformen tätig sein. Bei gruppenübergreifenden Aktivitäten bilden sich neue<br />
soziale Strukturen. Beim täglichen Gruppengeschehen wird Kooperation geübt<br />
und Freundschaften bilden sich.<br />
‣ Förderung des Selbstvertrauens und der Selbstverantwortung:<br />
Aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern wird für eine persönliche Gestaltung der<br />
Alltagsroutine gesorgt. Die Kinder werden ihrem Alter entsprechend zur<br />
selbständigen Bewältigung einfacher Tätigkeiten ermutigt. Z.B.:<br />
Eigenverantwortung für persönliche Dinge übernehmen, Arbeitshaltung,<br />
Tischkultur,...<br />
Durch die Wertschätzung der Kinder und ein positives Gruppenklima kann sich<br />
jedes Kind entfalten und gewinnt Selbstvertrauen.<br />
13.3.2 Wiederkommen in die Nachmittagsbetreuung in der<br />
Schulkindgruppe<br />
Da bei einem Großteil der Kinder der Erstkontakt mit unserer Einrichtung während<br />
der Kindergartenzeit bereits gegeben ist, ist die Eingewöhnung und der Übergang<br />
in die Schulkindgruppe meist ohne Probleme bewältigbar. Die Schulkindgruppen<br />
und die Schule stehen in engem Kontakt und ständigem Informationsaustausch.<br />
13.3.3 Tagesablauf in der Schulkindgruppe<br />
‣ Ankommen: Die Kinder kommen von der Schule und werden empfangen. Sie<br />
können Erlebnisse erzählen, sich ausruhen und sich in unterschiedlichen<br />
Sozialformen mit dem angebotenen Spielmaterial beschäftigen.<br />
‣ Mittagessen: Die Kinder gehen jeweils zu acht in den Speiseraum, holen ihr<br />
Tischkärtchen, nehmen das Essen zu sich und kehren anschließend in ihren<br />
Gruppenraum zurück.<br />
‣ Individuell gestaltete Spielphase: Jene Kinder die fünf Stunden Unterricht<br />
haben, kommen in dieser Zeit, gehen essen und beschäftigen sich anschließend<br />
ebenfalls im Gruppenraum.<br />
‣ Bewegungsausgleich im Garten oder im Turnsaal/ Zeit für<br />
Bildungsangebote<br />
‣ Lernzeit: Die Kinder erledigen selbständig in ruhiger und entspannter<br />
Atmosphäre ihre Hausaufgaben und erhalten von den Hortpädagoginnen die<br />
notwendige Unterstützung<br />
‣ Individuell gestaltete Spielphase: Bildungsangebote und Impulse werden den<br />
Interessen der Kinder entsprechend gesetzt<br />
‣ Ausklangs- und Abholphase: Die Kinder werden abgeholt oder nach<br />
Vereinbarung nach Hause geschickt.<br />
Besondere Tage, wie Geburtstage, religiöse Feste und Feste im<br />
Jahreskreislauf sind in der Planung von den Rahmenbedingungen und den<br />
Erzieherpersönlichkeiten abhängig.<br />
32
Für den Inhalt verantwortlich<br />
Mag. Kendler Marlene, Riedl Katharina, Speckbacher Brigitte, Maurer Sabine<br />
Gassner Sabine, Mag. Greifeneder-Frah<strong>am</strong>er Heidi, Hohenauer Bettina<br />
Kreil Elisabeth, Schropp Cornelia, Moser Ulrike, Reichhold Ricarda, Ferner Gerda<br />
Mag. (FH) Weiß Brigitte, Eder Sabrina, Gollackner Agnes<br />
Ein besonderer Dank gilt<br />
unserer ehemaligen Leiterin Frau Wagner Barbara,<br />
unseren ehemaligen Kolleginnen<br />
Lindenthaler Martina und Trickl Evelyn<br />
und<br />
unserer Fachinspektorin Frau Baumann Monika<br />
für die Unterstützung bei der Erstellung unseres Konzeptes.<br />
33
Anhang<br />
Quellennachweis:<br />
‣ http://www.salzburg.gv.at/kinderbetreuung<br />
o<br />
41. Gesetz vom <strong>18</strong>. April 2007 über die Kinderbetreuung im Land Salzburg<br />
(Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 2007)<br />
o Handbuch zur Erstellung eines Pädagogischen Konzeptes nach den<br />
Inhaltskriterien im Bundesland Salzburg<br />
‣ Methoden des Kindergartens, Band 2, 4. Auflage, Jahr 2000<br />
34