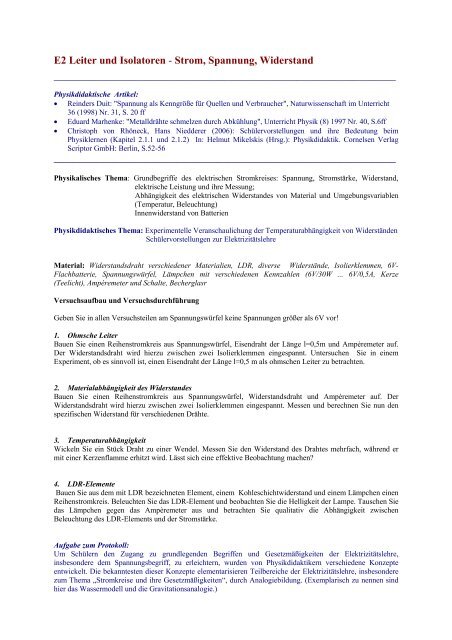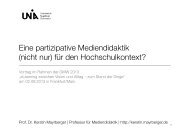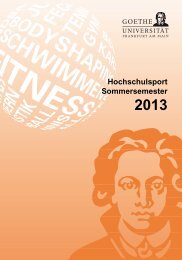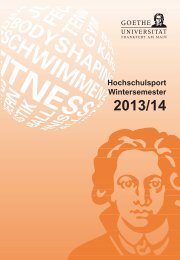E2 Leiter und Isolatoren - Strom, Spannung, Widerstand
E2 Leiter und Isolatoren - Strom, Spannung, Widerstand
E2 Leiter und Isolatoren - Strom, Spannung, Widerstand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>E2</strong> <strong>Leiter</strong> <strong>und</strong> <strong>Isolatoren</strong> - <strong>Strom</strong>, <strong>Spannung</strong>, <strong>Widerstand</strong><br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Physikdidaktische Artikel:<br />
• Reinders Duit: "<strong>Spannung</strong> als Kenngröße für Quellen <strong>und</strong> Verbraucher", Naturwissenschaft im Unterricht<br />
36 (1998) Nr. 31, S. 20 ff<br />
• Eduard Marhenke: "Metalldrähte schmelzen durch Abkühlung", Unterricht Physik (8) 1997 Nr. 40, S.6ff<br />
• Christoph von Rhöneck, Hans Niedderer (2006): Schülervorstellungen <strong>und</strong> ihre Bedeutung beim<br />
Physiklernen (Kapitel 2.1.1 <strong>und</strong> 2.1.2) In: Helmut Mikelskis (Hrsg.): Physikdidaktik. Cornelsen Verlag<br />
Scriptor GmbH: Berlin, S.52-56<br />
___________________________________________________________________________<br />
Physikalisches Thema: Gr<strong>und</strong>begriffe des elektrischen <strong>Strom</strong>kreises: <strong>Spannung</strong>, <strong>Strom</strong>stärke, <strong>Widerstand</strong>,<br />
elektrische Leistung <strong>und</strong> ihre Messung;<br />
Abhängigkeit des elektrischen <strong>Widerstand</strong>es von Material <strong>und</strong> Umgebungsvariablen<br />
(Temperatur, Beleuchtung)<br />
Innenwiderstand von Batterien<br />
Physikdidaktisches Thema: Experimentelle Veranschaulichung der Temperaturabhängigkeit von Widerständen<br />
Schülervorstellungen zur Elektrizitätslehre<br />
Material: <strong>Widerstand</strong>sdraht verschiedener Materialien, LDR, diverse Widerstände, Isolierklemmen, 6V-<br />
Flachbatterie, <strong>Spannung</strong>swürfel, Lämpchen mit verschiedenen Kennzahlen (6V/30W ... 6V/0,5A, Kerze<br />
(Teelicht), Ampèremeter <strong>und</strong> Schalte, Becherglasr<br />
Versuchsaufbau <strong>und</strong> Versuchsdurchführung<br />
Geben Sie in allen Versuchsteilen am <strong>Spannung</strong>swürfel keine <strong>Spannung</strong>en größer als 6V vor!<br />
1. Ohmsche <strong>Leiter</strong><br />
Bauen Sie einen Reihenstromkreis aus <strong>Spannung</strong>swürfel, Eisendraht der Länge l=0,5m <strong>und</strong> Ampèremeter auf.<br />
Der <strong>Widerstand</strong>sdraht wird hierzu zwischen zwei Isolierklemmen eingespannt. Untersuchen Sie in einem<br />
Experiment, ob es sinnvoll ist, einen Eisendraht der Länge l=0,5 m als ohmschen <strong>Leiter</strong> zu betrachten.<br />
2. Materialabhängigkeit des <strong>Widerstand</strong>es<br />
Bauen Sie einen Reihenstromkreis aus <strong>Spannung</strong>swürfel, <strong>Widerstand</strong>sdraht <strong>und</strong> Ampèremeter auf. Der<br />
<strong>Widerstand</strong>sdraht wird hierzu zwischen zwei Isolierklemmen eingespannt. Messen <strong>und</strong> berechnen Sie nun den<br />
spezifischen <strong>Widerstand</strong> für verschiedenen Drähte.<br />
3. Temperaturabhängigkeit<br />
Wickeln Sie ein Stück Draht zu einer Wendel. Messen Sie den <strong>Widerstand</strong> des Drahtes mehrfach, während er<br />
mit einer Kerzenflamme erhitzt wird. Lässt sich eine effektive Beobachtung machen?<br />
4. LDR-Elemente<br />
Bauen Sie aus dem mit LDR bezeichneten Element, einem Kohleschichtwiderstand <strong>und</strong> einem Lämpchen einen<br />
Reihenstromkreis. Beleuchten Sie das LDR-Element <strong>und</strong> beobachten Sie die Helligkeit der Lampe. Tauschen Sie<br />
das Lämpchen gegen das Ampèremeter aus <strong>und</strong> betrachten Sie qualitativ die Abhängigkeit zwischen<br />
Beleuchtung des LDR-Elements <strong>und</strong> der <strong>Strom</strong>stärke.<br />
Aufgabe zum Protokoll:<br />
Um Schülern den Zugang zu gr<strong>und</strong>legenden Begriffen <strong>und</strong> Gesetzmäßigkeiten der Elektrizitätslehre,<br />
insbesondere dem <strong>Spannung</strong>sbegriff, zu erleichtern, wurden von Physikdidaktikern verschiedene Konzepte<br />
entwickelt. Die bekanntesten dieser Konzepte elementarisieren Teilbereiche der Elektrizitätslehre, insbesondere<br />
zum Thema „<strong>Strom</strong>kreise <strong>und</strong> ihre Gesetzmäßigkeiten“, durch Analogiebildung. (Exemplarisch zu nennen sind<br />
hier das Wassermodell <strong>und</strong> die Gravitationsanalogie.)
Eine ehemalige Kollegin hat die Wasseranalogie <strong>und</strong> die Gravitationsanalogie zum elektrischen <strong>Strom</strong>kreis wie<br />
folgt kombiniert, um ihren Schülern die Leitungseigenschaften eines ohmschen <strong>Widerstand</strong>es inklusive einer<br />
Vermessung des durch ihn fließenden <strong>Strom</strong>es sowie der zwischen seinen Enden abfallenden <strong>Spannung</strong> nahe zu<br />
bringen. Die Analogiebildung nimmt sie anhand folgender Zeichnung vor:<br />
Am unteren Rohrende im Wasserfluss<br />
angebrachte Sonde zur Messung des<br />
Wasservolumendurchsatzes pro Sek<strong>und</strong>e<br />
∆V/s<br />
Wasserbassin<br />
auf der Höhe h1 Wasserrohr Ohmscher <strong>Leiter</strong> (<strong>Widerstand</strong>)<br />
Querschnittsfläche A der Querschnittsfläche A<br />
<strong>und</strong> der Länge l <strong>und</strong> der Länge l<br />
Gleich-<br />
Metermaßstab Wasserbassin auf der Höhe h2<br />
<strong>Spannung</strong> Uo<br />
A<br />
Ampèremeter Voltmeter<br />
a) Führen Sie die Analogiebildung in Worten aus. Orientieren Sie sich bei Ihrer Ausführungen an dem Schema,<br />
das Kircher, Girwidz <strong>und</strong> Häußler für die konkrete Analogiebildung aufgestellt haben (exemplarisch vorgestellt<br />
für das Beispiel der Wasseranalogie).<br />
b) Welche Schwierigkeiten sehen Sie in Hinblick auf die vorgenommene Analogiebildung. Orientieren Sie sich<br />
auch hier in Ihrer Antwort (zunächst) an den Schwierigkeiten, die nach Kircher, Girwidz <strong>und</strong> Häußler (siehe zu<br />
entsprechende Literturempfehlung zu E3) im Zusammenhang mit der Analogiebildung allgemein auftreten<br />
(können). Ergänzen Sie diesen Schwierigkeitskatalog, soweit Sie es in Hinblick auf das gegebene Beispiel für<br />
nötig halten!<br />
5. Schmelzen Metalldrähte bei Abkühlung?<br />
Erproben Sie den Versuch "Metalldrähte schmelzen durch Abkühlung", den Eduard Marhenke in der<br />
Zeitschrift Unterricht Physik (8) 1997 Nr. 40, S.6ff vorgestellt hat, auf seine Praktikabilität. Vollziehen Sie die<br />
vom Autor gegebene Erklärung nach <strong>und</strong> geben Sie eine Erläuterung in eigenen Worten.<br />
Überlegen Sie sich, an welcher Stelle einer Unterrichtseinheit zum Thema "<strong>Strom</strong> <strong>und</strong> <strong>Strom</strong>kreise" bzw. "<strong>Strom</strong><br />
<strong>und</strong> Gesetze" 1 Sie den Versuch in welcher Form (Schülerexperiment/Lehrerexperiment;<br />
Demonstrationsexperiment im darlegenden Unterricht/Experiment im frei-forschenden oder gelenktentdeckenden<br />
Unterricht) einsetzen würden.<br />
Welche physikalischen Kenntnisse sollten die Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern mitbringen bzw. welche Kenntnisse<br />
können anhand des Versuches vermittelt werden?<br />
Welche im Bereich der Elektrizitätslehre typischen Schülervorstellungen sollten Sie bei der Behandlung des<br />
Versuchs berücksichtigen?<br />
6. <strong>Spannung</strong>en als Kenngröße für Quellen <strong>und</strong> Verbraucher<br />
Bauen Sie einen Reihenstromkreis aus Batterie, einem der Lämpchen (mit zur Batterie passender<br />
<strong>Spannung</strong>skennzahl <strong>und</strong> möglichst großer <strong>Strom</strong>stärke- bzw. Leistungskennzahl) <strong>und</strong> Ampèremeter auf. Messen<br />
Sie die Stärke des <strong>Strom</strong>flusses durch das Lämpchen <strong>und</strong> sowie die an ihm abfallende <strong>Spannung</strong> für<br />
verschiedene Leistungs- bzw. <strong>Strom</strong>stärkekennzahlen. Wiederholen Sie die Messung je Lämpchen mit einem<br />
<strong>Spannung</strong>swürfel anstelle der Batterie als <strong>Spannung</strong>squelle. Vergleichen Sie Ihre Messwerte für die am<br />
1<br />
Im aktuellen Lehrplan Physik für den Bildungsgang Realschule vorgesehene Inhaltsfelder für Behandlung des<br />
Themas Elektrizitätslehre in der 8. Klasse.<br />
V
Lämpchen abfallende <strong>Spannung</strong> <strong>und</strong> die <strong>Strom</strong>stärke im <strong>Strom</strong>kreis mit den Kennzahlen auf der<br />
Lämpchenfassung. Wie erklären Sie Abweichungen zwischen Ihren Messergebnissen <strong>und</strong> den Kennzahlen auf<br />
den Lämpchen bzw. der Batterie?<br />
Hinweis: Keine der beigegebenen Lampen ist defekt, auch wenn Sie wider Erwarten nicht leuchten sollte.<br />
Messen Sie in jedem Fall <strong>Strom</strong> <strong>und</strong> <strong>Spannung</strong>.<br />
Aufgabe zum Protokoll:<br />
Was sollten Ihre Schüler zum Thema "<strong>Spannung</strong> als Kenngröße für Quellen <strong>und</strong> Verbrauchern" wissen, was zum<br />
Thema "<strong>Strom</strong>stärke- <strong>und</strong> Leistungskennzahlen" auf Quellen <strong>und</strong> Verbrauchern.<br />
7. Detektion von <strong>Spannung</strong>spolen mit der Glimmlampe<br />
Schließen Sie eine Glimmlampe zunächst an 100V Gleichspannung an. Vertauschen Sie anschließend die Pole.<br />
Schließen Sie die Glimmlampe danach an Netzspannung an. Benutzen Sie dazu den Zwischenschalter.<br />
Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen!<br />
8. Messbereichserweiterung von Ampèremetern <strong>und</strong> Voltmetern<br />
Im Versuchsteil 7 haben Sie mit vergleichsweise hohen (im Schulunterricht gemeinhin ungewöhnlichen, weil für<br />
den Menschen auch im Gleichspannungsfall nicht ungefährlichen) <strong>Spannung</strong>en gearbeitet. Nicht immer steht ein<br />
Voltmeter zur Verfügung, mit dem man entsprechend große <strong>Spannung</strong>en messen kann. Das gleiche gilt für das<br />
Messen hoher Ströme. Wissen Sie sich zu helfen, wenn die Sammlung Ihrer Schule in dieser Hinsicht einmal<br />
ungenügend ausgestattet ist?<br />
___________________________________________________________________________<br />
Einschub : Der Messbereich bei Ampèremetern <strong>und</strong> Voltmetern<br />
Jedes Ampèremeter hat aufgr<strong>und</strong> seiner Konstruktion einen ganz bestimmten Meßbereich. Wir betrachten als Beispiel ein Amperemeter mit<br />
dem inneren <strong>Widerstand</strong> R i . Es möge einen Meßbereich von 10mA besitzen <strong>und</strong> so kalibriert sein, daß einem Skalenteil 1mA entspricht.<br />
Wenn man einen über 10mA hinausgehenden <strong>Strom</strong> durch das Meßgerät schickt, so bewirkt dieser eine Erhitzung oder sogar ein<br />
Durchschmelzen der Spule; in jedem Fall wird das Gerät beschädigt.<br />
Trotzdem kann man aber mit diesem Gerät unter Ausnutzung des 2. Kirchhoffschen Gesetzes (Knotenregel) derartige Ströme messen. Wenn<br />
man etwa den Messbereich auf 100mA erweitern will, so muß man dafür sorgen, daß nur ein bestimmter Bruchteil des Gesamtstromes durch<br />
das Meßgerät geht. Dies wird erreicht, indem man parallel zum Amperemeter einen <strong>Widerstand</strong> R x von solcher Größe schaltet, daß 1/10<br />
des Gesamtstroms durch das Meßgerät <strong>und</strong> 9/10 durch den <strong>Widerstand</strong> R x fließen. Beachtet man, daß der innere <strong>Widerstand</strong> des<br />
Amperemeters R i beträgt, so muß nach dem 2. Kirchhoffschen Gesetz die Beziehung Rx/Ri=(1/10 *I )/ (9/10* I) gelten, d.h., es muß sein<br />
R x = 1/9 R i .<br />
Für die Erweiterung des Messbereichs bei Amperemetern gilt allgemein:<br />
Man kann den Meßbereich eines Amperemeters mit dem Inneren <strong>Widerstand</strong> R i dadurch auf das 10-, 100- <strong>und</strong> 1000fache erweitern,<br />
indem man einen Zweigwiderstand (Shunt) von<br />
1<br />
R i ,<br />
9<br />
1<br />
R i <strong>und</strong><br />
99<br />
1<br />
R i parallel zum Amperemeter schaltet.<br />
999<br />
________________________________________________________________________________________________________________<br />
Für die Erweiterung des Messbereichs bei Voltmetern gilt allgemein:<br />
Man kann den Meßbereich eines Voltmeters mit dem Innenwiderstand R i dadurch auf das 10-, 100-, <strong>und</strong> 1000fache erweitern, indem<br />
man einen Vorwiderstand von 9 R i , 99 R i <strong>und</strong> 999 R i in Reihe mit dem Voltmeter schaltet.<br />
zum Protokoll: Begründen Sie diese Regel!<br />
________________________________________________________________________________________________________________
Geeignete Nebenschluß- oder Vorwiderstände werden von der Industrie zu den Meßinstrumenten geliefert <strong>und</strong> brauchen nur ausgewechselt<br />
werden. In modernen Meßinstrumenten sind diese Widerstände fest eingebaut <strong>und</strong> können durch einen Schalter hinzugeschaltet werden.<br />
Abb.1 Erweiterung des Meßbereichs beim Ampèremeter<br />
(schematische Darstellung, "R" bezeichnet den Shunt!<br />
Verwenden Sie eines der klassischen<br />
Kombimessgeräte („kleine schwarze Kästen“) als<br />
Ampèremeter. Schalten Sie es zunächst über die<br />
normalen Eingangsbuchsen in Reihe mit dem rot<br />
gekennzeichneten <strong>Widerstand</strong> <strong>und</strong> einem<br />
<strong>Spannung</strong>swürfel. Geben Sie dabei eine externe<br />
<strong>Spannung</strong> von Uo= 10 V vor.<br />
Ermitteln Sie nun, welchen <strong>Widerstand</strong> Sie wie (in<br />
welcher Art der Schaltung) zu den<br />
Meßwerkseingangsbuchsen schalten müssten, um<br />
das Meßwerk im gegebenen Fall (für den<br />
gegebenen <strong>Widerstand</strong> <strong>und</strong> die genannte externe<br />
<strong>Spannung</strong> Uo) zur <strong>Strom</strong>messung zu nutzen, ohne<br />
es zu beschädigen. (Das Meßwerk darf maximal<br />
von einem <strong>Strom</strong> der Stärke von 1 mA durchflossen<br />
Abb.2 Erweiterung des Meßbereichs beim Voltmeter<br />
(schematische Darstellung)<br />
werden). Wählen Sie auf Gr<strong>und</strong>lage Ihrer<br />
theoretischen Überlegungen aus den gegebenen<br />
Widerständen einen <strong>Widerstand</strong> zur schadfreien<br />
externen Erweiterung ein. Nehmen Sie die externe<br />
Erweiterung vor. Führen Sie nun eine<br />
<strong>Strom</strong>messung durch. (Bitte zur Überprüfung<br />
zunächst einen Betreuer rufen.<br />
Entspricht die an der Skala des Meßwerks abgelesene Größe Ihren Erwartungen für die von Ihnen<br />
vorgenommene Meßbereichserweiterung?<br />
Dokumentieren Sie Ihre Arbeit mit entsprechenden Messwerten.<br />
Rs