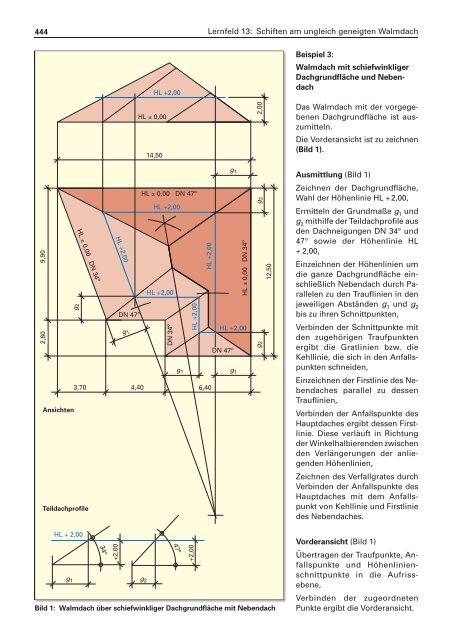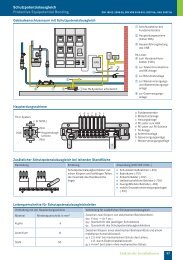Lernfeld 13: Schiften am ungleich geneigten Walmdach 444 Beispiel 3
Lernfeld 13: Schiften am ungleich geneigten Walmdach 444 Beispiel 3
Lernfeld 13: Schiften am ungleich geneigten Walmdach 444 Beispiel 3
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>444</strong><br />
<strong>Lernfeld</strong> <strong>13</strong>: <strong>Schiften</strong> <strong>am</strong> <strong>ungleich</strong> <strong>geneigten</strong> <strong>Walmdach</strong><br />
HL ± 0,00<br />
HL +2,00<br />
14,50<br />
2,00<br />
<strong>Beispiel</strong> 3:<br />
<strong>Walmdach</strong> mit schiefwinkliger<br />
Dachgrundfläche und Nebendach<br />
Das <strong>Walmdach</strong> mit der vorgegebenen<br />
Dachgrundfläche ist auszumitteln.<br />
Die Vorderansicht ist zu zeichnen<br />
(Bild 1).<br />
2,60<br />
9,90<br />
g 2<br />
HL ± 0,00 DN 34º<br />
3,70<br />
Ansichten<br />
Teildachprofile<br />
HL +2,00<br />
g 1<br />
g 1<br />
HL ± 0,00 DN 47º<br />
HL +2,00<br />
HL +2,00<br />
DN 47º<br />
DN 34º<br />
HL +2,00<br />
HL +2,00<br />
HL ± 0,00 DN 34º<br />
HL +2,00<br />
DN 47º<br />
g 1<br />
g 1<br />
4,40 6,40<br />
g 2 g 2<br />
12,50<br />
Ausmittlung (Bild 1)<br />
Zeichnen der Dachgrundfläche,<br />
Wahl der Höhenlinie HL + 2,00,<br />
Ermitteln der Grundmaße g 1 und<br />
g 2 mithilfe der Teildachprofile aus<br />
den Dachneigungen DN 34° und<br />
47° sowie der Höhenlinie HL<br />
+ 2,00,<br />
Einzeichnen der Höhenlinien um<br />
die ganze Dachgrundfläche einschließlich<br />
Nebendach durch Parallelen<br />
zu den Trauflinien in den<br />
jeweiligen Abständen g 1 und g 2<br />
bis zu ihren Schnittpunkten,<br />
Verbinden der Schnittpunkte mit<br />
den zugehörigen Traufpunkten<br />
ergibt die Gratlinien bzw. die<br />
Kehllinie, die sich in den Anfallspunkten<br />
schneiden,<br />
Einzeichnen der Firstlinie des Nebendaches<br />
parallel zu dessen<br />
Trauflinien,<br />
Verbinden der Anfallspunkte des<br />
Hauptdaches ergibt dessen Firstlinie.<br />
Diese verläuft in Richtung<br />
der Winkelhalbierenden zwischen<br />
den Verlängerungen der anliegenden<br />
Höhenlinien,<br />
Zeichnen des Verfallgrates durch<br />
Verbinden der Anfallspunkte des<br />
Hauptdaches mit dem Anfallspunkt<br />
von Kehllinie und Firstlinie<br />
des Nebendaches.<br />
HL + 2,00<br />
34º<br />
+2,00<br />
g 1 g 2<br />
Bild 1: <strong>Walmdach</strong> über schiefwinkliger Dachgrundfläche mit Nebendach<br />
47º<br />
+2,00<br />
Vorderansicht (Bild 1)<br />
Übertragen der Traufpunkte, Anfallspunkte<br />
und Höhenlinienschnittpunkte<br />
in die Aufrissebene,<br />
Verbinden der zugeordneten<br />
Punkte ergibt die Vorderansicht.
464<br />
<strong>Lernfeld</strong> 14: Einbau von Dachgauben und Dachflächenfenstern<br />
14.2 <strong>Lernfeld</strong>-Kenntnisse<br />
Schleppdachgaube<br />
Spitzdachgaube<br />
Bild 1: Dachgauben<br />
Trapezdachgaube<br />
Satteldachgaube<br />
14.2.1 Dachgauben<br />
Die Form und Konstruktion der<br />
Dachgaube richtete sich früher<br />
meist nach den zur Verfügung stehenden<br />
Baustoffen. So hat z. B. die<br />
Fledermausgaube eine Form, die<br />
aus der Zeit des Stroh- und Reetdaches<br />
st<strong>am</strong>mt. Im Laufe ihrer<br />
Entwicklung wurden Gauben jedoch<br />
immer mehr zur Gestaltung<br />
des Bauwerks herangezogen, da<br />
Materialien wie Walzbleche oder<br />
ähnlich formbare Baustoffe jede<br />
Gaubenform ermöglichten. Nach<br />
der Form unterscheidet man<br />
Schleppdach-, Satteldach-, <strong>Walmdach</strong>-,<br />
Spitzdach-, Trapezdach-,<br />
Rund- und Fledermausgauben.<br />
Aus der Vielzahl von Gaubenformen<br />
haben sich vor allem die<br />
Schleppdachgaube, die Trapezdachgaube<br />
und die Satteldachgaube<br />
in vielen Regionen als Dachaufbau<br />
durchgesetzt (Bild 1).<br />
Gaubensparren<br />
Wandpfette<br />
Sturzriegel<br />
Fachriegel<br />
Brüstungsriegel<br />
Gaubenpfosten<br />
Vordachsparren<br />
Bild 2: Gaubenbauteile und Konstruktionshölzer<br />
Hauptdach<br />
Dachbruch<br />
Gaubendach<br />
Gaubenbacken<br />
Gaubenwand<br />
Backenriegel<br />
Backensparren<br />
Wandschwelle<br />
Beisparren<br />
Bundsparren<br />
14.2.1.1 Schleppdachgaube<br />
Gaubenform<br />
Die Schleppdachgaube ist die älteste<br />
Gaubenform. Mit ihr lassen<br />
sich durch einen einfachen Konstruktionsaufbau<br />
viel Licht und<br />
Wohnraum schaffen. Die Schleppdachgaube<br />
hat eine geneigte<br />
Dachfläche, eine vordere Gaubenwand<br />
und auf beiden Gaubenquerseiten<br />
jeweils schiefwinklige,<br />
dreieckige Wandflächen, die als<br />
Gaubenbacken bezeichnet werden.<br />
Die Dachneigung der<br />
Schleppdachgaube ist flacher als<br />
die des Hauptdaches. Der Übergang<br />
von Hauptdachfläche zur<br />
Gaubendachfläche nennt man<br />
Dachbruch (Bild 2).<br />
Gaubenkonstruktion<br />
Die Schleppdachgaube ist eine<br />
zimmermannsmäßige Holzkonstruktion.<br />
Sie besteht aus verschiedenen<br />
Konstruktionshölzern, die<br />
sich in ihren Bezeichnungen und<br />
Aufgaben unterscheiden (Tabelle<br />
1, Seite 465).