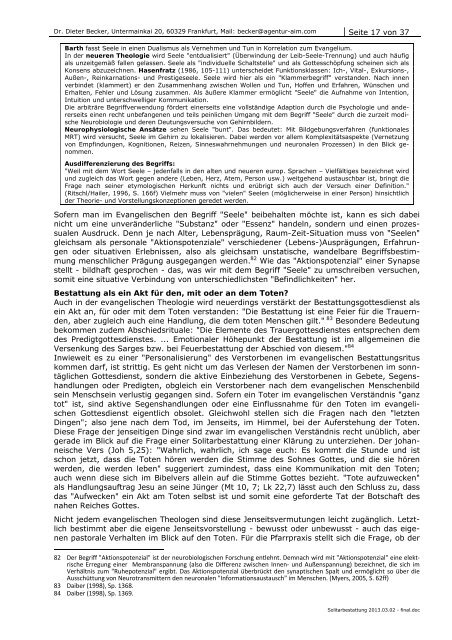Inhaltsverzeichnis Solitarbestattung - Winkelmesse ... - Agentur-aim
Inhaltsverzeichnis Solitarbestattung - Winkelmesse ... - Agentur-aim
Inhaltsverzeichnis Solitarbestattung - Winkelmesse ... - Agentur-aim
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. Dieter Becker, Untermainkai 20, 60329 Frankfurt, Mail: becker@agentur-<strong>aim</strong>.com Seite 17 von 37<br />
Barth fasst Seele in einen Dualismus als Vernehmen und Tun in Korrelation zum Evangelium.<br />
In der neueren Theologie wird Seele "entdualisiert" (Überwindung der Leib-Seele-Trennung) und auch häufig<br />
als unzeitgemäß fallen gelassen. Seele als "individuelle Schaltstelle" und als Gottesschöpfung scheinen sich als<br />
Konsens abzuzeichnen. Hasenfratz (1986, 105-111) unterscheidet Funktionsklassen: Ich-, Vital-, Exkursions-,<br />
Außen-, Reinkarnations- und Prestigeseele. Seele wird hier als ein "Klammerbegriff" verstanden. Nach innen<br />
verbindet (klammert) er den Zusammenhang zwischen Wollen und Tun, Hoffen und Erfahren, Wünschen und<br />
Erhalten, Fehler und Lösung zusammen. Als äußere Klammer ermöglicht "Seele" die Aufnahme von Intention,<br />
Intuition und unterschwelliger Kommunikation.<br />
Die arbiträre Begriffverwendung fördert einerseits eine vollständige Adaption durch die Psychologie und andererseits<br />
einen recht unbefangenen und teils peinlichen Umgang mit dem Begriff "Seele" durch die zurzeit modische<br />
Neurobiologie und deren Deutungsversuche von Gehirnbildern.<br />
Neurophysiologische Ansätze sehen Seele "bunt". Das bedeutet: Mit Bildgebungsverfahren (funktionales<br />
MRT) wird versucht, Seele im Gehirn zu lokalisieren. Dabei werden vor allem Komplexitätsaspekte (Vernetzung<br />
von Empfindungen, Kognitionen, Reizen, Sinneswahrnehmungen und neuronalen Prozessen) in den Blick genommen.<br />
Ausdifferenzierung des Begriffs:<br />
"Weil mit dem Wort Seele – jedenfalls in den alten und neueren europ. Sprachen – Vielfältiges bezeichnet wird<br />
und zugleich das Wort gegen andere (Leben, Herz, Atem, Person usw.) weitgehend austauschbar ist, bringt die<br />
Frage nach seiner etymologischen Herkunft nichts und erübrigt sich auch der Versuch einer Definition."<br />
(Ritschl/Hailer, 1996, S. 166f) Vielmehr muss von "vielen" Seelen (möglicherweise in einer Person) hinsichtlich<br />
der Theorie- und Vorstellungskonzeptionen geredet werden.<br />
Sofern man im Evangelischen den Begriff "Seele" beibehalten möchte ist, kann es sich dabei<br />
nicht um eine unveränderliche "Substanz" oder "Essenz" handeln, sondern und einen prozessualen<br />
Ausdruck. Denn je nach Alter, Lebensprägung, Raum-Zeit-Situation muss von "Seelen"<br />
gleichsam als personale "Aktionspotenziale" verschiedener (Lebens-)Ausprägungen, Erfahrungen<br />
oder situativen Erlebnissen, also als gleichsam unstatische, wandelbare Begriffsbestimmung<br />
menschlicher Prägung ausgegangen werden. 82 Wie das "Aktionspotenzial" einer Synapse<br />
stellt - bildhaft gesprochen - das, was wir mit dem Begriff "Seele" zu umschreiben versuchen,<br />
somit eine situative Verbindung von unterschiedlichsten "Befindlichkeiten" her.<br />
Bestattung als ein Akt für den, mit oder an dem Toten?<br />
Auch in der evangelischen Theologie wird neuerdings verstärkt der Bestattungsgottesdienst als<br />
ein Akt an, für oder mit dem Toten verstanden: "Die Bestattung ist eine Feier für die Trauernden,<br />
aber zugleich auch eine Handlung, die dem toten Menschen gilt." 83 Besondere Bedeutung<br />
bekommen zudem Abschiedsrituale: "Die Elemente des Trauergottesdienstes entsprechen dem<br />
des Predigtgottesdienstes. ... Emotionaler Höhepunkt der Bestattung ist im allgemeinen die<br />
Versenkung des Sarges bzw. bei Feuerbestattung der Abschied von diesem." 84<br />
Inwieweit es zu einer "Personalisierung" des Verstorbenen im evangelischen Bestattungsritus<br />
kommen darf, ist strittig. Es geht nicht um das Verlesen der Namen der Verstorbenen im sonntäglichen<br />
Gottesdienst, sondern die aktive Einbeziehung des Verstorbenen in Gebete, Segenshandlungen<br />
oder Predigten, obgleich ein Verstorbener nach dem evangelischen Menschenbild<br />
sein Menschsein verlustig gegangen sind. Sofern ein Toter im evangelischen Verständnis "ganz<br />
tot" ist, sind aktive Segenshandlungen oder eine Einflussnahme für den Toten im evangelischen<br />
Gottesdienst eigentlich obsolet. Gleichwohl stellen sich die Fragen nach den "letzten<br />
Dingen"; also jene nach dem Tod, im Jenseits, im Himmel, bei der Auferstehung der Toten.<br />
Diese Frage der jenseitigen Dinge sind zwar im evangelischen Verständnis recht unüblich, aber<br />
gerade im Blick auf die Frage einer <strong>Solitarbestattung</strong> einer Klärung zu unterziehen. Der johanneische<br />
Vers (Joh 5,25): "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist<br />
schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören<br />
werden, die werden leben" suggeriert zumindest, dass eine Kommunikation mit den Toten;<br />
auch wenn diese sich im Bibelvers allein auf die Stimme Gottes bezieht. "Tote aufzuwecken"<br />
als Handlungsauftrag Jesu an seine Jünger (Mt 10, 7; Lk 22,7) lässt auch den Schluss zu, dass<br />
das "Aufwecken" ein Akt am Toten selbst ist und somit eine geforderte Tat der Botschaft des<br />
nahen Reiches Gottes.<br />
Nicht jedem evangelischen Theologen sind diese Jenseitsvermutungen leicht zugänglich. Letztlich<br />
bestimmt aber die eigene Jenseitsvorstellung - bewusst oder unbewusst - auch das eigenen<br />
pastorale Verhalten im Blick auf den Toten. Für die Pfarrpraxis stellt sich die Frage, ob der<br />
82 Der Begriff "Aktionspotenzial" ist der neurobiologischen Forschung entlehnt. Demnach wird mit "Aktionspotenzial" eine elektrische<br />
Erregung einer Membranspannung (also die Differenz zwischen Innen‐ und Außenspannung) bezeichnet, die sich im<br />
Verhältnis zum "Ruhepotenzial" ergibt. Das Aktionspotenzial überbrückt den synaptischen Spalt und ermöglicht so über die<br />
Ausschüttung von Neurotransmittern den neuronalen "Informationsaustausch" im Menschen. (Myers, 2005, S. 62ff)<br />
83 Daiber (1998), Sp. 1368.<br />
84 Daiber (1998), Sp. 1369.<br />
<strong>Solitarbestattung</strong> 2013.03.02 - final.doc