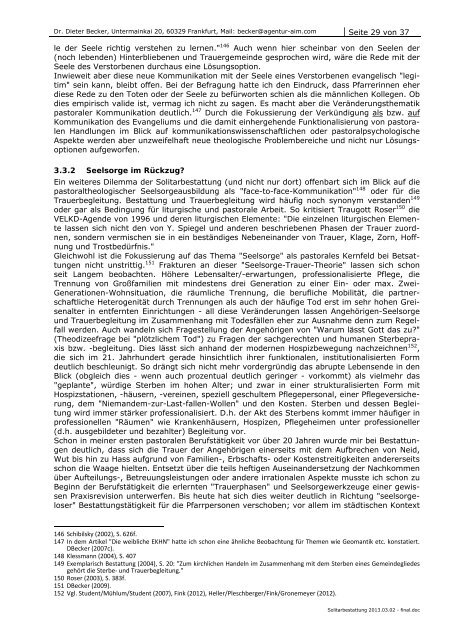Inhaltsverzeichnis Solitarbestattung - Winkelmesse ... - Agentur-aim
Inhaltsverzeichnis Solitarbestattung - Winkelmesse ... - Agentur-aim
Inhaltsverzeichnis Solitarbestattung - Winkelmesse ... - Agentur-aim
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. Dieter Becker, Untermainkai 20, 60329 Frankfurt, Mail: becker@agentur-<strong>aim</strong>.com Seite 29 von 37<br />
le der Seele richtig verstehen zu lernen." 146 Auch wenn hier scheinbar von den Seelen der<br />
(noch lebenden) Hinterbliebenen und Trauergemeinde gesprochen wird, wäre die Rede mit der<br />
Seele des Verstorbenen durchaus eine Lösungsoption.<br />
Inwieweit aber diese neue Kommunikation mit der Seele eines Verstorbenen evangelisch "legitim"<br />
sein kann, bleibt offen. Bei der Befragung hatte ich den Eindruck, dass Pfarrerinnen eher<br />
diese Rede zu den Toten oder der Seele zu befürworten schien als die männlichen Kollegen. Ob<br />
dies empirisch valide ist, vermag ich nicht zu sagen. Es macht aber die Veränderungsthematik<br />
pastoraler Kommunikation deutlich. 147 Durch die Fokussierung der Verkündigung als bzw. auf<br />
Kommunikation des Evangeliums und die damit einhergehende Funktionalisierung von pastoralen<br />
Handlungen im Blick auf kommunikationswissenschaftlichen oder pastoralpsychologische<br />
Aspekte werden aber unzweifelhaft neue theologische Problembereiche und nicht nur Lösungsoptionen<br />
aufgeworfen.<br />
3.3.2 Seelsorge im Rückzug?<br />
Ein weiteres Dilemma der <strong>Solitarbestattung</strong> (und nicht nur dort) offenbart sich im Blick auf die<br />
pastoraltheologischer Seelsorgeausbildung als "face-to-face-Kommunikation" 148 oder für die<br />
Trauerbegleitung. Bestattung und Trauerbegleitung wird häufig noch synonym verstanden 149<br />
oder gar als Bedingung für liturgische und pastorale Arbeit. So kritisiert Traugott Roser 150 die<br />
VELKD-Agende von 1996 und deren liturgischen Elemente: "Die einzelnen liturgischen Elemente<br />
lassen sich nicht den von Y. Spiegel und anderen beschriebenen Phasen der Trauer zuordnen,<br />
sondern vermischen sie in ein beständiges Nebeneinander von Trauer, Klage, Zorn, Hoffnung<br />
und Trostbedürfnis."<br />
Gleichwohl ist die Fokussierung auf das Thema "Seelsorge" als pastorales Kernfeld bei Betsattungen<br />
nicht unstrittig. 151 Frakturen an dieser "Seelsorge-Trauer-Theorie" lassen sich schon<br />
seit Langem beobachten. Höhere Lebensalter/-erwartungen, professionalisierte Pflege, die<br />
Trennung von Großfamilien mit mindestens drei Generation zu einer Ein- oder max. Zwei-<br />
Generationen-Wohnsituation, die räumliche Trennung, die berufliche Mobilität, die partnerschaftliche<br />
Heterogenität durch Trennungen als auch der häufige Tod erst im sehr hohen Greisenalter<br />
in entfernten Einrichtungen - all diese Veränderungen lassen Angehörigen-Seelsorge<br />
und Trauerbegleitung im Zusammenhang mit Todesfällen eher zur Ausnahme denn zum Regelfall<br />
werden. Auch wandeln sich Fragestellung der Angehörigen von "Warum lässt Gott das zu?"<br />
(Theodizeefrage bei "plötzlichem Tod") zu Fragen der sachgerechten und humanen Sterbepraxis<br />
bzw. -begleitung. Dies lässt sich anhand der modernen Hospizbewegung nachzeichnen 152 ,<br />
die sich im 21. Jahrhundert gerade hinsichtlich ihrer funktionalen, institutionalisierten Form<br />
deutlich beschleunigt. So drängt sich nicht mehr vordergründig das abrupte Lebensende in den<br />
Blick (obgleich dies - wenn auch prozentual deutlich geringer - vorkommt) als vielmehr das<br />
"geplante", würdige Sterben im hohen Alter; und zwar in einer strukturalisierten Form mit<br />
Hospizstationen, -häusern, -vereinen, speziell geschultem Pflegepersonal, einer Pflegeversicherung,<br />
dem "Niemandem-zur-Last-fallen-Wollen" und den Kosten. Sterben und dessen Begleitung<br />
wird immer stärker professionalisiert. D.h. der Akt des Sterbens kommt immer häufiger in<br />
professionellen "Räumen" wie Krankenhäusern, Hospizen, Pflegeheimen unter professioneller<br />
(d.h. ausgebildeter und bezahlter) Begleitung vor.<br />
Schon in meiner ersten pastoralen Berufstätigkeit vor über 20 Jahren wurde mir bei Bestattungen<br />
deutlich, dass sich die Trauer der Angehörigen einerseits mit dem Aufbrechen von Neid,<br />
Wut bis hin zu Hass aufgrund von Familien-, Erbschafts- oder Kostenstreitigkeiten andererseits<br />
schon die Waage hielten. Entsetzt über die teils heftigen Auseinandersetzung der Nachkommen<br />
über Aufteilungs-, Betreuungsleistungen oder andere irrationalen Aspekte musste ich schon zu<br />
Beginn der Berufstätigkeit die erlernten "Trauerphasen" und Seelsorgewerkzeuge einer gewissen<br />
Praxisrevision unterwerfen. Bis heute hat sich dies weiter deutlich in Richtung "seelsorgeloser"<br />
Bestattungstätigkeit für die Pfarrpersonen verschoben; vor allem im städtischen Kontext<br />
146 Schibilsky (2002), S. 626f.<br />
147 In dem Artikel "Die weibliche EKHN" hatte ich schon eine ähnliche Beobachtung für Themen wie Geomantik etc. konstatiert.<br />
DBecker (2007c).<br />
148 Klessmann (2004), S. 407<br />
149 Exemplarisch Bestattung (2004), S. 20: "Zum kirchlichen Handeln im Zusammenhang mit dem Sterben eines Gemeindegliedes<br />
gehört die Sterbe‐ und Trauerbegleitung."<br />
150 Roser (2003), S. 383f.<br />
151 DBecker (2009).<br />
152 Vgl. Student/Mühlum/Student (2007), Fink (2012), Heller/Pleschberger/Fink/Gronemeyer (2012).<br />
<strong>Solitarbestattung</strong> 2013.03.02 - final.doc