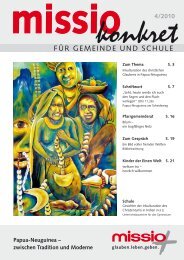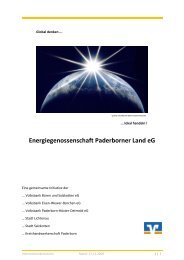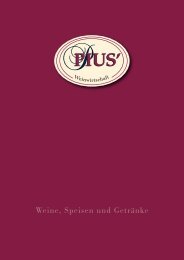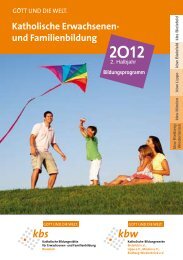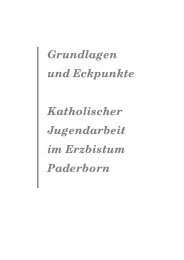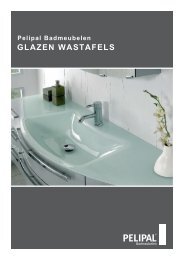9|10 2008
9|10 2008
9|10 2008
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fachmagazin für das österreichische Bankenmanagement<br />
<strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
www.bestbanking.at<br />
Schwerpunkt: Sicherheit<br />
Kollektivvertrag<br />
Sicherheit<br />
Antiskimming und<br />
Objektüberwachung<br />
Zeit für eine neue<br />
Sicherheitsstrategie?<br />
Islamic Banking und<br />
ethnisches Marketing<br />
bestbanking P.b.b. Verlagspostamt 1100 Wien, GZ: 06Z037041M Jahrgang 4 Euro: 8,–
www.iir.at/bargeld.html<br />
Effizientes Bargeldhandling<br />
kennt viele Möglichkeiten –<br />
wir zeigen Ihnen die Besten!<br />
IIR<br />
mit Medienpartner<br />
präsentieren<br />
Cash Handling in den Banken<br />
Strategien und Lösungen für eine optimale<br />
Kostensteuerung im Bargeldverkehr<br />
28. – 29. Jänner 2009, Arcotel Kaiserwasser, Wien<br />
Regulative und Zielsetzungen der EZB und OeNB –<br />
womit muss die Bankenlandschaft in Zukunft rechnen?<br />
Kernthema Bargeldoptimierung: Outsourcing,<br />
Cash Recycling und technische Innovationen<br />
Überfälle, Falschgeld und Bargeldmanipulation:<br />
Bargeld als Risikofaktor<br />
IHR PLUS!<br />
Ihre Experten:<br />
Armin Greif, Europäische Zentralbank (EZB)<br />
Dr. Stefan Augustin, Oesterreichische Nationalbank (OeNB)<br />
Dir. KR Karl Grünberger, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG<br />
Günter Ernst, GSA – Geldservice Austria<br />
Gerd Bokämper, Wincor Nixdorf International GmbH<br />
Peter Michael Seitz, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG<br />
Mag. (FH) Johann Friedl, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG<br />
Johann Ortner, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG<br />
Dipl. Math. Andreas Fischer, Sarros GmbH<br />
Friedrich Hammerschmidt, Oesterreichische Nationalbank (OeNB)<br />
Mit freundlicher Unterstützung von:
editorial<br />
Systemische Retter<br />
In schweren Zeiten präsentieren sich die Banken in Wien auf der, wie<br />
mir versichert wurde, Messe der Relationship Manager. Können diese<br />
das geschwundene Vertrauen zwischen den Banken noch retten? Nicht<br />
gerettet haben sie ihren professionellen Chic. Auf der Farewell-Party<br />
in der Hofburg waren sie nicht under-, sondern irgendwie dressed.<br />
Ausdruck des auf den Fugen geratenen Relationship?<br />
Vor die Kamera gebeten werden zur Zeit die verantwortlichen (Relationship) Manager – diesmal<br />
um die ahnungslosen, sonst immer etwas belächelten kleinen Sparer zu beruhigen. Kräftig unterstützt<br />
werden sie von den Politikern, die eine Mindesteinlagengarantie zusichern – und, unter<br />
anderen, von den kleinen Sparern, die, inklusive sämtlicher weiterer Steuerzahler, diese Garantie<br />
finanzieren. Wir vergarantieren uns also selbst – was im Sinne des gerne zitierten „Das Volk ist<br />
der Staat“ logisch ist und den Vorteil hat, dass wir nur uns selbst vertrauen müssen – und nicht<br />
der Bank (wer immer das auch sein mag – vielleicht die Software). In Island hat das Volk wohl<br />
einen Fehler gemacht, denn das Land steht nun vor dem Staatsbankrott.<br />
Mit den systemrelevanten Banken lassen wir uns auch selbst nicht im Stich, denn, wie bereits<br />
angedeutet, wir sind alle Teil des Systems. Allerdings – sind, wenn meine Bank verschwunden<br />
ist, meine Schulden in Form des Kontominus auch weg? Und wenn dem so wäre – soll ich mich<br />
dann egoistisch oder altruistisch bemühen? Oder fällt es, wenn ich mich egoistisch ausrichte,<br />
auf mich zurück, weil die Realwirtschaft einbricht und ich im Zuge des Jobverlustes erst recht<br />
wieder defizitär bin? Aber könnte dafür jemand an diesem Defizit verdienen und damit das<br />
System unterstützen oder würde es – gesamtwirtschaftlich gesehen, das heißt dem<br />
Kapitalismus, – eher schaden?<br />
Laut Louis Begley, erfolgreicher Wirtschaftsanwalt und Autor, ist der Kern des Kapitalismus die<br />
Gier – also ist er zutiefst menschlich. Denn auch meine Katze erscheint jedes Mal fordernd, wenn<br />
ich den Kühlschrank öffne – egal ob ihr Bauch voll oder leer ist.<br />
Sollte sich die Situation, wenn Sie das Heft in Händen halten, bereits wieder geändert haben,<br />
verzeihen Sie, dass wir nicht hellsichtig waren.<br />
Ihre<br />
Ihr<br />
Gertrud Zoklits<br />
Chefredakteurin<br />
Kurt Quendler<br />
Herausgeber<br />
Studiengesellschaft für Vertriebs-Innovation<br />
www.sg-innovation.at<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
3
news<br />
personen<br />
news<br />
Slavko Carić<br />
… übernimmt ab 1. Januar 2009 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Erste Bank Serbia.<br />
Er gehört seit Februar 2007 dem Vorstand der Erste Bank Serbia an. Er war für die Bereiche Corporate<br />
Banking und Treasury verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei der Erste Bank Serbia war er CEO des<br />
führenden serbischen Broker- und Investmenthauses Synergy Capital. Dank seiner profunden Kenntnis des<br />
serbischen Firmenkundengeschäfts wird der Fokus seiner Tätigkeit in Serbien das weitere Wachstum dieses<br />
Bereichs sein.<br />
Hubertus Hecht<br />
… ist der neue Leiter des Geschäftsbereiches Banking in Österreich und damit auch Mitglied der<br />
erweiterten Geschäftsleitung beim internationalen Consulter Capgemini. In seinen Verantwortungsbereich<br />
fallen alle Business Consulting Projekte im Bankensektor wie z. B. im Retail-, Corporate- und<br />
Private Banking, Backoffice Services, Risikomanagement und Post Merger Themen. Der ausgebildete<br />
Betriebswirt bringt eine langjährige Berufs- und Managementerfahrung sowohl im Banking als auch aus<br />
der Consulting Industrie mit.<br />
Franz Hochstrasser<br />
… wurde zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Erste Group ernannt. Er studierte Betriebswirtschaft<br />
in Graz, trat 1991 in die GiroCredit ein und wurde kurz nach der Fusion der GiroCredit<br />
mit der damaligen Erste Bank, im Jänner 1999 zum Vorstandsmitglied der Erste Group ernannt.<br />
Hochstrasser ist für die Aktivitäten des Bereiches Group Markets verantwortlich (bestehend aus den<br />
Bereichen Group Capital Markets, Group Balance Sheet Management und Group Research) und<br />
vorübergehend auch für den Bereich Group Corporate und Investment Banking.<br />
Manuel Lengauer<br />
… hat beim österreichischen Informationsdienstleister Bau Data GmbH die Vertriebsleitung für die<br />
neue Internet-Datenbank www.foerderdata.at übernommen. Lengauer hat über mehrere Jahre Vertriebserfahrung<br />
in der Finanzbranche gesammelt, in der Uniqua Versicherungen AG war der Salzburger<br />
als Point of Sale-Trainer tätig, bevor er in einer großen österreichischen Bankengruppe eine Ausbildung<br />
zum Finanzierungsberater absolvierte. Vor seinem Wechsel zur Bau Data GmbH war er Regionalmanager<br />
bei der internationalen Versicherungsgruppe Standard Life plc.<br />
Michael Mendel<br />
… wird mit 1. Jänner die Funktion des CRO (Chief Risk Officer) im Vorstand der Volksbank AG<br />
übernehmen. „Michael Mendel verfügt über internationale Erfahrung und ist zudem ein profunder<br />
Kenner der österreichischen Marktes“, betont Franz Pinkl, Generaldirektor der Volksbank AG. In seiner<br />
bisherigen beruflichen Laufbahn hat Michael Mendel in unterschiedlichen Positionen Verantwortung<br />
im Bereich Risk Management übernommen. So war er u.a. CRO bei der HVB und der Bank Austria,<br />
sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Bank Austria.<br />
Gabriele Spiegl<br />
… übernahm mit 1. September <strong>2008</strong> die Leitungsfunktion in der VKB-Bank Enns.<br />
Die Bankmanagerin verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung und konnte auch schon im Immobiliengeschäft<br />
Erfahrungen sammeln. Das Firmenkundengeschäft ist der 44jährigen Astnerin besonders<br />
ans Herz gewachsen, ihr Immobilien-Know-How möchte die neue Leiterin auch in Enns einfließen<br />
lassen. Die Freizeit verbringt Gabriele Spiegl als passionierte Hobbygärtnerin am liebsten in der<br />
Natur oder beim Golf spielen.<br />
4<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
inhalt<br />
bestbanking<br />
editorial Seite 3<br />
bestbanking-news Seite 6<br />
Kollektivvertrag Sicherheit im Geldinstitut Seite 10<br />
Sicherheit im Foyer durch Antiskimming und Objektüberwachung Seite 14<br />
Zeit für eine neue Sicherheitsstrategie? Seite 16<br />
Die Volksbank Mittweida erhielt den victor<br />
in der Sonderkategorie innovativste Bank Seite 22<br />
GBS: Spitzenposition bei SB-Online Münzeinzahlung im Foyerbetrieb Seite 18<br />
SiS verstärkt ihr Team mit Top-Profis Seite 19<br />
Kundenveranstaltung bei Ascom Austria Seite 20<br />
victor <strong>2008</strong> im Rahmen der Gala verliehen Seite 22<br />
NOVOTECH gratuliert allen Gewinnern des victor <strong>2008</strong> Seite 24<br />
Schlanke Bankprozesse Seite 25<br />
„Green Coin Logistics“ Seite 26<br />
Wincor World 2009: Mit Innovationen das Geschäft vorantreiben Seite 28<br />
Semantische Technologien: Nutzen & Chancen für den Finanzsektor Seite 30<br />
Islamic Banking und ethnisches Marketing Seite 32<br />
Zur Wincor World 2009 werden<br />
neue IT-Lösungen vorgestellt Seite 28<br />
Trends, Visionen und Wachstumsmärkte Seite 37<br />
Shop-Banking mit neuen Verkaufskonzepten Seite 40<br />
Kommunikation kompakt Seite 42<br />
Sibos <strong>2008</strong>: Von Bank zu Bank Seite 44<br />
Europäisches Forum Alpbach Bankenseminar <strong>2008</strong> Seite 48<br />
7th Private Banking Summit Seite 50<br />
Gelungene Koordination Seite 52<br />
Führung – ein Missverständnis Seite 53<br />
Präzise hören und sprechen Seite 55<br />
Kommt die Gratis-Gehaltskonten-Welle auch nach Österreich? Seite 56<br />
Designtes Notebookvergnügen Seite 57<br />
Der zweite „mein kreditshop“ der WSK-Bank, Seite 40<br />
Impressum / Vorschau / Anzeigenformate Seite 58<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
5
V.l.n.r.: Heinrich Spängler, Friederike Polzhofer (Neue<br />
Wiener Werkstätte), Christa Wagner (Josko Fenster und<br />
Türen GmbH), Heinz Senger-Weiss (Gebrüder Weiss<br />
AG) und Christoph Bründl (Sport Bründl Gruppe).<br />
… organisierte das vierte forum familienunternehmen.<br />
Im Salzburger Gwandhaus<br />
diskutierten Experten rund um das<br />
Thema „Kommunikation und Service als<br />
Erfolgsfaktoren für Familienunternehmen“.<br />
Unternehmensberaterin Michaela<br />
Bankhaus Spängler<br />
Kern wies in ihrem Vortrag vor rund 170<br />
Teilnehmern auf die Defizite hin, welche<br />
in vielen Familienunternehmen leider<br />
vorherrschen würden und rät zu klaren<br />
Regeln im Sinne eines Firmenkodex.<br />
Ebenso wichtig sei für ein Familienunternehmen<br />
aber auch die einheitliche und<br />
gezielte Kommunikation nach außen.<br />
Klare Regeln sieht auch Heinz Senger-<br />
Weiss, Vorstand bei der Gebrüder Weiss<br />
AG, als Grundvoraussetzung für den<br />
Erfolg von familiengeführten Betrieben.<br />
Er warnt jedoch davor, Regeln im Unternehmen<br />
nur zu kommunizieren und sie<br />
selbst nicht einzuhalten. Christa Wagner,<br />
geschäftsführende Gesellschafterin bei<br />
Josko, und Friederike Polzhofer von der<br />
Neuen Wiener Werkstätte plädieren für<br />
mehr Interaktion zwischen den aktiven<br />
news<br />
und „passiven“ Familienmitgliedern im<br />
Unternehmen. Ein regelmäßiges Treffen<br />
zum Gedankenaustausch und zur Erklärung<br />
der Strategien könne hier sehr<br />
hilfreich sein. Christoph Bründl, Geschäftsführer<br />
der Sport Bründl Gruppe<br />
mit Sitz in Kaprun, sieht sein Erfolgsgeheimnis<br />
wiederum im Kommunizieren<br />
von bestem Service. „Und das funktioniert<br />
bei uns nur über die Mitarbeiter. Sie<br />
müssen unsere Philosophie täglich direkt<br />
an unsere Kunden bringen.“ Das forum<br />
familienunternehmen hat sich als Treffpunkt<br />
für österreichische Familienunternehmen<br />
etabliert. Dabei handelte es sich<br />
um ein bedeutendes Segment der österreichischen<br />
Wirtschaft, immerhin sind<br />
80 Prozent der österreichischen Firmen<br />
familiengeführt.<br />
Telekom Austria Group<br />
… kooperiert mit der Abteilung für Betriebswirtschaftliche<br />
Steuerlehre der WU<br />
Wien. Mag. Hans Tschuden, CFO der<br />
Telekom Austria Group, unterzeichnet mit<br />
der Abteilung für Betriebswirtschaftliche<br />
Steuerlehre an der Wirtschaftsuniversität<br />
Wien (WU Wien) eine mehrjährige Kooperation.<br />
Neben Wirtschaftsprüfungsund<br />
Steuerberatungsgesellschaften ist die<br />
Telekom Austria Group damit das erste<br />
börsenotierte Unternehmen, das mit dem<br />
Fachinstitut eine enge inhaltliche Kooperation<br />
eingeht. „Steuerrechtliche Aspekte<br />
spielen in einem international tätigen<br />
Unternehmen wie der Telekom Austria<br />
Group eine große Rolle, wenn es um<br />
Strategien zur Steueroptimierung und<br />
Risikominimierung geht. Unser Ziel ist<br />
es, zwischen Wirtschaft und Lehre<br />
einen qualifizierten Wissensaustausch bei<br />
steuerrelevanten Fragestellungen zu starten<br />
– und zwar im beiderseitigen Interesse“,<br />
ist Hans Tschuden von der Kooperation<br />
überzeugt. Für den CFO stehen grenzüberschreitende<br />
steuerrechtliche Entscheidungen<br />
quasi auf der Tagesordnung,<br />
da die Telekom Austria Group über den<br />
österreichischen Heimatmarkt hinaus<br />
in Slowenien, Kroatien, der Republik<br />
Serbien, der Republik Mazedonien,<br />
Bulgarien, Weißrussland, Tschechien und<br />
Liechtenstein mit eigenen Unternehmen<br />
tätig ist.<br />
Visa Europe<br />
… hat ein Partnerschaftsabkommen mit<br />
RePay International abgeschlossen, in<br />
dessen Rahmen eine neue „grüne“ Visa-<br />
Karte für Firmen und Behörden in<br />
Europa umgesetzt werden soll. Damit<br />
knüpft Visa an die erfolgreiche Einführung<br />
der weltweit ersten CO2-neutralen<br />
Kreditkarte – der Visa GreenCard – für<br />
niederländische Konsumenten im Jahr<br />
2004 an. Dank der neuen Vereinbarung<br />
können die 4.600 europäischen Mitgliedsbanken<br />
von Visa ihren Geschäftskunden<br />
Visa-Karten anbieten, die im Rahmen<br />
von RePay's ClimaCount-Kompensationsprogramm<br />
Kohlenstoffemissionen ausgleichen,<br />
indem sie nachhaltige Projekte<br />
unterstützen. So wird zum Beispiel für<br />
jede Zahlung, die über eine Visa-Karte<br />
abgewickelt wird, die CO2-Emission des<br />
Produktes bzw. der Dienstleistung ermittelt<br />
und durch die Unterstützung eines<br />
Projektes etwa in den Bereichen Forstwirtschaft<br />
und erneuerbare Energien<br />
kompensiert. ClimaCount wird von der<br />
NGO Conservation International und<br />
dem niederländischen Forschungsinstitut<br />
TNO unterstützt. Da diese innovative,<br />
schlüsselfertige Zahlungsmethode bereits<br />
mit einer umfassenden technischen Back-<br />
Office-Infrastruktur ausgestattet ist, müssen<br />
die Mitgliedsbanken keine umfangreichen<br />
Investitionen in Back-Office-<br />
Funktionen tätigen. Über die Website<br />
www.climacount.com können Firmenkarteninhaber<br />
ihre Käufe einsehen und<br />
überprüfen, wie hoch die CO2-Emissionen<br />
für jede Transaktion sind und wie<br />
diese ausgeglichen werden.<br />
Bankindex<br />
von A bis Z<br />
Bull-Market<br />
… auch Hausse, längere Zeit anhaltende<br />
starke Kurssteigerungen an<br />
der Börse.<br />
Business Angel<br />
Business Angels sind Kapitalgeber<br />
und Mentor eines Unternehmens<br />
in einer Person: Sie investieren in<br />
erfolgversprechende, junge Unternehmen<br />
und bringen gleichzeitig<br />
ihre Erfahrungen und Kontakte ein.<br />
6<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
„Haus Marcus“ der Blach-Stiftung eröffnet<br />
Streitner, Bank & Objektinterieur, spendet Einrichtung für Behindertenbetreuungsstätte<br />
Das „Haus Marcus“ für Menschen<br />
mit schweren geistigen und mehrfachen<br />
Behinderungen ist nach rund einjähriger<br />
Bauzeit fertig gestellt. Die Betreuungsstätte<br />
wurde von Initiator Prof. Rudolf<br />
Blach und Gesundheits- und Sozialstadträtin<br />
Mag.a Sonja Wehsely in Anwesenheit<br />
von Prof.in Erika Stubenvoll, zweite<br />
Landtagspräsidentin und Vorsitzende der<br />
gemeinderätlichen Behindertenkommis-<br />
sion, sowie Sponsoren und Spendern und<br />
Bezirksvorsteher Norbert Scheed eröffnet.<br />
Das „Haus Marcus“ geht auf die<br />
Initiative von Prof. Rudolf Blach zurück.<br />
Er ist Vater eines behinderten Sohnes<br />
und will dessen Betreuung nach seinen<br />
Vorstellungen für die Zukunft absichern.<br />
Dazu hat er die Blach- Stiftung gegründet<br />
und gemeinsam mit der Stadt Wien<br />
über den Fonds Soziales Wien und dem<br />
Verein GIN (Gemeinwesenintegration<br />
und Normalisierung) den Bau des Hauses<br />
für Menschen mit Behinderung geplant.<br />
Die Freundschaft mit Prof. Blach und<br />
seiner Familie hat nun den Bankeinrichter<br />
Ing. A. Streitner aus Niederneukirchen<br />
veranlasst bei diesem großartigen<br />
Projekt als Sponsor mitzuwirken. Die<br />
Firma Ing. A. Streitner GesmbH stellte<br />
die Einrichtung von insgesamt zehn<br />
Zimmern und eines Aufenthaltsraumes<br />
zur Verfügung.<br />
Ing. A. Streitner: „Wir wollen als<br />
Unternehmen unserer sozialen Verantwortung<br />
gerecht werden und mit diesem<br />
Beitrag mithelfen, auf direktem Weg<br />
behinderten Menschen ein lebenswertes<br />
Umfeld zu schaffen.“<br />
Innovationspreis für blindengerechten Bankomat<br />
Seit dem Jahr 2005 wird in Österreich<br />
der „Ebiz E-Government Award“ verliehen.<br />
Der Preis zeichnet die nachhaltigsten<br />
und kreativsten IT-Lösungen für<br />
Business und Verwaltung aus. Die drei<br />
besten Projekte jedes Bundeslandes und<br />
eine Bundeswertung werden prämiert.<br />
Erstmals wurden heuer auch zwei Sonderpreise,<br />
einer für „Barrierefreiheit in der<br />
IT“ und einer für „Chancengleichheit in<br />
der IT“, vergeben. In der Kategorie<br />
Barrierefreiheit ging der Preis an die<br />
Raiffeisen-Landesbank Steiermark (RLB)<br />
und ihren Partner Wincor-Nixdorf. Ausgezeichnet<br />
wurde das Projekt „Blindengerechter<br />
Bankomat“. Seit Ende März<br />
steht so ein Bankomat in der Raiffeisen-<br />
bank beim Grazer LKH. „Durch die<br />
Nähe zum Odilien-Institut wurden<br />
wir für die Probleme blinder Menschen<br />
bei der Nutzung von Bankomaten sensibilisiert“,<br />
erklärt Joachim Schuller, Bankstellen-Vertriebsleiter.<br />
Ein weiteres rollstuhlfahrergerechtes<br />
Gerät wurde in der Raiffeisenbank am<br />
Jakominiplatz aufgestellt. Dort ging man<br />
einen Schritt weiter und baute den Bankomat<br />
so um, dass ihn auch Rollstuhlfahrer<br />
bequem und sicher nutzen können.<br />
Christian Weißer, General Manager<br />
Wincor Nixdorf Österreich: „Wir freuen<br />
uns sehr, dass wir dieses Projekt für die<br />
RLB Steiermark realisieren durften. Sie<br />
beweist Mut, etwas Neues in Österreich<br />
erstmals einzuführen und nimmt in<br />
hohem Maße ihre soziale Verantwortung<br />
gegenüber sehbehinderten Kunden wahr.<br />
Dass dieses Projekt jetzt außerdem<br />
öffentlich mit dem Sonderpreis für<br />
’barrierefreie IT‘ durch das Bundeskanzleramt<br />
geehrt wird, sollte zur Verbreitung<br />
anregen – die Zeit dafür ist jetzt.“<br />
Staatspreis <strong>2008</strong> für „Duale Zustellung“!<br />
Das innovative e-Government Service der Raiffeisen Informatik wurde mit<br />
dem „Multimedia & e-Business Staatspreis <strong>2008</strong>“ ausgezeichnet<br />
V.l.n.r.: Dir. Mag. Wilfried Pruschak, GF Raiffeisen<br />
Informatik, Werner Artacker und Mag. Christoph<br />
Scheichel (Produktmanager Raiffeisen Informatik GmbH)<br />
Raiffeisen Informatik erhielt den<br />
Oscar der IT-Branche. Für das neue<br />
Service „Duale Zustellung“ wurde der<br />
„Multimedia & e-Business Staatspreis<br />
<strong>2008</strong>“ von Christine Marek, Staatssekretärin<br />
für Wirtschaft und Arbeit, an<br />
den Geschäftsführer der Raiffeisen<br />
Informatik Dir. Mag. Wilfried Pruschak<br />
übergeben.<br />
„Wir sind sehr stolz auf unsere<br />
Lösung ’Duale Zustellung‘ und freuen<br />
uns über die Wertschätzung durch den<br />
Staatspreis“, freut sich Pruschak. „Der<br />
blaue Brief ist bald Geschichte. Jetzt<br />
kommt der elektronische Zustelldienst.<br />
Damit können Dokumente jederzeit und<br />
überall in Sekundenschnelle sicher übermittelt<br />
und garantiert an den wirklichen<br />
Adressaten zugestellt werden. Das ist<br />
nicht nur ein einfaches Mail, sondern beinhaltet<br />
alle rechtssicheren Zustellarten<br />
wie z. B. RSa und RSb Briefe“, hebt<br />
Pruschak die Vorteile des neuen Services<br />
hervor.<br />
Zum ersten Mal wurde der Staatspreis<br />
in der Kategorie „e-Government und<br />
öffentliche Dienste“ vergeben. In dieser<br />
Kategorie wurden die besten Projekte<br />
für die österreichische e-Government Initiative<br />
bewertet. Raiffeisen Informatik<br />
konnte sich unter insgesamt 270 Staatpreiseinreichungen<br />
erfolgreich auch als<br />
Gesamtsieger behaupten.<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
7
it-novum<br />
der zur börsenotierten KAP AG Unternehmensgruppe<br />
gehörende deutsche IT-<br />
Berater und -Dienstleister, startete am<br />
1.10. am österreichischen Markt. Die neue<br />
Niederlassung in Wien ist gleichzeitig<br />
die erste Tochtergesellschaft des Unternehmens<br />
im Ausland. „Im Hinblick auf<br />
Open Source Lösungen ist Österreich<br />
fast noch ein Emerging Market, auch<br />
wenn der IT-Markt an sich schon sehr<br />
gesättigt und hart umkämpft ist. Zudem<br />
ist Österreich das Tor zum Osten, wo<br />
Open Source noch kaum eine Rolle<br />
spielt“, erklärt Michael Kienle, Geschäftsführer<br />
it-novum GmbH. „Wir<br />
werden Open Source in Österreich zum<br />
Thema machen und dieses Wachstumsthema<br />
auch gezielt entwickeln.“<br />
Die Siemens AG und<br />
The Gores Group<br />
ein Private-Equity-Unternehmen mit Sitz<br />
in den Vereinigten Staaten, haben ihre<br />
Joint Venture-Transaktion abgeschlossen.<br />
Gores hat einen Anteil von 51% an<br />
Siemens Enterprise Communications<br />
erworben. Siemens bleibt mit 49% an<br />
dem Joint Venture beteiligt. Gores und<br />
Siemens wollen mindestens 350 Mio. €<br />
in das Joint Venture investieren – zusätzlich<br />
zu den ohnehin geplanten Ausgaben<br />
für Forschung und Entwicklung oder sonstigen<br />
Aufwendungen im Rahmen des<br />
normalen Geschäftsbetriebs. Die Investitionen<br />
dienen der Markteinführung von<br />
Produktinnovationen der Siemens Enterprise<br />
Communications und der Akquisition<br />
von weiteren Technologieplattformen.<br />
Der Erste Campus<br />
wird auf dem heutigen Areal des Südbahnhofs<br />
nach dem Entwurf des Architekturbüros<br />
„henke und schreieck“ gebaut. „Das<br />
Projekt fügt sich harmonisch in die<br />
städtebaulichen Gegebenheiten zwischen<br />
dem neuen Hauptbahnhof Wien und<br />
dem Schweizer Garten ein,“ erläuterte<br />
András Pálffy, der die Wettbewerbsjury<br />
leitete. Ihr gehörten unter anderem der<br />
Direktor des Architekturzentrums Wien,<br />
Dietmar Steiner, Vertreter der Stadt<br />
Wien und der ÖBB, sowie Erste Group-<br />
Vorstand Herbert Juranek und IMMO-<br />
RENT-Vorstand Gerald Antonitsch an.<br />
Der Trans-Eurasia-<br />
Express<br />
kam am 6. Oktober <strong>2008</strong> pünktlich in<br />
Hamburg an und beendete damit den<br />
erstenTransport, mit dem DB Schenker<br />
per Bahn IT-Produkte aus Südchina über<br />
eine Strecke von mehr als 10.000 Kilometern<br />
nach Deutschland gebracht hatte.<br />
Allein mit dieser ersten Fahrt wurden dabei<br />
im Vergleich zur Luftfracht insgesamt<br />
2.200 Tonnen an Treibhausgasemissionen<br />
vermieden. Mit der erstmaligen Nutzung<br />
der transeurasischen Schienenverbindung<br />
für den Transport kurzfristig benötigter<br />
Komponenten aus Produktionsstätten in<br />
Asien als umweltfreundlicher Alternative<br />
zur Luftfracht, unterstreicht Fujitsu<br />
Siemens Computers seine Position als<br />
führende IT-Hersteller mit 20jähriger<br />
Tradition und Erfahrung in der Umsetzung<br />
innovativer Green IT-Initiativen.Vor<br />
dem Transport auf der Schiene<br />
waren die einzigen Alternativen, entweder<br />
die Waren per Luftfracht zu beziehen<br />
– eine schnelle, aber teure Lösung<br />
– oder auf die Seefracht zu warten, die bis<br />
zu 28 Tagen benötigt.<br />
Der „Emerging<br />
Markets Award“<br />
ist eine gemeinsame Initiative von Bank<br />
Austria, HypoVereinsbank und Uni-<br />
Credit. Dieser Preis wurde bereits<br />
zum fünften Mal und erstmals in drei<br />
Ländern der UniCredit Group – Österreich,<br />
Deutschland und Italien – ausgeschrieben.<br />
In jedem dieser Länder wurden<br />
drei nationale Preisträger durch eine<br />
nationale Jury ermittelt. Österreichischer<br />
Gesamtsieger <strong>2008</strong> ist S&T, die beiden<br />
anderen österreichischen Gewinner sind<br />
Trenkwalder International AG und<br />
die DCM DECOmetal GmbH. Die<br />
Auszeichnung wird Ende Oktober im<br />
Rahmen einer feierlichen Zeremonie in<br />
Moskau übergeben. Mit dem „Emerging<br />
Markets Award“ werden jährlich Unternehmen<br />
aus dem Mittelstand ausgezeichnet,<br />
die sich mit Erfolg in Mittelund<br />
Osteuropa engagieren. Ausschlaggebende<br />
Kriterien für den Preis waren<br />
neben den ökonomischen Daten von<br />
S&T auch Faktoren wie Qualität der<br />
Kommunikation sowie Umwelt- und<br />
Sozialstandards.<br />
news<br />
CA Cheuvreux<br />
weitet seine Geschäftstätigkeit auf Österreich<br />
aus und steigt in den osteuropäischen<br />
Markt über die Zweigniederlassung<br />
Wien ein, die im Juli 08 eröffnet wurde.<br />
Der Full-Service Broker CA Cheuvreux<br />
ist eine 100%-Tochter von Calyon und<br />
gehört zur französischen Crédit Agricole<br />
Gruppe. Von Wien aus werden im<br />
Aktienhandel die Märkte in Österreich,<br />
Polen, Tschechien und Ungarn abgedeckt;<br />
an der Wiener Börse beträgt der<br />
Marktanteil von CA Cheuvreux derzeit<br />
etwa 5%. Die Österreich-Niederlassung<br />
von CA Cheuvreux wird von Eduard<br />
Berger geführt, die Position des Chefanalysten<br />
nimmt Alfred Reisenberger ein.<br />
Die Erste Bank<br />
hat eine eigene Abteilung zur Betreuung<br />
der Öffentlichen Hand gegründet. Unter<br />
dieser Kundengruppe sind Gebietskörperschaften,<br />
gesetzliche Interessensvertretungen,<br />
Sozialversicherungsträger, öffentlich-rechtliche<br />
Fonds und gesetzlich<br />
anerkannte Kirchen sowie privatrechtliche<br />
Körperschaften, die im mehrheitlichen<br />
Eigentum von Gebietskörperschaften<br />
stehen, zusammengefasst. Die<br />
Leitung übernimmt Stefano Massera.<br />
Die neue Abteilung soll künftig einen<br />
wichtigen Beitrag für das Kommerzgeschäft<br />
der Erste Bank leisten. Generell<br />
soll der Hauptkundenanteil der Erste<br />
Bank und der Sparkassen im Kommerzgeschäft<br />
in 3 Jahren auf 30% ansteigen.<br />
Die virtuelle Bank<br />
der UniCredit Group ist ein speziell für<br />
Finanzinstitute konzipiertes White-Label-<br />
Zahlungsprodukt. Es gibt ausländischen<br />
Banken die Möglichkeit, sich in den<br />
lokalen Abrechnungssystemen von Drittmärkten<br />
als virtuelle Banken zu präsentieren.<br />
Das Produkt gestattet eine kostengünstige<br />
Expansion nach CEE, bei der<br />
die Institute ihre eigenen Marken verwenden<br />
können, ohne dass eine physische<br />
Präsenz erforderlich ist. Die virtuelle Bank<br />
bietet Finanzinstituten und deren Kunden<br />
uneingeschränkten Zugang zu den inländischen<br />
Zahlungs- und Clearingsystemen<br />
in Österreich, Ungarn, der Tschechischen<br />
Republik und der Slowakei. Bis Ende<br />
<strong>2008</strong> soll das Angebot auch in Polen,<br />
Rumänien und Bulgarien verfügbar sein.<br />
8<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Zusammenarbeit zwischen Ascom<br />
Austria GmbH und Novotech<br />
Banksysteme GmbH vereinbart<br />
Fotos: Ascom<br />
Im Rahmen der Kundenveranstaltung am 11.9. wurde vor<br />
zahlreich anwesenden Gästen die Zusammenarbeit zwischen<br />
Ascom Austria GmbH und Novotech Banksysteme GmbH<br />
verkündet, dazu Bernd Mühlbacher, Businessmanager von<br />
Ascom Austria GmbH: „Ich freue mich unsere Produktpalette<br />
mit den hochwertigen SB Münzzählern von Novotech erweitern<br />
zu können. Ascom Austria ist seit vielen Jahren bekannt dafür<br />
aus jedem Segment die jeweils besten Lösungen anzubieten, ob<br />
das nun der TwinSafe Vertera im Bereich Teller Cash Recycler<br />
ist oder die Nvision im Bereich der Banknotenzähler mit Fitnesstest<br />
bzw. der Sirius SC/UC aus dem Bereich der SB- Münzrollengeber.“<br />
Peter Drimmel, Geschäftsführer von Novotech Banksysteme<br />
GmbH: „Die sequentielle Zusammenarbeit im Vertrieb mit<br />
ASCOM Austria war eine logische Konsequenz aus Sicht der<br />
zunehmenden Marktkonzentration. Die guten persönlichen<br />
Beziehungen zu dem Geschäftsführer, Peter Bernhofer, und dem<br />
Bernd Mühlbacher Business Manager Ascom Austria und GF Novotech Peter Drimmel<br />
Bereichsleiter, Bernd Mühlbacher, stellen die Basis einer langfristig<br />
erfolgreichen Marktbearbeitung dar. Die Stammkunden<br />
von Novotech werden weiterhin direkt betreut. Die Fokussierung<br />
von Novotech liegt auf den internationalen Bereichen „Core<br />
Brand Development“ und „OEM-Direct-Sales“, daher braucht<br />
es im Kerngeschäft einen zuverlässigen regionalen Partner.“ ❙<br />
afb<br />
TM<br />
financial understanding<br />
Lieber SOA als SOS !<br />
Lösung in Sicht –<br />
mit der afb Credit Management Solution<br />
Mehr Prozess-Effizienz und weniger Kosten durch eine automatisierte<br />
Kreditabwicklung: Modular aufgebaut, webbasiert und flexibel integrierbar<br />
erfüllt die afb Credit Management Solution alle Anforderungen an eine<br />
serviceorientierte IT-Architektur.<br />
CONTACT US!<br />
www.afb.de/soa<br />
soa@afb.de<br />
+49 (89) 78 000-400<br />
www.afb.de
Kollektivvertrag Sicherheit<br />
für MitarbeiterInnen in<br />
Geldinstituten abgeschlossen<br />
Ilse Fetik, Leiterin des Sicherheitskompetenz-Zentrums der Sparkassen in der s OM<br />
Entwicklung der Banküberfälle<br />
Die Möglichkeit, dass MitarbeiterInnen von Geldinstituten<br />
von einem oder mehreren Banküberfällen oder von einer anderen<br />
Gewaltanwendung (z.B. Bombendrohung, Geiselnahme etc.) betroffen<br />
sein können, steigt in Österreich in den letzten Jahren<br />
kontinuierlich weiter an. So wurden im Jahre 2007 allein in Wien<br />
74 Banküberfälle registriert. Für <strong>2008</strong>/09 ist aufgrund der bisher<br />
vorliegenden Daten und Erfahrungen (Stand 29.8.<strong>2008</strong>: 48 Banküberfälle)<br />
mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Im europäischen<br />
Vergleich liegt Wien damit hinter zahlreichen italienischen<br />
aber auch deutlich vor einigen deutschen Großstädten.<br />
Wer sind die Betroffenen?<br />
Nach Banküberfällen stehen in der Regel die TäterInnen,<br />
deren Festnahme, der Prozess, spektakuläre Begleitumstände<br />
etc. im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Opfer<br />
werden nicht selten erst wahrgenommen, wenn die Gewalttat<br />
unübersehbare Folgen hinterlassen hat.<br />
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen unmittelbar und<br />
mittelbar Betroffenen. Unmittelbar betroffen sind in erster Linie<br />
die MitarbeiterInnen im Kassenbereich. Mittelbar betroffen<br />
sind alle anderen im Falle eines Überfalls anwesenden Personen<br />
wie KundInnen und BetriebsmitarbeiterInnen, die entweder im<br />
angrenzenden Bereich der Kassa ihren Arbeitsplatz haben oder<br />
sich nur kurzfristig in diesem Bereich aufhalten.<br />
Auch Personen von Wartungsfirmen oder von Firmen, die<br />
für die Geldver- oder -entsorgung der Geräte im Foyer- und<br />
Kassenbereich zuständig sind, können im Zuge ihrer Tätigkeit<br />
in einen Bankraub verwickelt werden. Eine weitere Personengruppe,<br />
die häufig vernachlässigt wird, stellen die Reinigungskräfte<br />
dar. Sie sind in den meisten Fällen entweder die ersten<br />
oder die letzten, die eine Filiale betreten bzw. verlassen, und<br />
damit sind sie einer erhöhten Gefahr ausgesetzt, bei einem<br />
atypischen Banküberfall Zielperson zu sein. Lehrlinge werden<br />
jedenfalls im Rahmen ihrer Berufsschulausbildung bis dato<br />
nicht ausreichend auf das bestehende Berufsrisiko vorbereitet.<br />
Wie ist die Situation in den Geldinstituten?<br />
Es gibt vielfältige präventive Ansätze der einzelnen Geldinstitute,<br />
z. B. mit<br />
• baulichen, technischen, organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen<br />
oder<br />
• mit verstärktem Einsatz von Sicherheitspersonal.<br />
• Für MitarbeiterInnen im Vertrieb werden Schulungen<br />
und/oder Alarmübungen angeboten, jedoch sowohl in qualitativer<br />
als auch quantitativer Hinsicht noch nicht in ausreichendem<br />
Ausmaß – dies zeigt zumindest meine Erfahrung.<br />
Was ist gesetzlich geregelt?<br />
Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz regelt unter dem § 3<br />
die Verpflichtung der ArbeitgeberInnen für Sicherheit und<br />
Gesundheitsschutz der ArbeitnehmerInnen. § 14 des ASchG<br />
regelt die Unterweisungspflicht der ArbeitgeberInnen, ist aber<br />
zu wenig konkret.<br />
Was beinhaltet der Kollektivvertrag Sicherheit?<br />
Das Erlebnis von einem oder mehreren Banküberfällen<br />
bedeutet für die Betroffenen Gewaltanwendung, die zu traumatischen<br />
Folgen und gegebenenfalls bis zur Unfähigkeit, die<br />
Tätigkeit „am Schalter“ weiter ausüben zu können, führen kann.<br />
Nicht zuletzt dieser Umstand führte aktuell zu einer Ergänzung<br />
des Kollektivvertrags.<br />
Eine neue Ergänzungsbestimmung der Kollektivverträge<br />
für Sparkassen, Banken, Volksbanken Raiffeisen und Landeshypothekenanstalten<br />
soll durch präventive Maßnahmen in der<br />
Ausbildung, konkrete Unterweisung, regelmäßige Übungen und<br />
Fallbesprechungen die Chance für richtiges Verhalten erhöhen<br />
und dadurch das Risiko und die Auswirkungen von Überfällen<br />
vermindern.<br />
Die MitarbeiterInnen sollen mit einem bedarfs- und zielgruppenorientierten<br />
Maßnahmenpaket geschult, unterwiesen<br />
und betreut werden. Das praktische Üben soll die erworbenen<br />
Kenntnisse aus den theoretischen Lehreinheiten festigen und<br />
den MitarbeiterInnen Sicherheit für den Arbeitsalltag vermitteln.<br />
Thematisiert wird auch die richtige Nachbetreuung<br />
nach einer kriminellen Handlung, die den Betroffenen bei der<br />
Verarbeitung des Erlebnisses helfen soll. Wichtig ist, dass bereits<br />
am Tag des Geschehens eine psychosoziale Fachkraft mit Erfahrung<br />
im Gewalttraumabereich vor Ort ist. In der Folge entscheiden<br />
Betroffene selbst, ob sie die von der Sparkasse angebotene<br />
weiterführende Begleitung in Anspruch nehmen wollen.<br />
Abb. 1: Entwicklung der Anzahl der Banküberfälle in Wien von 1994 bis 2007, Quelle:<br />
Robbery News des LKA Wien<br />
10<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Wie wirksam ist Prävention?<br />
Die Kriminalprävention zielt darauf ab, durch aktive Gestaltung<br />
des Handlungsraumes, in dem kriminelle Handlungen<br />
gesetzt werden können, erstens solche zu verhindern und zweitens<br />
deren Konsequenzen zu mildern.<br />
Was nützt jedoch die beste Sicherheitsmaßnahme, wenn sie<br />
im Anlassfall nicht ausreichend bekannt ist und in geübter Form<br />
angewendet werden kann?<br />
Entscheidend ist, dass der Arbeitgeber seiner gesetzlichen<br />
Fürsorgepflicht nachkommt und durch geeignete Maßnahmen,<br />
Qualitätssicherung und entsprechende Wirksamkeitskontrolle<br />
sicherstellt, dass Menschenleben von MitarbeiterInnen, Kund-<br />
Innen etc. geschützt und betriebsbedingte Leistungsstörungen<br />
vermieden bzw. zumindest gemindert werden.<br />
Das praktische Üben soll die erworbenen Kenntnisse aus<br />
den theoretischen Lehreinheiten festigen und den Mitarbeiter-<br />
Innen Sicherheit für den Arbeitsalltag vermitteln. Eine der elementarsten<br />
Erkenntnisse der Lernpsychologie ist, dass ohne<br />
Wiederholung und Übung Lerninhalte rasch wieder verloren<br />
gehen. Die Ebbinghauskurve belegt dies eindrucksvoll.<br />
Demnach verliert der Mensch zuerst relativ schnell das Erlernte,<br />
danach verbleibt aber ein relativ konstanter Wissensstand.<br />
Neben dem frühzeitigen und regelmäßigen Wiederholen<br />
spielt auch die Schulungsdauer und –menge eine entscheidende<br />
Rolle. Bereits nach einer Stunde ist das „Lernplateau“ erreicht<br />
und nach ca. 3 Stunden wird beinahe der Nullpunkt erreicht.<br />
Dementsprechend sollte bei der Sicherheitsausbildung dieser<br />
Umstand berücksichtigt werden.<br />
Durch präventive Maßnahmen können Banküberfälle nicht<br />
generell verhindert werden, sie erhöhen aber die Chance, durch<br />
besondere Aufmerksamkeit kriminelle Handlungen abzuwehren<br />
und es kann das Bewusstsein im Umgang mit Bedrohungsszenarien<br />
gestärkt werden. Gut trainierte MitarbeiterInnen sind<br />
sensibilisiert und reagieren im Bedrohungsfall sicherer, benötigen<br />
weniger Nachbetreuung und können auch rascher wieder den<br />
Arbeitsprozess aufnehmen. Eventuell anwesende KundInnen können<br />
mittelbar durch deeskalierendes Verhalten geschützt werden.<br />
Psychische und physische Belastung<br />
Bei einem Überfall können die Betroffenen bei aller<br />
psychischen Belastung auch körperlich (persönlich) angegriffen<br />
werden. Die körperliche Gewalt kommt zwar nur vereinzelt vor,<br />
darf aber nicht außer Acht gelassen werden.<br />
In der Regel ist der Stress, dem Überfallene ausgesetzt sind,<br />
sehr groß. Diese psychische Belastung kann unterschiedlich<br />
ausgeprägt sein und, wenn sie nicht behandelt wird, bis zu langfristigen<br />
gesundheitlichen Problemen und Schäden führen.<br />
Daraus resultieren Fehlzeiten, die den Verlust des Arbeitsplatzes<br />
bedeuten können.<br />
Die primäre Traumatisierung (hohe zeitliche Nähe, direkte<br />
sensorische Eindrücke) beschreibt das eigene Erleben eines<br />
Traumas. Sekundäre Traumatisierung findet sich etwa bei<br />
ZeugInnen oder HelferInnen (zeitlicher Abstand, keine eigenen<br />
sensorischen Eindrücke).<br />
Das Erlebnis von einem oder mehreren Banküberfällen<br />
bedeutet für die Betroffenen Gewaltanwendung, die zu traumatischen<br />
Folgen und gegebenenfalls bis zur Unfähigkeit, diesen<br />
Beruf „am Schalter“ weiter ausüben zu können, führen kann.<br />
Nicht zuletzt dieser Umstand führte aktuell zu einer Ergänzung<br />
des Kollektivvertrages für Geldinstitute zum Thema Sicherheit<br />
– Ausbildung, Unterweisung, Nachbetreuung.<br />
Durch eine prophylaktische Erarbeitung des typischen Aggressionsgeschehens<br />
im Rahmen von entsprechenden Schulungen<br />
und einer laufenden Auseinandersetzung durch Unterweisung<br />
und Übung kann man unmittelbar und mittelbar Betroffene in<br />
Arbeitsbereichen mit Gewaltentladungspotential befähigen,<br />
• Gefahrensituationen rechtzeitig zu erkennen,<br />
• gegebenenfalls zu verhindern<br />
• oder zumindest deeskalierend zu wirken,<br />
• besser mit der Situation fertig zu werden<br />
• und auf eine gute Verarbeitung des Geschehenen vorbereiten.<br />
Welche Rolle spielen Führungskräfte und Kollegen?<br />
In einer Feldstudie von Ing. Thomas Reiner gaben alle<br />
befragten ExpertInnen bei der Frage, wie wichtig die MitarbeiterInnenführung<br />
für die Sicherheit in der Bank ist, einen<br />
Prozentsatz zwischen 80 und 100 an. Wenn das Sicherheitsthema<br />
zur „Chefsache“ erklärt und positives Verhalten vorgelebt wird,<br />
ist ein gutes Fundament für eine solide, akzeptierte und wirksame<br />
Sicherheitsausbildung gegeben.<br />
Darüber hinaus ist die Einbeziehung von Betroffenen eine<br />
wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die Maßnahmen an den<br />
tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientieren, z.B.<br />
durch eine Erhebung, welche Faktoren Überfallene als besonders<br />
belastend erleben und mit welchen Maßnahmen ihnen am<br />
besten geholfen werden kann.<br />
▲<br />
Abb. 2: Vergessenskurve nach Ebbinghaus (1885)<br />
Abb. 3: Verlust des Arbeitsplatzes nach einem traumatischen Ereignis, Quelle Mag.<br />
Reiter (Klinischer- und Gesundheitspsychologe, Rotes Kreuz und Uni Innsbruck)<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
11
Der Einsatz von Betroffenen im Rahmen der Ausbildung,<br />
Unterweisung, Übung und Nachbetreuung hat sich in der Praxis<br />
bereits sehr gut bewährt, weil diese MitarbeiterInnen als<br />
„Wissende“ akzeptiert werden. Meistens sind sie außerhalb<br />
hierarchischer Strukturen tätig und fokussieren ihre Arbeit auf<br />
die emotional basierten Problemstellungen. Ein strukturierter<br />
Ausbau dieses Modells in Richtung Peer-System erscheint sinnvoll.<br />
Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings auch die<br />
gezielte Ausbildung dieser Personen und laufende Begleitung<br />
durch SupervisorInnen. Dieser Lösungsansatz kann jedoch<br />
nicht den Einsatz von psychosozialen Fachkräften im Gewalttraumabereich<br />
oder therapeutische Behandlung durch Psycholog-<br />
Innen bzw. PsychotherapeutInnen ersetzen.<br />
Welche Rahmenbedingungen sind relevant?<br />
Außerdem braucht es eine institutionalisierte Wirksamkeitskontrolle<br />
z.B. im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS),<br />
Prüfungen durch die Revision etc. sowie Konsequenzen bei<br />
Nichteinhaltung. Es muss überprüft werden, ob vereinbarte Ausbildungs-,<br />
Unterweisungs- und Übungsmaßnahmen umgesetzt<br />
sowie begleitende Arbeitsanweisungen eingehalten werden.<br />
Im Sinne einer Qualitätssicherungsmaßnahme ist es sinnvoll,<br />
entweder anonymisiert oder personalisiert die Meinung der<br />
Betroffenen über Aufbau, Inhalt, Periodizität und Trainingsmethode<br />
sowie Trainer abzufragen.<br />
Aus meiner Erfahrung ist es wirkungsvoll, etwa zwei bis<br />
drei Wochen nach einem Überfallgeschehen ein Evaluierungsgespräch<br />
vor Ort mit den Betroffenen zu führen. Ziel ist,<br />
das Vorkommnis und seinen Ablauf nochmals durchzugehen<br />
und daraus eventuellen Handlungsbedarf abzuleiten. Einerseits<br />
können so sinnvolle z.B. bauliche und organisatorische Verbesserungsmöglichkeiten<br />
erkannt werden. Andererseits trägt<br />
diese Besprechung zur positiven Verarbeitung des Geschehenen<br />
durch die Betroffenen bei, festigt ihr Wissen um möglichst<br />
richtiges Verhalten für etwaige künftige Vorkommnisse und gibt<br />
Orientierung, ob Ausbildungs-, Unterweisungs- und Übungsinhalte<br />
oder -methoden angepasst werden müssen.<br />
Erfahrungsgemäß ist es wichtig, dass die Ausbildungsinhalte<br />
immer wieder den sich national und international verändernden<br />
Rahmenbedingungen angepasst werden und inhaltlich Ausbildung,<br />
Unterweisung und Übung abwechslungsreich gestaltet<br />
werden, damit die Aufmerksamkeit und der Erinnerungswert<br />
möglichst hoch gehalten werden können.<br />
Wie wichtig ist Nachbetreuung?<br />
Die psychologische Nachbetreuung war in früheren Jahren<br />
eher kein Thema. Es hat sich jedoch die Einstellung des<br />
Managements und der MitarbeiterInnen zu diesem Thema<br />
positiv verändert. Die Nachbetreuung wird mittlerweile in<br />
Österreich flächendeckend von den Geldinstituten ihren MitarbeiterInnen<br />
angeboten. Die Betroffenen können natürlich selbst<br />
entscheiden, ob sie eine Nachbetreuung in Anspruch nehmen<br />
wollen oder nicht. Ein erstes Gespräch mit einem/r Psychologen/in<br />
wird meist geführt. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass<br />
bereits am Tag des Geschehens eine psychosoziale Fachkraft mit<br />
Erfahrung im Gewalttraumabereich vor Ort ist, wie dies auch<br />
im neuen Kollektivvertrag beinhaltet ist. Einen neuen Ansatz<br />
liefert die Überlegung, das Peer-System nach Jeffrey T. Mitchell 1<br />
auch in Geldinstituten anzuwenden. Erfolgreich werden Peers<br />
bereits in Blaulichtorganisationen wie Rotes Kreuz, Feuerwehr,<br />
Polizei, aber auch in der Industrie (OeBB, Luftfahrt) eingesetzt.<br />
Erste Ansätze, Peers auch in den Geldinstituten einzusetzen,<br />
gibt es über die Initiative von Mag. Martin Reiter 2 in der Tiroler<br />
Sparkasse.<br />
Peers („Gleiche“ = Kollege) sind nach den Regeln der International<br />
Critical Incident Stress Foundation (ICISF) ausgewählte<br />
und speziell geschulte Personen. Sie sind als Bindeglied<br />
zwischen den Betroffenen und den professionellen HelferInnen<br />
zu sehen. Umgelegt auf Geldinstitute bedeutet dies, dass die<br />
Peers aus den eigenen Reihen kommen, den KollegInnen bekannt<br />
sind und auf eigene Erfahrung zurückgreifen können, was<br />
dadurch ihre Glaubwürdigkeit erhöht. Die Erfahrung zeigt, dass<br />
ein rasches Gespräch nach einem Ereignis die Gefahr einer<br />
Traumatisierung erheblich senkt. Das Peer-System bietet bankinterne<br />
Hilfe für KollegInnen von geschulten KollegInnen in<br />
außergewöhnlichen Situationen und Lebenslagen.<br />
Die Voraussetzungen für ein Peer-System skizziert Mag.<br />
Reiter folgendermaßen:<br />
• Erweiterung des betrieblichen Gesundheitsmanagements<br />
(BGM) der Bank<br />
• Bewusstseinsbildung (für MitarbeiterInnen und Führungskräfte)<br />
im Unternehmen<br />
• Adaptierung von Normen, Regeln und Wertvorstellungen<br />
innerhalb eines Geldinstituts<br />
• Das Vorleben von Normen, Regeln und Werten von der<br />
Managementebene bis hin zur MitarbeiterInnenebene<br />
• Berücksichtigung von gesundheitsförderlichen Maßnahmen<br />
bei internen Entscheidungen<br />
• MitarbeiterInnen als Humankapital des Unternehmens<br />
verstehen und nicht als Kostenfaktor<br />
• Ganzheitliches Verständnis für die Dynamik zwischen<br />
Unternehmen und Mensch<br />
Ein Beispiel aus der Praxis<br />
Wie ein Überfall durch ausgebildete, ruhig und überlegt<br />
handelnde MitarbeiterInnen deeskaliert werden kann, zeigt ein<br />
Auszug aus einem Polizei-Bericht aus dem Jahr <strong>2008</strong>:<br />
„Dieser Mann stellte sich an der Kassa an, als er an der Reihe<br />
war legte er ohne etwas zu sagen eine Papiertragtasche auf das<br />
Kassenpult, daraus entnahm er eine schwarze Pistole mit silberf.<br />
Lauf, repetierte die Waffe und sagte dann „ÜBERFALL –<br />
GELD HER“. In ihrer Aufregung gelang es der Kassierin nicht,<br />
mit dem vorgesehenen Code die Kassa zu öffnen. Dem Täter<br />
fiel das Missgeschick auf und er sagte er werde bis drei zählen<br />
und dann schießen, wenn er kein Geld erhalten würde. Er begann<br />
auch laut zu zählen. Der in der Nähe stehende Bankangestellte<br />
bekam den Vorfall mit und unterstützte sofort die nervöse<br />
Kollegin. Er löste mit der Fußschiene den Alarm aus und es gelang<br />
ihm dann in weiterer Folge, seiner Kollegin zu helfen und<br />
die Kassa zu öffnen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen.“<br />
Welche Rolle spielt die Medienberichterstattung?<br />
Eine auf Schlagzeilen ausgerichtete Medienberichterstattung<br />
kann dazu beitragen, dass, ähnlich wie bei Selbstmorden,<br />
Nachahmer auf den Plan gerufen werden. Durch die<br />
Veröffentlichung detaillierter Berichte über den Tathergang,<br />
12<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
die Beutesumme etc. vermittelt man potenziellen Tätern, dass es<br />
relativ leicht ist zu viel Geld zu kommen und gibt „Handlungsempfehlungen“,<br />
wie es geht. Über 50% der Täter lassen sich in<br />
irgendeiner Art und Weise von der Medienberichterstattung<br />
beeinflussen oder inspirieren.<br />
Zusammenfassung<br />
Nach Banküberfällen stehen in der Regel die TäterInnen,<br />
deren Festnahme, der Prozess, spektakuläre Begleitumstände<br />
etc. im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Opfer<br />
werden nicht selten erst wahrgenommen, wenn die Gewalttat<br />
unübersehbare Folgen hinterlassen hat.<br />
Erfolgsdruck, Deckungsbeitrag und hohe Zielvereinbarungen<br />
lassen in der Praxis die menschliche Komponente manchmal in<br />
den Hintergrund treten. Durch Schulung, Unterweisung und<br />
Übung können Banküberfälle nicht generell verhindert werden,<br />
sie erhöhen aber einerseits die Chance, durch besondere<br />
Aufmerksamkeit kriminelle Handlungen abzuwehren, und<br />
andererseits lehren und trainieren sie das richtige Verhalten und<br />
können dadurch Menschenleben schützen helfen.<br />
Durch eine umfassende Schulung und laufende Auseinandersetzung<br />
der MitarbeiterInnen mit der Problemstellung<br />
kann das Bewusstsein im Umgang mit Bedrohungsszenarien<br />
gestärkt werden. Gut geschulte und trainierte MitarbeiterInnen<br />
sind sensibilisiert und können daher Überfälle auch schon<br />
im Vorfeld verhindern oder zumindest deren Auswirkungen<br />
vermindern helfen. Betroffene reagieren im Bedrohungsfall<br />
sicherer, benötigen weniger Nachbetreuung und können daher<br />
auch rascher wieder den Arbeitsprozess aufnehmen. Eventuell<br />
anwesende KundInnen können mittelbar durch deeskalierendes<br />
Verhalten geschützt werden.<br />
Die MitarbeiterInnen stellen das größte Kapital eines<br />
Geldinstitutes dar und sind somit auch ein wesentlicher Risikound<br />
Sicherheitsfaktor. Es gibt unterschiedliche Ansätze der einzelnen<br />
Geldinstitute, Banküberfälle zu reduzieren: sei es mit<br />
baulichen, technischen, organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen<br />
oder mit verstärktem Einsatz von Sicherheitspersonal.<br />
Schulungen wurden zwar auch in der Vergangenheit angeboten,<br />
auch gab es Alarmübungen etc. – jedoch aus meiner Sicht noch<br />
nicht überall im notwendigen qualitativen und quantitativen<br />
Ausmaß.<br />
Der erste Schritt in die richtige Richtung ist der vor kurzem<br />
erst verabschiedete Kollektivvertrag Sicherheit für Geldinstitute.<br />
Es ist geplant, die Umsetzung und die Wirksamkeit des neuen<br />
KV in einem Jahr zu evaluieren.<br />
1<br />
Professor an der Universität von Baltimore, entwickelte das CISD (Critical Incident Stress Debriefing)<br />
2<br />
Klinischer- und Gesundheitspsychologe, Rotes Kreuz und Uni Innsbruck ❙<br />
Lösungen aus der SMARAGD<br />
Produkt-Familie sind bei rund<br />
750 Finanzinstituten in mehr als<br />
40 Ländern im Einsatz.<br />
cellent finance solutions AG<br />
Finanzkriminalität<br />
kennt viele Wege und keine Grenzen<br />
Die Bekämpfung der<br />
Finanzkriminalität steht<br />
weltweit im Fokus –<br />
ist Ihr Unternehmen vor den<br />
Konsequenzen geschützt?<br />
Die marktführende Softwarelösung der SMARAGD Produkt-Familie unterstützt Sie bei der konzernweiten<br />
Gefährdungsanalyse sowie bei der Überwachung von Finanzkriminalität.<br />
Risiko-/Gefährdungsanalyse<br />
Geldwäsche<br />
Embargo/Sanktionen<br />
Terrorismusfinanzierung<br />
Wertpapier-Insiderhandel<br />
Finanzbetrug<br />
Kontakt: Cellent Finance Solutions AG·Calwer Straße 33·D-70173 Stuttgart/Germany<br />
Tel. +49 (0) 711 222992-900·Fax +49 (0) 711 222992-999·info@cellent-fs.de·www.cellent-fs.de<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
13
Sicherheit im Foyer<br />
Objektüberwachung<br />
Die Zunahme von Vandalismus,<br />
Manipulationen bzw. Skimming an SB-<br />
Geräten sowie der unberechtigten Aufenthalte<br />
von Personen in Bankenfoyers und allgemein zugänglichen<br />
SB-Bereichen, rücken Produkte, die dem entgegenwirken, in den Fokus.<br />
MAKU Informationstechnik GmbH und die KEBA AG bieten effektive Maßnahmen um die<br />
Zutrittskontrollen LS23M und KeBin S6 gegen Manipulationsversuche zu sichern. Weitere ineinander<br />
greifende Maßnahmen zur Ausstattung von Foyers mit leistungsfähiger Objektüberwachung runden das Leistungsportfolio<br />
der MAKU Informationstechnik GmbH ab.<br />
von Burkhard Wolff<br />
Skimming-Attacken erschweren<br />
Nur das Auslesen sämtlicher Daten einer EC-Karte ermöglicht<br />
eine Verfügung am Geldausgabeautomaten. Durch die<br />
flache und geradlinige Bauform der Zutrittskontrolle LS 23M<br />
und die strukturierte Oberfläche sowie die allseitig gewölbten<br />
Konturen beim KeBin S6 wird Betrügern das Aufbringen eines<br />
unauffälligen Vorsatzgerätes zum Auslesen der Daten einer EC-<br />
Karte nahezu unmöglich gemacht. Es würde die einheitliche<br />
Form der Kartenleser sichtbar und auffällig verändern – was<br />
auch für Laien leicht erkennbar ist. Zusätzlich verlangt eine<br />
Funktionalität des KeBin S6-Kartenlesers den tiefen Einschub<br />
der Karte in das Lesemodul. Ein montiertes Vorsatzgerät hätte<br />
zur Folge, dass der Benutzer die Karte nicht mehr komplett in<br />
das Lesemodul einschieben kann und ein Lesefehler ausgegeben<br />
wird. In jedem Fall bleibt das Foyer geschlossen und ein Ausspähen<br />
der Karten-PIN im Foyer ist nicht möglich.<br />
Skimming-Attacken verhindern<br />
Vorsatzgeräte werden mit Hilfe eines von MAKU entwickelten<br />
Anti-Skimming-Moduls unwirksam gemacht. Bei der<br />
Entwicklung wurde besonders darauf geachtet, die Funktionsfähigkeit<br />
und Zuverlässigkeit der Zutrittskontrolle nicht zu beeinträchtigen.<br />
Die MAKU Lösung sowie auch die Lösung beim KeBin<br />
S6-Kartenleser schützen darüber hinaus zusätzlich das Kartenlesergehäuse<br />
gegen Manipulation und Demontage. Sämtliche<br />
Manipulationsversuche (wie das Öffnen des Kartenlesergehäuses<br />
oder des Türmoduls, die Entwendung und anschließendes<br />
Anbringen in manipulierter Form) werden automatisch erkannt<br />
und lösen eine sofortige Statusmeldung aus, die z.B. zur<br />
Sperrung der Zutrittsbereiche und Benachrichtigung einer<br />
zuständigen Stelle, z.B. Alarmzentrale, führt. Mit Hilfe der<br />
Fernwirkfunktion der DiVA-Systeme kann zusätzlich und direkt<br />
Einfluss genommen werden.<br />
Das Anti-Skimming-Modul von MAKU ist für alle<br />
LS 23M-Kartenleser mit geringstem Aufwand nachrüstbar.<br />
Optional bietet MAKU bis zu fünf unterschiedliche Schlüsselkreise<br />
an. Des Weiteren können alle installierten KEBA<br />
Pasador-Systeme mit der neuen Demontageüberwachungs-<br />
Firmware umgerüstet werden.<br />
Leistungsfähige Objektüberwachung im Foyer<br />
Mit Hilfe der neuen DiVA-Funktion „Überwachung“ von<br />
der MAKU Informationstechnik GmbH kann eine Raumüberwachung<br />
konfiguriert werden, die den genannten Problemen<br />
Vandalismus, Manipulationen bzw. Skimming entgegenwirkt.<br />
Im Menü der Funktion sind bis zu fünf Ereignisse für<br />
das Auslösen und für das Zurücksetzen der Überwachung konfigurierbar.<br />
Die Ereignisse sind Kontakte oder Bewegungserkennungsprofile.<br />
Für jede analoge Kamera können bis zu fünf<br />
Bewegungserkennungsprofile mit jeweils verschiedenen Abtastbereichen<br />
festgelegt und abgespeichert werden.<br />
Die Wirkungsweise wird an folgendem Beispiel deutlich:<br />
Eine Kamera wird auf den Geldausgabeautomaten ausgerichtet<br />
und erfasst dessen direktes Umfeld. Stellt die Software eine<br />
Bewegung in diesem Bereich fest, wird ein Timer gesetzt, der<br />
auf ein weiteres Ereignis, z.B. die GAA-Transaktion, wartet.<br />
Folgt dieses Ereignis nicht, wird eine Meldung generiert, die<br />
folgende Aktionen auslösen kann:<br />
• Alarmaufzeichnung<br />
Die Funktion „Überwachung“ wird als Gerät im System angelegt<br />
und kann als Ereignis in den Aufzeichnungsspuren ausgewählt<br />
werden.<br />
14<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
durch Antiskimming und<br />
Fotos: Maku<br />
• SNMP-Trap versenden<br />
In der Konfiguration der „Überwachung“ wird ein Benutzer-<br />
Trap festgelegt, der an einen SNMP- Server gesendet werden<br />
kann.<br />
• Bilder an Alarmzentrale schicken<br />
Über das Gerät „Alarm“ können Bilder auf einen externen<br />
FTP-Server gesendet werden.<br />
Mit der Funktion "Überwachung" werden die Sicherheit<br />
und der ungestörte Betrieb eines SB-Bereichs sichergestellt. Bei<br />
entsprechender Anbindung an eine Alarmzentrale können Vorfälle<br />
rechtzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen<br />
eingeleitet werden.<br />
❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
15
Zeit für eine neue<br />
Sicherheitsstrategie?<br />
Datendiebstahl hat Hochkonjunktur – auch in Österreich. Dabei stehen besonders die<br />
Finanzinstitute – die täglich eine Vielzahl geschäftskritischer und sensibler Daten<br />
austauschen – im Fokus der Datenspione. Höchste Zeit also, die eigene<br />
Sicherheitsstrategie auf den Prüfstand zu stellen.<br />
von Urs Flück<br />
Weltweit häufen sich die Meldungen zu Datenverlust und<br />
Datendiebstahl. In Großbritannien haben Diebe Anfang dieses<br />
Jahres mehrere Festplatten entwendet, auf denen persönliche<br />
Daten von Millionen Kindergeldempfängern gespeichert waren.<br />
Schwedens Militär untersuchte kürzlich einen Sicherheitsverstoß<br />
eines Mitarbeiters, der einen USB-Stick mit geheimen<br />
Daten an einen öffentlichen Computer angeschlossen hat. Auch<br />
Österreich macht mit besorgniserregenden Vorfällen von sich<br />
reden: Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat ein<br />
Justizwachbeamter in der Justizanstalt Wien-Josefstadt ausführliche<br />
Datensätze von über 8.500 Häftlingen gestohlen und<br />
einem Häftling übergeben.<br />
Nachrichten dieser Art sollten Unternehmen und besonders<br />
Finanzinstitute, die sensible und wertvolle Daten auf ihren<br />
Systemen gespeichert haben, wachrütteln. Sie werfen zudem die<br />
Frage auf: „Wie viele Sicherheitsverstöße in Banken und in<br />
Unternehmen gab es bereits in der Vergangenheit, die nie an die<br />
Öffentlichkeit gedrungen sind?“ Die Europäische Kommission<br />
hat das Problem erkannt und versucht unter Hochdruck, entsprechende<br />
Regelungen zu treffen. Analog zu Gesetzesvorlagen<br />
in einigen US-Bundesstaaten sollen die Banken verpflichtet<br />
werden, ihre Kunden zu informieren, sobald die Sicherheit<br />
persönlicher Daten ernsthaft verletzt wurde. Grundsätzlich gilt:<br />
Datenverluste ziehen nicht nur Umsatzeinbußen und hohe<br />
Vertrags- oder Konventionalstrafen nach sich, sondern schaden<br />
auch dem Image und der Glaubwürdigkeit derjenigen Finanzhäuser,<br />
die ihre Kundendaten schlampig absichern. Höchste<br />
Zeit für die Banken, sich die Gefahr digitaler Angriffe ins<br />
Bewusstsein zu rufen und die eigenen Sicherheitsstrategien und<br />
-maßnahmen auf den neuesten Stand zu bringen.<br />
Sicherheit gleich Risikomanagement<br />
Durchschnittlich gibt die Finanzbranche rund fünf Prozent<br />
ihres IT-Budgets für Sicherheitssysteme und -komponenten aus.<br />
Der Marktforscher Gartner fand jedoch heraus, dass kein direkter<br />
Zusammenhang zwischen der Höhe der Investitionssumme<br />
und dem Grad der Sicherheit besteht. Wer also viel Geld in<br />
Security-Anwendungen und dergleichen steckt, ist demnach<br />
noch lange nicht vor kriminellen Attacken gefeit. Die jüngsten<br />
Vorfälle beweisen, dass probate Regelungen und Prozesse nicht<br />
zwangsläufig vor Sicherheitsverstößen schützen.<br />
Um der „Datenklau“-Bedrohung entgegentreten zu können,<br />
sollten Sicherheitskonzepte grundsätzlich mit Risikomanagement-Überlegungen<br />
einhergehen. Dabei gilt es, potenzielle<br />
Schwachstellen und Gefahren für die Informationsquellen, auf<br />
die die Banken zugreifen, eindeutig zu identifizieren. Darauf<br />
aufbauend lassen sich entsprechende Gegenmaßnahmen definieren,<br />
welche die Organisation – je nach Priorität der Informationsquelle<br />
– im Falle eines Sicherheitsverstoßes einleitet.<br />
Security bringt klaren Return-on-Investment<br />
Wer sich effiziente Sicherheitsmaßnahmen ins Haus holen<br />
möchte, scheitert meist an der Hartnäckigkeit seiner Controlling-Abteilung<br />
oder stößt auf Unverständnis der Geschäftsführung.<br />
Meist spielen die Verantwortlichen Investitionen in die IT-<br />
Sicherheit als Kostenpunkt ohne Mehrwert herunter. Verschärfte<br />
Sicherheitsinstrumente leisten jedoch mehr, als vielen überhaupt<br />
klar ist. Sie tragen nicht nur den gesetzlichen Anforderungen<br />
Rechnung (Compliance), sondern schaffen eine höhere Systemverfügbarkeit<br />
und Datensicherheit. Damit gehen die Sicherheitsbestrebungen<br />
in ihrer gesamten Tragweite weit über die Grenzen<br />
der eigenen IT-Infrastruktur hinaus. Betrachtet man die möglichen<br />
Folgekosten von Datenverlusten und dem damit verbundenen<br />
möglichen Datenmissbrauch, so liefern sinnvoll eingesetzte<br />
Security-Komponenten einen klaren Return-on-Investment<br />
(RoI) – das überzeugendste Argument für deren Anschaffung.<br />
Die IT-Technologien selbst haben schon vor geraumer Zeit<br />
alle geografischen und logistischen Hürden überwunden. Selbst<br />
die kleinsten Banken können heutzutage geschäftskritische und<br />
sensible Daten innerhalb weltweit gespannter Netzwerke mit<br />
anderen Finanzinstituten und Partnern austauschen. In Zeiten<br />
der Globalisierung ist das Risiko von Sicherheitsverstößen<br />
16<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
jedoch so hoch wie nie. Nur wenn entsprechende Sicherheitstechnologien<br />
im Hintergrund arbeiten, kann die IT ihr volles,<br />
gewinnbringendes Potenzial entfalten.<br />
Geschäftsprozesse für das Tagesgeschäft absichern<br />
Banken müssen besonderes Augenmerk auf Datentransfers<br />
legen. Weil diese in den Instituten weit verbreitet Anwendung<br />
finden – sei es bei Datenbankaktualisierungen, Systemupdates<br />
von unterschiedlichen Filialen oder beim Austausch privater<br />
Kundeninformationen wie die Kreditkartennummer –, gehören<br />
sie fast schon zu jedem Geschäftsprozess dazu. Dadurch bietet<br />
sich Hackern eine größere Angriffsfläche mit zahlreichen<br />
Schwachstellen. Findet der Datenaustausch darüber hinaus ohne<br />
Verschlüsselung statt, kann die Information leicht über die<br />
jeweilige Kommunikationsverbindung abgefangen werden.<br />
Es gibt bereits einige Finanzinstitute, die sich über die Sensibilität<br />
und Wichtigkeit der Daten, die sie untereinander austauschen,<br />
durchaus im Klaren sind. Sie haben Pionierarbeit geleistet,<br />
wenn es darum geht, die Defizite des sogenannten File<br />
Transfer Protocol (FTP) auszumerzen und effektivere Sicherheitstechnologien<br />
zu implementieren. Mittlerweile zeichnet sich<br />
in der Branche ein Trend zum Einsatz sogenannter Managed<br />
File Transfer (MFT)-Produkte ab. Diese Lösungen punkten<br />
durch Sicherheit, Prognose-Funktionalität und effektives Datenmanagement<br />
innerhalb und außerhalb der Finanzorganisation.<br />
Ausgestattet mit zusätzlichen Verschlüsselungsdiensten lassen<br />
sich Datenpakete bereits während der Übertragung sichern. Zudem<br />
reduziert sich der manuelle Eingriff – meist das schwächste<br />
Glied innerhalb der gesamten Sicherheitskette – auf ein Minimum.<br />
Ein weiteres hilfreiches Mittel bei der Konzeption von<br />
Sicherheitsstrategien ist der sogenannte „Defence-in-depth“-<br />
Ansatz. Dabei werden verschiedene Sicherheitsmaßregeln<br />
definiert, die entsprechenden Prozesse übereinander gelegt und<br />
überlappend angeordnet. Sollte eine Sicherheitsmaßnahme im<br />
Falle eines Verstoßes versagen, kommt automatisch die darüber<br />
liegende Maßnahme zum Tragen.<br />
Mitarbeiter in den Sicherheitsprozess einbeziehen<br />
Ob die eingesetzte Sicherheitstechnologie letztendlich zum<br />
Erfolg führt, entscheiden auch die Mitarbeiter. Sie müssen<br />
dahingehend geschult werden, wann ein Sicherheitsverstoß<br />
vorliegt und welches Verhalten hierbei angebracht ist. Darüber<br />
hinaus müssen die eingesetzten Instrumente kontinuierlich getestet<br />
und kontrolliert werden, denn mit ständigen Änderungen<br />
des eigenen Geschäftsumfeldes entstehen neue Bedrohungen<br />
und treten weitere Schwachstellen zu Tage. Hinzu kommt: Da<br />
die eigenen Unternehmensgrenzen zunehmend verschwimmen<br />
und Memory Sticks oder iPods weit verbreiteten Einsatz finden,<br />
spielt die Perimeter-Sicherheit – die Sicherheit an den Nahtstellen,<br />
die das Unternehmensnetz mit der Öffentlichkeit verbinden,<br />
– das Schlüsselelement für jede Sicherheitsstrategie.<br />
Fest steht: Das eigene Sicherheitskonzept muss sowohl mit<br />
der Technologie als auch mit dem Einsatz im Tagesgeschäft<br />
wachsen. Wenn also die Controlling-Abteilung oder die<br />
Geschäftsführung die Kosten für die Sicherheitstechnologien<br />
unter die Lupe nimmt, sollte stets bedacht werden, dass Sicherheit<br />
einen wichtigen Beitrag zur Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit<br />
leistet.<br />
Urs Flück, Jahrgang 1966, ist seit Februar 2007 Industry<br />
Consultant für die Finanzbranche bei Sterling Commerce. In<br />
dieser Funktion unterstützt er die Pre-Sales Aktivitäten bei<br />
potentiellen Kunden der Finanzindustrie. Der gebürtige Schweizer<br />
kommt vom Finanzsoftware-Anbieter SunGard, für den Flück<br />
seit 1998 mit einer kurzen Unterbrechung als Senior Consultant<br />
tätig war. In dieser Position verantwortete er zahlreiche Kundenbeziehungen<br />
zur Finanzbranche in Zentraleuropa (Schweiz,<br />
Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und<br />
Benelux) und war im Business Development von neuen Modulen<br />
für andere SunGard Geschäftseinheiten tätig. Urs Flück hat ein<br />
Studium der Wirtschaftsinformatik und Russistik an der Universität<br />
Zürich erfolgreich abgeschlossen.<br />
❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
17
GBS festigt Spitzenposition bei SB-<br />
Online Münzeinzahlung im Foyerbetrieb<br />
Die erfolgreiche Teilnahme an der erstmaligen S-Proserv Ausschreibung für SB-<br />
Münzeinzahler im Online Betrieb bestätigt die führende Rolle der GBS-Technologie in<br />
diesem Marktsegment. Über einen Zeitraum von 5 Monaten wurden durch die Expertenrunde<br />
der Ersten Bank / Sparkassen zwei von acht Teilnehmern als künftige Lieferanten für<br />
den österreichischen Sparkassensektor ermittelt und zertifiziert.<br />
Dabei unterzog man die Geräte einer harten Prüfung. Zählgenauigkeit, Falschmünzenerkennung,<br />
Bedienungsfreundlichkeit und vor allem Fremdkörperunempfindlichkeit waren<br />
die technischen Kriterien. GBS punktete in allen diesen Bereichen und zusätzlich durch die<br />
enorme Wirtschaftlichkeit.<br />
GBS 9403DC - Online<br />
Erste Bank/Sparkassen zertifiziert<br />
Neue Wege in Bezug auf globale Anwendung<br />
der Technologie geht man in Gratkorn<br />
seit 2006. Man trennte sich von der in<br />
die Jahre gekommene Basis der Elektronik<br />
Hardware, entwickelte in einem sehr kurzen<br />
Zeitraum eine neue Generation mit hochintelligenten,<br />
modernsten Komponenten. Die bestens funktionierende vorhandene<br />
Mechanik musste den neuen Antriebsaggregaten angepasst werden bzw. es konnten<br />
zusätzliche technische Feinheiten zur weiteren Stabilisierung des Systems entwickelt<br />
und integriert werden.<br />
Fremdkörper resistentes High-Tech<br />
Münzfördersystem von GBS<br />
„Unsere Fremdkörperunempfindlichkeit ist enorm hoch. Wahrscheinlich<br />
die höchste, die es derzeit bei SB-Münzzählern gibt. Hier treten wir jeden<br />
Vergleich an. Die Statistiken der Instandhaltungskosten unserer SB-<br />
Münzzähler über die letzten 10 Jahre bestätigen dies eindrucksvoll“,<br />
sagt Franz Lechner, GBS-Geschäftsführer<br />
Fotos: GBS<br />
CNAC – Prüfung durch die Münze Österreich<br />
Im September <strong>2008</strong> wurde der neue GBS-Münzzählsensor CCV-10.1 in den Räumlichkeiten<br />
der Münze Österreich nach Art. 5 – 2005/504/EC erfolgreich geprüft. Damit erfüllt<br />
GBS die Anforderungen innerhalb der Währungsunion, ebenso kommen alle Nicht-€uro<br />
Partner in den Genuss höchster Zählsicherheit und Fälschungserkennung der Münzen.<br />
Weitere Infos über die komplette GBS-Produktpalette unter:<br />
www.gbs-moneysys.com<br />
GBS – know how and innovation<br />
GBS 9407DC -<br />
sidecar mit CCV-10.1<br />
Münzzählsensor<br />
18<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
SiS verstärkt ihr Team<br />
mit Top-Profis<br />
Foto: Maku<br />
Seit kurzem freut sich die SiS-Firmengruppe über eine<br />
besondere personelle Verstärkung. Bernd Göber und<br />
Wolfgang Hank, zwei in Branchenkreisen bestens<br />
bekannte Top-Profis, sind nunmehr bei der SiS für die<br />
Netzwerkintegrierte Sicherheitssysteme<br />
von MAKU Deutschland<br />
sind ein wichtiger Bestandteil des<br />
SiS-Bankensicherheitskonzepts<br />
Projektierung und den Vertrieb von Sicherheitssystemen<br />
Foto: SIS<br />
in Wien und Niederösterreich verantwortlich.<br />
Beide verfügen über eine jahrzehntelange Praxis und<br />
zeichnen sich besonders durch eine perfekte,<br />
kundenorientierte Projektumsetzung aus.<br />
„Unser Institut will bei sicherheitstechnischen<br />
Anlagen immer einen<br />
modernen Standard realisieren.<br />
SiS Security ist dabei der perfekte<br />
Ansprechpartner: optimale Beratung,<br />
straffe Projektabwicklung, gut geschultes<br />
Personal zeichnen diesen Lieferanten aus.“<br />
Frau Dir. Dr. Ilse A Vigl,<br />
Vorstand WSK-Bank (Wiener Spar- und Kreditinstitut)<br />
DiVA, eine Erfolgsstory in der Bankensicherheit<br />
Zwei erfahrene Speziallisten für Bankensicherheit verstärken das SiS-Team:<br />
Wolfgang Hank und Bernd Göber.<br />
Die SiS Firmengruppe um Egon Maurer, österreichweit<br />
Anbieter von hochwertigen Alarm-, Video,- und Zutrittssystemen,<br />
verstärkt damit ihre Marktpräsens in Ostösterreich.<br />
Wolfgang Hank wird die neue Geschäftsstelle in Stockerau<br />
leiten und als Prokurist auch Mitglied der Geschäftsleitung sein.<br />
Seine Grundsätze bringt er wie folgt auf den Punkt: „Ich will<br />
meine Kunden und Ansprechpartner mit einem erfolgreichen<br />
Team als verlässlicher Partner betreuen. Höchste Qualität und<br />
rasches Service sind unser gemeinsames Ziel! Nur so erreichen<br />
wir gemeinsam höchstmögliche Sicherheit“.<br />
In Folge dieser Geschäftserweiterung wird auch das Technikerteam<br />
der SiS weiter verstärkt. Auch hier wird ausschließlich auf<br />
erfahrene und bestens ausgebildete Fachleute zurückgegriffen.<br />
SiS ist ein VSÖ-zertifizierter Fachbetrieb<br />
für Sicherheitssysteme aller Klassen und ist<br />
nach ISO 9001 zertifiziert.<br />
Neben der Einbruchmeldeanlage ist die moderne digitale<br />
Videotechnik das wichtigste Element in einem Bankensicherheitskonzept.<br />
Neben höchstmöglicher Bildqualität und zuverlässiger<br />
Aufzeichnung ist dabei vor allem die Nutzung von<br />
bestehender IT-Infrastruktur bedeutend.<br />
DiVA wurde wegen der geschlossenen, manipulations- und<br />
virensicheren Web-Server-Architektur von allen relevanten<br />
Rechenzentren schon vor Jahren zum Betrieb am Bankennetz in<br />
Österreich zugelassen. Die Authentifizierung des gespeicherten<br />
Bildmaterials mittels eines digitalen Wasserzeichens ist ein<br />
weiteres, in Bankensystemen unverzichtbares Qualitätsmerkmal<br />
von DiVA.<br />
DiVA bietet aber noch viel mehr als nur die reine Bildaufzeichnung:<br />
Die Schnittstellen zu Geldausgabeautomaten sind<br />
ebenso Standard wie die Integration der Zutrittskontrolle. Und<br />
mit der Management-Software DiVA-Connect ist die Verwaltung<br />
von Filialstrukturen besonders<br />
einfach und übersichtlich.<br />
Die beiden SiS-Sicherheitsberater<br />
Wolfgang Hank<br />
(0676-4466300) und<br />
Bernd Göber (0676-4466360)<br />
informieren Sie gerne persönlich!<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
19
Kundenveranstaltung bei<br />
Bernd Mühlbacher, Business Manager Ascom Austria und Armin Assinger<br />
Am 11. September war es wieder so weit, Ascom Austria<br />
lud zur jährlichen Kundenveranstaltung ein. Bereits am<br />
Nachmittag startete die Veranstaltung mit einem<br />
Impuls-Workshop zum Thema „Hochsicherheitsschlösser“,<br />
am Abend gab es dann den mit Spannung erwarteten<br />
Gastvortrag von Armin Assinger zum Thema „Das Leben<br />
ist ein Abfahrtslauf“. Weiters wurde vor den zahlreich<br />
anwesenden Kunden die Zusammenarbeit für Österreich<br />
mit Novotech Bankensysteme GmbH, vertreten durch<br />
den GF Herrn Peter Drimmel, verkündet. „Ich freue mich<br />
unsere Produktpalette mit den hochwertigen SB-<br />
Münzzählern von Novotech erweitern zu können“, so<br />
Bernd Mühlbacher, Business Manager Ascom Austria.<br />
Die Möglichkeiten des Sperrens und Öffnens<br />
Viele Behältnisse in einer Bank – Panzertür, Kundensafe,<br />
Wertschutzschrank, Pulttresor, Einzahlungsautomat, AKT sowie<br />
Bankomat – und für jedes ein eigenes Schloss? Oder vielmehr<br />
ein Schloss für Sicherheit und durchgängige Technik im Haus?<br />
Mit dem Partnerunternehmen Safecor realisiert die Firma Ascom<br />
Austria letzteres. Die Impulsreferate von Olaf Kisser, Safecor<br />
Deutschland, Johannes Colleselli, Sicherheitsbeauftrageter der<br />
Hypo Tirol Bank, und DI (FH) Heinz Jatschka, Sicherheitsmanagement<br />
Filialnetz der Post.at, traten den Beweis an.<br />
Das elektronische Hochsicherheitsschloss Twinlock eCode<br />
ermöglicht – kostensparend – die entsprechende Nachrüstung<br />
der bereits vorhandenen Infrastruktur, womit – als erste, augenfälligste<br />
Erleichterung – die leidige und bei Verlust sehr kostenintensive<br />
Schlüsselverwaltung wegfällt. Dafür verfügt jeder<br />
Mitarbeiter über seinen eigenen Code, sodass auch im Falle von<br />
Urlaub oder Krankheit die Öffnung unter Vier-Augen-Prinzip<br />
erfolgen kann. In Zeiten sich teilweise verringernder Mitarbeiterzahl<br />
in den Filialen kann es trotz dieser Flexibilität zu<br />
einem „Vier-Augen-Engpass“ kommen. In diesem Fall erhält<br />
der mit seinem fixen Code ausgestattete Mitarbeiter auf Anruf<br />
per Telefon einen „Einmal-Code“, der ihn zum Öffnen berechtigt.<br />
Berechnet wird dieser Code, der ein bestimmtes Aussehen<br />
haben muss um auf einem bestimmten Gerät zu einer gewissen<br />
Zeit zu funktionieren, in der zentralen Datenbank mit einem<br />
Algorithmus. Eine Verbindung des Schlosses zu einem PC ist<br />
demnach nicht nötig. In dieser Datenbank sind sämtliche Beteiligten<br />
bzw. Beteiligungen gespeichert, womit dokumentiert ist,<br />
wann welches Behältnis von wem geöffnet wurde. Abgesehen<br />
davon, dass jede Öffnung mittels Fix-Code eines Filialmitarbeiters<br />
erfasst wird, ist auch die lückenlose Dokumentation bei Tourenfahrten<br />
möglich. Entweder sind die Codes, die zusammen mit<br />
dem persönlichen Pin zu einer festgesetzten Uhrzeit den Zugang<br />
zu den Automaten einer bestimmten Filiale ermöglichen,<br />
auf einer Karte gespeichert oder auf dem Tourenplan ausgedruckt<br />
und per Hand einzugeben. Muss unvorhergesehen ein<br />
weiteres Gerät begutachtet werden, wird per Telefon ein weiterer<br />
Code bekannt gegeben. Vom entsprechenden Automaten wird<br />
ein Antwortcode erhalten, der wiederum rückzumelden ist.<br />
In Deutschland aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften<br />
bereits etabliert in Österreich noch ein Diskussionspunkt ist die<br />
zeitverzögerte Öffnung der Tresore, die vor Überfällen schützen<br />
soll. Will man jedoch seine Mitarbeiter solch einer prekären<br />
Situation länger als unbedingt nötig aussetzen und sollen unbescholtene<br />
Kunden ungeduldig werden? Letzteres wäre durch<br />
gezielten Einsatz eines Überfallcodes zu umgehen, wie schnell<br />
und weit jedoch die Nachricht der Zeitverzögerung in den einschlägigen<br />
Kreisen die Runde macht, ist lediglich zu vermuten.<br />
In jedem Fall muss für die Auslösung des Alarms eine Verbindung<br />
zur Alarmanlage bestehen.<br />
Um als Berechtigter nicht selbst plötzlich vor verschlossenen<br />
Türen zu stehen, die nur mehr mit dem Brecheisen zu bezwingen<br />
sind, enthält das Schloss alle Bauteile in zweifacher<br />
Ausfertigung. Für die prompte Wiederherstellung der einen,<br />
möglicherweise ausgefallenen Baugruppe sorgt der Service.<br />
Sei es nun Cash in Transit, Cash Management, ATM<br />
Services oder Filialbetrieb – Ziel ist es, die Organisation in der<br />
Elektronik abzubilden und nicht, die Organisation der Elektronik<br />
anzupassen. So ist die Minimumlösung – beispielsweise des<br />
Problems „Schlüssel und Code“ sowie der Tresoröffnung in der<br />
Filiale – nach oben hin skalierbar.<br />
20<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Ascom Austria<br />
Die Praxis<br />
Aufgrund dieser Flexibilität<br />
kann das System Twinlock<br />
eCode den Prozessen beispielsweise<br />
der Hypo Tirol oder der<br />
Post gerecht werden. So werden<br />
in der Bank die Tresore täglich zu Dienstbeginn im Vier-<br />
Augen-Prinzip geöffnet und stehen während der Geschäftszeit<br />
offen. Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, müssen die<br />
Kombinationen aus Sicherheitsgründen vor Ort von Mitarbeitern<br />
des Facility Managements umgestellt werden. Dementsprechend<br />
ergaben sich Kosteneinsparung durch einen Wegfall<br />
von Reisekosten und Arbeitszeit, die Verbesserung der Sicherheit<br />
durch raschere Anpassung der Schlösser nach einem Mitarbeiterabgang<br />
und durch die Zwangsschließung während des<br />
Tages (weitere Öffnungen im Zwei-Augen-Prinzip), flexiblere<br />
Gestaltungsmöglichkeiten für Geschäftsstellen mit wenigen<br />
Mitarbeitern sowie sichere Geldentsorgung über das Werttransportunternehmen<br />
als Ziele der Nachrüstung. Als weitere<br />
Produktanforderungen wurden die Möglichkeit des Alternativbetriebs<br />
bei Stromausfall, die Beleuchtung des Displays, das<br />
Vorhandensein einer Sicherheitszertifizierung, die Möglichkeit<br />
vonVergabe bzw. Löschung von Berechtigungen mittels Einmalcode<br />
mit Zeitfenster sowie die Vergabe von Berechtigungen<br />
innerhalb von Zeitfenstern, die Aufschaltung auf eine Alarmanlage<br />
mit der Alternative des Überfallcodes, eine Eignung für<br />
Unterpulttresore sowie eine rechenzentrumunabhängige Software<br />
zur Einmalcodevergabe definiert.<br />
Die Realisierung in der Praxis ergab nun eine perfekte<br />
Zusammenarbeit mit der Firma Ascom und das Projekt erfreut<br />
sich einer breiten Akzeptanz bei Geschäftsstellenleitern und<br />
Mitarbeitern. Bezüglich Code kann bei Versetzung oder Abgang<br />
eines Mitarbeiters viel rascher reagiert werden, Urlaubsplanungen<br />
und Krankenstände sind wesentlich leichter zu managen, die<br />
Schlüsselverwaltung gehört der Vergangenheit an. Tagsüber sind<br />
die Wertbehältnisse nun geschlossen und ab einem gewissen<br />
Zeitpunkt mittels Zwangssperre unzugänglich, jede Öffnung<br />
wird personenbezogen kontrolliert. Und im Bedarfsfall erfolgt<br />
die Alarmauslösung über den Bedienteil des Schlosses.<br />
Nach einer Reihe von Überfällen auf Filialen fasste im Vorjahr<br />
die Post den Entschluss zu einer Pilotierung von Twinlock<br />
eCode. Die hervorstechendsten Merkmale waren auch hier die<br />
Möglichkeit der Adaptierung der Post-Organisation sowie der<br />
problemlose Betrieb. Darüber hinaus waren die zeitverzögerte<br />
Öffnung mit Anzeige am Display, der stille Alarm, der Wegfall<br />
von Schlüsselverwahrung und -übergabe, das Vorhandensein<br />
eines Pools an Mitarbeitern für die Handhabung, die kein<br />
Problem darstellt, sowie die positive Annahme durch die Mitarbeiter<br />
jene speziellen Bedürfnisse, die erfüllt wurden.<br />
Das Leben<br />
Hochsicherheitsschloss, Hypo Tirol Bank<br />
Auf ein Bedürfnis der ganz anderen Art ging Armin Assinger<br />
in seinem Gastvortrag „Das Leben ist ein Abfahrtslauf“ ein.<br />
Gekonnt zog er die Parallelen zwischen den Ängsten und<br />
(Selbst) Zweifeln, denen der Rennläufer auf der Strecke ausgeliefert<br />
ist, und jenen Unebenheiten und Hindernissen, mit<br />
welchen sich jeder Mensch in seinem Privat- und Berufsleben<br />
konfrontiert sieht. Als logische Konsequenz sind auch die<br />
Bewältigungsstrategien des Sportlers in jedermanns/jederfrau<br />
Alltag anwendbar. Die Hindernisse im Lauf unseres Lebens<br />
sind durch Entscheidungsfreude, Mut zum Ungewissen, Motivation,<br />
Erlernen der geeigneten Technik und Entspannung im<br />
richtigen Augenblick zu bewältigen. Zusammengenommen<br />
schafft dies auch Selbstvertrauen – ein effektives Gegenmittel<br />
gegen die Angst. Gelingt nun auch der Entschluss, diese überwinden<br />
zu wollen, sowie die Ausschaltung negativer Gedanken<br />
steht der Aktivierung aller Reserven im Zielschuss nichts mehr<br />
im Wege. Und dieses gute Gefühl, es geschafft zu haben, die<br />
Ausschüttung der Endorphine wird, einmal genossen, immer<br />
wieder erlebt werden wollen.<br />
❙<br />
Einer der letzten warmen Sommerabende lud zur Diskussion unter freiem Himmel ein.<br />
Fotos: Ascom<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
21
Kategorie Strategie: Raiffeisenbank Region Ried im Innkreis<br />
Kategorie Führung: Sparkasse Kremstal-Pyhrn<br />
victor <strong>2008</strong> im<br />
Rahmen der<br />
Kategorie Mitarbeiter: Sparkasse Reutte<br />
Gala verliehen<br />
Bereits zum fünften Mal lud der Consulter emotion banking alle Banken und Sparkassen des deutschsprachigen<br />
Raums zur victor Konferenz und Gala. Auf der victor Gala erlebten 500 Gäste unter dem Motto „orange passion“<br />
hautnah die spannende Kür der besten Banken. Die Bank des Jahres <strong>2008</strong>, die Volksbank Südburgenland, zeigte<br />
Leidenschaft für Teamwork: „Wer gemeinsam arbeitet, multipliziert. Wer einzeln arbeitet, addiert.“ Auch <strong>2008</strong> gab es<br />
wieder 5 Sieger in den Hauptkategorien Strategie, Führung, Mitarbeiter, Kunde und Unternehmenskultur.<br />
Die ausgezeichneten Banken<br />
Die Volksbank Mittweida erhielt den victor in der Sonderkategorie<br />
innovativste Bank. Die Jury fand: „Was uns fasziniert<br />
hat: Innovation wird in dieser Bank sehr stark gelebt. Ein<br />
Ergebnis dieses Geistes ist ein Kostenmanagement, das dazu<br />
führt, dass eine mittelständische Regionalbank eine CIR-Quote<br />
von 40 hat. Vst. Direktor Leonhard Zintl der Volksbank<br />
Mittweida auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept: „Es ist uns<br />
gelungen, Kostenmanagement als Grundkultur zu verankern.<br />
Das funktioniert nicht mit Vorschriften, sondern dadurch, dass<br />
jeder sich sein Tun bewusst macht, sich über Nutzen und<br />
Alternativen seines Tuns Gedanken macht.“<br />
Die Raiffeisenbank Region Ried im Innkreis konnte den<br />
Preis in der Kategorie Strategie für sich entscheiden. Was<br />
der Jury so gut gefiel: „Diese Bank hat fast 400 Punkte in der<br />
Säule Strategie erreicht. Denn sie hat eine sehr ehrgeizige, eine<br />
sehr klare Vision, die viel Mut benötigt. Was uns gut gefallen<br />
hat: Man hat 16-Bogen Plakate im ganzen Wirtschaftsbereich<br />
affichiert und sich damit in die Pflicht genommen, auch täglich<br />
an dieser Vision zu arbeiten.“ Direktor Hans Moser: „Unsere<br />
Mitarbeiter haben an der Strategie sehr maßgeblich mitgearbeitet.<br />
Es war unser gemeinsames Werk und damit war auch die<br />
100%ige Identifikation gegeben.“<br />
Der victor für die Kategorie Mitarbeiter ging an die<br />
Sparkasse Reutte vertreten durch Direktor Dr. Walter Hörtnagl<br />
und Direktor Franz Guem. Aus der Begründung der Jury: In<br />
der Siegerbank ist der so wichtige Flow-Zustand, in dem Mitarbeiter<br />
die besten Leistungen bringen, besonders stark vertreten<br />
und die richtige Mischung ist gefunden. Die Mitarbeiter bestätigen,<br />
dass sie ihre Fähigkeiten gut einsetzen können und dass<br />
sie mit Stolz und Freude bei ihrer Bank tätig sind. Vst. Direktor<br />
Dr. Walter Hörtnagl sieht den Erfolg als Langzeitwirkung:<br />
„Wahrscheinlich ist unser Erfolg eine nachhaltige Folgewirkung<br />
eines Motivationstages für Mitarbeiter.“<br />
Die Sparkasse Kremstal-Pyhrn mit Vst. Direktor Mmag.<br />
Rudolf Weiermayer siegten in der Kategorie Führung. Die<br />
Gründe für den Sieg waren für die Jury ganz klar: „In der Bank,<br />
die wir heute auszeichnen, strahlen die Führungskräfte Stärke<br />
und Vertrauen aus. Und sie sprechen mit Begeisterung über die<br />
Ziele – und diese Begeisterung ist ansteckend.“ Vst. Direktor<br />
Mmag. Rudolf Weiermayer ortet die Quelle des Erfolgs in<br />
der Einbindung seiner Mitarbeiter: „Es gelingt uns, die<br />
Mitarbeiter, die Führungskräfte, in alle Entscheidungen einzubinden.<br />
Sie entscheiden mit, sie tragen die Planung mit, sie<br />
tragen die Ziele mit.“<br />
Die Sparda-Bank Hessen vertreten durch Vorstandsdirektor<br />
Jürgen Weber freute sich über die victor Trophäe in der Kategorie<br />
Unternehmenskultur. Die Jury: „Diese Bank hat ein klares<br />
Profil, sie weist Ecken und Kanten auf. Und ihr Umgang mit<br />
Fehlern ist geprägt von sehr großer Offenheit. Das führt dazu,<br />
dass die Bank lernen kann. Und das tut sie auch gerne, weil sie<br />
extrem kundenorientiert ausgerichtet ist.“ Vorstandsvorsitzender<br />
22<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Fotos: emotion banking<br />
Kategorie Unternehmenskultur: Sparda-Bank Hessen<br />
Kategorie Kunde: Volksbank Tullnerfeld<br />
Jürgen Weber: „Ich freue mich besonders, dass wir in der<br />
Kategorie Kultur gewonnen haben, da wir aus einer Fusion entstanden<br />
sind. Wir haben sehr viel investiert, um unsere Werte,<br />
die wir verkörpern wollen, zu implementieren.“<br />
In der Kategorie Kunde gewann die Volksbank Tullnerfeld<br />
mit Direktor Mag. Herbert Blauensteiner und Direktor<br />
Christian Schilcher. Die Jury begeisterte sich am besonderen<br />
Engagement hinsichtlich Qualitätsorientierung: „Der Bank ist<br />
es extrem gut gelungen, ihren Kunden das Gefühl echter Beratungsgespräche<br />
zu vermitteln. Kunden werden Fragen gestellt,<br />
individuelle Produktlösungen angeboten und der Kunde versteht<br />
diese Lösungen auch. Die Bank hat eine Weiterempfehlungsquote,<br />
die sogar noch den hohen österreichischen Volksbankendurchschnitt<br />
toppt.“ Direktor Mag. Herbert Blauensteiner zu<br />
seiner Strategie: „Wir bauen unsere Mitarbeiter mit Schulungen<br />
auf und lassen ihnen großen Spielraum. Wenn ich den Kunden<br />
überrasche und er begeistert ist, dann pflanzt sich das fort.“<br />
Der Syndikus der WKO, Dr. Herbert Pichler, überreichte<br />
die goldene victor Trophäe für den Gesamtsieg und somit den<br />
Titel „Bank des Jahres“ <strong>2008</strong> an die Volksbank Südburgenland.<br />
Das begeisterte Team und eine stolze Geschäftsleitung, Direktor<br />
Gesamtsieg und somit den Titel „Bank des Jahres“ <strong>2008</strong>: Volksbank Südburgenland<br />
Mag. Harald Berger und Direktor Franz Knor, strahlten auf der<br />
Bühne. Die Jury zeichnete damit eine Bank aus, die in allen<br />
Bereichen überzeugte: „Die Bank des Jahres <strong>2008</strong> hat in Summe<br />
perfekt abgeschnitten und konnte die höchste Punkteanzahl von<br />
rund 1.900 erzielen – ein echter Allrounder.“ Direktor Mag.<br />
Harald Berger: „Es ist ein tolles Gefühl, hier stehen zu dürfen<br />
und als Bank des Jahres ausgezeichnet zu werden. Wir sind ein<br />
starkes Team und wissen: Wer gemeinsam arbeitet, multipliziert.<br />
Wer einzeln arbeitet, addiert.“<br />
❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
23
NOVOTECH gratuliert allen<br />
Gewinnern des <strong>2008</strong><br />
Auf der Businessgala zum VICTOR <strong>2008</strong> fanden sich Persönlichkeiten aus dem Banken- und Partnergeschäft der<br />
Branche in Baden ein. Auch dieses Jahr wurde ein Preis an einen aktuellen Novotech-Kunden verliehen: Herr Direktor<br />
Johann Moser von der Raiffeisenbank Ried (OÖ) durfte in der begehrten Kategorie „Führung“ die Victor-Statue in<br />
Empfang nehmen. Schon in den Vorjahren wurden Novotech-Kunden, wie zB. die Raiffeisenbank Pittental, mit einem<br />
Preis ausgezeichnet.<br />
Auch die stark aufstrebende VKB Bank gab sich ein Stelldichein beim victor:<br />
Marketingleiter Werner Wawra mit charmanter Begeitung<br />
Bildmitte: victor-Sieger und Novotech-Kunde Dir. Johann Moser (Raiffeisenbank<br />
Ried) mit Peter Drimmel und Christina Tambosi (Emotion Banking)<br />
Oberösterreicher umrahmen die Fachpresse: Gerhard Vorauer (RB Ried), Willi<br />
Danninger (RB Gramastetten), Kurt Quendler (bestbanking), Peter Drimmel,<br />
Franz Stockinger (RB Wels-Süd), Christian Köppl (RB Gramastetten)<br />
Keba & Novotech: Franz Berger (Keba), Peter Drimmel (Novotech),<br />
Helena Balaouras (Keba), Helmut Söllradl (Keba), Klaus Baumann (Keba)<br />
„Marktvermessung“ Cash Automation in Austria: Peter Drimmel (Novotech),<br />
Franz Berger (Keba), Bernd Mühlbacher (Ascom) und Andreas Artner<br />
(Monetech)<br />
<br />
Helmut Rötzer (Raiffeisen Informatik), Andreas Artner (Monetech), Peter<br />
Drimmel (Novotech) Thomas Schreiber (Raiffeisen Informatik)<br />
Fotos: Novotech<br />
<br />
<br />
24<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Franz Berger, MBA<br />
Geschäftsbereichsleiter, KEBA Bank- und<br />
Dienstleistungsautomation<br />
Schlanke<br />
Bankprozesse<br />
Standardtransaktionen am Schalter wie das Beheben von<br />
Bargeld oder die Durchführung einer Überweisung stellen<br />
95% aller Geschäftsfälle dar. Aufgrund des Einsatzes von Bankmitarbeitern<br />
und der Notwendigkeit der Nachbearbeitung verursachen<br />
diese aber enorme Kosten. Zur Reduktion bestehender<br />
Kosten können standardisierte Geschäftsfälle mit KEBA in die<br />
Selbstbedienungszone verlagert werden.<br />
Auf der einen Seite ist SB heute ein etablierter Vertriebsweg<br />
und aus dem Bankleben nicht mehr wegzudenken. Beinahe<br />
50% aller Bankkunden besuchen eine Filiale außerhalb der<br />
Öffnungszeiten.<br />
Auf der anderen Seite stehen 22% aller Bankkunden, die<br />
Geld am Schalter beheben, und 34%, die Überweisungen mit<br />
Hilfe eines Bankmitarbeiters tätigen. Dabei ginge die Möglichkeit<br />
der Automatisierung, die bei 95% aller Schaltertransaktionen<br />
besteht, mit einer Kostenersparnis von 80% einher. Demzufolge<br />
ist Selbstbedienung der kostengünstigste Weg für Banktransaktionen<br />
und ermöglicht zudem einen effizienteren Einsatz<br />
personeller Ressourcen. Was für viele Kunden heute selbstverständlich<br />
ist und hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und<br />
unbegrenzten Zugang erfordert, unterstützt auch die Bankmitarbeiter.<br />
Durch das Handling von Noten und Münzen, aber<br />
auch durch Non-Cash-Transaktionen in der SB-Zone werden<br />
Bankmitarbeiter freigespielt.<br />
Die Vorteile von Cash-Recycling liegen klar auf der Hand:<br />
Die Technologie ermöglicht nicht nur eine enorme Kostenreduktion<br />
und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Sie garantiert<br />
auch 100%ige Sicherheit, denn die Banknoten werden bei<br />
KEBA Cash-Recyclern doppelt geprüft (bei der Ein- und<br />
Auszahlung). Dadurch werden unwissend eingelegte Falschgeldnoten<br />
sowie falsch eingelegte Denominationen bei der<br />
Kassettenbestückung erst gar nicht ausbezahlt. Der Benutzer<br />
erhält mit Sicherheit echte und fitte, das heißt für den Umlauf<br />
für gut empfundene Banknoten. Die Bank wiederum befindet<br />
sich damit auf der sicheren Seite und genießt bei Kunden hohes<br />
Ansehen: durch erhöhte Sicherheit und Flexibilität für die<br />
Benutzer und das einzigartige, benutzerfreundliche Design der<br />
KEBA Geldautomaten mit Cash-Cycle-Technologie. ❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
25
Foto: Novotech<br />
„Green Coin Logistics“<br />
– auch Banken werden als Produktionsunternehmen<br />
künftig CO2-Zertifikate an der EEX ankaufen müssen<br />
Energiesparen ist in aller Munde. In der Informations- und<br />
Kommunikationstechnologie-Branche stellt Green-IT einen<br />
nicht mehr wegzudenkenden Zukunftstrend dar. Jetzt stellt sich<br />
die Frage: Sind wir bereits auf dem Weg zur ersten „Green-<br />
Bank“? Denn über kurz oder lang werden sich auch Dienstleistungsunternehmen<br />
mit dem Thema CO2-Ausstoß auseinandersetzen<br />
müssen. Dazu Peter Drimmel, Geschäftsführer von<br />
Novotech Banksysteme GmbH:<br />
„Die Industrie und Energiewirtschaft sind von der<br />
Erreichung der Kyoto-Klimaziele bereits betroffen.<br />
Schließlich muss Österreich die Treibhausgas-<br />
Emissionen bis 2012 um 13% reduzieren. Ich sehe<br />
die Entwicklung aber dahingehend, dass in Zukunft<br />
alle Unternehmen – auch die Dienstleistungsbetriebe<br />
– einen Beitrag leisten müssen und<br />
am CO2-Ausstoß gemessen werden.“<br />
Münztransport verursacht Kosten und CO2<br />
Alleine der Münztransport der Banken produziert einen<br />
enormen jährlichen CO2-Ausstoß und trägt so beachtlich zum<br />
negativen Klimawandel bei. „Green Coin Logistics ist daher gefragt“,<br />
ist Drimmel überzeugt und erklärt: „Die einbezahlten<br />
Münzen werden von Geldtransportern bei den Banken abgeholt,<br />
in ein Cash-Center zum Zählen und Rollieren gebracht<br />
und dann von dort wieder an die Bankfilialen verteilt. Auf die<br />
rund 5.500 Bankfilialen in Österreich aufgerechnet bedeutet<br />
dies einen jährlichen CO2-Ausstoß von 2.144,5 Tonnen – wie<br />
unser Rechenbeispiel alleine für den Münztransport zeigt. Aus<br />
technischer Sicht ist diese Emission absolut nicht erforderlich.<br />
Eine Lösung kann Coin Recycling am Bank-POS heißen.<br />
Die Münzen sollten daher im kombinierten Münzein- und<br />
-auszahlungsgerät gezählt, vereinzelt verpackt und wieder ausgegeben<br />
werden.“<br />
Bei Banknoten ist die hohe Kapitalbindung das Hauptargument,<br />
das für Cash-Recycling spricht. Bei Münzen sind<br />
bislang die Kosten – immerhin zwischen 10 und 35 Cent für<br />
26<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
eine gezählte Rolle Münzen – der ausschlaggebende Grund.<br />
Unternehmen werden aber auch zunehmend an der Verantwortung<br />
der Umwelt gegenüber gemessen. Der Klimaschutzgedanke,<br />
der vor allem durch die Bemühungen, den CO2-Ausstoß<br />
zu reduzieren, gemessen wird, wird immer wichtiger.<br />
„Künftig werden auch Banken – wie andere<br />
Produktionsunternehmen schon jetzt –<br />
verpflichtet, CO2-Zertifikate an der Leipziger<br />
CO2-Börse EEX zuzukaufen“,<br />
so die Erwartung von Drimmel.<br />
Rechenbeispiel: 2.144,5 Tonnen CO2 pro Jahr<br />
Einer der Hauptverursacher von CO2 ist der Transport. Ein<br />
einfaches Rechenbeispiel zeigt, welchen Beitrag die Banken<br />
alleine durch den Münztransport zu den Treibhausgas-<br />
Emissionen leisten. Schließlich werden die Münzen von einem<br />
gepanzerten Geldtransporter von den Banken in die Cash<br />
Center transportiert und die Münzrollen vom Cash Center<br />
wieder an die Banken verteilt. Pro Filiale fallen in der Woche<br />
durchschnittlich 80 Kilogramm Münzen an. Das bedeutet eine<br />
Jahresmenge von 4.160 Kilogramm. Bei 5.500 Filialen in ganz<br />
Österreich ergibt sich so ein gesamtes Transportaufkommen von<br />
22.880 Tonnen pro Jahr.<br />
Da ein Geldtransporter bis zu 800 Kilogramm transportiert,<br />
werden jeweils 10 Filialen zu einer Tagestour zusammengefasst,<br />
um das wöchentliche Münzaufkommen einzusammeln. Gleichzeitig<br />
werden dabei auf diesen Touren die Münzrollen verteilt<br />
und die Säcke mit den losen Münzen entgegengenommen. Daher<br />
ist der Geldtransporter auch ständig voll beladen. Bei seiner<br />
Tour von und zu einem der sieben österreichischen Cash Center<br />
legt ein Geldtransporter am Tag zirka eine Strecke von 200<br />
Kilometern zurück. Im Jahr ergibt sich so eine Gesamtstrecke<br />
von 5.720.000 Kilometern.<br />
Transportaufkommen in Tonnen und Kilometer in Österreich<br />
Anzahl der Bankfilialen 5.500 Stück<br />
Münzaufkommen pro Bankfiliale im Jahr 4.160 kg<br />
Gesamtes Münzaufkommen im Jahr 22.880 Tonnen<br />
Transportkapazität pro Fahrzeug 800 kg<br />
Anzahl der notwendigen Touren 28.600 Stück<br />
Durchschnittliche Strecke pro Tour 200 km<br />
Gesamte Transportstrecke im Jahr 5.720.000 km<br />
von Treibstoff beläuft sich daher auf 2.002 Tonnen im Jahr.<br />
Zweitens werden durch den Transport die Fahrzeuge „verbraucht“.<br />
Die (Wieder)Herstellung dieser Fahrzeuge ist mit<br />
erheblichem Energieaufwand und damit CO2-Ausstoß verbunden.<br />
Rechnet man mit einem Eigengewicht des gepanzerten<br />
Fahrzeugs von 2.500 Kilogramm und mindestens 3 kg CO2 pro<br />
Kilogramm Eigengewicht für die Erzeugung und Verarbeitung<br />
des Fahrzeugs (typischerweise Stahlerzeugung und -bearbeitung),<br />
dann ergeben sich 7.500 Kilogramm CO2 für die Herstellung<br />
eines Fahrzeugs. Wenn ein Fahrzeug in etwa 300.000 Kilometer<br />
im Einsatz ist, dann werden für den Münztransport im Jahr<br />
19 Fahrzeuge „verbraucht“. Für die Wiederherstellung ergibt<br />
sich somit eine negative CO2-Bilanz von 142,5 Tonnen im Jahr.<br />
Beide Komponenten zusammen resultieren in einem CO2-Ausstoß<br />
von jährlich 2.144,5 Tonnen in Österreich allein. Diese<br />
Emissionen entsprechen der CO2-Produktion von mehr als 160<br />
Haushalten, die durch konsequentes Coin-Recyling eingespart<br />
werden können.<br />
Jährlicher CO2-Ausstoß in Österreich durch Münztransport<br />
Gesamte Transportstrecke 5.720.000 km<br />
CO2-Ausstoß pro Kilometer<br />
350 g/km<br />
CO2-Ausstoß Treibstoff-Verbrennung 2002 to<br />
CO2-Ausstoß Herstellung pro Fahrzeug 7.500 kg<br />
Anzahl der „verbrauchten“ Fahrzeuge 19 Stück<br />
CO2-Ausstoß Fahrzeug-Herstellung 142,5 to<br />
Gesamter CO2-Ausstoß Münztransport 2.144,5 to<br />
Cash- und Coin Recyling als Beitrag<br />
zum Klimaschutz<br />
Der geschlossene Münzkreislauf ist somit nicht nur aus<br />
ökonomischen Gründen sinnvoll, sondern Banken können<br />
dadurch aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Von<br />
technischer Seite gibt es mit den kombinierten Münzein- und<br />
-auszahlungsgeräten seit kurzem die optimalen technischen<br />
Voraussetzungen.<br />
„Die Klimaschutzdiskussion und ein<br />
zugehöriger rechtlicher Rahmen werden auch<br />
vor Banken nicht halt machen. Green Coin<br />
Logistics ist daher die logische Konsequenz für<br />
einen nachhaltig agierenden Banksektor“,<br />
zeigt sich Drimmel überzeugt.<br />
❙<br />
Der CO2-Ausstoß durch den Transport setzt sich aus zwei<br />
Komponenten zusammen. Erstens wird durch die Verbrennung<br />
von Treibstoff während der Fahrt CO2 erzeugt. Dazu gibt es<br />
vom Verband der Automobilindustrie (Deutschland) eine halbjährlich<br />
aktualisierte Liste des CO2-Ausstoßes pro gefahrenen<br />
Kilometer. Unbeladene Transporter (z.B. VW T5 Diesel mit 96<br />
Kilowatt) erzeugen in etwa 250 Gramm CO2 pro gefahrenen<br />
Kilometer, bei beladenen wird mit 350 Gramm CO2 pro Kilometer<br />
gerechnet. Der Gesamtausstoß durch die Verbrennung<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
27
Fotos: Wincor Nixdorf<br />
Mit Innovationen das<br />
Geschäft vorantreiben<br />
Zur Wincor World 2009 werden neue IT-Lösungen vorgestellt, mit denen<br />
Retailbanken und Handelsunternehmen Prozessverbesserungen erreichen.<br />
Wincor Nixdorf und 40 weitere Aussteller zeigen, wie neue Angebote vom Consulting<br />
bis zum Betrieb die wertschöpfungsorientierte Neuausrichtung aller Abläufe rund um das<br />
Filialgeschäft unterstützen. Dabei sind Plattformsoftware zur einheitlichen Steuerung<br />
aller Prozesse und dazugehörige Professional Services von zentraler Bedeutung.<br />
✔ Cashmanagement:<br />
Lösungen, die Kosten und Risiken beim Bargeldhandling reduzieren und die Geldkreisläufe<br />
optimieren.<br />
✔ Automatisierte Sales- und Marketing-Prozesse:<br />
Zur Steigerung der Vertriebseffizienz durch individuelle Consulting-Leistungen<br />
und den Einsatz intelligenter Lösungen<br />
✔ Automatisierung von Checkout-Prozessen:<br />
Für die Verbesserung von Kundenzufriedenheit und Kostenstrukturen durch eine<br />
Reorganisation des Checkouts.<br />
✔ Managed Services und Outsourcing:<br />
Damit unsere Kunden sich voll auf ihr Geschäft konzentrieren können, stellt WN<br />
ein Angebot von standardisierten Leistungen bis zu individuellen Konzepten zur<br />
effizienten Gestaltung der IT-Infrastruktur vor.<br />
Sicherheitsthemen im Bereich der<br />
Geldautomaten sowohl Hardware als<br />
auch Software wird auch ein<br />
bestimmendes Thema auf der Wincor<br />
World 2009 sein. Weiters werden<br />
Prozesse von Banken und Handel<br />
analysiert und für unsere Kunden<br />
transparent und sichtbar gemacht unter<br />
dem Motto „was kann der Handel von<br />
den Banken lernen und was können<br />
die Banken vom Handel lernen“.<br />
Christian Weißer, Chef von Wincor Nixdorf Österreich<br />
28<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
DIE NEUEN<br />
SICHERHEITSTECHNOLOGIEN<br />
IM BANKWESEN FÜHREN ZU<br />
ERHEBLICHEN LOGISTIKPROBLEMEN<br />
IM GEWERBE DER BANKRÄUBER<br />
UND BETRÜGER.<br />
29
Danielle Bonardelle - Fotolia.com<br />
Semantische Technologien:<br />
Nutzen & Chancen für den Finanzsektor<br />
Forscher basteln weltweit an einem besseren Internet. Das sogenannte semantische Web soll es leichter machen,<br />
Inhalte zu finden. Die Idee an sich ist so alt wie das World Wide Web selbst. An der Umsetzung in Wirtschaft, Industrie<br />
und Medien arbeitet die kleine, aber wachsende Semantic Web Company in Wien maßgeblich mit. Wie Banken von<br />
dieser Entwicklung profitieren können, fragte Marion Fugléwicz-Bren*) den Geschäftsführer Mag. Andreas Blumauer.<br />
Das meiste Wissen innerhalb von Unternehmen ist im einen<br />
oder anderen Textformat gespeichert – als E-Mail, Bericht,<br />
Studie oder Präsentation. Die Marktforscher von IDC schätzen<br />
das weltweite Datenvolumen im Jahr 2011 auf 1,8 Billionen<br />
Gigabyte und damit auf das zehnfache im Vergleich zu 2006.<br />
Könnte man auf einem einfachen Weg aus diesen unstrukturierten<br />
Daten strukturierte Informationen gewinnen, würden diese<br />
einer viel größeren Zahl von Mitarbeitern zur Verfügung gestellt<br />
werden können und Firmen wären auf einen Schlag wesentlich<br />
„klüger“, so die deutsche Computerwoche.<br />
Doch wie lassen sich diese ständig wachsenden Datenberge<br />
durchforsten und relevante Informationen daraus extrahieren?<br />
Die Antwort liefern Methoden wie Data Mining oder Text<br />
Mining. Data Mining untersucht strukturierte Daten, wie sie<br />
in Datenbanken vorhanden sind. Die schwierigere Aufgabe,<br />
nämlich aus unstrukturierten Texten unter Verwendung von<br />
Sprachanalyse Informationen zu extrahieren, hat Text Mining<br />
(auch Text Analytics genannt).<br />
Naturgemäß können überall dort, wo komplexe Entscheidungsprozesse<br />
unterstützt werden und dabei große Informationsmengen<br />
verarbeitet werden müssen, semantische Technologien<br />
zum Tragen kommen. Welche Rolle spielen semantische Technologien<br />
im Bankwesen bzw. im Finanzsektor schon heute und<br />
worin liegt dabei der Nutzen? Andreas Blumauer: „Mit Hilfe<br />
semantischer Technologien wie Text-Mining, Thesauri (ein<br />
Thesaurus oder Wortnetz ist in der Dokumentationswissenschaft<br />
ein kontrolliertes Vokabular, dessen Begriffe durch Relationen<br />
miteinander verbunden sind, Anm. d. Red.) oder semantischen<br />
Netzen werden vor allem unstrukturierte Informationen wie zum<br />
Beispiel Nachrichtentexte, Marktstudien oder Trendanalysen<br />
besser durchsuchbar gemacht. Durch halbautomatische Vernetzung<br />
von Informationsbeständen beziehungsweise mittels<br />
Ähnlichkeitssuche können oft Querverbindungen entdeckt<br />
werden, die dann etwa einem Analysten interessante, neue<br />
Einblicke geben können. Besonderes Potential dafür ist vor allem<br />
für wissensintensive Bereiche wie Asset Management oder Investment<br />
Banking auszumachen. Nach außen hin zum Kunden<br />
können semantisch gestützte Web-Oberflächen zum Beispiel beratungsintensive<br />
Produkte differenzierter darstellen, das Cross-<br />
Selling unterstützen oder im Call Center zum Einsatz kommen“.<br />
Ein Beispiel: Mit OpenCalais (http://www.opencalais.com)<br />
hat Thomson Reuters ein Service entwickelt, das aus beliebigen<br />
Texten oder Dokumenten die wichtigsten Fragmente und Aussagen<br />
vollautomatisch extrahiert: Dazu zählen Personennamen,<br />
Organisationen, Ortsangaben oder Finanzprodukte. Mit diesem<br />
„semantifizierten“ Informationsbestand können in weiterer<br />
Folge beispielsweise intelligentere Suchmaschinen entwickelt<br />
werden. Eine konkrete Anwendung auf Basis von OpenCalais,<br />
die die Entscheidungsfindung bei Termingeschäften unterstützt,<br />
ist PitGuru.com.<br />
30<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
„Nach außen hin zum Kunden können<br />
semantisch gestützte Web-Oberflächen<br />
zum Beispiel beratungsintensive<br />
Produkte differenzierter darstellen, das<br />
Cross-Selling unterstützen oder im Call<br />
Center zum Einsatz kommen“,<br />
Andreas Blumauer<br />
Durch den Einsatz von Services wie OpenCalais in Kombination<br />
mit individuellen Fach-Thesauri können Banken hausintern<br />
zahlreiche wissensintensive Abläufe punktgenau mit<br />
relevanter, kontextbezogener Information versorgen, Mitarbeiter<br />
entlasten und schließlich die Qualität von Entscheidungen verbessern<br />
und transparenter machen, so Blumauer. Aber „...erst<br />
langsam beginnt sich eine neue Sichtweise heraus zu kristallisieren:<br />
Im Mittelpunkt des Systems steht dann endlich der<br />
Mitarbeiter selbst, seine sozialen Netze im Unternehmen, seine<br />
Expertise und die Pfade der Wissensgenerierung, -erhaltung<br />
und -weitergabe, an denen er beteiligt ist“. Lösungsansätze dazu<br />
biete das Social Semantic Web. Denn: „Wissensmanagement<br />
kann nicht von oben herab einfach verordnet oder durch den<br />
Erwerb von Softwarepaketen einfach installiert werden – das ist<br />
spätestens seit den Bauchlandungen, die Wissensmanagement-<br />
Projekte vielfach Anfang des neuen Jahrtausends gemacht<br />
haben, klar geworden“. Eines ist für Blumauer und seine Mitarbeiter<br />
schon lange klar: Wissen ist ein Gut, das geteilt werden<br />
sollte. Dazu müssen einige Parameter beachtet werden. Aber<br />
wenn Unternehmen nicht heute beginnen, Strategien für den<br />
effizienten Umgang mit der Ressource Wissen zu entwickeln,<br />
können sie morgen nicht wettbewerbsfähig bleiben.<br />
Was ist das Semantic Web?<br />
Die Idee des „semantischen Web“ geht zurück auf Tim Berners-<br />
Lee, den Erfinder des World Wide Web. Im Zentrum steht die<br />
Entwicklung von semantischen Technologien, mit deren Hilfe<br />
Computer die Inhalte von Musik, Bildern und Videos besser verarbeiten<br />
können sollen. Semantisch bedeutet, dass Inhalte<br />
nicht bloß eine Bedeutung haben, sondern auch in Beziehung<br />
zu anderen Bedeutungen stehen, somit hierarchische Klassen<br />
bilden oder sich gegenseitig ausschließen. Beispiel: Ein LKW ist<br />
ein Auto, aber weder PKW noch Geländewagen. Solche semantischen<br />
Klassifizierungen werden als Metadaten den Inhalten<br />
beigefügt. Dafür sind die Web Ontology Language (OWL) sowie<br />
das Resource Description Framework (RDF) entwickelt worden,<br />
zwei maschinenlesbare Sprachen zur formalen Beschreibung<br />
von Multimedia-Inhalten.<br />
Andreas Blumauer und die Semantic Web Company begleiten Unternehmen seit<br />
2004 beim Aufbau semantisch gestützter Informationssysteme. Zu den Kunden zählen<br />
internationale Konzerne aus dem Versicherungswesen, Industrieanlagenbau, der<br />
Medien- & Content- und der IT-Branche.<br />
„Mittels Ähnlichkeitssuche können oft<br />
Querverbindungen entdeckt werden, die<br />
dann etwa einem Analysten interessante,<br />
neue Einblicke geben können“,<br />
Andreas Blumauer<br />
Neue Seminare bei der Semantic Web Company<br />
Die Semantic Web Company (SWC) bietet Mitte Oktober<br />
geballte Kompetenz in drei Seminartagen: Die offenen und<br />
einzeln buchbaren Seminare vermitteln Grundlagen und<br />
Praxiswissen über Methoden, Technologien und Standards der<br />
nächsten Web-Generation. Unternehmen und öffentliche Organisationen<br />
profitieren von professionellen Dienstleistungen für<br />
die Themenfelder Semantic Web, semantische Technologien<br />
und Social Software. Die angebotenen Dienstleistungen<br />
gliedern sich in die Geschäftsfelder: Seminare & Inhouse<br />
Schulungen, Consulting, Transfer Projekte sowie Publikationen,<br />
Media & Events. Unternehmensrelevante Trends werden marktgerecht<br />
und anwendungsorientiert aufbereitet. Die SWC beschäftigt<br />
sich gemeinsam mit einem länderübergreifenden<br />
Partnernetzwerk aus technischer und organisationaler Perspektive<br />
mit dem „Internet der nächsten Generation“. So können<br />
etwa Unternehmer und/oder Seminar-Teilnehmer schnell erkennen,<br />
ohne dabei auf kritische Faktoren zu vergessen, wo<br />
mögliche Anwendungsszenarien des „Semantic Web“ in ihrer<br />
Organisation verborgen sind und vor allem, wie man daraus<br />
effiziente Arbeitsschritte generiert.<br />
www.semantic-web.at<br />
❙<br />
*) Marion Fugléwicz-Bren ist Journalistin und PR-Consultant in Wien. www.marions.at<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
31
Islamic Banking und<br />
Zwei Chancen für künftiges Wachstum<br />
von Dr. Christian Rauscher, GF emotion banking<br />
Der demographische Wandel und die globale Dynamik<br />
fordern die bestehenden Geschäftsmodelle der heimischen<br />
Banken. Immer öfter stößt das Massenmarketing – der „one size<br />
fits all“ Ansatz – der österreichischen Banken an seine Grenzen.<br />
Neue, interessante Zielgruppen formen sich und fordern individuelle<br />
Konzepte. Während die Zielgruppe der Senioren und<br />
jene der gehobenen Affluents langsam auch von den Banken als<br />
Marktchance erkannt werden, ist eine weitere Zielgruppe noch<br />
nicht am Radarschirm der heimischen Spar- und Kreditunternehmen<br />
aufgetaucht; die Gruppe der ethnischen Minoritäten.<br />
Der Consulter emotion banking hat sich bereits in den letzten<br />
Jahren auf diese Zielgruppe spezialisiert und in seiner aktuellen<br />
Studie die Chancen und Risiken von ethnischem Marketing und<br />
Islamic Banking in Österreich analysiert.<br />
Der gegenwärtige Preiswettbewerb in<br />
Deutschland fordert zum Denken auf<br />
In Deutschland fischen Banken derzeit mit 0,– € Angeboten<br />
nach neuen Kunden. Der Preiswettbewerb geht so weit, dass<br />
Kunden jeden Monat, in dem ein Mindestsaldo nicht unterschritten<br />
wird, Gutschriften erhalten. Auf Dauer ist das jedoch<br />
weder eine kreative, noch ökonomisch sinnvolle Methode der<br />
Kundengewinnung. Und wenn der zweimalige victor Sieger,<br />
VstDir. Troppman von der Deutschen Kredit Bank, darauf verweist,<br />
dass seine Bank eine CIR von 27 aufweist, dann ist rasch<br />
klar, wer wohl den längeren Atem in Sachen „Diskont“ hat. Die<br />
Preisstrategie kann also nicht das Aktionsfeld der Mittelstandsbanken<br />
sein. All zu oft werden Preiszuckerl nicht als Teil einer<br />
Strategie gewährt, sondern aus Druck und Zwang des Marktes.<br />
Doch was können Banken tun? Neue, nachhaltige Strategien<br />
finden um dem Preisdruck zu entkommen. Besser, nicht Billiger.<br />
Das ist jedoch keine Frage des Produktes mehr. Heute bedeutet<br />
„besser sein“ die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle<br />
der heimischen Banken entlang der zentralen Nutzenlinien<br />
„Zeit und Convenience“, „Luxus und soziale Netzwerke“ sowie<br />
„Erlebnis und Entertainment“ gepaart mit Individualität und<br />
überzeugendem Design. Die Devise lautet ganz klar: Differenzieren.<br />
Anders sein. Profil zeigen! Was international bereits an<br />
zig Beispielen vorgelebt wird, Stichwort Umpqua Bank oder<br />
Q110, das erfordert gerade von Universalbanken viel Mut. Mut<br />
ist der Weg aus dem Mittelmaß. Das liebliche Verhalten des „wir<br />
machen es allen recht“ funktioniert nur noch bedingt. Im Kern<br />
bedeutet dies einen Schwenk vom standardisierten Massenmarketing<br />
hin zu differenziertem Zielgruppenmarketing.<br />
Die Notwendigkeit für Zielgruppenmarketing haben Banken<br />
bereits erkannt. 70% der im Rahmen des Bankbarometer 07 befragten<br />
Führungskräfte sind davon überzeugt, dass der Aufbau<br />
von spezialisierten Zielgruppen- oder Kompetenzcentern sehr<br />
erfolgreich wäre. Jedoch denkt Österreich dabei immer noch an<br />
die viel diskutierte und wenig umsorgte Zielgruppe der<br />
50+/60+/SilverAger und an die etwas besser bearbeitete Zielgruppe<br />
der gehobenen Privatkunden. Doch damit erkennen die<br />
Banken nur einen Ausschnitt der demografischen Verschiebung,<br />
die auf uns zukommt!<br />
Die österreichische Gesellschaftsstruktur<br />
wandelt sich – Ethnien als neue Zielgruppe<br />
Österreich ist Teil einer globalen Welt. Globalisierung beschreibt,<br />
grob gesprochen, einen Prozess der Entnationalisierung<br />
und somit ein Zusammenrücken. Grenzen verschwinden, Volkswirtschaften<br />
und Kulturen vernetzen sich. Dieses Zusammengehen<br />
fordert und fördert Mobilität der Menschen und führt ganz<br />
automatisch zu Austausch von Ideen, kulturellen Konzepten<br />
und Werten über nationale Grenzen hinweg. Das bedeutet, dass<br />
eine Vorbereitung auf demographischen Wandel notwendig ist,<br />
der abseits der Alterungsdiskussion oder der „female power“<br />
stattfindet. In einer globalen Welt verliert der Nationalstaat<br />
Österreich stückweise an Bedeutung und die Gesellschaft wird<br />
sich aus zahlreichen Ethnien formen. Bereits jetzt zeigt sich ein<br />
deutlicher Wandel in der österreichischen Gesellschaftsstruktur.<br />
Ethnische Österreicher leben in der ganzen Welt verstreut und<br />
ethnische Nicht-Österreicher leben in Österreich. Interessant ist<br />
somit die Frage: Haben die ethnischen Nicht-Österreicher<br />
andere Bedürfnisse und Ansprüche an Banken? Gibt es hier<br />
Potenzial bzw. andere, bisher nicht optimal befriedigte Bedürfnisse?<br />
In Amerika zum Beispiel ist ethnisches Marketing<br />
ein wichtiger Trend. Natürlich einer mit einer ganz anderen<br />
ökonomischen Bedeutung. Wenn man die Kaufkraft der Minderheitsethnien<br />
in den USA – die Hispanics, Afro Americans,<br />
Asiens etc. – aufsummiert und gesondert ausweisen würde, dann<br />
wäre diese Gruppe die sechst kaufkräftigste Nation der Welt! In<br />
Österreich ist ethnisches Marketing noch eine Aufgabe mit viel<br />
Potenzial. Doch bedenken Sie: Wo sonst gibt es in einem gesättigten<br />
Markt zweistellige Wachstumsraten?<br />
Banken bieten sich gleich zwei Möglichkeiten<br />
der Spezialisierung<br />
Für die Finanzbranche bieten sich gleich zwei Möglichkeiten<br />
differenziertes Marketing zu betreiben: ethnisches Banking und<br />
Islamic Banking. Während sich Ethnisches Banking auf kulturell<br />
bedingte Unterschiede im Kaufverhalten spezialisiert (insbesondere<br />
Sprache und Distributionskanal), geht Islamic Banking<br />
noch einen Schritt weiter. Der Islam prägt durch seine Vor-<br />
32<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
ethnisches Marketing<br />
der Österreichischen Banken<br />
Grafik: © emotion banking<br />
schriften das tägliche Leben der Muslime und verbindet zahlreiche<br />
Ethnien unter dem gemeinsamen Dach der Religion.<br />
Dementsprechend vergrößert sich die Zielgruppe, denn der<br />
Islam bildet ein Dach für die Mehrzahl der Türken, Bosnier,<br />
Mazedonier, Iraner und weiterer ethnischer Minderheiten in<br />
Österreich. Dadurch werden Muslime zu einer neuen und<br />
interessanten Zielgruppe für Banken. Es gilt jedoch zu bedenken,<br />
dass Islamic Banking weit komplexer als Ethnisches<br />
Banking ist, denn es verlangt eine konsequente Umsetzung, die<br />
religiös fundiert ist. Eine reine Marketingverpackung bringt hier<br />
keinen Erfolg. Zudem braucht es speziell geschulte Mitarbeiter,<br />
die sich mit den religiösen Vorschriften und den Produkten<br />
nicht nur auskennen, sondern sich voll inhaltlich identifizieren<br />
und danach leben. Diese Herausforderung stellt international<br />
betrachtet gegenwärtig die größte Hürde für das Wachstum dar.<br />
In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der islamischen<br />
Banken weltweit von 300 auf 470 gestiegen. Heute sind rund<br />
300.000 Mitarbeiter in islamischen Banken engagiert. Doch die<br />
Ausbildung kommt mit dem Bedarf nicht nach. Lediglich 20%<br />
der Mitarbeiter dürften global betrachtet eine profunde Ausbildung<br />
hinsichtlich der Sharia und dem Bankwesen aufweisen.<br />
Dementsprechend mehren sich auch schon die kritischen<br />
Stimmen hinsichtlich der Qualität der entwickelten Produkte<br />
und Lösungen. Letztlich sind diese Probleme jedoch typisch für<br />
eine boomende Wirtschaft…<br />
▲<br />
Grafik: © emotion banking<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
33
Grafik: © emotion banking<br />
Das Wort Mohammeds als Grundlage<br />
für Bankgeschäft ohne Zinsen<br />
Weltweit ist der Islam die zweitgrößte Religion. Er basiert<br />
auf dem Koran, der als das unverfälschte Wort Gottes gilt und<br />
von Mohammed selbst niedergeschrieben wurde. Im Islam gibt<br />
es keine Trennung zwischen Religion und Staat bzw. Privatleben.<br />
Die Sharia regelt die Umsetzung des Islam im täglichen<br />
leben. Laut Koran ist es verboten für den Besitz von Geld<br />
Zinsen zu erhalten, also einen vorab festgelegten Gewinn zu<br />
nehmen. Dies beruht auf dem Prinzip sich nicht an Armen zu<br />
bereichern. Ebenso untersagt ist es, sich an Spekulationen<br />
im Rahmen des Glücksspiels zu beteiligen. Hingegen werden<br />
Profite aus Investitionen, mit der Ausnahme von unreinen<br />
Waren wie Schweinefleisch, Alkohol, Waffen, Glücksspiel,<br />
illegale Drogen oder Pornographie, ausdrücklich gefördert, da es<br />
sich um risikobehaftete Geschäfte handelt. Für die Produktentwicklung<br />
heißt das, dass Spielarten des Profit and Loss Sharing<br />
oder der Mark Up Finanzierung möglich sind.<br />
Zahlreiche Fakten zeigen künftiges<br />
Potenzial für Islamic Banking<br />
Die aktuelle Studie von emotion banking zeigt das Potenzial<br />
von Islamic Banking erstmals in Österreich auf. In einer<br />
postalischen und – ergänzend durchgeführten – persönlichen<br />
Befragung wurden österreichweit 121 vollwertige Fragebögen<br />
generiert. Die Befragung fand auf deutsch, türkisch und arabisch<br />
zu Themen wie Finanzprodukte, Finanzkompetenz und Beratungsbedarf,<br />
Sparen, Finanzierungen, die Bedeutung des Islam<br />
im täglichen Leben sowie Bedarf und Nutzung von shariakonformen<br />
Produkten statt. Die Studie liefert neben empirischen<br />
Erhebungen und Auswertungen in den beschriebenen Themenfeldern<br />
wertvolle theoretische Grundlagen und informatives<br />
Hintergrundwissen sowie eine Typologie der islamischen Bevölkerung<br />
Österreichs in 5 Clustern. Dabei konnten zahlreiche<br />
Zahlen und Fakten auch für Österreich bestätigt werden, die<br />
bereits in unserem Artikel vor zwei Jahren (bestbanking 10/06)<br />
mit globalen Zahlen angekündigt wurden.<br />
Grafik: © emotion banking , Quelle: Institut für Demographie 2006<br />
Fakt 1: Die Muslime in Österreich sind<br />
eine dynamisch wachsende Zielgruppe<br />
Seit 1991 hat sich die muslimische Bevölkerung mehr als<br />
verdoppelt und liegt 2007 bei 4,9% der Gesamtbevölkerung.<br />
Das Institut für Demographie zeigt in einer aktuellen Studie<br />
unterschiedliche Szenarien auf, die den Anteil an Muslimen in<br />
Österreich bis 2051 prognostizieren. Die Zukunftsprojektionen<br />
beruhen auf drei Indikatoren für die gesellschaftliche Entwicklung:<br />
erstens der Geburtenentwicklung, zweitens der<br />
Migration und drittens der Austritte aus der Religionsgemeinschaft.<br />
Mittels dieser Indikatoren wurden unterschiedliche<br />
Entwicklungen berechnet. Szenario niedrig erreicht dabei einen<br />
prognostizierten Anteil der unter 14jährigen von 20% Muslimen,<br />
Szenario mittel 35% und Szenario hoch sogar 50% (das<br />
bedeutet, dass im Jahr 2051 jeder 2. österreichische Jugendliche<br />
Muslim ist). Bei Durchsicht der Szenarien zeigt sich – auch bei<br />
einem deutlichen Abflachen der Zahl der Kirchenaustritte bei<br />
der römisch-katholischen Glaubensgemeinschaft (von gegenwärtig<br />
rund 30.000 Personen pro Jahr) – als realistischer Wert<br />
für die österreichische Gesellschaft, dass zumindest ein Fünftel<br />
der Bevölkerung moslemischen Glaubens sein wird.<br />
Fakt 2: Attraktive Eigenschaften der<br />
Zielgruppe für die Finanzbranche<br />
Erstens: Die Betrachtung der Einkommenssituation führt<br />
vorerst in die Irre. Mehr als die Hälfte der türkischen Bevölkerung<br />
in Österreich wird z.B. zur unteren Einkommensschicht<br />
gezählt und das durchschnittliche (Median) Nettohaushaltseinkommen<br />
liegt zwischen € 1001 und € 2000. Die Sparquote<br />
ist jedoch höher ausgeprägt als in den ethnisch-österreichischen<br />
Haushalten und liegt pro Monat und Haushalt nach der aktuellen<br />
Studie von emotion banking bei € 173. Dieser Einblick in die<br />
finanzielle Situation der islamischen Bevölkerung erscheint auf<br />
den ersten Blick wenig attraktiv für Banken. Doch es lohnt sich,<br />
etwas genauer hinzuschauen. Denn es gibt überdurchschnittlich<br />
viele junge Muslime in Österreich. Während ca. 83% der Muslime<br />
unter 40 Jahre sind, sind es nur rund 50% der Österreicher.<br />
Gerade in dieser Alterskategorie liegt der größte Bedarf an<br />
Finanzprodukten als auch die Aktiveinkommen. Diese Schere in<br />
der Altersstruktur wird künftig weiter zugunsten der Muslime<br />
aufgehen. Grund hierfür ist die deutlich höhere Fertilitätsrate<br />
von muslimischen Frauen (2,34 vs. 1,4 bei Österreicherinnen).<br />
Zweitens: der finanzielle Wohlstand der Muslime erhöht<br />
sich merkbar und ihre Kaufkraft steigt. Dies zeigt sich z.B. in<br />
34<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Fakt 3: Große Bedeutung des Islam –<br />
großes Interesse an shariakonformen Produkten<br />
Grafik: © emotion banking, Quelle: BMI Studie 2006<br />
der steigenden Immobiliennachfrage. Die aktuelle Zielgruppenstudie<br />
von emotion banking zeigt, dass rund die Hälfte der<br />
Muslime in Österreich in den nächsten drei Jahren den Kauf<br />
einer Eigentumswohnung plant, ein Drittel den Kauf eines<br />
Hauses und 16% den Bau eines Hauses. Auch die rückläufigen<br />
Geldtransfers ins Heimatland (1995 34% vs. 2007 21%) sind ein<br />
Indiz, dass das in Österreich verdiente Geld im Land bleibt und<br />
Österreich als Heimat gesehen wird.<br />
Für 88% der österreichischen Muslime nehmen der Islam<br />
und seine Vorschriften einen sehr hohen bis hohen Stellenwert<br />
ein. Vor allem die Gabe von Almosen, das Fasten und die<br />
Gebete werden beachtet. Das Zinsverbot ist eher wichtig – die<br />
von Banken ausgezahlten Zinsen werden selten behalten, jedoch<br />
auch nur teilweise gespendet.<br />
Doch würden Österreichs Muslime nun auch shariakonforme<br />
Bankprodukte kaufen? Während nur 11% der österreichischen<br />
Banker glauben, dass Islamic Banking ein für ihre Bank Erfolg<br />
versprechendes Konzept ist (Bankbarometer 07), sind die<br />
Muslime anderer Meinung. 80% der Muslime sagen, dass es<br />
ihnen wichtig ist, ihr Geld nach den Regeln des Koran zu verwalten<br />
und anzulegen. 56% bekunden ihr Interesse am Kauf von<br />
shariakonformen Produkten und für 53% ist dieses Angebot<br />
sogar ein Kriterium zur Wahl ihrer Bank. Nur rund 12% haben<br />
bereits Angebote zu shariakonformen Produkten erhalten und<br />
nutzen diese auch. Immerhin 5% haben jedoch auch bereits<br />
schlechte Erfahrungen mit islamischen Holdings gemacht.<br />
Wohnpläne in den<br />
nächsten 3 Jahren<br />
Transferieren Sie regelmäßig<br />
Geld in Ihr Herkunftsland bzw.<br />
an Verwandte im Ausland?<br />
Grafiken: © emotion banking<br />
Drittens: Großes Potenzial bei der Produktnutzung. Österreichs<br />
Muslime nutzen noch weit weniger Produkte als Einheimische.<br />
Während Österreicher durchschnittlich rund 4,4<br />
Finanzprodukte haben, nutzen Muslime hingegen nur 2,8.<br />
Girokonto und Sparbuch sind dabei die Favoriten. Bei Versicherungen<br />
wird fast nur die Kfz-Versicherung (62,5%) genutzt.<br />
Die sonstige Nutzung ist signifikant gering (25% haben bspw.<br />
eine Haushaltsversicherung).<br />
Viertens: Die Zielgruppe ist hochgradig vernetzt. 84%<br />
der moslemischen Frauen ehelichen einen Mann der gleichen<br />
Konfession. Die Struktur der Großfamilie ist stark ausgeprägt<br />
und der Zusammenhalt der Ethnischen Minderheiten sehr<br />
hoch. Hierdurch ergeben sich wertvolle Ansatzpunkte für<br />
Mundpropaganda und Weiterempfehlungsmarketing. Wer „in<br />
der Zielgruppe drinnen ist“, der wächst auch ohne zentrale<br />
Kommunikationskampagnen.<br />
Doch bietet Islamic Banking auch für Österreichs Mittelstandsbanken<br />
dieses Potenzial? Aus Sicht der Muslime, ja! Ein<br />
Drittel der Muslime gibt konkret an, dass sie shariakonforme<br />
Bankprodukte bei einer Raiffeisenbank, Sparkasse oder Volksbank<br />
kaufen würden. Das bedeutet, dass nicht nur Interesse<br />
an den Produkten besteht, sondern konkrete Kaufabsichten<br />
existieren. Etwas weniger als die Hälfte der Muslime ist sich in<br />
ihrer Entscheidung noch nicht ganz sicher und will von den<br />
Banken überzeugt werden.<br />
Fakt 4: Verständnis und Exklusivität erwünscht<br />
Erstens: Muslimische Kunden stellen beim Kauf von<br />
Finanzprodukten spezielle Anforderungen. Insbesondere Beratung<br />
in der eigenen Muttersprache und damit besseres<br />
Verständnis für den kulturellen Hintergrund und die Mentalität<br />
Welchen Stellenwert nehmen<br />
der Islam als Religion und seine<br />
Glaubensgrundsätze in Ihrem<br />
Leben ein?<br />
Grafiken: © emotion banking<br />
Würden Sie shariakonforme<br />
Produkte bei einer Raiffeisenbank,<br />
Sparkasse oder Volksbank<br />
kaufen?<br />
▲<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
35
Grafiken: © emotion banking<br />
Wer setzt den<br />
ersten Schritt?<br />
sind wichtig. Beim Kauf von shariakonformen Produkten<br />
kommt noch die Forderung nach fundiertem Wissen über den<br />
islamischen Glauben hinzu.<br />
Zweitens: Exklusivität ist gefragt. Überraschend ist, dass die<br />
islamische Bevölkerung in Österreich ein höheres Interesse an<br />
exklusiven und gehobenen Bankdienstleistungen hat als die<br />
österreichische. Auch abwechslungsreicher und angenehmer<br />
Erlebnischarakter in der Bank ist stärker gefragt. Zusätzlich<br />
sollen Bankgeschäfte vor allem rasch abgewickelt werden.<br />
5 Cluster zeigen gezielte<br />
Ansprachemöglichkeiten für Banken<br />
Zusätzlich zu den Erhebungen der Finanzthemen hat emotion<br />
banking eine Typologie der muslimischen Bevölkerung erstellt.<br />
Grundlage hiefür ist die Lebensstilsegmentierung und somit das<br />
Bestreben, detaillierte Informationen über die Einstellungen<br />
und Denkweisen der Kunden zu erfahren. Wofür engagieren Sie<br />
sich? Welche Ziele verfolgen sie? Welche Hobbies und Interessen<br />
haben sie? All das sind typische Fragen einer Lebensstilsegmentierung.<br />
Auf Baisis der Antworten konnten 5 Cluster<br />
identifiziert werden, die nach ihrer finanziellen, religiösen und<br />
sozialen Komponente eingestuft wurden. Daraus ergeben sich<br />
spezielle Anforderungen für Produkte, Preisgestaltung, Vertrieb,<br />
Marketing, Berater, Abwicklung der Geschäfte und Filiale. Im<br />
kurzen Überblick sehen die Cluster folgendermaßen aus:<br />
Cluster 1 ist wenig religiös, gut etabliert und hat großes<br />
Interesse an Informationen zu Finanzen. Er fühlt sich bei<br />
Universalbanken gut aufgehoben, ist jedoch auch für Ethnobanking<br />
Konzepte offen.<br />
Cluster 2 ist sehr religiös, hat nur geringe finanzielle Mittel<br />
und nutzt auch Banken nur marginal. Hier bietet sich großes<br />
Interesse für Islamic Banking jedoch mit geringer Kaufkraft.<br />
Auch Cluster 3 ist ebenfalls Kandidat für Islamic Banking<br />
und ethnisches Banking. Große Religiosität, überdurchschnittliches<br />
Einkommen und der Wunsch nach Selbstbestimmung bei<br />
finanziellen Angelegenheiten, jedoch auch geringes Interesse an<br />
zusätzlichen Informationen zu Bankprodukten kennzeichnen<br />
diesen Cluster.<br />
Cluster 4 ist der perfekte Islamic Banking Kunde: sehr<br />
religiös, etwas aufgeschlossen, wenig Finanzerfahrung und<br />
perfekte Deutschkenntnisse kennzeichnen ihn.<br />
Cluster 5 ist jung und konsumorientiert, jedoch wenig<br />
religiös. Hier sind sowohl Universalbanken als auch ethnisches<br />
banking ansprechend.<br />
International häufen sich die<br />
Erfolgsmeldungen über Islamic<br />
Banking. Jedoch ist hierbei ein<br />
zweiter Blick geboten. Denn die<br />
meisten Erfolgsgeschichten betreffen<br />
den Teilbereich Islamic<br />
Finance und beziehen sich damit<br />
auf das internationale Projektfinanzierungsgeschäft. Retail<br />
Banking wurde in Europa insbesondere von der Islamic Bank of<br />
Britain umgesetzt. Das Konzept zeigt jedoch, dass auch in<br />
Europa das Privatkundengeschäft erfolgreich realisiert werden<br />
kann. Jüngst wurde auch in Frankreich mit dem Retailgeschäft<br />
begonnen. In Italien ist der Markteintritt noch für heuer von der<br />
European Islamic Investment Bank angekündigt worden. Es ist<br />
nur eine Frage der Zeit, bis auch im deutschen Sprachraum die<br />
ersten Angebote fix etabliert sind, denn die Produkte sind<br />
bereits vorhanden. Die Studie zeigt nun, dass auch das Interesse<br />
von Seiten der Muslime besteht, wobei wichtig ist, dass die<br />
shariakonformen Produkte hinsichtlich Ertrag und Kosten<br />
absolut wettbewerbsfähig sein müssen. Konkrete Gespräche mit<br />
Banken der Primärstufen werden bereits geführt, wobei im<br />
ersten Schritt vermutlich eher die Schiene des ethnischen<br />
Marketings zum Einsatz kommen wird. Damit würden die<br />
Banken dem Beispiel der heimischen Handelsunternehmen,<br />
wie z.B. Merkur, folgen. Auch dort gibt es ein klar definiertes<br />
Segment an türkischen Produkten, das auf die speziellen Feiertage<br />
und Feste exakt ausgerichtet wird. Hier sind die Banken im<br />
Hintertreffen und haben noch Chancen, denn gerade bei der<br />
Beratung stellt die Sprache eine echte Herausforderung dar.<br />
Wenn die Informationen nicht klar verstanden werden, führt das<br />
automatisch zum Gefühl hintergangen zu werden. Die Zeitverzögerung<br />
der Realisierung eines Retailbankings für Moslems<br />
auch hierzulande resultiert somit vor allem aus den Sprachunterschieden,<br />
die in England und Frankreich kein Thema darstellen.<br />
Die bestehenden Parameter und das Potenzial zeigen jedoch:<br />
Ethnisches Bankgeschäft oder gar Bankgeschäft ohne Zinsen ist<br />
möglich…<br />
Jetzt bestellen: Islamic Banking Studie<br />
Sichern Sie sich mit der Islamic Banking Studie jetzt ihren<br />
Wissensvorsprung über Islamic Banking und eine neue Zielgruppe.<br />
Erfahren Sie auf über 90 Seiten weitere Informationen<br />
zu den Hintergründen und zum Potenzial von Islamic Banking<br />
in Österreich. Sie erhalten mit den detaillierten Ergebnissen<br />
der Typologie aufschlussreiche Informationen zur Wahl der<br />
Konzepte und seinen Marketingaktivitäten.<br />
Bestellen Sie noch heute bei emotion banking<br />
(christina.tambosi@emotion-banking.at) oder bei bestbanking<br />
(kurt.quendler@bestbanking.at) und profitieren Sie von den<br />
Ergebnissen der Studie.<br />
❙<br />
36<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Trends, Visionen und<br />
Wachstumsmärkte<br />
mit Konstantin Koenigs, Vice President Marketing der NCR für Europa,<br />
den Nahen Osten und Afrika (EMEA), sprach Gertrud Zoklits<br />
Wie sieht die Marktlandschaft in Ihrem Geschäftsbereich in<br />
der EMEA-Region aus? Wie gestaltet sich die Wettbewerbslandschaft<br />
in der Region, wie viele Anbieter gibt es, ist der<br />
Markt stark umkämpft? Welches Segment sehen Sie, auf<br />
die Zukunft gerichtet, als wachstumsstärkstes an? Die<br />
Situationen in den verschiedenen Märkten der Region – wie<br />
unterscheiden sie sich, wie weit sind die einzelnen Märkte<br />
fortgeschritten?<br />
Die westeuropäischen Märkte sind größtenteils saturiert –<br />
das trifft auch auf Österreich zu. Der Markt in Zentral- und<br />
Osteuropa (CEE) verzeichnet das derzeit weitaus größte und<br />
schnellste Wachstum unter allen Regionen (Westeuropa, Naher<br />
Osten und Afrika): Allein in 2007 ist die Anzahl installierter<br />
Geldautomaten in CEE gegenüber dem Vorjahr um 34% gestiegen<br />
– damit hat sich das Geldautomatennetz in der Region<br />
seit 2004 mehr als verdoppelt. In den meisten dieser Länder ist<br />
die Privatisierung und Konsolidierung des Bankenmarktes weit<br />
fortgeschritten. Stark präsent sind dabei einige internationale<br />
Marktführer. Mehr als 50% des Marktes werden allein von den<br />
sieben größten Banken kontrolliert. Und der ‘CEE Banking<br />
Sector Report’ (Raiffeisen Research) prognostiziert, dass sich<br />
der CEE-Bankenmarkt bis Ende 2011 mehr als verdoppeln soll.<br />
In der Türkei, in Russland und der Ukraine ist die Konsolidierung<br />
bislang weniger weit fortgeschritten. Umso mehr wächst<br />
das Interesse der internationalen Banken für diese Märkte und<br />
das damit verbundene Wachstumspotenzial auszuschöpfen.<br />
Eine zweite Konsolidierungswelle des Bankenmarkts in den<br />
Ländern, die sich schon seit den 1990er Jahren der freien<br />
Wirtschaft geöffnet hatten, bewirkt ebenfalls strukturelle Veränderungen.<br />
Mit dem Aufschwung in CEE steigt auch der Konsum und<br />
belebt das Bankengeschäft, etwa durch steigendes Interesse an<br />
Krediten. Beispielsweise ist in Russland die Nachfrage nach<br />
Konsumkrediten von 2003 bis 2005 um 490% gestiegen – und<br />
von 2005 auf 2006 das Kreditvolumen der Privathaushalte<br />
um 73%. Zudem erschließen die Banken mit Finanzdienstleistungen,<br />
die teils sehr länderspezifisch sind, weitere Wachstumspotenziale.<br />
Die Verfügbarkeit von Bargeld spielt in CEE allerorten eine<br />
weitaus wichtigere Rolle als in Westeuropa. Andererseits zeigt<br />
sich „Plastikgeld“ in CEE im Vergleich zur weiten Verbreitung<br />
von EC- und Kreditkarte im Westen eher unterrepräsentiert.<br />
Auch die Versorgung mit Girokonten ist noch vergleichsweise<br />
gering, Tendenz steigend. Verständlich ist daher, dass sich in den<br />
CEE-Ländern Geldautomaten meist außerhalb von Bankfilialen<br />
befinden, etwa in Kaufhäusern, Einkaufszentren, an<br />
Bahnhöfen oder auch in Unternehmen. Russland ist mit 43%<br />
aller in der Region installierten Systeme der größte Geldautomatenmarkt<br />
in den CEE-Ländern mit einem anhaltend starken<br />
Wachstum (gefolgt von der Ukraine, 18%).<br />
SB-Lösungen werden aber nicht nur zur Bargeldbeschaffung<br />
für den Einkauf des täglichen Bedarfs genutzt. Auch Kreditrückzahlungen<br />
werden beispielsweise in Russland bar am<br />
Geldautomaten abgewickelt; hinzu kommen Bareinzahlung von<br />
Gas- oder Stromrechnungen bei den Finanzinstituten. Die<br />
Banken in Russland und anderen Ländern der Region reagieren<br />
auf diese Kundenanforderungen mit einem Ausbau ihres<br />
SB-Angebots, das die automatisierte Bargeldeinzahlung mit<br />
einschließt. Den Bankkunden bietet dies mehr Flexibilität bei<br />
der Erledigung ihrer Bankgeschäfte – und sie sind unabhängig<br />
von Banköffnungszeiten.<br />
Mit 44% aller in CEE installierten Geldautomaten<br />
ist NCR nach Angaben von RBR* Marktführer in der Region.<br />
Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bereich der Geldeinzahlungssysteme.<br />
Dieses Segment genießt unsere große Aufmerksamkeit.<br />
Erkennen Sie einen Trend im Einsatz Ihrer Produkte, auf den<br />
Sie – hauptsächlich – setzen?<br />
Der Trend geht eindeutig hin zum multifunktionalen SB-<br />
Gerät, das neben der Erledigung der täglichen Geldgeschäfte<br />
ein breites Serviceangebot an Transaktionsdienstleistungen<br />
bietet. Hierzu zählen am Beispiel unserer neuen NCR SelfServ<br />
30er Serie neben der Geldaus- und -einzahlung – als einzelne<br />
Banknoten oder auch in Bündeln – ebenso die Bearbeitung<br />
von Rechnungen, Überweisungen, Kontoauszügen und das Aufladen<br />
von Mobiltelefonen. Die höhere Funktionalität der NCR<br />
SelfServ Lösungen geht zudem Hand in Hand mit einer noch<br />
einfacheren, intuitiveren Bedienung der Systeme. Hiervon profitieren<br />
neben den Bankkunden auch Geldtransportunternehmen<br />
und Servicetechniker.<br />
Ein neues, interessantes Thema sehen wir bei Transaktionen,<br />
die die sogenannte Near Field Communuication (NFC) mit<br />
kontaktlosen Karten nutzen. Der Geldautomat dient hier als<br />
„Trusted Device“ zur Autorisierung solcher Transaktionen.<br />
▲<br />
*Retail Banking Research Ltd. London, 2007<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
37
Fotos: NCR SelfServ<br />
Wie kommunizieren Sie mit Ihren Kunden, welche<br />
Werbemittel, Medien etc. nutzen Sie, um mit Ihren Kunden zu<br />
kommunizieren (und um neue Kunden zu akquirieren)?<br />
Wir setzen eine ganze Reihe an Mitteln ein, um unsere<br />
bestehenden und potenziellen Kunden auf dem Laufenden zu<br />
halten. Neben Messeauftritten, bei denen wir mit einem Stand<br />
repräsentiert sind, treten wir als Sponsor einzelner Veranstaltungen<br />
auf, halten Hausmessen und Infotage ab, laden zum<br />
Networking ein, versenden Newsletter. Zu den klassischen Werbemaßnahmen<br />
gehören auch Anzeigen in Fachmedien – unser<br />
Augemerk liegt jedoch auf einer umfassenden persönlichen<br />
Beratung, die mittels Produktbroschüren noch unterstützt wird.<br />
Welchen Stellenwert hat die Kundenpflege, -betreuung, der<br />
Service – was bieten Sie an? Wird z.B. ein Servicepaket<br />
mitverkauft bzw. setzen Sie (auch) auf Soft Skills als Marketingtool?<br />
Der direkte Kontakt zum Kunden ist uns – wie oben<br />
erwähnt – sehr wichtig. Unsere Vertriebsleute sind über verschiedene<br />
Geschäftsstellen im Land verteilt und können so<br />
regelmäßig beim Kunden vor Ort sein. Allein in der DACH-<br />
Region beschäftigen wir knapp 60 Vertriebsmitarbeiter.<br />
Wie gestaltet sich die Produktlandschaft, inwieweit unterscheiden<br />
sich die Produkte der verschiedenen Anbieter?<br />
NCR legt größten Wert auf maximale Verfügbarkeit seiner<br />
Produkte. Dies erreichen wir durch hohe Produkt- und Servicequalität,<br />
unterlegt durch Features, die eine extrem einfache<br />
Administrierbarkeit unserer Systeme unterstützen.<br />
Was bieten Sie, können Sie, was andere nicht bieten, nicht<br />
können?<br />
Produktseitig möchte ich das am Beispiel der NCR SelfServ<br />
veranschaulichen: Diese neue Generation an multifunktionalen<br />
Geldautomaten ist die erste ihrer Art mit einer innovativen<br />
„Selbstheilungs-Technologie“. Diese sorgt bei Störungen dafür,<br />
dass die SB-Systeme automatisch neu hochgefahren und somit<br />
innerhalb kürzester Zeit wieder betriebsbereit sind. Hierdurch<br />
kann der Arbeitsaufwand bei der Standardwartung von bis zu<br />
vier Stunden auf weniger als 20 Minuten reduziert werden. Diese<br />
Technologie ist auf dem Markt einzigartig. Sie unterstützt Banken<br />
dabei, Kosten zu senken und die Hochverfügbarkeit ihres SB-<br />
Angebots zugunsten der Kundenzufriedenheit sicherzustellen.<br />
Weitere Vorteile der NCR SelfServ Produktlinie im Bereich der<br />
Wartung und Verfügbarkeit bestehen zum Beispiel in der grafischen<br />
Bedienkonsole inklusive interaktiver Videounterstützung:<br />
Damit lassen sich Ausfälle deutlich schneller und einfacher<br />
durch eigene Mitarbeiter oder Wartungspersonal beheben.<br />
Als langjähriger Marktführer von SB-Systemen für die<br />
Finanzindustrie können wir im Bereich Managed Services auf<br />
eine im Vergleich zum Wettbewerb unerreichte Datenhistorie<br />
zurückgreifen, die uns hilft, Verhaltensmuster der Systeme<br />
schneller zu erkennen und entsprechend schneller zu reagieren.<br />
Auch bei der Standortanalyse hilft uns die Historie – Daten aus<br />
Transaktionszahlungen, durchschnittlich umgesetzten Geldmengen,<br />
Rahmenparametern der Kunden etc. –, dem Kunden<br />
passgenaue Services anzubieten. Unsere Kunden erhalten Berichte,<br />
Auswertungen und Analysen über ihr Geschäftsgebaren<br />
aus einer Hand, was bei anderen Anbietern nur durch Zukauf<br />
von umfangreichen Analysetools und -datenbanken möglich ist.<br />
Nicht zuletzt möchte ich auch unser Fraud Department in<br />
Großbritannien erwähnen. Dort werden alle an den NCR<br />
Geldautomaten auftretenden Fehler und Attacken registriert,<br />
analysiert und – wenn notwendig – neue Sicherheitslösungen<br />
entwickelt. Das Fraud Department dient somit als weltweiter<br />
Filter, der beispielsweise Manipulationen frühzeitig aufspürt<br />
und durch gezielte Maßnahmen allen angebundenen SB-<br />
Systemen erweiterten Schutz bietet – auch vor Bedrohungen,<br />
die bisher nur im Ausland aufgetreten sind.<br />
Wie läuft die Kaufentscheidung des Kunden ab, welche<br />
Faktoren sind für den Kunden entscheidend und welche Rolle<br />
spielt der Preis dabei?<br />
Das kann man pauschal gar nicht sagen, es sind ganz unterschiedliche<br />
Faktoren, die letztendlich die Kaufentscheidung<br />
beeinflussen. Bei dem einen kommt es auf Alleinstellungsmerkmale<br />
einzelner Produkte, das Dual-Konzept oder das Design an<br />
– daher auch bei NCR SelfServ das einheitliche Erscheinungsbild<br />
bei allen Modellen –, bei dem anderen steht die Verfügbarkeit<br />
der Systeme an übergeordneter Stelle. Der Preis ist dabei<br />
immer auch ein wichtiger Punkt – aber letztendlich nicht der<br />
einzige und wichtigste. Hat der Kunde gute Erfahrungen mit<br />
NCR gemacht, stimmt die Betreuung, Liefertreue und Qualität,<br />
bezieht er oftmals auch unsere plattformunabhängige Software<br />
oder andere Serviceleistungen. Bei immer mehr Kunden überzeugen<br />
wir mit einem gesamtheitlichen Paket, bestehend<br />
aus Beratungsdienstleistung, Hardware und Software sowie<br />
Managed Services.<br />
Wie sieht Ihre Strategie für die weitere Zukunft aus? Auf<br />
welche Produkte werden Sie setzen und warum? Und welche<br />
werblichen Ansprachen werden sie wählen?<br />
Dazu möchte ich folgende Information vorwegschicken:<br />
Im Oktober letzten Jahres erfolgte die Ausgliederung der<br />
Data Warehousing-Sparte, die seitdem als Teradata Corporation<br />
firmiert. Mit dieser strategischen Maßnahme können wir jetzt<br />
noch schneller auf die sich verändernden Marktbedingungen<br />
38<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Foto: NCR / Healthcare - Check-in-Schalter für das Krankenhaus<br />
und Kundenbedürfnisse reagieren. Seitdem<br />
verfolgen wir eine Drei-Punkte-Strategie:<br />
Erstens: das Lösungsportfolio und die Services<br />
in unseren Kernbereichen Finance und Retail<br />
erweitern. <strong>2008</strong> ist übrigens das Jahr mit den<br />
meisten Produktlaunches seit zehn Jahren!<br />
Zweitens: zukünftig unsere Selbstbedienungslösungen<br />
über verschiedene Industrien und<br />
Märkte hinweg anbieten. Als Beispiel mag hier<br />
ein Geldautomat an der Tankstelle oder ein<br />
„Check-in-Schalter“ im Krankenhaus dienen –<br />
unter dem Stichwort‚ Zusammenwachsen<br />
von Märkten’. Und schließlich: verstärkt neue,<br />
aufstrebende Industrien wie Touristik und Gesundheitswesen<br />
mit Hilfe weiterer Investitionen<br />
in unser intelligentes Selbstbedienungsportfolio<br />
adressieren. Dafür haben wir<br />
uns zusätzliches Know-how in unser<br />
Unternehmen geholt.<br />
Wie bereits erwähnt, setzt NCR<br />
zudem auf neue Technologien wie<br />
NFC, auch in Richtung Mobility,<br />
sowie auf Outsourcing von SB-Services.<br />
Banken oder Einzelhändler können sich auf ihre Kernkompetenzen<br />
konzentrieren, während wir uns um Geldbestände und<br />
Papierstau, Service und Support, Fernüberwachung oder eben<br />
um alle Dienstleistungen rund um die Systeme kümmern.<br />
Werblich sehen wir vor allem die Betonung auf den<br />
Konsumentennutzen. Denn technische Innovationen wie beispielsweise<br />
der fast uneingeschränkte Zugriff auf das Internet<br />
beeinflussen ganz wesentlich das Verbraucherverhalten, und wir<br />
als zukunftsorientiertes Unternehmen richten uns intensiv<br />
auf die Bedürfnisse der Konsumenten aus. Diese lauten heute<br />
stärker denn je, zeit- und ortsunabhängig mit Unternehmen in<br />
Verbindung zu treten und Geschäfte zu tätigen.<br />
In den kommenden drei Jahren – was werden die spannendsten<br />
Herausforderungen für Sie sein?<br />
Unsere jährlich durchgeführten Umfragen belegen, dass<br />
die Endkunden vermehrt Wert darauf legen, alle möglichen<br />
Selbstbedienungskanäle wie Geldautomaten, Kioske, Internet,<br />
Handy und PDA je nach ihren jeweiligen Ansprüchen zu<br />
nutzen. Zum einen werden Unternehmen sich also den<br />
geänderten Kundenbedürfnissen anpassen müssen, um ihre<br />
Kunden nachhaltig zu binden. Zum anderen sehen wir auch eine<br />
Vermischung der verschiedenen Geschäftsfelder wie Handel,<br />
Gesundheitswesen, Reisebranche und Finanzwelt – Stichwort<br />
Konvergenz: Geldautomaten an Drittplätzen wie U-Bahnhöfen,<br />
Tankstellen oder beim Lebensmittelhändler um die Ecke;<br />
Handykartenaufladen und Ticketkauf am Geldautomaten;<br />
„Check-in“ im Krankenhaus, wie man es von Flughäfen her<br />
kennt, werden zukünftig gang und gäbe sein. Die Selbstbedienung<br />
ist also auf dem besten Weg, der bevorzugte Kanal<br />
der Konsumenten zu werden. Laut den Analysten von Gartner<br />
Research werden bis im Jahr 2010 über SB-Systeme 58% aller<br />
Kundeninteraktionen ablaufen.<br />
NCR hat diesen Trend frühzeitig erkannt und seine<br />
branchenübergreifende SB-Strategie darauf ausgerichtet. Nicht<br />
zuletzt verlagern Banken zeit- und kostenintensive Standardtransaktionen<br />
vom Schalter auf den SB-Kanal und auf Dienstleister,<br />
damit sie sich wiederum auf ihre Kernkompetenzen,<br />
die Beratung und den Vertrieb, konzentrieren können. Es wird<br />
entscheidend sein, den Banken mit einem ganzheitlichen<br />
Konzept entgegenzukommen und von Filialgestaltung über<br />
reine Hardware bis hin zu Serviceleistungen alles aus einer<br />
Hand zu bieten.<br />
Dr. Konstantin Koenigs<br />
ganz persönlich:<br />
Kinder: 1 Tochter<br />
Sport: Mountainbiking<br />
Hobbies bzw. Interessen:<br />
Musik (Klassik, Jazz), Lesen (Philiosphie,<br />
Naturwissenschaften)<br />
Reisen:<br />
sehr viele Geschäftsreisen, daher nur<br />
Kurztrips mit der Familie zu europäischen Zielen<br />
Kraft- bzw. Energiequelle (Stressbewältigung):<br />
Famile, Spazierengehen<br />
Was ist Ihnen ganz persönlich in Ihrem Leben wichtig?<br />
Im Beruf: Die Menschen und ganz besonders diejenigen, für<br />
die ich direkte Verantwortung trage. Privat und allgemein das<br />
Arbeiten an einer besseren Welt für unsere Kinder und bei all<br />
dem nicht vergessen, dass das Leben hier und heute stattfindet.<br />
Berufliche Stationen:<br />
Dr. Konstantin Koenigs ist Vice President Marketing der NCR für<br />
Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA). In dieser Position<br />
verantwortet er das Produkt- und Lösungsmarketing.<br />
Vor der Übernahme dieser Verantwortung leitete Koenigs den<br />
Geschäftsbereich FSD Central Europe. In dieser Zeit führte<br />
NCR in der Region eine neue Softwareplattform für Selbstbedienungssysteme<br />
sowie umfassende Service-Angebote für den Betrieb<br />
von SB-Netzwerken ein.<br />
Nach seinem Studium und dem Betrieb seines eigenen kleinen<br />
Softwarehauses war Konstantin Koenigs am Lehrstuhl Prof. Dr.<br />
Reinhart Blum tätig, hielt Vorlesungen und forschte auf dem Arbeitsgebiet<br />
der Wirtschaftsstruktur in Deutschland.<br />
Der Diplom-Betriebswirt und promovierte Volkswirt ist Autor<br />
zahlreicher Beiträge in der Fach- und Wirtschaftspresse zu Themen<br />
wie „Banking der Zukunft“ und „Outsourcing für<br />
Finanzdienstleister“. Er ist seit 1989 für NCR tätig, nachdem er<br />
bereits nach dem Abitur eine Lehre zum Datenverarbeitungskaufmann<br />
im Hause NCR absolvierte.<br />
Zum Unternehmen:<br />
Wann wurde NCR gegründet? John H. Patterson gründete die<br />
National Cash Register Company, Hersteller der ersten<br />
mechanischen Registrierkasse im Jahre 1884.<br />
Welche Standorte gibt es? NCR ist in über 130 Ländern weltweit<br />
mit Niederlassungen vertreten.<br />
Zahl der Mitarbeiter: Weltweit etwa 23.200 (Stand 31.12.2007)<br />
Letzter Jahresumsatz: 4,97 Mrd. USD<br />
Letzter Jahresgewinn: 171 Mio. USD<br />
❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
39
Shop-Banking<br />
mit neuen<br />
Verkaufskonzepten<br />
WSK-Bank Vorstandsdirektorin Dr. Ilse A. Vigl führt ihr<br />
Konzept vom innovativen Shop-Banking erfolgreich in die<br />
zweite Runde. Am 9. 9. <strong>2008</strong> eröffnet der zweite „mein<br />
kreditshop“ der WSK-Bank in der Meidlinger Hauptstraße<br />
im 12. Wiener Gemeindebezirk.<br />
„Wir schlugen einen neuen Weg ein, als wir<br />
letztes Jahr den Prototyp von ´mein<br />
kreditshop´ in der Favoritenstraße<br />
eröffneten. Wir waren damit übrigens die<br />
ersten in Österreich,“<br />
erläutert Dr. Ilse A. Vigl,<br />
„Unser mutiges Konzept wurde von den<br />
Kunden sehr goutiert und so führen wir den<br />
eingeschlagenen Weg wie geplant fort.“<br />
Das Team v.l.n.r.: Kundenberater, Thomas KUNOVJANEK, Shopmanagerin<br />
Claudia WEICHSELBAUMER, Kundenberater Stefan AUREDNICEK und<br />
Kundenberaterin Elisabeth KOCOUREK<br />
40<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Fotos: mein kreditshop<br />
Auf Augenhöhe<br />
Shop mit Lounge statt Bank mit Schalter<br />
Das Konzept bricht mit allen herkömmlichen Banken-<br />
Standards und Banken-Konventionen. Die Shops in der<br />
Meidlinger Hauptstrasse 47 und in der Favoritenstraße 101 erinnern<br />
wohl mehr an eine Lounge mit Wohnzimmercharakter als<br />
an eine herkömmliche Bank mit Schalterräumen. Modern und<br />
gemütlich in kräftigen Rot- und Orangetönen eingerichtet, kann<br />
der Kunde bequem an den Serviceterminals oder in der Kaffee-<br />
Lounge verweilen. „Wir wollen keine Distanz zwischen Bankangestellten<br />
und Kunden – hier begegnen sich beide auf Augenhöhe.<br />
Nach einem Beratungsgespräch weiß der Kunde rasch, was<br />
er sich leisten kann. Kredite und Finanzprodukte werden in Ihrer<br />
Darstellung einfach und praktikabel angeboten. Wir gewähren<br />
auch keine Kredite, wir verkaufen sie“, so Dr. Ilse A. Vigl.<br />
Neben all den ausgefeilten bankspezifischen Inhalten punktet<br />
„mein kreditshop“ – wie der Name mit dem bewusst gewählten<br />
Personalpronomen bereits verrät – mit besonderer Kundennähe.<br />
Der Bankangestellte ist – dezent in „mein kreditshop“-<br />
Bekleidung gehüllt – vor allem serviceorientiert.<br />
Hier ist niemand Bittsteller, hier ist jeder ein Kunde mit<br />
allen Rechten. Die Kundennähe äußert sich u.a. auch durch<br />
Vielsprachigkeit der Mitarbeiter zum einen, zum anderen wird<br />
der Kunde rein grafisch bereits am Welcome-Desk in über<br />
15 Sprachen willkommen geheißen. „Service ist eine Sache,<br />
partnerschaftliches und freundliches Begegnen auf Augenhöhe<br />
ist gerade im Bankensektor nochmals eine ganz andere Sache“,<br />
so die innovative Vorstandsdirektorin, die alle klassischen<br />
Schalter aus den Räumen verbannt hat. Loungetische, Desks,<br />
Terminals und Schreibtische werden offeriert, der Kunde hat die<br />
Freiheit der Wahl.<br />
Freundlich, hell, entgegenkommend, modern, ohne Barrieren<br />
und Hemmschwellen mit besonders kundenfreundlichen Mitarbeitern<br />
und einfach zu handhabenden Produkten adressiert man<br />
sehr partnerschaftlich die Kundenschicht, die sich Wünsche auf<br />
einfache und unkomplizierte Weise erfüllen will.<br />
„Die Meidlinger Hauptstraße ist eine gute Frequenzlage und<br />
„mein kreditshop“ adressiert die konsumfreudige und einzelhandelsafine<br />
Käuferschaft“, begründet Vigl die Wahl des zweiten<br />
Standorts. Shopkonform und kundenfreundlich sind auch die<br />
für eine Bank ungewöhnlichen Öffnungszeiten, Montag bis<br />
Freitag ist man von 9:30-18:00 Uhr und Samstag von 09:00-<br />
12:30 Uhr offen für die Wünsche der Kunden.<br />
www.meinkreditshop.at<br />
❙<br />
„mein Kreditshop“ in der Meidlinger Hauptstr. 47, 1120 Wien, ein weiteres Projekt von POS Manigatterer und Tulzer&Osterauer<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
41
Kommunikation<br />
kompakt<br />
Wie jeder andere Verband ist auch der Deutsche Sparkassen-<br />
und Giroverband gezwungen, seine verfügbaren<br />
Mittel so effizient und sparsam wie möglich<br />
einzusetzen – unter anderem letztlich deshalb, weil<br />
er als Verband keine eigenen Gewinne erwirtschaften<br />
darf, sondern lediglich die Beiträge seiner Mitglieder<br />
verwaltet. Ein Großteil seiner Aufgaben besteht in der<br />
Kommunkation mit seinen unterschiedlichen Partnern,<br />
sodass er besonderes Augenmerk auf eine störungsfrei<br />
funktionierende und kosteneffiziente Kommunikations-<br />
Infrastruktur legt.<br />
Um dies sicherzustellen, arbeitet der DSGV derzeit mit den<br />
Kommunikations-Spezialisten der retarus GmbH zusammen.<br />
Ein erster Kontakt zu den Münchner Messaging-Experten<br />
entstand im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung<br />
Kommunikation und Medien des DSGV. Hier wurde<br />
ursprünglich eine Telekom T400-Anwendung für den Fax-<br />
Versand von Informationen an die verschiedenen Redaktionen<br />
und Journalisten eingesetzt. Da diese Lösung zuletzt jedoch<br />
an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stieß, wurde sie durch<br />
die Messaging-Plattform Retarus WebExpress abgelöst. Nach<br />
einer Implementierungszeit von nur wenigen Tagen konnte<br />
das monatliche Volumen von 10.000 bis 15.000 Fax-Seiten<br />
problemlos bewältigt werden.<br />
Volumenaussendungen per Telefax<br />
WebExpress ist eine Dialog-Kommunikationsplattform,<br />
über die Mailings per E-Mail, Fax und SMS schnell und einfach<br />
versandt werden können. Sie läuft über die Kommunikationsinfrastruktur<br />
in den Retarus Rechenzentren. Konkret bedeutet<br />
dies, dass der Anwender weder spezielle Software, noch besondere<br />
Hardware installieren oder pflegen muss. Alles, was<br />
für den Einsatz von WebExpress erforderlich ist, ist ein Standard-Browser,<br />
der auf jedem Computer mit Internet-Zugang<br />
ohnedies verfügbar ist. Damit ist WebExpress an allen sieben<br />
Tagen der Woche rund um die Uhr verfügbar. Die Benutzeroberfläche<br />
ist einfach und intuitiv zu bedienen und erfordert<br />
keinen nennenswerten, zusätzlichen Schulungsaufwand. Nachrichten<br />
erreichen alle Adressaten – egal, ob diese per E-Mail,<br />
Fax oder SMS angesprochen werden sollen – in kürzester<br />
Zeit. Gleichzeitig sorgt WebExpress dafür, dass erst gar keine<br />
intransparenten Kostenstrukturen entstehen: Hier werden nur<br />
die versendeten Nachrichten abgerechnet. Grundgebühren oder<br />
spezielle Zeitkomponenten fallen nicht an und der Versand<br />
eines einzelnen Fax-Dokuments oder einer Volumen-Rundsendung<br />
an mehrere hundert Adressaten ist stets kalkulierbar.<br />
Individuelle Einsatzmöglichkeiten<br />
durch Managed Fax Services<br />
Auch zur IT-Abteilung des Verbandes entstand rasch<br />
Kontakt. Da die Kommunikation per Telefax nicht nur in dessen<br />
Presse- und Öffentlichkeitarbeit eine entscheidende Rolle spielt,<br />
standen hier die Retarus Managed Fax Services von Anfang an<br />
im Mittelpunkt des Interesses: Fax2Mail und Mail2Fax. Beide<br />
Services integrieren die Funktionalität von Telefax und E-Mail.<br />
Mit Retarus Mail2Fax können Telefaxe ganz einfach aus<br />
dem E-Mail-Programm des Anwenders verschickt werden. Die<br />
Nachrichten werden dabei über die Fax- Infrastruktur in den<br />
Retarus Rechenzentren transaktionssicher und ohne Einsatz<br />
von eigener Hard- und Software zuverlässig versendet. Für<br />
den DSGV entfällt damit die Notwendigkeit, eigene Telefaxleitungen<br />
und Faxserver vorzuhalten. Wie schon bei Retarus<br />
WebExpress werden auch hier nur die tatsächlich erbrachten<br />
Leistungen – also die Anzahl der erfolgreich zugestellten Fax-<br />
Seiten – berechnet. Die Betriebskosten bleiben so für den<br />
DSGV stets transparent und kalkulierbar. Dementsprechend<br />
kümmert sich Retarus Fax2Mail um den Empfangsbetrieb von<br />
Telefax-Nachrichten: Fax-Mitteilungen, die an den DSGV gerichtet<br />
sind, werden in den Retarus Rechenzentren empfangen<br />
und von dort an die E-Mail Eingangspostfächer der individuellen<br />
Empfänger im DSGV weitergeleitet. Damit ersparen sich die<br />
Mitarbeiter des DSGV das umständliche nachträgliche Digitalisieren<br />
der Mitteilungen per Scanner: sämtliche Nachrichten<br />
42<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
können unverzüglich bearbeitet, weitergeleitet und archiviert<br />
werden. Auch hier muss der DSGV für jeden Fax-Empfänger<br />
lediglich einen PC mit E-Mail-Zugang vorhalten und braucht<br />
sich nicht mehr um Hardware, Software, Leitungen oder Verbrauchsmaterialien<br />
zu kümmern.<br />
Managed E-Mail Services als Weg<br />
aus der Kostenfalle<br />
Nach der erfolgreichen Integration der Retarus Managed<br />
Fax Services in die Kommunikationsstrategie des DSGV lag der<br />
anschließende Fokus schnell auf der E-Mail Kommunikation<br />
des Verbandes. Auch hier bestand spürbarer Handlungsbedarf,<br />
denn zuvor wurde der Aufgabenkomplex E-Mail komplett in<br />
Eigenregie betrieben. Mit den Managed E-Mail Services steht<br />
dem DSGV nun die komplette Security-Infrastruktur der<br />
Retarus Rechenzentren im 24/7 Betrieb zur Verfügung – also<br />
rund um die Uhr an allen sieben Wochentagen. In finanzieller<br />
Hinsicht erschließt sich dem DSGV durch den professionell gemanagten<br />
Dienst ein beachtliches Kosteneinsparungspotenzial.<br />
Der finanzielle Aufwand für die Bereitstellung der erforderlichen<br />
Bandbreite der Leitungen, für Hardware, Software, Wartung,<br />
Updates etc. fällt in den Zuständigkeitsbereich der retarus<br />
GmbH und wird pauschal abgegolten, so dass auch hier die<br />
größtmögliche Kostentransparenz erreicht wurde. Selbstverständlich<br />
bietet der Einsatz der Managed E-Mail Services auch<br />
ganz handfeste praktische Vorzüge, denn alle eingehenden<br />
E-Mails durchlaufen einen dreifachen Sicherheitscheck: RMX<br />
AntiVirus MultiScan, RMX AntiSpam und RMX Directory<br />
Filter. Im RMX AntiVirus MultiScan wird jede E-Mail von vier<br />
verschiedenen Antiviren-Scannern, die mehrmals täglich aktualisiert<br />
werden, auf Viren und anderen Schad-Code überprüft.<br />
Foto: retarus GmbH<br />
Infizierte E-Mails werden hier sofort gelöscht und der Empfänger<br />
wird per E-Mail über die Löschung informiert, so dass er<br />
gegebenenfalls mit dem Absender Kontakt aufnehmen kann.<br />
Der Spam-Filter RMX AntiSpam schützt die Mitarbeiter des<br />
DSGV vor unerwünschten E-Mail Nachrichten, dem sogenannten<br />
Spam: auch der Anti-Spam-Service von Retarus wird<br />
in Abstimmung mit dem DSGV regelmäßig feinjustiert und<br />
optimiert. Dadurch konnte inzwischen eine Erkennungsrate<br />
von 99,95% erreicht werden. Alle Spam-Mails werden wahlweise<br />
als Spam markiert und zugestellt, oder sie werden in einer<br />
Quarantäne gespeichert. In diesem Fall erhält der Empfänger<br />
täglich eine Übersicht, aus der hervor geht, welche Sendungen<br />
unter Quarantäne gestellt wurden und welche Nachrichten<br />
Schad-Code enthielten. Sollte eine E-Mail irrtümlich als Spam<br />
erkannt worden sein, kann sie bequem per Mausklick aus dieser<br />
Quarantäneliste abgerufen und dem Empfänger zugestellt<br />
werden. Einen wirksamen Schutz vor E-Mails, die von Spam-<br />
Automaten generiert und massenhaft an nicht existierende<br />
Adressaten beim DSGV abgesetzt werden, liefert der RMX<br />
Directory Filter. Hier werden alle eingehenden Mails automatisch<br />
mit den bestehenden Adressbüchern abgeglichen und<br />
nur jene Nachrichten durchgelassen, für die es auch tatsächlich<br />
einen gültigen Empfänger gibt.<br />
Schnelle Lieferung<br />
Ungeachtet der komplexen Funktionalität der Managed<br />
Mail- und Fax-Services erfolgte die Einrichtung dieser<br />
Services in denkbar kurzer Zeit: Von der Präsentation bis zum<br />
vollständigen Rollout der Lösungen im März <strong>2008</strong> vergingen<br />
knapp fünf Monate, von denen der Löwenanteil darauf verwendet<br />
wurde, die Dienste genau auf die Belange des DSGV<br />
abzustimmen. Ein weiterer Monat war dem Testbetrieb vorbehalten.<br />
Hier wurden alle Services gründlich in einem kleinen<br />
Anwenderkreis getestet und gingen im Anschluss unmittelbar<br />
in den Live-Betrieb über. Seit März <strong>2008</strong> sind insgesamt drei<br />
Domains mit rund 800 E-Mail-Konten an das System angeschlossen<br />
und arbeiten ohne Beanstandung. Seit April <strong>2008</strong><br />
wird im Verband auch der Retarus SMS-Messenger als zusätzliches<br />
Informationssystem genutzt. Dieses kleine Desktop-<br />
Werkzeug erlaubt es, SMS-Nachrichten bequem und ohne langes<br />
Klicken vom PC an ein oder mehrere Handys zu versenden.<br />
Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV)<br />
ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe. Seine Mitarbeiter<br />
vertreten an den Standorten Berlin, Bonn und Brüssel die<br />
Interessen von 446 Sparkassen, sieben Landesbank-Konzernen,<br />
zehn Landesbausparkassen, zwölf regionalen, öffentlichen<br />
Erstversicherern sowie weiteren Finanzdienstleistungs-Unternehmen<br />
wie etwa der DekaBank Deutsche Girozentrale oder<br />
der Deutschen Leasing Gruppe. Insgesamt umfasst der Finanzverbund<br />
der Sparkassen-Finanzgruppe 630 Unternehmen und<br />
beschäftigt etwa 377.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2007 erreichte<br />
die Sparkassen-Finanzgruppe eine kumulierte Bilanzsumme<br />
von rund 3.600 Milliarden Euro. Verantwortlich für diesen Erfolg<br />
der Sparkassen-Finanzgruppe ist die optimale Kombination<br />
aus Unternehmensgröße bei gleichzeitig dezentraler Aufgabenorientierung<br />
der rund 22.200 Geschäftsstellen.<br />
❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
43
Fotos: Swift<br />
Von Bank zu Bank<br />
Vom 15. bis 19. September <strong>2008</strong> hatte die Sibos in Wien ihre Tore geöffnet und 245 Ausstellern die Möglichkeit<br />
gegeben, sich mit teilweise beeindruckenden Ständen zu präsentieren. Neben Banken waren auf der von SWIFT<br />
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) getragenen Messe Anbieter von Lösungen für die<br />
Branche vertreten.<br />
Mit überproportionaler Anwesenheit zeichneten sich die<br />
USA und Großbritannien aus, an außereuropäischen Ländern<br />
zeigten Indien, Japan, Russland und Singapore recht rege Tätigkeit.<br />
Europäische Stände kamen darüber hinaus aus Belgien,<br />
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,<br />
Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Rumänien,<br />
Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien, und Slowakische<br />
Republik. Des Weiteren zeigten sich Jordanien, die Türkei und<br />
die Ukraine. Aus Übersee auch gekommen waren Australien,<br />
Brasilien China, Indonesien und Kanada. Die „Repräsentanz“<br />
für Afrika kam aus Südafrika.<br />
Angesichts eines immer mannigfaltiger werdenden Publikums<br />
sprechen die Inhalte der gebotenen Vorträge, Konferenzen,<br />
Diskussionsrunden und Foren unterschiedliche Fragestellungen<br />
– von dem Aufeinanderprallen von Hedge Fonds und Investment<br />
Managern über Banking und Electronic Clearing im Mittleren<br />
Osten bis zur Corporate Social Responsibility – sowie spezifische<br />
Marktsektoren an. Beleuchtet werden die Themen sowohl von<br />
innerhalb als auch außerhalb der Sichtweise der Finanzindustrie.<br />
Mit SWIFT @ Sibos bestreitet Swift eine eigene Reihe, um dem<br />
Publikum das Wesen, die Möglichkeiten und Vorteile von Swift<br />
näher zu bringen. Für eine Teilnahme spielt die Verwendung<br />
dieses Formats natürlich eine Rolle – bei afrikanischen Banken<br />
z. Bsp. ist es noch gar nicht etabliert (allerdings wurde 2007<br />
Swift Johannesburg eröffnet) – aber auch das Volumen des Auslandsgeschäftes<br />
und die Kategorie der Klientel.<br />
Es ist eine Messe der Kontakte, des Knüpfens und Pflegens<br />
von ihnen. Zahlreiche Banken und Unternehmen, die keinen<br />
Stand eingerichtet haben, schicken ihre Vertreter, die Terminkalender<br />
wurden bereits im Vorfeld gefüllt. Die – unter anderem –<br />
Zeit- und Reisekostenersparnis macht die Teilnahme an der<br />
Sibos attraktiv.<br />
▲<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
45
Network Management, Erste Group, als Gruppe, die durch Zukäufe<br />
nun mit vielen verschiedenen Softwaresystemen zurechtkommen<br />
muss und diese vereinheitlichen möchte, auf der Suche<br />
nach neuen technischen Lösungen, wobei der Partner aufgrund<br />
der Anforderungen an Sicherheit und Servicierbarkeit nicht zu<br />
klein sein darf. Ebenso sind die Börsen anwesend, die mit der<br />
Konkurrenz neu entstehender Börsenplattformen zu kämpfen<br />
haben. Dies bedeutet auch eine Neuausrichtung der Banken, die<br />
den Volumina folgen, Nischenprodukte suchen und ihren Weg<br />
neu finden müssen.<br />
Partnerschaften<br />
So ist die Oberbank zum ersten Mal mit der BKS Bank<br />
gemeinsam auf der Sibos mit einem Stand präsent um die<br />
Position der 3-Banken-Gruppe (Oberbank, BKS und BTV) zu<br />
demonstrieren. Sie sind im begleitenden Kundengeschäft tätig,<br />
operieren mit einem Filialnetz, sind mit Geschäftsstellen und<br />
Repräsentanzen in den um Österreich liegenden Ländern sowie<br />
in Kroatien vertreten. Mit 2500 Bankpartnern weltweit ist es<br />
nicht verwunderlich, dass innerhalb von vier Tagen mehr als 140<br />
offizielle Meetings – 75 Prozent davon mit bestehenden Bank-<br />
Verbindungen – auf der Sibos stattfanden. Es kommen jedoch<br />
auch außer Protokoll Banken, wie zum Beispiel „standlose“<br />
aus Kasachstan, auf die Gruppe zu, so Manfred Weissmann,<br />
General Manager, Deputy Head of Global Financial Markets,<br />
Head of Financial Institutions, Oberbank AG.<br />
Als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im<br />
Bereich Commercial Banking ist die Deutsche Bank Partner<br />
der Oberbank. Den Nutzen daraus fasst Stefan Viertel, Vice<br />
President, Cash Management Financial Institutions, Austria<br />
and CE, Deutsche Bank, in der Erhöhung der Reichweite<br />
der Oberbank zusammen. Cash Management, Wertpapiergeschäfte,<br />
Abwicklung von Transaktionen von Wertpapieren,<br />
Liquiditätsmanagement, Checkservices, Reportingservices oder<br />
weltweites Clearing (Euro plus sämtliche Fremdwährungen)<br />
stellen die Kernkompetenz des Hauses dar – in dieses Business<br />
wird sowohl Geld als auch Personal (für den wichtigen Punkt<br />
Relationship) investiert.<br />
Neue Wege<br />
Die Erste Bank war bisher mit drei bis fünf Personen auf<br />
der Sibos vertreten. Nun in Wien möchten sie sich als Bankengruppe<br />
und vor allem ihre CEE Kompetenz und entsprechenden<br />
Angebote den anderen anwesenden Banken präsentieren.<br />
So suchen sich beispielsweise eine HSBC oder die Skandinavier,<br />
aber auch kleine deutsche Banken, weil es für sie ansonsten zu<br />
teuer kommt, einen Partner, der in CEE bereits etabliert ist und<br />
sie im Wertpapiergeschäft und /oder Zahlungsverkehr in dieser<br />
Region unterstützen kann. Preise werden auf der Messe nicht<br />
diskutiert, sondern das Geschäft publiziert, ein Überblick gegeben.<br />
Sie selbst sind, so Alexander Schleifer, Head of Custody&<br />
Selbstdarstellung<br />
Die fünf Relationship Manager, so Dr. Harald Raffay,<br />
Head of Financial Institutions & Syndications, BAWAG.PSK,<br />
sind im Stundentakt mit Terminen eingeteilt. Ist ein spezielles<br />
Produkt Thema, ist auch der entsprechende Verantwortliche dabei.<br />
Auch sie nützen die große Messe der Relationship Manager<br />
sowohl als Informationsplattform und Überblick über die<br />
diversen Angebote bezüglich Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft,<br />
Leasing, IT oder Syndizierungsgeschäft als auch<br />
zur Geschäftsanbahnung – die Gespräche werden bei den<br />
abendlichen Empfängen fortgesetzt, auch im Sinne des immer<br />
wichtiger werdenden „know your customer“. Wie viel in eine<br />
Präsenz investiert wird, ist nicht nur eine Frage des Geldes,<br />
sondern auch des Selbstverständnisses des Institutes und der<br />
beabsichtigten Werbewirksamkeit. Inklusive des zu gebenden<br />
Empfanges muss mit Kosten zwischen Euro 100.000, wobei dies<br />
einen sehr bescheidenen Level darstellt, und Euro 500.000<br />
gerechnet werden. Für Harald Raffay ist dies das best angelegte<br />
Geld einer Bank.<br />
Vielfältigkeit<br />
Grundsätzlich Ideenbringer für den Stand der RZB war<br />
Direktor Günther Gall, Bereichsleiter Transaction Services, der<br />
seit 1988 an der Sibos teilnimmt und Österreich im Swift-Board<br />
vertritt. Auch für ihn sind die Ersparnis von Zeit und Reisekosten<br />
sowie die vielfältigen Kontaktmöglichkeiten das schlagende<br />
Argument für die Teilnahme. Umso interessanter wird die<br />
Fotos: Swift<br />
46<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Plattform, als sie nicht mehr nur ein Interbankendiskussionsmarktplatz,<br />
sondern zusätzlich ein Firmenkundenmarktplatz geworden<br />
ist. Weltweit nutzen bereits zirka 380 Firmenkunden,<br />
die zwar nicht mit Ständen, aber doch anwesend sind, Swift und<br />
stellen nun ebenfalls ihre Forderungen. Es werden jedoch nicht<br />
nur Standardisierung und operationale Systeme und Prozesse<br />
diskutiert, sondern auch Marktrisken, Systemkrisen und aktuelle<br />
Finanzindustrieprobleme, und zwar auf einem hohen Level.<br />
Dies macht die Veranstaltung auch für die leitenden Angestellten<br />
der Banken interessant – 22 Prozent Senior Vice<br />
Presidents und 6 Prozent CEOs waren anwesend.<br />
Auch die RZB vereinbarte im Vorfeld Termine mit Banken<br />
und Firmenkunden. Potentielle Kunden gibt es im Custodygeschäft.<br />
Diese Kontakte werden auf der Sibos entweder initiiert<br />
oder, wenn Gespräche bereits stattgefunden haben, weiter<br />
gepflegt. Denn sowohl im Custody als auch Cash Management<br />
zieht sich der Prozess, einen Kunden zu gewinnen, oft von<br />
einem halben Jahr bis hin zu zwei Jahren. Dabei ist es bezüglich<br />
Custody enorm hilfreich, dass die RZB heuer als einzige österreichische<br />
Custody Provider Bank im Top Rating des Global<br />
Custodian gelistet ist.<br />
Internationalität<br />
Mit ihren Produkten für das Transaktionsgeschäft soll den<br />
östlichen Banken der Zugang zur westlichen Hemisphäre<br />
eröffnet werden und den westlichen Banken der Zugang zu<br />
Osteuropa. Die RZB versteht sich als eine Emerging Market<br />
Bank, die nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Asien präsent<br />
ist – mit Filialen in Peking und Singapur sowie Niederlassungen<br />
in Hongkong, Seoul und Mumbai. Diese beiden Märkte bieten<br />
interessante Potentiale und Margen aufgrund der Marktentwicklung,<br />
in den Ensure Markets sind die großen Namen<br />
etabliert, wodurch man lediglich in den Verdrängungswettbewerb<br />
gehen kann, der eine sehr teure Angelegenheit ist, die<br />
wenig Gewinne abwirft. Derzeit gearbeitet wird an einer Bank<br />
in Kasachstan, wobei der Aufbau Sache der Raiffeisen International<br />
ist. Ist dieser abgeschlossen, stellt die RZB jene Produkte,<br />
die benötigt werden – für den Aufbau des Zahlungsverkehrs, die<br />
Eröffnung von Konten etc. –, zur Verfügung. Über die Informationen<br />
rechtlicher Rahmenbedingen verfügen die Mitarbeiter<br />
vor Ort. Ein starker Boom ist auch Russland mit CIS, wo die<br />
RZB – in Osteuropa ist sie hauptsächlich eine Retailbank –<br />
über ein starkes Filialnetz verfügt, das auch in die Regionen und<br />
dort in die wichtigen Industriegebiete verzweigt ist.<br />
Zukunftsgeld<br />
In einigen Ländern im östlichen Europa haben 90 Prozent<br />
der (potentiellen) Privatkunden (noch) kein Konto und die<br />
Märkte in der gesamten Region sind bargeldorientiert. Hingegen<br />
sieht Günther Gall den Gegensatz Karten – oder Bargeldzahlung<br />
in Österreich als Generationenkonflikt. Die jüngere<br />
Generation tendiere eindeutig zur Karte und berücksichtigt<br />
man, dass es in Asien Internetgeld gibt, mit dem bereits Kinder<br />
hantieren, sollte man auf die Kinder hören, wenn man beurteilen<br />
will, wie sich der Zahlungsverkehr der Zukunft gestalten wird.<br />
Die Sibos 2009 wird vom 14. bis 18. September in Hong<br />
Kong stattfinden.<br />
❙<br />
Da die Statistik für Wien zu Redaktionsschluss noch<br />
nicht ausgearbeitet war, hier, um ein Bild zu bekommen,<br />
die Zahlen von Boston. In Wien wurden 8.000 bis 10.000<br />
Besucher erwartet.<br />
Primary market focus in %<br />
Payments 43.1<br />
Securities 23<br />
Cash management 16.8<br />
Trade services 10.8<br />
FX/MM 4<br />
Derivatives 2.3<br />
Function in %<br />
MD/Director/EVP 26<br />
VP/Functional Head 24<br />
Departmental Manager 21<br />
Account Manager 10<br />
Section Head/Supervisor 9<br />
Board member/CEO 8<br />
Operator/Technician 2<br />
Regions in %<br />
Europe 49<br />
Americas 34.5<br />
Asia Pacific 10.5<br />
ME & Africa 6<br />
Primary responsibility in %<br />
Business development/strategy 25.8<br />
Sales 21.4<br />
Other 16.9<br />
Operations 12.7<br />
IT/Technology 12.4<br />
Marketing 9.7<br />
Standards 1.1<br />
Primary nature of institution in %<br />
Commercial Bank 41.9<br />
Software supplier/consultancy 30.3<br />
Investment Bank 8.2<br />
Central Bank 4.7<br />
Corporate 4.5<br />
Market Infrastructure 3.3<br />
Investment Management 2.8<br />
Exchange/CSD 2.5<br />
Broker/Dealer 1.6<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
47
Europäisches Forum Alpbach<br />
Bankenseminar <strong>2008</strong><br />
In zahlreichen Referaten wurden die bestimmenden Erfolgsfaktoren der Bankenbranche analysiert. Dabei ging es<br />
nicht nur um die beiden wichtigen Kundensegmente „Privatkunden“ und „Firmenkunden“. Wichtigste Themen waren<br />
die Auswirkungen der Subprime Krise und die neuerliche Reformierung der Finanzmarktaufsicht.<br />
von DionR. Norbert Sasse, SG-I<br />
Risikomanagement im Lichte der aktuellen Situation<br />
Seinen einleitenden Vortrag widmete Mag. Andreas Ittner,<br />
Mitglied des Direktoriums der OeNB dem Thema „Risikomanagement<br />
im Lichte der aktuellen Situation“. Risiko ist kein<br />
vermeidbares Übel, sondern zentraler Gegenstand jedes Bankgeschäftes.<br />
Risikomanagement ist somit eine Kernaufgabe des<br />
Bankensystems und bringt Nutzen für Kreditnehmer und Einleger<br />
sowie für Kapitalgeber. Moderne Risikomanagementsysteme<br />
zwingen zur strukturierten Erfassung von Risken und<br />
erlauben die Bemessung der Zusammenhänge zwischen einzelnen<br />
Geschäften und Risikoarten. Kein System kann mit seinen<br />
Modellergebnissen jedoch mehr als eine Entscheidungsgrundlage<br />
liefern. Ittner kam auch auf die aktuelle Situation zu sprechen<br />
und erklärte, dass die schwierigen Rahmenbedingungen wohl<br />
noch anhalten werden und dass die Intensität der Rückkopplungseffekte<br />
mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung noch<br />
unklar sei. Ittner gab die Einschätzung des Internationalen<br />
Währungsfonds (IWF) wieder, nach der sich die Wertabschreibungen<br />
auf 950 Mrd. Dollar belaufen. Der Großteil entfalle<br />
dabei auf Wertpapiere, rund 500 Mrd. Dollar seien von den<br />
Banken abgeschrieben worden. Vermutlich aufgrund des hohen<br />
CEE Engagements kommen Österreichs Banken mit Wertberichtigungen<br />
von 2 Mrd. Euro vergleichsweise glimpflich davon.<br />
Ein Ende der Krise ist derzeit noch nicht abzusehen.<br />
Interview von Eva Komarek und Thomson Reuters<br />
mit David Roberts MBA, Generaldirektor der<br />
BAWAG PSK<br />
„Ich bin zur BAWAG gekommen um sie wieder erfolgreich<br />
am Markt zu machen. Die Mitarbeiter der Bank haben eine<br />
schwierige Zeit hinter sich und wollen nun wieder ungestört<br />
arbeiten. Es bestärkt sie zu sehen, dass Investments getätigt und<br />
neue Programme gestartet werden. Ja, es geht auch um die<br />
Reduktion von 400 Arbeitsplätzen, die soll jedoch freiwillig erfolgen,<br />
es laufen derzeit Umschulungsaktionen und Gespräche<br />
mit dem Betriebsrat. Ich bin erstaunt darüber, wie schnell wir die<br />
Probleme hinter uns gelassen haben.“ Bei den Einlagen hat die<br />
Bank bereits um 250 Mio. Euro zugelegt. Wachstumspotential<br />
sieht Roberts im Hypothekengeschäft, im Zahlungsverkehr, im<br />
Kommerzgeschäft und im Direkt Banking. Ziel ist es, das Image<br />
der Bank zu verbessern und eine vernünftige Balance zwischen<br />
den Interessen der Mitarbeiter, der Kunden und der Aktionäre<br />
zu finden. Das vorhandene CEE Geschäft war zu klein um es<br />
erfolgreich auszubauen, das bedeutet jedoch nicht, dass sich<br />
die BAWAG nicht im Ausland engagieren möchte. In welchen<br />
Ländern dieses Engagement erfolgen soll, blieb offen. „Wir<br />
haben derzeit ein sehr starkes Team und planen in fünf Jahren<br />
einen Gewinn von 500 Mio. Euro.“ Ob dann noch Roberts an<br />
der Spitze der Bank ist, konnte nicht geklärt werden.<br />
Mag. Dr. Peter BOSEK, Vorstandsdirektor, Erste Group Bank AG. „Verkauf ist auch<br />
heute noch für viele Bankmitarbeiter tendenziell unseriös, diese Ansicht ist falsch.“<br />
Mag. Michael Ikrath, Abgeordneter zum Nationalrat; Generalsekretär Österreichischer<br />
Sparkassenverbandes. „Die Prüfverfahren sollen effizienter gestaltet werden.“<br />
48<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Fotos: © Copyright <strong>2008</strong> SGI<br />
David Roberts MBA, Generaldirektor der BAWAG<br />
PSK. „Mein Job ist es soviel Mitarbeiter wie möglich zu<br />
halten und die Bank profitabler zu machen.“<br />
Dr. Kurt Pribil, Vorstandsdirektor, Österreichische<br />
Finanzmarktaufsichtsbehörde.“ Es kann nicht sein, dass<br />
Strafbescheide nicht zustellbar sind, weil es keine<br />
österreichische Zustelladresse gibt.“<br />
Dr. Herbert Pichler, GF Bundessparte Bank und<br />
Versicherung, WKO, Wien. „Die Umsetzung zu vieler<br />
Richtlinien schafft Probleme, die Institute fordern eine<br />
regulatorische Pause.“<br />
Retailbanking:<br />
Auslaufmodell oder Hoffnungsträger?<br />
„Bei der Subprimekrise ging und geht es nicht nur um faule<br />
Hypotheken, sondern auch um ein falsches Verständnis des<br />
Bankenmodells“, meinte Mag. Dr. Peter Bosek, Vorstandsdirektor,<br />
Erste Group Bank AG, in seinem Vortrag. In den letzten<br />
beiden Jahrzehnten war die Bankenindustrie eine Wachstumsmaschine.<br />
Manche Banken haben Geschäftsmodelle entwickelt<br />
die kaum „Kunden“ benötigt haben, sie haben sich vom Kunden<br />
wegentwickelt. Jetzt erleben wir eine Renaissance des Retail<br />
Bankings. Banken die, wie die Erste Bank, an einer klaren und<br />
an den Kunden ausgerichteten Strategie festgehalten haben, sind<br />
letztlich die Gewinner. Der Unternehmenszweck muss perfekt<br />
definiert und kommuniziert werden. Ein Verständnis der Kundenwünsche<br />
und ein professioneller Verkauf sind Erfolgsgaranten<br />
eines kundenorientierten Retailbankenmodells. Vertrauen des<br />
Kunden ist jedoch das wichtigste Asset, die Banken sind in den<br />
letzten Jahren oft leichtfertig damit umgegangen. Der Erfolg<br />
benötigt aber auch eine einwandfreie Umsetzung. Letztlich sind<br />
es die Verkaufsfähigkeiten der Mitarbeiter, die klaren Rollendefinitionen,<br />
die sauberen Prozesse und das aktive Verkaufsmanagement,<br />
die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.<br />
Erfolgsfaktoren der Aufsicht<br />
Herr Vorstandsdirektor Dr. Kurt Pribil, Österreichische<br />
Finanzmarktaufsichtsbehörde, eröffnete seinen Vortrag mit der<br />
Feststellung, dass eine – oft geforderte – effiziente und erfolgreiche<br />
Aufsicht nur dann möglich ist, wenn die vorgelagerten<br />
Aufsichtsinstanzen, wie interne Revision, Aufsichtsrat und<br />
Wirtschafts-/Bankprüfer, funktionieren. Wesentliche Bedeutung<br />
kommt den gut ausgebildeten Mitarbeitern, der gesetzlichen<br />
Grundlage und der ständigen Weiterentwicklung zu. Die mit<br />
Beginn des Jahres in Kraft getretene Aufsichtsreform ist nicht<br />
weit genug gegangen. Pribil ist der Ansicht, dass es beispielsweise<br />
unzureichende Regelungen bezüglich der Konsolidierung von<br />
Stiftungen und zum Risikotransfer an Stiftungen gibt. Im UGB<br />
fehlen verbindliche Bilanzierungsregelungen derivative Produkte<br />
und Hedging betreffend. Ebenso bieten die allgemeinen Regelungen<br />
wenig Ansatzpunkte für die Erfassung und Bewertung abgegebener<br />
Garantien. Das neue – in Diskussion stehende – Auf-<br />
Mag. Andreas ITTNER, seit 1. Sept. <strong>2008</strong> Mitglied des Direktoriums der<br />
Oesterreichischen Nationalbank im Gespräch mit Dr. Peter Steiner, Vorstand, Institut<br />
für Banken und Finanzierung, Karl-Franzens-Universität Graz. „Das Risiko war<br />
intransparent, die Banken haben sich aufeinander verlassen.“<br />
sichtspaket enthält zusätzliche Möglichkeiten und Maßnahmen.<br />
Darunter fallen: Das Recht auf Hausdurchsuchung und Beschlagnahme,<br />
erweiterte Auskunftsrechte zur Beweissicherung,<br />
die Vereinfachung des Verfahrens zur Abberufung eines Geschäftsleiters<br />
bei massivem Zweifel an der Zuverlässigkeit, die<br />
verpflichtende Nominierung eines Zustellbevollmächtigten im<br />
Inland, eine erhöhte Transparenz im Sinne des Anlegerschutzes,<br />
eine angemessene Erhöhung der Strafrahmen sowie kapitalmarktorientierte<br />
Kommunikationsbestimmung für die FMA.<br />
Es ist klar, dass nicht alle diese – undiskutierten – Vorschläge<br />
ungeteilte Freude bei den betroffenen Instituten finden.<br />
Dr. Herbert Pichler, GF Bundessparte Bank und Versicherung,<br />
WKO Wien, unterstreicht sein großes Interesse an einer<br />
effizienten Aufsicht und bietet konstruktive Mitwirkung an der<br />
Aufsichtsdebatte. Bezüglich der auf österreichische Banken hereingebrochnen<br />
Regulierungswelle betonte Pichler einmal mehr,<br />
dass die Gefahr einer Überregulierung der Banken bestehe.<br />
Künftig sei eine besondere Zielgenauigkeit bei regulatorischen<br />
Maßnahmen erforderlich. Zu viele Richtlinien schaffen Probleme,<br />
ein Goldplating, d.h. über das notwendige Ausmaß hinausgehende<br />
landespezifische „Ergänzungen“, sieht er als Gefahr. ❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
49
7 th PRIVATE BANKING SUMMIT<br />
NAVIGATING THROUGH TURBULENT TIMES<br />
Jean Pierre Cuoni, EFG International. „Unsere Client<br />
Relationship Officers sind erfahrene und professionelle<br />
Fachleute, die im Jahr 30 Mio. CHF Geschäft im Jahr<br />
generieren.“<br />
Chris Meares, CEO, Group Private Banking, HSBC.<br />
„Auch im Private Banking ist das Verhältnis der Kosten<br />
zum Ertrag (Cost : Income Ratio) der wesentliche<br />
Performance Indikator.“<br />
EUROFORUM Handelszeitung Konferenz AG<br />
2. und 3. September <strong>2008</strong> Renaissance Hotel, Zürich-Glattpark<br />
von DionR. Norbert Sasse, SG-I<br />
Anregende Podiumsdiskussionen ließen wenig Fragen<br />
offen. Im Bild: v.l. Koos Vink, Van Lanschot Bankiers<br />
S.A., Joachim H. Straehle, CEO Bank Sarasin & Cie<br />
AG, Basel, und Dr. Leo Thomas Schrutt, Head of<br />
Wealth Management & Investment, Stanford Group<br />
(Suisse) AG, Zürich.<br />
Privatbanken sind bisher durch die Subprime Krise nur geringfügig<br />
betroffen, die Talsohle ist jedoch noch nicht erreicht,<br />
so Teodoro D. Cocca, Professor für Asset Management an<br />
der Johannes Kepler Universität Linz in seinem einleitenden<br />
Vortrag. Die Krise hat gezeigt, wie schnell Banken Geld verlieren<br />
können und sie zwingt die Banken ihre Strategie von<br />
Wachstum auf Kostenreduktion zu ändern. Das Gesamtumfeld<br />
ist für Privatbanken derzeit überaus schwierig. Dafür gibt es<br />
mehrere Gründe, zunächst natürlich die Subprime Krise, aber<br />
auch der geringere Konsum und die Rezession in den USA sowie<br />
die gebremste Entwicklung der Weltwirtschaft. Die Wachstumsraten<br />
der Schweizer Privatbanken sind im vergangenen Jahr<br />
sowohl im Onshore als auch und noch mehr im Offshore<br />
Bereich gesunken, das bedeutet jedoch nicht, dass „Offshore“<br />
nicht für kleinere Institute weiterhin interessant ist.<br />
Schlussfolgerungen aus der Krise<br />
Robert Parker, Vice Chairman of Asset Management bei der<br />
Credit Suisse, brachte in seinem Vortrag Ausblick und Schlussfolgerungen<br />
auf den Punkt. Das Geschäft der Privatbanken<br />
zeigt naturgemäß eine starke Abhängigkeit von den jeweiligen<br />
Rahmenbedingungen. Die Wirtschaft, aber auch die geopolitische<br />
Situation darf dabei nicht außer Acht gelassen werden.<br />
Alle politischen Entwicklungen, ob es die Krise in Georgien ist,<br />
der Wechsel des Premierministers in Japan oder die Situation in<br />
Thailand, das alles hat Einfluss auf den Markt. Was die Zukunft<br />
anlangt, ergeben sich aus heutiger Sicht einige Konsequenzen<br />
für Privatbanken. Grundsätzlich bleiben die Wachstumserwartungen<br />
der Branche attraktiv, wenn es gelingt dem Kunden<br />
einen klaren Nutzen zu geben. Das betrifft sowohl die Performance<br />
als auch die Produktinnovation. Transparenz und<br />
Risikomanagement stehen dabei im Vordergrund. Die Wachstumsentwicklung<br />
in den „Emerging Markets“ bleibt weiterhin<br />
positiv. Privatbanken werden sich künftig stärker auf das Beratungsmodell<br />
konzentrieren. Der Konsolidierungsprozess geht<br />
weiter. Die Chancen für „Boutiquen“ sind als positiv zu bewerten.<br />
Es ist mit einer sinkenden Kundenloyalität zu rechnen.<br />
Es stehen uns zumindest 6 – 12 Monate Rezession bevor. Es ist<br />
anzunehmen, dass der Ölpreis weiter nach unten geht und der<br />
US Dollar gegenüber dem Euro aufholt. Der Euro ist viel zu<br />
hoch bewertet, das stellt ein wirtschaftliches Problem dar.<br />
50<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Ein neues Geschäftsmodell<br />
Die EFG Bank mit Hauptsitz in Zürich wurde erst 1995 gegründet<br />
und ist heute eine globale Gruppe, die Private-Bankingund<br />
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Zurzeit<br />
sind die unter EFG International zusammengeschlossenen<br />
Privatbanken an 50 Standorten in mehr als 30 Ländern tätig<br />
und beschäftigen 2175 Mitarbeiter. Die verwalteten Kundenvermögen<br />
(inkl. angekündigter Akquisitionen) betrugen CHF<br />
98.3 Mrd. per 31.12. 2007, was einem Anstieg im Jahresvergleich<br />
um 34% entspricht. Von Moody's wird die Bank mit<br />
einem Rating von „A2“ und von Fitch Ratings mit „A“ bewertet.<br />
EFG International erzielte im Jahr 2007 erneut einen<br />
Rekordgewinn. Jean Pierre Cuoni, Chairman of the Board, berichtet<br />
in seinem Vortrag: „Wir erobern die Märkte mit unserem<br />
besonderen Geschäftsmodell, das ist die Ursache unseres ungebrochenen<br />
Wachstums. Marktanteile und Größen sind für uns<br />
nicht von Bedeutung, was zählt, ist der lokale Vertrieb in<br />
den Ländern. Der Kunde kauft nicht von der Bank, sondern von<br />
einer Person.“ Das Geschäftsmodell der EFG basiert auf der<br />
hohen Eigenverantwortung der Client Relationship Officers<br />
(CRO), sie sind für das Geschäft verantwortlich und entscheiden<br />
selbstständig über Preise und Margen.<br />
Mit Spannung verfolgen die Teilnehmer die Diskussionen.<br />
Fotos: © <strong>2008</strong> Euroforum Handelszeitung Konferenz AG<br />
Das Jahrzehnt der Finanz Krisen<br />
„Die größte Finanzkrise der letzten Jahrzehnte, die Immobilienkrise<br />
in den USA, wurde durch ein Regierungsprogramm<br />
verursacht, das die Allgemeinheit zu hohen Investitionen und<br />
damit verbundenen Hypotheken veranlasste“, führte Herr Andreas<br />
Huebner, Senior Managing Director, Lazard Asset Management<br />
GmbH, Frankfurt, in seinem Referat aus. „Die Spekulation mit<br />
diesen Schulden führte uns zu dieser Situation, deren Ende noch<br />
nicht absehbar ist. Heute sehen wir uns unter anderem auch<br />
dem Problem gegenüber, dass die Riskmanager der Institute<br />
Kredite ablehnen und dadurch mögliche Geschäfte verhindern.<br />
Prof. Teodoro D. Cocca im Gespräch im Gespräch mit Claudio Frehner, Director<br />
Corporate Business Development, Bank Vontobel AG. „Niemand hat die dramatischen<br />
Veränderungen des Jahres <strong>2008</strong> vorausgesehen, wir werden uns an dieses Jahr als eines<br />
der schwierigsten in der Geschichte des Bankwesens erinnern.“<br />
Krisen entstehen immer dann, wenn Leute zuviel Geld haben<br />
und damit in einer verrückten Weise spekulieren. Vertrauen und<br />
Verantwortung ist die einzige vernünftige Geschäftsgrundlage.“<br />
Die gegenwärtigen Entwicklungen im Private Banking sind<br />
Inhalt eines Workshops, der am 3. Juni 2009 im Rahmen des<br />
Retail Banking Forums 2009 stattfinden wird. Veranstalter ist<br />
die Studiengesellschaft für Vertriebs-Innovation.<br />
❙<br />
MANAGEMENT SYMPOSIUM<br />
Studiengesellschaft für Vertriebs-Innovation<br />
„RETAIL BANKING FORUM 2009“<br />
4. und 5. Juni 2009 in Wien, Hotel Schloss Wilhelminenberg, 1160 Wien, Savoyenstr. 2<br />
• SB-Technologie<br />
• Zahlungsverkehr<br />
• Vertrieb<br />
*gilt für Buchungen bis 31.12.<strong>2008</strong><br />
SPECIAL:<br />
am 3. Juni 2009<br />
Private Banking<br />
jetzt buchen und<br />
€ 100,– sparen*<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
51
Gelungene Koordination<br />
Am 29. August <strong>2008</strong> feierte die Raiffeisen Informatik mit den langjährigen technischen Kollegen der<br />
Raiffeisenbanken im Rahmen eines ideenreich gestalteten Festes das 25-jährige Bestehen „EDV Koordinatoren“.<br />
Der EDV Koordinator nimmt in den Raiffeisen Bankstellen<br />
eine wichtige Rolle ein. Er ist für alle Belange hinsichtlich<br />
Informationstechnologie in seiner Bankstelle verantwortlich und<br />
diesbezüglich Ansprechpartner für den Kundenbetreuer der<br />
Raiffeisen Informatik. Die Zusammenarbeit zwischen den<br />
Rechenzentrumsmitarbeitern und den EDV-Koordinatoren<br />
zeichnet sich durch die ausgeprägte Team- und Lösungsorientierung<br />
auf beiden Seiten aus. Und dies nunmehr schon seit<br />
25 Jahren. Dieses Jubiläum nahm die Raiffeisen Informatik zum<br />
Anlass, um ihre Kunden für die langjährige und zielorientierte<br />
Zusammenarbeit zu danken.<br />
Direktor Josef Buxbaum ließ diese Zeit auf, wie er selbst<br />
bemerkte, seriöse Weise Revue passieren.<br />
Arbeit …<br />
Bis zu Anfang der 80er Jahre waren die IT-Anwendungen<br />
auf reinen Batch-Betrieb beschränkt und nur einzelne Personen<br />
bzw. Abteilungen waren davon betroffen. 1982, in dem Jahr, als<br />
sich Österreich in einer Volksabstimmung gegen das Konferenzzentrum<br />
der UNO-City aussprach, bereitete das damalige<br />
Raiffeisen Rechenzentrum bei gleichzeitiger Forcierung der<br />
Online-Verbreitung den Einsatz von GEBOS (Generelles<br />
Banken Online System) vor. Involviert waren durch die Größe<br />
des Projekts um einige Abteilungen mehr als zuvor – somit war<br />
Koordinationsbedarf gegeben. Die Funktion des sogenannten<br />
EDV-Koordinators wurde initiiert und dessen Einführung<br />
beschlossen. Ein Jahr später – der Papst besuchte erstmals<br />
Österreich – fand die erste Informations-Seminar-Reihe quer<br />
durch alle EDV-Aspekte statt. Mit der zunehmenden Durchdringung<br />
der IT in alle Bereiche ab Anfang der 90er Jahre stieg<br />
auch der Beratungsbedarf durch die Raiffeisen Informatik.<br />
Aufgrund dessen wurde der EDV-Organisations-Berater<br />
(EOB) als Ansprechpartner installiert. Ein ständig zugeordneter<br />
Ansprechpartner steht dem EDV-Koordinator zur Verfügung.<br />
Dadurch können die stets wachsenden Herausforderungen der<br />
IT in den Banken gemeistert werden.<br />
Mag. Hartmut Müller, Geschäftsführer der Raiffeisen<br />
Informatik, blickte in die Zukunft und zeichnete zwei doch<br />
sehr unterschiedliche Szenarien bezüglich IT-Technik und IT-<br />
Markt für das Jahr 2020. Auf dem Weg dorthin muss auch die<br />
Raiffeisen Informatik ihre strategischen Entscheidungen treffen,<br />
wobei Hartmut Müller überzeugt ist, dass zwischen den beiden<br />
Polen der ideale Weg zu finden ist. Open Source wird hinkünftig<br />
laut Müller eine wichtige Rolle spielen. Er hob zudem<br />
den Nutzen von Open Source hervor: Senkung der Lizenzkosten,<br />
Unabhängigkeit in der Weiterentwicklung, einer selbstbestimmten<br />
Systemarchitektur, Aufbau des Know-hows bei den<br />
Mitarbeitern und Wertschöpfung vor Ort.<br />
... und Vergnügen<br />
Einen anekdotischen Streifzugs brachte die Kabarett-<br />
Gruppe „Moxguat“ (drei Raiffeisen Informatik-Mitarbeiter –<br />
unter diesen der Personalchef ) dar. Unterhaltsam und das<br />
Publikum mit einbeziehend ließen sie 25 Jahre IT-Geschichte<br />
Revue passieren. Im Anschluss daran fuhren mit Bussen alle<br />
geladenen Gäste nach Tulln, um dort an Bord der „Prinz<br />
Eugen“ zu gehen. Vom leiblichen Wohl über Unterhaltung bis<br />
zu Spannung war für alles gesorgt. Nach dem Willkommenstrunk<br />
standen Buffet und erfrischendes sowie inspirierendes<br />
Nass zur freien Verfügung. Kubanische Musik und kubanischer<br />
Tanz ließen einen Hauch Exotik durch das Schiff wehen. Die<br />
Beobachtung des Passierens der Schleuse Greifenstein sorgte für<br />
interessiertes Staunen auf Deck.<br />
Eine Stunde vor Mitternacht ging die „Prinz Eugen“ bei der<br />
Reichsbrücke vor Anker, das Fest durfte noch eine Weile ausklingen,<br />
denn die Trennung fiel schwer.<br />
❙<br />
Fotos: Raiffeisen Informatik<br />
25 Jahre EDV-Koordinatoren, v.l.n.r.: Gerhard Koller RBB Jennersdorf,<br />
Dir. Erich Tröscher RB Ybbstal, Dir. Josef Buxbaum Bereichsleiter Raiffeisen<br />
Informatik, Dir. Hartmut Müller Geschäftsführer Raiffeisen Informatik<br />
Donauschifffahrt mit der MS Prinz Eugen<br />
v.l.n.r.: Kapitän MS Prinz Eugen, Franz Elsinger Raiffeisen Informatik, Dir. Josef<br />
Buxbaum Bereichsleiter Raiffeisen Informatik<br />
52<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
FÜHRUNG –<br />
ein Missverständnis<br />
Führungskräfte haben immer Leidensdruck. Viele nennen ihr Gehalt „Schmerzensgeld“.<br />
Wie kommt es dazu? Warum macht Führung so wenig Freude?<br />
von Ruth Seliger<br />
Die Antwort ist einfach und kompliziert zugleich: Über<br />
Führung bestehen Bilder, die aus der Distanz attraktiv und sogar<br />
plausibel wirken, bei Nähe betrachtet aber die Wurzel des Übels<br />
sind. Wer an Führung denkt, denkt an Macht, Einfluss, an den<br />
stolzen Kapitän auf seinem Schiff, an die Möglichkeit, zu lenken<br />
und zu bestimmen.<br />
Wer solche Bilder über Führung hat, scheitert an der<br />
Realität und der Leidensweg beginnt. Wer solche Bilder hat,<br />
sitzt einigen Missverständnisse über Führung auf:<br />
Missverständnis 1:<br />
Die Verwechslung von Führung und Führern<br />
Seit Führung ein Thema der Forschung und der Diskussion<br />
ist – also seit etwa 100 Jahren, davor war Führung gottgewollt<br />
oder über die Mitgliedschaft in einer Herrscherfamilie geregelt –<br />
denkt man dabei vor allem an die Personen, die Führung<br />
ausüben, also an die Führungskräfte, Manager oder wie immer<br />
man sie nennt. Dabei fallen einem archetypische Bilder von<br />
Führungspersonen ein:<br />
✒ Der mächtige Feldherr, der kraft seines Amtes,<br />
seiner Position seine Truppen kontrolliert und befehligt;<br />
✒ Der kluge Experte, der kraft seines Wissens und Wissensvorsprungs<br />
andere befehligen kann;<br />
✒ Der charismatische Held, der alle Menschen fasziniert und<br />
dem alle gern folgen, um ein wenig so zu sein, wie er;<br />
✒ Der fürsorgliche Vater, der Mitarbeiter als „seine Kinder“<br />
beschützt und erzieht.<br />
Alle diese Bilder von Führung und Führern haben aus unterschiedlichen<br />
Gründen ausgedient. Sie funktionieren nicht mehr,<br />
weil sich die Welt und Organisationen verändert haben. Sie<br />
schaden Führungskräften, die versuchen, diesen Bildern zu entsprechen.<br />
Führung wird gern als Merkmal, als Eigenschaft oder<br />
auch nur als Aufgabe von Personen betrachtet. Zweifellos<br />
braucht Führung Menschen, die sie ausüben. Und ohne Zweifel<br />
braucht man für diese Tätigkeit Menschen, die dafür Begabung<br />
mitbringen.<br />
Doch Führung ist vor allem ein Phänomen von Organisationen.<br />
Führung ist das Rückgrat von Organisationen. Führung<br />
ist eine der zentralen Aufgaben in Organisationen und sollte<br />
eher als Aufgabe denn als Eigenschaft gesehen werden. Führung<br />
hat im Wesentlichen zwei große Aufgaben für Organisationen<br />
zu bewältigen:<br />
✒ Menschen an die Organisationen zu binden und sie bei<br />
ihren Leistungsprozessen zu begleiten.<br />
✒ Die innere und äußere Komplexität von Organisationen zu<br />
bewältigen, indem sie Entscheidungen trifft.<br />
Wer Führung mit Führungskräften verwechselt und auf<br />
die Personen reduziert, blendet einen wesentlichen Teil von<br />
Führung aus. Kein Wunder, wenn diese verkürzte Sicht<br />
Führungskräften zu schaffen macht, die die gesamte Last auf<br />
ihren Schultern spüren.<br />
Missverständnis 2:<br />
Führung ist eine lineare Aufgabe<br />
Wer an Führung denkt, hat oft folgendes Bild: Die<br />
Führungskraft entscheidet, ordnet an, Mitarbeiter führen aus.<br />
Der Führungsprozess wird als linearer Vorgang gesehen, der so<br />
funktioniert wie das Ein- und Ausschalten eines Fernsehers: hier<br />
der Knopfdruck „Anweisung“ – dort „Ausführung“.<br />
Wer Führungserfahrung hat, weiß, in der Realität läuft das<br />
nicht so. Das Problem dabei ist vor allem, dass man denkt, es<br />
könnte oder sollte so sein. Wer an dieses lineare Bild glaubt,<br />
fühlt sich bald als erfolglos und leidet.<br />
Führung ist in mehrfacher Hinsicht kein linearer, sondern<br />
ein zirkulärer Prozess:<br />
✒ Wer Menschen führt, weiß, dass die Mitarbeiter insofern<br />
„zurück-führen“ als sie nur unter gewissen Bedingungen<br />
Aufträge ausführen.<br />
Mitarbeiter können auch anders. Wer erfolgreich führt,<br />
weiß, dass er/sie diese Bedingungen kennen und in der<br />
Führungsarbeit bedenken muss. So kann man Führung als<br />
einen zirkulären Prozesse des gegenseitigen Beeinflussens<br />
beschreiben.<br />
✒ Führung ist zugleich ein auf sich selbst gerichtetes Geschäft,<br />
indem Führung auch die Bedingungen des Führens<br />
schafft. Führung entscheidet über Führungsstrukturen, über<br />
Führungskultur, über Entscheidungskompetenzen. Damit<br />
schafft Führung die Rahmenbedingungen, unter denen<br />
Führung stattfindet. Nicht nur die einzelne Führungskraft<br />
muss sich selbst führen, sondern Führung als Teilsystem von<br />
Organisationen<br />
führt sich selbst.<br />
▲<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
53
Wer sich mit Führung beschäftigt, sollte daher einen Blick<br />
für die Wechselwirkungen und zirkuläre Natur von Führung<br />
haben. Wer Führung als linearen Prozess versteht und erwartet,<br />
dass Führung in der Praxis so funktioniert, scheitert an seinen<br />
eigenen Bildern.<br />
Missverständnis 3:<br />
Führung ist das Gegenteil von Arbeit<br />
Wer mit Führungskräften zu tun hat, wird oft zu hören<br />
bekommen: „Wann soll ich denn führen, ich habe doch so viel<br />
Arbeit!“<br />
Für viele Führungskräfte und auch für viele Organisationen<br />
ist Führung das, was man tut, wenn sonst nichts ansteht.<br />
Führungskräfte werden in kaum einer Organisation an ihren<br />
Führungsleistungen gemessen, sondern an ihren operativen<br />
Ergebnissen. Dabei ist Führung die einzige Voraussetzung<br />
für gute Erfolge. Der Charakter von Führung ist der von<br />
„Hausfrauenarbeit“: eine kontinuierliche Aufgabe des Putzens,<br />
Ordnens, Versorgens. Führung schafft Bedingungen und Voraussetzungen<br />
für Leistung.<br />
Viele Führungskräfte haben sich allerdings nicht für einen<br />
Hausfrauenjob beworben. Für sie war die Führungsfunktion<br />
attraktiv, weil sie mit Heldentum, Macht, persönlicher Performance<br />
assoziiert wurde. Hausfrauenarbeit war nicht das<br />
Wunschbild. In der Praxis erleben sich Führungskräfte dann<br />
als Hausfrauen. Und sie bekommen diese Realität mit ihren<br />
eigenen Bildern von Führung nicht unter einen Hut. Das verursacht<br />
Leid.<br />
In meinem Buch „Das Dschungelbuch der Führung“ stelle<br />
ich ausgehend von meiner mehr als zwanzigjährigen Erfahrung<br />
als Beraterin, Trainerin und Coach von Führungskräften ein<br />
Führungsmodell vor, das eine realistische und umfassende Sicht<br />
auf Führung bietet. Mir ist es wichtig, dass Führung als professionelle<br />
Aufgabe in ihrer gesamten Komplexität erfasst werden<br />
kann. Zugleich ist die hohe Komplexität von Führung verwirrend.<br />
Das Führungsmodell „Leadership Map“ bietet Führungskräften<br />
Übersicht und Orientierung in dieser Komplexität.<br />
Die Leadership Map<br />
Die Leadership Map ist eine Landkarte durch den Dschungel<br />
des Führens, die den Anspruch hat, der Komplexität der Aufgabe<br />
gerecht zu werden. Sie soll Führungskräften dabei helfen,<br />
Überblick über ihre Aufgabe zu bekommen und damit auch zu<br />
sehen, was sie gerade nicht sehen – den blinden Fleck. Denn<br />
man kann normalerweise nicht sehen, was man nicht sehen<br />
kann.<br />
Die Leadership Map ist ein Führungsmodell, in das sehr<br />
viele Theorien eingearbeitet sind, die Führungskräften bei ihrer<br />
Aufgabe von Nutzen sein sollen. Sie ist ein Instrument, das die<br />
Aufmerksamkeit auf drei Dimensionen des Führens lenkt:<br />
✒ Führung als Praxis ist die vordergründigste Dimension.<br />
Dabei geht es um die konkreten Aktivitäten des Führens.<br />
Die Aufgaben des Führens differenzieren sich in die drei<br />
Aspekte:<br />
• Sich selbst führen:<br />
Die Kerntätigkeit heißt Reflexion: die eigenen Bilder,<br />
Annahmen, Werte, Ziele, Interessen, Muster permanent<br />
reflektieren. Sich selbst führen bedeutet aber auch Selbstmanagement:<br />
seine Zeit, Aufgaben und Spielregeln zu<br />
gestalten.<br />
• Menschen führen:<br />
Kernaufgabe ist Kommunikation. Menschen zu führen<br />
erfordert Menschenkenntnis und die Fähigkeit, sich in<br />
Beziehung zu setzen.<br />
• Die Organisation führen:<br />
Hier geht es vor allem um die Tätigkeit des Entscheidens.<br />
Entscheidungen sind das Instrument, um Komplexität zu<br />
bearbeiten.<br />
✒ Führung als Profession beschreibt die Qualitätsstandards,<br />
den Maßstab, an dem Führung gemessen werden kann.<br />
Auch diese Dimension des Führens gliedert sich in drei<br />
Aspekte:<br />
• Theorie, Wissen, Erfahrung:<br />
Jede Profession stützt sich auf ein eigenes Wissen.<br />
Führungswissen umfasst (oder sollte umfassen) alle Fragen<br />
der Führungspraxis, also Themen der Selbstreflexion,<br />
der Kommunikation und des Entscheidens; darüber hinaus<br />
braucht Führungswissen auch Organisationswissen,<br />
mitunter Arbeitsrecht, Fachwissen.<br />
• Rollenklarheit:<br />
Zum professionellen Standard zählt es, in seinem Verhalten<br />
im Rahmen der Rolle bzw. der Rollenerwartungen<br />
zu bleiben. Die Rolle als Führungskraft ist nicht nur<br />
kaum zu definieren, sie wird darüber hinaus auch in jeder<br />
Organisation je nach Kultur unterschiedlich gesehen.<br />
• Instrumente:<br />
Jeder Beruf hat sein spezifisches Werkzeug, das einerseits<br />
dem „Gegenstand“ der Tätigkeit entsprechen soll,<br />
andererseits aber auch von Fragen der Theorie und der<br />
jeweiligen Werthaltungen abhängig ist. So kann man heute<br />
Mitarbeiter nicht mehr schlagen. Dieses „Instrument“ ist<br />
nicht mehr einsetzbar. Führungsinstrumente sollten<br />
entlang der Praxis Instrumente und Methoden der<br />
Selbstreflexion und des Selbstmanagements, der Kommunikation<br />
und von Entscheiden umfassen.<br />
✒ Führung als Prozess beschreibt die Aufgabe des Führens als<br />
kontinuierlichen Ablauf von einzelnen Schritten. Führung<br />
ist keine einmalige Tätigkeit, sondern ein kontinuierlicher<br />
Prozess, den ich im Modell wieder in drei zentrale Aspekte<br />
gegliedert habe:<br />
• Wachsamkeit:<br />
Dieser Aspekt beschreibt die Tätigkeit des Informationen<br />
Gewinnens durch beobachten, fragen, lesen, Dialoge.<br />
Informationen sollten die Basis aller Führungsaktivitäten<br />
sein.<br />
• Wertschätzung:<br />
Mit diesem Begriff ist vor allem die Verarbeitung von<br />
Informationen gemeint: Welche Schlüsse ziehen wir aus<br />
Informationen, welche Annahmen tätigen wir? Wertschätzung<br />
umschreibt einen Verarbeitungsmodus, in dem<br />
vor allem die nützlichen, wertvollen und lösungsrelevanten<br />
Aspekte aus Informationen verwendet werden.<br />
Die Beobachtung von Mitarbeitern sollte sich also<br />
etwa mehr auf deren Potenziale als auf deren Fehler konzentrieren.<br />
54<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Die Leadership Map im Überblick<br />
In der Praxis können Führungskräfte dieses Modell benützen,<br />
um ihre eigene Tätigkeit immer wieder zu überprüfen,<br />
um zu sehen, wohin die Aufmerksamkeit geht, wo etwas im<br />
Dunkeln bleibt. Missverständnisse entstehen oft aus einer<br />
verkürzten Sicht auf die Welt. Wenn man Führung lediglich<br />
aus einer der hier vorgestellten Perspektiven betrachtet, dann<br />
wundert es nicht, dass man diesen Teil für das ganze Stück hält.<br />
Die hier präsentierte Leadership Map bildet Führung in ihrer<br />
Komplexität und Differenziertheit ab. Man muss sich schon der<br />
Mühe unterziehen, immer wieder auf dieses gesamte Bild<br />
zu schauen, will man nicht Gefahr laufen, zu „schrecklichen“<br />
Vereinfachungen oder Missverständnissen zu kommen. Mut zur<br />
Komplexität ist angesagt.<br />
• Wirksamkeit:<br />
Damit ist der Schritt der Umsetzung von Überlegungen und<br />
inneren Entscheidungen gemeint. Führung wird erst durch<br />
Aktivitäten wirksam. Aktivitäten brauchen Mut, Kraft und<br />
Risikobereitschaft, aber auch Weitblick und eine klare Haltung.<br />
Dr. Ruth Seliger ist geschäftsführende Gesellschafterin der<br />
1986 gegründeten Train Consulting. Sie studierte Pädagogik,<br />
Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Philosophie und verfügt<br />
über Ausbildungen in systemischer Beratung, Appreciative<br />
Inquiry und Großgruppen-Methoden.<br />
Diese Dimensionen und Aspekte von Führung sind für sich<br />
genommen nicht unbedingt neu. Neu ist die Verbindung dieser<br />
Dimensionen. Erst dadurch, dass alle diese Aspekte aufeinander<br />
bezogen, miteinander vernetzt sind, wird die Komplexität von<br />
Führung deutlich.<br />
Das Dschungelbuch der Führung<br />
Ein Navigationssystem für Führungskräfte<br />
ca. 176 Seiten, 60 Abb., Gb, <strong>2008</strong>, € (D) 29,95 | € (A) 30,80<br />
Carl-Auer Verlag , ISBN 978-3-89670-637-9<br />
❙<br />
Präzise hören und<br />
sprechen<br />
Sandberg hat ein Headset entwickelt, das nicht<br />
nur von allem ein bisschen etwas kann, sondern alles<br />
bis hin zur Perfektion: Musik- und Sprachwiedergabe<br />
in allerbester Qualität. Sein Erscheinungsbild ist trendy<br />
ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen. Die Wiedergabe<br />
sowohl von Bass als auch den hohen Tönen ist rein<br />
und präzise, ohne dabei scharf oder rumpelig zu sein. Das<br />
Headset ist mehr als nur die Summe seiner Teile.<br />
Anders Petersen, Produktmanager bei Sandberg A/S, erklärt:<br />
"Wir möchten, dass das CobraSet jenes breite Familiensegment<br />
bedient, in dem die Familie einen Computer hat, der den Anforderungen<br />
jedes einzelnen Mitglieds genügen muss, egal ob es<br />
sich dabei um Flugsimulatoren, Aktion-Spiele, IP-Telefonie oder<br />
klassische Serenaden handelt. Das CobraSet kann sie alle zufrieden<br />
stellen. Außerdem haben wir den Preis absichtlich 30–50%<br />
niedriger angesetzt als den für ähnliche Headsets üblichen. Denn<br />
die Marke Sandberg soll als Lieferant qualitativ hochwertiger<br />
Audiogeräte angesehen werden. Die beste Möglichkeit dies sicherzustellen<br />
ist, dafür zu sorgen, dass unsere Produkte einfach zu<br />
kaufen und kostengünstig sind. So können sie unsere Kunden zu<br />
Hause testen und herausfinden, wie gut sie sind, ohne dafür große<br />
Mengen an Geld ausgeben zu müssen."<br />
❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
55
KOLUMNE • NEUE WEGE ZUM ERFOLG<br />
Kommt die Gratis-Gehaltskonten-<br />
Welle auch nach Österreich?<br />
Wenn man sich die Entwicklungen<br />
im deutschen Privatkundenmarkt betrachtet,<br />
dann fällt einem sofort der starke<br />
Trend zu kostenlosen Gehaltskonten auf.<br />
Kaum eine deutsche Großbank, die nicht<br />
ein entsprechendes Gratiskonto bewirbt,<br />
um Kunden zu gewinnen. Und nicht nur<br />
das. Oftmals wird den Kunden sogar<br />
noch ein Bonus bezahlt!<br />
Gratis-Angebote wie jenes der<br />
Commerzbank oder von Direktbanken<br />
wie der DKB oder der ING DiBa sind in<br />
Deutschland mittlerweile ein Standard.<br />
Sie bilden für Konsumenten, welche ein<br />
Gehaltskonto zu eröffnen beabsichtigen,<br />
immer häufiger einen „Referenzpreis“ für<br />
Vergleiche mit den Angeboten anderer<br />
Banken. Von diesen wird dann ebenso<br />
eine „gratis Kontoführung“ und „kostenlose<br />
Kredit- und Maestrokarten“ erwartet.<br />
Mittlerweile werden zudem nicht<br />
unbeträchtliche Beträge als „Startguthaben“<br />
bezahlt (z.B. EUR 75 durch die<br />
Commerzbank), hohe Guthaben-Zinsen<br />
geboten (z.B. 3,8% bei der DKB) oder<br />
Vergütungen für die Nutzung der Kreditkarte<br />
bezahlt (z.B. 50 Cent Bonus für<br />
Einkäufe mit der VISA-Karte bei der<br />
ING-DiBa Deutschland).<br />
Was steckt hinter dem Trend? Kurz<br />
gesagt: verschärfter Wettbewerb um je-<br />
den Kunden, ein zentrales Produkt in der<br />
Kundenbeziehung mit großem Cross-<br />
Selling-Potenzial und Kundensegmente<br />
mit unterschiedlichen Produktanforderungen<br />
und -erwartungen. Aber gilt das<br />
auch für Österreich und ist damit ein<br />
„Überschwappen“ des Trends zu erwarten?<br />
In den Kundenbedarfsanalysen meiner<br />
eigenen Beratungsprojekte für renommierte<br />
österreichische Banken konnte ich<br />
erkennen, dass das Gehaltskonto entgegen<br />
der allgemeinen Meinung das<br />
größte Potenzial für die Gewinnung von<br />
Neukunden aufweist. Das scheint zunächst<br />
ein Paradoxon zu sein, ist doch die<br />
Wechselhäufigkeit der Bankkunden eher<br />
gering, ebenso wie der Informationsstand<br />
und das Preisbewußtsein. Auch bereits<br />
bestehende Angebote, etwa jenes der<br />
easybank oder der Spardabank, haben<br />
noch nicht zu spürbaren Umbrüchen geführt.<br />
Aber legt man den Konsumenten,<br />
wie in meiner Methodik vorgesehen,<br />
konkrete Angebote mittels indirekter Befragung<br />
vor – versetzt man sie also in eine<br />
Entscheidungssituation – steigt die<br />
Bereitschaft zu wechseln sprunghaft an.<br />
Immerhin ist auch die Zufriedenheit mit<br />
aktuellen Produkten eher bescheiden.<br />
Gelingt es einem Anbieter also, einige<br />
Hausaufgaben professionell zu erledigen,<br />
ZUR<br />
PERSON<br />
Foto: NEW WAYS<br />
Mag. Alexander<br />
Neumayer<br />
war jahrelang im<br />
strategischen<br />
Management der<br />
Raiffeisen Bankengruppe<br />
Österreich<br />
tätig. Er machte<br />
sich 2003 mit der<br />
Gründung von<br />
NEW WAYS selbstständig und unterstützt<br />
als Strategie- und Vertriebsberater Banken<br />
auf ihren neuen Wegen zum Erfolg.<br />
dann kann auch in Österreich ein großes,<br />
schlummerndes Potenzial erschlossen<br />
werden. Einige meiner Kunden haben<br />
dies frühzeitig erkannt und in Projekten<br />
den genetischen Code der Bedürfnisse in<br />
der Nachfrage nach Gehaltskonten entschlüsselt.<br />
Damit haben sie nicht nur ihre<br />
aktuellen Gehaltskonto-Pakete für verschiedene<br />
Bedürfnissegmente auf Basis<br />
von Marktsimulationen optimiert, sondern<br />
auch bereits Gehaltskonto-Produkte<br />
„in der Schublade“, welche im Falle<br />
des Falles auch aggressiven Angeboten<br />
von Großbanken und Direkbanken à la<br />
Deutschland Paroli bieten können.<br />
Ich freue mich auf Ihre Meinung zu diesem<br />
Thema an a.neumayer@new-ways.at. ❙<br />
✎<br />
harald senk<br />
training & coaching<br />
kg<br />
A-7063 Oggau, Neubaugasse 3<br />
Telefon 0676/3198048<br />
• Training und Umsetzungsbegleitung für BSB und neuen Vertrieb<br />
• Vertriebscoaching für VerkäuferInnen im Innen- und Außendienst<br />
• Teamentwicklung und Motivation für Vertriebsteams<br />
Besuchen Sie uns noch heute unter www.haraldsenk.at<br />
56<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
Fotos: Fujitsu Siemens<br />
Designtes Notebookvergnügen<br />
Der Massenmarkt für Computer ist unübersichtlich, die Produkte sehen sich oft zum Verwechseln ähnlich. Mit einem<br />
durchgängigen Designkonzept macht Fujitsu Siemens Computers nun seine Produkte unterscheidbar und entschied<br />
sich zudem für die Integration des Designprozesses in alle Phasen der Produktherstellung.<br />
Nicht nur das Äußere wird zum Gegenstand der Gestaltung,<br />
sondern die Gesamtheit des Gerätes: Fujitsu Siemens Computers<br />
geht es um Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Verarbeitung.<br />
„Design ist für uns kein Modetrend, sondern eine<br />
langfristige strategische Investition in die Marke“, so Barbara<br />
Schädler, Chief Marketing Officer bei Fujitsu Siemens Computers.<br />
Die Designsprache, die künftig für alle Consumer- wie<br />
auch Businessprodukte von Fujitsu Siemens Computers verbindlich<br />
ist, hat das Unternehmen in einem zweijährigen, interdisziplinären<br />
Projekt entwickelt. Als externer Partner unterstützte<br />
die international renommierte Design- und Innovationsberatung<br />
IDEO mit Sitz in Palo Alto, London und München<br />
das Team. „Das Äußere aus dem Inneren entwickeln“ lautet das<br />
Credo für das konsistente Designkonzept, für das sich in einer<br />
umfassenden Conjoint-Analyse die Mehrheit der 1.200 befragten<br />
Kunden aussprach. Ob mobil oder stationär, im Beruf oder<br />
zuhause, Web- oder Power-User – die Benutzer wünschen sich<br />
Computer, an denen sie Spaß haben und mit denen sie ihre<br />
eigene Kommunikations- Infrastruktur bauen können. Deshalb<br />
haben die Designer und Ingenieure von Fujitsu Siemens Computers<br />
Hand in Hand ein Konzept entwickelt, das innovative<br />
Technologien zum Vorschein bringt. „Die technologischen Elemente<br />
der Geräte sind auf den ersten Blick erkennbar. Technologie<br />
macht den Unterschied, Design zeigt ihn“, resümiert Horak.<br />
Im neuen Design bringt Fujitsu Siemens Computers drei<br />
Produktlinien heraus: AMILO ist der Name für die Consumerprodukte<br />
in kontrastreichem schwarz-weiß, deren Schönheit<br />
funktionell ausgefeilt ist. Als elegantes Accessoire kommt der<br />
kleine, quadratische GraphicBooster daher, der zum Beispiel aus<br />
dem ultraleichten AMILO Sa 3650 ein wahres Powerpaket in<br />
Sachen Grafikleistung macht. Die Modelle in weißer, seidiger<br />
oder hochglänzender Oberfläche mit den geraden schwarzen<br />
Trennlinien machen sich in jedem Ambiente gut. SCENIC-<br />
VIEW, ESPRIMO Mobile, ESPRIMO und CELSIUS heißen<br />
die Brüder, die ihre Talente im Business Client-Umfeld entfalten.<br />
In unauffälligem Anthrazit gekleidet strahlen diese Geräte<br />
Zuverlässigkeit, Robustheit und Integrationsfähigkeit aus. Ob<br />
Techniker oder Manager, Mann oder Frau – sie sind als Mobiles<br />
die perfekten Begleiter in die Business-Meetings und als PCs<br />
der perfekte Partner am Arbeitsplatz. PRIMERGY bezeichnet<br />
Fujitsu Siemens Computers nach wie vor alle Powerspieler,<br />
die jedes Data Center zu Höchstleistungen bringt. Die grauschwarzen<br />
Server sehen nicht nur uneinnehmbar stark aus, sie<br />
sind es auch: Sie sorgen für Sicherheit, Hochverfügbarkeit und<br />
sind die Hüter der Daten. (verfügbar ab Q1 2009)<br />
Die Konsistenz des Designkonzepts ermöglicht sowohl<br />
eine hohe Standardisierung wie auch Individualisierung. Auf<br />
der Designplattform entstehen in kurzen Innovationszyklen<br />
spezifische, auf Kundengruppen zugeschnittene Produkte und<br />
Modelle. Dass das Design eine hohe Wiedererkennbarkeit der<br />
Marke garantiert, zeigt ein Test unter Kunden: 80% haben die<br />
Produkte sicher Fujitsu Siemens Computers zugeordnet. Das<br />
einheitliche Design von Business- und Private-Notebook stellt<br />
auch einen Blick in die Zukunft dar, denn, so meint Wolfgang<br />
Horak, diese beiden Bereiche werden verschmelzen. Das private<br />
Notebook in die Firma zu bringen ist aus dem Blickwinkel<br />
der Sicherheitstechnologie bereits möglich, aus Kostengründen<br />
werden die Firmen dies wohl forcieren. Darüber hinaus werden<br />
Design, Brand und Customizing die entscheidenden Faktoren<br />
sein, um sich im Wettbewerb zu unterscheiden.<br />
❙<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong><br />
57
estbanking –<br />
laut Leserumfrage die Nr. 1<br />
bei den Führungskräften<br />
im Bankenbereich<br />
Direktoren, Vorstände und Geschäftsleiter<br />
wurden im Juli <strong>2008</strong> von<br />
emotion banking eingeladen, mittels<br />
elektronischem Fragebogen ihre<br />
Meinung über bestbanking kundzutun.<br />
Die Befragten äußerten sich insgesamt erfreulich positiv über das Medium. Über 90%<br />
lesen es regelmäßig, die meisten seit zwei bis drei Jahren. Gerne wird bestbanking auch an<br />
andere weitergegeben und erlangt so, bei einer Auflage von 5.000 Stück, eine Leserreichweite<br />
von 9.600. Mit der Themenzusammenstellung, deren Aktualität, der Qualität des Textes und der<br />
Fotos, den Titelbildern, dem Layout und Verhältnis von Text und Bild sowie dem Online-Auftritt<br />
zeigen sich die Befragten durchgehend sehr zufrieden. Überzeugt ist die Leserschaft auch von der<br />
fachlichen Kompetenz der Beiträge, der Praxisrelevanz und Nützlichkeit der Informationen sowie<br />
der Objektivität und Sachlichkeit des Magazins und empfiehlt es weiter.<br />
Wir freuen uns sehr über diese positive Resonanz, aber auch über Anregungen und konstruktive<br />
Kritik (unsere E-Mailadressen finden Sie weiter unten auf dieser Seite), denn wir sind bestrebt,<br />
auch in Zukunft Ihren Erwartungen an ein Fachmagazin für Banken gerecht zu werden.<br />
Ihr bestbanking-Team<br />
Aktuelle Themen der nächsten bestbanking:<br />
E-Mail-Sicherheit, Business Intelligence, Geschäfts-Strategie,<br />
neue Standards für Karten, Vertriebsinnovationen, Sicherheit<br />
Redaktions- und Anzeigenschluss für bestbanking 11|12 <strong>2008</strong>:<br />
17. November <strong>2008</strong><br />
Kontakte:<br />
Kurt Quendler, +43 664 32 12 499, kurt.quendler@bestbanking.at<br />
Mag. Gertrud Zoklits, +43 676 75 44 952, gertrud.zoklits@bestbanking.at<br />
Osteuropa: András Szöcs, +40 724 931 357, andras.szocs@bestbanking.eu<br />
bestbanking<br />
Bankpraxis im Top-Format<br />
Impressum:<br />
Grundlegende Richtung:<br />
bestbanking ist ein unabhängiges Fachmagazin<br />
für Banken und Finanzdienstleister.<br />
Verlags- und Redaktionsadresse:<br />
bestbanking medien<br />
Favoritner Gewerbering 32, 1100 Wien<br />
T +43 1 960 65 900, F +43 1 960 65 990<br />
www.bestbanking.at<br />
Medieninhaber, Herausgeber:<br />
Kurt Quendler, M +43 664 32 12 499<br />
kurt.quendler@bestbanking.at<br />
Chefredakteurin:<br />
Mag. Gertrud Zoklits, +43 676 75 44 952<br />
gertrud.zoklits@bestbanking.at<br />
Autoren dieser Ausgabe:<br />
Dr. Barbara Aigner, Franz Berger, MBA,<br />
Ing. MBA Peter Drimmel, Ilse Fetik, Urs Flück,<br />
Marion Fugléwicz-Bren, Franz Lechner,<br />
Mag. Alexander Neumayer, Dr. Christian Rauscher,<br />
DionR. Norbert Sasse, Ruth Seliger,<br />
Mag. (FH) Christina Tambosi, Burkhard Wolff,<br />
Dr. Ilse A. Vigl, Mag. Gertrud Zoklits<br />
Coverbild:<br />
©<br />
Edward White - Fotolia.com<br />
Marketing und Grafik:<br />
Brigitte Strohmayer, M +43 664 110 43 54<br />
b.strohmayer@bestbanking.at<br />
Druck:<br />
agensketterl Druckerei GmbH, Wien-Mauerbach<br />
Erscheinungsweise:<br />
6x bestbanking, bestbanking special<br />
Auflage:<br />
5.000 Stück<br />
Anzeigenleitung:<br />
Kurt Quendler, M +43 664 32 12 499<br />
anzeigen@bestbanking.at<br />
Anzeigen-, Aboservice und Vertrieb:<br />
bestbanking medien<br />
Favoritner Gewerbering 32, 1100 Wien<br />
T +43 1 960 65 900, F +43 1 960 65 990<br />
abo@bestbanking.at<br />
Rechnungslegung:<br />
5artig Werbeagentur GmbH<br />
Favoritner Gewerbering 32, 1100 Wien<br />
T +43 1 960 65 900, F +43 1 960 65 990<br />
Das Abonnement gilt auf ein weiteres Jahr verlängert,<br />
wenn nicht acht Wochen vor dem Ende des Bezugszeitraums<br />
eine schriftliche Abbestellung erfolgt.<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise,<br />
nur mit Genehmigung des Verlages.<br />
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.<br />
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste <strong>2008</strong>.<br />
Alle als namentlich gekennzeichneten Beiträge spiegeln<br />
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.<br />
Alle Rechte, insbesondere die Übernahme von Beiträgen<br />
nach § 44 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten.<br />
1/1 Seite<br />
178 x 252 mm<br />
€ 4.900,-<br />
2/3 Seite quer<br />
178 x 168 mm<br />
€ 3.790,-<br />
2/3 Seite hoch<br />
117 x 252 mm<br />
€ 3.790,-<br />
1/2 Seite quer<br />
178 x 126 mm<br />
€ 3.250,-<br />
1/2 Seite hoch<br />
87 x 252 mm<br />
€ 3.250,-<br />
1/3 Seite quer<br />
178 x 84 mm<br />
€ 2.900,–<br />
1/3 Seite hoch<br />
56 x 252 mm<br />
€ 2.900,–<br />
1/4 Seite hoch<br />
87x 126 mm<br />
€ 2.350,–<br />
Alle Formate abfallend +10%. Zuschläge für Sonderplatzierungen auf Anfrage. Anzeigensteuer +5% und +20% Mehrwertsteuer.<br />
58<br />
bestbanking <strong>9|10</strong> <strong>2008</strong>
NEHMEN SIE DIE ZUKUNFT INS VISIER:<br />
FILIALPROZESSE OPTIMIEREN.<br />
Abläufe gezielt verbessern. Wincor<br />
Nixdorf weiß, wie man mit innovativen<br />
IT-Lösungen Prozessoptimierungen im<br />
Filialgeschäft von Banken erzielen kann.<br />
Aus jahrzehntelanger Erfahrung haben<br />
wir ein durchgängiges Lösungsportfolio<br />
aus Hardware, Software und einem<br />
spezialisierten Dienstleistungsangebot<br />
entwickelt. Unsere besondere Stärke<br />
liegt in der Automatisierung von Prozessen<br />
in den Filialen, der Migration von<br />
Abläufen auf Selbstbedienungslösungen<br />
und der kostenoptimierten Betriebsführung.<br />
Von den 25 weltweit führenden<br />
Retailbanken verlassen sich fast alle auf<br />
unser Know-how. Das macht uns zum<br />
idealen Partner auch für Ihren Veränderungsprozess.<br />
Lassen Sie sich deshalb<br />
von unseren innovativen Lösungen<br />
überzeugen. Wir von Wincor Nixdorf<br />
beraten Sie gern: Tel. +49 5251 693-3301.<br />
Oder besuchen Sie uns im Internet unter<br />
www.wincor-nixdorf.com<br />
EXPERIENCE MEETS VISION.