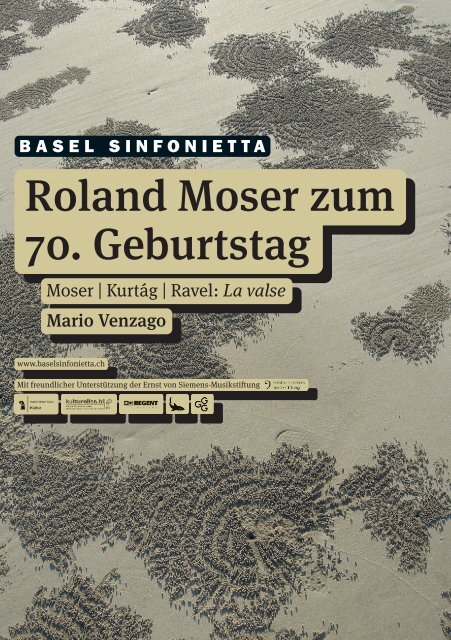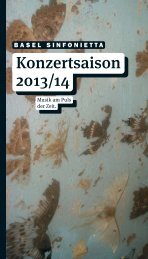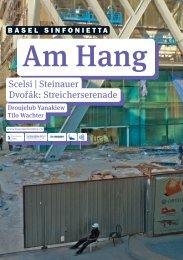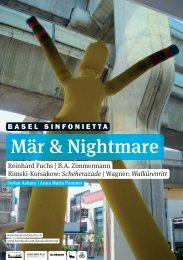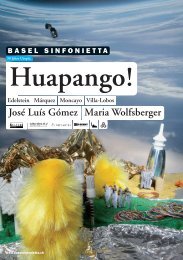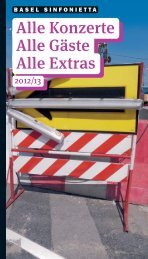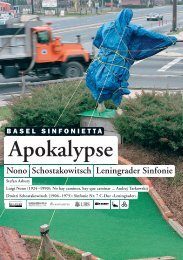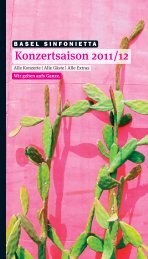Programmheft (pdf) - Basel Sinfonietta
Programmheft (pdf) - Basel Sinfonietta
Programmheft (pdf) - Basel Sinfonietta
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Roland Moser zum<br />
70. Geburtstag<br />
Moser | Kurtág | Ravel: La valse<br />
Mario Venzago<br />
www.baselsinfonietta.ch<br />
Mit freundlicher Unterstützung der Ernst von Siemens-Musikstiftung
Subventionsgeber<br />
Hauptgönner<br />
Co-Sponsoren<br />
Medienpartner<br />
Die basel sinfonietta dankt ihren Partnern.
Zum Programm<br />
Roland Moser (*1943)<br />
WAL für schweres Orchester mit fünf Saxophonen (1980–1983)<br />
26 Min.<br />
Prolog – quasi Adagio – quasi Scherzo – quasi Recitativo –<br />
quasi Passacaglia – quasi Cadenza – Echo – Epilog<br />
Première étude pour les disparitions für Orchester<br />
Uraufführung | Auftragswerk der basel sinfonietta<br />
19 Min.<br />
Pause<br />
Maurice Ravel (1875–1937)<br />
La valse, poème chorégraphique pour orchestre (1919/1920)<br />
14 Min.<br />
György Kurtág (*1926)<br />
Stele op. 33 (1994)<br />
13 Min.<br />
I. Adagio<br />
II. Lamentoso – Disperato, con moto<br />
III. Molto sostenuto<br />
Leitung: Mario Venzago<br />
Saxophonquintett: XASAX<br />
Das Konzert wird vom Schweizer Radio SRF 2 mitgeschnitten und<br />
am Donnerstag, 13. Februar 2014 um 20 Uhr ausgestrahlt.<br />
Der Kompositionsauftrag an Roland Moser wird durch<br />
die Ernst von Siemens Musikstiftung finanziert.
Zum Konzert<br />
Roland Moser zum 70. Geburtstag<br />
<strong>Basel</strong>, Stadtcasino<br />
Samstag, 7. Dezember 2013, 19.30 Uhr<br />
Konzerteinführung um 18.45 Uhr mit Roman Brotbeck und Roland Moser
Zu den Werken<br />
Peintures et disparitions<br />
Maurice Ravel: La valse<br />
Sergei Diaghilev hatte wohl auch in diesem<br />
Falle Recht. Als Ravel im April 1920 die<br />
K lavierfassung von La valse Diaghilev und<br />
seinem Kreis, dem auch Igor Strawinsky<br />
b eiwohnte, vorspielte, um mög liche Änderungen<br />
in Bezug auf die Bühnenumsetzung<br />
zu besprechen, soll Diaghilev gesagt<br />
haben: «Ravel, c’est un chefd’œuvre,<br />
mais ce n’est pas un ballet. C’est la peinture<br />
d’un ballet.» Es sei ein Meisterwerk,<br />
aber kein Ballett, sondern ein Porträt, die<br />
Abbildung eines Balletts. Dieser Kommentar<br />
führte zum endgültigen Zerwürfnis<br />
zwischen Ravel und Diaghilev, und weil<br />
Strawinsky der Einschätzung von Diaghilev<br />
nicht widersprach, sondern nur nachdenklich genickt haben soll, hat Ravel auch<br />
zu ihm den Kontakt abgebrochen.<br />
Aber Diaghilev, der grosse Impresario der Ballets russes, hatte trotzdem Recht. La valse<br />
ist kein Walzer, sondern ein Werk über den Walzer, ein Tanz über den Tanz. Ravel lässt<br />
den Walzer nur noch tanzen, um dessen Ende anzukündigen. Eine solch reflektierende<br />
Haltung war 1920 nicht mehr im Horizont von Diaghilevs Tanzästhetik. Die Experimente<br />
der Vorkriegszeit mit Vaslav Nijinsky, dem Choreographen des UrSacre, waren vergessen.<br />
Nijinsky hätte wohl La valse im eigentlichen Sinne des Wortes vertanzen können,<br />
aber er hatte sich 1920 schon lange von Diaghilev getrennt und befand sich zu dieser<br />
Zeit als SchizophreniePatient in der Psychiatrie. Seine jüngere Schwester, Bronislava<br />
Nijinska, war 1928 die Erste, die La valse mit Ida Rubinstein in der Hauptrolle choreographierte.<br />
Heute ist Ravels La valse in allen Konzertsälen weltweit zu hören, und das Werk wird<br />
häufig als bombastisches SchlussStück präsentiert, womöglich noch kombiniert mit<br />
Ravels zweitem Renner, dem Boléro. Allerdings: Ins Repertoire des von den Nazis<br />
b egründeten kitschdurchfluteten Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker hat<br />
La valse es trotzdem nicht geschafft, – zu Recht! Denn an der dort gefeierten Walzerseligkeit<br />
und an der den Schein bis zur Lüge zelebrierenden Gesellschaft hat sich Ravel<br />
ja gerade abgearbeitet.
Zu den Werken<br />
Unter der Leitung von Mario Venzago und im Kontext des Programms des heutigen<br />
K onzerts der basel sinfonietta wird Ravels Werk neu zu entdecken sein: ein Untergangsstück,<br />
in dem das alte Europa mit all seinen Widersprüchen, aber auch mit seinen<br />
f aszinierenden Illusionen zu Grabe getragen wird; ein Erinnerungsstück an eine inzwischen<br />
zerstörte und zerrissene Scheinwelt; ein grimmighämischer Totentanz.<br />
Ravel hat eine dichte und polyphone Partitur geschrieben; zu den schmelzenden Walzermelodien<br />
werden ständig hänselnde, ironischaffektierte oder giftigschrille Gegenstimmen<br />
gesetzt; gleich die allerersten Melodien hat Ravel den näselnden Fagotten<br />
überlassen; aufkommende Walzerseligkeit wird schon nach ein paar Takten in einen<br />
brutalen Galopp getrieben. Es wirkt so, als würden hier unheimliche Gespenster t anzen;<br />
wohl nicht zufällig stimmt das Schlagzeug kurz vor Schluss förmlich ein «Knochengerassel»<br />
an. In vielen Aufnahmen ist davon allerdings erstaunlich wenig zu hören, weil<br />
manch ein Dirigent sich auf die DreivierteltaktMelodien konzentriert und den zerfetzten<br />
Walzer doch noch irgendwie zu restaurieren versucht. Dabei sollte gerade das<br />
Maskenhafte dieses Walzers herausgeschält und die grinsenden Grimassen dahinter<br />
hörbar gemacht werden. Denn hinter jeder WalzerMaske lauert bei Ravel ein Abgrund,<br />
der im Verlaufe der Komposition zum unerbittlichen Sog ins Dunkle wird. Es gibt nur<br />
wenige Werke, die in solch beängstigender Modernität die Katastrophe des Ersten Weltkrieges<br />
und des mit ihm untergegangenen Europas heraufbeschwören.
Zu den Werken<br />
Roland Moser: WAL für schweres Orchester<br />
La valse steht für das vielschichtig komponierte Programm des heutigen Konzertes.<br />
Auch von WAL für schweres Orchester könnte man mit Diaghilev sagen: «Ce n’est<br />
pas une baleine, c’est la peinture d’une baleine.» Moser hat keine Programmmusik<br />
k omponiert, und wer musikalische Übertragungen von Walgesängen erwartet, wird<br />
enttäuscht.<br />
Es ist schwierig, die Qualität von Roland Mosers Musik zu beschreiben, denn sie entzieht<br />
sich einem einfachen Zugriff; Moser liebt das Paradoxe, Systeme, die scheitern,<br />
Dinge, die nicht «stimmen». Moser liebt auch Rätsel und versteckte Botschaften: Zum<br />
Beispiel «spricht» im WAL, kurz nach Beginn des Stückes, ein Instrument eine zentrale<br />
Textstelle des Gedichtes Gesang der Wale von Günter Herburger, auf das sich Moser<br />
in seiner Komposition bezieht. Welchem Instrument wohl hat Moser diesen «Text»<br />
g egeben? Der Tuba oder den versammelten tiefen Streichern? Nein, ausgerechnet<br />
dem Piccolo, jenem Instrument, das nicht einmal die eingestrichene Oktave erreicht<br />
und mit dem man einen Wal zuallerletzt in Verbindung bringt. Und selbstverständlich<br />
«spricht» das Piccolo den Text nur, indem der Spieler sprechend bläst und in der<br />
M e lodie die Wortbetonungen exakt übernimmt. In diesem Text wird das Programm<br />
von WAL formuliert, aber nur der PiccoloSpieler und der Dirigent bzw. der Besitzer der<br />
Partitur kennen es wörtlich; alle andern hören nur, dass da etwas gesagt wird, aber was<br />
genau, verstehen sie nicht.<br />
Und Sie möchten nun, dass ich hier dieses Programm offenlege? Ich tue es nicht, denn<br />
Sie würden wenig gewinnen, viel eher gar die Magie des Momentes nicht mehr spüren,<br />
diese unerhörte Spannung zwischen dem grossen und schweren Orchester und der<br />
fast «himmlisch» wirkenden PiccoloBotschaft nicht mehr erleben können. Es ist keine<br />
Geziertheit, wenn Roland Moser wenig preisgibt von den Gedanken und Systemen, die<br />
hinter seiner Musik stehen. Denn das «Wissen» kann von der eigentlichen Qualität der<br />
Musik gerade ab lenken. In WAL liegt diese Qualität im durchaus paradoxen Umgang<br />
mit dem schweren Orchester: Dieses wird nämlich in seiner Schwere gar nicht ausgeschöpft,<br />
vielmehr schreibt Moser eine leichte und sehr bewegliche Musik, welche an<br />
die Schwerelosigkeit und Wendigkeit der Wale im Meer erinnert. Trotz ihrer Schwerelosigkeit<br />
entwickelt die Musik eine starke Sogwirkung. Und diese hat mit der speziellen<br />
Harmonik des Werkes zu tun.<br />
Früh schon hat Roland Moser nach Auswegen aus der harmonischen Einförmigkeit<br />
v ieler Zwölftonstücke mit ihrer Dominanz von Septimen, Sekunden und über mässigen<br />
Quarten gesucht. Diese Intervalle klingen zwar alle komplex, aber auch immer ziemlich<br />
ähnlich. Moser wurde in der Folge zum h armonischen Alchimisten, der er bis heute ist.
Zu den Werken<br />
In WAL zeigt sich dies in den unglaublich hellen und farbintensiven Klängen, vor allem<br />
aber in diesem harmonischen Sog, der Spannung erzeugt, ohne je ins bekannte Auflösungsregister<br />
der tonalen Musik zu fallen.<br />
Schon in den 1970er Jahren beschäftigte sich Roland Moser mit jenen neuen harmonischen<br />
Räumen, die schliesslich in WAL realisiert wurden. Dabei war das Bild ad<br />
m arginem von Paul Klee der entscheidende Auslöser: In der Bildmitte befindet sich ein<br />
roter sonnenähnlicher Punkt, an den vier Bildrändern kleben merkwürdige Gestalten,<br />
so als wollten sie dem Bild entfliehen und würden sie vom Bilderrahmen eingesperrt.<br />
Der Punkt in der Mitte ist ein «Fluchtpunkt», nicht etwa weil sich die Gestalten nach<br />
ihm ausrichten, sondern weil sie ihm vielmehr zu entfliehen suchen. Zwischen dem<br />
Z entralpunkt und den Rändern entsteht ein unterspanntschwebender und wegen des<br />
roten Punktes leicht drehender Raum. Dieses KleeBild bildet die Vorlage für die Raumvorstellungen<br />
in der Komposition WAL. Moser verwendet eine einfache Leiter aus<br />
Roland Moser<br />
Roland Moser wurde 1943 in Bern geboren,<br />
wo er auch seine MusikAusbildung<br />
(u.a. Komposition bei Sandor<br />
Veress) erhielt. Spätere Studien führten<br />
ihn nach Freiburg im Breisgau und<br />
Köln. Von 1969 bis 1984 unterrichtete<br />
er am Winterthurer Konservatorium<br />
Theorie und Neue Musik. Danach arbeitete<br />
er bis zu seiner Emeritierung 2008 an der Basler Hochschule für Musik mit<br />
Klassen für Komposition, Instrumentation und Musiktheorie. Als Mitglied des Ensemble<br />
Neue Horizonte Bern sammelt er seit über vierzig Jahren Erfahrungen mit<br />
experimenteller Musik.<br />
Sein umfangreiches Œuvre kreist um einige Schwerpunkte. Dazu zählen eine neue<br />
Art der Auseinandersetzung mit der Epoche der Romantik in grösseren zyklischen<br />
Arbeiten mit Singstimmen und abendfüllenden musikdramatischen Werke sowie<br />
Chor, Orchester und Kammermusik. Öfters bilden historische Gattungen oder<br />
Einzelwerke den Ausgangspunkt zu neuen oder auch bloss leicht verscho benen<br />
Hörweisen. Ein besonderes Interesse gilt – auch in zahlreichen Texten – besonderen<br />
Phänomenen von Harmonik, musikalischer Zeit und der Beziehung von<br />
Musik und Sprache.
Zu den Werken<br />
36 Tönen, in der immer zwei grosse und eine kleine Sekunde einander folgen. Die Skala<br />
dreht sich so im Quartenzirkel durch alle «Tonarten», bis sie nach 5 Oktaven (und einer<br />
enharmonischen Verwechslung) zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Die vier möglichen<br />
Transpositionen bewirken lediglich die Versetzung der Skala in andere Oktavlagen.<br />
I nnerhalb einer Oktave ist die Leiter diatonisch, über die 5 Oktaven enthält sie aber<br />
jeden der 12 Töne dreimal, so dass der Tonraum sich bildlich gesprochen um 360 Grad<br />
dreht, was zu dieser schraubenden und manchmal in sich drehenden Harmonik führt,<br />
die weder eine Auflösung findet noch finden will.<br />
WAL gliedert sich in acht ineinander übergehende Teile. Sie sind fast alle – und da<br />
wären wir wieder bei Ravels La valse – mit «quasi» überschrieben: quasi Adagio, quasi<br />
Scherzo, quasi Recitativo, quasi Passacaglia. Da ist nichts «eigentlich» gemeint, alles<br />
nur ein Alsob. Die Teile sind musikalisch sehr eng verbunden und nicht immer<br />
klar abgegrenzt. Unüberhörbar ist allerdings der Beginn des vierten Teiles: Ein Drittel<br />
des Werkes ist schon verklungen, und da setzen aufs Mal fünf Saxophone ein, alleine,<br />
homophon, ein SaxophonChor. Er kommt wie aus einer anderen Welt. Von neuem eine<br />
«Botschaft», so eine Moser’sche Flaschenpost mit breitem Assoziationsfeld: fünf Unheil<br />
ankündigende Boten? Jedenfalls ein Anderes. Das Orchester verstummt. Und erst<br />
w ährend der nachfolgenden Quasi Passacaglia stimmt das Orchester langsam wieder<br />
mit ein, immer dichter, unerbittlicher und mitreissender. Aber in dieser imposanten<br />
O rchesterherrlichkeit lässt Moser WAL nicht enden. In Quasi Cadenza erzählen die<br />
T enorSaxophone von den Walen, sogar vom Traum des lyrischen Ichs, selber wieder<br />
zum Wal zu werden. Im Epilog schliesslich betritt Moser noch einmal eine andere Welt.<br />
Ohne Zuweisung zu einem bestimmten Instrument steht in der Partitur ein Textausschnitt<br />
von Elias Canetti aus den Aufzeichnungen von 1942/43, der das Sterben der Tiere<br />
beschreibt und mit den Worten endet: «Haben die Tiere weniger Angst, weil sie ohne<br />
Worte leben?» Die Saxophone geraten mit ihrer Rede ins Stocken, und die Pauken stimmen<br />
mit den Bläsern einen Kondukt an. Ein Memoriam auf den WAL.
…auch für Konzertbesucher und Musikschaffende.<br />
Mitreden, wenn über<br />
neue Formen der Musik<br />
gesprochen wird.<br />
Kultur abonnieren. Mit dem BaZ-Abo.<br />
Abo-Bestellungen per Telefon 061 639 13 13, als SMS mit Kennwort «abo» oder<br />
«schnupperabo», Namen und Adresse an 363 (20 Rp./SMS) oder als E-Mail mit Betreff<br />
«Abo» oder «Schnupperabo», Namen und Adresse an info@baz.ch<br />
(Das Schnupper-Abo ist auf die Schweiz beschränkt und gilt nur für Haushalte, in welchen innerhalb der letzten 12 Monate<br />
kein BaZ-Abo abbestellt wurde.)<br />
Erst lesen, dann reden.
Zu den Werken<br />
Roland Moser: Première étude pour les disparitions<br />
Wie ein grosser Nachklang zu WAL wirkt im Programm des heutigen Konzertabends<br />
Première étude pour les disparitions (vgl. dazu auch den eigenen Text von Roland<br />
Moser). Wer gut hinhört, wird bemerken, dass gleich zu Beginn der Etude neben kurzen<br />
Bruchstücken aus anderen Orchesterwerken von Roland Moser auch WAL zitiert<br />
wird. Dreissig Jahre stehen zwischen den beiden Werken. Während im WAL Klang<br />
a ufgebaut und neue Harmonien erforscht werden und sich ein grosses Werk ausbreitet,<br />
das erst im Abgesang auch das Verschwinden thematisiert, werden bei der Etude<br />
von Anfang an die «disparitions» komponiert. Der Plural bei «disparitions» ist Moser<br />
wichtig, weil er hier unterschiedlichste Formen des Verschwindens, des Abbauens und<br />
Auslöschens übt. Das Werk ist pluralistischer, viele Materialien werden nur kurz aufgenommen<br />
und dann abgebaut.<br />
Anfänglich wechseln die Abschnitte in so rascher Folge, so dass man an einen<br />
Schumann’schen Zyklus erinnert wird: Naturstimmung, Nachtstimmung mit Okarinaruf,<br />
einen Nachtvogel imitierend; gewisse Partien sind frei komponiert, d.h. ausserhalb<br />
eines dirigierten Metrums zu spielen. Allen Gesten ist ein Auslöschungskoeffizient eingeschrieben,<br />
der die meist polyphonen Strukturen von innen heraus auflöst, sie klärt,<br />
indem sie durchsichtig werden, und zugleich a uslöschen lässt. Man ist als Hörer gut<br />
b eraten, bei diesem Orchesterwerk auf das N achklingen und die vielen negativen Melodien<br />
zu hören, die beim Wegnehmen von Klang entstehen. In der Mitte des Werkes<br />
zergliedert sich das Orchester in sechs unterschiedliche Instrumentengruppen. Im<br />
G egensatz zu WAL, wo diese Gruppierungen im Orchester Leben schaffen, löschen sich<br />
bei der Etude die Gruppen gegenseitig aus. Eindrücklich zu hören ist dies bei der Stelle<br />
Meine Première étude pour les disparitions ist kein Abschied, sondern der Anfang<br />
einer auf vier Stücke ausgelegten Werkreihe mit abnehmender Grösse der Besetzung.<br />
(Parallel dazu arbeite ich zurzeit an einem EnsembleZyklus extended<br />
m oments mit offenem Ende.)<br />
Aus Widersprüchen kommen Antriebe zur Komposition. Im Orchesterstück versuchte<br />
ich, auf verschiedenen Ebenen Wege aus der Fülle durch Reduktion<br />
h indurch bis zum Verschwinden zu gehen, also umgekehrt zum häufiger begangenen<br />
Weg, aus einer kleinen Zelle etwas grösseres wachsen zu lassen. In<br />
der Wahrnehmung kann dies vielleicht bisweilen sogar zunehmende Intensität<br />
b ewirken.<br />
Roland Moser
Zu den Werken<br />
mit den beiden Streichquartetten: Das zweite Streichquartett saugt hier das erste förmlich<br />
ein. Auch eine Zwölftonreihe verwendet Roland Moser zum ersten Mal seit Langem<br />
wieder, aber auch sie dient ihm ironischerweise nur dazu, durchlöchert und damit ihres<br />
eigentlichen strukturellen Sinnes beraubt zu werden.<br />
Was bei WAL die Saxophone sind, die erst nach einem Drittel des Werkes einsetzen,<br />
ist bei der Etude das Klavier, das nach zwei Dritteln des Stücks aus einem kurzen<br />
F ortissimoAkkord der Blechbläser heraus selbstständig zu spielen beginnt und den<br />
g anzen Schluss übernehmen wird, nur von einem einzigen kurzen Streichereinsatz<br />
und einer nochmals raumgreifenden Melodie der Bassklarinette ergänzt. Ein Drittel<br />
also dieser Etude ist ein Klavierstück, dessen Tonvorrat sich zunehmend verkleinert,<br />
bis zum Schluss nur noch D und Dis übrigbleiben.<br />
György Kurtág: Stele op. 33<br />
Stele von György Kurtág bildet den konsequenten<br />
Abschluss dieses stimmigen<br />
Konzertabends, nicht nur weil die Verwandtschaft<br />
zu Roland Mosers musikalischem<br />
Denken geradezu verblüffend ist,<br />
sondern weil es ein Stück über das Erinnern<br />
ist, quasi une peinture de la mort.<br />
Mit dem Titel Stele ist hier eine Grabsäule<br />
gemeint. In Griechenland waren in diese<br />
oft Worte und Zeichen eingeritzt, die an<br />
den Tod und den Toten erinnern sollten. Es ist nach einem sehr frühen Bratschen <br />
konzert das erste gültige Orchesterwerk von György Kurtág. Er hat es 1994 während<br />
eines BerlinAufenthaltes komponiert, als Hommage an den ein Jahr zuvor verstorbenen<br />
Freund und Förderer, den Komponisten und Musikpublizisten András Mihály<br />
(1917–1993). Kurtág verlangt ein riesiges Orchester, mit 6 Flöten, 6 Klarinetten, vier<br />
WagnerTuben und vier Hörnern, 2 Klavieren, Cimbalom, 2 Harfen etc. Dabei ist ihm<br />
wichtig, in allen Instrumenten Chöre zu bilden, also von Bassflöte bis Piccolo, von<br />
K ontrabassklarinette bis EsKlarinette möglichst immer die ganzen Instrumenten<br />
Familien versammelt zu haben. Mit diesen Instrumentengruppen schafft Kurtág von<br />
Anfang an einen speziellen Orchesterklang, der nicht die Verschmelzung, sondern<br />
die Parzellierung sucht. Das geht bis ins Detail, wenn z.B. die einigermassen wichtige<br />
Anmerkung «Feierlich: Hommage à Bruckner» nur gerade für die WagnerTuben gilt,<br />
also nur von den Tuben, nicht vom Rest des Orchesters realisiert werden soll. Ähn
Zu den Werken<br />
lich wie bei Roland Moser entfaltet sich das Werk in verschiedenen kontrastierenden<br />
Teilen, die alle unterschiedliche Positionen zum Tod darstellen: Zu Beginn ein statisches<br />
Adagio, das sich ins FeierlichVersöhnende steigert, dann aber von einem<br />
ä usserst aggressiven Lamentoso disperato unterbrochen wird. Hier wird die ganze<br />
Wut auf den Tod herausgeschrien: Cimbalom, Marimba, Trompeten und Schlagzeug<br />
(dar unter auch die Frusta, eine Peitsche!) zeigen den Protest gegen den Tod. Dieser<br />
P rotest klingt ab und führt in einen MisteriosoTeil mit faszinierenden Mischklängen<br />
aus K lavieren, Harfe, Cimbalom und Celesta. Der letzte Teil ist geprägt vom «ritmo di<br />
5 battuto», ein Quintolenrhythmus, der an den menschlichen Herzschlag erinnert und<br />
der sich zum Schluss des Stückes zur Todesallegorie verdichtet und zeigt, dass es einen<br />
präziseren Komponisten als Kurtág kaum gibt. Innerhalb dieser Quintolenfigur gibt es<br />
eine Art von innerem Zittern. Es entsteht dadurch, dass die Streicher und die Bongos<br />
den Rhythmus doppelt so schnell spielen wie die andern Instrumente. Dadurch entsteht<br />
ein auffälliges Nachschlagen jener Instrumente, welche die Quintole langsam spielen;<br />
obwohl streng rhythmisch gespielt wirkt dieses Nachschlagen wie ein ritardando, wie<br />
ein Hinauszögern. Erst zum Schluss, im allerletzten Takt, spielen alle Instrumente<br />
die Quintole im schnellen Tempo. Die irritierende Quintole im Innern hat gesiegt. Unerbittlich.<br />
Das ist der Schluss.<br />
Roman Brotbeck
Zu den Mitwirkenden<br />
Mario Venzago<br />
Mario Venzago ist Chefdirigent des Berner<br />
Symphonieorchesters, Principle Conductor<br />
der Northern Sinfonia Newcastle,<br />
A rtist in Association bei der finnischen<br />
T apiola <strong>Sinfonietta</strong> sowie «Schumann<br />
Dirigent» der Düsseldorfer Symphoniker.<br />
Er wurde in Zürich geboren, studierte u.a.<br />
bei Hans Swarowski in Wien und war<br />
z unächst Konzertpianist beim Rundfunk<br />
der Italienischen Schweiz. Von 2000 bis<br />
2003 war er als Nachfolger von Pinchas<br />
Z ukerman und David Zinman Künstlerischer<br />
Leiter des Baltimore Music Summer<br />
Festes. Venzago dirigierte u.a. die Berliner<br />
Philharmoniker, das Gewandhausorchester<br />
Leipzig, die Orchester von Philadelphia<br />
und Boston, das London Philharmonic Orchestra, das Orchestre Philharmonique<br />
de Radio France, die Filarmonica della Scala und das NHK Symphony Orchestra.<br />
Mehrere seiner CDEinspielungen wurden mit wichtigen Preisen ausgezeichnet. Derzeit<br />
entsteht eine Gesamtaufnahme der BrucknerSymphonien für das Label CPO. Während<br />
fast zehn Jahren bekleidete Mario Venzago überdies eine Professur an der Staatlichen<br />
Musikhochschule Mannheim.<br />
Saxophon-Ensemble XASAX<br />
Unter dem Namen XASAX haben sich 1992 die drei französischen Saxophonisten Serge<br />
Bertocchi, JeanMichel Goury, PierreStéphane Meugé und der Schweizer Marcus Weiss<br />
zu einem SaxophonEnsemble der besonderen Art zusammengetan. Ihre Erfahrungen<br />
als Solisten und Kammermusiker und ihre Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik<br />
sollten in die Entwicklung eines neuen Repertoires für Saxophone einfliessen.<br />
Neben Klassikern spielt das Ensemble vermehrt Kompositionen avancierter Jazzmusiker<br />
wie Elliott Sharp, Alex Buess, Barry Guy und John Zorn. In den letzten zwei Jahren<br />
stehen verschiedenste Werke des italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino im<br />
Zentrum ihres Interesses, so das spektakuläre «La Bocca, i piedi, il suono» für vier<br />
s olistische Altsaxophone und hundert Saxophone. Das Hauptinteresse von XASAX<br />
liegt darin, ihrem jungen Instrument ein eigenes Terrain zu schaffen, verschiedensten<br />
historischen Verbindungen nachzugehen und Fäden zwischen scheinbar fremden<br />
P ositionen zu ziehen.
aktuell<br />
Neu präsentieren wir Ihnen auf diesen Seiten des Konzertprogramm hefts aktuelle Informationen<br />
rund um das Orchester. Hier erfahren Sie mehr über unsere Arbeit und unsere Erfolge, lesen<br />
Berichte über besondere Projekte und Reisen und bekom men zudem unsere kommenden Konzerte<br />
näher vorgestellt. Kurz: Wir möchten Ihnen das mitteilen, was nicht immer in der Zeitung<br />
steht und für Sie dennoch von Interesse sein könnte.<br />
Von alten Gewohnheiten und<br />
neuen Herausforderungen<br />
BILD: ZVG<br />
Neue Kräfte bei der basel sinfonietta: Edith Schoger (links) und Mara Berger.<br />
Seit wenigen Tagen verstärkt Mara Berger als Projektmanagerin das Team der basel sinfonietta.<br />
Edith Schoger sammelt seit zwei Monaten als Praktikantin Erfahrungen im Orchesterbüro. Für<br />
die Newsseite haben sie sich gegenseitig ein paar Fragen gestellt.<br />
Edith Schoger: Liebe Mara, herzlich willkommen<br />
im Team der basel sinfonietta. Worauf<br />
freust du dich hier am meisten?<br />
Mara Berger: Ich freue mich auf neue Herausforderungen<br />
und spannende Projekte. Natürlich<br />
freue ich mich aber am meisten auf den Besuch<br />
der kommenden Konzerte.<br />
Wie hat die basel sinfonietta deine Aufmerksamkeit<br />
auf sich gezogen?<br />
Als ich über das «E.A. Poe Project» von 2011 las,<br />
war ich sofort interessiert mehr über die sinfo-<br />
nie tta zu erfahren. Ich lebe erst seit einem Jahr<br />
in <strong>Basel</strong> und war enttäuscht, das Konzert verpasst<br />
zu haben. Ich liebe die Bücher Poes –<br />
und die Kombination eines avantgardistischen<br />
Stumm films der 30er Jahre mit Debussys impressionistischen<br />
Tönen muss ein tolles Erlebnis<br />
gewesen sein.<br />
Welches ist dein Highlight in dieser Saison?<br />
Als Filmliebhaberin hat mich die Live-Vertonung<br />
des Filmklassikers «Metropolis» sehr fasziniert<br />
und beeindruckt.
Du hast Kunst und Design studiert. Wenn du<br />
an die basel sinfonietta denkst, welches Bild<br />
bringst du damit in Verbindung?<br />
Ich bin Illustratorin und mir kommen sofort die<br />
charmanten Zeichnungen und Filme Loriots<br />
zum Thema Musik in den Sinn. Er selbst war<br />
ein grosser Opernliebhaber und ein begnadeter<br />
Zeichner und Humorist. Natürlich denke ich<br />
aber auch an die Heivisch-Illustrationen in den<br />
Konzertprogrammheften der sinfonietta, welche<br />
jedes Mal so einfallsreich und individuell gestaltet<br />
sind.<br />
Was findest du an der basel sinfonietta am<br />
spannendsten?<br />
Mir gefällt, dass es ein modernes Orchester ist,<br />
das keine Angst vor Experimenten hat.<br />
Was wird man auf deinem Arbeitstisch immer<br />
finden?<br />
Ein Bild von meiner Oma, meine Agenda, ein<br />
Skizzenbuch und Schokolade.<br />
Welches Buch liest du gerade?<br />
«Just Kids», die Biografie von Patti Smith und<br />
«Eine kurze Geschichte des Fortschritts» von<br />
Ronald Wright.<br />
Espresso oder Kaffee Crème?<br />
Schwarztee mit Milch und Zucker.<br />
Mara Berger: Edith, du bist seit zwei Monaten<br />
Praktikantin bei der basel sinfonietta. Was<br />
hast Du bis jetzt bei der sinfonietta gelernt?<br />
Edith Schoger: Dass jedes Konzert anders ist.<br />
Natürlich spreche ich nicht nur von der Musik.<br />
Ich finde es aufregend wie jedes Konzert eine eigene,<br />
spezifische Planung benötigt. Dabei habe<br />
ich gelernt, wie viele verschiedene Instanzen<br />
man koordinieren muss, damit am Schluss ein<br />
erlebnisreicher Abend für das Publikum entsteht.<br />
Welches ist dein Highlight der laufenden Saison?<br />
Schon lange wollte ich den Film «Metropolis»<br />
sehen. Ihn in der Kombination mit Live-Musik<br />
erleben zu dürfen, war grossartig. Auch auf das<br />
Projekt mit Roland Moser freue ich mich. Der<br />
grosse Einblick in die Planung, ein kurzes Treffen<br />
mit Moser und die vorliegende, handgeschriebene<br />
Partitur der Uraufführung tragen zu<br />
einer wachsenden Vorfreude bei.<br />
Du studierst Musikwissenschaften und Germanistik<br />
in Zürich. Welche Bereiche aus Deinem<br />
Studium kannst und möchtest Du bei der<br />
sinfonietta direkt anwenden?<br />
Mir macht es sehr Spass, viel des im Studium Erlernten<br />
endlich mal zu erleben. Gerade die<br />
Übertragung auf neue, für mich auch unbekannte<br />
Stücke – im Gegensatz zu den vielen<br />
Klassikern die man im Studium bespricht –<br />
macht die Arbeit hier sehr reizvoll.<br />
Wie geht dein Weg weiter nach deinem Praktikum<br />
bei uns?<br />
Die Lieblingsfrage jedes Studenten. Sicher will<br />
ich mein Master-Studium abschliessen. Dazu<br />
gehe ich hoffentlich im März für ein Semester<br />
nach Wien, bevor ich dann mein Studium in Zürich<br />
beende. Und was danach kommt…<br />
Wenn Dein Leben ein Musikstück wäre, welchen<br />
Komponisten würdest Du dafür wählen?<br />
Mein Leben vertont – damit würde ich Bartók<br />
oder Smetana beauftragen. Beide können auf<br />
wunderbare Weise Stimmungen vermitteln und<br />
das mit einer Musiksprache, die mir sehr entspricht.<br />
Für die verrückten Seiten ein bisschen<br />
Strawinsky – das ergibt zwar eine seltsame<br />
Kombination, aber das wäre, glaube ich, mein<br />
Leben vertont.<br />
Hund oder Katze?<br />
Definitiv Hund! Katzen und ich vertragen uns<br />
nicht sehr gut.
Konzertvorschau:<br />
Tod, Tränen, Verklärung<br />
Leitung: Timothy Brock<br />
Bass: Dimitry Ivashchenko (Mussorgski) |<br />
Robert Koller (Zimmermann)<br />
Sprecher: Peter Schweiger | Helmut Vogel<br />
Stefano Piffarini (*1980)<br />
Via del Paradiso, sizilianischer Trauermarsch<br />
über einem Thema von Marin Marais (2012) |<br />
Uraufführung<br />
Modest Mussorgski (1839 –1881)<br />
Lieder und Tänze des Todes für Bass und<br />
Orchester (1875/1877) | Orchestrierung von<br />
Dmitri Schostakowitsch (1962)<br />
Bernd Alois Zimmermann (1918 –1970)<br />
Ich wandte mich und sah an alles Unrecht,<br />
das geschah unter der Sonne, ekklesiastische<br />
Aktion für zwei Sprecher, Bass-Solo und<br />
Orchester (1970)<br />
Richard Strauss (1864–1949)<br />
Tod und Verklärung, Tondichtung für grosses<br />
Orchester op. 24 (1890)<br />
<strong>Basel</strong> | Stadtcasino<br />
Sonntag | 26. Januar 2014 | 19 Uhr<br />
Konzerteinführung 18.15 Uhr<br />
BILD: SPEHR + SCHULTHESS<br />
Subventionserhöhung<br />
Am 22. Oktober beantragte der Regierungsrat<br />
<strong>Basel</strong>-Stadt dem Grossen Rat, der basel sinfonietta<br />
ab 2014 Unterstützungsbeiträge in Höhe<br />
von jährlich 334 000 Franken zu bewilligen,<br />
was einer Erhöhung von 100 000 Franken entspricht.<br />
Dazu der Regierungsrat: «Um Planungssicherheit<br />
zu erreichen, ist die basel sinfonietta<br />
auf eine solide erhöhte Sockelfinanzierung<br />
angewiesen. Das Orchester hat sich<br />
durch seine Qualität und sein spezifisches<br />
Programm einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet.<br />
Dies belegt auch die Liste von Konzertauftritten<br />
an renommierten Festivals.»<br />
Conductor in Residence<br />
An einer ausserordentlichen Generalversamm<br />
l ung haben sich die Vereinsmitglieder<br />
der basel sinfonietta entschieden, einen «Conductor<br />
in Residence» zu engagieren. Dieser<br />
soll ab der Saison 2016/17 drei bis vier Sessionen<br />
leiten und so über einen längeren Zeitraum<br />
auf eine kontinuierliche Verbesserung<br />
der klanglichen Qualität hinarbeiten. Eine<br />
Findungskommission, bestehend aus Musikerinnen<br />
und Musikern der basel sinfonietta<br />
sowie einer Vertretung der Geschäftsleitung,<br />
wurde mit der Suche nach einem geeigneten<br />
Kandidaten beauftragt.<br />
Neue Geschäftsleitung<br />
Nach der Trennung von ihrem Geschäftsführer<br />
nutzte der Vorstand der basel sinfonietta<br />
die vergangenen Wochen, um die Organisationsstruktur<br />
des Orchesters und der Geschäftsstelle<br />
neu zu überdenken. Im Zuge dessen<br />
entschied sich der Vorstand für ein Modell<br />
der Co-Leitung und wählte Felix Heri und Eva<br />
Ruckstuhl, welche die Geschäfte der basel sinfonietta<br />
bereits übergangsweise leiteten, einstimmig<br />
zur neuen Geschäftsleitung.
Biographie<br />
basel sinfonietta<br />
Die basel sinfonietta wurde 1980 von jungen Musikerinnen und Musikern mit viel<br />
I dealismus gegründet. Damals und heute ist es das Ziel des Orchesters, zeitgenössische<br />
Musik, Unbekanntes sowie bekannte Werke in neuen Zusammenhängen zu vermitteln.<br />
Das Orchester verwirklichte in seiner Geschichte neben traditionellen Sinfoniekonzerten<br />
zahlreiche grenzüberschreitende Produktionen mit Jazz, Tanz und Performance<br />
sowie diverse Stummfilm und Multimediaprojekte und hat bislang über 50 Uraufführungen,<br />
teilweise als Auftragswerke, realisiert. Mit diesem Blick auf das Unkonventionelle<br />
hat sich die basel sinfonietta als grosses Sinfonieorchester internatio nal einen<br />
Namen gemacht, wobei ein besonderer Schwerpunkt der Neuen Musik gilt.<br />
Die basel sinfonietta ist das einzige Schweizer Orchester, das vier Mal an die Salzburger<br />
Festspiele geladen wurde. Darüber hinaus war der Klangkörper u.a. am Lucerne Festival,<br />
der Biennale di Venezia, der Musica Strasbourg, den Tagen für Neue Musik Z ürich,<br />
dem Festival d’Automne Paris, den Klangspuren Schwaz/Tirol, den Internationalen<br />
F erienkursen für Neue Musik Darmstadt, am Festival für zeitgenössische Musik rainy<br />
days in Luxemburg sowie am Kunstfest Weimar zu Gast.<br />
Die basel sinfonietta arbeitet regelmässig mit hervorragenden Gastdirigenten zusammen:<br />
u.a. Stefan Asbury, Fabrice Bollon, Dennis R. Davies, Mark FitzGerald, Jürg Henneberger,<br />
Peter Hirsch, Michael Hofstetter, Karen Kamensek, Johannes Kalitzke, Jun Märkl, Emilio<br />
Pomàrico, Kasper de Roo, Steven Sloane, Jonathan Stockhammer und Jürg Wyttenbach.<br />
Traditionsgemäss sieht sich das Orchester auch als Förderer von jungen Schweizer<br />
M usiktalenten, die einerseits im Orchester mitwirken oder einen Kompositionsauftrag<br />
erhalten. Darüber hinaus engagiert sich die basel sinfonietta sehr e rfolgreich bei EducationProjekten.<br />
Die Mitglieder der basel sinfonietta wirken freischaffend in verschiedenen Ensembles<br />
und sind des Weiteren als Pädagogen tätig. Das Modell der Selbstverwaltung bietet<br />
den MusikerInnen grosse Mitsprachemöglichkeit in künstlerischen sowie organisatorischen<br />
Fragen und fördert eine lebendige und frische Orchesterkultur.<br />
Die basel sinfonietta wird u.a. durch die Kantone <strong>Basel</strong>Stadt und <strong>Basel</strong>Landschaft<br />
u nterstützt.<br />
www.baselsinfonietta.ch<br />
www.facebook.com/baselsinfonietta<br />
Vorstand der basel sinfonietta: Georges Depierre (Violoncello), Wipke Eisele (Violine),<br />
Thomas Nidecker (Posaune), Sylvia Oelkrug (Violine), Bernd Schöpflin (Kontrabass), Udo Schmitz<br />
(Horn), Benedikt Vonder Mühll (Kontrabass), Christine Wagner (Viola), Barbara Weishaupt<br />
( Violoncello)<br />
Geschäftsstelle der basel sinfonietta: Felix Heri (Geschäftsleitung und Konzertorganisation),<br />
Eva Ruckstuhl (Geschäftsleitung und Öffentlichkeitsarbeit), Susanne Jani (Personalbüro und<br />
Buchhaltung), Mara Berger (Projektmanagement), Edith Schoger (Praktikum)
Ein Schluck <strong>Basel</strong><br />
www.ralphdinkel.ch<br />
Wir wünschen Ihnen einen spannenden Abend.<br />
Brauerei Fischerstube ·www.uelibier.ch<br />
Musik ist unser Markenzeichen.<br />
Blasinstrumente, Flügel und Klaviere, Keyboards,<br />
Schlaginstrumente, Rhythmusinstrumente,<br />
Saiteninstrumente, Mietinstrumente, Werkstätten,<br />
Zubehör, Musikbücher, Musiknoten, Musiksoftware,<br />
CDs und DVDs.<br />
<strong>Basel</strong>, Freie Strasse 70, Telefon 061 272 33 90, Fax 061 272 33 52<br />
www.musikhug.ch
Donatoren<br />
Elektra Birseck (EBM), Münchenstein<br />
IWB (Industrielle Donatoren Werke <strong>Basel</strong>)<br />
MCH Donatoren Group<br />
Schild Donatoren AG, Liestal<br />
Geschäftsstelle<br />
basel sinfonietta<br />
Postfach 131<br />
4018 <strong>Basel</strong><br />
T +41 (0)61 335 54 15<br />
F +41 (0)61 335 55 35<br />
info@baselsinfonietta.ch<br />
www.baselsinfonietta.ch<br />
Programmgruppe<br />
Cornelius Bauer, Regula Bernath, Georges Depierre, Martin Jaggi, Marc Kilchenmann,<br />
Ulla Levens, Benedikt Vonder Mühll, Thomas Nidecker, Regula Schädelin, David Sontòn Caflisch,<br />
Guido Stier, Takashi Sugimoto, Franco Tosi, Ruth Wäffler, Christine Wagner<br />
Impressum<br />
Redaktion: Eva Ruckstuhl<br />
Gestaltung: WOMM Werbeagentur AG, <strong>Basel</strong><br />
Druck: Schwabe AG, Muttenz<br />
Textnachweise<br />
Originalbeitrag von Roman Brotbeck<br />
Bildnachweise<br />
Titelbild: Spehr + Schulthess<br />
Seite 4: Getty Images<br />
Seite 7: Renate Wernli<br />
Seite 11: István Huszti<br />
Seite 13: zVg
Herzlichen Dank<br />
Herzlichen Dank<br />
Die basel sinfonietta dankt den Gemeinden Aesch, Allschwil, Arlesheim, BielBenken,<br />
Binningen, Bottmingen, Oberwil, Pfeffingen, Reinach und Therwil für die Unterstützung.<br />
Insbesondere aber danken wir allen Mitgliedern des Fördervereins der basel<br />
s infonietta, namentlich den Patronatsmit gliedern:<br />
Katharina & Manuel AebyHammel<br />
Ilse AndresZuber<br />
Maria & Franz BergerCoenen<br />
Ruth & Hansueli Bernath<br />
Erika BinkertMeyer<br />
Peter & Rita BlochBaranowski<br />
Hansjörg Blöchlinger & Dorothea Seckler<br />
Ulrich Blumenbach<br />
Markus R. Bodmer<br />
Peter Boller<br />
Bettina Boller Andreae<br />
Yvonne & Michael Böhler<br />
Elisabeth & Urs Brodbeck<br />
Susanne & Max Brugger<br />
Sigrid Brüggemann<br />
Christine & Bernhard Burckhardt<br />
Leonhard Burckhardt<br />
David Thomas Christie<br />
Fitzgerald Crain<br />
Martin Derungs<br />
MarieChristine & Patrick J. Dreyfus<br />
Paul J. Dreyfus<br />
Norbert & Sabine EgliRüegg<br />
Jürg Ewald & Urte Dufner<br />
Peter Facklam<br />
Charlotte Fischer<br />
Esther Fornallaz<br />
Andreas Gerwig<br />
Sabine Goepfert<br />
Ulrich P. H. Goetz<br />
Annetta & Gustav Grisard<br />
Annagret & Kurt GublerSallenbach<br />
Walter GürberSenn<br />
Ursula & Josef Hofstetter<br />
Bernhard Hohl & Susanne Clowry<br />
Madeleine Hublard<br />
Gertrud HublardSieber<br />
Bianca HumbelRizzi<br />
B. & G. IlaryKopp<br />
Graziella & Ruedi Isler<br />
Verena & Hans KappusWinkler<br />
Luzia & Jan KonecnySprecher<br />
Alexander Krauer<br />
MarieThérèse KuhnSchleiniger<br />
Christian Lang<br />
Irma Laukkanen<br />
Manuel Levy<br />
René Levy<br />
Annemarie & Thomas MartinVogt<br />
Beat MeyerWyss<br />
Thomas Metzger<br />
Andreas Nidecker<br />
Rosmarie NideckerHuggenberg<br />
Catherine Oeri<br />
Madeleine & Pietro Pezzoli<br />
Nicolas Ryhiner & Beatrice Zurlinden<br />
Regula & Jürg Schädelin<br />
Evi & Andres SchaubKeiser<br />
Charlotte & Peter Schiess<br />
Herbert Schill & Dora Eberhart<br />
René SchluepZimmermann<br />
Beat Schönenberger<br />
Christine Striebel<br />
Katharina StriebelBurckhardt<br />
Brigitte & Moritz Suter<br />
Nora & Daniel Suter<br />
Philipp Sutter<br />
Monica Thommy<br />
Irene & Hans TroxlerKeller<br />
Verena Trutmann<br />
Christine Vischer<br />
Heinrich A. Vischer<br />
Rudolf Vonder Mühll<br />
MarieChristine WackernagelBurckhardt<br />
Philipp Weber<br />
Marianne & Daniel WeidmannMunk<br />
Alfred Weishaupt<br />
Anna Wildberger<br />
Peter A. Zahn<br />
Auch danken wir den zahlreichen Spenderinnen und Spendern, die nicht genannt<br />
w erden möchten.
Förderverein<br />
Die basel sinfonietta erweitert ihren Freundeskreis<br />
– seien Sie auch dabei!<br />
Seit über 30 Jahren steht die basel sinfonietta für ungewöhnliche und aufregende Programme,<br />
Neuentdeckungen, Ausgrabungen, Uraufführungen sowie hohe künstlerische<br />
Qualität. Ein «Geheimtipp» ist sie schon lange nicht mehr, wie zahlreiche Einladungen<br />
an Internationale Festivals bezeugen. So ist die basel sinfonietta das einzige Schweizer<br />
Orchester, das vier Mal an den Salzburger Festspielen zu Gast war.<br />
Unterstützen Sie <strong>Basel</strong>s ungewöhnlichstes Orchester, ohne welches das Musikleben der<br />
Schweiz um Vieles ärmer wäre, und werden Sie und Ihre Familie Mitglied im Förderver -<br />
ein der basel sinfonietta. Ihr Einsatz: Bereits ab CHF 50 jährlich können Sie dem Verein<br />
beitreten. Ihre Vorteile einer Mitgliedschaft: ein exklusives Gönnerkonzert, Einladungen<br />
zu Probenbesuchen und regelmässige Informationen über die Kon zerte der basel sinfonietta.<br />
Patronatsmitglieder erhalten zudem die Doppel-CD der basel sinfonietta mit der<br />
Filmmusik zu Das neue Babylon von Dmitri Schostakowitsch.<br />
Jedes Mitglied zählt: Die basel sinfonietta braucht Ihre Unterstützung!<br />
Freundliche Grüsse<br />
Maria Berger, Präsidentin Förderverein basel sinfonietta<br />
Ja, ich möchte Mitglied im Förderverein basel sinfonietta werden.<br />
Einzelmitglieder CHF 50<br />
Ab CHF 1000 sind Sie zum Bezug von<br />
Privatperson als Patronatsmitglied ab CHF 200<br />
12 Freikarten pro Saison berechtigt.<br />
Paare/Familien CHF 80<br />
Patronatsmitglieder werden in den<br />
Firma als Patronatsmitglied ab CHF 1000<br />
Pro grammheften aufgeführt.<br />
Vorname, Name<br />
Strasse<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon, Fax<br />
e-Mail<br />
Datum, Unterschrift