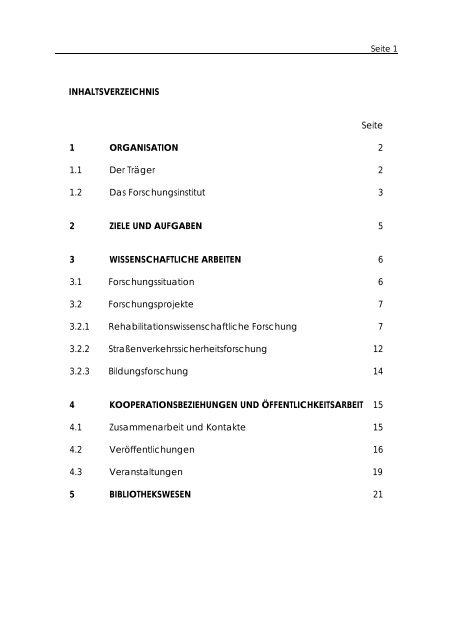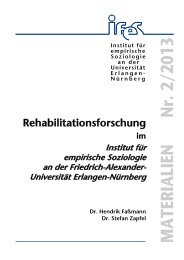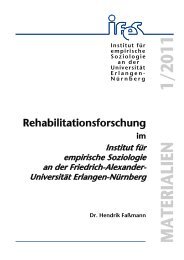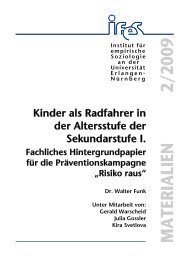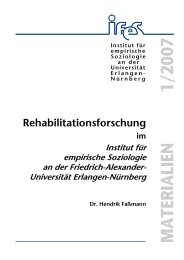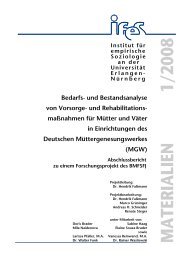Tätigkeitsbericht 2003/2004 - IfeS - Friedrich-Alexander-Universität ...
Tätigkeitsbericht 2003/2004 - IfeS - Friedrich-Alexander-Universität ...
Tätigkeitsbericht 2003/2004 - IfeS - Friedrich-Alexander-Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 1<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Seite<br />
1 ORGANISATION 2<br />
1.1 Der Träger 2<br />
1.2 Das Forschungsinstitut 3<br />
2 ZIELE UND AUFGABEN 5<br />
3 WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN 6<br />
3.1 Forschungssituation 6<br />
3.2 Forschungsprojekte 7<br />
3.2.1 Rehabilitationswissenschaftliche Forschung 7<br />
3.2.2 Straßenverkehrssicherheitsforschung 12<br />
3.2.3 Bildungsforschung 14<br />
4 KOOPERATIONSBEZIEHUNGEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 15<br />
4.1 Zusammenarbeit und Kontakte 15<br />
4.2 Veröffentlichungen 16<br />
4.3 Veranstaltungen 19<br />
5 BIBLIOTHEKSWESEN 21
Seite 2<br />
1 ORGANISATION<br />
1.1 Der Träger<br />
Das Institut für empirische Soziologie an der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg<br />
wurde im Jahre 1950 von der Gesellschaft für empirische soziologische<br />
Forschung e.V. als dem Trägerverein in der Nachfolge des Instituts für Begabtenforschung<br />
am Niedersächsischen Kultusministerium als unabhängiges<br />
wissenschaftliches Forschungsinstitut gegründet. Seinen Sitz hatte es zunächst in<br />
Hannover, ab 1955 wie die Trägergesellschaft in Nürnberg.<br />
Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der empirischen soziologischen<br />
Forschung auf freier wissenschaftlicher Grundlage, insbesondere durch<br />
die Unterhaltung eines Instituts für empirische Soziologie. Die Gesellschaft ist nicht<br />
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet, sondern der verfolgte<br />
Zweck ist ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig.<br />
Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung und das<br />
Kuratorium.<br />
Der V o r s t a n d, der die Gesellschaft nach außen vertritt, besteht aus dem<br />
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem geschäftsführenden<br />
Vorsitzenden.<br />
Vorsitzender des Vorstandes ist derzeit Herr Dr. Walter H. Schusser, München;<br />
stellvertretender Vorsitzender Herr Direktor Wolfgang Schmeinck, Essen; geschäftsführender<br />
Vorsitzender ist Herr Präsident Dr. Herbert Rische, Berlin. Der Vorstand<br />
war am 10. Oktober 2002 von der Mitgliederversammlung wieder gewählt<br />
worden. Seine Amtszeit beträgt zwei Jahre; nach der Satzung bleibt er jedoch<br />
bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt.<br />
Mitglieder der Gesellschaft für empirische soziologische Forschung e.V. sind natürliche<br />
und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts.<br />
Der M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g obliegt die Bestellung des Vorstandes,<br />
die Entgegennahme des Jahresberichtes, die Prüfung und Genehmigung des<br />
Jahresabschlusses und die Entlastung des Vorstandes. Laut Satzung muß jedes<br />
Jahr eine Mitgliederversammlung stattfinden.<br />
Das K u r a t o r i u m wird vom Vorstand berufen und steht ihm bei der Durchführung<br />
der Aufgaben der Gesellschaft beratend zur Seite. Insbesondere soll es<br />
um eine enge Verbindung der Gesellschaft mit der Wissenschaft, der Wirtschaft<br />
und der Öffentlichkeit bemüht sein. Das Kuratorium besteht aus dem Vorstand<br />
und Persönlichkeiten des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens.
Seite 3<br />
1.2 Das Forschungsinstitut<br />
Die Gesellschaft für empirische soziologische Forschung e.V. unterhält gemäß ihrer<br />
Satzungsbestimmungen das Institut für empirische Soziologie an der <strong>Friedrich</strong>-<br />
<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg, das 1950 seine wissenschaftliche Arbeit<br />
aufgenommen hat.<br />
Das Institut hat den Status eines Instituts an der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg,<br />
um sowohl seine Verbindung zur wissenschaftlichen Forschung<br />
und Lehre an der Universität als auch seine Unabhängigkeit gegenüber wirtschaftlichen<br />
und gesellschaftlichen Gruppen zu betonen.<br />
Bis zu seinem Tode im Jahre 1963 war Herr Prof. Dr. Karl Valentin Müller wissenschaftlicher<br />
Direktor dieses Instituts, dem der damalige Inhaber des Lehrstuhls für<br />
Soziologie, Herr Prof. Dr. Karl Gustav Specht, folgte. Nach dessen überraschendem<br />
Tod im Jahre 1980 leitete Herr Dr. Rainer Wasilewski das Forschungsinstitut<br />
bis 1983, als der Lehrstuhlnachfolger, Herr Prof. Dr. Günter Büschges, die Leitung<br />
dieses Instituts übernahm und sie im Jahre 2001 an seinen Nachfolger auf dem<br />
Lehrstuhl, Herrn Prof. Dr. Johann Bacher, übergab.<br />
Geschäftsführer des Instituts ist Herr Dr. Rainer Wasilewski, stellvertretender Geschäftsführer<br />
Herr Dr. Hendrik Faßmann.<br />
Das Institut für empirische Soziologie beschäftigt einen kleinen Stamm von Wissenschaftlern/-innen,<br />
der je nach Art und Umfang der Forschungsaufgaben<br />
durch zusätzliche Mitarbeiter/-innen erweitert wird. Die Forschungsaufgaben<br />
werden durch interdisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppen wahrgenommen,<br />
wobei nach Bedarf Experten/-innen einzelner wissenschaftlicher Fachrichtungen<br />
zur Beratung und zur Bearbeitung von Teilaufgaben herangezogen werden.<br />
Im Institut waren im Berichtszeitraum ständig oder zeitweise folgende wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter/-innen tätig:<br />
Frau Dipl. Sozialwirtin Doris Brader<br />
Herr Dipl. Sozialwirt Michael Ellinger<br />
Herr Dr. rer. pol. Hendrik Faßmann<br />
Herr Dr. rer. pol. Walter Funk<br />
Frau Dipl. Sozialwirtin Birgit Lechner<br />
Frau Dipl. Volkswirtin Julia Lewerenz<br />
Frau Dipl. Sozialwirtin Renate Steger<br />
Herr Dipl. Sozialwirt Christian Walter<br />
Frau Dipl. Sozialwirtin Christina Wübbeke
Seite 4<br />
Herr Dipl. Sozialwirt Ralf Zimmermann<br />
Die Verwaltungsaufgaben von Institut und Gesellschaft werden wahrgenommen<br />
von:<br />
Frau Sigrid Albrecht (wissenschaftliche Fachbibliothek)<br />
Frau Heike Streipert (Buchhaltung und Sekretariat)<br />
Darüber hinaus waren im Institut im Berichtszeitraum folgende wissenschaftliche<br />
bzw. studentische Assistenzkräfte und Praktikanten/-innen tätig:<br />
Herr cand. rer. pol. Dani Dinu<br />
Frau cand. rer. pol. Agnes Dundler<br />
Herr cand. rer. pol. Axel Eilenberger<br />
Frau cand. rer. pol. Verena Fichtelmann<br />
Frau cand. rer. pol. Barbara Hasselmann<br />
Frau cand. rer. pol. Irene Hohlheimer<br />
Frau Soziologin M.A. Yuriko Inoue<br />
Herr cand. rer. pol. Robert Jentzsch<br />
Frau cand. rer. pol. Daniela Mattern<br />
Frau cand. rer. pol. Bianca Lenz<br />
Frau cand. rer. pol. Kalina Lipinska<br />
Herr cand. rer. pol. Harald Mederer<br />
Frau cand. rer. pol. Mila Naidenowa<br />
Herr cand. rer. pol. Clemens Ohlert<br />
Frau cand. rer. pol. Christiane Papenroth<br />
Frau cand. rer. pol. Anja Spengler<br />
Herr cand. phil. Jens Stegmaier<br />
Frau cand. rer. pol. Christina Tischer<br />
Die Studierenden können im Rahmen ihrer Mitarbeit wesentliche Erfahrungen im<br />
Hinblick auf die Forschungspraxis erwerben. Darüber hinaus wird immer wieder<br />
die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen von Projekten Diplomarbeiten anzufertigen,<br />
die häufig auch – in Absprache mit den betreffenden Lehrstühlen der <strong>Friedrich</strong>-<br />
<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg - von Wissenschaftlern/-innen des Instituts<br />
betreut werden. Damit leistet das Institut einen bemerkenswerten Beitrag zur<br />
praxisorientierten Ausbildung von Studierenden aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.<br />
Die Räumlichkeiten des Instituts befinden sich nahe des Stadtzentrums und des<br />
Hauptbahnhofs von Nürnberg in der Marienstraße 2. Sie sind dem Institut für Freie<br />
Berufe an der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg benachbart,<br />
mit dem das Institut für empirische in enger wissenschaftlicher und organisatorischer<br />
Kooperation steht.
Seite 5<br />
2 Ziele und Aufgaben<br />
Ziel der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts ist es, in der angewandten empirischen<br />
soziologischen Forschung mittels empirischer Untersuchungen bestehendes<br />
Wissen zu sichern und zu vertiefen und darauf aufbauend neue Einsichten<br />
und Erkenntnisse zu erlangen, die sowohl als Beitrag zur Erweiterung theoretischer<br />
Überlegungen als auch zur Umsetzung in praktisches Handeln dienen können.<br />
Diese Ausrichtung an einer anwendungsorientierten Forschungsleitlinie erfordert<br />
zum einen eine ständige Perzeption der Entwicklung von Theorie und<br />
Empirie in den Sozialwissenschaften und verpflichtet das Institut zum anderen zu<br />
einem stetigen und intensiven Dialog mit der Praxis und den dort verantwortlichen<br />
Entscheidungsträgern.<br />
Dieser Zielsetzung versucht das Institut durch die Wahrnehmung von Forschungsaufgaben<br />
in der Grundlagenforschung und in der anwendungsorientierten<br />
Auftragsforschung nahezukommen, wobei aber keineswegs eine Trennlinie<br />
zwischen diesen Forschungspositionen gezogen wird, sondern beide gegenseitiger<br />
Durchdringung und Befruchtung unterliegen. Die Teilhabe am Erkenntnisfortschritt<br />
in den Sozialwissenschaften ist damit gleichzeitig auch Beitrag zur Sicherung<br />
einer optimalen Entscheidungsfindung in der Praxis.<br />
Das Institut hat es sich darüber hinaus zur Aufgabe gemacht, Ergebnisse seiner<br />
Forschungsarbeit neben den Fachwissenschaftlern/-innen auch einem breiteren<br />
Kreis von an diesen Problemen Interessierten zugänglich zu machen.<br />
Als Forum dieser Bemühungen dienen die Jahresversammlungen der Gesellschaft<br />
für empirische soziologische Forschung e.V., zu denen ausgewählte Persönlichkeiten<br />
aus Wissenschaft und Praxis eingeladen werden, und in deren<br />
Rahmen Fragestellungen und Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung des<br />
Instituts vorgelegt und zur Diskussion gestellt werden. Der Information der Öffentlichkeit<br />
in Wissenschaft und Praxis über Aufgaben und Arbeiten des Instituts dienen<br />
darüber hinaus die Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen und Forschungsberichten.<br />
Das Institut finanziert sich fast ausschließlich aus Mitteln ihm übertragener Forschungsarbeiten.<br />
Daneben fließen dem Institut zur Finanzierung der Grundkosten<br />
in geringem Maße Spenden und Beiträge der Mitglieder der Gesellschaft für<br />
empirische soziologische Forschung e.V. zu. Das Institut erhält über diese Mittel<br />
hinaus keinerlei projektunabhängige Zuschüsse oder Zuwendungen durch private<br />
oder öffentliche Institutionen.
Seite 6<br />
3 Wissenschaftliche Arbeiten<br />
3.1 Forschungssituation<br />
Vor dem Hintergrund der weiterhin angespannten allgemeinen wirtschaftlichen<br />
Situation sind auch die Forschungsmöglichkeiten freier Forschungsinstitute – wie<br />
des Instituts für empirische Soziologie – kritisch zu beurteilen. So sind gerade die<br />
von ihnen angebotenen Dienstleistungen häufig in besonderem Maße von Einsparungen<br />
betroffen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Öffentlichen<br />
Hand, dem immer weniger Mittel zur Programmentwicklung und –evaluation zur<br />
Verfügung stehen. So weit Vorhaben überhaupt noch ausgeschrieben werden,<br />
konkurrieren hier nunmehr über die herkömmlichen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Forschungsinstitute hinaus in zunehmendem Maße rein kommerziell<br />
ausgerichtete Marktforschungsinstitute und in neuerer Zeit vor allem auch Organisationsentwickler<br />
und Unternehmensberater. Auf der anderen Seite drängen<br />
um Drittmittel bemüht universitäre Einrichtungen in den Markt, die aufgrund ihrer<br />
institutionellen Anbindung konkurrenzlos günstig anbieten können, auch wenn<br />
nicht immer sicher ist, ob sie übernommene Aufträge tatsächlich auch in angemessener<br />
Qualität im gegebenen Zeitrahmen bewältigen können. Schließlich<br />
haben sich öffentliche Institutionen – von Bundesministerien und Länderbehörden<br />
über öffentliche Körperschaften bis hin zu kommunalen Planungseinrichtungen<br />
– eine Vielzahl von Forschungsinstitutionen (Ressortforschung, Forschungsverbünde)<br />
und Beratungsstäben geschaffen, die in erheblichem Maße den Forschungs-<br />
und Entwicklungsbedarf bei Planung und Entscheidung für öffentliche<br />
Aufgaben abdecken und damit die Vergabe von Forschungsaufträgen an freie<br />
Forschungsinstitute wesentlich erschweren oder sogar erübrigen.<br />
Trotz dieser veränderten und sich weiter verändernden Situation im Bereich der<br />
anwendungsorientierten sozialwissenschaftlichen Forschung ist es dem Institut für<br />
empirische Soziologie auch im Berichtszeitraum erfolgreich gelungen, sich zu<br />
behaupten. Die nachfolgend dargestellten Forschungsarbeiten vermitteln davon<br />
einen Eindruck.
Seite 7<br />
3.2 Forschungsprojekte<br />
3.2.1 Rehabilitationswissenschaftliche Forschung<br />
Die wissenschaftliche Begleitung der seit 1999 laufenden Modellinitiative der<br />
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation<br />
„REGIonale NEtzwerke zur beruflichen Rehabilitation<br />
(lern-)behinderter Jugendlicher (REGINE)“<br />
wurde zum Ende des Jahres <strong>2003</strong> mit Vorlage eines umfangreichen Abschlußberichts<br />
erfolgreich abgeschlossen.<br />
Anliegen des Entwicklungsprojekts war es, die Ausgestaltung und Umsetzung des<br />
neuen Lernorts „Betriebliche Ausbildung und reha-spezifische Förderung durch<br />
einen Bildungsträger“ der ortsnahen Berufsausbildung kontrolliert zu erproben,<br />
auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen und ggf. zu optimieren. Beginnend mit<br />
dem Schulabschlußhalbjahr 1998/99 wurden sukzessive vier Jahrgänge lernbehinderter<br />
Jugendlicher an neun Standorten bundesweit einbezogen. Dabei sollte<br />
die Begleitforschung nicht nur prozeßbegleitend ergebnisorientiert arbeiten<br />
(summative Evaluation), sich also auf die Feststellung von Rehabilitationserfolgen<br />
beschränken. Vielmehr sollte sie durch formative Evaluation auch einen Beitrag<br />
zur Konzeptentwicklung und –präzisierung des neuen Lernortes leisten.<br />
Das Modellprojekt REGINE hat gezeigt, daß es möglich ist, Jugendliche mit<br />
(Lern-) Behinderungen unter „normalen“ Bedingungen erfolgreich betrieblich<br />
auszubilden: Bedingung ist, daß dabei nicht nur die Auszubildenden, sondern vor<br />
allem auch die Betriebe ausbildungsbegleitend durch Bildungsträger unterstützt<br />
werden. Kann dieses den Arbeitgebern plausibel vermittelt und erfahrbar gemacht<br />
werden, so sind diese durchaus bereit, Menschen mit Behinderungen<br />
auszubilden. Mehr als die Hälfte (55%) der TeilnehmerInnen des ersten einbezogenen<br />
Jahrganges beendeten die Ausbildung erfolgreich. 87% der Jugendlichen,<br />
die an der Abschluß- bzw. Wiederholungsprüfung teilnahmen, erreichten<br />
den Ausbildungsabschluß. Von ihnen wurden zwei Fünftel im Ausbildungsbetrieb<br />
weiterbeschäftigt; insgesamt ist mehr als die Hälfte ausbildungsadäquat tätig.<br />
Allerdings gilt es jedoch noch eine Reihe von Problemen zu lösen, um die Ausbildungserfolge<br />
zu optimieren: Demnach ist es erforderlich, die Teilnehmer/-innen-<br />
Auswahl zu verbessern, die bisher oftmals zu spät erfolgt und sich nicht immer als<br />
paßgenau erweist. Zudem gelingt es vielfach nicht, adressatengerechte Ausbildungsbetriebe<br />
zu akquirieren. Als „Achillesferse“ des neuen Lern-orts muß<br />
schließlich die (Regel-)Berufsschule angesehen werden, kann sie doch in der<br />
Regel den Bedürfnissen gerade von lernbehinderten Auszubildenden nicht ge-
Seite 8<br />
recht werden. Diese Defizite müssen daher von den eingebundenen Bildungsträgern<br />
kompensiert werden.<br />
Abgesehen von der Präsentation wichtiger Projektergebnisse in Form von Protokollen,<br />
jährlichen Berichten und anderen Publikationen konnten im Rahmen des<br />
Projekts weitere wichtige Produkte erarbeitet werden: So wurden etwa die Dokumentationsunterlagen,<br />
die zunächst nur für Zwecke der prozeßbegleitenden<br />
Evaluation vorgesehen waren, in einigen Einrichtungen in Instrumente überführt,<br />
die dort routinemäßig zum Assessment und zur Maßnahmedokumentation verwendet<br />
werden, und wurden gelegentlich sogar in das einrichtungsinterne Qualitätssicherungshandbuch<br />
aufgenommen. Dies gilt auch im Hinblick auf die<br />
REGINE-Arbeitsstandards, die im Projektverlauf entwickelt und publiziert werden<br />
konnten: Dies geschah im Rahmen überregionaler Workshops, die von der Begleitforschung<br />
vorbereitet und moderiert wurden und an denen neben den Bildungsträgern<br />
auch die Reha-Berater/-innen der Arbeitsagenturen an den Projektstandorten<br />
sowie Vertreter/-innen von Bundesministerium für Gesundheit und<br />
Soziale Sicherung, Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und Bundesagentur<br />
für Arbeit teilnahmen. Diese Workshops dienten darüber hinaus auch<br />
dem überregionalen Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den Projektpartnern.<br />
Viele dieser Kontakte werden auch nach Projektende weiter aufrecht<br />
erhalten und bei Bedarf problemorientiert in Anspruch genommen.<br />
Der REGINE-Abschlußbericht wurde vom Bundesministerium für Gesundheit und<br />
Soziale Sicherung veröffentlicht und kann im Internet unter der Adresse des Ministeriums<br />
http://www.bmgs.bund.de/download/broschueren/FC311.PDF sowie<br />
der Materialien (Heft 1/<strong>2004</strong>) des Instituts für empirische Soziologie an der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität<br />
Erlangen-Nürnberg http://www.ifes.uni-erlangen.de/<br />
pub/pdf/m_1_<strong>2004</strong>.pdf heruntergeladen bzw. bestellt werden.<br />
Nach Vorlage des Abschlußberichts bestand unter den Projektpartnern Übereinstimmung,<br />
die Ergebnisse des Modellprojekts REGINE nicht nur zu publizieren,<br />
sondern auch einem breiten Interessenten/-innenkreis vorzustellen, um auf einen<br />
effektiven Transfer der Modellerfahrungen hinwirken zu können. Insbesondere<br />
sollten Möglichkeiten erwogen werden, jene Hindernisse zu beseitigen, die bisher<br />
einer Umsetzung des wohnortnahen Berufsförderungskonzepts entgegenstehen,<br />
um dieses dauerhaft etablieren zu können. Das Institut für empirische Soziologie<br />
wurde daher beauftragt, eine entsprechende Transferveranstaltung zu konzipieren,<br />
zu moderieren und die erzielten Ergebnisse öffentlichkeitswirksam zu dokumentieren.<br />
In enger Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation<br />
und dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung und<br />
unter der Schirmherrschaft des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange<br />
behinderter Menschen wurde daher am 21. April <strong>2004</strong> die
Seite 9<br />
Fachtagung<br />
„Betriebliche Ausbildung behinderter Jugendlicher<br />
Chancen, Erfahrungen und Grenzen“<br />
im Kleisthaus in Berlin durchgeführt. An der Veranstaltung nahmen knapp 100<br />
Vertreter/-innen von Rehabilitationsträgern, Schulbehörden, Sozialpartnern,<br />
Selbsthilfeverbänden, Sozialpolitik und Wissenschaft teil. Diese erarbeiteten<br />
nach einem Übersichtsreferat der REGINE-Begleitforschung in themenbezogenen<br />
Arbeitsgruppen eine Reihe von Ansätzen zur Optimierung des neuen Lernorts.<br />
Die Publikation der Tagungsergebnisse wird derzeit vorbereitet.<br />
Fortgeführt wurde im Berichtszeitraum die Arbeit am Modellprojekt<br />
Case Management zur Erhaltung von Arbeits- und<br />
Ausbildungsverhältnissen behinderter Menschen (CMB),<br />
das in Kooperation mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung<br />
und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation wissenschaftlich begleitet<br />
wird. Dieses Case Management dient dazu, das Verfahren zur Fortsetzung<br />
oder Wiederaufnahme der alten oder angepaßten beruflichen Tätigkeit oder<br />
Ausbildung im bisherigen Betrieb schneller, zielgenauer und sparsamer durchzuführen.<br />
Durch Maßnahmen wie behinderungsgerechte Ausstattung des bisherigen<br />
Arbeitsplatzes, Änderung der Arbeitsorganisation, Umsetzung, Schaffung eines<br />
neuen Arbeitsplatzes oder Weiterbildung in enger Kooperation mit dem Betrieb<br />
sollen die negativen Auswirkungen der Behinderung auf die Beschäftigung<br />
kompensiert werden. Die Case Manager/-innen fungieren dabei als Vermittler<br />
zwischen Rehabilitand/-in, Arbeitgeber und anderen Rehabilitationsträgern sowie<br />
allen weiteren relevanten Stellen und Diensten. In Abstimmung mit diesen<br />
wird festgelegt, welche Hilfen der / die Klient/-in benötigt, um das bisherige Arbeitsverhältnis<br />
fortführen zu können.<br />
Ziel des Projekts ist die Erprobung von Case Management an etwa fünfzehn verschiedenen<br />
Standorten in der Bundesrepublik Deutschland über einen Zeitraum<br />
von drei Jahren hinweg. Geprüft werden soll, unter welchen Rahmenbedingungen<br />
Case Management optimal ausgestaltet werden kann. Dabei ist grundsätzlich<br />
offen, ob es mit eigenen personellen Ressourcen der zuständigen Rehabilitationsträger<br />
oder durch „eingekaufte“ Dienstleister verwirklicht wird. Insbesondere<br />
geht es darum, Entscheidungshilfen zur Schaffung rechtlicher Grundlagen für eine<br />
künftige institutionelle Förderung des Case Managements für alle in Frage<br />
kommenden Rehabilitationsträger zu liefern.<br />
Die wissenschaftliche Begleitung hat die Aufgabe, durch formative Evaluation<br />
im engen praxisorientierten Dialog mit den Projektnehmern einen Beitrag zur
Seite 10<br />
Konzeptentwicklung und -präzisierung sowie zur Implementation von Case Management<br />
und damit zu seiner Qualitätssicherung zu leisten. Dabei steht das Forschungsteam<br />
über die gesamte Projektlaufzeit im engen Kontakt mit den durchführenden<br />
Stellen an den Projektstandorten. Demgegenüber dient die summative<br />
Evaluation dazu, die Effektivität der einzelnen Aktivitäten des Modellprojekts<br />
zu überprüfen. Zu beantworten ist schließlich die Frage nach den Möglichkeiten<br />
und Grenzen sowie des Transfers des Modells in ein allgemeines Konzept für ein<br />
Case Management zum Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen von Behinderten.<br />
Im Rahmen des Forschungsprogramms kommen im wesentlichen qualitative Methoden<br />
(z.B. qualitative Interviews, Durchführung von Workshops und Groß-)<br />
Gruppenveranstaltungen), aber auch quantitative Verfahren (z.B. Dokumentation<br />
von Prozeßdaten, Fragebogenerhebungen) zum Einsatz.<br />
Das Modellprojekt endet mit der Vorlage des Abschlußberichts zum Jahresende<br />
<strong>2004</strong>. Zwischenberichte wurden in den Materialien Heft 3/2002 und Heft 5/<strong>2003</strong><br />
veröffentlicht und können auf der Homepage des Institut für empirische Soziologie<br />
an der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg bestellt bzw. unter<br />
den Adressen http://www.ifes.uni-erlangen.de/pub/pdf/m_3_2002.pdf und<br />
http://www.ifes.uni-erlangen.de/pub/pdf/m_3_2002.pdf heruntergeladen werden.<br />
Fortgesetzt wurde auch die vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale<br />
Sicherung und dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,<br />
Familie und Frauen geförderten Begleitforschung des über fünf Beobachtungsjahre<br />
laufenden Modellprojekts<br />
Intergrative Berufliche Rehabilitation von<br />
Personen mit Aphasie (IBRA).<br />
Gegenstand des Modellprojekts ist ein neues Konzept zur beruflichen Wiedereingliederung<br />
von Aphasikern/-innen, das in Kooperation von Berufsförderungswerk<br />
Nürnberg gGmbH und Kiliani-Klinik, Bad Windsheim, erprobt werden soll.<br />
Ziel des Projekts ist die Überwindung bisher unzulänglicher Strukturbedingungen<br />
von beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen für Personen mit Aphasie. Mit dem<br />
Konzept werden angestrebt<br />
‣ die Steigerung der Maßnahmeneffektivität durch<br />
• interdisziplinäre, synergetische Kooperation im Rahmen von Assessment,<br />
Qualifizierung und (Re-)Integration der Aphasiker/-innen,
Seite 11<br />
• adressatengerechte Gestaltung und Umsetzung der Qualifizierungsund<br />
Betreuungsangebote,<br />
• Sicherung hoher Qualitätsstandards durch professionelles Reha-<br />
Management und Qualifizierungsmaßnahmen für das Fachpersonal,<br />
‣ die Steigerung der Maßnahmeneffizienz durch<br />
• Vernetzung der Modellpartner,<br />
• Verkürzung des gesamten Rehabilitationsprozesses,<br />
• Kostenreduktion.<br />
Die wissenschaftliche Begleitung hat zunächst die Aufgabe, durch formative E-<br />
valuation im engen praxisorientierten Dialog mit den Projektpartnern einen Beitrag<br />
zur Konzeptentwicklung und -präzisierung sowie zur Implementation des<br />
IBRA-Konzepts und damit zu seiner Qualitätssicherung zu leisten. Demgegenüber<br />
dient die summative Evaluation dazu, die Effektivität und Effizienz der einzelnen<br />
Aktivitäten des Modellprojekts zu überprüfen. Zu beantworten ist schließlich die<br />
Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen sowie des Transfers des Modells in<br />
ein allgemeines Konzept von integrierten Maßnahmen zur Teilhabe von Aphasikern/-innen<br />
am Arbeitsleben.<br />
Im Rahmen des Forschungsprogramms kommen im wesentlichen qualitative Methoden<br />
(z.B. qualitative Interviews, Gruppendiskussionen), aber auch quantitative<br />
Verfahren zum Einsatz. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung werden<br />
in Zwischenberichten sowie in einem Abschlußbericht präsentiert, der auch<br />
Handlungsempfehlungen enthalten wird. In der Zwischenzeit liegen bereits drei<br />
(unveröffentlichte) Zwischenberichte vor, ein vierter ist in Vorbereitung.<br />
Das Institut für empirische Soziologie an der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg<br />
hatte bereits im Jahre 1989/90 die Schrift<br />
Arbeitshilfe für die stufenweise Wiedereingliederung<br />
in den Arbeitsprozeß,<br />
im Auftrage der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation erstellt. Vor dem<br />
Hintergrund sozialrechtlicher Änderungen (insbesondere SGB IX) wurde nunmehr<br />
eine vollständige Überarbeitung dieser Arbeitshilfe erforderlich, mit der wiederum<br />
das Institut beauftragt wurde. Die Novellierung erfolgte in enger Kooperation<br />
mit der Auftraggeberin und den Rehabilitationsträgern. Die Broschüre wurde im<br />
April <strong>2004</strong> fertiggestellt und kann bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation<br />
bezogen bzw. von deren Homepage unter der Adresse http://www.barfrankfurt.de/publik/publik3.htm<br />
heruntergeladen werden.
Seite 12<br />
3.2.2 Straßenverkehrssicherheitsforschung<br />
Im Berichtszeitraum arbeitete das Institut an einem Projekt, das ein Thema aus<br />
dem vorhergehenden Berichtszeitraum aufgriff:<br />
Kinder im Straßenverkehr<br />
Anforderungswandel der Verkehrsumwelt und<br />
Sozialisationsbedingungen<br />
Diese Studie, die im Sommer des Jahres <strong>2003</strong> abgeschlossen wurde, befasste<br />
sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen der heutige und zukünftige Straßenverkehr<br />
für Kinder eine Überforderung darstellt und welche Möglichkeiten<br />
und Wege die Gesellschaft bereit hält, dieser Überforderung gegen zu steuern.<br />
Darüber hinaus war eine Bewertung vorzunehmen, welche Sicherheitsmaßnahmen<br />
für Kinder noch zeitgemäß sind und ggf. einer Überarbeitung oder Ergänzung<br />
bedürfen.<br />
Die Ergebnisse zeigten, dass im Rahmen der Umorientierung oder Neuausrichtung<br />
der Verkehrssicherheitsarbeit für Kinder insbesondere die Vernetzung der<br />
Verkehrssicherheitsarbeit auf der kommunalen Ebene echte Verkehrssicherheits-<br />
„Gewinne“ verspricht. Darüber hinaus wurde die Nutzung der eigenen Ressourcen<br />
der Kinder für die Problembewältigung im Straßenverkehr und den Aufbau<br />
einer eigenen Handlungskompetenz exemplarisch vorgestellt.<br />
Trotz aller edukatorischer Bemühungen, lassen sich die entwicklungsbedingten<br />
natürlichen kindlichen Besonderheiten hinsichtlich ihres Denkens und ihrer Wahrnehmung<br />
nicht vollständig kompensieren. Dies ist ein starkes Argument für die<br />
Propagierung der bekannten „Verbundstrategie“ aus Education (Verkehrserziehung),<br />
Engineering (planerische und technische Maßnahmen in der Verkehrsumwelt)<br />
und Enforcement (Verkehrsüberwachung), bzw. die Betonung nichtedukatorischer<br />
Aspekte der Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Kinder.<br />
Um Synergieeffekte zu nutzen wird den Akteuren der Verkehrssicherheitsarbeit<br />
auch die Kooperation mit Akteuren anderer spezifischer Erziehungsbereiche<br />
empfohlen. Auch hinsichtlich einer lebenszyklischen Perspektive werden für die<br />
Institutionen Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schulen, Ganztagsschulen<br />
und Fahrschulen Aspekte lebensweltorientierter Verkehrssicherheitsmaßnahmen<br />
enumeriert.<br />
Hinsichtlich des Einsatzes von Engineering-Maßnahmen wird betont, dass hierdurch<br />
Verkehrssicherheit als kollektives Gut produziert wird, von dem prinzipiell<br />
niemand ausgeschlossen werden kann und das – im ökonomischen Sinne – positive<br />
externe Effekte für alle Bevölkerungsgruppen produziert. Für Maßnahmen
Seite 13<br />
des Engineering und des Enforcement werden diverse Beispiele aufgelistet.<br />
Im wissenschaftlichen Bereich wird zur Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit<br />
für Kinder die Dauerbeobachtung und jährliche Aktualisierung (Längsschnittcharakter)<br />
eines Standardprogramms relevanter Indikatoren der Verkehrsbeteiligung,<br />
Verunfallung und sonstiger kinder- und straßenverkehrsspezifischer Indikatoren<br />
auf der Ebene von Kreisen, ihre Aufarbeitung in Tabellenform, ihre Ablage<br />
in einer Datenbank (Verkehrssicherheitsdatenbank), deren Visualisierung als<br />
thematische Landkarten auf Kreisebene (Verkehrssicherheitsatlas) und die Veröffentlichung<br />
der Karten in einer Druck- und einer elektronischen Fassung vorgeschlagen.<br />
Auch die Online-Stellung der Datenbank ins Internet sollte erwogen<br />
werden.<br />
Aktuell wird im Institut die Studie<br />
Autobenutzung und Verkehrsrisiko in der Lebenswert<br />
der jungen Fahranfänger und -anfängerinnen<br />
bearbeitet. Dieses Projekt soll eine deskriptive Analyse der Exposition von Fahranfängern/-innen<br />
– operationalisiert als Praxis der Autonutzung – hinsichtlich der<br />
Quantität (Fahrleistung), der Qualität (Ziel, Zeit, Begleitung, etc.) und des zeitlichen<br />
Verlaufs der Verkehrsexposition leisten. Eine differenzierte Betrachtung der<br />
Verkehrsexposition erfolgt in relativ kurzen Zeitintervallen anhand einer soziologischen<br />
Typisierung von Fahranfängern/-innen unter Feststellung der Unfallhäufigkeiten<br />
und der Identifizierung von Risikogruppen. Hierzu werden eine internationale<br />
Literaturrecherche, Gruppendiskussionen, Expertengespräche und eine<br />
bundesweite schriftliche Befragung von Fahranfängern/-innen durchgeführt.<br />
Ziel ist die Bereitstellung von aktuellen Basisdaten für verkehrspolitisches Handeln<br />
und die Erarbeitung von Grundlagen für mögliche Verbesserungen der gesetzlichen<br />
Regelungen zum Fahrerlaubniserwerb, für Maßnahmen zur Erhöhung der<br />
Sicherheit von Fahranfängern und -anfängerinnen im Straßenverkehr und für<br />
weiterführende Forschungsprojekte. Die Vorlage der Untersuchungsergebnisse ist<br />
für den Sommer 2006 vorgesehen.
Seite 14<br />
3.2.3 Bildungsforschung<br />
Im Berichtszeitrum führte das Institut im Auftrag des Bildungszentrums der Stadt<br />
Nürnberg und in Kooperation mit dem Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum<br />
der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg für das Projekt<br />
Schule, Ausbildung, Beruf – Chancen junger Migranten/-innen<br />
im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen<br />
(Berufliches Qualifizierungsnetzwerk (BQN) Nürnberg, Fürth, Erlangen)<br />
eine Sekundäranalyse entsprechender Datenquellen durch. Um die Berufschancen<br />
junger Menschen mit Migrationshintergrund für das Städtedreieck Nürnberg,<br />
Fürth und Erlangen quantitativ erfassen zu können, wurden die hierzu verfügbaren<br />
regionalen Daten gesammelt, ausgewertet und dokumentiert. Ziel dieser Deskription<br />
war es, die Situation von jungen Migranten/-innen in vergleichenden<br />
quantitativen Zahlen darzustellen. Der Ergebnisbericht wurde im Jahr <strong>2003</strong> unter<br />
dem gleichnamigen Titel vom Bildungszentrum der Stadt Nürnberg veröffentlicht.
Seite 15<br />
4 Kooperationsbeziehungen und Öffentlichkeitsarbeit<br />
4.1 Zusammenarbeit und Kontakte<br />
Im Rahmen seiner Forschungsarbeiten pflegt das Institut einen intensiven Erfahrungsaustausch<br />
mit anderen Fachleuten und wissenschaftlichen Instituten, die<br />
auf gleichen oder ähnlichen Forschungsgebieten arbeiten. Derartige Kontakte<br />
beschränken sich jedoch nicht nur auf Angehörige der eigenen sozialwissenschaftlichen<br />
Disziplinen, sondern beziehen auch Wissenschaftlern/-innen anderer<br />
Fächer in diese Kooperation mit ein, um damit eine wirkliche Interdisziplinarität<br />
der wissenschaftlichen Forschung zu fördern.<br />
Gute Beziehungen bestehen zur Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät<br />
der Universität Erlangen-Nürnberg in Nürnberg. Insbesondere mit dem Lehrstuhl<br />
für Soziologie (Prof. Dr. Bacher), dem Lehrstuhl für Statistik und empirische<br />
Wirtschaftsforschung (Prof. Dr. Buttler), dem Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,<br />
inbes. Gesundheitsmanagement (Prof. Dr. Schöffski)und dem Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik<br />
und Personalentwicklung (Prof. Dr. Stender) steht das Institut<br />
im regen Austausch bei der Planung neuer Forschungsvorhaben sowie zur<br />
Erörterung wissenschaftlicher Problemstellungen. Darüber hinaus arbeitete das<br />
Institut in der Vergangenheit recht fruchtbar mit dem Sozialwissenschaftlichen<br />
Forschungszentrum der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg (SFZ)<br />
(Prof. Dr. Stosberg) zusammen, das allerdings leider zum Ende des Jahres <strong>2004</strong><br />
aufgelöst wird.<br />
Ein nicht unerheblicher Teil der Studierenden der Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen<br />
Fakultät der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg erhält<br />
im Rahmen einer Mitarbeit an Forschungen des Instituts die Möglichkeit, eigene<br />
Erfahrungen mit den Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung<br />
zu sammeln. Verschiedentlich können auch Studierende des Fachs Soziologie<br />
an der Philosophischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg sowie<br />
Studierende der Nürnberger Fachhochschulen im Rahmen von Praktika und als<br />
studentische Hilfskräfte am Institut Einblicke in die sozialwissenschaftliche Praxisforschung<br />
gewinnen.<br />
Nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Nähe arbeitet das Institut für empirische<br />
Soziologie besonders intensiv mit dem Institut für Freie Berufe an der <strong>Friedrich</strong>-<br />
<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg zusammen. Über eine reine Bürogemeinschaft<br />
hinaus stehen die Mitarbeiter/-innen der beiden Einrichtungen in einem<br />
ständigen wissenschaftlichen Diskurs, organisieren gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen<br />
und führen auch Forschungsprojekte von gemeinsamem<br />
Interesse durch.
Seite 16<br />
Im Rahmen der Erschließung neuer Forschungsfelder steht das Institut für empirische<br />
Soziologie darüber hinaus im engen Austausch mit dem Observatoire Européen<br />
de la Violence Scolaire Bordeaux (Prof. Debarbieux) sowie dem Institut für<br />
angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam<br />
(IFK) (Prof. Dr. Sturzbecher).<br />
Gerade bei seiner anwendungsorientierten Forschungsausrichtung ist das Institut<br />
bestrebt, zur Pflege des Erfahrungsaustausches von Wissenschaft und Praxis vielfältige<br />
Kontakte in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik zu unterhalten.<br />
Diese Kontakte, die von Informationsgesprächen bis hin zu Projektausschüssen<br />
reichen, dienen der gegenseitigen Information und Abstimmung über gemeinsam<br />
interessierende Fragen, Probleme und Forschungsangelegenheiten,<br />
sowie vor allem der Diskussion um die Übertragung und Umsetzung der Forschungsergebnisse<br />
in die praktische Verwertung. Gerade durch die Pflege dieser<br />
Kontakte versucht das Institut seiner Zielsetzung gerecht zu werden, Forschungen<br />
auch als wissenschaftliche Grundlage praktischer Politik zu betreiben.<br />
4.2 Veröffentlichungen<br />
Der Information der Öffentlichkeit in Wissenschaft und Praxis über Aufgaben und<br />
Arbeiten des Instituts dienen die Tätigkeitsberichte, die einem Kreis von interessierten<br />
Wissenschaftlern, wissenschaftlichen Institutionen und Persönlichkeiten<br />
und Organisationen in Wirtschaft und Verwaltung zugestellt werden. Darüber<br />
hinaus werden Ergebnisberichte von Untersuchungen des Instituts im Eigenverlag<br />
in der Schriftenreihe des Instituts für empirische Soziologie veröffentlicht, sofern<br />
Ergebnisse zur Veröffentlichung freigegeben worden sind, nicht in fremden Verlagen<br />
bzw. Schriftenreihen publiziert werden und die Finanzierung der Druckkosten<br />
gesichert werden kann. Die Reihe Materialien aus dem Institut für empirische<br />
Soziologie an der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg dient der<br />
Veröffentlichung von freigegebenen Zwischenberichten, Vorträgen und Aufsätzen,<br />
die im Rahmen der laufenden Projektarbeiten entstehen. Diese Materialien<br />
werden an eine begrenzte Zahl von Interessenten versandt bzw. gegen eine<br />
Schutzgebühr abgegeben und können auch von der Homepage des Instituts<br />
heruntergeladen werden. Im Berichtszeitraum erschienen folgende Hefte:<br />
Heft 3/2002 Brader, D.; Faßmann, H.; Wübbeke, Chr.: „Case Management zur<br />
Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen behinderter<br />
Menschen (CMB)“ – Erster Sachstandsbericht einer Modellinitiative<br />
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. (161 Seiten)<br />
Heft 4/2002 Funk, W.: Schulklima in Hessen – Deutsche Teilstudie zu einer international<br />
vergleichenden Untersuchung im Auftrag des Observatoriums
Seite 17<br />
für Gewalt an Schulen, Universität Bordeaux. Endbericht. (126 Seiten)<br />
Heft 1/<strong>2003</strong> Funk, W.: Die Potentiale kommunal vernetzter Verkehrssicherheitsarbeit<br />
für Kinder. Überarbeiteter Vortrag auf dem Symposium „Vernetzte<br />
Verkehrssicherheitsarbeit für Kinder im Erftkreis“, am Dienstag<br />
10.12.2002, Rathaus Brühl. (35 Seiten)<br />
Heft 2/<strong>2003</strong> Faßmann, H.: Case Management und Netzwerkkooperation zur Erhaltung<br />
von Beschäftigungsverhältnissen behinderter Menschen –<br />
Chancen, Probleme und Handlungsmöglichkeiten. (26 Seiten)<br />
Heft 3/<strong>2003</strong> Funk, W.: School Climate and Violence in Schools – Results from the<br />
German Part of the European Survey on School Life. (20 Seiten)<br />
Heft 4/<strong>2003</strong> Faßmann, H.; Lechner, B.; Steger, R.: Qualitätsstandards für den<br />
Lern-ort „Betriebliche Berufsausbildung und reha-spezifische Förderung<br />
durch einen Bildungsträger“ - Ergebnisse einer Modellinitiative<br />
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation „REGIonale<br />
NEtzwerke zur beruflichen Rehabilitation (lern-) behinderter Jugendlicher<br />
(REGINE)“. (75 Seiten)<br />
Heft 5/<strong>2003</strong> Brader, D.; Faßmann, H.; Wübbeke, Chr.: „Case Management zur<br />
Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen behinderter<br />
Menschen (CMB)“ – Zweiter Sachstandsbericht einer Modellinitiative<br />
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. (131 Seiten)<br />
Heft 6/<strong>2003</strong> Steger, R.: Netzwerkentwicklung im professionellen Bereich dargestellt<br />
am Modellprojekt REGINE und dem Beraternetzwerk zetTeam<br />
(56 Seiten)<br />
Heft 1/<strong>2004</strong> Faßmann, H.; Lechner, B.; Steger, R.; Zimmermann, R.: „REGIonale<br />
NEtzwerke zur beruflichen Rehabilitation (lern-) behinderter Jugendlicher<br />
(REGINE)“ – Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung<br />
einer Modellinitiative der Bundesarbeitsgemeinschaft für<br />
Rehabilitation. (362 Seiten)<br />
Darüber hinaus wurde an anderer Stelle eine Reihe weiterer Beiträge von Mitarbeitern/-innen<br />
des Instituts publiziert:<br />
Funk, W.; Wiedemann, A.; Rehm, B. (2002) Verkehrssicherheit von ausländischen<br />
Arbeitnehmern und ihren Familien. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen,<br />
Mensch und Sicherheit, Heft M 136. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW<br />
Funk, W.; Faßmann, H. (2002) Beteiligung, Verhalten und Sicherheit von Kindern<br />
und Jugendlichen im Straßenverkehr. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen,<br />
Mensch und Sicherheit, Heft M 138. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag<br />
NW
Seite 18<br />
Funk, W.; Wiedemann, A. (2002) Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Kinder. Eine<br />
Sichtung der Maßnahmenlandschaft Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen,<br />
Mensch und Sicherheit, Heft M 139. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag<br />
NW<br />
Funk, W.; Oberlander, W. (2002): Aspekte der Berufsbildentwicklung für Berufsbetreuerinnen<br />
und Berufsbetreuer. In: bdb aspekte. Verbandszeitung des Bundesverbandes<br />
der Berufsbetreuer/innen e. V., Heft 41 (Oktober): 9-12<br />
Steger, R. (2002): Welche Mindestanforderungen müssen für eine betriebliche<br />
Vollausbildung erfüllt sein? Erfahrungen mit der Ausbildung lernbehinderter<br />
Jugendlicher im Modellprojekt REGINE. In: IFAS gGmbH (Hrsg.). Reader zur<br />
Fachtagung „Berufliche Rehabilitation lernbehinderter Jugendlicher auf dem<br />
ersten Arbeitsmarkt“ am 27. November 2002 in Göttingen. Göttingen: IFAS: 56-<br />
66<br />
Funk, W.; Ellinger, M. (<strong>2003</strong>) Statistische Auswertung vom Institut für empirische<br />
Soziologie (<strong>IfeS</strong>) Nürnberg. S. 29-79 in: Bildungszentrum der Stadt Nürnberg, BZ-<br />
Süd-Lernende Region (Hrsg.): Schule, Ausbildung, Beruf – Chancen junger Migranten/innen<br />
im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen. Nürnberg: Bildungszentrum<br />
der Stadt Nürnberg<br />
Funk, W. (<strong>2003</strong>): Situation und Perspektiven der Professionalisierung von Berufsbetreuern.<br />
Ergebnisse einer Befragung der Mitglieder des Bundesverbandes der<br />
Berufsbetreuer/-innen e. V.. Herausgegeben vom Bundesverband der Berufsbetreuer,<br />
bdb argumente, Heft 2, Hamburg: BdB<br />
Funk, W.; Oberlander, W. (<strong>2003</strong>): Perspektiven der Qualitätssicherung in der Berufsbetreuung.<br />
S. 237-258 in: Reiner Adler (Hrsg.): Qualitätssicherung in der<br />
Betreuung. Qualitätssystem und Qualitätsmanagement bei der rechtlichen<br />
Betreuung Erwachsener. Köln: Bundesanzeiger Verlag<br />
Funk, W.; Oberlander, W. (<strong>2003</strong>): Berufsbild und Qualitätssicherung in der Berufsbetreuung.<br />
Studie des Institutes für Freie Berufe in Nürnberg. Herausgegeben<br />
vom Bundesverband der Berufsbetreuer, bdb argumente, Heft 1, Hamburg:<br />
BdB<br />
Funk, W.; Förter-Vondey, K. (<strong>2003</strong>): Situation und Perspektiven der Professionalisierung<br />
von Berufsbetreuern. Ergebnisse einer Befragung der Mitglieder des Bundesverbandes<br />
der Berufsbetreuer/-innen e. V. In: bdb aspekte, Verbandszeitung<br />
des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen e. V., Heft 45 (Juni): 9-12<br />
Faßmann, H.; Lechner, B.; Steger, R. (<strong>2003</strong>): REGINE – Qualitätsstandards für den<br />
Lernort. Maßnahme: „Betriebliche Berufsausbildung und reha-spezifische Förderung<br />
durch einen Bildungsträger“. In: Informationen für die Beratungs- und<br />
Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit, <strong>2003</strong>, Nr.17: 19-20<br />
Faßmann, H.; Steger, R. (<strong>2004</strong>): "REGIonale NEtzwerke zur beruflichen Rehabilitation<br />
(lern-)behinderter Jugendlicher (REGINE)" – Überblick über Anliegen, Anlage<br />
und Ergebnisse eines Modellprojekts der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Seite 19<br />
Rehabilitation. In: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Hrsg.): Betriebliche<br />
Ausbildung behinderter Jugendlicher – Chancen, Erfahrungen und<br />
Grenzen. In Vorbereitung<br />
Schließlich entstand im Rahmen des REGINE-Modellprojekts auch eine Diplomarbeit<br />
zum Erwerb des akademischen Grades „Diplom-Sozialwirtin (Univ.)“:<br />
Fichtelmann, V. (<strong>2003</strong>): „Duale Berufsausbildung und reha-spezifische Förderung<br />
durch einen Bildungsträger“. (Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät<br />
der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Soziologie,<br />
Prof. Dr. J. Bacher)<br />
4.3 Veranstaltungen<br />
Mitarbeiter/-innen des Instituts berichteten im Rahmen der folgenden Veranstaltungen<br />
über ihre Projektarbeit und die dabei erzielten Ergebnisse:<br />
‣ Fachtagung Integrationsfachdienst / Case Management mit Podiumsdiskussion<br />
im BFZ Peters in Waldkraiburg am 21. März 2002<br />
‣ Fachtagung Beschäftigungsfähigkeit fördern! Prävention und Rehabilitation<br />
im Unternehmen des Instituts für Qualitätssicherung in Prävention und<br />
Rehabilitation (GmbH) an der Deutschen Sporthochschule Köln (IQPR) in<br />
Köln am 18./19. Juni 2002<br />
‣ Arbeitstagung „Rehabilitation“ des Bundesverbandes der Unfallkassen im<br />
BFW Eckert Regenstauf am 18. Oktober 2002<br />
‣ Fachtagung „Berufliche Rehabilitation lernbehinderter Jugendlicher auf<br />
dem ersten Arbeitsmarkt“ des Instituts für angewandte Sozialfragen (IFAS)<br />
in Göttingen am 27. November 2002<br />
‣ Symposium der Kreispolizeibehörde Bergheim „Vernetzte Verkehrssicherheitsarbeit<br />
für Kinder im Erftkreis“, am 10.12.2002 im Rathaus Brühl<br />
‣ 2. Sitzung des BAR-Arbeitskreises „Rehabilitation und Teilhabe“ in Frankfurt<br />
am Main am 6. Februar <strong>2003</strong><br />
‣ Tagung Alles im Fluß? Kontinuität und Erneuerung der Integrationsfachdienste<br />
in der Evangelischen Akademie Bad Boll vom 17. - 19. März <strong>2003</strong><br />
‣ Second International Conference on Violence in School: Research, Best<br />
Practices and Teacher Training, May 11 to 14, <strong>2003</strong>, Québec City,<br />
Québec, Canada
Seite 20<br />
‣ Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation „Betriebliche<br />
Ausbildung behinderter Jugendlicher – Chancen, Erfahrungen und<br />
Grenzen“ am 21. April <strong>2004</strong> im Kleisthaus in Berlin<br />
Darüber hinaus war das Institut auf dem Messestand der Bundesarbeitsgemeinschaft<br />
für Rehabilitation (BAR) im Rahmen der Fachmesse REHACare International<br />
vom 15. - 18. Oktober <strong>2003</strong> in Düsseldorf vertreten und präsentierte dort das<br />
Modellprojekt "Case Management zur Erhaltung von Beschäftigungsverhältnissen<br />
behinderter Menschen (CMB)".
Seite 21<br />
5 Bibliothekswesen<br />
Das Institut unterhält eine Fachbibliothek, die einen Grundbestand an Literatur<br />
zu fast allen Bereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften umfaßt. Darüber<br />
hinaus werden laufend die wichtigsten neueren Veröffentlichungen aus<br />
der sozialwissenschaftlichen Methodenlehre, der soziologischen Theorie, der<br />
Medizinsoziologie, der Rehabilitation, der Gerontologie, der Gesundheitsökonomie<br />
und der Industrie- und Betriebssoziologie sowie Standardwerke anderer<br />
Fachdisziplinen und benachbarter Wissenschaftsgebiete erworben.<br />
Die Fachbibliothek des Instituts dient in erster Linie der wissenschaftlichen Arbeit<br />
im Institut. Sie steht als Präsenzbibliothek jedoch in begrenztem Umfang den Studierenden<br />
der Universität und auch der interessierten Öffentlichkeit als Informationsmöglichkeit<br />
zu den Arbeitsschwerpunkten des Instituts zur Verfügung.<br />
Die Institutsbibliothek beteiligt sich in begrenztem Maße auch am Leihverkehr<br />
der deutschen Bibliotheken, so daß Interessierte im In- und Ausland über die Ausleihe<br />
Zugriff auf die Bibliotheksbestände haben. Mit dem Ausbau der Außenkontakte<br />
des Instituts und der wachsenden Zahl seiner Veröffentlichungen wird diese<br />
Möglichkeit zunehmend in Anspruch genommen.