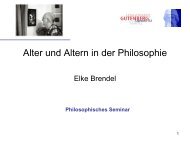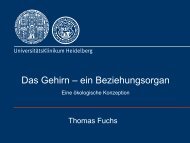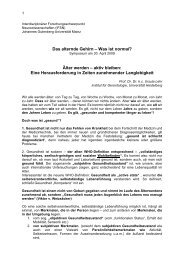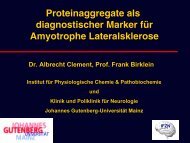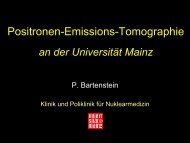Elektrophysiologie und virtuelle Realität als Mittel zur Untersuchung ...
Elektrophysiologie und virtuelle Realität als Mittel zur Untersuchung ...
Elektrophysiologie und virtuelle Realität als Mittel zur Untersuchung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
..... PSYCHOLOGIE<br />
verb<strong>und</strong>en sind. Die so genannten ereigniskorrelierten<br />
Potenziale oder EKPs zeichnen sich durch eine<br />
charakteristische Wellenform aus, die sich in unterschiedliche<br />
Komponenten einteilen lassen (Abb. 3,<br />
links). Jede dieser Komponenten wird dabei bestimmten<br />
Verarbeitungsschritten im neurokognitiven<br />
System zugeordnet, etwa der sensorischen Verarbeitung<br />
eines Reizes, der kognitiven Bewertung oder<br />
der Initiierung einer motorischen Reaktion auf den<br />
Reiz. Damit lassen sich Aussagen machen über<br />
bestimmte Prozesse, die an der Informationsverarbeitung<br />
beteiligt sind, <strong>und</strong> ihre zeitliche Abfolge. Mit<br />
geeigneten Modellierungsverfahren lassen sich<br />
sogar die beteiligten neuronalen Strukturen identifizieren,<br />
wenn auch mit geringerer räumlicher Auflösung<br />
<strong>als</strong> in der funktionalen Kernspintomographie<br />
(fMRI). Ein großer Vorteil ist jedoch die hohe zeitliche<br />
Auflösung des EEGs, die im Millisek<strong>und</strong>enbereich<br />
liegt <strong>und</strong> hierin dem fMRI überlegen ist. Außerdem<br />
ist der apparative Aufwand des EEGs vergleichsweise<br />
gering <strong>und</strong> macht eine Nutzung im VR-Labor möglich.<br />
Neuere Ansätze wie die parallele fMRI- <strong>und</strong><br />
EEG-Aufzeichnung versprechen eine Kombination<br />
der hohen zeitlichen Auflösung des EEGs mit der<br />
hohen räumlichen Auflösung des fMRI.<br />
Mit Hilfe von verschiedenen EKP-Studien konnten<br />
wir zeigen, dass ein hoher Anteil der visuellen Informationsverarbeitung<br />
automatisch <strong>und</strong> auf der Ebene<br />
sensorischer Verarbeitungsschritte erfolgt. Bereits im<br />
sensorischen System wird eine Repräsentation über<br />
Invarianten der visuellen Umgebung abgespeichert,<br />
auf deren Basis auch zeitlich getrennt präsentierte<br />
Reize verglichen <strong>und</strong> bewertet werden, um schon<br />
nach wenigen Millisek<strong>und</strong>en <strong>und</strong> ohne Zuwendung<br />
von Aufmerksamkeit unerwartete Veränderungen zu<br />
detektieren (siehe Berti & Schröger, 2004). In Abb. 3<br />
ist das Ergebnis dieser Studie zusammengefasst: Es<br />
zeigt sich, dass bereits nach 200 Millisek<strong>und</strong>en ein<br />
deutlicher Unterschied bei der Verarbeitung der veränderten<br />
Reize zu beobachten ist. Diese Verarbeitung<br />
ist in dem Sinne automatisch, <strong>als</strong> dass die Versuchspersonen<br />
ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen<br />
Aspekt der visuellen Stimulation richteten. Die<br />
Fähigkeit, möglichst schnell Veränderungen in der<br />
visuellen Umwelt zu entdecken, die nicht im Fokus<br />
der Aufmerksamkeit liegen, ist etwa im Straßenverkehr<br />
von besonderer Bedeutung. Während im Alltag<br />
allerdings deutliche Veränderungen wie das plötzliche<br />
Erscheinen eines Objektes oder Bewegungs- <strong>und</strong><br />
Geschwindigkeitsänderungen Aufmerksamkeit anziehen,<br />
zeigt sich in unseren Laborexperimenten,<br />
dass auch vergleichsweise geringe Veränderungen<br />
auf Basis eines sensorischen Gedächtnisvergleichsprozesses<br />
erkannt werden. Die Verteilung der EKPs<br />
(Abb. 3, rechts) auf der Schädeloberfläche legt die<br />
Vermutung nahe, dass die primären, visuellen Areale<br />
Quelle dieser Prozesse sind. Dies ist ein weiterer Hinweis<br />
darauf, dass dieser Gedächtnisvergleichsprozess<br />
tatsächlich eine Leistung des sensorischen Systems<br />
ist <strong>und</strong> in diesem Sinne kognitive Funktionen<br />
deutlich früher in der Informationsverarbeitung verankert<br />
sind, <strong>als</strong> man oftm<strong>als</strong> annimmt.<br />
Zur Zeit messen wir EKPs, die bestimmten Phasen<br />
der Kontaktzeitschätzung zugeordnet werden können,<br />
um der bislang ungeklärten Frage nachzugehen,<br />
ob es beim Menschen ein Modul (etwa Kortexareal<br />
MT) gibt, das bei jeder Kontaktzeitschätzung aktiv<br />
wird, ähnlich wie man es bei Tauben gef<strong>und</strong>en hat.<br />
Ebenso sind wir dabei, Blickbewegungen <strong>und</strong> EKPs<br />
miteinander in Beziehung zu setzen, um Prozessen<br />
der Objekterkennung auf die Spur zu kommen.<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die<br />
Kombination von VR mit neurowissenschaftlichen<br />
Methoden eine weitgehend einmalige Chance darstellt,<br />
um die Prozesse zu analysieren, die der visuellen<br />
Wahrnehmung zugr<strong>und</strong>e liegen. Diese Methodenkombination<br />
werden wir in Zukunft weiterentwickeln,<br />
um die daraus erwachsenden Chancen in<br />
Mainz zu nutzen.<br />
■ Summary<br />
We explore the processes <strong>und</strong>erlying human visual<br />
perception. To do so, during the last two years we<br />
have assembled a technology that allows us to simulate<br />
complex scenes, as for example vehicles approaching<br />
an observer on collision course. It <strong>als</strong>o enables<br />
us to relate behavioral measures such as reaction<br />
time with electrophysiological parameters such as<br />
evoked brain potenti<strong>als</strong>. The integrative approach,<br />
set within a virtual reality laboratory, combines computer<br />
science, electrophysiology, and cognitive psychology.<br />
We report findings that support the advantage<br />
of this approach.<br />
Literatur<br />
Berti, S., Schröger, E. (2004). Distraction effects in vision: behavioral and event-related brain potential indices. Neuroreport<br />
15, 665-669.<br />
Hecht, H., Savelsbergh, G. J. P. (Eds.) (2004). Time-to-contact. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.<br />
24