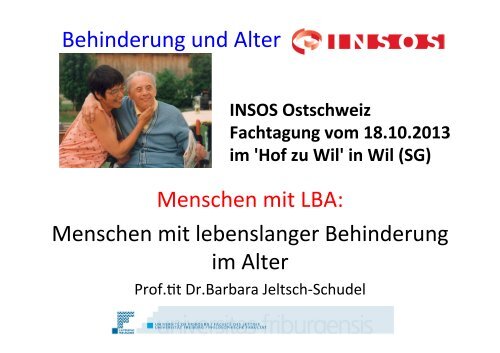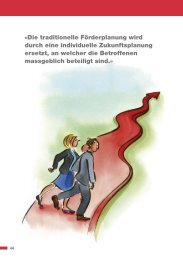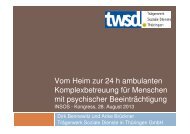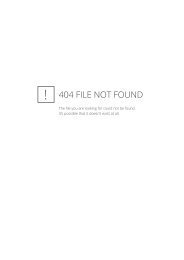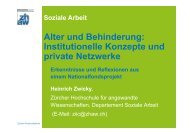Menschen mit lebenslanger Behinderung im Alter - Insos
Menschen mit lebenslanger Behinderung im Alter - Insos
Menschen mit lebenslanger Behinderung im Alter - Insos
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Behinderung</strong> und <strong>Alter</strong> <br />
INSOS Ostschweiz <br />
Fachtagung vom 18.10.2013 <br />
<strong>im</strong> 'Hof zu Wil' in Wil (SG) <br />
<strong>Menschen</strong> <strong>mit</strong> LBA: <br />
<strong>Menschen</strong> <strong>mit</strong> <strong>lebenslanger</strong> <strong>Behinderung</strong> <br />
<strong>im</strong> <strong>Alter</strong> <br />
Prof.:t Dr.Barbara Jeltsch-‐Schudel
<strong>Alter</strong> und <strong>Alter</strong>n
Zwölf Essen:als der Gerontologie <br />
<strong>Alter</strong>n als <br />
• dynamischer Prozess, der sowohl Verluste wie <br />
Gewinne beinhaltet, <br />
• biologisch-‐medizinisch bes:mmter Prozess <br />
• <strong>lebenslanger</strong> und biografisch verankerter <br />
Prozess, <br />
• sozial und soziokulturell bes:mmter Prozess <br />
• Produkt von Person und räumlicher Umwelt <br />
• ökonomisch bes:mmter Prozess <br />
Wahl Hans-‐Werner; Heyl Vera (2004): Gerontologie – Einführung und Geschichte. <br />
StuWgart: Kohlhammer
Zwölf Essen:als der Gerontologie <br />
<strong>Alter</strong>n als <br />
• geschlechtsspezifischer Prozess, der Frauen und Männer <br />
unterschiedlich berührt <br />
• differen:eller Prozess, und zwar bezüglich aller <br />
D<strong>im</strong>ensionen des <strong>Alter</strong>ns <br />
• mul:d<strong>im</strong>ensionaler Prozess, der sich auf verschiedenen <br />
Ebenen vollzieht <br />
• mul:direk:onaler Prozess, der je nach Ebenen <br />
unterschiedliche Verläufe zeigt <br />
• Prozess, der sich zwischen Objek:vität und Subjek:vität <br />
bewegt <br />
• plas:scher Prozess <strong>mit</strong> Grenzen. <strong>Alter</strong>n ist innerhalb von <br />
Grenzen gestaltbar <br />
Wahl Hans-‐Werner; Heyl Vera (2004): Gerontologie – Einführung und Geschichte. StuWgart: Kohlhammer
Vier Phasen <strong>im</strong> Lebenslauf älterer <br />
Erwachsener <br />
1. Phase: Letzte Berufsphase und nahende <br />
Pensionierung (variierend, je nach <strong>Alter</strong> der <br />
Pensionierung) <br />
2. Phase: Gesundes Rentenalter (hohe soziale und <br />
persönliche Autonomie) <br />
3. Phase: Fragiles Rentenalter (Erschwerung eines <br />
eigenständigen Lebens durch Einschränkungen <br />
und <strong>Behinderung</strong>en) <br />
4. Phase: <strong>Alter</strong> <strong>mit</strong> Pflegebedürbigkeit <br />
(gesundheitlich bedingte Abhängigkeit und <br />
Pflegebedürbigkeit) <br />
hWp://www.hoepflinger.com/dtop/Wandel-‐des-‐<strong>Alter</strong>s.pdf
Zwei <strong>Alter</strong>skulturen <br />
• <strong>Alter</strong>skultur für ak:ve Rentner und <br />
Rentnerinnen: Teilnahme und Ak:vität als <br />
Grundlage für ein würdiges Leben <br />
• <strong>Alter</strong>skultur für behinderte und pflegebedürbige <br />
<strong>Menschen</strong>: Solidarität und Anteilnahme sowie <br />
Rücksichtnahme auf die persönlichen <br />
Lebenserfahrungen „Würde für pflegebedürbige <br />
betagte <strong>Menschen</strong> erfordert Modele des ‚New <br />
public-‐Managements, welche ethische <br />
Dilemmas und menschliche Grenzerfahrungen als <br />
Leitlinien <strong>mit</strong>einbeziehen <br />
Höpflinger F. (o.J.): <strong>Alter</strong>/n heute und Aspekte einer modernen <strong>Alter</strong>spoli:k, Thesen)
<strong>Behinderung</strong>: Klassifika:onen <br />
WHO: Interna:onal Classifica:on <br />
of Func:oning, Disability and Health <br />
ICF -‐ Interna:onale Klassifika:on der Funk:onsfähigkeit, <br />
<strong>Behinderung</strong> und Gesundheit <br />
Klassifika:on der Körperfunk:onen <br />
Klassifika:on der Körperstrukturen <br />
Klassifika:on der Ak:vitäten und Par:zipa:on [Teilhabe] <br />
Klassifika:on der Umwelmaktoren <br />
La classifica:on interna:onale du fonc:onnement, du <br />
handicap et de la santé (CIF)
<strong>Behinderung</strong> sensu WHO: <br />
Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (ICF 2002, 23) <br />
Gesundheitsproblem <br />
(Gesundheitsstörung-‐ oder Krankheit, ICD) <br />
Körperstrukturen und -‐<br />
funk:onen <br />
Ak:vitäten Par:zipa:on /<br />
Teilhabe <br />
Umwelmaktoren <br />
• materiell, sozial, <br />
einstellungsbezogen <br />
Persönliche Faktoren <br />
• <strong>Alter</strong>, Geschlecht, <br />
Bewäl8gungsstrategien
Das individuelle Modell <br />
• <strong>Behinderung</strong> <strong>im</strong> Sinne einer biologisch-medizinischen<br />
Schädigung ist Ausgangspunkt aller <br />
medizinischen, rehabilita:ven und pädagogischen <br />
Bemühungen, <br />
• WHO (1980): Schädigung <strong>im</strong>pairment ist Ursache <br />
von Beeinträch:gung disability und <strong>Behinderung</strong> <br />
handicap <br />
• <strong>Behinderung</strong> bedeutet ein Körperschaden oder <br />
eine funk:onelle <strong>Behinderung</strong> wird in <br />
gewissermassen als Eigenschab des Individuums <br />
verstanden
Das soziale Modell <br />
• <strong>Behinderung</strong> entsteht durch das soziale System <br />
bzw. dessen Barrieren gegen die Par:zipa:on <br />
eines beeinträch:gten <strong>Menschen</strong> <br />
• Gesellschabliche Regulierungen und <br />
Veränderungen werden durch das <br />
Selbsthilfepoten:al der Betroffenen ausgelöst <br />
(Disability Studies) <br />
• <strong>im</strong>pairment („Natur“) ist unhinterfragte Basis <br />
von disability („Kultur“)
Das kulturelle Modell <br />
• <strong>Behinderung</strong> als spezifische Form der <br />
„Problema:sierung“ körperlicher Differenz <br />
• Dekonstruk:on von Kategorien wie <br />
„behindert“ – „nichtbehindert“ -‐> diversity <br />
• Iden8tät: von Deutungsmustern des <br />
Eigenen und des Fremden bes:mmt <br />
Waldschmidt Anne (2005): Disability Studies: Individuelles, soziales <br />
und/oder kulturelles Modell von <strong>Behinderung</strong>? <br />
Psychol.u.Gesellschabskri:k, H1, 9-‐31
Körper: Bild und Bedeutung <br />
Das Wahre, Gute und Schöne
Intersek:onalität <br />
Class <br />
Race <br />
Gender <br />
Disabiliy <br />
Age
<strong>Behinderung</strong> und Geschlecht
Entwicklung <br />
Ak:vität des sich entwickelnden Subjektes <br />
eine Umgebung, <br />
die das Subjekt <strong>mit</strong> den ihm <br />
zur Verfügung stehenden <br />
Ak:vitäts-‐ und Ausdrucks-‐ <br />
möglichkeiten wahrnehmen <br />
kann <br />
die dem Subjekt Gelegenheit gibt, sich <strong>mit</strong> ihr auseinanderzusetzen, d.h. <br />
durch eigenes Handeln in ihr etwas zu bewirken, <br />
die dem Subjekt gemeinsames sinnhabes Handeln ermöglicht und <br />
die dem Subjekt <strong>mit</strong> Anerkennung begegnet. <br />
© Barbara Jeltsch-‐Schudel
Entwicklungsaufgaben <br />
Entwicklungs-‐ Entwicklungsaufgaben <br />
periode <br />
MiWleres 1. He<strong>im</strong>/Haushalt führen <br />
Erwachsenenalter 2. Kinder aufziehen <br />
(31-‐50) 3. Berufliche Karriere <br />
Spätes <br />
1. Energien auf neue Rollen <br />
Erwachsenenalter lenken <br />
(51 und älter) 2. Akzep:eren des eigenen <br />
Lebens <br />
3. Eine Haltung zum Sterben <br />
entwickeln
Rahmenbedingungen in der Schweiz <br />
• Aufwachsen in Familien: Rollen der Eltern <br />
• Normalbiographie: Phasen <strong>im</strong> Lebenslauf <br />
• Situa:on von Familien <strong>mit</strong> behinderten <br />
Kindern <br />
• Angebote (Invalidenversicherung ab 1961) <br />
• Sonderschulung <br />
• Heilpädagogische Früherziehung <br />
• Berufsbildung für Behinderte <br />
Jeltsch-‐Schudel Barbara (2008): Iden:tät und <strong>Behinderung</strong> -‐ Biografische <br />
Reflexionen erwachsener Personen <strong>mit</strong> einer Seh-‐, Hör-‐ oder <br />
Körperbehinderung. Oberhausen: Athena
Lebensthemen <br />
• Gelingende Interak:on <strong>im</strong> Aufwachsen <br />
unter den Bedingungen einer <strong>Behinderung</strong> <br />
• Wahrnehmen des Andersseins und <br />
Umgehen <strong>mit</strong> der eigenen <strong>Behinderung</strong> <br />
• Loslösung und Abhängigkeit <br />
• Selbstbes:mmung und Fremdbes:mmung <br />
© Barbara Jeltsch-‐Schudel
Iden:tätsentwicklung unter der Bedingung einer <br />
geis:gen <strong>Behinderung</strong> <br />
• Iden:tätsentwicklung und Iden:tätsarbeit <br />
• Wenig Erfahrungen der Situa:onen von gelingender <br />
Interak:on <br />
• Erschwerung des Erlebens von Selbstwirksamkeit <br />
und Selbstbes:mmung <br />
• Marginalisierung in Einrichtungen der <br />
Sondererziehung <br />
• Einschränkte Möglichkeit <strong>im</strong> Erwerb <br />
gesellschablicher Rollen <br />
• Probleme <strong>im</strong> Anerkanntwerden als sexuelles Wesen <br />
• Mühe be<strong>im</strong> Erlangen des Status eines Erwachsenen <br />
© Barbara Jeltsch-‐Schudel
<strong>Menschen</strong> <br />
<strong>mit</strong> <strong>lebenslanger</strong> <br />
<strong>Behinderung</strong>serfahrung <br />
<strong>im</strong> <strong>Alter</strong> (LBA)
Behindertsein und <strong>Alter</strong>n <br />
Biologisches <strong>Alter</strong>n: <br />
• Bezieht sich auf Körperfunk:onen und ist <br />
grundsätzlich gleich wie bei <strong>Menschen</strong> <br />
ohne geis:ge <strong>Behinderung</strong>, aber vieles ist <br />
noch kaum erforscht (so etwa Einflüsse <br />
von Medikamenten, Erfahrungen und <br />
Bedeutung der Menopause, Diagnos:k <br />
von Hör-‐Sehfunk:onen) <br />
Psychologisches <strong>Alter</strong>n: <br />
Soziologisches <strong>Alter</strong>n:
Behindertsein und <strong>Alter</strong>n <br />
Biologisches <strong>Alter</strong>n: <br />
Psychologisches <strong>Alter</strong>n: <br />
• Schwerpunkt der bekannten Kenntnisse sind <br />
ins-‐besondere die Intelligenzfunk:onen in <br />
ihrer Unter-‐scheidung zwischen der fluiden <br />
und der kristallinen Intelligenz. Ausserdem <br />
beginnt sich ein Bewusstsein dafür zu <br />
entwickeln, dass psychische Probleme <strong>im</strong> <strong>Alter</strong> <br />
aubreten können und differen:aldiagnos:sch <br />
von <strong>Alter</strong>ungsprozessen unterschieden <br />
werden müssen <br />
Soziologisches <strong>Alter</strong>n:
Behindertsein und <strong>Alter</strong>n <br />
Biologisches <strong>Alter</strong>n: <br />
Psychologisches <strong>Alter</strong>n: <br />
Soziologisches <strong>Alter</strong>n: <br />
• Weist auf die Benachteiligung durch <strong>Alter</strong> und <br />
<strong>Behinderung</strong> hin, denn es handelt sich <br />
gewissermassen um zwei Tabus. Eine <br />
Betrachtung der kohorten-‐bezogenen <br />
Besonderheiten ist von hoher Bedeutung für <br />
die gerontagogische Arbeit, weil sich <br />
biografische Erfahrungen je nach Kohorte <br />
unterscheiden. <br />
Hinweis: Havemann Meindert, Stöppler Reinhilde (2004): <strong>Alter</strong>n <strong>mit</strong> geis:ger <br />
<strong>Behinderung</strong> – Grundlagen und Perspek:ven für Begleitung, Bildung und <br />
Rehabilita:on. StuWgart : Kohlhammer
Lebenslauf <br />
charakterisiert durch <br />
• Kon:nuität (kulturell definierte und <br />
materielle gesicherte Lebensspanne) <br />
• Sequenzialität (zeitlich geordneter <br />
Ablauf zentraler Lebensereignisse) <br />
• Biographizität (Orien:erungsrahmen <br />
für individuellen Lebensplan) <br />
Wacker Elisabeth (2002): Bewäl:gung der Lebensübergänge für <br />
altere behinderte <strong>Menschen</strong>. Dokumenta:on „Lebenswelten <br />
von älteren <strong>Menschen</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>“
Lebenslauf und Lebensgeschichte <br />
• Lebenslauf = zeitlicher Ablauf verschiedener <br />
Phasen, die <strong>im</strong> allgemeinen Leben <br />
vorkommen <br />
• Lebensgeschichte = „die <strong>im</strong> Gedächtnis <br />
aufgezeichnete, in ihm eingegrabene und <br />
niedergeschriebene <br />
Lebensgeschichte“ (Petzold 1999, 4)
Zur Lebenssitua:on von älteren/alten <br />
<strong>Menschen</strong> <strong>mit</strong> LBA <br />
• Entwicklungsaspekt: Iden:tätsentwicklung unter den <br />
Bedingungen einer geis:gen <strong>Behinderung</strong> und <strong>mit</strong> und <br />
ohne Erfahrungen ins:tu:oneller Betreuung oder <br />
Erziehung <br />
• Ökonomischer Aspekt: Berufsbildung und <br />
Arbeitssitua:on unter erschwerten Bedingungen (d.h. <br />
keine Pension, staWdessen IV-‐Rente) <br />
• GeneraUver Aspekt: keine unmiWelbaren Nachkommen, <br />
Genera:onenkeWe abgebrochen (entsprechende <br />
Auswirkungen auf das soziale Netz) <br />
©Barbara Jeltsch-‐Schudel/Anne Junk-‐Ihry
Übergänge <strong>im</strong> Leben von <strong>Menschen</strong> <strong>mit</strong> LBA <br />
(<strong>lebenslanger</strong> <strong>Behinderung</strong>serfahrung <strong>im</strong> <strong>Alter</strong>) <br />
• Arbeit – Beschäbigung – Ruhestand <br />
• Wohnen: Wohnorte und Wohnformen <br />
• Freizeit und Bildung <br />
• Begleitung – Unterstützung – Pflege <br />
-‐> Veränderungen bez. <br />
Bedürfnisse und Bedarf
Bedürfnisse von <strong>Menschen</strong> <strong>mit</strong> LBA <br />
• nach mehr Ruhe und Erholung <br />
• nach intensiverer Betreuung und <br />
Hilfestellung <br />
• nach einer Reduzierung von Anforderungen <br />
• nach einem hohen Maß an <br />
Selbstbes:mmung bei der Auswahl von <br />
Ak:vitäten. <br />
Wacker Elisabeth (2002) Bewäl:gung der Lebensübergänge für ältere behinderte <strong>Menschen</strong>
Veränderungen der Bedürfnislagen <br />
Bedürfnislage<br />
Arbeitszeitverkürzung<br />
Bereich<br />
Arbeit<br />
x<br />
Bereich<br />
Wohnen<br />
Reduzierte Leistungsanforderungen x x<br />
Veränderte Arbeitsangebote<br />
Längere Erholungspausen<br />
Intensivere Betreuung und Hilfestellung x x x<br />
Ruhigere Atmosphäre x x x<br />
Ruhigere Alltagsgestaltung<br />
Strukturierter Tagesablauf<br />
Sinnvolle Tätigkeit<br />
Breit gefächerte Angebote<br />
Freiwillige Teilnahme<br />
Finanzielle Hilfe<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Bereich<br />
Freizeit<br />
x<br />
x<br />
X<br />
Wacker Elisabeth (2002) Bewäl:gung der Lebensübergänge für ältere behinderte <strong>Menschen</strong>
Drei Phasen der Pensionierung <br />
• Vorbereitung auf den <br />
Ruhestand <br />
• EintriW in den Ruhestand <br />
• Anpassung an den Ruhestand <br />
-‐> Veränderung der <br />
Lebenssitua:on <br />
(Gusset-‐Bährer)
Rahmenbedingungen in der Schweiz für SeniorInnen <br />
<strong>mit</strong> <strong>lebenslanger</strong> <strong>Behinderung</strong>serfahrung <br />
Behindertenhilfe Altenhilfe<br />
Wohnhe<strong>im</strong><br />
Wohngruppen<br />
Begleitetes<br />
Wohnen<br />
Assistenzmodell<br />
Gesundheitswesen<br />
<strong>Alter</strong>swohnungen<br />
<strong>Alter</strong>she<strong>im</strong><br />
Pflegehe<strong>im</strong><br />
Psychiatrische<br />
Klinik<br />
Spital (ev.<br />
Geriatrie)<br />
© Barbara Jeltsch-‐Schudel <br />
alte Behinderte oder behinderte Alte?
Behindertenhilfe – Altenhilfe <br />
Während die Altenhilfe ihren Schwerpunkt in der <br />
Pflege, Alltagsbegleitung und Rehabilita:on von <br />
pflegebedürbigen alten <strong>Menschen</strong> sieht, liegt der <br />
Fokus der Behindertenhilfe auf einer <br />
lebensbegleitenden heilpädagogischen <br />
Förderung und Begleitung sowie integra:ven – <br />
insbesondere berufspädagogischen – <br />
Unterstützungsleistungen. <br />
Hollander JuWa (2009): Lebenswelten <strong>im</strong> <strong>Alter</strong> – Konvergenzen von Altenhilfe und Behindertenhilfe. Diss. Uni Köln
UNO-‐Behindertenkonven:on <br />
ArUkel 19 <br />
Unabhängige Lebensführung und <br />
Teilhabe an der Gemeinscha[ <br />
...indem sie (die Vertragsstaaten) insbesondere dafür <br />
sorgen, dass <br />
a) <strong>Menschen</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en gleichberech:gt die <br />
Möglichkeit haben, ihren Wohnsitz zu wählen und zu <br />
entscheiden, wo und <strong>mit</strong> wem sie leben, und nicht <br />
verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben <br />
hWp://www.humanrights.ch/home/front_content.php?idcat=937
Begleitung zum Lebensende <br />
• Situa:on lebensbedrohlicher/schwerer <br />
Krankheit <br />
• Selbstbes:mmung, eigener Wille (Themen: <br />
Pa:entenverfügung; Zusammenarbeit <strong>mit</strong> <br />
Angehörigen) <br />
• Pallia:vmedizin und Hospizarbeit (Themen: <br />
Verhungern und Verdursten, Umgang <strong>mit</strong> <br />
Schmerz) <br />
• Sterbehilfe/Sterbebegleitung
Zur Begleitung Sterbender <br />
Was brauchen <strong>Menschen</strong> am Lebensende? <br />
-‐ Kommunika:on: auch das Thema des <br />
eigenen Sterbens <br />
-‐ Medizinische Therapie: bezüglich <br />
Schmerzen, Atemnot usw. <br />
-‐ Psychosoziale Betreuung: u.a. <br />
Trauerbegleitung <br />
-‐ Spirituelle Begleitung
Mögliche Einflussfaktoren auf den <br />
Trauerprozess <br />
Persönlichkeit <br />
– Selbstwertgefühl/Iden:tät <br />
– Kogni:on und Emo:onalität <br />
(orien:ert an den drei Bereichen der Heilpädagogischen Diagnos:k; Inhalte <br />
bezogen auf Trauerprozesse © Barbara Jeltsch)
Mögliche Einflussfaktoren auf den <br />
Trauerprozess <br />
Lebenskontext <br />
– Enge Bezugspersonen: <br />
Interak:onen <br />
– Soziales Netz <br />
– „Kultur“ der <br />
Wohnsitua:on <br />
– Umgang <strong>mit</strong> Tabuthemen <br />
wie Sterben und Tod <br />
– Begleitungs-‐ und <br />
Unterstützungsmöglichkeit<br />
en <strong>im</strong> Trauerprozess/in der <br />
Trauerarbeit <br />
(orien:ert an den drei Bereichen der Heilpädagogischen Diagnos:k; Inhalte bezogen auf <br />
Trauerprozesse © Barbara Jeltsch)
Mögliche Einflussfaktoren auf den <br />
Trauerprozess <br />
Lebensgeschichte <br />
– Trennungs-‐ und <br />
Verlusterfahrungen <br />
– Erfahrungen von <br />
Aussonderung und <br />
Bedrohung <br />
(orien:ert an den drei Bereichen der Heilpädagogischen Diagnos:k; <br />
Inhalte bezogen auf Trauerprozesse © Barbara Jeltsch)
Fragen für die gerontagogische <br />
Arbeit <strong>mit</strong> <strong>Menschen</strong> <strong>mit</strong> LBA <br />
• Bildungsrecht <strong>im</strong> <strong>Alter</strong>? <br />
• Pflegebedarf: Ort des Lebens? <br />
• Zugang zu Angeboten wie Pallia:ve Care? <br />
• Ra:onierung in der Medizin? <br />
• PAS (Begleiteter Suizid) und geis:ge <br />
<strong>Behinderung</strong>? <br />
• Wer definiert den Bedarf? <br />
© Barbara Jeltsch-‐Schudel