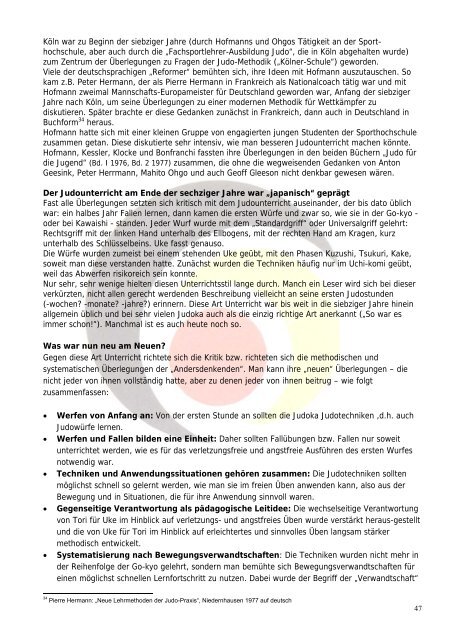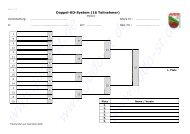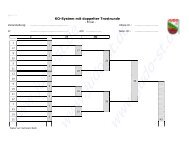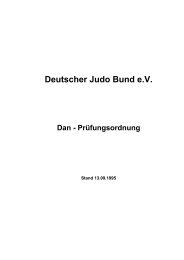Begleitmaterial DJB Dan-Prüfungsprogramm 2010
Begleitmaterial DJB Dan-Prüfungsprogramm 2010
Begleitmaterial DJB Dan-Prüfungsprogramm 2010
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Köln war zu Beginn der siebziger Jahre (durch Hofmanns und Ohgos Tätigkeit an der Sporthochschule,<br />
aber auch durch die „Fachsportlehrer-Ausbildung Judo“, die in Köln abgehalten wurde)<br />
zum Zentrum der Überlegungen zu Fragen der Judo-Methodik („Kölner-Schule“) geworden.<br />
Viele der deutschsprachigen „Reformer“ bemühten sich, ihre Ideen mit Hofmann auszutauschen. So<br />
kam z.B. Peter Hermann, der als Pierre Hermann in Frankreich als Nationalcoach tätig war und mit<br />
Hofmann zweimal Mannschafts-Europameister für Deutschland geworden war, Anfang der siebziger<br />
Jahre nach Köln, um seine Überlegungen zu einer modernen Methodik für Wettkämpfer zu<br />
diskutieren. Später brachte er diese Gedanken zunächst in Frankreich, dann auch in Deutschland in<br />
Buchform 34 heraus.<br />
Hofmann hatte sich mit einer kleinen Gruppe von engagierten jungen Studenten der Sporthochschule<br />
zusammen getan. Diese diskutierte sehr intensiv, wie man besseren Judounterricht machen könnte.<br />
Hofmann, Kessler, Klocke und Bonfranchi fassten ihre Überlegungen in den beiden Büchern „Judo für<br />
die Jugend“ (Bd. I 1976, Bd. 2 1977) zusammen, die ohne die wegweisenden Gedanken von Anton<br />
Geesink, Peter Herrmann, Mahito Ohgo und auch Geoff Gleeson nicht denkbar gewesen wären.<br />
Der Judounterricht am Ende der sechziger Jahre war „japanisch“ geprägt<br />
Fast alle Überlegungen setzten sich kritisch mit dem Judounterricht auseinander, der bis dato üblich<br />
war: ein halbes Jahr Fallen lernen, dann kamen die ersten Würfe und zwar so, wie sie in der Go-kyo -<br />
oder bei Kawaishi - standen. Jeder Wurf wurde mit dem „Standardgriff“ oder Universalgriff gelehrt:<br />
Rechtsgriff mit der linken Hand unterhalb des Ellbogens, mit der rechten Hand am Kragen, kurz<br />
unterhalb des Schlüsselbeins. Uke fasst genauso.<br />
Die Würfe wurden zumeist bei einem stehenden Uke geübt, mit den Phasen Kuzushi, Tsukuri, Kake,<br />
soweit man diese verstanden hatte. Zunächst wurden die Techniken häufig nur im Uchi-komi geübt,<br />
weil das Abwerfen risikoreich sein konnte.<br />
Nur sehr, sehr wenige hielten diesen Unterrichtsstil lange durch. Manch ein Leser wird sich bei dieser<br />
verkürzten, nicht allen gerecht werdenden Beschreibung vielleicht an seine ersten Judostunden<br />
(-wochen? -monate? -jahre?) erinnern. Diese Art Unterricht war bis weit in die siebziger Jahre hinein<br />
allgemein üblich und bei sehr vielen Judoka auch als die einzig richtige Art anerkannt („So war es<br />
immer schon!“). Manchmal ist es auch heute noch so.<br />
Was war nun neu am Neuen?<br />
Gegen diese Art Unterricht richtete sich die Kritik bzw. richteten sich die methodischen und<br />
systematischen Überlegungen der „Andersdenkenden“. Man kann ihre „neuen“ Überlegungen – die<br />
nicht jeder von ihnen vollständig hatte, aber zu denen jeder von ihnen beitrug – wie folgt<br />
zusammenfassen:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Werfen von Anfang an: Von der ersten Stunde an sollten die Judoka Judotechniken ,d.h. auch<br />
Judowürfe lernen.<br />
Werfen und Fallen bilden eine Einheit: Daher sollten Fallübungen bzw. Fallen nur soweit<br />
unterrichtet werden, wie es für das verletzungsfreie und angstfreie Ausführen des ersten Wurfes<br />
notwendig war.<br />
Techniken und Anwendungssituationen gehören zusammen: Die Judotechniken sollten<br />
möglichst schnell so gelernt werden, wie man sie im freien Üben anwenden kann, also aus der<br />
Bewegung und in Situationen, die für ihre Anwendung sinnvoll waren.<br />
Gegenseitige Verantwortung als pädagogische Leitidee: Die wechselseitige Verantwortung<br />
von Tori für Uke im Hinblick auf verletzungs- und angstfreies Üben wurde verstärkt heraus-gestellt<br />
und die von Uke für Tori im Hinblick auf erleichtertes und sinnvolles Üben langsam stärker<br />
methodisch entwickelt.<br />
Systematisierung nach Bewegungsverwandtschaften: Die Techniken wurden nicht mehr in<br />
der Reihenfolge der Go-kyo gelehrt, sondern man bemühte sich Bewegungsverwandtschaften für<br />
einen möglichst schnellen Lernfortschritt zu nutzen. Dabei wurde der Begriff der „Verwandtschaft“<br />
34<br />
Pierre Hermann: „Neue Lehrmethoden der Judo-Praxis“, Niedernhausen 1977 auf deutsch<br />
47